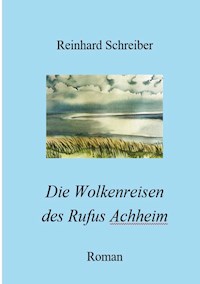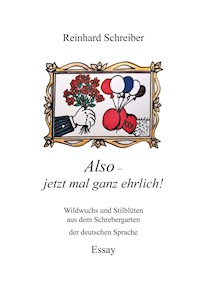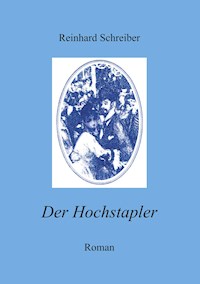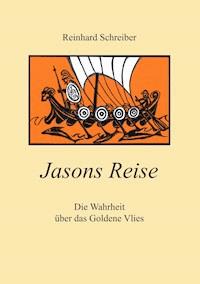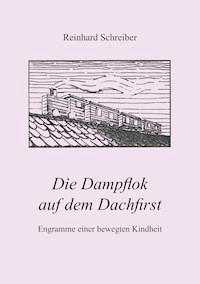
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Engramme einer bewegten Kindheit rufen Erinnerungen an Episoden wach, die belegen, dass junge Kinder trotz der bedrohlichen Umstände und einschneidenden Entbehrungen der letzten Kriegsjahre die nachfolgende Zeit durchaus als beglückende Kindheit erleben konnten. Das Attribut bewegt ist hier nicht nur im emotionalen Sinne zu verstehen, sondern bezieht sich auch ganz vordergründig auf die häufigen Orts- und noch häufigeren Wohnungswechsel in den Nachkriegsjahren, die den Weg einer Familie von Prag, der Stadt an der Moldau, über Moosburg an der Isar nach Speyer am Rhein geprägt haben. Die beschriebenen Erinnerungsbilder lassen diese frühen Kinderjahre in einem wesentlich günstigeren Licht erscheinen als die Mitteilungen in vielen Dokumentationen, die als erschütternde Zeugnisse dieser Zeit vorrangig tragische Einzelschicksale mit ihren traumatischen Begleiterscheinungen und deren Folgen zum Thema haben. Die Einschränkungen der Nachkriegszeit konnten bei Kindern dieser Generation aber auch bewirken, dass sich deren Freude über ganz einfache Dinge des Lebens und die Tiefe ihrer Erlebnisse bis hin zum gefühlten Wunder steigern konnten - und dies auf eine Art und Weise, die ihre eigenen Nachkommen, die unter friedlicheren Bedingungen aufwachsen durften, kaum nachempfinden können. Nicht zuletzt sollen die Aufzeichnungen der Erinnerungsbilder ein Dank sein für das unschätzbare Glück, diese schwierigen Zeiten nicht nur unbeschadet überstanden, sondern auch den Wert der Bescheidenheit kennengelernt und für das weitere Leben verinnerlicht zu haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Erinnerung an meine Eltern
und zum Dank an meine Geschwister
Ich mache Rast am Strom des Lebens,
der zu den Meeren des Vergessens zieht.
Flussaufwärts will ich wandern zu den Quellen,
die der Erinn'rung raunen stilles Lied.
Epigramm (anonym, 18./19. Jh.)
Inhalt
Wie mit scharfen Tinten
Die Wurzeln meiner Familie
Prag, die
Goldene Stadt
1944
Das Haus am Rebhügel
Die Dampflok auf dem Dachfirst
Sommerschlösschen und Kohlenklau
Die Münze unter der Trambahn
Runde Felsen, grauer Turm
1945
Gasmaske und Stanniolpapier
Nachts auf dem Holzvergaser
Über Saaz nach Ebnath
Das Mietshaus am Stadtberg
Strohsäcke im Lager
Tanz im Krautfass
Der Landser mit der Suppenschüssel
Die Ringe im Fellsack und ein
Husarenstück
Mit Pfeil und Bogen am Mühlbach
Am Rand des Bombentrichters
Moosburg, die
Neue Heimat
Herbergssuche und Blaumilch
Die Heigl-Mutter
Der Schokoladenmann
Hamsterfahrten und Gugelhupf
Zigarettenmarken und Silberring
Orangen in der Milchkanne
1946
Hexen im Stall und im Albtraum
Onkels, Tanten und Patronen
Tabakduft in der Scheune
Das
Stalag
und der
Ami im Busch
Hochsommer und
Rosinenbomber
Wunderpakete aus Amerika
Die Krönner-Kathi
Die Häring-Eltern
Sommer auf dem Lande
Froschkönig und Hühnerstall
Schallendes Gelächter im Gemüsegarten
Butterbrot und Gänsebraten
Zeit haben – ein Exkurs
Ein Mann steht vor der Tür
Die Hexe im Kindergarten
Gramola
und Nikolaus
Advent mit
Waatschn
Das Christkind im Schlüsselloch
1947
Glatteis
Der Unfall des Osterhasen
Lieserls Ankunft
Der
Wastl
und der Metzgerhund
Mit dem Vater im Holz
Cartemm!
Die Schule auf dem Tafelberg
Der süße Brei
Riesen in der Stadt
Hauchbildchen und Tannengrün
1948
Die Huber-Villa
Das schwarze Klavier
Der Geruch von Bleistift und Ölfarbe
Übermalungen
Währungsreform und Herrenrad
Das Freibad in der
Bonau
1949
Im Ländgässchen
Piraten am Mühlbach
Radrennen am Tafelberg
Vanille-Eis und Dampferfahrt
Der Radfahrer auf der Brücke
Eierverkäufer und Fledermausjäger
Die Limousinen am Königsplatz
1950
Fasching mit Knallkorken
Wer soll das bezahlen…
Die silbernen Dosen
Speyer, die
Kaiserstadt am Rhein
Einzug ins Staatsarchiv
Die Schule in der Himmelsgasse
Der
Persching
Der fünfte im Bunde
1951
Königlich-Bayerisches Gymnasium
1954
Abschied im Herbst
1955
Ein Wunder nach Maß
1956
Der Garten meiner Mutter
Nachgedanken zum Glück
Mein besonderer Dank gilt Herrn Alexander Gregorius für die freundliche Unterstützung bei der Lösung der EDV-technischen Probleme, die mit der Herstellung des Buchs verbunden waren.
R.S.
Wie mit scharfen Tinten
Vor vielen Jahren las ich in einer Münchner Regionalzeitung unter der Rubrik Wandertipps für die bayrischen Alpen eine Formulierung, die mir seither nicht mehr aus dem Kopf ging: Wie mit scharfen Tinten ins Firmament geätzt, erhebt sich vor der fernen Gebirgskette die Benediktenwand.
Die ersten Worte dieser feierlichen Beschreibung haben sich mir, warum auch immer, tief ins Gedächtnis eingegraben – vielleicht, weil sie meine Vorstellung von einem Engramm in treffender Weise wiedergeben. Laut Fremdwörterbuch sind Engramme Fragmente von Episoden, die als Gedächtnisspur geistiger Eindrücke im Gehirn eingespeichert sind.
Was mich am meisten an diesen fasziniert, ist die gesetzmäßig wiederholbare Abrufbarkeit von immer gleichen, gestochen scharfen Bildern vor dem inneren Auge bei Nennung eines Schlüsselworts, aber auch bei anderen sensorischen Wahrnehmungen wie der eines Bildes oder einer Landschaft, eines Geruchs, eines Geschmacks, einer Tastempfindung, eines Klangs oder einer Tonfolge. Aber das geht vermutlich manch einem Anderen ganz ähnlich – je nach Ausprägung seiner visuellen Veranlagung und je nach den emotionalen Begleitumständen, unter denen Erinnerungsbilder abgespeichert werden.
So finde ich meine eigenen und eigentümlichen Engramme wie mit scharfen Tinten ins Gedächtnis geätzt – die ältesten von ihnen wie Schwarz-Weiß-Bilder, die aber als solche im einzigen Fotoalbum, das ich aus dieser Zeit besitze, überhaupt nicht vorkommen und die mit zunehmenden Lebensjahren allmählich an Bewegung und Farbe gewinnen.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich lange darüber nachgedacht habe, ob die Kindheitserinnerungen, die ich selbst als aufregend oder merkwürdig empfunden und gespeichert habe, für jemanden, der mich nicht persönlich kennt, überhaupt von Belang sind.
Die Motivation, sie publik zu machen, ergab sich aus einer zufälligen Beobachtung: Seit Beginn der Neunziger Jahre hatte ich – zunächst aus purer Neugier – immer wieder Kinder und deren Eltern, mit denen ich beruflich zu tun hatte, nach dem ersten Erlebnis gefragt, an das sie sich erinnern können. Dabei ergab sich ein erstaunlich weites Spektrum der beginnenden Erinnerungsfähigkeit: Selten wurde das dritte Lebensjahr angegeben, am häufigsten das vierte und fünfte, in einigen Fällen zu meiner Verblüffung aber auch das sechste bis hin zum achten Lebensjahr. Warum die letztgenannten Spätzünder unfassbarer Weise sich nicht an Bilder aus ihrer frühen Kindheit erinnern konnten, ließ sich auch durch eingehende Nachfragen nicht klären.
Dieses Phänomen einer Kindheit mit leeren Speichern war für mich der Imperativ dafür, meine eigenen frühen Kindheitserinnerungen zunächst für mich selbst aufzuzeichnen, und beeinflusste später meinen Entschluss, sie als Episoden mit Pointe auch Anderen zugänglich zu machen. Ich habe sie zum einen als Dank an meine Eltern und Geschwister niedergeschrieben, aber auch zur Erinnerung an viele Menschen, die uns begegnet sind und von denen uns einige in mancher Notlage geholfen haben. Zur Entscheidung, meine Erinnerungsbilder festzuhalten, mag letztlich auch die Befürchtung beigetragen haben, ihre Konturen könnten sich im Laufe der Zeit unwiederbringlich in Nacht und Nebel auflösen.
Es möchte sein, dass sich mancher Zeitzeuge der frühen Nachkriegsjahre, aber auch ein passionierter jüngerer Leser in einem der festgehaltenen Erlebnisse zufällig selbst wiederfindet – und vielleicht wird ihn der Gedanke daran zum Schmunzeln bringen.
Die Wurzeln meiner Familie
Meine Mutter Maria stammte aus Mähren und hatte durchwegs bäuerliche Vorfahren, deren Ahnenreihe sich unter dem Namen Klug urkundlich bis ins siebzehnte Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Sie hatte sechs Geschwister und wuchs auf einem stattlichen Bauernhof in Rattendorf in der Nähe der Stadt Mährisch-Trübau auf, wo sie auch zur Schule ging. Da sie als Hoferbin nicht in Betracht kam, durfte sie in Prag studieren, um Lehrerin zu werden und Sprachen zu erlernen.
Mein Vater Rudolf kam aus Böhmen und entstammte einer bürgerlichen Familie aus Neudek im Erzgebirge, wo mein Großvater als Prokurist in einer Wollfabrik angestellt war – eine Funktion, deren klangvoller Name mich schon als Kind äußerst beeindruckte, obwohl ich gar nicht wusste, was er eigentlich bedeutete. Nach der Schulzeit in Karlsbad ging mein Vater zum Studium der Geschichte an die Universität Prag, wo er sich als Historiker habilitierte und den Lehrstuhl für Böhmische Landesgeschichte übertragen bekam. Prag, die vielgestaltige Stadt – so der Titel seines später erschienenen Buches – war auch der Ort, wo sich meine Eltern kennenlernten und kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs heirateten.
Drei von ihren fünf Kindern kamen dort zur Welt: ein Jahr vor mir meine Schwester Johanna und zwei Jahre nach mir meine Schwester Helga. Nach der Evakuierung bei Kriegsende von Böhmen nach Bayern und der Heimkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft wurde in Moosburg/Oberbayern meine um sechs Jahre jüngere Schwester Elisabeth geboren, und später in Speyer/Pfalz mein um neun Jahre jüngerer Bruder Roland.
Kurz zuvor war mein Vater dorthin als Leiter des Staatsarchivs berufen worden. Acht Jahre nach Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft verstarb er mit siebenundvierzig Jahren an einem kriegsbedingten Leberleiden. Seine kurz zuvor erfolgte Berufung auf den Lehrstuhl für Landesgeschichte an der Universität Mainz konnte er nicht mehr antreten.
Trotz äußerst knapper Mittel gelang es unserer Mutter – sie war damals siebenunddreißig Jahre alt –, für unsere Familie ein Haus zu bauen und jedem von uns ein Studium zu ermöglichen. Wir alle ergriffen Berufe am Menschen: meine drei Schwestern wurden Lehrerinnen, mein Bruder und ich Ärzte.
Von unserem Vater haben wir Geschwister vermutlich das systematische Denken des Historikers geerbt, von unserer Mutter das Interesse an guter Küche, an fremden Sprachen und an Gartengestaltung – sofern die Anlagen zu solchen Fähigkeiten überhaupt vererbbar sind.
Prag, die Goldene Stadt
Sommer 1941 – Frühjahr 1945
Am 21. August 1941 wurde ich in Prag geboren – und zwar, wie meine Mutter mir später erzählte, ganz unspektakulär an einem Donnerstagvormittag gegen elf Uhr. Mein Sternkreiszeichen war der Löwe, dessen angebliche Dominanz zwar nicht meinem späteren Lebensgefühl entsprach, mir aber – mit fortschreitendem Lebensalter – zunehmend nachgesagt wurde.
Die Überprüfung dieser These in einschlägigen astrologischen Publikationen ergab, dass diese unsympathische Eigenschaft nicht allein diesem, sondern ebenso einigen weiteren Sternkreiszeichen zugesprochen wird – ganz abgesehen von der entscheidenden Bedeutung des individuellen Aszendenten, um den ich mich aber nie gekümmert habe.
Mit den folgenden Aufzeichnungen will ich meine Erinnerungsbilder in chronologischer Abfolge festhalten, wie ich sie im Laufe meiner Kindheit an wechselnden Orten in mir aufgenommen und gespeichert habe. Meinen Geschwistern ebenso wie meinen Freunden und langjährigen Wegbegleitern möchte ich damit die Möglichkeit geben, all die Episoden, die meine frühen Kinderjahre geprägt und vermutlich auch Einfluss auf Entscheidungen während meines späteren Lebenswegs genommen haben, als Mosaiksteine meiner Identität kennenzulernen.
1944
Das Haus am Rebhügel
Für die beiden ersten Lebensjahre ist meine Erinnerung leer. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man sich vorstellt, dass die Hirnspeicher in dieser Zeit erst einmal trainiert werden müssen, um Erinnerungsbilder aufnehmen zu können, sodass diese später – nach Entwicklung des Langzeitgedächtnisses – immer wieder unverändert abgerufen werden können.
Dieser Freisetzungsprozess muss bei mir zwischen zweieinhalb und drei Jahren in Gang gekommen sein. Meine frühesten Engramme betreffen unsere Wohnung am Rebhügel im Stadtteil Dewitz, dessen Räume ich viele Jahre später noch genau skizzieren konnte, sowie den dazugehörigen Sandkasten unterhalb des Küchenbalkons, von dem aus die Mutter zu uns herunterrief, es gebe jetzt gleich Knopfis. Dabei handelte es sich um bunt dragierte Schokoladenlinsen, wie es sie heute noch gibt, die in einer weißen Porzellandose mit Goldranddeckel in einem dunkel polierten Vitrinenschrank aufbewahrt wurden. Dass sie nur als Einzelstücke ausgegeben wurden, nahmen meine Schwester Johanna und ich klaglos hin.
Ein weiteres Engramm aus dieser Zeit ist ein Paket mit glänzend-braunen Esskastanien, das uns der Vater aus der Pfalz geschickt hatte, wo er gerade mit einem Funktrupp im Kriegseinsatz war. Die Mutter verwandelte sie in wunderbare Maronenkugeln, die sie in Kristallzucker wälzte, sodass sie wie Raureif glitzerten. Wenn mir heute Maronen in jeglicher Zubereitungsart begegnen oder ich auch nur ihren Duft wahrnehme, sehe ich dieses wunderbare Paket und die fertigen Köstlichkeiten wieder vor mir.
Als ich acht Jahre später bei einer Herbstwanderung durch die Pfalz mit meinem Vater nach Wachenheim an der Weinstraße kam, zeigte er mir dort ein Haus mit der Aufschrift Bäckerei Felix, wo er im Krieg vorübergehend einquartiert gewesen war. Von dort aus hatte er die Pfälzer Maronen nach Prag geschickt – und hier schloss sich für mich ein Kreis, der mit einem wunderbaren sensorischen Engramm begonnen hatte.
Die Dampflok auf dem Dachfirst
Eines der frühesten und das für mich nachhaltigste meiner Engramme, welches ich beim Stichwort Prag als allererstes assoziiere, ist ein hohes Gebäude ganz in der Nähe unserer Wohnung, an dem unsere Spaziergänge öfters vorüberführten. Oben auf dem Dachfirst nahm ich eine ganze Reihe von kastenförmigen Aufsätzen mit viereckigen Fenstern wahr, über die bisweilen eine dünne weiße Rauchfahne hinwegstrich. Dieser faszinierende Anblick hat sich mir mit fotografischer Schärfe als dampfender Eisenbahnzug eingeprägt und sich mir beim Stichwort Prag immer wieder in Erinnerung gebracht.
Als ich fünf Jahrzehnte später mit meiner Familie meine Heimatstadt besuchte und ihr stolz dieses unglaubliche Wunderwerk präsentieren wollte, musste ich feststellen, dass es sich bei dem Gebäude um ein Schulhaus handelte, welches noch immer als solches genutzt wurde und dessen einzeln beheizbare Räume jeweils einen eigenen Kamin hatten. Die Serie der Schornsteine am Dachfirst, die an den Seiten fensterartig durchbrochen waren, hatte bei mir ein Erinnerungsbild hinterlassen, das ich nun Jahrzehnte später revidieren musste.
Immerhin stieg an diesem Tag wenigstens ein zartes Rauchwölkchen aus einem der vorderen Kamine auf, der vermeintlichen Lokomotive. Ich empfand dies als ein versöhnliches Zeichen zum Trost für die ernüchternde Enttarnung eines trügerischen Wunschbilds, das trotz seiner Entzauberung als Engramm jedoch nie verschwunden und bis heute unverändert abrufbar geblieben ist.
Sommerschlösschen und Kohlenklau
Auf unseren Spaziergängen waren wir bisweilen am Haus mit der Dampflok nach rechts abgebogen und zu einem kleinen Schlösschen gelangt, an dessen tempelartiger weißer Frontseite schlanke Säulen ein flaches Giebeldreieck trugen. Das weiß-goldene Leuchten in der Sonne unter einem strahlend-blauen Himmel hat in mir ein Bild von märchenhaftem Reichtum hinterlassen, das bei mir tiefe Ehrfurcht auslöste. Als besonders geheimnisvoll empfand ich, dass dort nie irgendein Mensch und auch nie ein offenes Portal zu sehen waren – alles wirkte auf mich wie verwunschen.
Bei einem späteren Besuch in Prag folgte ich dem Weg meiner Erinnerung und konnte der Familie tatsächlich zeigen, dass dieses Sommerschlösschen weder meiner Fantasie noch irgendeinem Bilderbuch entsprungen war. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, dies sei das Hanspaulka-Schlösschen, dessen Baustil ich heute wohl als klassizistisch einschätzen würde. Auch wenn es ziemlich vernachlässigt wirkte – es leuchtete wie früher vor einem tiefblauen Spätsommerhimmel. Als ich es zwanzig Jahre später nochmals aufsuchte, war es in wundervoller Weise restauriert und von einer herrschaftlichen Mauer umgeben, die seine einstige Unnahbarkeit endgültig besiegelte.
Von anderen Spaziergängen in entgegengesetzter Richtung hat sich bei mir das Bild einer kleinen freistehenden Rundkapelle auf einer leicht abfallenden Wiese eingeprägt, die im Schatten hoher dunkler Bäume lag. Die Türe war stets verschlossen und die eisernen Schlagläden an den Rundbogenfenstern erlaubten keinen Blick ins Innere. An ebendiesem Hang entstand auch mein Engramm von einer Rodelpartie im ersten Schnee, die meine Mutter mit Johanna und mir unternommen hatte.
Obwohl das Kirchlein in meinem Namensgedächtnis zwar fälschlich, aber durchaus freundlich als Nikolaus-Kapelle abgespeichert war, erzeugte ihr Erinnerungsbild bei mir immer ein beklemmendes Gefühl – wohl auch deshalb, weil meine Mutter uns einmal zugeflüstert hatte, man könne dort nicht spielen, weil da der Kohlenklau umgehe. Ich wusste damals zwar nicht, was es mit dieser Schreckensgestalt auf sich hatte, registrierte sie aber intuitiv als bedrohlich. Erst viel später, als ich im Zuge erzieherischer Maßnahmen vor dem Schwarzen Mann gewarnt wurde, ahnte ich einen Zusammenhang mit jenem Unhold, der zu Kriegszeiten in schamloser Weise nicht nur Kinder erschreckt, sondern sogar Kohlen geklaut haben soll.
Auch diesen unheimlichen Ort konnte ich stolz meiner Familie zeigen – er hatte in fünf Jahrzehnten nichts von seiner mystischen Aura eingebüßt.
Die Münze unter der Trambahn
Ein etwas längerer Spaziergang führte den Rebhügel abwärts auf einem Fußweg, von dem man einen wunderbaren Rundblick auf die im hellen Dunstschleier liegende Goldene Stadt hatte. Von dort gelangte man über hölzerne Treppenstufen hinunter zur Haltestelle der Trambahn.
Ich erinnere mich an einen netten, zu allerlei Späßen aufgelegten Herrn, der wohl ein Freund der Familie war und uns mit der Mutter dorthin begleitete. Um das Warten auf die Straßenbahn kurzweilig zu gestalten, zog er eine Münze aus der Geldbörse und legte sie zu unserer Verwunderung auf die Schiene. Nachdem die Trambahn herangerattert und kreischend zum Stillstand gekommen war, zog er hinter einem der Räder ein großes, rundliches Metallplättchen heraus, das in der Sonne silbrig blitzte.
Für mich war dies ein unfassbares Wunder, an dessen Zauber ich heute jedes Mal mit großem Respekt zurückdenken muss, wenn ich ein Schienenfahrzeug herandonnern höre.
Runde Felsen, grauer Turm
Dieses Engramm gehört zu Neudek im Erzgebirge, dem Heimatort meines Vaters. Es war wohl bei einem Besuch im Hause der Großeltern, als ich den Straßenzug davor als Erinnerungsbild in mir aufnahm: ein schmales zweistöckiges Stadthaus, eingezwängt in eine farblose Häuserzeile und überragt von einem grauen, rundlich abgeschliffenen Felsen, der von einem kantigen Turm gekrönt war.
Vermutlich war es spät im Herbst gewesen, denn der Himmel war bleigrau bedeckt und der dunkle Felsen erschien dadurch fast bedrohlich. Für mich wirkte er wie ein Stapel von rundlichen Käselaiben, den Riesen aufgeschichtet hatten. Der klotzige Turm auf der Spitze ließ nicht erkennen, ob er früher als Burg-, Glocken- oder Wachturm genutzt worden war, aber ich hatte wohl schon irgendetwas von Rittern und Riesen gehört, die ich mir in dieses trotzige Bauwerk hineindachte..
Allein dieses Leitbild vor Augen, fand ich auf unserer späteren Reise über Karlsbad nach Prag das Elternhaus meines Vaters wieder. Dabei konnte ich meiner Familie im Hinterhof auch die beweisenden