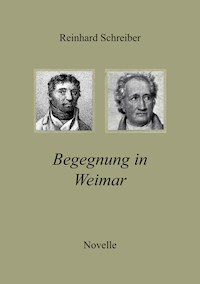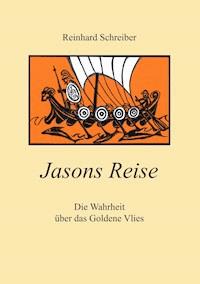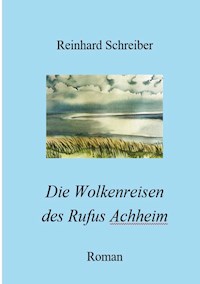
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
An einem neblig-trüben Novembermorgen begibt sich der Arzt Doktor Rufus Achheim frühmorgens in seine Klinik. Er hat an diesem Samstag zwar keinen Notrufdienst, möchte aber noch ein paar liegengebliebene Schreibarbeiten erledigen. Auf dem Heimweg entdeckt er am Straßenrand sein völlig demo-liertes Fahrrad, mit dem er am Vorabend nach Hause gefahren ist. Er beschließt, es am Nachmittag mit dem Wagen zu holen, unternimmt aber stattdessen einen Waldspaziergang zu einem nahegelegenen Weiler, wo er auf dem kleinen Kirchhof einer jungen Frau begegnet. Sie spricht ihn an und er erfährt von ihr, wie er sich seinen lebenslangen Wunschtraum erfüllen könne, mit den Wolken zu reisen. Er folgt ihren Hinweisen und trifft dabei auf Protagonisten aus Geschichten, die er früher einmal gelesen oder von denen er gehört hat. Deren Biographien haben alle eine Gemeinsamkeit - nämlich, dass ihnen eine ersehnte Aussprache oder eine letzte Begegnung mit bestimmten Menschen zeitlebens versagt geblieben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Nebeltag
Begegnung in Rieden
Beim Burgturm von Akrokorinth
Am Felsenkegel von Matiana
Auf dem Gipfel der Schneekoppe
Bei der Kirche auf dem Wyschehrad
Am Turm auf der Rottmannshöhe
Das Treffen in Rieden
Anhang
Mein besonderer Dank gilt Herrn Marc Heinzmann für die freundliche Unterstützung bei der Lösung von EDV-technischen Problemen, die mit der Herstellung dieses Buchs verbunden waren. R.S.
Nebeltag
Doktor Rufus Achheim lebte seit Jahren in einer kleinen Kreisstadt, die am nördlichen Ende eines der bayrischen Seen lag und am Westufer von einem Schloss überragt wurde. An dieser Stelle hatte der Überlieferung nach im Mittelalter ein Ritter namens Hans von Starenberg eine erste Burganlage errichtet. Später residierten dort lange Zeit Kurfürsten in einem klassizistischen Residenzbau, der in der Neuzeit – gleichsam in historischer Konsequenz – zum Amtssitz der Finanzbehörde umgewidmet wurde. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Geldadel aus der nahen Landeshauptstadt an den Ost- und Westufern am Fuße bewaldeter Hügel stattliche Villen erbauen lassen, die der Gegend nachhaltig das Siegel der Wohlhabenheit aufgedrückt hatten. Vom Gebirgspanorama über der südlichen Seeregion und den pittoresken Wolkenbildern am duftig-blauen Himmel waren früher immer wieder namhafte Maler und Literaten angelockt worden. Der ländliche Charme des vormaligen Fischerdorfs war allerdings gegen Ende des 19. Jahrhunderts endgültig gewichen, als man mit der Einführung technischer Neuerungen wie der Dampfschifffahrt und der Eisenbahn begonnen hatte, Raum und Zeit schrumpfen zu lassen und für sprudelnden Fremdenverkehr zu sorgen.
Rufus hatte kein Problem im Umgang mit dem schwallartigen Tourismus an Wochenenden und Feiertagen, da er es vermied, zu solchen Zeiten die belebte Seepromenade und die wimmelnden Badestrände am Ost- und Westufer aufzusuchen. Das fiel ihm selbst bei schönstem Wetter nicht schwer, da er als Alternative an solchen Tagen meistens genug damit zu tun hatte, in der Kreisklinik Kinder mit Schrammen, Wespenstichen, Kopf- und Bauchschmerzen, Schädelprellungen, Knochenbrüchen, Sonnenstich, Gehirnerschütterung oder hohem Fieber ärztlich zu versorgen.
Es war an einem grauen Samstag Anfang November, als er sehr früh am Morgen wach wurde. Beim Blick aus dem Fenster zum Garten hin waren die Kronen der alten Buchen in dichten Nebel gehüllt, und auch der kleine Gartenteich, auf den jeden Morgen sein erster Blick fiel, war im Nichts verschwunden. Er war allein im Haus, weil seine Frau Julia übers Wochenende zu einem Bridge-Turnier in ein nahe gelegenes Kurstädtchen gereist war, das seit dem 19. Jahrhundert dank der Lehren seines heilkundigen Ortspfarrers namens Kneipp über die segensreichen Kräfte der Natur anhaltende Berühmtheit erlangt hatte. Die Kinder waren längst außer Hauses und kamen allenfalls im Sommer vorbei, wenn das Badewetter sie an den See lockte.
Am Vorabend war Rufus ziemlich spät nach Hause gekommen, da er noch Arztberichte durchgesehen und einigen Schreibkram erledigt hatte, der unter der Woche liegengeblieben war. Obwohl er an diesem Tag keinen Notrufdienst hatte, beschloss er, sich noch den Rest dieser Arbeiten ungestört vorzunehmen. Wegen des außergewöhnlich dichten Nebels und der ohnehin nur kurzen Wegstrecke zur Klinik verzichtete er auf den Wagen und machte sich zu Fuß auf den Weg. Die Sicht war so schlecht, dass er nur langsam vorankam und sich an manchen Stellen an den Zäunen entlanghangeln musste. Es war sehr still, da der Nebel jeden Laut schluckte, und kaum verwunderlich, dass bei solch unfreundlichem Wetter weit und breit kein Mensch zu sehen war.
Als er endlich den Übergang an der Hauptstraße erreicht hatte, zeigte die Fußgängerampel Rot. Während er wartete, hörte er, wie ein leises Motorengeräusch näherkam. Ein Wagen mit blassen Nebelleuchten rollte langsam heran und hielt am Übergang, weil auch für ihn soeben das rote Signal aufgeleuchtet hatte. In den wenigen Augenblicken des gemeinsamen Wartens nahm Rufus wahr, dass es sich um einen schwarzen Pallas handelte, eine Limousine der Marke Citroën. Dieser futuristisch gestylte Oldtimer war, seit er ihn als Vierzehnjähriger zum ersten Mal gesehen hatte, zu seinem Traumauto geworden und es auch geblieben.
Seltsamerweise war die Innenbeleuchtung des Wagens eingeschaltet, sodass er trotz des Nebels für einen kurzen Augenblick das Gesicht des Fahrers erkennen konnte. Es wirkte im schwachen Licht fahl, und die dunkle Augenpartie war überschattet von einem Borsalino, unter dessen breiter Krempe schütter-graue Haarsträhnen herabfielen. Die Gesichtszüge erinnerten Rufus blitzartig an die von Michel Piccoli, einem französischen Schauspieler der Nouvelle Vague, dessen Filme ihn in seiner Jugend fasziniert hatten. Nach kurzem Warten gab das grüne Signal den Fußgängerübergang frei, und als Rufus die Gegenseite erreicht hatte und zurückblickte, sah er nur noch, wie das dunkle Gefährt langsam anrollte und seine Rückleuchten im Nebel verschwanden. Diese überraschende Begegnung hatte ihn aus unerfindlichen Gründen seltsam berührt und beschäftigte ihn beim Weitergehen, ohne dass er dafür eine plausible Erklärung finden konnte.
Noch tief in Gedanken erreichte er nach wenigen Minuten die Klinik und betrat durch die gläserne Drehtür das Foyer. Der Pförtner saß, verborgen hinter einer Zeitung, in der Loge und hatte neben sich eine leere Bierflasche stehen. Er bemerkte Rufus überhaupt nicht, sodass dieser, um ihn nicht zu stören, mit einem stummen Nicken unbemerkt an ihm vorbeigehen konnte. Er begab sich geradewegs zu seinem Dienstzimmer, dessen Tür nicht verschlossen war – die Putzfrau musste wohl schon in aller Frühe dagewesen sein.
Auf dem Schreibtisch türmten sich die Unterschriftsmappen, die er am Vorabend noch erledigt hatte. Er trug sie zur Ablage ins Sekretariat hinüber und machte sich an die Durchsicht der verbliebenen Ordner. Nach gut eineinhalb Stunden konnte er erleichtert den letzten Aktendeckel zuklappen und entschloss sich, da er keinen Zeitdruck hatte, zu einem kurzen Gang über seine Klinikabteilung.
Der breite zentrale Flur, auf den die Patientenzimmer mündeten, war leer und lag im Dämmerlicht, da man offenbar die schwache Nachtbeleuchtung noch belassen hatte. Das hing vermutlich damit zusammen, dass wegen des düsteren, trüben Wetters sowohl die kleinen Patienten in ihren Gitterbettchen als auch deren Begleitmütter auf ihren Klappliegen noch friedlich schliefen. Beim Blick durch die verglasten Türen fand Rufus diese Annahme bestätigt und durfte davon ausgehen, dass es momentan allen gut ging. Als er am Raum vorüberkam, in dem die Kinderschwestern gerade bei einer Tasse Kaffee mit der Dienstübergabe beschäftigt waren, hörte er durch den offenen Türspalt murmelnde Gespräche und ab und zu gedämpftes Lachen. Er wollte dabei nicht stören und machte sich wieder auf den Weg zum Ausgang, ohne dabei irgendjemandem zu begegnen.
Der Pförtner saß unverändert hinter seiner Zeitung und nahm ihn auch jetzt nicht zur Kenntnis, obwohl er ihn sonst immer mit einem jovialen „Grüß Gott, Herr Doktor!“ zu grüßen pflegte. Draußen hatte der Nebel kaum nachgelassen, sodass Rufus sich auch jetzt wieder vorsichtig vorantasten musste. Nach Überqueren der Hauptstraße wechselte er für den Heimweg die Straßenseite, da ihm die Orientierung dort leichter erschien.
Nach ein paar Schritten stand er plötzlich vor einem Fahrrad, das am Zaun lehnte und ziemlich demoliert wirkte. Beim näheren Hinsehen entdeckte er völlig überrascht anhand eines Aufklebers, dass es zweifellos sein eigenes war, mit dem er gestern Abend nach Hause gefahren war. Das Vorderrad war zu einem Achter verbogen, der Lenker verdreht und das Tretlager durchgebrochen. Wie es hierher kam, war ihm ein Rätsel, und er spielte kurz mit dem Gedanken, es könnte nachts entwendet worden sein, da er es meist nur unter dem Vordach neben der Haustür abstellte und bisweilen vergaß, es abzusperren. Weil es in diesem Zustand überhaupt nicht fortzubewegen war, nahm er sich vor, die traurigen Überreste später mit dem Wagen abzuholen, und setzte seinen Heimweg fort.
Zuhause nahm er die Morgenzeitung aus dem Briefkasten und blätterte sie bei einer Tasse Tee durch, ohne viel zu entdecken, was er nicht schon am Vortag aus den Radionachrichten erfahren hatte. Das anhaltend trübe Wetter bewirkte auch bei ihm – so wie bei seinen kleinen Patienten – ein gewisses Schlafbedürfnis. Da sein freier Tag es ihm gestattete, kam er dem – entgegen seiner sonstigen Gewohnheit – mit einem Nickerchen auf der Couch im Wohnzimmer nach.
Als er wieder erwachte, war es bereits Nachmittag. Der Nebel hatte sich gelichtet, und die Baumkronen im Garten und auch das dunkle Auge des Teichs waren wieder schwach zu erkennen. Er überlegte kurz, ob er jetzt sein ruiniertes Fahrrad abholen solle oder erst noch einen kleinen Waldspaziergang nach Rieden, einem Weiler in der Nähe, machen könne. Im Sommer war dies seit Jahren eines seiner Lieblingsziele, weil sich von dort an schönen Tagen ein herrlicher Blick auf die Bergkette über dem südlichen See bot. Daran war an einem Nebeltag wie dem heutigen zwar nicht zu denken, aber der Weg dorthin war für ihn immer schon eine willkommene Möglichkeit zu entspannter Meditation gewesen.
Begegnung in Rieden
Rufus zog seinen alten Dufflecoat und die Wanderschuhe an und stieg die Steintreppe empor, die dem Gartentor gegenüber direkt hinauf zum Waldweg führte. Er ging durch einen dichten Buchenwald, dessen Blattwerk im Gegensatz zu dem der selteneren Eichen bereits vollständig abgefallen war. Beim Blick nach oben konnte er trotz des vom Nebel verschleierten, aber hell wirkenden Himmels die Äste bis hinauf in ihre oberen Verzweigungen verfolgen. Sie erinnerten ihn an dünne Quellrinnsale, die sich auf ihrem Weg ins Tal zu kleinen Bächen vereinigten, um zu stärker werdenden Flüssen zusammenzufließen und in den Hauptstrom des mächtigen Stammes einzumünden, der schließlich im Blättermeer des Waldbodens verschwand.
Als er aus dem Wald heraustrat, wurde es lichter und er erkannte vor sich den flachen Höhenrücken, auf dessen Kamm sich die Wirtschaftsgebäude des alten Gutshofs Rieden schemenhaft in den weißen Schwaden abzeichneten. Dort hatte Ludwig III., der letzte bayrische König, Anfang des 20. Jahrhunderts als Prinzregent ein Mustergut aufgebaut und durch eine vorbildliche Milchwirtschaft zur Versorgung der Bevölkerung beigetragen. In der Neuzeit waren die umliegenden Weideflächen in ein Golfresort umgewandelt worden, ohne dass dadurch der ländliche Charme des Weilers merklich gestört wurde.
Im Näherkommen sah Rufus zunächst die Zwiebelhaube der kleinen Kirche St. Peter und Paul aus dem Nebelgrau auftauchen und daneben die Gaststätte des Golfclubs, die jetzt nach Saisonende bereits geschlossen war. Durch ein Gatter betrat er den kleinen Friedhof, der das Kirchlein umgab, und studierte beim Gang durch die Gräberreihen die Inschriften auf den alten Grabsteinen und Kreuzen, obwohl er die meisten schon von früheren Besuchen her kannte. Für ihn hatte dieser Ort eine besondere Aura, weil bei älteren Grabstellen Beruf und Heimatort der Bestatteten aufgeführt waren. Das regte ihn immer wieder zum Versuch an, sich in Gedanken ein Bild von der beigesetzten Persönlichkeit zu machen.
Hier gab es klangvolle Namen von Staatsbeamten, Bürgermeistern, Ärzten und Adligen, aber auch die von einfachen Handwerkern und Bauern, wobei letztere als Ökonom daselbst und deren Frauen als Ökonomsgattin tituliert waren. Zum Schmunzeln brachten ihn Bezeichnungen wie Privatier für jemanden, der damit zu erkennen gab, dass er auch ohne repräsentativen Beruf so viel Vermögen ererbt oder angehäuft hatte, dass er sich frühzeitig zur Ruhe hatte setzen können. Für noch mehr innere Erheiterung sorgte die Berufsangabe Jungfrau auf dem Grabstein einer Dame, die mit weit über Achtzig verstorben war.
Schließlich betrat Rufus auch den kleinen Kirchenraum, weil die Stimmung im Inneren ihm schon oft Gelegenheit zur kurzen Besinnung gegeben hatte. Er nahm in einer Bank gegenüber dem raumhohen schmiedeeisernen Gitter Platz, das den Kirchenraum vor Raub und Schaden schützen sollte, und konnte im Dämmerlicht am gotischen Altar die in Gold gefassten Figuren der beiden Kirchenpatrone erkennen. Die Mitte des Kirchenschiffs nahm ein stattlicher Sarkophag aus purpurfarbenem Marmor mit der lebensgroßen Skulptur einer schönen jungen Frau ein.
Einer Tafel neben der Eingangstür war zu entnehmen, dass es sich dabei um Prinzessin Mathilde handelte, eine der Töchter des letzten bayrischen Königs, die 1877 in Lindau am Bodensee geboren und in jungen Jahren an einem Lungenleiden verstorben war. Rufus hatte bereits früher einiges über ihre tragische Lebensgeschichte gelesen und war jedes Mal, wenn er diesen Ort der Ruhe besuchte, aufs Neue von ihrem traurigen Schicksal berührt gewesen.
Während er auch diesmal solchen Gedanken nachhing, hatte er das Gefühl, nicht allein im Raum zu sein. Er wandte sich um und entdeckte im Dunkel der hinteren Bankreihe unter der Empore eine Person, deren Gesicht von einem Schleier verhüllt war. Er nickte ihr wortlos zu und bemerkte, wie sie kurz darauf den Kirchenraum verließ. Einige Zeit später trat auch er wieder ins Freie und erblickte vor der dunklen Thujen-Gruppe gegenüber die Gestalt, die er gerade eben wahrgenommen hatte.
Es war eine Dame in einem hellen, glatt fallenden Gewand mit einem seidenen Schleier über dem schmalen Haupt, der ihr fast so etwas wie den Aspekt einer klassischen Bühnenfigur gab. Als er ihr nochmals kurz zunickte, kam sie mit leichtem Schritt – fast so, als schwebe sie – auf ihn zu und schob den Schleier vom Gesicht zurück. Rufus erblickte die ebenmäßigen Züge einer jungen Frau und hatte intuitiv das Gefühl, diese bereits irgendwo gesehen zu haben.
„Sie sind neu hier“, sprach sie ihn ohne Umschweife an. „Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich bin Prinzessin Mathilde, die jüngste Tochter von König Ludwig III. von Bayern, und war die Lieblingsenkelin meines Großvaters, des Prinzregenten Luitpold. Ich erlebte eine unbeschwerte Kindheit in Lindau am Bodensee und heiratete in jungen Jahren Prinz Ludwig von Sachsen-Coburg und Gotha. Wir hatten zwei reizende Kinder, Antonius und Maria, die uns viel Freude bereiteten.
Im Jahr 1906 machte sich bei mir eine zunehmende Mattigkeit bemerkbar, und als dann sehr hartnäckige Hustenanfälle hinzukamen, stellten die Ärzte die Diagnose einer Tuberkulose und schickten mich zur Kur in die Schweiz. Leider schlugen die in Davos üblichen Licht- und Luftkuren bei mir nicht an, sodass ich immer häufiger Sauerstoff erhalten musste. Meine seelische Verfassung wurde zwar durch die wunderbare Bergwelt zunächst aufgehellt, aber mein körperliches Befinden verschlechterte sich rapide, sodass ich dort nach kurzem Aufenthalt mit neunundzwanzig Jahren verstarb.
Dies bedeutete einen schmerzlichen Verlust für die gesamte Familie und war für meinen Vater Anlass, mich hier in diesem Kirchlein, das zum Gutshof gehörte, in dem Marmorsarkophag beisetzen zu lassen, den Sie drinnen wohl schon gesehen haben.“
Rufus hatte es bei diesem ergreifenden Lebensbericht fast die Sprache verschlagen. Er war tief berührt, und als er nach anfänglichem Schweigen seine Fassung wiedergewonnen hatte, fand er zu ersten Worten: „Wie kann es sein, dass ich Sie, nachdem Sie vor mehr als einem Jahrhundert unsere Welt verlassen haben, jetzt hier antreffe? Mein Name ist Rufus, und ich bin heute nicht das erste Mal da, weil mich die Aura dieses Ortes schon seit langer Zeit immer wieder angezogen hat.“
Sie lächelte verständnisvoll zu ihm herüber, als wolle sie ihm irgendetwas schonend beibringen.
„Rufus, Sie haben vermutlich noch nicht bemerkt, dass auch Sie die Welt der Sterblichen bereits verlassen haben und von nun an auf der anderen Seite des Lebens stehen, der die Unsterblichen angehören. Eine solche Veränderung werden Sie sich vielleicht ganz anders vorgestellt haben, aber so ist sie nun wirklich – sonst hätten Sie mich auch gar nicht wahrnehmen können“.
Jetzt fiel es Rufus wie Schuppen von den Augen. Er hatte offenbar am Vorabend auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad einen Unfall erlitten, womit alles Seltsame zu erklären war, was er heute erlebt hatte: die menschenleeren Straßen, der geheimnisvolle Fahrer im dunklen Pallas, der schweigsame Pförtner in der Klinik, der unbemerkte Gang durch die Abteilung und das demolierte Fahrrad am Straßenrand.
„Ich habe heute einige Dinge erlebt, die mir zu denken gegeben haben“, meinte er schließlich, „und ich verstehe erst jetzt, was wirklich geschehen ist. Ich muss mich über mich selbst wundern, dass ich mich durch mein jetziges Wissen eigentlich eher erleichtert fühle und über das Vorgefallene nachträglich auch keinen Schrecken empfinden kann. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich mit ruhigen Worten mit meiner neuen Befindlichkeit bekannt gemacht haben.“
„Seien Sie hier bei uns willkommen! Ich kann Ihnen gerne ein paar Ratschläge geben, die für Sie in Zukunft nützlich sein können“, bot Mathilde an. „Wenn Sie wollen, können wir dort drüben auf der Bank unter der Birke Platz nehmen – es gibt da nämlich eine ganze Menge an Dingen, die ich Ihnen mitteilen kann.“
Sie ließen sich nieder, und Rufus konnte von hier aus in der Gräberreihe an der Westmauer der Kirche die freie Grabstelle sehen, die er vor einigen Jahren im Pfarramt der Kreisstadt für sich hatte reservieren lassen. Die vorsorgliche Sicherung der Anwartschaft war zweifellos angebracht, denn er wusste, dass auf dem kleinen Friedhof solche Plätze nur selten zu vergeben waren. Vor einiger Zeit hatte man an mehreren Pfosten der Umzäunung lange Stangen mit Starenkästen angebracht, deren Bewohner im Frühjahr bei Sonnenaufgang für ein Morgenkonzert sorgen sollten – ein schöner Gedanke, der diesen stillen Ort vielleicht mit etwas Leben erfüllen würde.
Zunächst herrschte für ein paar Augenblicke Schweigen, weil beide versuchten, zunächst ihr Denken zu sortieren. Dann ergriff Mathilde, als könne sie Gedanken lesen, das Wort: „Darf ich annehmen, dass der freie Platz dort drüben, zu dem Sie gerade hinüberblicken, ihre Grabstelle ist? Eine recht schöne Lage – Sie haben gut daran getan, sich frühzeitig darum zu bemühen.
Ich werde Ihnen jetzt ein paar Hinweise zu uns Unsterblichen geben, die für jeden, der hier neu ist, wichtig sind. Sie betreffen zum einen das Verständnis fremder Sprachen und die Möglichkeit, auch über weite Entfernungen miteinander in Kontakt zu treten. Zum anderen beziehen sie sich auf die Fähigkeit zur Translokation, was bedeutet, dass man in kürzester Zeit auch ferne Ziele erreichen kann, indem man mit den Wolken reist.
Die wichtigste Voraussetzung dafür ist der feste Wille, etwas Bestimmtes zu bewirken, und dazu bedarf es einer starken meditativen Konzentration, die ständig geübt werden muss. Erste Erfolge werden Sie daran erkennen, dass sie sogar ungehindert durch Türen und Wände gehen können. Wie Sie sehen, gewinnen Sie da einige Vorteile – aber denken Sie auch immer daran: Sie müssen sich ständig mit mentalen Übungen darum bemühen und bekommen dabei nichts geschenkt.
Zunächst zur Verständigung untereinander: Jeder von uns kann sich in seiner Muttersprache ausdrücken und wird trotzdem von jedem verstanden. Zeit und Ort spielen dabei keine Rolle. Zur Kontaktaufnahme muss intensiv an die gewünschte Person gedacht werden, aber etwas Geduld sollte man dabei schon haben. Das Zustandekommen einer Verbindung erfolgt ähnlich wie bei der modernen Form der drahtlosen Übermittlung von Botschaften, wie sie heutzutage gang und gäbe ist – wie das genau vor sich geht, kann ich allerdings nicht sagen.“
„Soll das heißen“, warf Rufus ein, „dass die Nachrichten, die von den Sterblichen als sogenannte Mails in den Äther geschickt werden, auch von den Unsterblichen wahrgenommen werden können? Diese sind ja nicht die vorgesehenen Adressaten, und da wäre so ein unerlaubter Zugriff, um Botschaften zu lesen, eigentlich unzulässig und fast so etwas wie Spionage.“
Mathilde wirkte leicht amüsiert, als sie entgegnete: „Sie haben Recht, aber da kann ich Sie völlig beruhigen. Wir könnten zwar diese Mitteilungen verstehen, aber angesichts ihrer immensen Flut, ihrer meist banalen Inhalte und ihres oft seltsamen Wortschatzes kümmert sich kaum einer von uns wirklich darum. Wir haben da viel bessere Möglichkeiten zur direkten Kommunikation, indem wir mit Unseresgleichen durch mentale Kräfte ein Treffen an bestimmten Orten vereinbaren können und uns von einer Wolke dorthin bringen lassen.