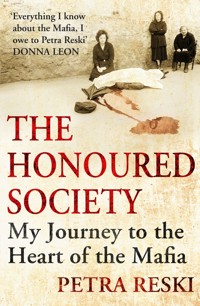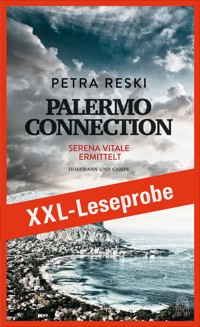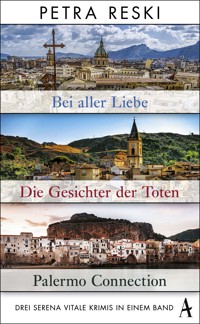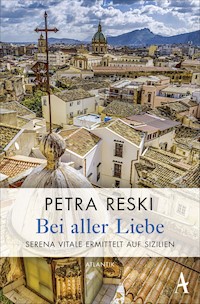
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Serena Vitale
- Sprache: Deutsch
»Die palermitische Staatsanwältin mit dem Hang zu scharfen Fragen und Heiligenfiguren ermittelt in jener ›Zwischenwelt‹, die ihre Schöpferin so penibel erforscht: Netzwerke aus Politikern, Unternehmern und Mafiosi also, die voneinander profitieren.« Frankfurter Allgemeine Zeitung Der letzte Band der Serena Vitale Trilogie In Palermo wird ein deutscher Staatsanwalt ermordet aufgefunden – ausgerechnet auf dem Straßenstrich der Transvestiten. Serena Vitale will mit dem Fall nichts zu tun haben, schließlich nehmen afrikanische Schlepperbanden all ihre Zeit in Anspruch, denn am Elend der Flüchtlinge wollen viele verdienen. Doch der Staatsanwalt ermittelte in Deutschland gegen die Mafia, und Serena Vitale ist sonnenklar, dass es sich keinesfalls um ein Verbrechen aus Leidenschaft handelt. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich selbst in die Ermittlungen zu stürzen. Die Vorgänger der Trilogie: Band 1 - Palermo Connection Band 2 - Die Gesichter der Toten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Petra Reski
Bei aller Liebe
Serena Vitale ermittelt auf Sizilien
Roman
Hoffmann und Campe
Ah, you loved me as a loser But now you’re worried that I just might win
You know the way to stop me But you don’t have the discipline
How many nights I prayed for this To let my work begin
First we take Manhattan
Then we take Berlin
Leonard Cohen
1
Wahrscheinlich wollte er etwas von ihr. Ganz bestimmt wollte er etwas von ihr. Deshalb rückte sie den Stuhl zurück und setzte sich erst hin, nachdem sie den gebührenden Abstand geschaffen hatte. Der Abstand ist das Wichtigste. In jeder Hinsicht, im Ton, im Raum und überhaupt. Sie wollen mit der Justiz zusammenarbeiten? Ja? Dann muss ich Sie auf dies und das und jenes aufmerksam machen.
Und, ja, es wäre ihr lieber, mit einem Mafioso hier zu sitzen, als mit ihrem Kollegen Jerry Sutera, der die widerwärtige Angewohnheit hatte, Zigarillos zu rauchen, sizilianische, was die Sache nicht besser machte.
Vor ihr ein überquellender Aschenbecher, daneben vergilbte Aktenbündel. In der Ecke ein Ventilator, der seinen Geist schon zu Zeiten Garibaldis aufgegeben hatte. Das Büro stank wie die Pest, von Jerry ganz zu schweigen. Sie fragte sich, wie seine Frau das aushielt. Falls er überhaupt eine hatte.
Bis vor kurzem hatte Jerry mit ihr in der Antimafia-Staatsanwaltschaft gearbeitet, jetzt war er abgezogen worden und kümmerte sich um Einbrüche in Discount-Supermärkte in der Via Tasca Lanza, Schwarzbauten in Brancaccio, sexbesessene Lehrerinnen (eine hatte einen sechzehnjährigen Schüler verführt, in der Tiefgarage ihres Hauses, tolle Frau, fand Jerry) und Touristinnen, die in Capo Gallo von den Klippen fielen, während sie das Panorama fotografierten. Bereitschaftsdienst Tote, Bereitschaftsdienst Lebende, business as usual.
»Spuck’s aus, Jerry«, sagte sie und griff nach einer der Mappen, die auf seinem Schreibtisch lagen, um sich etwas Luft zuzufächeln.
»Ich wollte dich nur fragen …«
»Lass mich raten: Ob ich dich vertreten kann?«
Er blickte auf. »Immer direkt. Liegt wohl an deinen deutschen Genen.« Er leckte an einem neuen Zigarillo und suchte in dem Aktenberg auf seinem Schreibtisch nach einem Feuerzeug.
»Soll ich dir meine Abstammungsurkunde zeigen? Wir Vitales sind Sizilianer bis ins zehnte Glied«, sagte Serena.
»Dann bist du genmanipuliert. Man hat dich mit den Deutschen geklont. Ich finde jedenfalls nichts Sizilianisches an dir.«
»Weil das Erbgut durch die Luft manipuliert wird?«, fragte sie.
»Wenn man dafür anfällig ist, schon.«
Alter Witz. Kursierte in der Staatsanwaltschaft Palermo, seitdem bekannt geworden war, dass sie in Deutschland aufgewachsen war. Nicht nur die Mafiosi nannten sie La crucca, die Deutsche. An schlechten Tagen wurde ihr vorgeworfen, unflexibel, phantasielos und pedantisch zu sein. An guten Tagen galt sie als aufrichtig, tiefgründig und verlässlich. Heute war definitiv ein guter Tag. Gleich würde Jerry »Du bist meine einzige Hoffnung« säuseln, »stellina mia, du bist die Einzige hier, auf die ich mich verlassen kann, meine Mutter wird fünfundachtzig, und es würde ihr das Herz brechen, wenn ich auf ihrem Geburtstag fehlen würde, nur weil ich Bereitschaftsdienst habe.«
Und dann müsste sie am Abend auf den Wein und den Spätfilm verzichten, sich eine Hose, einen Pullover und eine Jacke auf den Stuhl neben ihrem Bett bereitlegen, daneben die Liste der diensthabenden Gerichtsmediziner und das auf volle Lautstärke gestellte Diensttelefon des »Bereitschaftsdienstes Tote«, und außerdem hoffen, dass die Polizisten nicht wieder die falsche Nummer wählen würden: Die Telefonnummer des »Bereitschaftsdienstes Tote« unterschied sich von der des »Bereitschaftsdienstes Lebende« lediglich durch die letzte Zahl, weshalb sie, wenn das Telefon klingelte, immer gleich »Tot oder lebendig, ispettò?« rief, woraufhin der Polizist sich darüber beschwerte, wie fließend die Grenze zwischen Leben und Tod sei: »Und welche Nummer, verdammte Scheiße, sollen wir im Fall eines irreversiblen Komas anrufen, die für die Toten oder die für die Lebendigen?«
Und am Ende würde sie in den Zen gerufen, und das bedeutete verfaulte Matratzen, zersplitterte Asbestplatten und umgestürzte Müllcontainer. Daneben die verkohlten Gerippe geklauter Autos und auf der Erde benutzte Spritzen, weshalb sie feste Schuhe tragen müsste, denn der Zen war in Palermo keine Spielart des Buddhismus, sondern die Ausgeburt der Hirne durchgeknallter Stadtplaner der siebziger Jahre: Die Zona Espansione Nord bestand aus endlosen Reihen sandfarbener Betonkästen, von denen der Putz abfiel und die bis heute über kein vernünftiges Abwassersystem verfügten.
Wer hier lebte, knipste sich den Strom von Straßenlaternen ab und versorgte ganz Palermo mit Kokain, Heroin, Crystal Meth und Marihuana.
Weshalb man, wenn man in den Zen gerufen wurde, in der Regel tote Pusher fand. Oder einen, der einen anderen cornuto e sbirro genannt hatte, denn »gehörnter Spitzel« war im Zen eine tödliche Beleidigung, ausreichend, um vor der Haustür abgeknallt zu werden. Neulich hatte es hier eine Schießerei zwischen zwei Familien gegeben, nur weil sich die Kinder um einen Ball gestritten hatten.
»Jetzt sag schon, was willst du?« Sie drehte sich auf dem Stuhl etwas weg, um dem Geruch zu entgehen, den Jerry ausdünstete, wenn er sich bewegte. Dieser Hauch von Elefantendung, kalter Zigarillorauch, der seiner ungelüfteten Kleidung entströmte.
Aus der Mappe, mit der sie sich Luft zufächelte, fielen Fotos. Von einer Leiche. Nicht unbedingt überraschend hier.
Ein Toter, umgeben von Absperrbändern, den Beinen des Gerichtsmediziners und den Koffern der Frontschweine von der Spurensicherung. Sie raffte die Fotos schnell zusammen und warf sie auf den Schreibtisch.
Jerry schob die Fotos wieder zu ihr zurück. »Den haben wir neulich im Parco della Favorita gefunden. Nichts davon gehört? Er lag in der Nähe vom Transenstrich.«
Sie schob die Fotos von sich weg. »Nein, habe ich verpasst, bis gestern war ich auf Levanzo.«
»Und da liest du keine Zeitungen? Klickst nicht mal im Netz herum, Facebook oder so?«
»Ich pflege meine Ferien in einem Funkloch zu verbringen, Jerry. Die Sekretärinnen haben meine Festnetznummer. Ich wollte mich entgiften.«
»Oh, la dottoressa begibt sich ins Funkloch, um sich zu entgiften! Dann hast du das Riesending natürlich verpasst. Aufmacher im Giornale di Sicilia. Endlich hatten sie einen Vorwand, um die Hintern der Afrikanerinnen auf die erste Seite zu setzen. Nach dem Motto: Prostitution bei Tageslicht, vor den Augen unschuldiger Kinder, und die Behörden unternehmen nichts.« Er schob die Fotos wieder zu ihr hin. »Kannst du mal kurz …«
»Du bist wirklich penetrant, Jerry.«
»Sei doch nicht so herzlos. Schau dir die Bilder doch wenigstens mal an.«
Der Tote trug eine Krawatte, dunkelblau, mit kleinen grünen Punkten. Nicht ungewöhnlich, viele Freier kamen nach Büroschluss bei den Transen vorbei: Rechtsanwälte, Steuerberater, Professoren. Aber auch Gemüsehändler in der Mittagspause, Elektriker nach Feierabend und von der Familie ausgehaltene Muttersöhnchen, die den ganzen Tag Zeit hatten.
Regelmäßig wallte Empörung gegen den Straßenstrich auf, regelmäßig rebellierten die afrikanischen Prostituierten gegen diese Scheinheiligkeit, regelmäßig wurden Selbsthilfegruppen für sie gegründet. Und dann kam Nachschub aus Benin oder Nigeria, und alles ging weiter.
»Und?«
»Keine Ahnung.«
»Schau dir die Bilder doch mal genauer an.«
Unter dem Vorwand, die Fotos bei Tageslicht besser sehen zu können, riss sie das Fenster auf und sog frische Luft ein. Die Punkte auf der Krawatte entpuppten sich beim näheren Hinsehen als kleine, grüne Elefanten.
»Mach’s nicht so spannend, Jerry.«
»Wir hatten ihn noch nicht identifiziert, aber ziemlich schnell eine Spur. Jemand hatte das Opfer kurz zuvor mit einem Afrikaner gesehen, mit einem Somalier. Wie sich herausstellte, wohnte der im Zen, zwei Kollegen vom Kommissariat San Lorenzo sind also hin, nur um ihn zu überprüfen, aber der Typ ist völlig durchgedreht, und wenn der Kollege nicht so schnell reagiert hätte …«
»Das heißt?«
»Der hat sofort auf den Beamten gezielt.«
»Verletzt?«
»Tot.«
»Wer?«
»Der Somalier.«
»Ach«, sagte Serena.
»Was heißt hier ›ach‹? Der hatte die Pistole in der Hand, mit der der Typ im Parco della Favorita erschossen wurde. Und Schmauchspuren auf der Hand. Serena, nein, wirklich, der Kollege trägt keine Schuld. Der ist so traumatisiert, dass er psychologisch betreut werden muss.«
Er schob ihr ein weiteres Foto zu. Ein Zimmer wie eine Müllkippe. Der Afrikaner lag vor einem Flachbildschirm in einer Blutlache inmitten eines Bergs verkrusteter Teller. Ein muskulöser Oberkörper. Und rosa Strapse. Mit rosa Samtschleifen, die den Toten verletzlich, fast kindlich wirken ließen, trotz des muskulösen Oberkörpers.
Es hieß, dass Männer, die Sex mit einer Transe hatten, latent schwul seien und sich das nur nicht eingestehen wollten. Dabei waren viele Transen weiblicher als jede Frau. Obwohl – der hier hatte außer rosa Strapsen gar nichts Weibliches an sich.
Jerry blickte sie erwartungsvoll an. Wahrscheinlich wollte er gelobt werden. Männer wollten immer gelobt werden. Die einen dafür, den Müll heruntergebracht zu haben, die anderen dafür, an toten afrikanischen Transen Schmauchspuren festgestellt zu haben. Che palle, was für ein Scheiß.
»Jerry, ich muss jetzt los, ich habe noch zu tun.«
»Sei doch nicht so unflexibel.«
»Ich bin nicht unflexibel, sondern unter Zeitdruck. Ich muss noch zweihundert Seiten Abhörprotokolle lesen. Operation Thaumas.«
Jerry stöhnte entrüstet auf. So als hätte sie gesagt: Und was ist deine tote afrikanische Transe gegen dreihundertsechsundsechzig tote afrikanische Flüchtlinge? Ersoffen vor Lampedusa, weil die gierigen Schleuser tausend Menschen in ein Boot gequetscht hatten, in das mit Mühe fünfhundert gepasst hätten?
Und, Gott ja, genau das hatte sie gedacht.
An toten Afrikanern hatte es ihnen in den letzten Jahren wirklich nicht gemangelt. Sie hatten hier schon so viele Ermittlungen gegen Schleuserbanden durchgezogen, dass ihnen langsam die Namen von Meeresgottheiten ausgingen. »Thaumas« hatte »Nereide 1« und »Nereide 2« abgelöst. Davor hatte es »Poseidon 1«, »Poseidon 2« und »Proteus« gegeben. Einer der Schleuser von Nereide 2 war in Deutschland festgenommen worden, ein Eritreer. In Göttingen verhaftet und nach Palermo ausgeliefert. Und nachdem sich ein libyscher Schleuser entschieden hatte, auszupacken – über die guten Beziehungen zur Präfektur von Agrigent, die ihnen falsche Papiere für Flüchtlingsfamilienzusammenführung verkauft hatte –, hätte daraus eine schöne runde Sache werden können. Wenn der Prozess nicht nach Rom verlegt worden wäre. Wo alles versickerte. Jedenfalls alles, was die Präfektur von Agrigent betraf.
Sie hatte es schon fast bis zur Tür geschafft, als Jerry triumphierend rief: »Der Tote von La Favorita ist übrigens ein Deutscher. Wir haben ihn gestern identifiziert.«
»Sextourist?«, fragte Serena boshaft.
»Staatsanwalt.«
»Und was hat der hier gemacht?«
»Das wollte ich von dir wissen«, sagte Jerry und grinste.
»Nur weil ich Deutsch spreche, kenne ich noch lange nicht alle deutschen Staatsanwälte.«
»Nein, aber du kennst dich mit Deutschland besser aus als ich.«
Jetzt war alles klar. Jerry sah eine Lawine aus Rechtshilfeersuchen, kryptischen Vorschriften über grenzüberschreitende Zusammenarbeit und endlosen Besuchen des deutschen Konsuls aus Neapel auf sich zurollen. Alles müsste übersetzt werden. Interpol aus Rom würde sich einschalten. Und zu allem Überfluss würden irgendwelche deutsche Beamte hier aufkreuzen, die versuchen würden, mit ihm auf Englisch zu kommunizieren.
Dabei war das einzig Englische an Jerry sein Vorname. Und an den war er nur gekommen, weil Calogero zu lang war und ein amerikanischer FBI-Kollege seine Mails immer an Jerry statt an Geri gerichtet hatte. Die einzige Fremdsprache, die Jerry jemals erlernt hatte, war Italienisch, ansonsten sprach er nur palirmitanu.
»Wobei das eine das andere ja nicht ausschließt. Ich meine: Sextourist und Staatsanwalt«, sagte Jerry. »Seine Frau hat die Polizei alarmiert, nachdem er sich seit zwei Tagen nicht mehr gemeldet hatte. Sie wollte nach vier Tagen nachkommen, sie hatten vor, auf Sizilien Urlaub zu machen, Selinunt, das Tal der Tempel, Taormina. Eine Rundreise, das Übliche. Er war früher gefahren, weil er etwas ermitteln wollte. Sagte seine Frau. Sie wusste aber nicht, was. Sie wusste auch nicht, wo. Palermo, Agrigent oder Trapani, sie hatte keine Ahnung. Sie wusste eigentlich nichts, nur dass er für eine Woche eine Wohnung gemietet hatte, in der Via Emerico Amari.«
Er schob ihr weitere Fotos hinüber. Aufnahmen aus der Pathologie. Der Tote lag auf dem Stahltisch, der Kopf war abgestützt, das Gesicht voller Totenflecken, die Haare nass, die Lippen weiß vertrocknet.
Sie legte das Foto wieder hin und suchte nach dem Bild mit der Krawatte.
Der Polizeikongress in Köln »Safety first«. Der Umtrunk. Da war dieser Typ gewesen, der eine ähnliche Krawatte getragen hatte. Mit fliegenden Schweinen oder so. Staatsanwälte hatten gelegentlich einen Hang zu solchen idiotischen Krawatten. Sie hielten das für Ironie.
Sie hätte diesen blödsinnigen Kongress vergessen, wenn sich unter den Vortragenden nicht ein völlig irrer Journalist befunden hätte, der, um die allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen, sich allen Ernstes dazu verstiegen hatte, die Existenz der Mafia in Deutschland zu leugnen. Und in dem Moment, sie erinnerte sich jetzt wieder ganz genau daran, hatte sie kurz in die Augen dieses Staatsanwalts mit der bescheuerten Krawatte geblickt. Er hatte ihren Blick erwidert. Und den Kopf geschüttelt.
Wie lange war das her? Zwei, drei Jahre? Beim Umtrunk hatten sie sich über den Journalisten lustig gemacht. Und schon nach dem ersten Glas Wein hatte der Staatsanwalt – verdammt, wie hieß der denn noch? Irgendwas mit K, so ein typisch deutscher Name – ihr gestanden, wie sehr er Italien liebte. Nichts Ungewöhnliches. Alle Männer gaben in ihrer Gegenwart vor, Italien zu lieben, Norditaliener gaben sogar vor, speziell Sizilien zu lieben, und wenn sie erfuhren, dass sie in Palermo lebte, gerieten sie völlig außer Rand und Band.
Sie hatte ihn und sogar seine Scheißkrawatte lustig gefunden. Bis dieser Arsch ihren Rechtshilfeantrag abgelehnt hatte, nur einen Monat nach dem Kongress.
»Und, kennst du ihn wirklich nicht?«
»Wie heißt er?«
»Gregor Kampmann. Oberstaatsanwalt aus Köln.«
Sie erinnerte sich noch daran, wie sie jedes Blatt abgezeichnet hatte. ALLA COMPENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA GERMANIA, Staatsanwaltschaft Köln, z.Hd. von Herrn OSTA GREGOR KAMPMANN.
Sie wollte die Güter eines Mafiosos beschlagnahmen, der in Solingen lebte, und da war es tatsächlich Kampmann gewesen, der die Beschlagnahmung abgelehnt hatte.
Solche Typen hatte sie gefressen: auf Kongressen auf Antimafia-Kämpfer machen, sich aber bei der nächsten Gelegenheit hinter Paragraphen verstecken. Die Welt war voller Heuchler. Ging ein Schlauchboot unter, waren alle Flüchtlinge. Näherte sich der Todestag von Falcone und Borsellino, waren alle Falcone und Borsellino. Und wenn es darum ging, Haltung zu zeigen, knickten sie ein. Es kotzte sie an.
Und jetzt lag er hier auf dem Seziertisch, dieser Erbsenzähler mit Doppelleben, dieser Biedermann, der nach Palermo gekommen war, um mit einer afrikanischen Transe zu vögeln, genau wie die Bosse, die ihren Söhnen, wenn sie zum ersten Mal ein Bordell besuchten, mit auf den Weg zu geben pflegten: U feto si fa fuora, die schmutzigen Dinge erledigt man woanders.
Sie hatte die Erinnerung an ihn verdrängt, bis jetzt. Bis der alte Ziegenbock von Jerry Sutera ihr diese Fotos unter die Nase gehalten hatte.
»Und? Kennst du ihn?«
»Nein«, sagte sie. »Nie gesehen.«
»Gut, lebendig wird er natürlich etwas besser ausgesehen haben als auf diesem Foto. Aber der Name, den hast du auch noch nie …?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Deutscher Staatsanwalt tot auf Transenstrich ist natürlich eine Schlagzeile, auf die jede Zeitung scharf ist«, sagte Jerry und grinste.
Natürlich spürte Sutera, diese alte Ratte, dass sie anders reagierte. Anders, als wenn sie sich die Bilder von toten Pushern oder durchgeknallten Familienvätern ansah, die sich von unten ins Kinn geschossen hatten, oder von Mafiosi, die für einen sgarro, eine Verfehlung, die sie nicht mehr gut machen konnten, mit dem Leben bezahlen mussten und mit einem dünnen Stahlseil stranguliert worden waren.
In Serena stieg Wut auf. Wut auf diesen Zwangscharakter von deutschem Oberstaatsanwalt. Wut auf Jerry Sutera, dieses Frettchen, das sich vor der Arbeit, die mit dem Fall verbunden war, drücken und gleichzeitig groß herauskommen wollte: sein Foto – getwittert, gepostet und auf allen Titelseiten. Nicht unter Folter würde sie zugeben, dass sie Kampmann gekannt hatte.
Und noch während sie dies dachte, meldete sich ihr schlechtes Gewissen. Verdammtes katholisches Unterbewusstsein. Wurde sie es denn nie los? Gnade, Vergebung und Mitgefühl – ausgerechnet mit diesem Paragraphenreiter von deutschem Staatsanwalt? Was in ihr sagte, seine einzige »Verfehlung« habe letztlich nur darin bestanden, latent schwul gewesen zu sein? Wobei es sie, ehrlich gesagt, wunderte, wie man in einer Stadt wie Köln überhaupt noch latent schwul sein konnte. Aber andererseits war das vielleicht der besondere Kick. Verheiratet zu sein und Sex mit einer afrikanischen Transe in Palermo zu haben, war auf jeden Fall aufregender, als offen schwul zu sein und Sex mit einem Oberstudienrat in Köln zu haben, mit dem man sich schon vor fünfzehn Jahren verpartnert hatte. Was wusste sie denn schon von diesem Kampmann? Vielleicht hatte er durch den Sex mit der Transe seinem strengen Über-Ich entkommen wollen? Seinem Hang zur Paragraphenreiterei?
Meldete sich da etwa ihre innere Mutter Teresa? Egal. Jerrys geifernde Frettchenhaftigkeit war auf jeden Fall noch schwerer zu ertragen.
»Denn das erwartet man ja wirklich nicht: ein deutscher Staatsanwalt, der nach Palermo kommt, um …«
»Weißt du, Jerry, wenn du einfach die Klappe halten würdest, wäre das schon mal ein guter Anfang.«
»Wieso? Was ist das Problem? Kanntest du ihn doch? Oder hast du am Ende plötzlich dein Herz für Freier entdeckt?«
»Nein, ich kannte ihn nicht. Aber du auch nicht.«
»Wird schwer, das unter der Decke zu halten.«
»Oh, Palermo ist wohl der beste Ort, um etwas unter der Decke zu halten«, sagte Serena. »Immerhin hat man es hier hingekriegt, die Existenz der Mafia hundert Jahre lang zu leugnen, da wirst du es wohl schaffen, die sexuellen Neigungen eines deutschen Staatsanwalts mit einer gewissen Diskretion zu behandeln, oder?«
Jerry Sutera lehnte sich zurück und zog an seinem Zigarillo. Stieß den Rauch aus.
Ja, Serena ist eine interessante Frau, dachte er. Auch wenn sie eine Nervensäge war, wenn es um Dinge ging, die ihr wichtig waren. Etwa die Zusammenhänge zwischen Politik und Mafia, was viel zu oft dasselbe war, klar, aber die Hingabe, mit der Serena ihre Ermittlungen führte, fand Jerry Sutera extrem anstrengend. Und manchmal auch ein bisschen unheimlich. Auch weil man ihr diese Hartnäckigkeit nicht ansah, so zierlich wie sie war. So blond. So frisch gebügelt. Ihr Äußeres täuschte natürlich. Man traute ihr keine Schlechtigkeit zu, dabei konnte keine so dreist lügen wie die Vitale. Er hatte das selbst erlebt, sie hatte sogar den Bischof von Monreale angelogen, weil sie ihn im Verdacht hatte, für Saruzzo Greco Geld zu waschen.
Anders als die Vitale hatte er Familie, nicht alle konnten so durchs Leben gehen wie sie, der es immer um das Große und Ganze ging, auch wenn es nur ein Einbruch in die Lagerhalle eines Supermarkts war. Es musste doch auch mal Ruhe sein. Da war er ganz der Meinung von Rizzo, dem neuen Chefankläger der Antimafia-Staatsanwaltschaft. Als Rizzo der Vitale vor die Nase gesetzt wurde, hatte sie die alte Fabel von dem amerikanischen Boss zitiert, der die Mafia erklärt: »Angenommen, ein neuer Chefankläger soll ernannt werden. Drei stehen zur Auswahl. Einer hat die besten politischen Verbindungen, einer ist superintelligent und einer ist ein Dummkopf. Am Ende wird der Dummkopf zum Chefankläger ernannt. Das ist Mafia.«
Und wenn er nur an die Ermittlungen zu Dino Greco dachte, Saruzzo Grecos Sohn. Die schlimmste Zeit seines Lebens. Da hatte ihn Rizzo ausgerechnet der Vitale zugeteilt. Monatelang hatte er kaum ein Auge zugemacht. Die Vitale hatte jede Ausschreibung, jedes Firmengeflecht und jedes Konto der Vertrauten von Dino Greco überprüft. Kein Wochenende auf Alicudi mehr, kein einziger Segeltörn, er war nicht mal mehr dazu gekommen, sonntags zum Essen zu seiner Mutter zu fahren. Und während sie im Justizpalast gesessen hatten und versuchten, Schaubilder von Grecos Geldströmen zu erstellen, war Dino Greco auf dem Antimafia-Tag des sizilianischen Unternehmerverbands aufgetaucht, praktisch an der Seite des Innenministers. Jeder Idiot hätte spätestens da kapiert, dass es sinnlos war, weiterzumachen. Nur nicht die Vitale. Die verwanzte jeden Schafstall zwischen Palermo und Mezzojuso und sah in jedem Meckern, jedem Blöken, jedem Furz einen Beweis. Bis Rizzo sie gezwungen hatte, den Fall Dino Greco zu archivieren.
Gott sei Dank hatte sie jetzt mit den Schleusern genug zu tun. Angeblich war Greco in Deutschland, und so Gott wollte, war er da vor ihr sicher. Ja, so weit hatte sie ihn getrieben, dass er Solidarität mit einem Mafioso empfand.
Durch den blauen Dunst seines Zigarillos hindurch sah er, wie Serena Vitale aufstand. Sie murmelte etwas von ihren Abhörprotokollen, die sie noch zu lesen hatte, für die Thaumas-Ermittlung, ja klar, ihre superwichtigen Antimafia-Ermittlungen waren natürlich dringlicher als seine Schmuddelgeschichten.
Eine Stunde danach ließ er Serena wissen, dass er eine hübsche Germanistikstudentin gefunden habe, die für ihn dolmetschte.
Zwei Tage später gab es in Palermo keine Zeitung mehr, die nicht über den Fall berichtet hatte: »Deutscher Staatsanwalt in Palermo von afrikanischer Transe ermordet«. Nachzulesen in Il Giornale di Sicilia, La Sicilia, Il Quotidiano della Sicilia und auf den Palermo-Seiten der Repubblica und des Corriere della Sera. Und online natürlich auch. Jemand hatte daraufhin getwittert: »Zum #Sextourismus nach #Palermo: Deutscher Staatsanwalt von #Transe ermordet«. Danach waren deutsche Reporter in Palermo aufgetaucht. Die BildZeitung hatte getitelt: »Bizarres Doppelleben des Gregor K. Afrikanische Transe erschießt deutschen Staatsanwalt in Palermo. Mord in Ekstase?«
2
Was er an den Deutschen bewunderte, war ihr Ordnungssinn. Und ihren Rechtsstaat, den bewunderte er natürlich auch. Und wenn man das miteinander vermischte, also den Rechtsstaat mit dem Ordnungssinn, kam ein Gefängnis heraus, das dekoriert war wie ein Pfarrgemeindesaal für einen Kindergeburtstag. Fehlten nur noch die Luftballons.
Dino war auf dem Weg in den Besucherraum der Justizvollzugsanstalt (irre, dieses Amtsdeutsch!) Düsseldorf in Ratingen. Er ging durch einen unterirdischen Gang, der in optimistisch stimmenden Farben gestrichen war, diagonale Streifen in Grün, Blau, Rot und Gelb. Kurz vor dem Besucherraum standen Automaten mit Süßigkeiten, man hatte ihm ausgerichtet, dass ’Ntoni am liebsten Marsriegel und Ritter-Sport-Schokolade aß, zur Not auch Weingummi und Lakritz. Also zog Dino süßes Zeug für zwanzig Euro aus dem Automaten, mehr war nicht gestattet. Er wurde durch einen weiteren Flur geführt, an dessen Ende ein Lebensbaum aus Keramik hing. Ob die hier dachten, dass so eine Deko Aggressionen abbaute? Weil die Gefangenen komplett debil waren? So wie die Familie am Nebentisch, die in ihren ausgebeulten Trainingshosen alle so aussahen, als kämen sie gerade von einem Bankraub? Kaum hatten sie sich hingesetzt, fraßen sie dem Häftling die mitgebrachten Süßigkeiten weg. Die zahnlose Mutter fiel über die Kekse her, der Bruder, ein Fettsack mit Hasenscharte, stopfte sich Marshmallows in den Mund, die großflächig tätowierte Schwester kaute auf Weingummi herum. Der Häftling wirkte noch am normalsten, trotz Basecap und verfaulten Zahnstümpfen.
Der Besucherraum war ein großer Glaskasten, bewacht von einem Wärter, der auf einer Empore saß. Als ’Ntoni hereingeführt wurde, wirkte er mit seiner Krawatte und den Manschettenknöpfen aus Perlmutt wie ein Bankdirektor, der Opfer eines Justizirrtums geworden war.
’Ntoni saß wegen Versicherungsbetrugs, er hatte allen Ernstes einen Autounfall fingiert (mal kurz die Handbremse angezogen, als keiner damit rechnete – Gutachter, Werkstatt und Rechtsanwalt waren mit zehn Prozent am Umsatz beteiligt). Und das, obwohl ’Ntoni sich jederzeit drei Ferrari hätte leisten können und nur noch rumänische Zigeuner auf das Geschäft mit dem Autobums setzten. Kalabrier blieben eben Bauerntölpel, die aus Erdlöchern gekrochen waren. Hatte Dinos Vater immer schon gesagt.
Dino stand auf, küsste ’Ntoni auf die Wangen, ekelte sich vor dem süßlichen Geruch seines Rasierwassers und schob die Süßigkeiten über den Tisch. ’Ntoni musterte sie kurz und legte sie kommentarlos beiseite.
»Siehst gut aus, wie immer«, sagte Dino. »Hast du abgenommen? Steht dir gut.«
’Ntoni war eitel, das hatte sein Vater oft betont, und sein Vater hatte immer recht gehabt. Jedenfalls, was die Schlichtheit und den Geiz der Kalabrier betraf. Im Gefängnis hatte ’Ntoni einen Gitarrenkurs belegt und sich an der Hüfte operieren lassen, nur weil es umsonst war.
»Hier ist es besser als in den Thermen von Acireale«, sagte ’Ntoni und kicherte. »Einzelzimmer mit viel Tageslicht, endlich kann ich mich etwas ausruhen. In einem Monat geht es ja schon wieder los.«
Seitdem Dino in Köln angekommen war, hatte er sich um eine gute Zusammenarbeit mit den Kalabriern bemüht, er hatte ’Ntoni sogar gelegentlich Kokain abgenommen, erst fünf Kilo hier, zehn Kilo da, dann mehr, obwohl es ihm am Arsch vorbeiging, aber was tut man nicht alles um des lieben Friedens willen. Die Kalabrier trieben wie Fettaugen auf der deutschen Suppe, mit ihren Eisdielen und Hotels, den Pizzerien und Feinkost-Importen. Alleine das: Feinkost. Um zu begreifen, dass da etwas nicht stimmen konnte, musste man kein OK-Ermittler sein. Feinkost aus Kalabrien war so was wie trockener Regen. Ein Oxymoron, wenn er sich recht erinnerte. Er schickte einen kurzen, liebevollen Gedanken an seinen alten Italienischlehrer, dem Einzigen in Corleone, der Dinos Vater an Weihnachten keinen Präsentkorb geschickt hatte. Und den man eines Tages verbrannt in einem Feld bei Bisacquino gefunden hatte. Friede seiner Asche.
In jüngster Zeit waren zu den kalabrischen Eisdielen, Pizzerien, Hotels und Feinkost-Importen noch Immobilien gekommen, in Ziegelstein zu investieren war die Devise der Kalabrier, im Osten gehörten ihnen ganze Innenstädte. In Stuttgart war ihnen ein Neubaugebiet von hundert Hektar in bester Lage in den Schoß gefallen, ein Gottesgeschenk, hatte ’Ntoni gesagt, Stuttgart 21, das größte Bauprojekt Deutschlands.
’Ntoni musterte die Süßigkeiten. Lange würde es nicht dauern, bis er die Tüten aufreißen und alles in sich hineinstopfen würde, die Marsriegel, die Ritter-Sport-Schokolade, das Haribo-Konfekt. Er würde alles auffressen, nur weil es umsonst war.
»Wie geht es deinem Vater?«, fragte ’Ntoni.
»Er hatte eine schwere Bronchitis, aber wir hoffen, dass es jetzt endlich wieder aufwärts geht, ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert, sie hat ihn vorgestern besucht, mit meinem Bruder.«
Jetzt würde ’Ntoni wieder die Freundschaft zu seinem Vater beschwören, das gehörte zum Ritual. Dino lächelte. Sein Vater war schwer krebskrank. Im Grunde warteten alle nur darauf, dass er endlich krepieren würde. Seit Jahren vegetierte er vor sich hin – hinter Panzerglas im Hochsicherheitsgefängnis von Opera bei Milano. Das war nicht so ein Freizeitparadies wie das Gefängnis hier. Sein Vater hatte sich geopfert, für alle. Für seine Söhne, seine Frau, für die Cosa Nostra, für alle. Nachdem Saruzzo Greco festgenommen worden war, nach dreiunddreißig Jahren im Untergrund, hatte sich alles bestens gefügt. Die Idioten glaubten wieder an den Staat, der den Antistaat besiegte, Alessio Lombardo war immer noch untergetaucht und spielte überzeugend seine Rolle des Ungreifbaren, Unsichtbaren, Absoluten. Dank ihm konnte jeder dieser Ministerpräsidentendarsteller alle drei Monate ankündigen, dass seine unmittelbare Festnahme bevorstand, Journalisten füllten mit den Alessio-Lombardo-Starporträts ihr Sommerloch, die Antimafia-Gläubigen arbeiteten sich auf ihren Facebook-Seiten in Großbuchstaben an ihm ab, und ein paar Vollidioten konnten immer noch an den großen Cosa-Nostra-Traum glauben: heute Sekundenkleber in die Schlösser der Gemüseläden von Albergheria spritzen und morgen in einer Stretchlimousine durch New York fahren.
»Dein Vater ist ein großer Mann«, sagte ’Ntoni. »Wir werden nie vergessen, was er für uns alle getan hat.«
»Danke, ’Ntoni«, sagte Dino heiser.
Gott, ja. Sie hatten allen Anlass, seinem Vater dankbar sein. Nach den Attentaten hatte er Mühe gehabt, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Nach den attentatuni, wie sie sein Vater immer halb ehrfürchtig, halb abfällig genannt hatte, hatte die ganze Welt auf Sizilien gestarrt und jeden Gemeindepolizisten zum Antimafia-Heiligen aufgeblasen. Jahrzehntelang hatte die Cosa Nostra unter einem Vergrößerungsglas gelebt, es war schwere Arbeit gewesen, aber es hatte sich gelohnt. Nicht nur für die Cosa Nostra, sondern für alle. Die Kronzeugenregelung war praktisch abgeschafft. Es gab so gut wie keine Aussteiger mehr. Die Antimafia-Bewegung war unter Kontrolle gebracht. Berlusconi hatte sich sein Gehirn weggevögelt und war durch einen Jüngeren ersetzt worden. Im Parlament saß nicht mehr die alte Garde, deren Vergangenheit von den Schmutzfinken zur Genüge durchwühlt worden war, sondern ihre unbelasteten Kinder, blank wie Babypopos. Ohne Vorstrafen, ohne Skandale, die die Alten hinter sich hergezogen hatten wie eine Ölspur. Alles war wie geleckt.
Und während sein Vater sich den Arsch aufgerissen hatte, waren die Kalabrier im Windschatten der Cosa Nostra aufgestiegen, hatten den Kokainhandel weltweit unter ihre Kontrolle gebracht und waren so reich geworden, dass sie ihr Geld in Einmachgläsern vergraben mussten, in denen es verfaulte, wenn sie es nicht schnell genug waschen konnten. Solchen Vollidioten durfte man das Geschäft nicht allein überlassen.
Draußen schien die Sonne. Wenn man hier aus dem Fenster blickte, sah man grünen Rasen ohne einen einzigen Papierschnipsel, zierliche Ahornbäume und azurblauen Himmel. Sein Vater schaute aus seinem Fenster auf Natodraht, Betonmauern und Wachtürme mit MG-Schützen. Wenn er denn auf den Tisch kletterte.
»Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit ein paar Probleme hattest, in Palermo«, sagte ’Ntoni. »Irgendwas mit Touristen.«
»Ach, ist das hier auch angekommen?«
»Buschtrommeln«, sagte ’Ntoni und leckte sich Schokolade vom Finger.
»’Ntoni, ganz ehrlich, ich möchte nichts anderes, als ein ganz normales Leben führen. Aber du weißt ja, in Italien ist das nicht möglich.«
»Wem sagst du das.«
»Und der Tourismus ist für Sizilien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ich habe immer daran geglaubt. Einer meiner Freunde veranstaltet Rundreisen. Er hat mich überzeugt, dass es eine gute Idee wäre, den Touristen etwas vom wirklichen Sizilien zu erzählen. Ich meine, sie kommen nach Palermo und sehen nichts anderes als Antimafia-Staatsanwälte, die in gepanzerten Limousinen mit Blaulicht durch die Stadt rasen. Also habe ich mich bereit erklärt, zweimal pro Woche deutschen Reisegruppen in einem Hotel in Palermo die Mafia zu erklären. Mein Freund führte kurz in die Geschichte der Cosa Nostra ein, und dann habe ich eine Stunde lang erzählt. Meine Kindheit in Corleone, das Leben auf der Flucht, die Rückkehr nach Corleone.«
»Auf Deutsch?«, fragte ’Ntoni.
»Klar, auf Deutsch. Und ich sage dir, die haben Augen gemacht. So etwas haben sie noch nie gehört. Etwa, wie man sich fühlt, wenn man als Sohn eines Mafiabosses in Sippenhaft genommen wird. Das hat sie richtig mitgenommen. Sie haben so konzentriert zugehört, dass sie kaum zu atmen wagten.« Dino schluckte. Machte eine Pause. Seufzte. Und sagte: »Weißt du, ’Ntoni, es war für mich sehr stimulierend, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die aus einem anderen Kulturkreis stammen.«
’Ntoni nickte. Auf die Deutschen ließ er nichts kommen. »Ich verstehe dich, Dino. Das ist auch der Grund, weshalb ich hiergeblieben bin.«
»In Italien wird alles, wirklich alles, was ich sage, gegen mich verwendet. Auch diese Mal dauerte es nicht lange, schon ging es wieder los mit dem Jüngsten Gericht. Die Antimafia-Apostel haben losgeheult, von wegen: Greco-Sohn lässt sich von Touristen bezahlen.« Er knackte mit den Fingergelenken. »Die Geschichte ist durch die gesamte Presse gegangen. Repubblica, La Stampa, Corriere. Wurde wie besessen geteilt, getwittert, gepostet. Mein Vater: das personifizierte Böse. In Italien bin ich ein Bürger zweiter Klasse, ’Ntoni.«
’Ntoni nickte wieder. Wie gut, dass er in Deutschland geblieben war. Und eine Deutsche geheiratet hatte. Inzwischen war die Ehe zwar geschieden, aber sie war die Mutter seiner Söhne und hatte ihn nie verraten. Er hatte ihr nach der Scheidung das Haus in Oberhausen überlassen.
»Mein Vater hat mich natürlich auch dafür kritisiert, dass ich mich mit den Touristen getroffen habe, ’Ntoni. Du kennst ihn ja. Ganz die alte Schule: Schafskäse, Zichorien und ›die Ehre des Schweigens‹. Aber für mich und meine Geschwister war es auch nicht leicht. Wir sind die meistkontrollierten Personen Italiens. Wir führen ein Leben im Big-Brother-Container, wir spielen mit in der großen Cosa-Nostra-Reality-Show.«
»Ich verstehe dich, Dino«, sagte ’Ntoni mitleidig und riss mit den Zähnen die Tüte mit den Marsriegeln auf.
Dino blickte wie ein waidwundes Reh und sagte: »Aber ich will mich nicht beschweren. Wer hätte mehr als du unseren Schmerz geteilt?«
Er bemerkte, dass in ’Ntonis Mundwinkel kleine, mit Karamell verklebte Krümel hingen, und dachte daran, wie sein Vater bei seinem letzten Besuch im bleichen Neonlicht im Besucherraum des Hochsicherheitsgefängnisses hinter Panzerglas gesessen und unsicher nach dem Hörer der Gegensprechanlage getastet hatte. Sein Bruder hatte alles mit seinem Smartphone gefilmt. Das Video sollte den körperlichen Verfall seines Vaters dokumentieren, der Anwalt kämpfte dafür, seinen Vater unter Hausarrest stellen zu lassen. War es nicht ein Menschenrecht, in Würde zu sterben? Zur Not würden sie sich bis zum Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hochklagen. Und während sein Vater in der Hochsicherheitshaft verkümmerte, hatte sich dieser Kalabrier in Deutschland eine Fettleber angefressen.
»’Ntoni, ich leide wie ein Hund, wenn ich meinen Vater sehe. Er hat immer alles den anderen gegeben. Sein ganzes Leben. Alles. Das letzte Mal hat er mich gefragt, ob es mir gut gehe, ob ich auch genügend essen würde. Mein Herz hat geblutet, ’Ntoni. Da sitzt dein Vater vor dir, klein und schmächtig in diesem viel zu weiten Trainingsanzug, hinter Panzerglas, und fragt dich, ob es dir gut gehe. Und wiegt vielleicht noch fünfzig Kilo. Mein Vater, fünfzig Kilo, ’Ntoni! Und du weißt doch, wie wichtig die Mahlzeiten für ihn immer waren, Sfincione nur aus Palermo, mit Schafskäse und Provola und Petersilie, bei der focaccia nur die maritata: Milz, Lunge, Schmalz und Ricotta, und wehe, wenn der Caciocavallo fehlte!«
»Ich weiß, Dino, ich weiß.«
»Und jetzt darf meine Mutter ihm nicht mal Süßigkeiten schicken, wir haben alles versucht, wir haben darum gebettelt, ihm ein paar verdammte gebrannte Mandeln, getrocknete Feigen oder wenigstens die dolci della martorana zukommen zu lassen. Aber sie haben ein Theater gemacht, als könnte er mit ein paar Weintrauben, Kirschen und Auberginen aus glasiertem Mandelteig ein Hochsicherheitsgefängnis in die Luft jagen. Nicht mal das gönnt man ihm. Mein Vater, der alles den anderen gegeben hat. Ich musste nach Deutschland gehen. Sonst hätten sie alles beschlagnahmt.«
’Ntoni schluckte. Nickte. Und glaubte Dino kein einziges Wort. Der alte Greco saß im Knast und würde keine Leiche aus dem Keller ziehen, keinen Staatspräsidenten, keinen Ministerpräsidenten, nicht mal einen Gemeinderat. Von dem ging keine Gefahr aus. Er würde schweigen bis zum Tod. Und falls sein idiotischer Sohn nicht so irre war auszupacken, würde es in ganz Italien niemand wagen, sich in die Geschäfte der Grecos einzumischen. Ganz im Gegenteil. Die Familie Greco war in Italien so sicher wie in Abrahams Schoß. Und genau das war das Problem. Schließlich hatte Dino sogar erfolgreich in die Trans-Adria-Pipeline investiert, ohne dass ihm dabei Steine in den Weg gelegt worden waren. Selbst die harten Hunde der Antimafia-Staatsanwaltschaft Palermo hatten sich an den Grecos die Zähne ausgebissen. Der Form halber waren nur Peanuts beschlagnahmt worden, der Rest florierte. Aber offenbar kriegten die Grecos den Hals nicht voll. Strebten nach Höherem. Er würde nicht hinnehmen, dass sie den mühevoll erreichten Frieden gefährdeten. Schließlich war es ihm, ’Ntoni, zu verdanken, dass wieder alles ruhig war, nach den Morden von Duisburg. Allein das Geld für die Anwälte. Jeden verfluchten Mistkratzer hatten sie in Grund und Boden geklagt. In Düsseldorf, in München, in Leipzig. Da war es schnell aus der Mode gekommen, ehrbare italienische Unternehmer in den Dreck zu ziehen. Es herrschte Frieden. Keine Rede mehr von Mafia, nur noch von Pizza Romana mit oder ohne Oregano. Und da konnten sie diesen verhätschelten Cosa-Nostra-Prinzen so gut gebrauchen wie eine Fistel am Arsch. ’Ntoni brach sich ein Stück von der mitgebrachten Ritter-Sport-Schokolade ab. Marzipan. Er hasste Marzipan. Er steckte sich die Schokolade in den Mund und schloss genießerisch die Augen. Als er sie wieder öffnete, schob er den Rest der Schokolade zu Dino hinüber.
Dino schüttelte den Kopf und schob die Schokolade wieder zurück. Offenbar war ’Ntoni von seinen Worten so ergriffen, dass ihm nichts anderes eingefallen war, als ihm etwas von seiner Marzipanschokolade anzubieten.
»Alles, was ich vom Leben erwarte, ’Ntoni, ist etwas Respekt. Für meine Mutter, meine Geschwister und für mich.«
Dino lehnte sich zurück. Das konnte er: auf Knopfdruck die ganz große Oper. Er und sein Bruder hatten früh gelernt, unterwürfig zu sein. Ehrerbietungen, Wertschätzungsfloskeln und Hochachtungsschwulst konnten sie auf Knopfdruck absondern. Und ansonsten schweigen: Jedes Mal, wenn die anderen Bosse gekommen waren, um ihrem Vater Reverenz zu erweisen, eine Investition zu besprechen, hatten sie daneben gestanden wie Marmorstatuen.
’Ntoni schluckte. »Niemand versteht dich besser als ich, Dino. Genau deshalb bin ich in Deutschland geblieben. Hier werde ich nicht diskriminiert, nur weil ich in San Luca geboren wurde.«
Jetzt fehlte nur noch die Kirsche auf der Torte, dachte Dino. »Weißt du, ’Ntoni, was der einzige Moment war, als mein Vater bei meinem letzten Besuch wieder auflebte? Als ich ihm gesagt habe, dass ich nach Deutschland gehen würde. Da war er wieder ganz der Alte.«
Was er ’Ntoni nicht sagte, war, wer ihm dazu geraten hatte. Nachdem er die Deutschen an einem sonnendunstigen Nachmittag getroffen hatte, auf einer Hotelterrasse in der Via Roma mit Blick auf die Kathedrale von Palermo. Nachdem er in ihre Gesichter geblickt hatte. In ihre blauen Augen.
Am Tag darauf war er nach Düsseldorf geflogen. Und hatte sich mit Don Rosario getroffen, den er noch aus der Zeit kannte, als er mit seinen Geschwistern bei seinem Onkel in Leverkusen den Sommer verbracht hatte.
Don Rosario stammte aus Montelepre, von ihm hatte Dino die erste heilige Kommunion empfangen, und er kümmerte sich um sämtliche italienischen Gemeinden zwischen Sauerland, Niederrhein und südlicher Eifel. Dank Don Rosario waren schnell diskrete Verhandlungen gelaufen, Schaltstellen besetzt und erste Investitionen getätigt worden. Denn die Flüchtlinge waren wirklich ein Gottesgeschenk.
’Ntoni versuchte ein Lächeln. Er zog kurz die Oberlippe hoch und sagte: »Wir alle verdanken deinem Vater viel.« Er machte eine Pause. Und fügte hinzu: »Umso mehr freut es mich, dass du dich hier gut eingelebt hast.«
Wie gut Dino sich eingelebt hatte, war dem fetten Kalabrier natürlich nicht entgangen. Vor allem nicht, dass Dino ein paar Schrottimmobilien aufgekauft hatte, in Köln, am Niederrhein, im Ruhrgebiet. Auch eine ehemalige Reha-Klinik in Paderborn hatte er gekauft. Kleinigkeiten. Viel mehr aber interessierten ihn die ehemaligen Luftwaffenkasernen im Weserbergland und in der Eifel, auf die ’Ntoni seine dicken Finger gelegt hatte.
Dino hatte gerade angesetzt, das heikle Thema endlich anzusprechen, als der auf der Empore sitzende Wächter aufstand und »Kommen Sie jetzt bitten zum Ende« sagte. Die Addams Family vom Nebentisch hatte sämtliche Süßigkeiten aufgefressen und schüttelte sich die Krümel von den Trainingshosen.
’Ntoni streckte sich und fing an, seine Süßigkeiten zusammenzupacken, die restlichen Marsriegel, die halbe Tafel Ritter Sport.
Dino umarmte ihn zum Abschied. Wieder stieg ihm das widerlich süße Rasierwasser in die Nase. Er flüsterte: »Wir haben vergessen, über die Kasernen zu reden.«
’Ntoni küsste ihn auf die Wange. »Wer bin ich, dass ich dem Sohn von Saruzzo Greco einen Wunsch abschlagen könnte?«
Dino umarmte ihn und sagte: »Der Herr sei mit dir.«
Er lief den Gang mit den diagonalen Streifen in optimistischen Farben entlang. Ließ sich von den Wächtern seine Geldbörse, die Rolex und die Goldkette mit dem kleinen Kruzifix aushändigen. Unterschrieb das Besucherprotokoll beim Verlassen des Gefängnisses.
Und dachte: Es geht doch nichts über Freundschaft.
3
»Du siehst aus wie einer, der gerade aus Syrien zurückgekommen ist«, sagte Erkan und versuchte mit dem Kamm ein paar Zotteln aus Wienekes Bart zu entfernen.
»Ich sehe aus wie mein alter Chemielehrer«, sagte Wieneke.
»Hör auf zu jammern, glaubst du denn, ein Bart wächst einfach von allein, ohne dass du dich um ihn kümmern musst?«
Wieneke schloss die Augen und versank etwas tiefer in seinem Frisierumhang. Wahrscheinlich würde jetzt wieder ein längerer Vortrag zum Thema »Aufzucht und Pflege von Vollbärten« folgen.
»Benutzt du nie das Seidenöl, das ich dir letztes Mal mitgegeben habe?«
»Doch, aber manchmal vergesse ich es«, sagte Wieneke schuldbewusst.
Wenn er geahnt hätte, dass Bartpflege eine Lebensaufgabe ist, hätte er nie damit angefangen. Spliss in den Haarspitzen, Haarbruch, Bartschuppen – es gab alles.
»Und das Shampoo? Welches benutzt du?«
»Francesca kauft mir immer Apfelshampoo. Das mag ich am liebsten.«
»Apfelshampoo? Bist du wahnsinnig? Das wirkt wie DDT. Davon fallen dir nicht nur die Haare aus, davon fällt dir alles ab.«
Erkan begann seinen Bart zu trimmen, kämmte, glich die Seiten aus und kontrollierte den Anblick im Spiegel.
»Dabei kannst du nur von Glück reden, mit deinem Bartwuchs. Was meinst du, wie viele Männer mit Problembärten hier sitzen, erst gestern dein ehemaliger Kollege von FAKT.«
Wieneke richtete sich kurz auf. »Wer?«
»Na, dieser Lohmeyer.«
Ach, Lohmeyer, der alte Schleimer. Chef vom Dienst. Gott, wie weit weg das alles war.
»Was der für Löcher in seinem Bart hat, kannst du dir nicht vorstellen. Da ist nix zu kaschieren. Ein Riesenloch auf der Oberlippe direkt unter der Nase, und die Unterlippe sieht auch scheiße aus. Er hat alles versucht, Knoblauch mit heißer Butter, Hautarzt, Joggen, nichts hilft.«
Tja, man konnte nicht alles haben. Eine feste Stelle bei FAKT und einen Bart ohne Löcher. Erkan hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, welch Potenzial in seinen Haarwurzeln schlummerte. Testosteron pur. Und ein Wunder der Natur dazu, denn sein Schädel war blank. Und da kam auch nichts mehr nach. Aber was ihm oben fehlte, wuchs unten: In nur drei Monaten war Wieneke ein Vollbart gewachsen, kein Ziegenbärtchen, kein Ludenbart, kein Henri-Quatre-Schwuchtelbärtchen, sondern ein Eins-a-Vollbart. Nur Francesca hatte wieder mal was zu meckern gehabt: Mit seiner Glatze und dem Vollbart sehe er aus wie ein albanischer Türsteher. Eifersucht, nichts anderes. Denn seitdem Wieneke Bart trug, schauten die Frauen ihn anders an.
»Ein Bart, das heißt: Du darfst hart sein und schmutzig«, hatte Erkan erklärt. Sein Eimsbütteler Friseursalon glich neuerdings nicht mehr einer Kifferhöhle in Istanbul, sondern wollte ein Barbershop in Little Italy sein. Zu Zeiten von Lucky Luciano. Keine Wasserpfeifen mehr, keine glitzernden Ansichten der Hagia Sophia, stattdessen antike Friseurstühle aus Wurzelholz, Friseurkommoden aus den dreißiger Jahren, abgegriffene Playboy-Hefte (Sammlerstücke, behauptete Erkan) und blinde Spiegel, die irgendein anatolischer Onkel in seinem Keller liegen gehabt hatte. An der Wand vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos von Herrenfrisuren mit viel Pomade, auf dem Boden schwarz-weiße Fliesen. Alles voll retro. Nur die Preise nicht. Die hatten sich verdoppelt.
Trimmen zehn Euro, Trimmen plus Rasur dreißig Euro, was bei Wienekes außergewöhnlichem Bartwuchs zu einem Kostenfaktor geworden war. An seinem letzten Artikel hatte er drei Tage gefummelt und ganze dreihundert Euro verdient.
Er arbeitete praktisch für seinen Bart.
Und deshalb war er das letzte Mal zu einem anderen Friseur gegangen, aber da hatte man ihn in einen pinkfarbenen Kittel gezwängt und neben Frauen gesetzt, die Tonnen von Alufolie auf dem Kopf trugen. Von dem Geruch des Wasserstoffperoxyds wäre er fast ohnmächtig geworden. Reumütige Rückkehr zu Erkan. Und zu den Männern mit den Problembärten.
Erkan zwirbelte mit einem Faden in seinem Gesicht herum, eine speziell anatolische Technik, um einzelne Haare aus dem Gesicht zu zupfen. Dann wickelte er etwas Watte um ein Holzstäbchen, tränkte es mit Spiritus, zündete die Watte an und strich damit an Wienekes Ohr entlang, um die kleinen Härchen abzufackeln. Wieneke erstarrte und wagte nicht zu protestieren. Zum Schluss legte ihm Erkan ein heißes feuchtes Tuch auf das Gesicht. Zur Entspannung.
Und als Wieneke ihm so ausgeliefert dalag, hörte er, wie die Tür aufging und jemand »Guten Tag, Erkan, hätten Sie Zeit für mich zwischendurch?« rief. Es war nicht zu fassen. Diese Kastratenstimme. Tillmann. Sein alter Chefredakteur. Ließ der sich jetzt etwa auch einen Bart stehen?
Und schon wanzte sich Erkan an Tillmann heran: »Aber für Sie doch immer.«
Wieneke wagte kaum zu atmen. Bei seiner letzten Begegnung mit Tillmann war er kurz davor gewesen, ihm auf den Schreibtisch zu pinkeln. Auf seine der Größe nach geordneten Bleistifte. Auf seine Unterschriftenmappe. In seinen Kamillentee. Stattdessen hatte er gekündigt. Mitten in der Medienkrise. Ja, ihr Weicheier da draußen: Noch nie versucht, mal antizyklisch zu leben?
Aber warum zum Teufel musste der Sack jetzt hier aufkreuzen? Wieneke fiel ein, dass seine Kuriertasche neben ihm stand. Mit dem FAKT-Logo. Die hatte er aus reiner Anhänglichkeit nicht weggeworfen. Er versuchte, sie mit dem Fuß zu erreichen, um sie weiter unter den Frisiertisch zu schieben, kam aber nicht an sie heran. Er rutschte noch tiefer in seinen Frisierstuhl und stellte sich tot. Vielleicht ging es ja schnell bei Tillmann, vielleicht wollte er sich nur ein paar Haare von den Ohren abflammen lassen.
Erkan schlug Schaum. Aus der Rasierseife.
»Alles bestens bei FAKT?«, fragte er, ganz die alte türkische Honigbiene.
Der Frisierstuhl ächzte unter Tillmanns Gewicht.
»Ach, wir können uns nicht beklagen, unsere Zahlen sind gut. Was mich viel mehr bedrückt, ist der Vertrauensverlust der Menschen gegenüber seriösen Medien.«
Natürlich genoss einer wie Tillmann nicht einfach seinen Erfolg. Nein, er grämte sich um die Branche.
»Verschwörungstheorien verdrängen seriösen Journalismus«, sagte Tillmann. »Und das, obwohl die deutschen Medien zu den besten der Welt gehören. Und zu den unabhängigsten.«
Erkan, der außer seiner türkischen Sportzeitung Fanatik online gar nichts las, in dem kein Funke Moral steckte, dem Rassismus, Islamismus, Klimawandel, Globalisierung und die Medienkrise scheißegal waren, weil es ihm nur um Rasieren und Trimmen, Waschen und Legen ging, sagte: »Ja, das ist wirklich erschreckend.«
Wieneke schnaufte unter seinem Tuch.
»Versteh mich nicht falsch, natürlich begrüße auch ich es, wenn sich Menschen über Plattformen im Internet Gehör verschaffen. Aber uns Journalisten zu unterstellen, wir würden Nachrichten unterdrücken, ist bösartig.«
Das feuchte Tuch auf Wienekes Gesicht wurde langsam kalt. Diesem Sackgesicht bei seinem Wort zum Sonntag zuhören zu müssen, hatte ihm gerade noch gefehlt. Wer kroch denn jedem Unternehmer in den Arsch? Wer ließ sich denn auf Segeljachten mitnehmen?
»Meinungsfreiheit ist doch keine Lizenz, andere Menschen an den Pranger zu stellen. Nein, mein lieber Erkan, ich lasse nicht zu, dass unsere Integrität infrage gestellt wird.«
Beim Wort »Integrität« riss sich Wieneke das Tuch vom Gesicht und sprang von seinem Stuhl auf. Erschrocken richtete sich Tillmann auf. Erkan wäre fast das Rasiermesser aus der Hand gefallen.
»Ach, Wieneke«, sagte Tillmann, nachdem er sich wieder gefasst hatte. »Ich hätte Sie fast nicht erkannt, mit diesem Bart.«
»Oh, Wiwi, sorry, ich hatte dich vergessen«, stammelte Erkan.
»Kein Problem, ich hab’s nur etwas eilig, ich habe noch einen Termin.«
Wieneke ging zur Kasse und suchte in seiner Brieftasche nach Geld. Hatte er nicht gestern erst hundert Euro abgehoben? Er blätterte in zerknitterten Taxiquittungen, Tankbelegen, Restaurantrechnungen. Belege für Briefmarken, Bücher, Batterien. Den Papierkram hatte er unterschätzt, als er sich dazu entschlossen hatte, frei zu arbeiten. Diese Sammelwut, der er sich neuerdings zu unterwerfen hatte, war erniedrigend. Andererseits konnte er es sich nicht leisten, seine mühsam erschriebenen Kröten dem Fiskus in den Rachen zu werfen. Kleinvieh macht auch Mist. Die Quittung für das Parfüm für Francesca konnte er als Geschenk an einen Geschäftsfreund absetzen. Neuerdings konnte er sogar Staubsaugerbeutel, Wischtücher und Haushaltsreiniger einreichen. Betriebsausgaben für sein Arbeitszimmer. Aber wo zum Teufel waren die hundert Euro geblieben?
Während Wieneke in seiner Brieftasche kramte, rief Tillmann aus dem Hintergrund: »Und wie läuft das Geschäft so als Freier?«
»Kann mich nicht beschweren«, stieß Wieneke mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Mit der EC