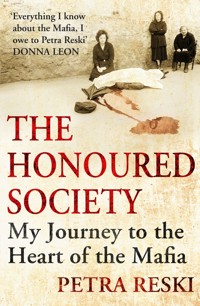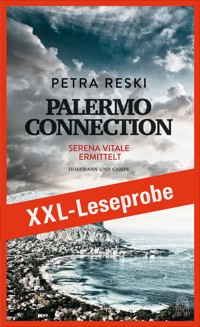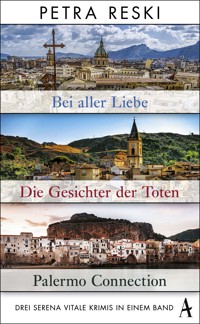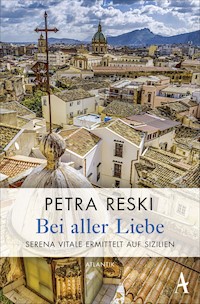9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
»Petra Reski verdanke ich meine grenzenlose Begeisterung für Venedig. Ihr Blick auf die Stadt ist kenntnisreich, leidenschaftlich, kritisch, humorvoll. Niemand hätte mir dieses Wunder besser näherbringen können als sie.« Joachim Król »Ihr Buch macht Lust auf einen Aufenthalt und eben nicht bloß auf eine Stippvisite; und es sensibilisiert einen zugleich dafür, welchen Einfluss man als Tourist hat.« Süddeutsche Zeitung Ein authentischer Erfahrungsbericht aus dem Sehnsuchtsort Venedig für alle Liebhaberinnen und Liebhaber der Lagunenstadt In ihrem Sachbuch wirft Petra Reski einen wehmütigen Blick hinter die Kulissen Venedigs und erzählt, wie es ist, in einer Stadt zu leben, die von aller Welt zu Tode geliebt wird. Petra Reski, die seit den Neunzigern in Venedig lebt und die Stadt kennt wie keine Zweite, erzählt so atmosphärisch wie schonungslos vom Leben in Venedig. Einst hat sie ihr Herz an einen Venezianer verloren – längst hat sie sich in dessen Heimat-Stadt verliebt. Doch Kreuzfahrt-Tourismus, Immobilien-Spekulation und gewissenlose Bürgermeister setzen der Stadt zu. Petra Reski kennt sie noch, die alten Venezianer und die Geheimnisse dieser Stadt: den Fischer, der Opern-Arien schmettert. Den Conte, der gegen Gondel-Serenaden kämpft. Den Gemüse-Händler, der inmitten von Touristen-Strömen um seine Existenz bangt. Sie zeichnet ein wehmütiges Bild von Venedig, dessen Ausverkauf an den reinen Kommerz beschlossene Sache zu sein scheint. Ihr Buch ist ein leidenschaftlicher Erfahrungsbericht aus dem Sehnsuchtsort Venedig – der faszinierendsten Stadt der Welt. Petra Reski wurde im Ruhrgebiet geboren. Nach dem Studium besuchte sie die Henri-Nannen-Schule und arbeitete als Redakteurin beim Stern, bevor sie in Venedig ihr Herz verlor. Seit 1991 schreibt sie von dort aus Romane, Sachbücher und Reportagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Petra Reski
Als ich einmal in den Canal Grande fiel
Vom Leben in Venedig
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Von Touristen überrannt, vom Hochwasser bedroht – und dennoch die schönste Stadt der Welt: Petra Reski, die seit den Neunzigern in der Lagunenstadt lebt und sie kennt wie keine Zweite, erzählt so atmosphärisch wie schonungslos vom Leben in Venedig. Einst hat sie ihr Herz an einen Venezianer verloren – längst hat sie sich in dessen Heimatstadt verliebt. Doch Kreuzfahrttourismus, Immobilienspekulation und gewissenlose Bürgermeister setzen der Stadt zu. Petra Reski kennt sie noch, die alten Venezianer und die Geheimnisse dieser Stadt, sie zeichnet ein wehmütiges Bild von Venedig, dessen Untergang es unbedingt zu verhindern gilt.
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Karten
San Piero
Santa Maria del Giglio
San Fantin
Martini-Bar
Calle Vallaresso
San Marco
San Moisè
Calle dei Assassini
Calle della Mandola
Canale della Giudecca
Canal Grande
San Servolo – San Clemente
Sacca Sessola – Poveglia
Ponte Calatrava
Ca’ Farsetti
Ruhrgebiet
Dorsoduro
Palazzo Pesaro degli Orfei
Palazzo Ducale
Mestre
Kamen
Hawaii
Veniceland
Teatro Goldoni
Campo Santi Giovanni e Paolo
Ospedale Civile
San Michele
Piazza San Marco
Aqua granda
Resistere, resistere, resistere
Bocca di Porto di Lido
Laguna ferita
Sabbadino
Markusdom
Corona
Rio Rossini
Parco Savorgnan
Ponte della Libertà
Nachwort zur Taschenbuchausgabe
Weiterführende Links
Wenn die Bilder der Erinnerung erst einmal in Worte gefasst sind, erlöschen sie, sagte Polo. Vielleicht fürchte ich, das ganze Venedig auf einmal zu verlieren, wenn ich davon spreche. Oder vielleicht habe ich es, während ich von anderen Städten sprach, bereits nach und nach verloren.
Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte
Für Lino
Karten
San Piero
Als ich mit meinem Boot durch den Kanal von San Pietro fahre, rufe ich ihn mal wieder an, weil ich eine kleine Runde mit ihm machen will.
Alberto ist Fischer, er lebt auf San Pietro di Castello, genauer gesagt auf San Piero, so heißt es in Venedig, wo man es liebt, die Konsonanten zu verschleifen. San Piero ist diese kleine Insel, die man erreicht, wenn man die Via Garibaldi bis zum Ende läuft und dann die Holzbrücke überquert. Oder, wie ich heute sagen würde: An San Piero kommt man vorbei, wenn man vom Markusbecken kurz vor Sant’Elena in den Rio dei Giardini einbiegt und dann nach dem Rio di Quintavalle geradeaus weiterfährt.
Seitdem ich Boot fahre, una topetta, eine kleine Ratte, wie man das typisch venezianische Fischerboot hier nennt, treibt mich die Geltungssucht eines Kindes, das gerade gelernt hat, Fahrrad zu fahren: Ich platze vor Stolz und vor Mitteilungsdrang. Nachdem ich mein Leben in Venedig bis vor Kurzem in dem würdelosen Zustand einer Fußgängerin verbringen musste, bin ich endlich in der venezianischen Evolutionsleiter aufgestiegen. Seit dem ersten Tag am Steuer meiner topetta ist mein Leben ein anderes: Ich muss nicht mehr permesso, permesso! flehen, um mir den Weg durch die millionste Reisegruppe zu bahnen; ich fahre an ihr vorbei.
Deshalb kann ich es kaum erwarten, Alberto sein Ciao amore schmettern zu hören, um mich als eine darzustellen, die sich am Steuerhebel ihres kleinen Fischerboots furchtlos nicht nur den Gezeiten und dem Wellengang entgegenwirft, sondern auch Autofähren, Vaporetti und Kreuzfahrtschiffen von der Größe eines Wohnblocks.
Wer wenn nicht Alberto könnte verstehen, dass ich zu meinem Boot eine Beziehung entwickelt habe wie Männer zu ihren Autos? Ich wienere daran herum, bis ich mich vor mir selbst erschrecke. Und fühle mich schuldig, wenn ich Venedig verlasse, und sei es nur für ein Wochenende: Wenn ich am Anleger stehe, auf das Vaporetto warte und mein Boot vor mir liegen sehe, allein, irgendwie im Stich gelassen, habe ich das Gefühl, als würde es mir einen traurigen Blick zuwerfen, so wie ein Hund, den man beim Dogsitter abliefert.
Alberto wäre auch der Einzige, der nachvollziehen könnte, wie ich mich neulich gefühlt habe, als ich aus der Lagune zurückkehrte und bei spiegelglatt daliegendem Wasser wie von unsichtbarer Hand gezogen kurz vor San Piero fast gegen die Mauer des Arsenale geknallt wäre, weil sich eine unheimliche Unterströmung meiner bemächtigt hatte. Er würde auch verstehen, dass ich unweit der Giardini versucht habe, um die Ecke zu biegen und gleichzeitig meiner Reinigungsfrau zuzuwinken, die auf dem Ufer neben dem Kanal vorbeilief. Woraufhin ich etwas unelegant an den im Kanal angelegten Booten entlanggeschrappt bin.
Normalerweise ist die Rollenverteilung zwischen Alberto und mir umgekehrt: Er ist es, der am Steuerhebel sitzt und mich mitnimmt. Alberto hat sein halbes Leben auf der Lagune verbracht, wo er sich ohne Kompass zurechtfindet, weil er die Richtung aus den Wellen und dem Wind liest. Je nachdem, ob die Wellen kurz und gerollt oder lang und gerade sind, ob er den Wind hinter den Ohren hat oder ob er ihm vor der Stirn steht, weiß Alberto, ob es die Bora aus Nordosten ist oder der Garbin aus Südwesten, der den Nebel bringt.
Ich lerne Alberto an einem Tag kennen, an dem ich mit einem Fotografen durch Venedig laufe, den ich nicht leiden kann. Als wir San Piero betreten, bleibe ich wie erstarrt stehen: Im Schatten vor dem Campanile sitzt ein Mann und flickt seine Netze. Ich traue meinen Augen nicht und denke: Das kann nicht wahr sein. Die Lagune ist doch nur eine Dekoration, hier fischt doch keiner mehr in echt. Die Fische kommen aus dem Atlantik und vom Fischmarkt in Chioggia.
Das Stühlchen, auf dem der Mann sitzt, verschwindet fast komplett unter seinen Hinterbacken, sein Netz hat er wie einen glitzernden Umhang auf einen vor ihm stehenden Stuhl drapiert. Neben ihm ein verrosteter, vom Salzwasser verkrusteter Einkaufswagen und ein Gettoblaster, aus dem Opernarien ertönen.
Ich blicke zu dem Fotografen, er macht sich mit einem Wildledertuch an seinen Linsen zu schaffen und sieht nichts.
Als ich mich nähere, fragt der Mann: Wie heißt du?, so wie Kinder, wenn sie sich kennenlernen.
Mi chiamo Alberto, sagt er, reicht mir die Hand, ruft: Manon!, deutet auf den Gettoblaster und sagt: Manon von Massenet! Nicht zu verwechseln mit Manon Lescaut von Puccini! Und dann singt er mit, auf Französisch, und der Campanile zittert ein bisschen, weil sein Gesang so gewaltig ist wie seine Hinterbacken.
Ich singe nur lyrischen Tenor!, sagt Alberto und gibt noch etwas Donizetti als Zugabe, bevor er sein Stühlchen und das Netz auf dem Einkaufswagen verkeilt und zurück nach Hause schiebt, während ich mich mit dem Fotografen zanke, weil er Alberto übersehen hat.
Alberto ist tatsächlich einer der letzten Fischer Venedigs. Er lebt mit seiner Frau in einem Kloster aus dem 15. Jahrhundert. Es wurde unter Napoleon in eine Kaserne verwandelt, an die militärische Vergangenheit erinnert noch eine verblasste faschistische Inschrift über dem Klostergang: Credere, obbedire, combattere – Glauben, gehorchen, kämpfen.
Nach den Faschisten kam die englische Kavallerie, danach kamen die Flüchtlinge aus Istrien und schließlich Alberto und seine Frau: Ihre Wohnung besteht im Wesentlichen aus einem langen, schmalen Flur mit winzigen Zimmern, ehemalige Mönchszellen, aus denen die Wände herausgebrochen wurden. Zwanzig Familien wohnen hier, aber es ist so, als würde nur Alberto in diesem Kloster leben. Im Refektorium hat er seine Netze und Reusen und Bojen gelagert, ein Horror Vacui aus aufgerollten Trossen und Schleppleinen, aus bunten Schnüren, Ankern und algengrünen Fischernetzen, aus Korkschwimmern und verrosteten Netzgewichten – im Klosterkapitel liegen Teile seines alten Fischerboots: ein Lagerraum, der jederzeit als Installation der Biennale durchgehen könnte.
Dass sich seine Sozialwohnung in einem entweihten venezianischen Kloster befindet, betrachtet Alberto einerseits als Fügung, andererseits als himmlische Hinterhältigkeit, weil es ihn an einen schweren Schicksalsschlag erinnert: Nach dem Tod seines Vaters entschied sich Albertos Mutter für die radikale Hinwendung zu Gott und trat in ein Klausurkloster ein. Erst zwanzig Jahre nach ihrem Klostereintritt durfte Alberto sie zum ersten Mal besuchen. Er weinte, weil er sie nicht umarmen durfte und auch ihr Gesicht nicht sah, weil sie hinter den Gittern des Besuchszimmers saß. Sie war nicht mehr seine Mutter, sie hieß jetzt Suor Camilla. Wenn er darüber spricht, weint er noch heute.
Ja, alles etwas hinfällig hier, sagt Alberto immer, meine Kinder wollen in solchen Wohnungen nicht mehr leben, meine Tochter ist nach Mestre gezogen und mein Sohn auf den Lido. Sie wollen modern sein, mit dem Auto vor der Haustür.
Für Alberto und mich ist unsere Begegnung im Schatten des Campanile der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Mit ihm lerne ich die Lagune kennen, er sitzt am Heck seines Boots, gewaltig und tätowiert, und schreit gegen den Wind und die Wellen an. Und lobt mich mit einem Brava!, wenn ich die Inseln schon von Weitem an ihrer Form erkenne. Wenn Sardinenschwärme silbrig glitzernd aus dem Wasser springen, ruft er: Das hier ist der Bauch von Venedig!, und wenn Motorboote in James-Bond-Manier an uns vorbeirasen und ihre gewaltigen Bugwellen sein Boot fast zum Kentern bringen, brüllt Alberto ihnen nach: Geld, Geld, Geld!, weil die Inseln der venezianischen Lagune inzwischen auch zu Spekulationsobjekten verkommen sind.
Dank Alberto weiß ich, dass die Seebarsche zum überwintern an die kroatische Küste wandern, weil die Lagune dann zu kalt ist. Dank ihm weiß ich, dass auf Sant’Erasmo früher vor allem die Glasbläser von Murano wohnten, die sich auf ihren Artischockenfeldern von der Arbeit in dem Höllenschlund erholten: Männer, die es immer in den Knien hatten, so wie sein Freund Renato, zwischen dessen Gemüsefeldern wir uns von den Mücken zerstechen lassen und Prosecco trinken. Prosecco, der leicht nach Salz schmeckt, wie alles, das auf Sant’Erasmo angebaut wird.
Dank Alberto weiß ich, dass es auf der Insel Vignole früher eine vollbusige Wirtin gab, die ihrem Mann unendlich viele Hörner aufgesetzt hat. Mit Alberto stolpere ich auf Certosa zwischen Ziegen, Verschanzungen und Mordgruben durch die kriegerische Vergangenheit der Insel, mit Alberto fahre ich auf Inseln für Pestkranke, für Seeleute mit Syphilis und für Verrückte und weiß, dass in seiner breiten Brust ein sentimentales Herz schlägt.
Alberto wäre gerne lyrischer Tenor geworden, wenn ihn seine Gesangslehrerin auf der Giudecca nicht nach der ersten Stunde wieder hinausgeworfen hätte. Er ist ein Mann, der den Barockkomponisten Albinoni verehrt, wegen der Melancholie, des größten aller Gefühle, wie er meint. Denn ungeachtet seiner Statur ist Alberto ein sensibler Mensch, der das Meer und Kafka liebt und Sätze sagt wie: Seitdem ich Der Prozess gelesen habe, fehlt mir in der Literatur das Salz. Gegen Kafka sind alle anderen Schriftsteller wie tiefgekühlter Fisch!
Alberto, der es gewohnt ist, gegen das Meer anzubrüllen, singt im Boot auch schon mal die Kriegshymne von San Marco: Le glorie del nostro leon – am liebsten, wenn wir durch den Kanal neben dem Arsenale fahren, wo es schön hallt, wenn sein Gesang gegen die Mauer fällt.
Alberto singt auch auf Festen, nie aber bei Gondelserenaden: Serenadensänger sind wie Nutten, sagt er. Je früher du sie aus der Gondel wirfst, desto besser.
Er hat auch auf meinen Geburtstagsfesten gesungen und bei unserer Hochzeit sogar stehend auf den Stufen der Fenice-Oper, die Touristen starrten ihn an wie eine Erscheinung: Ein Mann mit Armen wie Baumstämme, tätowierte Baumstämme, die er schwang, als er Nessun dorma! Nessun dorma! Tu pure, o Principessa sang. Er donnerte seine Botschaft so überzeugend in die Welt – Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò! –, dass selbst hart gesottene Venedig-in-zwei-Stunden-Kreuzfahrttouristen wie vom Blitz getroffen stehen blieben.
Jedes Mal, wenn wir uns hören, sagt Alberto: Ciao amore!, nur einmal hat er sich ungewöhnlich einsilbig gezeigt. Da war ich auch mit dem Boot unterwegs, im Kanal kurz vor San Piero, und wollte ihn zu einer kleinen Runde in der topetta einladen.
Als ich ihn anrief, klang Alberto verschlafen, an sich nichts Ungewöhnliches, er steht immer im Morgengrauen auf, um zum Fischen rauszufahren, weshalb er einen ausgiebigen Mittagsschlaf halten muss.
Alberto, ich habe jetzt ein Boot!, rief ich aufgeregt, aber er reagierte nicht.
Ich dachte, dass ich ihn aus dem Schlaf aufgeschreckt hatte, wahrscheinlich hatte er mich gar nicht richtig verstanden, deshalb beschloss ich, nicht weiter darauf zu bestehen, und sagte nur: Va bene, Alberto, ich rufe dich wieder an.
Vielleicht hatte er nachts gefischt, zusammen mit seinem Freund. Denn neuerdings ist Alberto nicht mehr allein in der Lagune unterwegs, seine Kinder und seine Frau haben darauf bestanden, dass er das Boot aufgibt, weil der Verkehr in der Lagune lebensgefährlich ist: Kürzlich wurden zwei Fischer von einem Jugendlichen in einem Motorboot überfahren, der in überschallgeschwindigkeit über sie hinweggerast ist. Einer der Fischer war auf der Stelle tot, der andere starb im Krankenhaus. Zur Erinnerung an dieses Unglück hängt ein blumengeschmücktes Tabernakel mit dem Foto der beiden Fischer an einer Dalbe vor der Insel Certosa. Es sieht aus wie ein Vogelhäuschen mit einem Kreuz auf dem Dach.
Alberto sei zu schwer und habe Schwierigkeiten, das Boot zu besteigen, meinen seine Kinder. Tatsache ist, dass Albertos Frau ausgezeichnet kocht, was sich langfristig negativ auf seine Figur ausgewirkt hat. Weil sich seine Kinder und seine Frau Sorgen machen, hat Alberto am Ende nachgegeben: Er hat mir schon oft erklärt, wie sinnlos es ist, gegen eine Frau zu rebellieren, die zwanzig Jahre lang mit ihm zusammen gefischt hat und in den Armen mehr Kraft hatte als er selbst, wenn sie die Netze hochzog. Meine Frau ist der Mann in der Familie!
Albertos Frau stammt aus Murano, wo sie als impiraresse gearbeitet hat, als Perlenauffädlerin – eine kunstfertige Arbeit, die sie auch heute noch macht: Sie hält eine Holzschale mit winzigen Perlen auf dem Schoß und fährt mit einer Art langstieligem Kamm in die Perlen, die auf den dünnen Zinken stecken bleiben und auf Fäden gezogen werden.
Auf vergilbten Fotos sieht man die Perlenauffädlerinnen vor den Haustüren in den venezianischen Gassen sitzen, die impiraresse war ein typischer Frauenberuf: schlecht bezahlt und wenig geachtet.
Die Frauen wurden ausgebeutet wie heute die Immigranten auf den Feldern, sagt Alberto immer.
Heute sind die impiraresse schon längst von Maschinen ersetzt worden, umso wertvoller ist mir die Kette, die Albertos Frau mir aufgefädelt und zum Geburtstag geschenkt hat. Sie sieht aus wie flüssiges Gold.
Dass seine Frau in seiner Ehe den Ton angeben würde, hat Alberto schon vor der Hochzeit zu spüren bekommen: Als sie sich kennenlernten, trug er auf dem Oberarm eine nackte Frau, die mit dem Busen wackelte, wenn er den Muskel anspannte. Bevor sie vor den Altar traten, musste Alberto sich einen Indianer daraus machen lassen.
Und deshalb leistet er auch keinen großen Widerstand, als seine Frau und seine Kinder von ihm verlangen, sein Boot aufzugeben. Was im Grunde einer Amputation gleichkommt. Die er nur überlebt hat, weil ihm ein Freund oft sein Boot überlässt. Albertos Frau muss ja nicht alles wissen.
Alle meine Abenteuer mit meiner topetta will ich Alberto erzählen, ich weiß, dass er mich lachend loben würde, und ich würde mich heldenhaft und noch etwas venezianischer fühlen. So, wie wenn wir am Ende einer Runde durch die Lagune am Dogenpalast vorbeifahren und auf die Menschenströme auf der Piazza blicken, die vom Wasser aus aussieht wie ein überfülltes Floß.
Das Leben in Venedig ist so, als ob man eine Frau liebte, die in Schwierigkeiten ist, sagt Alberto dann immer etwas rebellisch. Aber Liebe bedeutet auch, dass man Schwierigkeiten überwindet. Ich bin in Venedig geboren und werde hier auch sterben!
Als ich auf der Höhe von San Piero bin, rufe ich ihn an. Es klingelt ziemlich lange, bis er antwortet.
Ciao Alberto, rufe ich, willst du kurz runterkommen, ich will dir mein Boot zeigen!
Es dauert eine Weile, bis er antwortet.
Wie?, fragt er, was für ein Boot, wo bist du denn?
Ich bin hier unten, wenn du rauskommst, siehst du mich sofort!
Wo unten?, fragt Alberto ungläubig.
Hier unten vor deinem Haus, sage ich und frage mich, ob ich Alberto nicht schon wieder aus dem Mittagsschlaf aufgeschreckt habe.
In der Straße?, fragt Alberto, und ich frage mich, ob er nicht vielleicht schwer krank und durcheinander ist und ich das nur nicht wusste.
Was für eine Straße?, frage ich vorsichtig.
Aber ich bin … ich bin doch in Mestre.
Du bist in … Mestre?
Das kann nicht sein. Sicher habe ich mich verhört.
Wie: in Mestre?, frage ich ungläubig.
Wir sind umgezogen. Ich wohne nicht mehr auf San Piero. Wusstest du das nicht?
Alberto in Mestre, das kann nicht sein, er ist doch ein Lagunenfisch, un paganeo, un gò, einer, der ohne Wasser nicht überleben kann. Ich presse mir ein vernuscheltes Nein ab, so fassungslos bin ich.
Kurz herrscht Stille zwischen uns.
Die Frau bestimmt alles, du kennst das doch, sagt Alberto, wobei er klingt, als würde er nicht mit einer Frau, sondern mit einem Schicksalsgenossen reden. Einer, der auch von einer unerbittlichen Ehefrau gezwiebelt wird.
Du weißt doch, wie das ist, sagt er. Sie wollte nach Mestre … unsere Tochter wohnt hier … und dann sind da noch die Enkelkinder … und das Einkaufen ist so auch viel einfacher für meine Frau.
Ah, sage ich, mehr bringe ich nicht heraus, weil ich fast angefangen hätte zu heulen.
Und eure Wohnung? Habt ihr sie aufgegeben?, frage ich noch hoffnungsvoll, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Alberto ohne Netz und doppelten Boden nach Mestre gezogen ist, das mit seinen Mietskasernen und Hotelsilos aussieht wie eine Trabantenstadt aus Sowjetzeiten, die aus Versehen am Rand der Lagune fallen gelassen wurde.
Ja, natürlich, die Wohnung ist weg, sagt Alberto.
Ah, sage ich wieder und schlucke. Und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich suche nach einem Zuspruch. Irgendwas, womit ich Alberto trösten kann, wodurch ich diesem Umzug nach Mestre etwas abgewinnen kann. Aber mir fällt nichts ein.
Ach, dann hole ich dich demnächst mal an dem Piazzale Roma ab und wir machen eine Runde in meinem Boot, höre ich mich sagen. Und klinge falsch.
Aber Alberto sagt: Ja.
Bis bald, sage ich.
Ciao, sagt Alberto.
Ohne das amore am Ende.
Santa Maria del Giglio
Ich sitze in meinem Boot und bin noch betäubt von der Hiobsbotschaft, dass Alberto jetzt in Mestre in irgendeinem Plattenbau wohnt. Ausgerechnet er, der immer sagte: Venedig ohne die Lagune, das ist wie eine Frau ohne Unterleib.
Es ist Hochsommer in Venedig, voll besetzte Taxiboote mit lachenden Menschen fahren vorbei, Frauen mit riesigen Sonnenbrillen halten ihre Smartphones in die Luft, und ich fühle mich einsam.
Jeden Tag verlassen Venezianer ihre Stadt, der Exodus wird von der Leuchtanzeige im Schaufenster der Apotheke Morelli angezeigt. In Hongkong zählte man die letzten Tage als britische Kronkolonie, in Venedig zählt man die letzten Venezianer. Jeden Tag werden wir weniger, nie werden wir mehr. Mehr werden immer nur die Airbnbs, die Take-aways, die Kreuzfahrtschiffe, die Hotels, die Billigflüge und der Zynismus.
Es ist heiß, ich schwitze in der Sonne und ziehe die Plane über das Boot, ein Tropfen fällt von innen auf mein Brillenglas, aber es ist kein Schweiß. Ein Taxi voller Chinesen fährt vorbei, die Chinesen fotografieren mich.
Im Grunde interessiert Venedigs Schicksal niemanden auf der Welt. Nur die Fassade interessiert und die lustigen, netten Venedig-Tipps, wo essen, wo schlafen, wie die Schlange am Markusplatz vermeiden.
Die Venezianer sind so gut wie ausgestorben?
Sicher, hat man doch alles schon gehört, ist eben der Lauf der Welt. Berggorillas sterben aus und Spitzmaulnashörner und eben auch Venezianer. Früher war auch nicht alles besser! Andere Leute haben viel größere Sorgen, die werden vom Bürgerkrieg, von der Dürre oder irgendwelchen Diktatoren aus ihrer Heimat vertrieben, da fallen ein paar Venezianer echt nicht ins Gewicht.
Als ich auf die Gondelfähre warte, mit der ich auf die andere Seite des Canal Grande fahren will, drängelt sich eine Reisegruppe neben mich auf den Anleger. Die Männer tragen kurze Hosen, riesige Rucksäcke und Safarijacken, die aussehen, als seien sie speziell für Einsätze in subtropischen Gebieten gedacht. Die Frauen tragen Flipflops und kreischen, als die Gondel beim Einsteigen schwankt.
Und schon wieder muss ich an Alberto denken, wenn er sagte: Venedig ist eine Nutte. Eine ganz billige Nutte. Das sagte er, wenn mal wieder Leute vor seiner Haustür in San Pietro di Castello standen, die nicht begreifen wollten, dass dies zwar ein ehemaliges Kloster war, in dem er wohnte, aber dennoch eine Privatwohnung.
Dieses Problem wird sich in Mestre natürlich nicht mehr stellen.
Eine Frau steigt so ungeschickt in die Gondel am Anleger von Santa Maria del Giglio, dass sie fast ins Wasser fällt. Jemand schreit etwas vom »Tod in Venedig« und lacht. Der Tod klebt wie ein Kaugummi an der Stadt.
Und während ich wegen Alberto in Endzeitstimmung versinke, höre ich, wie jemand hinter mir Ciao Reski sagt. Es ist der Venezianer an meiner Seite, was mich tröstet. Er ist der Einzige hier ohne Rucksack und ohne Mineralwasserflasche in der Hand. Der Einzige, der ein Jackett und ein Hemd trägt. Als er die Gondolieri mit ihren Spitznamen anspricht und mit ihnen auf Venezianisch über das Hochwasser und den Schirokko redet, bestaunen ihn die Touristen wie ein seltenes Tier.
Genau so habe ich ihn damals bestaunt, als ich an einem kühlen Septembertag zum ersten Mal nach Venedig kam und von Venedig nicht viel mehr wusste, als dass es im Wasser lag.
Ich erzähle ihm, dass mein Freund Alberto jetzt in Mestre lebt.
Der Venezianer flucht. Er flucht wie jemand, der sieht, wie alle tatenlos dabei zusehen, als ein Wehrloser angegriffen wird. Er blickt mich traurig an, sagt: Das tut mir leid, und es klingt, als hätte er mir Beileid gewünscht.
Ich putze meine Nase, damit in der Gondel keiner mitkriegt, dass ich mitten auf dem Canal Grande zu heulen anfange. Ich trauere um Alberto, als wäre er gestorben, obwohl er nur nach Mestre gezogen ist.
Am Ufer angekommen, trennen sich unsere Wege wieder. Ich sehe den Venezianer in der Menge untertauchen.
Auf dem Weg zum Markusplatz gleitet er durch die Menschenmengen wie durch Fischschwärme, anders als ich regt er sich nie über die vielen fehlgeleiteten Fische auf, die uns anrempeln, er sieht sie gar nicht, er sieht immer nur außergewöhnliche Ornamente, Mauerbögen und Pilaster. Und den gläsernen Schirokkohimmel, der sich über allem wölbt, den sieht er auch.
San Fantin
Auf jeden Fall ist es schlecht, in einem Text über Venedig Touristen auftauchen zu lassen. Der Tourist will allein sein auf der Welt, das ist sein größtes Problem.
Ich kann das gut verstehen. Mir ging das genauso, als ich zum ersten Mal nach Venedig kam, vor einem halben Leben. Da legte auch ich großen Wert darauf, Venedig nicht als Touristin zu besuchen, sondern als Dienstreisende, weil ich während des Filmfestivals ein Interview mit Lina Wertmüller führen sollte. Das nie zustande kam. Den Markusplatz habe ich aus reinem Pflichtgefühl besucht. Nur, damit ich mir nicht hätte vorwerfen müssen, ihn übersehen zu haben.
Ich habe damals auch zwei Karnevalsmasken gekauft. Eine für mich und eine für eine Freundin, die darüber etwas erstaunt war, weil sie mir eine solche Schwäche nicht zugetraut hätte.
Wie zum Hohn fährt in diesem Augenblick im Kanal neben mir eine Gondelserenadepartie mit Japanern vorbei, die den letzten Rest fernöstlichen Formgefühls fahren lassen und wie entfesselt zu Ciao Venezia ciao ciao ciao johlen und schunkeln.
Ich lebe in einer Stadt, die unter der Liebe von mehr als dreißig Millionen Menschen pro Jahr leidet. Kein Grund zur Klage, werden Sie sagen, zu Recht, denn es gibt schlimmere Schicksale, Leukämie zum Beispiel oder Abhängigkeit von Lösungsmitteln oder ein Leben in der polaren Klimazone, wo nur bestimmte Flechtenarten eine überlebenschance haben.
Heute besteht das Leben in Venedig vor allem darin, einer Stadt beim Sterben zuzuschauen. Venedig ist im Locked-in-Syndrom gefangen: Der Tod tritt möglicherweise noch lange nicht ein, aber eine Aussicht auf Heilung besteht auch nicht mehr.
Wir sind Venedigs Sterbebegleiter, so wie die Bruderschaft der Gehenkten, die einst im Ateneo Veneto am Campo San Fantin ihren Sitz hatte, dessen Aula Magna mitsamt ihren Pilastern, Marmorkapitellen und Deckengemälden von Jacopo Palma dem Jüngeren auch heute noch so aussieht, als würden sich gleich die vermummten Brüder hier treffen – und nicht vielmehr venezianische Damen im Nerz, die sich einen Vortrag über den Einfluss von Venedig auf das Werk von Antonello da Messina anhören.
Manchmal, wenn aus dem Kanal unter unserem Fenster O sole mio dröhnt, in den Gondeln gegrölt und geklatscht, und auf der Brücke über dem Kanal den Gondelserenaden applaudiert wird, versuche ich, mir vorzustellen, wie sich vermummte Männer über diese Brücke einen Weg bahnen durch die fotografierenden und klatschenden Paare, Männer in schwarzen Umhängen und Kapuzen: Männer, deren Gesichter schwarz verhüllt sind, nur die Augen sind zu sehen; Männer, die auf der Brust ein ovales Medaillon mit einem Kruzifix tragen, in der einen Hand eine Geißel, in der anderen Hand das Bildnis des heiligen Hieronymus – die Kennzeichen des »Kollegiums der Gehenkten«, der Bruderschaft vom Campo San Fantin.
Die Scuola dei Picai, wie sie auf Venezianisch genannt wird, war in Venedig dafür berühmt, zum Tode Verurteilte auf ihrem letzten Weg zu begleiten, ihnen Trost zuzusprechen, bevor sie zwischen den Blutsäulen auf dem Markusplatz geköpft und ihre Körper danach gevierteilt wurden.
Die Bruderschaft machte sich in Zweierreihen auf den Weg ins Gefängnis, bis zu zweihundert Brüder mitsamt Fackeln, Kerzen, Standarten, Weihwasser, einem großen Kruzifix aus Ebenholz und einem kleinen, bronzenen Kruzifix, das der Hinrichtungskandidat küssen musste, bevor er den letzten Atemzug tat.
Die Prozession machte am Markusplatz halt, erst in der von Napoleon zerstörten Kirche von San Geminiano, dann in der Markuskirche. Und endete schließlich in einer kleinen Kirche hinter den Bleikammern, wo die Todeskandidaten die Tage von der Urteilsverkündung bis zur Hinrichtung verbrachten. Im günstigsten Fall begleitete die Bruderschaft den Verurteilten zum Schafott zwischen den beiden Säulen am Markusplatz. In weniger günstigen Fällen sah das Urteil noch vor der Hinrichtung einen langen Kreuzweg vor: Eine Via Crucis, die am Ufer der Piazzetta begann, wo der Verurteilte einen Kahn bestieg, an einen Pfahl gefesselt und über den Canal Grande zur Chiesa di Santa Croce gefahren wurde, wo man ihn mit glühenden Zangen folterte, dann wurden ihm die Hände amputiert und an Ketten um den Hals gehängt. Damit der Unglückliche nicht schon vor der Urteilsvollstreckung verblutete, wurde ihm eine Schweinsblase über die Armstümpfe gestreift – für solche Feinheiten war der Chirurg der Scuola San Fantin zuständig, der auch die Stelle an den Armen kennzeichnete, an der das Messer angesetzt wurde.
Zurück zum Galgen am Markusplatz ging es zu Fuß, wenn der Verurteilte nicht gar am Schweif eines Pferdes zum Markusplatz geschleift wurde, das Ganze begleitet von einem Ausrufer, der verkündete, für welches Verbrechen hier gebüßt wurde, während die Brüder von San Fantin um »ein Vaterunser, ein Ave Maria für unseren armen Bruder« baten.
Der letzte Akt wurde auf dem Markusplatz vollzogen, auf dem Schafott zwischen den beiden Säulen, den Hoheitszeichen der Stadt, dem geflügelten Markuslöwen und dem heiligen Theodor, dem Drachentöter, der aussieht, als führe er ein Krokodil an der Leine. Politischen Verbrechern oder manchen Adeligen widerfuhr das zweifelhafte Privileg, in der Galerie des Dogenpalastes zwischen den »Blutsäulen« hingerichtet zu werden, den beiden roten Säulen, zwischen denen der Doge gewöhnlich Aufführungen auf der Piazzetta beiwohnte. Gemeine Diebe wurden unweit der Stelle hingerichtet, an der sie den Diebstahl begangen hatten. Die Reste der gevierteilten Leiche wurden aufgespießt und zur Schau gestellt – wenn es das Urteil vorsah, sogar bis zur endgültigen Verwesung. Ansonsten sorgte die Bruderschaft dafür, dass die sterblichen überreste beerdigt wurden, auf dem kleinen Hinrichtungsfriedhof am Campo Santi Giovanni e Paolo oder auf dem auf der Isola Santa Maria delle Grazie. In der Basilika Santi Giovanni e Paolo erinnert noch heute eine marmorne Inschrift neben dem schwarzen Altar der Kruzifixkapelle an die armen Seelen, die von den Brüdern von San Fantin getröstet wurden. Da, wo sich einst der kleine Friedhof der Hingerichteten befand, ist heute ein gepflasterter Innenhof. Man kann ihn von der Rosenkranzkapelle aus sehen. Manchmal spielen die Kinder der Pfarrgemeinde hier Basketball.
Heute machen wir eigentlich nichts anderes als die Brüder von San Fantin – wir begleiten Venedig auf dem Weg zum Schafott. Und sprechen uns selbst dabei Trost zu.
Die Frage ist nur: Für welches Verbrechen muss Venedig büßen?
Martini-Bar
Als ich zum ersten Mal nach Venedig kam, wusste ich alles über Paris, aber nichts über Venedig. Ich kannte jedes Stadtviertel der Romane von Balzac, ich wusste, welche Entwicklung Paris nach Haussmann genommen hatte, wo sich die Passagen befanden, die Walter Benjamins Passagenwerk inspiriert hatten, und welche Funktion die topografischen Angaben in Emile Zolas Nana besaßen, über die ich meine Examensarbeit verfasst hatte.
Von Venedig wusste ich nicht mehr, als dass es im Wasser lag.
Ich trat aus dem Bahnhof, suchte nach einem Taxi und war erstaunt, dass man hier die Sache mit dem Wasser tatsächlich ernst meinte. Dass man konsequent auf Straßen verzichtet hatte, überraschte mich.
Als kleines Mädchen glaubte ich, dass Venedig von Doggen gegründet wurde. Kein Witz. Ich hatte ein Quartettspiel, bei dem eine Frage lautete: Wie heißt das Herrschergeschlecht in Venedig? Und die Antwort war: die Dogen.
Und ich dachte nur: Okay, warum auch nicht. In Rom war ja auch ein Hund im Spiel gewesen, diese Wölfin mit den Hängebrüsten.
Es war nicht vorauszusehen, dass mir im Restaurant ein Mann gegenübersitzen würde, der auch allein aß und in einem dicken Kunstband blätterte. Einen Mann, der mit einem Kunstband essen geht, fand ich sehr interessant. Konnte ja nicht ahnen, wohin das führt.
Nach dem Essen ließ mir der Mann mit dem Kunstbuch einen nach Marzipan schmeckenden Likör servieren, so kamen wir ins Gespräch. Er behauptete, mich bereits am Nachmittag in einem Café an der Riva degli Schiavoni gesehen zu haben, wo ich Postkarten geschrieben hätte.
Ich glaubte ihm nicht. Denn wie sollte man inmitten dieses Wimmelbilds aus Reisegruppen, Touristengeschwadern und durchgeknallten Schulklassenknäueln auf Abschlussfahrt einen einzelnen Menschen wahrnehmen und sich auch noch an ihn erinnern?
Er lügt, dachte ich. Aber er lügt schön.
Auf die Frage, wohin ich ginge und ob er mich begleiten dürfte, antwortete ich routiniert mit: Harry’s Bar.
Denn auch wenn sich meine Venedig-Kenntnisse auf jene eine Karte meines Quartettspiels beschränkten, wollte ich mit dem intendierten Besuch dieser Wallfahrtsstätte des Ruhms doch eine gewisse Weltläufigkeit beweisen. Auch wenn ich gar nicht wusste, wo sich dieser mythische Ort befand. Gott sei Dank wusste es der Mann mit dem Kunstbuch.
Als er die Tür von Harry’s Bar öffnete, wehte Zugluft über die Gäste – die nicht, wie ich angenommen hatte, an der Bar standen und Cocktails tranken, sondern auf Kinderstühlchen an Kindertischchen aßen. Und aus Kindergläsern tranken.
Die Einzigen, die an der Bar standen, waren wir. Und zu meinem großen Erstaunen musste ich feststellen, dass Harry’s Bar gar keine Bar war, sondern ein Restaurant. Mit kleinen Sesselchen, niedrigen Tischchen, zierlichem Besteck und winzigen Gläsern. Ein bisschen wie ein Kindergarten für Erwachsene. An den Wänden hingen Fotos mit gezacktem Rand, die aussahen wie alte Familienfotos und die anstelle von Verwandten Hemingway mit Cowboyhut auf Torcello zeigten oder eine lachende Peggy Guggenheim. Vielleicht lachte sie, weil es keinen anderen Ort auf der Welt gibt, der Menschen, die alles haben, dazu bringt, auf Kinderstühlchen an Kindertischchen zu essen.
Ich stellte fest, dass der Mann mit dem Kunstbuch für einen Italiener erstaunlich blass war und etwas Melancholisches in seinem Blick lag. Dass er bemerkenswert breite Handgelenke hatte und ihm eine dunkelbraune Haarsträhne in die Stirn fiel.
Vorsichtshalber unterzog ich ihn einem Verhör. Nicht, dass er dachte, eine ahnungslose deutsche Dienstreisende hereinlegen zu können.
Ich legte Wert darauf festzustellen, dass ich es mir nicht ausgesucht hatte, Venedig zu besuchen: Ich erklärte, dass mich meine Redaktion zum Filmfest nach Venedig beordert hatte, so wie sie mich zuvor auch zur Hochwasserkatastrophe des Nils nach Khartum, zu den Demonstrationen wegen der Schließung der Lenin-Werft nach Danzig und zum Bombenanschlag ins schottische Lockerbie verfügt hatte.
Ich fragte ihn, ob er Venezianer sei, was ich heute als etwas unhöflich empfinde. Da lernt man einen Mann kennen und fragt ihn nach seiner Abstammung? Wahrscheinlich lag es daran, dass ich schon damals immerhin mitgekriegt hatte, dass die Venezianer etwas Besonderes waren, weshalb ich vermutete, dass hinter seinem Namen wahrscheinlich jede Menge Vorfahren steckten, die unzählige Erdteile entdeckt, sagenhafte Seeschlachten geschlagen und ganze Flotten versenkt hatten.
Als ich wissen wollte, wo er wohnte, sagte er allen Ernstes: San Marco. Da war ich überzeugt, an einen besonders dreisten Lügner geraten zu sein. Schließlich wusste doch die Welt, dass am Markusplatz niemand wohnte. Andererseits geriet ich kurz ins Zweifeln, denn ich befand mich in einer Stadt, in der nicht mal die Himmelsrichtungen so funktionierten wie im Rest der Welt. Wasser statt Straßen, und alle sagten immer: Geradeaus!, wenn man nach dem Weg fragte, obwohl hier überhaupt nichts geradeaus ging.
Ich fragte ihn streng, ob er immer in Venedig gelebt habe. Denn was heißt schon Venezianer? Nicht, dass ich es am Ende mit einem verkappten Südtiroler zu tun hatte, der vorgestern nach Venedig gezogen war und sich jetzt als Venezianer tarnte. Als er mir lachend bestätigte, dass er praktisch von Geburt an Venezianer sei, wie seine Familie im übrigen auch, seit Hunderten von Jahren, lachte ich auch, wenn auch immer noch etwas ungläubig. Und in Venedig kenne jeder jeden, sagte er, weil hier nur noch eine Handvoll Venezianer lebten: Siamo solo quattro gatti, wir sind nur noch vier Katzen.
Unbeirrt von meinem Verhör lud er mich auf einen Drink in eine richtige Bar ein. Blindlings folgte ich ihm durch die Gassen. Es gefiel mir, mich für furchtlos zu halten.
Ich wäre ihm auf der Stelle bis ans Ende der Welt gefolgt, fragen Sie mich nicht, warum, vielleicht wegen der Haarsträhne, die ihm ins Gesicht fiel, und wegen des melancholischen Lächelns und seiner Handgelenke, die aussahen wie die eines Boxers.
Auf dem Weg zur Bar liege der Ort, an dem sich sein laboratorio befinde, sagte er. Er machte etwas mit Stoffen und Lampen, genau verstand ich es nicht, und was laboratorio hieß, wusste ich auch nicht, für mich klang es wie Chemielabor. Er sagte was von Fortuny, den ich nicht kannte, und erzählte was von Proust, den ich kannte, aber was genau zwischen Proust und diesem Fortuny lag, verstand ich nicht, gab jedoch vor, alles verstanden zu haben, immerhin war ich Romanistin, auch wenn ich von der Recherche nur Un amour de Swann gelesen hatte.
Er fragte mich, ob ich das laboratorio sehen wollte. Natürlich wollte ich es sehen, er führte mich in einen Palazzo, der eigentlich ein Künstleratelier war, ein verwunschener Ort, die Wände waren mit Samt und goldbedruckter Baumwolle geschmückt, in der Luft schwebten Seidenlampen, die aussahen wie Papierdrachen, die jemand dort vergessen hatte. überall bizarre Kostbarkeiten: Sarazenenschilder, orientalische Silbersandalen und Samurairüstungen.
Es war ein Ort, der aussah wie von jemandem geschaffen, der aus der Welt flüchten und ihr gleichzeitig voranschreiten wollte. Mit Samt bespannte Wände, erblindete Spiegel, Porträts irgendwelcher Sultane – eine Welt, die so anders war als alles, was ich bislang gesehen hatte.
Ich versuchte, mich unbeeindruckt zu geben, und lief zum Fenster, weil aus einer Gondel, die unten im Kanal vorbeifuhr, wie aus einer unermesslichen Ferne Gondola, gondola, gondolí schallte.
Ich seufzte.
Der Venezianer stand neben mir und seufzte ebenfalls. Er stand so nah neben mir, dass ich sein Rasierwasser riechen konnte. Er roch nach Sandelholz.
Hier singt man also tatsächlich in den Kanälen!, sagte ich, vom Sandelholzduft berauscht, und der Venezianer sagte resigniert: Eh sì.
Diese Musik hat etwas Fellineskes, bemerkte ich, aber der Mann entgegnete nichts, sondern verriegelte das Fenster und führte mich in die Martini-Bar. Es war ein Nachtlokal, das aussah wie die Hotelbars in Warschau kurz vor dem Fall der Mauer. Unter einer Discokugel kreiselte ein einsames Paar nach den Klängen eines elektrischen Klaviers. Wir tranken Champagner, erzählten uns unsere Leben, und der Venezianer strich mir das Haar aus dem Gesicht.
Ich hatte noch nie einen Mann getroffen, der mir das Haar aus dem Gesicht gestrichen hat.
Calle Vallaresso
Kurz nach dem Mauerfall zog ich nach Venedig, antizyklisch sozusagen, denn in der Zeit fing gerade der Berlin-Hype an, also Subkultur und cool und die Graffiti auf der Yorckbrücke und nicht etwa die leprösen Paläste, die schon der Futurist Marinetti verdammt hatte – samt den Gondeln, die er Schaukelstühle für Idioten nannte und die im Kanal unter unseren Fenstern vorbeigleiten, beladen mit Reisegruppen aus Minnesota oder Osaka, die zu Funiculi, Funicula mitklatschen und kreischen, als säßen sie in einer Achterbahn.
Man zieht nicht ungestraft in einen Mythos, sagte ich mir. Auch wenn ich das mit dem Mythos gar nicht so sah. Mir machte vor allem die Insellage zu schaffen. Und die Tatsache, dass die Venezianer nicht Italienisch, sondern Venezianisch sprechen, was ich für einen Sprachfehler hielt.
Ich mochte es nicht, wenn sie Venezianisch sprechen, weil ich mich dann ausgeschlossen fühlte. Automatisch hörte ich weg. Der Venezianer antwortete immer auf Italienisch, wenn ich dabei war und man ihn auf Venezianisch ansprach.
Es war die Zeit vor den Kreuzfahrtschiffen und vor den Billigflügen. Es war die Zeit der Busladungen voll mit dem ehemaligen Ostblock, der den Kommunismus abgeschüttelt hatte, um endlich mal Tauben auf dem Markusplatz füttern zu können.
Aber ab fünf Uhr nachmittags war der Zauber ungebrochen, man hörte wieder seine eigenen Schritte und die Schreie der Schwalben im Sturzflug. Im Caffè Florian saßen nach Veilchenpuder duftende venezianische Contessen, deren Beine so kurz waren, dass sie den Boden nicht berührten. Ein pensionierter venezianischer General mit schwarz gefärbtem Haar hielt an dem Tisch rechts vom Eingang Hof. Die Venezianer näherten sich ihm kratzfüßig und sprachen ihn mit Conte an, denn wenn es sich darum handelte, dem Sohn den Militärdienst zu ersparen, waren seine Beziehungen sehr wertvoll.
Jahrzehnte später erfahre ich, dass die Contessen gar keine waren, sondern die Töchter eines süditalienischen Schokoladenvertreters. Und dass der General weder Conte noch Venezianer war, sondern irgendwo aus dem Friaul kam. Aber das sind Geheimnisse, die nur die Venezianer kennen. Und in die werde ich erst eingeweiht, nachdem ich lange genug in Venedig gelebt und mich so als würdig erwiesen habe.
An die Contessen und den General denke ich jedes Mal, wenn ich über den Markusplatz laufe, wo am frühen Morgen alle auf der Suche nach ihrem persönlichen Stück Venedig sind: Derangierte chinesische Bräute mit verschmutzten Schleppen, die von ihren Fotografen im Morgenlicht über den Platz gescheucht werden. Straßenkehrer, die mit ihren Reisigbesen um Frauen herumfegen, die sich erst von ihren Stühlen erheben, nachdem die Besen über ihre Füße gefahren sind. Männer in Radlerhosen, die im Säulengang des Dogenpalastes schwitzend Liegestütze machen, beobachtet von staunenden Nonnen im Gegenlicht.
Das Problem ist, dass die Zeit so schnell vergeht. Denn eigentlich bin ich erst gestern hier angekommen, bei diesem gleißenden Morgenlicht, das mich auch jetzt blendet.
Ich denke oft daran, wie wir uns kennengelernt haben. Besonders häufig passiert mir das zur Zeit des Filmfests – wenn ich morgens zum Vaporetto renne, weil der erste Film in der Früh um halb neun beginnt. Dann laufe ich die Calle Vallaresso entlang, vorbei an dem Restaurant, in dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind und das heute kein Restaurant mehr ist, sondern ein Tiffany-Juwelier. Aber Harry’s Bar gibt es noch. Nahezu unverändert.
Ich renne, weil das Sieben-Uhr-neunundzwanzig-Vaporetto im Grunde schon um sieben Uhr fünfundzwanzig an- und wieder ablegt. Gott sei Dank ist die Calle Vallaresso um diese Zeit noch leer, neben mir laufen nur zwei Amerikaner, die in Funktionshemden und Funktionsshorts ihr vom Computer verordnetes Laufprogramm absolvieren.
Um sieben Uhr dreiundzwanzig sitze ich schwer atmend an der Haltestelle San Marco. Außer mir wartet niemand auf das Vaporetto. Frühmorgens im Spätsommerlicht ist die Haltestelle San Marco die schönste Haltestelle der Welt, mit dem tiefblauen Markusbecken, dem Himmel in reinstem Azur und dem gleißenden Marmor der Punta della Dogana, des einstigen Zollgebäudes, das sich wie ein Schiffsbug zwischen Canal Grande und Canale della Giudecca schiebt. Auf dem Dach thront die Macht des Schicksals, mit der Göttin Fortuna, die auf der goldenen Weltkugel tanzt und sich in die Richtung dreht, in die sie der Wind weht.
Die Fenster der Vaporettostation rahmen diesen Anblick ein, mit dem verblassten Neonlicht und den abgetretenen Markierungen des Non oltrepassare durante l’attesa, dem »Nicht überschreiten während des Wartens«, das die Touristen nie begreifen, weshalb sie von den Vaporettoschaffnern immer angeblafft werden.