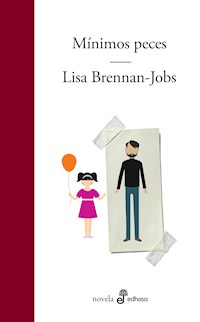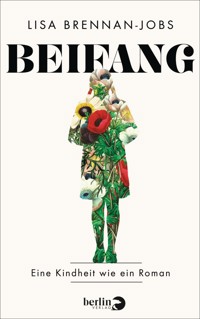
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
»Achtundzwanzig Prozent der männlichen Bevölkerung der USA könnten der Vater sein.« Das sagte Steve Jobs dem Time Magazine über seine Tochter Lisa. Für die Öffentlichkeit war er da schon ein Halbgott. Was bedeutet es, einen Vater zu haben, der lange nichts von einem wissen wollte? Behutsam nähert Lisa Brennan-Job sich dieser für sie brennenden Frage und versucht mit ihren Kindheitserinnerungen Antworten zu finden. Aber, anders als von vielen erhofft, ist es keine gehässige Abrechnung mit dem Apple-Guru geworden, sondern ein kluges und berührendes Buch über die Liebe zwischen Eltern und Kindern - allen Widrigkeiten zum Trotz. Lisa war das Ergebnis einer schon im Ansatz gescheiterten Liebe. Als die Studentin Chrisann Brennan schwanger wurde, hatte Steve Jobs hatte gerade das College geschmissen und schraubte in der berühmten Garage im Silicon Valley komische Kästen zusammen. Chrisann wollte Künstlerin werden und verließ den "Nerd" Steve. Diese Kränkung sollte er ihr - und auch Lisa - lange nicht verzeihen. Der Apple-Gründer bestritt die Vaterschaft, nannte aber gleichzeitig wohl einen seiner Computer nach ihr. Und das kleine Mädchen erlebte eine Kindheit der Extreme: Da war einerseits ihre Hippie-Mutter, die nicht einmal genug Geld für ein Sofa hatte, und andrerseits eben einer der reichsten und berühmtesten Männer der Welt … Herzzerreißend und komisch – eine Kindheit, die man so nie erfinden könnte. »Ein zauberhaftes, berührend intimes Porträt, eine Geschichte aus der Sicht einer Tochter, deren Vater mit seinen eigenen Wurzeln zu kämpfen hatte - und der doch beinahe zu dem Vater wurde, den sie sich gewünscht hätte.« ―Susan Cheever
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Für Bill
ISBN 978-3-8270-7959-6© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2018Covergestaltung: zero-media.net, München nach demEntwurf von Alison FornerCovermotiv: Getty Images/teobraga; Getty Images/nicoolayDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
INHALT
Einleitung
Hippies
Lebenslinien
Lassen wir’s krachen
Beifang
Ausreißer
Kleines Land
Vermarktbare Fähigkeiten
Fliehkraft
Koda
DRITTER FISCHER
Meister, wie können doch nur die Fische in der See leben?
ERSTER FISCHER. Nun! Eben so, wie die Menschen zu Lande; die Großen fressen die Kleinen. Unsre reichen Geizhälse kann ich mit nichts so gut, als mit einem Walfische vergleichen; der spielt und bäumt, und treibt die armen kleinen Fische vor sich her, bis er sie zuletzt all’ mit einem Schluck hinunterschlingt. Solche Walfische soll es auch auf dem Lande geben, die solange das Maul aufsperren, bis sie das ganze Kirchsprengel, Kirche, Glockenturm, Glocken und alles hinuntergeschluckt haben.
Shakespeare, Perikles (in der Übersetzung von Ludwig Tieck)
… es war sehr sonderbar, der unerkannte Ursprung dieser öffentlichen Attraktion zu sein und im Graupelregen zu stehen – man kam sich vor wie ein Phantom.
Saul Bellow, Humboldts Vermächtnis (in der Übersetzung von Eike Schönfeld)
Drei Monate vor seinem Tod begann ich, Sachen aus dem Haus meines Vaters zu stehlen. Ich lief barfuß umher und ließ Gegenstände in meinen Taschen verschwinden. Rouge, Zahnpasta, zwei leicht angestoßene, seladonblaue Fingerschalen, eine Flasche Nagellack, ein Paar abgetragene lederne Ballettschläppchen und vier vergilbte Kissenhüllen von der Farbe alter Zähne.
Nach jedem Diebstahl war etwas in mir gestillt. Ich versprach mir, dass es das letzte Mal gewesen sei. Doch der Drang, mir noch etwas zu nehmen, kam immer wieder wie Durst.
Auf Zehenspitzen ging ich ins Zimmer meines Vaters. Ich achtete darauf, an der Schwelle einen großen Schritt zu machen, um nicht auf die knarrende Diele zu treten. Als er noch Treppen steigen konnte, war dies sein Arbeitszimmer gewesen, jetzt stand hier sein Bett. Der Raum war vollgestopft mit Büchern, Briefen und Arzneimittelflaschen; Äpfeln aus Glas, Äpfeln aus Holz; Preisen, Zeitschriften, stapelweise Papier; gerahmten Drucken von Hasui, Zwielicht und Sonnenuntergänge an Tempeln. Auf die Wand neben ihm fiel ein Streifen rosa Licht.
Er trug Shorts und saß, an Kissen gelehnt, im Bett. Die Beine, nackt und so dünn wie Arme, waren angewinkelt wie die eines Grashüpfers.
»Hi, Lis«, sagte er.
Neben ihm stand Segyu Rinpoche. Er war in letzter Zeit oft da, wenn ich zu Besuch kam. Rinpoche, ein kleiner Brasilianer mit funkelnden braunen Augen und einer kratzigen Stimme, war ein buddhistischer Mönch mit brauner Kutte über dem runden Bauch. Wir nannten ihn bei seinem Titel. Tibetanische Heilige wurden heutzutage manchmal im Westen geboren, zum Beispiel in Brasilien. Mir kam er nicht sehr heilig vor – er war weder entrückt noch undurchschaubar. Neben uns summte ein schwarzer, leinener Nährstoffbeutel mit Motor und Pumpe; der Schlauch verschwand irgendwo unter der Bettwäsche meines Vaters.
»Es ist gut, seine Füße zu berühren«, sagte Rinpoche und legte die Hände um einen Fuß meines Vaters auf dem Bett. »So.«
Ich wusste nicht, ob das Füßeberühren für meinen Vater oder für mich gedacht war oder für uns beide.
»Okay«, sagte ich. Ich nahm den anderen Fuß in seiner dicken Socke, auch wenn das komisch war, und beobachtete ihn, denn wenn er vor Schmerz oder Wut das Gesicht verzog, sah es so ähnlich aus, wie wenn er anfing zu lächeln.
»Das ist schön«, sagte mein Vater und schloss die Augen. Ich schielte auf die Kommode neben ihm und zu den Regalen auf der anderen Seite des Zimmers, falls es dort etwas gab, das ich haben wollte, dabei wusste ich, dass ich es nicht wagen würde, in seiner Gegenwart zu stehlen.
Während er schlief, streifte ich durchs Haus – was ich suchte, war mir selbst nicht klar. Im Wohnzimmer saß eine Krankenschwester; die Hände im Schoß, horchte sie darauf, dass mein Vater nach ihr rief. Es war still im Haus, die Geräusche gedämpft, die weiß gestrichenen Backsteinwände knittrig wie Kissen. Der Terrakottaboden fühlte sich kühl unter meinen Füßen an, außer dort, wo die Sonne ihn auf Hauttemperatur erwärmt hatte.
Im kleinen Bad neben der Küche, in dem Schränkchen, wo früher immer ein zerfleddertes Exemplar der Bhagavadgita gestanden hatte, fand ich eine Flasche teures Rosengesichtsspray. Bei geschlossener Tür setzte ich mich, ohne das Licht einzuschalten, auf die Klobrille, sprühte in die Luft und machte die Augen zu. Das Spray nieselte auf mich herab, kühl und heilig, wie im Wald oder in einer alten Steinkirche.
Außerdem lag dort noch ein silberner Lipglossstift, der oben eine kleine Bürste und unten einen Drehmechanismus hatte, mit dem man die Flüssigkeit in die Bürstenmitte schieben konnte. Den musste ich haben. Ich steckte ihn ein, um ihn mit in die Einzimmerwohnung in Greenwich Village zu nehmen, wo ich mit meinem Freund zusammenlebte, denn mir war so klar, wie mir je irgendetwas klar gewesen war, dass dieser Lipgloss mein Leben vervollständigen würde. Weil ich der Haushälterin, meinem Bruder, meinen Schwestern und meiner Stiefmutter im Haus aus dem Weg gehen musste, um nicht beim Klauen erwischt zu werden, aber auch, weil es wehtat, wenn sie mich nicht wahrnahmen oder mein Hallo nicht erwiderten, und ich mich stattdessen auf der dunklen Toilette einsprühte, damit das Gefühl nachließ, dass ich nach und nach verschwand – denn in dem herabnieselnden Spray spürte ich wieder so etwas wie meine Konturen –, empfand ich es allmählich als anstrengend, ja lästig, meinen kranken Vater in seinem Zimmer zu besuchen.
Im zurückliegenden Jahr war ich etwa alle zwei Monate übers Wochenende bei ihm gewesen.
Die Hoffnung auf eine große Versöhnung, wie im Film, hatte ich aufgegeben, aber ich kam trotzdem immer wieder.
Zwischen den Besuchen sah ich meinen Vater überall in New York. Ich sah ihn im Kino sitzen, genau die gleiche Linie von Hals, Kiefer, Wangenknochen. Ich sah ihn, wenn ich im Winter am Hudson entlanglief, auf einer Bank sitzen und die Boote auf dem Dock betrachten, sah ihn auf dem Weg zur Arbeit in der Subway oder auf dem Bahnsteig, wenn ich durch das Gedränge davonging. Dünne Männer mit olivenfarbener Haut, feinen Fingern, schmalen Handgelenken, Stoppelbart, die aus bestimmten Blickwinkeln genauso aussahen wie er. Jedes Mal musste ich dann genauer hinschauen, und das Herz schlug mir bis zum Hals, obwohl ich wusste, dass er es unmöglich sein konnte, weil er ja in Kalifornien krank im Bett lag.
Davor, in den Jahren, als wir kaum miteinander redeten, hatte ich überall sein Foto gesehen. Es gab mir einen seltsamen Kick. Das Gefühl war so ähnlich, wie wenn ich mich in einem Spiegel auf der anderen Seite eines Raums entdeckte und dachte, es sei jemand anderes, bis ich merkte, dass es mein eigenes Gesicht war: Da war er, schaute aus Zeitschriften und Zeitungen und Bildschirmen heraus, egal, in welcher Stadt ich war. Das ist mein Vater, und niemand weiß es, aber es ist wahr.
Bevor ich mich verabschiedete, ging ich noch einmal auf die Toilette, um mich einzusprühen. Das Spray war naturbelassen, was zur Folge hatte, dass es binnen weniger Minuten nicht mehr scharf nach Rosen roch, sondern faulig und übel wie ein Sumpf, aber das wusste ich da noch nicht.
Als ich in sein Zimmer kam, wollte er gerade aufstehen. Ich sah zu, wie er mit einem Arm beide Beine umfasste, sich um neunzig Grad herumdrehte, indem er sich mit dem anderen Arm vom Kopfende abstieß, und dann mit beiden Armen die eigenen Beine über den Bettrand und auf den Boden drückte. Als wir uns umarmten, spürte ich seine Wirbel, seine Rippen. Er roch muffig, nach Medizinschweiß.
»Ich komme bald wieder«, sagte ich.
Wir ließen uns los, und ich ging zur Tür.
»Lis?«
»Ja?«
»Du riechst nach Klo.«
HIPPIES
Als ich sieben wurde, waren meine Mutter und ich schon dreizehnmal umgezogen.
Mal wohnten wir im möblierten Schlafzimmer einer Freundin, mal vorübergehend bei irgendwem zur Untermiete, immer inoffiziell. Die letzte Wohnsituation war ungeeignet geworden, als jemand ohne Vorwarnung den Kühlschrank verkauft hatte. Am nächsten Tag rief meine Mutter meinen Vater an, bat um mehr Geld, und er erhöhte die Unterhaltszahlungen um zweihundert Dollar pro Monat. Wir zogen erneut um, ins Erdgeschoss eines kleinen Gebäudes hinter einem Haus in der Channing Avenue in Palo Alto – es war das erste Mal, dass im Mietvertrag der Name meiner Mutter stand. Diese neue Wohnung war nur für uns.
Das vordere Haus war ein dunkelbraunes Craftsman mit staubbedecktem Efeu, wo Rasen hätte sein können, und zwei Buscheichen, die so krumm waren, dass ihre Zweige beinahe den Boden berührten. Zwischen den Bäumen und dem Efeu hingen Spinnennetze voller Pollen, die in der Sonne weiß leuchteten. Von der Straße aus war nicht zu sehen, dass sich hinter dem Haus ein Apartmentkomplex befand.
Vorher hatten wir in umliegenden Ortschaften gewohnt – Menlo Park, Los Altos, Portola Valley –, aber Palo Alto ist der Ort, den wir unser Zuhause nennen sollten.
Hier war der Boden schwarz, feucht und wohlriechend; unter den Steinen fand ich kleine rote Käfer, rosa- und aschefarbene Würmer, dünne Tausendfüßler und schieferfarbene Asseln, die sich zu gepanzerten Kugeln einrollten, wenn ich sie störte. Die Luft roch nach Eukalyptus und sonnenwarmer Erde, nach Feuchtigkeit und gemähtem Gras. Eisenbahngleise teilen die Stadt in zwei Hälften; nicht weit von ihnen liegt die Stanford University mit ihrem großen Rasenoval und der goldgeränderten Kapelle am Ende einer von Palmen gesäumten Straße.
Am Tag unseres Einzugs parkte meine Mutter den Wagen vor dem Haus, und wir trugen unsere Sachen hinein: Küchenutensilien, einen Futon, einen Schreibtisch, einen Schaukelstuhl, Lampen, Bücher. »Deshalb kriegen Nomaden nie was zustande«, sagte sie, als sie eine Kiste über die Schwelle schleppte. Ihre Haare waren zerzaust, ihre Hände mit weißer Grundierungsfarbe gesprenkelt. »Sie bleiben nicht lange genug an einem Ort, um irgendetwas Dauerhaftes aufzubauen.«
Das Wohnzimmer hatte Glasschiebetüren, durch die man auf eine kleine Terrasse trat. Hinter der Terrasse waren ein Stück Rasen aus trockenem Gras und Disteln, eine weitere Buscheiche und ein Feigenbaum – beide spindeldürr – sowie eine Reihe Bambus, den man, wie meine Mutter sagte, schwer wieder loswurde, wenn er erst einmal Wurzeln geschlagen hatte.
Als wir mit dem Ausladen fertig waren, stand sie mit den Händen in den Hüften da, und gemeinsam blickten wir uns im Zimmer um: Mit all unseren Habseligkeiten darin sah es immer noch leer aus.
Am nächsten Tag rief sie meinen Vater in seinem Büro an und bat ihn um Hilfe.
»Elaine kommt mit dem Transporter – wir fahren zum Haus deines Vaters und holen ein Sofa ab«, sagte meine Mutter ein paar Tage später. Mein Vater wohnte in Monte Sereno, einem Vorort von Saratoga, etwa eine halbe Stunde von uns entfernt. Ich war noch nie in seinem Haus gewesen und hatte auch noch nie von dem Ort gehört, wo er wohnte – ich war ihm erst ein paarmal begegnet.
Meine Mutter sagte, mein Vater habe ihr dieses Sofa angeboten, als sie ihn angerufen habe. Aber wenn wir es uns nicht bald holten, würde er es wegwerfen oder das Angebot zurückziehen, das sei ihr klar. Und wer wusste, wann wir das nächste Mal Zugriff auf Elaines Transporter hätten.
Ich ging in dieselbe Klasse wie Elaines Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Elaine war älter als meine Mutter und hatte welliges schwarzes Haar mit losen Strähnen, die bei gewissem Licht einen Heiligenschein um ihren Kopf herum schufen. Meine Mutter war jung, sensibel und schillernd, ohne Ehemann, Haus und Familie, die Vorzüge über die Elaine verfügte. Dafür hatte sie mich, und ich hatte zwei Aufgaben: erstens, sie zu beschützen, damit sie mich beschützen konnte; zweitens, sie zu formen und aufzurauen, damit sie mit der Welt zurechtkam, so wie man eine Oberfläche mit Sandpapier bearbeitet, damit die Farbe hält.
»Links oder rechts?«, fragte Elaine andauernd. Sie war in Eile, weil sie einen Arzttermin hatte. Meine Mutter ist Legasthenikerin, behauptete aber, das sei nicht der Grund, warum sie Landkarten scheue. Vielmehr trage sie die Karten in sich selbst und könne den Weg zu jedem Ort finden, wo sie je gewesen sei, selbst wenn ein paar Umwege nötig seien, bis sie sich orientiert habe. Aber wir verirrten uns oft.
»Links«, sagte sie. »Nein, rechts. Warte. Doch links.«
Elaine war leicht gereizt, aber meine Mutter entschuldigte sich nicht. Sie benahm sich, als wäre man auf Augenhöhe mit denen, die einen retten.
Die Sonne zeichnete mir Spitze auf die Beine. Die Luft war feucht und dick und kitzelte mich mit dem Geruch nach Gewürzlorbeer und Erde in der Nase.
Die Hügel in den Städten rund um Palo Alto waren durch Verschiebungen unter der Erde entstanden, dadurch, dass Platten sich aneinander rieben. »Wir müssen in der Nähe des Grabenbruchs sein«, sagte meine Mutter. »Wenn es jetzt ein Erdbeben gäbe, würden wir verschluckt werden.«
Wir fanden die richtige Straße und dann die baumbestandene Auffahrt mit einem Rasen am Ende – einem Kreis aus leuchtendem Gras, dessen dünne Halme aussahen, als würden sie sich weich unter meinen Füßen anfühlen. Das Haus war zwei Stockwerke hoch und hatte ein Giebeldach, dunkle Schindeln auf weißem Gipsverputz. Lange Fenster verbogen das Licht. So sahen die Häuser aus, die ich auf leere Seiten zeichnete.
Wir klingelten und warteten, aber niemand kam. Meine Mutter versuchte, die Tür zu öffnen.
»Abgeschlossen«, sagte sie. »Mist. Ich wette, er lässt sich nicht blicken.«
Sie ging ums Haus herum, prüfte die Fenster, die Hintertür. »Abgeschlossen!«, rief sie immer wieder. Ich war mir nicht so sicher, ob es wirklich sein Haus war.
Sie kam wieder nach vorne und sah zu den Schiebefenstern hinauf, zu hoch für sie. »Ich versuch’s mal mit denen«, sagte sie. Sie stieg auf einen Sprinklerkopf, dann auf ein Regenrohr, bekam die Kante eines Fenstersimses zu fassen und drückte sich flach an die Wand. Sie fand neue Tritte und Griffe, blickte hinauf, zog sich höher.
Elaine und ich sahen zu. Ich hatte panische Angst, dass sie abstürzen würde.
Mein Vater sollte eigentlich an die Tür kommen und uns hereinbitten. Vielleicht würde er uns noch weitere Möbel zeigen, die er nicht brauchte, und uns einladen wiederzukommen.
Stattdessen kletterte meine Mutter wie ein Dieb am Haus hoch.
»Lass uns lieber wegfahren«, rief ich. »Ich glaube, wir dürfen nicht hier sein.«
»Ich hoffe, es gibt keine Alarmanlage«, sagte sie.
Sie erreichte das Sims. Ich hielt die Luft an, wartete darauf, dass eine Sirene losheulen würde, doch der Tag blieb so still wie zuvor. Sie entriegelte das Fenster, das sich scharrend hoch- und aufschieben ließ, verschwand, Bein für Bein, drinnen und trat ein paar Sekunden später aus der Haustür in den Sonnenschein.
»Wir sind drinnen!«, sagte sie. Ich schaute durch die Tür: Holzböden, die das Licht reflektierten, hohe Zimmerdecken. Kühle, leere Räume. Ich verband ihn an dem Tag – und später – mit Lichtlachen, die durch große Fenster fielen, Schatten in der Tiefe von Räumen, den muffigen, süßen Gerüchen von Schimmel und Weihrauch.
Meine Mutter und Elaine trugen das Sofa, manövrierten es durch die Tür und die Treppe hinunter. »Es wiegt nicht viel«, sagte meine Mutter und bat mich, aus dem Weg zu gehen. Ein dickes geflochtenes Bastgestell mit Polstern aus grob gewebtem Leinen. Die Kissen waren cremefarben und mit leuchtenden Chintzblumen in Rot, Orange und Blau gesprenkelt, und jahrelang zupfte ich an den Rändern der Blütenblätter und versuchte, mit den Fingernägeln unter ihre gemalten Spitzen zu gelangen.
Elaine und meine Mutter bewegten sich schnell und ernst, so als wären sie wütend; meiner Mutter fiel eine Haarlocke aus dem Reif. Nachdem sie es hinten in den Transporter geschoben hatten, gingen sie wieder hinein und holten noch einen Sessel und einen Schemel heraus, beides passend zum Sofa.
»Okay, fahren wir«, sagte meine Mutter.
Hinten war der Wagen voll, also saß ich vorne auf ihrem Schoß.
Meine Mutter und Elaine waren aufgedreht. Sie hatten ihre Möbel, und Elaine würde nicht zu spät zu ihrem Termin kommen. Das war der Grund für meine Wachsamkeit und Besorgnis: Ich wollte, dass meine Mutter fröhlich und zufrieden war.
Elaine bog aus der Einfahrt auf eine zweispurige Straße ein. Einen Augenblick später fegten zwei Polizeiwagen aus der entgegengesetzten Richtung an uns vorbei.
»Vielleicht sind sie hinter uns her!«, sagte Elaine.
»Vielleicht müssen wir ins Gefängnis!«, sagte meine Mutter lachend.
Ich verstand ihren übermütigen Ton nicht. Wenn wir ins Gefängnis kämen, wären wir getrennt. Soweit ich wusste, wurden Kinder und Erwachsene nicht in denselben Zellen untergebracht.
Am nächsten Tag rief mein Vater an. »He, seid ihr bei mir eingebrochen und habt das Sofa mitgenommen?«, fragte er. Er lachte. Er habe einen stillen Alarm. Der sei auf der örtlichen Polizeiwache losgegangen, und daraufhin seien vier Polizeiwagen zum Haus gerast und hätten uns knapp verpasst.
»Ja, sind wir«, sagte sie, etwas Prahlerisches in der Stimme.
Jahrelang verfolgte mich die Idee eines stillen Alarms und wie nah wir der Gefahr gewesen waren, ohne es zu wissen.
Meine Eltern lernten sich im Frühjahr 1972 an der Homestead High School in Cupertino, Kalifornien, kennen, als er in der elften und sie in der zehnten Klasse war.
Jeden Mittwoch arbeitete sie die ganze Nacht lang auf dem Schulhof mit ein paar Freunden zusammen an einem Animationsfilm. Als sie in einer dieser Nächte gerade im Scheinwerferlicht stand und im Begriff war, die Knetanimationsfiguren zu bewegen, kam mein Vater zu ihr und gab ihr einen Bob-Dylan-Songtext, den er abgetippt hatte: Sad Eyed Lady of the Lowlands.
»Wenn du fertig bist, möchte ich ihn wiederhaben«, sagte er.
Er kam immer, wenn sie da war, und hielt Kerzen für sie, damit sie etwas sehen konnte, während sie zwischen den Takes zeichnete.
In jenem Sommer zogen sie zusammen in eine Hütte am Ende der Stevens Canyon Road; mein Vater bezahlte die Miete vom Erlös aus dem Verkauf der sogenannten Blue Boxes, die er zusammen mit seinem Freund Woz baute. Woz war Ingenieur, ein paar Jahre älter als mein Vater, schüchtern und ernst, dunkelhaarig. Sie hatten sich in einer Technik-AG kennengelernt, waren Freunde geworden, die auch zusammenarbeiteten, und sollten später gemeinsam Apple gründen. Die Blue Boxes erzeugten die Töne, mit denen Anrufe umsonst durchkamen, illegal. Sie hatten in der Bibliothek ein Buch der Telefongesellschaft gefunden, in dem das System erklärt und die genaue Tonabfolge beschrieben wurde. Man hielt die Box an den Hörer, die Box erzeugte die Töne, und die Telefongesellschaft verband einen kostenlos, weltweit, mit jedem, den man anrufen wollte. Die Leute, die neben der Hütte wohnten, hatten aggressive Ziegen, und wenn meine Eltern mit dem Auto nach Hause kamen, lenkte meine Vater die Ziegen ab, während meine Mutter zur Tür rannte, oder er rannte auf die Beifahrerseite und trug sie hinein.
Damals waren die Eltern meiner Mutter schon geschieden; ihre Mutter war psychisch krank und wurde zunehmend grausam. Meine Mutter lebte abwechselnd bei ihr und bei ihrem Vater, der oft nicht da war, sondern unterwegs auf Geschäftsreisen. Er hielt nichts davon, dass meine Eltern zusammenziehen wollten, versuchte aber auch nicht, sie daran zu hindern. Der Vater meines Vaters, Paul, war entrüstet über das Vorhaben, seine Mutter Clara dagegen verständnisvoll, die Einzige der vier, die abends einmal zum Essen zu ihnen kam; es gab Campbells-Suppe, Spaghetti und Salat.
Im Herbst zog mein Vater nach Oregon, um sein Studium am Reed College aufzunehmen, das er nach ungefähr sechs Monaten schmiss. Sie trennten sich; richtig darüber gesprochen hätten sie nicht, sagte meine Mutter, weder über die Beziehung noch über die Trennung, und sie habe bald einen neuen Freund gehabt. Als er begriffen habe, dass es vorbei war, sei er so fertig gewesen, dass er kaum aufrecht habe gehen, sich nur noch habe vorwärtsschleppen können. Dass sie es war, die sich von ihm getrennt hatte, überraschte mich, und später fragte ich mich, ob das vielleicht ein Grund war, warum er sich nach meiner Geburt ihr gegenüber so rachsüchtig zeigte. Er sei damals ziellos gewesen, sagte sie, ein Studienabbrecher, der sich nach ihr sehnte, selbst wenn sie bei ihm war.
Meine Eltern reisten beide unabhängig voneinander nach Indien. Er blieb sechs Monate, sie nach seiner Rückkehr ein Jahr. Wie er mir später erzählte, war er eigentlich nach Indien gegangen, um den Guru Neem Karoli Baba kennenzulernen, doch der war, als er ankam, gerade gestorben. Der Ashram, in dem der Guru gelebt hatte, ließ meinen Vater ein paar Tage lang dort wohnen, in einem weißen Zimmer, in dem es nichts weiter gab als ein Bett auf dem Boden und ein Exemplar des Buches Autobiografie eines Yogi.
Zwei Jahre später, als die Firma, die mein Vater gemeinsam mit Woz gründete – Apple –, noch ganz am Anfang stand, waren meine Eltern wieder ein Paar und wohnten zusammen mit einem gewissen Daniel, der wie sie bei Apple arbeitete, in einem dunkelbraunen, im Ranchstil gebauten Haus in Cupertino. Meine Mutter arbeitete im Lager. Sie hatte beschlossen, Geld anzusparen, um die Vororte und meinen launischen Vater irgendwann verlassen zu können und im The Good Earth in Palo Alto anzuheuern, einem Biorestaurant an der Ecke von University Corner und Emerson Street. Sie hatte sich eine Spirale einsetzen lassen, die ihr Körper jedoch, wie es in seltenen Fällen passiert, unbemerkt abstieß, und stellte irgendwann fest, dass sie schwanger war.
Sie sagte es meinem Vater am nächsten Tag. Sie standen im Zimmer direkt neben der Küche. Möbel gab es darin nicht, nur einen Teppich. Er machte ein wütendes Gesicht, presste die Kiefer aufeinander, stürmte dann aus der Haustür und knallte sie hinter sich zu. Er fuhr weg, und sie glaubte, dass er zu einem Anwalt gefahren war, der ihm riet, nicht mehr mit ihr zu sprechen, denn von da an schwieg er eisern.
Sie kündigte ihren Job im Lager von Apple, weil es ihr zu peinlich war, mit dem Kind meines Vaters im Bauch herumzulaufen und gleichzeitig in seiner Firma zu arbeiten, und wohnte bei verschiedenen Freunden. Sie lebte von Sozialhilfe, hatte kein Auto, kein Einkommen. Sie erwog eine Abtreibung, entschied sich aber dagegen, nachdem sie mehrfach von einem Schweißbrenner zwischen ihren Beinen geträumt hatte. Auch über Adoption dachte sie nach, doch die einzige Frau bei Planned Parenthood, der sie Vertrauen schenkte, wurde in einen anderen Bezirk versetzt. Sie ging putzen und wohnte eine Zeit lang in einem Trailer. Viermal während ihrer Schwangerschaft nahm sie an Schweige-Retreats teil, unter anderem, weil es dort so viel zu essen gab. Mein Vater blieb in dem Haus in Cupertino, bis er das Haus in Monte Sereno kaufte, aus dem wir uns später das Sofa holten.
Im Frühjahr 1978, als meine Eltern vierundzwanzig waren, brachte meine Mutter mich auf der Farm ihres gemeinsamen Freundes Robert in Oregon mithilfe zweier Hebammen zur Welt. Von der ersten Wehe bis zur Geburt vergingen drei Stunden. Robert machte Fotos. Mein Vater kam ein paar Tage später dazu. »Es ist nicht mein Kind«, sagte er immer wieder zu jedem auf der Farm aber er war trotzdem ins Flugzeug gestiegen, um mich zu sehen. Ich hatte schwarzes Haar und eine große Nase, und Robert sagte: »Sie sieht aber aus wie du.«
Meine Eltern gingen mit mir auf eine Wiese, legten mich auf eine Decke und blätterten in einem Namensbuch. Er wollte mich Claire nennen. Sie erwogen diverse Namen, ohne sich einigen zu können. Sie wollten nichts Abgeleitetes, keine Kurzform eines längeren Namens.
»Wie wäre es mit Lisa«, sagte meine Mutter schließlich.
»Ja. Das ist es«, sagte er freudig.
Am nächsten Tag flog er ab.
»Ist Lisa nicht die Kurzform von Elisabeth?«, fragte ich meine Mutter.
»Nein. Wir haben nachgeschaut. Es ist ein eigener Name.«
»Und warum hast du ihn meinen Namen mit aussuchen lassen, obwohl er behauptete, er wäre gar nicht mein Vater?«
»Weil er dein Vater war«, sagte sie.
Auf meiner Geburtsurkunde trug meine Mutter ihre beiden Namen ein, aber als meinen Nachnamen nur ihren: Brennan. Sie zeichnete überall Sterne an den Rand des Dokuments, Sterne, die nur Umrisse haben und in der Mitte hohl sind.
Ein paar Wochen später zogen meine Mutter und ich zu ihrer älteren Schwester Kathy in einen Ort namens Idyllwild in Südkalifornien. Meine Mutter lebte nach wie vor von Sozialhilfe; mein Vater kam nicht zu Besuch und zahlte keinen Unterhalt. Wir blieben fünf Monate dort, bevor unsere Umzugsserie begann.
In der Zeit, als meine Mutter schwanger war, begann mein Vater an einem Computer zu arbeiten, der später Lisa heißen sollte. Es war der Vorläufer des Macintosh, der erste Computer für den Massenmarkt mit externer Maus – so groß wie ein Stück Käse –, inklusive Software in Form von Floppy Disks: LisaCalc und LisaWrite. Doch er erwies sich als zu teuer für den Markt, ein kommerzieller Misserfolg; mein Vater hatte in dem Team angefangen, das für Lisa arbeitete, war dann aber ins konkurrierende Mac-Team gewechselt, wo er gegen den Lisa-Computer arbeitete. Die Produktion wurde eingestellt, die dreitausend nicht verkauften Geräte landeten irgendwann auf einer Mülldeponie in Logan, Utah.
Bis ich zwei war, besserte meine Mutter die Sozialhilfezahlungen mit Putz- und Kellnerinnenjobs auf. Von meinem Vater kam keine Unterstützung, ihr Vater und ihre Schwestern halfen, wenn sie konnten; viel war es nicht. Sie fand Betreuung für mich in einer kirchlichen Kindertagesstätte, die von der Frau des Pfarrers geleitet wurde. Ein paar Monate lang hatten wir ein Zimmer in einem Haus, von dem meine Mutter durch einen Aushang erfahren hatte; es war für Schwangere gedacht, die darüber nachdachten, ihr Kind zur Adoption freizugeben.
»Wenn du geweint hast, habe ich mitgeweint; ich war noch so jung, ich wusste nicht, was ich machen sollte, und deine Traurigkeit hat mich traurig gemacht«, sagte meine Mutter über diese Jahre. Das kam mir falsch vor. Zu viel Verschmelzung. Dennoch spürte ich, wie es mich geformt hatte, mein Mitgefühl mit anderen, das manchmal so stark war, als wären sie ich. Durch die Abwesenheit meines Vaters wirkt all ihr Tun und Lassen dramatischer, so als fände es vor einer schwarzen Kulisse statt.
Ich warf ihr später vor, dass ich in Räumen, wo auch nur das mindeste Geräusch zu hören war, schwer einschlafen konnte.
»Du hättest dafür sorgen sollen, dass ich auch an lauten Orten schlafen kann«, sagte ich.
»Aber es war ja außer mir niemand da«, sagte sie. »Was sollte ich denn machen – auf Töpfe und Pfannen schlagen?«
Als ich eins wurde, nahm sie eine Stelle als Kellnerin im Varsity Theater, einem Programmkinorestaurant in Palo Alto, an. Für mich fand sie einen guten, billigen Krippenplatz im Downtown Children’s Center.
1980, als ich zwei war, verklagte der Bezirksanwalt von San Mateo County, Kalifornien meinen Vater auf Unterhaltszahlungen. Der Staat forderte ihn auf, Kindesunterhalt zu zahlen und außerdem die bereits geleisteten Sozialhilfebeträge zurückzuerstatten. Das Verfahren wurde im Namen meiner Mutter, aber vom Bundesstaat Kalifornien eingeleitet. Mein Vater reagierte darauf, indem er die Vaterschaft leugnete, in einer eidesstattlichen Erklärung schwor, er sei unfruchtbar, und den Namen eines anderen Mannes nannte, der angeblich mein Vater sei. Nachdem das Gericht die zahnmedizinischen und medizinischen Daten dieses Mannes angefordert und keine Übereinstimmung festgestellt hatte, behaupteten die Anwälte meines Vaters: »Zwischen August 1977 und Anfang Januar 1978 hatte die Klägerin Geschlechtsverkehr mit einer bestimmten Person oder mehreren Personen, deren Namen der Angeklagte nicht kennt, die Klägerin aber sehr wohl.«
Ich musste einen DNA-Test machen. Die Tests waren neu, sie wurden mit Blut statt Schleimhautabstrich gemacht, und meine Mutter sagte, die Krankenschwester habe keine Vene finden können und immer wieder auf meinen Arm eingestochen, während ich heulte. Mein Vater war auch da, weil das Gericht angeordnet hatte, dass wir alle zur gleichen Zeit ins Krankenhaus kommen sollten. Im Wartezimmer gingen sie und mein Vater höflich miteinander um. Die Ergebnisse kamen: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir verwandt waren, lag bei dem höchsten Wert, den man mit damaligen Instrumenten messen konnte: 94,4 %. Das Gericht verfügte, dass mein Vater Sozialhilferückzahlungen von ungefähr 6000 Dollar zu leisten hatte, Kindesunterhaltszahlungen von 385 Dollar im Monat, die er auf 500 aufstockte, und Krankenversicherungsbeiträge, bis ich achtzehn wäre.
Es ist Fall 239948, archiviert auf Mikrofiche im Kammergericht, Klägerin: Bezirk San Mateo, gegen den Angeklagten: meinen Vater. Er unterschrieb in Kleinbuchstaben, eine noch nicht so routinierte Version seiner späteren Unterschrift. Die Unterschrift meiner Mutter sieht verkrampft und wacklig aus; sie hat gleich zwei davon geleistet, einmal unterhalb und einmal auf der Linie. Ein dritter, angefangener Versuch ist durchgestrichen – wäre diese Unterschrift ebenfalls vollständig, würde sie über den anderen schweben.
Der Fall wurde am 8. Dezember 1980 geschlossen. Die Anwälte meines Vaters drängten auf Einigung, und meine Mutter begriff nicht, warum die Sache, die sich über Monate hingeschleppt hatte, auf einmal so eilig zu Ende gebracht werden sollte. Vier Tage später ging Apple an die Börse, und mein Vater war über Nacht mehr als zweihundert Millionen Dollar schwer.
Aber vorher, gleich nachdem der Fall abgeschlossen worden war, kam mein Vater mich einmal in der Oak Grove Avenue in Menlo Park, wo wir ein Einzimmerapartment bewohnten, besuchen. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es war seit meiner Geburt in Oregon das erste Mal, dass ich ihn sah.
»Weißt du, wer ich bin?«, fragte er. Er warf sich die Haare aus den Augen.
Ich war zwei Jahre alt; ich wusste es nicht.
»Ich bin dein Vater.«
»Als wäre er Darth Vader«, sagte meine Mutter später, als sie mir davon erzählte.
»Ich bin einer der wichtigsten Menschen, die du je kennenlernen wirst«, sagte er.
Auf unserer Straße hingen die rosa Schoten von Pfefferbeeren so tief von den Zweigen herab, dass ich sie berühren konnte; wenn ich sie zwischen den Fingern rieb, platzten sie auf. Die Blätter, die aussahen wie Fischgräten, schaukelten im Wind. Trauertauben machten Töne wie verstimmte Holzblasinstrumente. Rund um manche Baumstämme herum war der Bürgersteig rissig und verzogen.
»Das liegt an den Baumwurzeln«, sagte meine Mutter. »Sie sind stark genug, um den Zement hochzuschieben.«
Wenn ich mit meiner Mutter unter der Dusche stand, rannen die Tropfen an der Wand herunter. Tropfen waren wie Tiere: Sie bewegten sich ruckartig, suchten sich verschlungene Pfade, waren mal langsamer, mal schneller, hinterließen eine Spur. Die Dusche war dunkel und geschlossen, gekachelt und verhängt. Wenn meine Mutter das Wasser heiß stellte, riefen wir: Offene Poren!, und wenn es kalt war, riefen wir: Geschlossene … Poren! Sie erklärte mir, dass Poren Löcher in der Haut seien, die sich bei Hitze öffneten und bei Kälte schlossen.
Sie hielt mich in der Dusche in den Armen, und ich schmiegte mich an sie und wusste nicht genau, wo sie aufhörte und ich anfing.
Meine Mutter hatte sich zum Ziel gesetzt, eine gute Mutter und eine erfolgreiche Künstlerin zu sein, und jedes Mal, wenn wir umzogen, nahm sie zwei große Bücher mit, ein Fotoalbum mit Bildern von meiner Geburt und ein Buch, das sie ihr »Portfolio« nannte. Beim ersten wäre es mir lieber gewesen, wenn sie es weggeworfen hätte, weil es Nacktbilder enthielt, beim zweiten machte ich mir Sorgen, dass sie es verlieren könnte.
Das Portfolio enthielt eine Reihe ihrer Zeichnungen in Plastikhüllen. Dass es Portfolio hieß, verlieh ihm in meinen Augen Bedeutung. Ich mochte das Gewicht der Seiten in meiner Hand, wenn ich darin blätterte. Auf einer Bleistiftzeichnung saß eine Frau bei offenem Fenster am Schreibtisch, und ein Windstoß hob ihre Haare an, formte einen Fächer daraus und wirbelte weiße Bögen Papier um sie herum wie aufgescheuchte Falter.
»Die Haare sind so schön«, sagte ich. »Der Rock ist so schön.« Ich konnte mich nicht sattsehen; ich wünschte, ich wäre diese Frau, oder meine Mutter.
Sie hatte am Tisch gesessen, als sie diese Zeichnung machte, mit Drehbleistift, Radiergummi und ihrem Handballen, und zwischendurch Grafit- und Radiergummireste vom Papier gepustet. Ich liebte das Flüstern des Stifts auf dem Papier und hörte gern, wie ihr Atem gleichmäßig und langsam wurde, wenn sie arbeitete. Sie schien ihre Kunst mit Neugier zu betrachten, nicht mit Urhebergefühlen, so als wäre nicht sie diejenige, die die Striche machte.
Was mich so beeindruckte, war der Realismus der Zeichnung. Jedes Detail war präzise wie ein Foto. Aber zugleich war die Szene auch fantastisch. Ich fand es herrlich, wie die Frau in ihrem engen Rock und ihrer hochgeschlossenen Bluse dasaß, gesammelt und würdevoll mitten im Chaos der herumfliegenden Blätter.
»Das ist nur eine Illustration, keine Kunst«, sagte sie geringschätzig, als ich sie fragte, warum sie nicht viel mehr von solchen Zeichnungen mache. (Es war ein kommerzielles Werk, weniger imponierend als ihre Gemälde; mir war der Unterschied zwischen beidem nicht klar.) Sie hatte den Auftrag bekommen, ein Buch mit dem Titel Taipan zu illustrieren, und dies war eine der Zeichnungen dafür.
Wir hatten kein Auto, deshalb saß ich hinten auf ihrem Fahrrad in einem Plastiksitz, und wir fuhren auf dem Bürgersteig unter Bäumen entlang. Einmal kam uns ein Fahrradfahrer entgegen; meine Mutter wollte ausweichen, der andere auch, und sie stießen zusammen. Wir flogen hin, schürften uns Hände und Knie auf. In der Nähe war ein Stück Rasen, dort erholten wir uns von dem Schreck. Meine Mutter saß da und schluchzte, die Beine angewinkelt, die Shorts heruntergerutscht, eins ihrer Knie zerschrammt und blutig. Der Mann wollte helfen. Sie schluchzte so lange und so sehr, dass ich wusste, es kam von mehr als nur dem Sturz.
Eines Abends, kurze Zeit später, wollte ich einen Spaziergang machen. Sie war deprimiert und hatte keine Lust, aber ich bettelte und zog sie am Arm, bis sie nachgab. Ein Stück die Straße hinunter sahen wir einen blattgrünen VW Käfer Cabrio mit einem Schild daran: Zu verkaufen, direkt vom Besitzer, $ 700. Sie lief um den Wagen herum und schaute in die Fenster.
»Was meinst du, Lisa? Das könnte doch genau das sein, was wir brauchen.«
Sie schrieb sich den Namen des Besitzers und seine Telefonnummer auf. Später ging ihr Vater mit in die Kreditabteilung seiner Firma und bürgte für sie. Wenn meine Mutter erzählte, wie ich sie an jenem Abend zum Spazierengehen genötigt hatte, klang es, als hätte ich eine Heldentat vollbracht.
Auf Autofahrten sang sie, je nach Laune, entweder Joni Mitchells »Blue« oder »The Teddy Bears’ Picnic« oder »Tom Dooley«. Es war auch ein Song dabei, in dem jemand Gott um ein Auto und einen Fernseher bat. Wenn sie sich glücklich und angriffslustig fühlte, sang sie »Rocky Raccoon«; da gab es eine Sequenz, bei der sie ohne richtige Wörter die Tonleiter rauf- und runterjodelte, wie ein Scat-Sänger, und ich musste lachen, obwohl ich es zugleich peinlich fand. Ich war mir sicher, dass sie es erfunden hatte – es war zu merkwürdig für einen echten Song –, und als ich Jahre später im Radio die Beatles-Version hörte, war ich fassungslos.
Dies waren die Reagan-Jahre, und Reagan hatte alleinerziehende Mütter und Mütter, die Sozialhilfe bezogen, verleumdet – er nannte sie »Stützeköniginnen«, die »staatliche Almosen« annähmen, um »Cadillac« fahren zu können –, und später sagte sie zu mir, dass Reagan ein Idiot und ein Gauner sei und Ketchup in der Schulspeisung als Gemüse eingestuft habe.
Irgendwann in dieser Zeit kam meine Tante Linda – die jüngere Schwester meiner Mutter – zu uns zu Besuch. Linda arbeitete bei Supercuts und sparte auf eine Eigentumswohnung. Wir hatten kein Geld mehr, und Linda sagt, sie sei eine Stunde gefahren, um meiner Mutter zwanzig Dollar für Lebensmittel und Windeln zu geben; meine Mutter kaufte dann Lebensmittel und Windeln davon, aber auch einen Strauß Gänseblümchen und eine kleine Packung gemustertes Origamipapier. Wenn wir mal Geld hatten, brannte es schnell und lichterloh, wie Zunder. Wir hatten entweder wenig oder nicht genug. Meine Mutter war nicht gut im Sparen oder Geldverdienen, aber sie liebte alles Schöne.
Linda erinnert sich, wie meine Mutter auf dem Futon saß, als sie hereinkam, und ins Telefon schluchzte: »Im Ernst, Steve, wir brauchen einfach Geld. Bitte überweise uns ein bisschen Geld.« Ich war drei, was mir zu klein dafür erscheint, aber Linda meint, ich hätte meiner Mutter den Hörer aus der Hand gerissen, »sie braucht einfach ein bisschen Geld, okay?« gesagt und aufgelegt.
»Wie viel Geld hat er?«, fragte ich meine Mutter ein paar Jahre später.
»Siehst du das?« Meine Mutter zeigte auf einen Papierschnipsel von der Größe eines Radiergummis. »So viel haben wir. Und siehst du das?«, sagte sie und zeigte auf eine ganze Rolle weißes Packpapier. »So viel hat er.«
Da waren wir gerade wieder vom Lake Tahoe weggezogen, wo wir mit dem grünen VW hingefahren waren, um bei dem Freund meiner Mutter zu wohnen, der einmal ein berühmter Kletterer gewesen war, bevor er wegen einer Sehnenverletzung und einer verpatzten Operation am rechten Ringfinger mit dem Klettern aufhören musste. Er hatte dann eine Firma für Outdoorkleidung gegründet, und meine Mutter steuerte Illustrationen von Gamaschen und anderen Ausrüstungsdetails bei und arbeitete außerdem als Kellnerin in einem Restaurant. Später, nachdem sie sich getrennt hatten, wurde er ein erfolgreicher Staubsaugervertreter und wiedergeborener Christ, aber damals kam er noch manchmal in Zeitschriftenartikeln übers Klettern vor. Einmal, beim Einkaufen, zeigte meine Mutter auf das Cover einer Zeitschrift, auf dem man jemanden an einer Felswand hängen sah. »Das ist er«, sagte sie. »Er war ein Weltklassekletterer.« Ein winziger Fleck am Berg – ich konnte ihn kaum erkennen. Ich bezweifelte, dass es sich um denselben Mann handelte, der mit mir im Skylandia-Park durch den Zedernwald zum Strand gegangen war.
Sie schlug eine andere Zeitschrift auf. »Und dies«, sagte sie, »ist dein Vater.« Also, hier konnte ich wenigstens das Gesicht erkennen. Mein Vater war hübsch, mit dunklem Haar, roten Lippen, einem ansprechenden Lächeln. Der Kletterer war konturlos, mein Vater klar umrissen. Obwohl der Kletterer derjenige war, der sich um mich kümmerte, bemitleidete ich ihn jetzt wegen seiner Bedeutungslosigkeit und hatte gleichzeitig ein schlechtes Gewissen deswegen, denn er war ja immerhin da.
Wir hatten fast zwei Jahre in Tahoe gewohnt, als meine Mutter den Kletterer verlassen und in die Bay Area zurückkehren wollte. Das war im Januar 1983, so um die Zeit, als die Geschichte im Time Magazine über meinen Vater und Computer herauskam, »The Machine of the Year« – da war ich vier. Er deutete in dem Artikel an, dass meine Mutter mit vielen Männern geschlafen und gelogen habe. Über mich sagte er: »Achtundzwanzig Prozent der männlichen Bevölkerung der USA könnten der Vater sein« – wahrscheinlich gestützt auf eine Rechenmanipulation des DNA-Testergebnisses.
Nachdem sie den Artikel gelesen hatte, bewegte meine Mutter sich in Zeitlupe, und ihre Gesichtsmuskeln waren ganz schlaff. Sie kochte Abendessen, ohne Licht in der Küche zu machen außer einer schwachen Lampe unter dem Küchenschrank. Doch nach ein paar Tagen hatte sie sich gefangen und ihren Sinn für Humor wiedergefunden und schickte meinem Vater ein Bild von mir, auf dem ich in unserem Haus auf einem Stuhl sitze und nichts als eine Groucho-Marx-Scherzartikelbrille mit großer Plastiknase und unechtem Schnurrbart anhabe.
»Ich denke, sie ist dein Kind!«, schrieb sie hinten auf das Foto. Er trug damals Schnurrbart und Brille und hatte eine große Nase.
Daraufhin schickte er ihr einen Scheck über 500 Dollar, und mit diesem Geld zogen wir in die Bay Area zurück, wo wir einen Monat lang ein Zimmer in einem Haus an der Avy Avenue in Menlo Park mieteten, bei einem Hippie, der Bienen hielt.
Am Tag nach unserer Rückkehr aus Tahoe wollte mein Vater uns sein neues Haus zeigen. Ich hatte ihn ewig nicht gesehen und würde ihn danach ewig nicht wiedersehen. Die Erinnerung an diesen Tag mit dem absonderlichen Haus und meinem seltsamen Vater schien surreal, wenn ich später daran dachte; als hätte das alles gar nicht stattgefunden.
Er holte uns mit seinem Porsche ab.
Im Haus gab es keine Möbel, nur viele riesige Zimmer. Irgendwo in einem großen, feuchtkalten Raum fanden meine Mutter und ich eine Kirchenorgel, die auf einem erhöhten Stück Boden stand, darunter der Holzrahmen mit den Fußpedalen, und zwei ganze Zimmer mit gitterartigen Wänden und Hunderten von Metallpfeifen darin, manche so groß, dass ich hineinpasste, andere kleiner als der Nagel meines kleinen Fingers, und alle Größen dazwischen. Jede einzelne Orgelpfeife steckte senkrecht in einer Holzfassung, die eigens für sie gemacht war.
Ich entdeckte einen Fahrstuhl und fuhr damit ein paarmal rauf und runter, bis Steve sagte: Okay, das reicht.
Die Fassade, die man sah, wenn man in die Einfahrt einbog, erwies sich als die Schmalseite des Hauses, und nach hinten, zum Rasen hin, war es monumental, mit weißen Torbögen, an denen sich knallpinke Bougainvilleen bis in die Einfahrt bauschten. »Das Haus taugt nichts«, sagte Steve zu meiner Mutter. »Es ist Schrott. Ich werde es abreißen. Ich habe das Ganze hier wegen der Bäume gekauft.« Ich erschrak heftig – aber sie gingen weiter, als wäre nichts gewesen. Wie konnte er sich für Bäume interessieren, wenn es so ein Haus gab? Würde er es abreißen, bevor ich noch einmal wiederkommen könnte?
Sein ›s‹ klang wie ein in Wasser gelöschtes Streichholz. Im Gehen neigte er den Oberkörper vor, als wandere er einen Berg hoch, und schien die Knie nie ganz durchzudrücken. Sein dunkles Haar fiel ihm ins Gesicht, und wenn es ihn störte, warf er es mit einer ruckartigen Kopfbewegung nach hinten. Sein Gesicht sah frisch aus gegen das dunkle, glänzende Haar. In seiner Nähe zu sein, in dem hellen Licht, um uns der Geruch nach Erde und Bäumen, die Weite des Lands, war elektrisierend und magisch. Einmal merkte ich, wie er mich von der Seite ansah, ein braunes, scharfes Auge.
Er zeigte auf drei riesige Eichen ganz am Ende des großen Rasens. »Die da«, sagte er zu meiner Mutter. »Deshalb habe ich das Grundstück gekauft.«
War das ein Witz? Ich wusste es nicht.
»Wie alt sind sie?«, fragte meine Mutter.
»Zweihundert Jahre.« Ich konnte mit meinen Armen nur einen winzigen Bruchteil der Stämme umfassen.
Wir gingen zum Haus zurück und dann einen Abhang hinunter zu einem großen Pool, mitten auf einer ungemähten Wiese voller hoher Gräser. Vom Beckenrand aus schauten wir auf die Wasseroberfläche, die Tausende tote Insekten mit einem Netz überzogen hatten: schwarze Spinnen, Weberknechte, eine Libelle mit nur einem Flügel. Vor lauter Insekten konnte man kaum das Wasser sehen. Auch ein Frosch lag da, mit dem Bauch nach oben, und so viel totes Laub, dass das Wasser dick und dunkel geworden war wie Tinte.
»Sieht aus, als wäre hier ein bisschen Poolreinigung angesagt, Steve«, sagte meine Mutter.
»Vielleicht nehme ich das Ding auch einfach raus«, sagte er, und in der Nacht träumte ich, dass die Insekten und Tiere als Drachen aus dem Becken aufstiegen und, wild mit den Flügeln schlagend, in den Himmel flogen, und danach war das Wasser klar und türkis mit Netzlinien aus weißem Licht.
Ein paar Wochen danach kaufte mein Vater uns einen silbernen Honda Civic anstelle unseres grünen VW. Wir holten ihn beim Autohändler ab.
Mehrere Monate später brauchte meine Mutter mal einen Tapetenwechsel, und wir fuhren für ein, zwei Tage nach Harbin Hot Springs. Auf dem Rückweg war es dunkel, es regnete, und auf einer Schnellstraße, die sich durch die Hügellandschaft schlängelte, ein paar Stunden von zu Hause entfernt, verfuhr sie sich. Der Scheibenwischer auf ihrer Seite war besser; der auf meiner Seite hatte sich in der Mitte verzogen und hinterließ Schlieren. In der Windschutzscheibe vor mir war eine wie ein kleines Auge geformte Kerbe, wahrscheinlich von einem Kieselstein, der dort irgendwann aufgeschlagen war.
»Es ist alles nichts. Nichts«, sagte sie. Ich wusste nicht, was sie meinte. Sie fing an zu weinen. Das Geräusch, das sie machte, war ein hohes, ununterbrochenes Wimmern, als striche ein Bogen über eine Saite.
Mit 28 und wieder einmal Single, fand sie es wesentlich schwerer, ein Kind großzuziehen, als sie gedacht hatte. Von ihrer Familie konnte sie nicht viel Hilfe erwarten, ihr Vater Jim, der ihr kleine Geldbeträge lieh und mir bald darauf mein erstes Paar fester Schuhe kaufen würde, war in keiner nennenswerten Weise für sie da. Ihre Stiefmutter Faye passte später manchmal auf mich auf, aber sie hatte nicht gern kleine Kinder in ihrem Haus, die überall Unordnung machten. Ihre ältere Schwester hatte selbst ein Baby und war alleinstehend, und die beiden jüngeren Schwestern waren mit ihrem Start ins Leben beschäftigt. Meine Mutter schämte sich dafür, unverheiratet zu sein, und fühlte sich aus der Gesellschaft ausgestoßen.
Wir kamen an denselben Hügeln vorbei, durch die wir bei Tageslicht gefahren waren, als sie so glatt und vertrauenerweckend gewirkt hatten wie Kamelhöcker. Jetzt waren es trostlose schwarze Kurven unter einem dunklen Himmel. Sie weinte noch heftiger, runde, stoßartige Schluchzer. Ich war mucksmäuschenstill. Auf der anderen Seite der Schnellstraße kam uns ein Wagen entgegen, und ich schaute rasch zu ihr, um ihr Gesicht zu sehen, als das Licht der Scheinwerfer sie streifte.
»Ich glaube, wir haben die Ausfahrt verpasst. Keine Ahnung.« Es regnete jetzt noch stärker, und sie schaltete die Scheibenwischer auf die höchste Stufe. Sobald die Halbkreise frei waren, füllte der Regen sie wieder aus.
»Ich will dieses Leben nicht«, schluchzte sie. »Ich will hier raus. Ich hab das Leben satt. Scheißeeeee!« Sie schrie, ja heulte regelrecht. Ein Nebelhorn. Ich hielt mir die Ohren zu. »Leck mich doch! Leck mich, du Arsch!«, schrie sie die Windschutzscheibe an. Als wäre sie auf die wütend.
Ich saß, von zwei Sicherheitsgurten gehalten, neben ihr und schaute nach vorne (damals mussten Kinder noch nicht hinten sitzen). Ich stellte mir vor, dass in den Autos, die uns entgegenkamen, den Autos um uns herum, Ruhe und Frieden herrschten, und wünschte, ich säße in einem von denen. Wäre sie doch nur wieder wie vorher bei Tageslicht, dachte ich. Die eine Ausgabe von ihr schien für die andere nicht zugänglich zu sein. Hinterher sagte sie, während sie geschrien habe, sei ihr durchaus bewusst gewesen, dass ich alt genug war, um mich später daran zu erinnern, aber sie habe sich trotzdem nicht beherrschen können.
»Ich habe nichts«, sagte sie. »Dieses Leben ist beschissen. Beschissen.« Sie rang nach Atem. »Ich will nicht mehr leben! Dieses Scheißleben. Ich hasse dieses Leben!« Ihre Kehle war wie Kies, ihre Stimme heiser vom Brüllen. »Es ist die Hölle.«
Immer wenn sie brüllte, trat sie aufs Gaspedal, als wollte sie ihre Stimme durch den Motor verstärken, und das Auto machte Sätze, schlitterte vorwärts, ließ den Regen aufschäumen wie Speichel.
»Dieses Scheiß-Time-Magazine. Dieses beschissene Arschloch!« Arschloch war schlimmer als Arsch, es war eine Steigerung. Es traf mich wie ein Schlag aufs Brustbein. Sie stieß einen Schrei aus, schüttelte den Kopf, dass ihr die Haare ums Gesicht flogen, bleckte die Zähne, haute mit der flachen Hand aufs Armaturenbrett, und ich fuhr zusammen.
»Was?«, schrie sie mich an. »Waaaas?«
Ich erstarrte; ich wurde zum Inbild eines in ihrem Sitz erstarrten Mädchens.
Plötzlich bog sie so ruckartig von der Schnellstraße ab, dass ich dachte, jetzt führen wir in den Tod, aber es war eine Ausfahrt.
Sie fuhr an den Rand, trat scharf auf die Bremse und schluchzte mit bebendem Rücken in ihre verschränkten Arme. Ihr Kummer hüllte mich ein, ich konnte ihm nicht entkommen, nichts tun, was ihn aufgelöst hätte. Ein paar Minuten später fuhr meine Mutter wieder los, nahm eine Überführung über die Schnellstraße, fand einen anderen Weg. Sie weinte weiter, aber nicht mehr so heftig, und irgendwann bat ich das gesprungene Glasauge, die kleine Kerbe in der Windschutzschutzscheibe, für mich auf die Straße zu achten, eine Art Gebet, und schlief ein.
Auf dem Höhepunkt ihrer Hoffnungslosigkeit und Schreierei hatte ich in unserer Nähe eine stille Anwesenheit gespürt, obwohl ich wusste, dass wir in dieser Wasserhölle, in der der Wagen herumrutschte, allein waren. Ich spürte etwas, das uns wohlgesinnt war, aber nicht eingreifen konnte, vielleicht hinten im Wagen saß. Es konnte nichts machen, nichts ändern, nur zusehen und aufpassen. Später fragte ich mich, ob es ein Geist meines jetzigen Ich gewesen war, der mein jüngeres Ich und meine Mutter in jenem Wagen begleitet hatte.
Am nächsten Morgen trug der Mann, der Bienen hielt, einen knitterigen weißen Anzug inklusive Schutzhandschuhen und eine Kopfbedeckung mit eingenähtem Netz. Die Bienen wohnten in einer Lattenkiste in dem kleinen Garten hinter dem Haus. Wir standen in der Küche, einem Anbau des Bungalows, und schauten hinaus. Er rief mich und winkte mir, ich solle herauskommen.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte er.
»Sie ist ziemlich allergisch auf Bienen«, rief meine Mutter ihm zu. Einmal war ich auf eine Biene getreten, und mein Fuß war angeschwollen; ich konnte eine Woche lang nicht laufen.
»Meine Bienen sind glückliche Bienen«, sagte er. »Die stechen nicht.« Er nahm die Kopfbedeckung ab, damit wir sein Gesicht sehen konnten. »Es sind Honigbienen; sie sind freundlich«, sagte er.
»Aber Sie tragen einen Anzug«, sagte meine Mutter. »Meine Tochter hat kurze Hosen an. Sie ist ungeschützt.«
»Ich muss ja auch da reinfassen, um ihren Honig zu holen. Sonst wäre ich so angezogen wie ihr. Sie wollen dich nicht stechen«, sagte er zu mir. »Weißt du, was passiert, wenn sie es tun? Dann verlieren sie ihr Leben.« Er machte eine Pause. »Warum sollten sie ihr Leben opfern, um dir wehzutun, wo sie doch glücklich sind und du ihnen gar nichts tust?«
»Sind Sie sich sicher?«, fragte meine Mutter noch einmal. Die Sache war uns nicht geheuer, aber was wussten wir schon über Bienen.
»Ja«, sagte er und setzte seine Kopfbedeckung wieder auf. Ich hatte noch nie einen Bienenstock von Nahem gesehen.
»Na schön …«, sagte meine Mutter, nur halb überzeugt. Ich ging zu ihm hinüber und schaute in die wimmelnde, samtige Masse hinab. Die Bienen bildeten einen schimmernden Teppich. Manche flogen höher und hüpften in der Luft wie winzige Ballons an einer Schnur. Eine landete auf meiner Wange und begann, im Kreis zu laufen. Ich wusste nicht, dass dieses Kreisen eine Art Vorbereitungstanz war. Als ich sie wegzuwischen versuchte, hing sie fest; dann stach sie zu.
Ich rannte zu meiner Mutter, die mich in die Küche zog. Durch die offenen Fenster schallte ihre Stimme hinaus.
»Was haben Sie sich dabei gedacht?«, brüllte sie, während sie einen Schrank nach dem anderen aufriss, bis sie Backpulver fand, dass sie in einer Schüssel mit Wasser mischte. »Wie können Sie es wagen.« Sie ging neben mir in die Hocke, zog mit einer Pinzette den Stachel heraus und tupfte mir dann mit den Fingerkuppen die Paste auf die Wange, die schon anzuschwellen begann.
»Was für ein Idiot«, murmelte sie. »Steht da in voller Montur. Und sagt einem kleinen Mädchen, sie sei nicht in Gefahr.«
Wenn wir ein bisschen Geld übrig hatten, fuhren wir zu einem Lebensmittelgeschäft namens Draeger’s, wo sich in den Backöfen hinter der Theke reihenweise Fleisch drehte. Es roch nach süßem Schmutz und Bratendunst. Die noch rohen Hühnchen konnte man daran erkennen, dass sie hellweiß und mit orangefarbenem Pulver bestäubt waren; die fertig gebratenen waren braun und prall. Sie zog eine Nummer.
»Ein halbes Grillhähnchen, bitte«, sagte sie, wenn unsere Nummer aufgerufen wurde. Ein Mann rückte dem Vogel mit einer Art Gartenschere zu Leibe; es knirschte immer so schön, wenn er die Rippen durchschnitt. Er ließ die Hühnerhälfte in eine weiße, silbern ausgekleidete Tüte gleiten.
Wenn wir wieder im Auto saßen, stellte meine Mutter die Tüte zwischen uns auf die Handbremse und riss sie auf, und wir aßen das Hühnchen mit den Fingern, während um uns herum die Fenster beschlugen.
Hinterher knüllte sie die Tüte um die Knochen herum, wischte mir mit einer Serviette die fettigen Finger ab und untersuchte meinen Handteller, auf dem die Haut Furchen bildete wie ein aus großer Höhe gesehenes trockenes Flussbett. Keine zwei Menschen hätten dieselben Linien, hatte sie mir einmal erklärt, aber das Muster sei bei allen ähnlich.
Sie kippte meine Hand ein wenig, damit Licht auf die Rillen fiel, und erschrak. »O Gott«, sagte sie.
»Was?«, fragte ich.
»Es ist bloß … nicht so gut. Die Linien fransen aus.« Sie wirkte erschüttert, war plötzlich in sich gekehrt, still. Diese Übung durchliefen wir in verschiedenen Varianten immer wieder, häuften über die Jahre immer mehr Details an, und jedes Mal machte meine Mutter die gleichen Fehler, als wäre das alles ganz neu.
»Was bedeutet das?« Panik in meiner Brust, meinem Bauch.
»So was habe ich noch nie gesehen. Diese Lebenslinie, die geschwungene da – Löcher, Blasen.«
»Was ist denn so schlimm an Blasen?«
»Sie stehen für Traumata, Brüche«, sagte sie. »Es tut mir so leid.« Ich wusste, dass sie sich nicht für die Hand entschuldigte, sondern für mein Leben. Den Beginn meines Lebens, an den ich mich nicht erinnerte. Dafür, wie schwer alles war. Vielleicht nahm sie an, dass ich nicht wusste, wie eine Familie eigentlich aussehen sollte, aber einmal, als ich auf einem Spielplatz einen Jungen jagte, der zu große Schuhe anhatte, hörte sie mich verächtlich zu ihm sagen: »Du hast ja noch nicht mal einen Vater.«
»Was ist das für eine?«, fragte ich und zeigte auf die Linie, die unterhalb des kleinen Fingers ansetzte.
»Deine Herzlinie«, sagte sie. »Auch schwierig.« Mich packte so etwas Ähnliches wie Trauer, obwohl wir eben noch fröhlich gewesen waren.
»Und diese hier?« Die letzte, von der Lebenslinie abzweigend, mitten durch meine Handfläche hindurch. Schärfer als die anderen zunächst – oh, Hoffnung! –, doch dann erschlaffte sie, wurde immer dünner und teilte sich wie ein Zweig.
»Warte«, sagte sie, und ihre Miene hellte sich auf. »Ist das deine linke Hand?« Sie war, wie gesagt, Legasthenikerin und verwechselte manchmal die Seiten.
»Ja«, sagte ich.
»Okay – gut –, die linke sagt mir etwas über die Umstände, die dir mitgegeben wurden. Lass mich mal deine rechte sehen.«
Ich gab ihr meine andere Hand, und sie hielt sie vorsichtig fest, zeichnete die Linien nach, drehte und wendete sie, um besser sehen zu können. Die Haut glänzte vom restlichen Hühnchenfett. »Diese Hand sagt mir, was du aus deinem Leben machen wirst«, sagte sie. »Hier sieht es viel besser aus.«
Woher wusste sie das? Ich fragte mich, ob sie das Handlesen in Indien gelernt hatte.
In Indien benutze in der Öffentlichkeit nie jemand seine linke Hand, sagte sie; in der Begegnung mit anderen werde ausschließlich die Rechte benutzt. Statt mit Klopapier wischten die Leute sich nämlich mit der linken Hand ab. Zwar wuschen sie sie hinterher, aber ich war trotzdem entsetzt.
»Wenn ich nach Indien fahre«, sagte ich, wann immer die Sprache auf dieses Land kam, »nehme ich überall eine Klorolle mit hin.«
Sie erzählte mir von einem Festival in Allahabad, dem Kumbha Mela, auf das sie damals gegangen war. Es fand nur alle zwölf Jahre statt, diesmal am Zusammenfluss des Ganges und des Yamuna. Es waren Massen von Menschen da. In der Ferne saß ein sehr heiliger Mann auf einem Geländer, segnete Orangen und warf sie in die Menge.
»Er war so weit weg, dass es wirkte, als wäre er nur ein paar Zentimeter groß«, sagte sie.
Die anderen Orangen landeten nirgends in ihrer Nähe, doch dann warf er diese eine, und sie sah schon, dass sie genau auf sie zukam, und kurz darauf traf sie sie – peng – mitten auf die Brust, mitten ins Herz, und verschlug ihr den Atem.
Die Orange prallte ab, und ein paar Männer sprangen hinterher; behalten konnte sie sie also nicht. Aber ich wusste, dass es etwas Besonderes über sie aussagte, über uns, dass die aus solcher Entfernung geworfene heilige Orange ausgerechnet sie ins Herz getroffen hatte.
»Weißt du«, sagte sie, »als du geboren wurdest, kamst du herausgeschossen wie eine Rakete.« Das hatte sie mir schon oft erzählt, aber ich tat so, als hätte ich es vergessen. »Ich hatte vorher an mehreren Geburtsvorbereitungskursen teilgenommen, und überall hieß es, ich müsste pressen, und dann war es so weit, und du kamst dermaßen schnell heraus, dass ich dich gar nicht halten konnte.« Ich liebte diese Geschichte – wie ich, anders als andere Babys, meine Mutter nicht gezwungen hatte, mich auf die Welt zu pressen, wodurch ihr etwas erspart geblieben war, was wiederum etwas über mich besagte.
All das – die Hand, die Orange, die Geburt – bedeutete, dass es mir gut gehen würde als Erwachsener.
»Wenn ich erwachsen bin, bist du alt«, sagte ich. Ich stellte mir vor, wie ich entlang der Lebenslinie voranschritt; älter werden hieß, auf dieser Linie ein Stück weiter zu sein.
Wir gingen zu Peet’s Coffee bei uns um die Ecke, wo der Mann hinter der Theke ihr immer einen Kaffee ausgab, und setzten uns draußen auf die Bank in die warme Sonne. Die zwei Reihen Platanen rund um den Platz gegenüber vom Coffee Shop waren fast bis auf die Stämme zurückgeschnitten worden; mit ihren kurzen Ästen und den dicken Kugeln am Ende sahen sie aus, als spielten sie Jacks. Die Luft roch nach jungem Holz.
»So?« Sie tat so, als laufe sie am Stock, wie eine alte Frau, krumm und zahnlos. Dann richtete sie sich wieder auf. »Ich bin nur vierundzwanzig Jahre älter als du, mein Schatz. Wenn du erwachsen bist, werde ich immer noch jung sein.«
Ich sagte »Ach so«, als stimmte ich ihr zu. Aber es spielte keine Rolle, was sie sagte oder mir erklärte. Ich betrachtete uns als Wippe: Wenn eine von uns Kraft oder Glück oder Substanz hatte, musste die andere schwächer werden. Wenn ich noch jung war, wäre sie alt. Sie würde wie alte Leute riechen, nach gebrauchtem Blumenwasser. Ich wäre neu und grün und würde nach frisch gestutzten Ästen duften.
Mitten im Schuljahr kam ich in die Vorschulklasse einer staatlichen Grundschule in Palo Alto. Davor war ich auf eine andere Schule gegangen, aber meine Mutter fand, dass zu viele Jungs in der Klasse waren, und so wechselte ich. An meinem ersten Schultag ging eine Hilfslehrerin mit mir nach draußen und machte ein Polaroidfoto von mir. Sie heftete es zu den Fotos der anderen Kinder an eine Tafel und schrieb meinen Namen darunter. Ich hatte mir albernerweise die Hand um den Kopf gelegt, weil ich dachte, das würde gut aussehen, während die anderen Kinder einfach vor einem blauen Hintergrund saßen. Das Bild war lichtgetränkt, improvisiert – ich fand, es zeigte nicht nur, dass ich später dazugekommen, sondern auch, dass ich substanzlos war, vom Licht ausgewaschen.
Die Lehrerin, Pat, groß und rund, hatte eine Singsangstimme und trug bis zu den Knöcheln reichende Jeansröcke, Sandalen mit Socken, T-Shirts, die ihr über den mächtigen Busen hingen, und eine Lesebrille an einer Schnur. In der Pause spielten wir hinter dem Klassenzimmer auf einem Holzklettergerüst, dessen verschiedene Teile mit Brettern verbunden waren. Ein Netz aus Tauwerk zwischen zwei hölzernen Plattformen wurde der »Bumsgraben« genannt. Bumsen, so wie ich es verstand, hieß, dass man schwankte und sich wieder fing, schwankte, sich fing. Es konnte einem schlecht dabei werden. Als ich noch neu auf der Schule war, fiel ich einmal in das Netz, und während ich herauskletterte, riefen die anderen alle: Bums-en! Bums-en!
In dieser Vorschule wurde großer Wert aufs Lesen gelegt, aber ich konnte nicht lesen. Für jedes durchgelesene Buch bekamen die Kinder einen kleinen Teddybären geschenkt.
Um eine der Hilfslehrerinnen dazu zu bringen, mir einen Teddybären zu schenken, lernte ich ein Buch auswendig.
»Ich bin so weit«, sagte ich. Wir setzten uns in der Leseecke mit dem Rücken am Bücherregal auf den Boden, und ich schlug das Buch auf. Ich hielt mich an das, was ich auswendig gelernt hatte, sowie an die dazugehörigen Bilder und sagte auf, was meiner Meinung nach da stand. Nach zwei Seiten verhärtete sich ihre Miene, und ihre Lippen wurden schmal.
»Du hast an der falschen Stelle umgeblättert«, sagte sie. »Und ein Wort ausgelassen.«
»Nur einen Bären«, sagte ich. »Bitte.«
»Noch nicht«, sagte sie.
Daniela hatte schon zweiundzwanzig angehäuft; ich fragte sie, ob ich einen haben dürfe.
»Du musst ein Buch lesen, um einen zu bekommen«, sagte Daniela.
Ich bekam zunehmend das Gefühl, dass ich etwas Ekliges und Beschämendes an mir hatte, und fürchtete zugleich, dass es zu spät sei, etwas daran zu ändern, dass da nichts mehr zu machen sei. Ich war anders als andere Mädchen in meinem Alter, und jeder, der einen guten, reinen Charakter hatte, würde es auf der Stelle merken und sich abgestoßen fühlen. Ein Hinweis war das Foto. Ein anderer, dass ich nicht lesen konnte. Und der letzte, dass ich so pingelig und mit mir selbst beschäftigt war, wie ich es von anderen Mädchen nicht kannte. Meine Sehnsüchte waren zu stark und wild. In mir war eine Unruhe wie von Würmern, als hätte ich beim Naschen von Keksteig eine Krankheit oder Larven in mich aufgenommen, wie sie durch rohe Eier und Mehl übertragen werden. Ich spürte es selbst und war mir sicher, dass auch andere es merkten, sobald sie mich sahen, und daher erschrak ich jedes Mal, wenn ich zufällig an einem Spiegel vorbeikam und feststellte, dass ich gar nicht so schmutzig und abstoßend aussah, wie ich dachte.