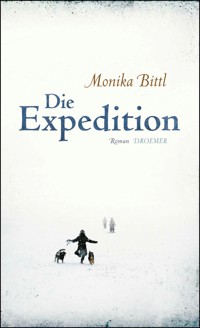6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Hebamme kämpft für ihr Wissen und ihre Liebe in einer von Männern dominierten Welt. München, 1811: Lucilie Vinzenz ist eine Hebamme, die sich nicht damit abfinden will, dass bei einer Geburt Mutter und Kind häufig sterben. Unermüdlich erweitert sie ihr Wissen, gibt es an die Frauen weiter und achtet streng auf Hygiene. Doch damit bringt sie Ärzte und Kirchenherren gegen sich auf, die nicht akzeptieren wollen, dass eine Frau andere Frauen aufwiegelt gegen die gottgegebene Ordnung. Als eine Intrige gegen sie gesponnen wird, flieht Lucilie in ihr Heimatdorf, an den Ort ihrer schmerzhaften Vergangenheit. Als junge Frau war sie schwanger geworden und von ihrem Vater dafür grausam bestraft worden. Mit ihm, der ihr damals das Kind wegnahm, hat sie seither nie wieder ein Wort gewechselt. Ausgerechnet hier trifft sie auf einen Gleichgesinnten, den Dorfarzt Denaro. Sie verlieben sich ineinander – doch dann muss Lucilie erfahren, dass er auf schreckliche Weise mit ihrer Vergangenheit verknüpft ist ... Ein ergreifender historischer Roman über eine starke Frau, die für ihr Wissen, ihre Überzeugungen und ihre Liebe kämpft in einer Zeit, in der die Schulmedizin mit dem alten Hebammenwissen in Konflikt steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Monika Bittl
Bergwehen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
München 1811: Die Hebamme Lucilie kämpft für bessere hygienische Verhältnisse bei Geburten. Mit ihren neuen Methoden bringt sie Ärzte und Kirchenherren gegen sich auf. In dem Dorfarzt Denaro findet sie einen Mitstreiter und verliebt sich in ihn – doch er ist auf schreckliche Weise mit ihrer Vergangenheit verknüpft!
Inhaltsübersicht
In Liebe meinen Eltern
»Das Leben ist kurz, [...]
I.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
II.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
III.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Nachwort
Glossar
In Liebe meinen Eltern
»Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang,
die Gelegenheit flüchtig, die Erfahrung trügerisch,
das Urteil schwierig.«
Hippokrates
I.
1.
Als der Große Komet des Jahres 1811 über Europas nächtlichem Himmel am hellsten strahlte, fiel kurz vor den Toren von Paris ein Schuss. Die Pferde scheuten, der Kutscher schrie auf, rote und gelbe Blätter flogen von den Bäumen, und der Wagen blieb stehen. Der zweite Schuss aus dem Manson-Gewehr durchschlug die Kutschentür, der dritte traf Lucilie Vinzenz in die Brust. Die Vierundvierzigjährige erschrak mehr, als einen Schmerz zu verspüren. Ihr Blut sickerte durch den festen Stoff des dunklen Dirndls in ihr weißes Baumwollhemd und durchtränkte langsam die Wolldecke, die über ihrem Schoß lag. Lucilie hob ihre Hand, um noch einmal das geliebte Gegenüber zu berühren, doch der Arm rutschte nach unten, eine Strähne aus ihrem dunklen Haarschopf löste sich, und ihr Körper sank an die Lehne zurück.
Die vierte Kugel durchschlug ihren mit Weihrauch und getrockneten Bergpflanzen gefüllten Beutel, es roch nach verbranntem Fleisch, Lavendel und Myrrhe. Ein Wolf heulte auf, Lucilie hörte den Kutscher vom Bock fallen und ein Röcheln. Weitere Schüsse wurden abgefeuert, die restlichen Glasscheiben zersplitterten, und Lucilies Kopf fiel nach hinten, so dass ihr Blick direkt auf den Großen Kometen gerichtet war. Blut quoll aus ihrem Mund, die Lider erschlafften und ihre Lippen formten sich zu einem Lächeln. Sie dachte an den silbernen Knopf, den sie doch eben noch an Tonis Jacke genäht hatte. Nach wie vielen Monaten hatte sie endlich das Gewand ihres Kindes in Ordnung gebracht – und dem silbernen Knopf sollten nun ihre letzten Gedanken gehören?
Lucilie erkannte im Hauch der kalten Herbstluft ihren letzten Atemzug und sah ein gleißendes Licht, das sie rief. Als Oberhebamme Lucilie Vinzenz trat sie dieser Erscheinung, nun in ihrem hellgrünen Sommerkleid, durch das Kutschendach hindurch aufrecht und unversehrt entgegen. Gerade noch hatte sie ihr Werk vollendet, den tödlichen Preis dafür nahm sie mannhaft hin.
So starb Lucilie versöhnt mit der Welt, die sie jedoch über Jahrzehnte vergessen sollte, weil ein zerstreuter Setzer ihr Manuskript versehentlich in einer falschen Schublade ablegte und stattdessen ein Kochbuch drucken ließ. Dieses Missgeschick bezahlten unzählige Menschen mit ihrem Leben.
2.
Als der Große Komet in einer Aprilnacht des Jahres 1811 der Erde zum ersten Mal so nahe kam, dass er mit bloßem Auge am Himmel zu erkennen war, verschlief fast die gesamte medizinische Elite Europas dieses Ereignis. Die berühmtesten Ärzte jener Zeit waren auf Einladung Napoleons aus Leipzig, Pavia, London, Wien, Berlin, Bologna, Dublin und anderen Universitätsstädten nach Paris gereist, um ihr Wissen in theoretischen und praktischen Bereichen auszutauschen. Am zweiten Kongresstag begannen sich die Mediziner in den kaiserlichen Sälen jedoch so heftig zu streiten, dass die Vorträge auf die Abendstunden verlegt wurden; am dritten und vierten Kongressnachmittag kam man sich über die Viersäftetheorie, Chirurgie und Diätetik in die Haare, die weiteren Nächte im Pariser Schloss setzte man sich nicht mehr nur fachlich auseinander, sondern beleidigte sich auch persönlich. Der stämmige Engländer Edward Jenner wurde schließlich handgreiflich, packte seinen Landsmann John Brown am Backenbart und stieß ihn gegen die Tür. Der in Berlin lehrende Christoph Wilhelm Hufeland ergriff Partei – und einen silbernen Kerzenständer – für Jenner, sein Weimarer Gegenspieler Johann Christian Stark setzte sich mit einem Faustschlag für Brown ein; der schmächtige Franzose Joseph-Ignace Guillotin und der vollbärtige Ire James Parkinson versuchten die Männer zu trennen, brachten damit aber den päpstlichen Leibarzt gegen sich auf, und aus der Rangelei einiger wurde eine Prügelei fast aller, die mit vielen Hämatomen, einigen Frakturen und mehreren Platzwunden endete.
Napoleon, der zu einem »ärztlich-neutralen Kongress« geladen hatte, sich von den Akademikern aber grundlegende Erkenntnisse im Hinblick auf die Kriegsmedizin erhofft hatte, fluchte »merde« und befahl eine Zuwendung an die von den Gelehrten verachtete Zunft der Wundärzte sowie die Einrichtung einer Akademie zu deren raschen Ausbildung. Warum zum Teufel hatte er nicht gleich die Praktiker der Chirurgie zu einem Treffen gebeten? Sein Leibarzt und sein Privatsekretär, auf deren Vorschlag hin sich die Akademiker versammelt hatten, bemühten sich um Schadensbegrenzung, und die medizinischen Koryphäen einigten sich daraufhin, sich in dieser Angelegenheit an ihre ärztliche Schweigepflicht zu halten und für den französischen Kaiser noch vor ihrer Abreise eine schriftliche Stellungnahme zu verfassen. Würde erst das niedere Geschäft der Wundärzte von Napoleon gefördert, wäre einer höheren Anerkennung von Badern, Quacksalbern und Hebammen in ganz Europa Tür und Tor geöffnet. Ohnehin zog es das gemeine Volk viel zu sehr zu den Heilern, die ohne jegliches Studium praktizierten.
So saßen die berühmtesten Ärzte jener Zeit drei Tage und Nächte in der französischen Hauptstadt an ihren Schreibtischen, um die Ehre ihres Berufsstandes ins rechte Licht zu rücken, der niederen Chirurgie nicht Vorschub zu leisten und um ihre Einkünfte zu sichern.
Seit dem Altertum, so führte der weltweit führende Theoretiker des Jahres 1811, John Brown, in seinem Schreiben an Napoleon aus, existiere die Viersäftetheorie, derzufolge der Mensch aus Blut, Schleim, schwarzer und gelber Galle bestehe. Nur wenn das Säftegemisch im Körper ausgewogen ist, sei man gesund. Wolle man die Alten plötzlich verachten? Brown wolle sich an dieser Stelle nicht darüber auslassen, dass auch Wasser, Luft, Erde und Feuer sowie Lebensalter und das Temperament der Menschen eine Rolle spiele – vehement wolle er hingegen die neueren Theorien eines Edward Jenner abstreiten, der glaube, ohne die innere Medizin und ohne Beachtung der Seele, Krankheiten bekämpfen zu können.
Edward Jenner, der in England vor einigen Jahren durch Experimente eine Behandlungsmethode gegen Pocken gefunden hatte, bezichtigte Brown der »akademischen Scharlatanerie«. Keiner könne die Viersäftelehre beweisen, sie sei ein reines Konstrukt. Sein Verfahren der Immunisierung durch Impfung hingegen ließe sich experimentell bestätigen, und dieser Beweisbarkeit gehöre die Zukunft. Sogar der Papst habe mittlerweile den Erfolg seiner Methode anerkannt, im Staate Bayern habe man die Impfung bereits verpflichtend eingeführt, und er sei sich sicher, weitere Länder würden diesem Beispiel folgen; mehr noch: das Grundprinzip des Verfahrens ließe sich sicherlich auch auf andere Krankheiten übertragen.
Hufeland betonte in seinem Schreiben die große Bedeutung der Diätetik und der von ihm weiterentwickelten Makrobiotik, derzufolge eine gute Gesundheit ganz wesentlich vom Organismus selbst geregelt würde, vorausgesetzt man ernähre sich gesund, bewege sich maßvoll und nutze die Heilkräfte der Natur. Auch Hufeland berief sich auf die Tradition des Altertums und zitierte Hippokrates, wonach ein tüchtiger Arzt ein guter Vorausseher sei. Durch Hufelands Unterstützung sei diese Theorie von einem gewissen Hahnemann weiterentwickelt worden, so dass als Behandlungsmöglichkeiten nun sogar Medizin in Form von kleinen Kügelchen, genannt Globuli, zur Verfügung stünde. Entschieden ablehnen würde er jedoch die Auffassung, wonach ein Mensch nur nach biologischen und physiologischen Mechanismen funktioniere, denn ohne einen eigenen Energiekern ließe sich das Leben nicht erklären.
Johann Stark, der Hufeland aus seiner Weimarer Führungsposition vertrieben hatte, spottete in seiner schriftlichen Darlegung über die Makrobiotik und beschrieb ausführlich, wie nach dieser Lehre ernährte Kinder schlecht heranwuchsen. Die »abstrusen Praktiken« – womit er auf Hahnemanns Homöopathie zielte – würde er nicht einmal in einem Nebensatz weiter ausführen, um den Kaiser damit nicht zu langweilen. Denn auch im Allgemeinen begrüße er Napoleons Regime, das den Klerikalen endlich die Macht beschnitt. Stark plädierte er in einer langen Fußnote ausführlich dafür, Papst Pius VII. weiter festzusetzen, um der Wissenschaft und Kunst auch künftig die nötigen Freiheiten einzuräumen, die sie dringend bräuchten. In einer anderen Fußnote warnte er Napoleon vor den Argumenten des päpstlichen Leibarztes. Dieser würde sicherlich wieder mit den allgemein menschlichen Ängsten und einer unausrottbaren Moral spielen und auf Krankheiten als Strafe Gottes hinweisen.
Der päpstliche Leibarzt Luigi Novesanto eröffnete seinen Bericht mit einer ausführlichen Erörterung der von Gott vorgesehenen Krankheiten als Strafen für sündiges Verhalten. In einem alphabetischen Katalog verzeichnete er die gängigsten Krankheiten und ordnete sie den Kategorien »Behandlungswürdig« oder »Gottesstrafe« zu. Eindringlich wies der päpstliche Vertraute außerdem darauf hin, den Wundärzten, Badern und Hebammen das Handwerk zu legen, da ihre Gottesferne nach Einstellung der Hexenprozesse ein neues, ungeahntes Ausmaß entfalte, das Volk diesen Scharlatanen vertraue und die jeweiligen Zünfte weit weniger Kontrolle über ihre Mitglieder ausüben könnten als akademische Reglementierungen.
»Merde«, rief Napoleon erneut aus, als er die ersten Schreiben überflogen hatte, jeder Feldscher könne ihm da mehr erklären! Sein Sekretär hatte die Stellungnahmen nach Ansehen der Ärzte sortiert und sie dem Kaiser in einer Mappe an den privaten Schreibtisch gebracht. Der kleingewachsene Feldherr schleuderte die Schreiben in eine Ecke, fragte: »Was soll das heißen?«, wartete keine Antwort ab und ergänzte: »Keiner weiß was, die streiten sich nur!« Der Sekretär, den jede Theorie – soweit er sie hatte verstehen können – für sich überzeugte, nickte mehrmals. Gab es eine Zunft oder einen anderen Berufsstand, in dem sich die Koryphäen derart widersprachen? War es denkbar, dass ein Feldherr den Nutzen der Kavallerie bezweifelte, ein anderer aber ausschließlich auf diese baute?
Der Privatsekretär sammelte die Blätter wieder auf, der französische Kaiser schüttelte den Kopf und sah für einen Moment ratlos und fragend drein. Der Bedienstete wich dem ungewohnten Blick aus, bis ihm die erlösende Bemerkung eines Arztes, die er zufällig auf dem Flur aufgeschnappt hatte, einfiel. Er schlug vor, die medizinische Elite zur Abreise zu veranlassen, man müsse sich nicht sofort für den einen oder anderen entscheiden, die Sachlage erfordere im Gegensatz zu militärischen oder politischen Fragen nicht sogleich ein Urteil. Womöglich könne man dieses sogar dem Lauf der Zeit überlassen, denn für den Kaiser seien vor allem die praktischen Kenntnisse der Wundärzte entscheidend. Napoleon nickte, der Sekretär wechselte schnell das Thema und verwies darauf, dass vor der kaiserlichen Tür die Erfinder warteten, für die man einen Wettbewerb zur Herstellung haltbarer Lebensmittel ausgelobt hatte.
Napoleon gab eine Geldanweisung für die sofortige Einrichtung einer Akademie für Wundärzte heraus, besprach mit zwei Generälen seinen nächsten Feldzug, ließ nach einer Mätresse schicken und die Erfinder vorsprechen. Einem von ihnen war es gelungen, Gemüse in Gläsern zu konservieren, und er erhielt das Preisgeld. Die Behälter stellten sich jedoch als kriegsuntauglich heraus, da sie zu schwer zu transportieren waren, und Napoleon besann sich wieder in allen Belangen auf seine alten Maximen. Die hießen, dass der Krieg den Krieg zu ernähren hatte, Ärzte allesamt Idioten seien und er nur seinem Instinkt vertrauen könne. »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« waren schließlich nicht auf alle menschlichen Bereiche anwendbar.
Als der Große Komet schließlich mit bloßem Auge am nächtlichen Himmel sichtbar wurde, schliefen alle Mediziner zum ersten Mal seit vielen Tagen und Nächten endlich wieder. Napoleons Leibarzt und der Privatsekretär des französischen Kaisers dankten bei Champagner dem in Fachkreisen unbekannten bayerischen Professor Aigner für dessen Hilfestellung in dieser diffizilen Angelegenheit, denn von ihm war der entscheidende Ratschlag gekommen, mit dem sie Bonaparte beruhigen konnten: Dies war kein Krieg, bei dem man sich sofort entscheiden müsste.
3.
Als sich der Große Komet des Jahres 1811 zum ersten Mal über dem europäischen Himmel zeigte, öffnete Lucilie Vinzenz ein Fenster im großen Saal der Münchner Gebäranstalt, um frische Luft in den Raum zu lassen. Lucilie sah ein ungewöhnliches Licht am nächtlichen Sternenhimmel, hatte jedoch keine Zeit mehr, noch einmal genau hinzublicken, denn man rief sie aus den verschiedenen Ecken des Saals zu den Schwangeren, Kreißenden und Wöchnerinnen. Die Oberhebamme mit den glänzend schwarzen Haaren steckte ein paar widerspenstige Strähnen, die sich aus ihrem Schopf gelöst hatten, zurück, ehe sie die Größe einer Muttermundöffnung ertastete, einem Lehrmädchen die Mischung für den wehentreibenden Himbeerblättertee erklärte, mit ihrer Stellvertreterin eine Kindswendung besprach, einer Magd zeigte, wie sie das Kind richtig an die Brust anlegen musste, bei einem Einlauf half und besorgt feuchte Tücher auf den Kopf einer Wöchnerin im Kindbettfieber legte.
Hinter jedem Paravent, mit dem Lucilie den Saal in kleine Bereiche hatte einteilen lassen, erwartete man sie heute, immer wieder strich sich Lucilie ihre von Blut, Schleim und Schweiß bedeckten Hände am dunklen Rock ab, und kaum hatte sie eine Frage beantwortet, benötigte man an anderer Stelle ihren Rat. Schnellen Schrittes bewegte sich die Oberhebamme von einem Patientenplatz zum nächsten, rückte da und dort ein Licht, ein Laken oder einen Gebärstuhl zurecht, schloss auf Wunsch der Hebammen wieder das Fenster und lächelte im Vorbeigehen aufmunternd den schreienden Kreißenden und erschöpften Müttern zu. Sie sprach dabei ruhig mit all den Weibern, bei denen sie etwas verweilte, bis sie eine freie Minute fand, um sich am Stehpult Notizen zu machen.
Lucilie nahm Tinte und Feder und schlug doch das dicke Heft, in das sie sonst fein säuberlich Aufnahme, Namen, Beobachtungen, Komplikationen und andere Anmerkungen notierte, heute nicht auf. Mit beiden Händen hielt sie das geschlossene Anstaltsbüchlein fest, denn ihr fehlte der Mut, ihrem Verdacht nachzugehen und die Kreuze hinter den Namen der vergangenen drei Monate zu zählen. »Es darf nicht sein«, flehte die Oberhebamme innerlich, schloss ihre braunen Augen mit den langen Wimpern und stemmte ihre ausgestreckten Arme auf den Hefteinband. Dabei nahm sie plötzlich die stickige Luft, das Geschrei und den stechenden Geruch nach Exkrementen im Raum wahr, so als würde sie den Saal zum ersten Mal betreten. Lucilie blickte ins Leere, bis ein Lehrmädchen, das Wasser geholt hatte, sie aus ihren Gedanken riss. Draußen würde sich ein Weib herumdrücken, ob die Frau Oberhebamme nicht nachsehen könne? Lucilie nickte, nahm ein Wolltuch und einen Becher Tee und war dankbar für die Gelegenheit, an die frische Luft zu kommen.
Beim Sendlinger Tor, nahe der mit Bäumen neu angelegten Sonnenstraße, lag der schlichte Bau mit der Hebammengebäranstalt hinter ein paar Häusern der neu entstehenden Vorstadt und vor einem weiten Feld. Lucilie trat vor die Eingangstür, drückte sie mit dem Rücken zu, stellte das Gaslicht ab und blieb mit dem Tee oben auf der Treppe stehen. Sie schaute über die Dächer der schlafenden Stadt hinweg in den nächtlichen Sternenhimmel. Ein kalter Aprilwind ließ sie leicht frösteln, sie zog das Wolltuch enger um Schultern und Hals und nahm einen Schluck Tee. Tief sog sie die frische Luft ein. Sie würde hier einfach warten, bis sich das Weib zeigte. Meist dauerte es keine fünf Minuten, bis die Frauen hinter einem Baum, aus dem Dunkel der Straße oder vom Feld her auf sie zukamen und ihr Anliegen vortrugen. Manche schmissen sich verzweifelt vor ihr auf den Boden, andere schilderten umständlich ihre unglückliche Lage, und wieder andere weinten still vor ihr und vor diesem Haus, auf das sich all ihre Hoffnungen richteten.
Wartend bemerkte Lucilie wieder das seltsame Licht am Sternenhimmel. Es schien sich zu verbreitern. Lucilie kniff die Augen zusammen, sah zunächst schärfer, doch die Himmelserscheinung verschwamm wieder vor ihren Augen, und eine Wolke schob sich davor. Lucilie fragte sich, was dieses Licht war. »Aber was ist das andere nur?«, drängte sich Lucilie auf, und sie sah die Sterbekreuze im Heft wieder vor sich. Sie schloss die Augen, und ein Schauder durchlief sie; sie sah die Gesichter zu den Namen; sie sah in ein Dunkel, das sie nicht sehen wollte, und begann zu zittern.
»Gnädige Frau«, hörte Lucilie eine Stimme neben sich. Lucilie zuckte zusammen und ließ den Becher mit dem Tee fallen. Ein Mädchen, das fünfzehn Jahre alt sein mochte, trat auf sie zu und blieb drei Stufen unter ihr stehen.
»Entschuldigung«, sagte das Mädchen und bückte sich nach dem Becher. Lucilie warf ihm einen strengen Blick zu und ärgerte sich über sich selbst. Seit wann war sie so schreckhaft? Mannsbilder mieden das Haus weiträumig, und vor den Weibern in Not brauchte sie sich weiß Gott nicht zu fürchten.
»Was willst denn hier, mitten in der Nacht?«, fragte Lucilie wie schon so oft. »In anderen Umständen scheinst ja nicht zu sein!«
Das Mädchen hielt ihr den leeren Becher hin.
»Das möchte ich der Frau Oberhebamme persönlich sagen!«
Nicht einmal ganze eineinhalb Meter war Lucilie groß und ihr Körperbau so zierlich, fast knabenhaft, dass Unbekannte ihr nicht zutrauten, sie könnte eine Hebamme sein, und schon gar nicht Bayerns Oberhebamme.
»Bitte, bringen Sie mich zu ihr! Ich komm sonst nicht weg von daheim!«, kam das Mädchen Lucilies nächster Frage zuvor. »Der Papa erschlagt mich sonst.«
Lucilies Augen hatten sich an das schwache Licht der Gasfunzel gewöhnt, sie bemerkte rote und blaue Flecken auf der Wange des blonden Mädchens.
»Ich weiß, wie weh die Schläge vom Vater tun.« Lucilie bemühte sich stets, ihr Verständnis nicht allzu sehr zu zeigen, um so das Gespräch schnell zu beenden und den Weibern einen größeren inneren Aufruhr zu ersparen.
»Wir bringen hier Kinder zur Welt und machen keine weg!«, sagte Lucilie bestimmt. Und sie fügte hinzu, was sie immer hinzufügte: Freilich sei es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass die Mannsbilder sich der Sünde hingeben könnten, ohne die Folgen zu tragen; dass man die Uhr nicht mehr zurückdrehen könne und nun eben Leben da sei; dass sie selbst in Teufels Küche käme, wenn sie »so etwas« tun würde. Und wie stets schloss Lucilie aufmunternd, dass es immer Wege und Möglichkeiten geben würde, einen Bangaden großzuziehen, halb München sei unehelich geboren, und dass die Magd jetzt tapfer sein müsse und an die Frucht in ihrem Bauch denken sollte. Nur ihren Namen sollte sie ihr nicht verraten, sonst müsste sie es dem Pfarrer melden, aber drei Wochen vor der Niederkunft könne das Frauenzimmer wiederkommen und bei freier Kost und Logis in der Anstalt entbinden.
»Sie sind die Frau Oberhebamme Vinzenz!«, rief das Mädchen zu Lucilies Erstaunen. So gelassen hatte noch kein Weib auf ihre Ausführungen reagiert.
»Ich hab doch gar keine Frucht im Leib! Ich möchte lernen bei Ihnen!«, fuhr das Mädchen mit starker Stimme fort. »Ich will Hebamme werden!«
»Aha.« Lucilie lächelte. Dieses Mal war es ihr also erspart geblieben, die Verzweiflung auszuhalten und eine Ansicht zu vertreten, an der sie selbst immer mehr zweifelte.
Es begann zu regnen, und während Lucilie geschützt unter einem Vordach stand, prasselten bald immer mehr Tropfen auf das Mädchen. Ob aus Respekt vor ihr oder weil sie so bei der Sache war – das junge Weib nahm die Nässe unbeeindruckt hin.
»Und das Lehrgeld? Wo willst das hernehmen, wenn du von daheim weg bist?«, fragte Lucilie. Das Mädchen stieg die Stufen zu ihr hinauf und zog eine goldene Kette aus der Schürzentasche.
»Die hat mir die Mama zugesteckt, langt das?«
Lucilie nickte, ohne die Kette genauer zu betrachten. Das Mädchen sah ihr unerschrocken in die Augen, und Lucilie glaubte in seinem Blick einen festen Willen und Klugheit zu erkennen. Mehrmals hatte Lucilie schon Schülerinnen eingestellt, die das Lehrgeld nicht ganz aufbringen konnten, und eigentlich war sie damit immer gut gefahren, denn diese Mädchen strengten sich mehr als andere an, um ihre ärmliche Herkunft wettzumachen. Sie kannten meist Dreck, Geschrei und Gestank und scheuten sich nicht, auch in den misslichsten Lagen mit anzupacken.
Trotzdem führte Lucilie das Mädchen, das Eva hieß, durch den Saal, um ihre Nervenstärke zu prüfen. Eva sah allem unerschrocken zu und nickte beim Stehpult, ja, natürlich, sie hätte sich eine Gebäranstalt auch gar nicht vornehm vorgestellt, sie möchte den Beruf der Geburtshelferin lernen.
Am nächsten Tag hatte Lucilie eine eifrige und geschickte Helferin, deren Wesen und Aussehen sie an sich selbst vor vielen, vielen Jahren erinnerte: Klein und zierlich war die Eva, aber stark und zäh. Glänzendes Haar säumte das schmale Gesicht mit den vollen Lippen, nur die Backenknochen und die Nase zeigten sich nicht so markant wie bei ihr, und die blonde Haarfarbe ließ Eva sanfter wirken. Mit ihren flinken Augen behielt die Schülerin auch im Trubel den Überblick, und nach einer Woche musste Lucilie ihr nichts mehr anschaffen, denn Eva wusste ganz von alleine, wo sie anzupacken und wo sie zu warten hatte. Sie holte das Essen aus der Küche und deckte den Tisch im kleinen Speisesaal, hielt Klistiere und Taufwasser bereit, schürte den Ofen für Teewasser an, wechselte Kerzen, reichte eine Geburtszange, leerte die Kübel mit Exkrementen, sprach da und dort ein aufmunterndes Wort und sah ruhig und interessiert zu, wenn Lucilie einen Bauch abtastete und den Geburtstermin ausrechnete, einen Muttermund sanft zu weiten versuchte, Kräutermischungen in Scheiden rieb oder gar ihre berühmten Handgriffe anwendete, die ein Ungeborenes im Bauch zu wenden vermochten.
Doch statt sich über die Geschicklichkeit des neuen Lehrmädchens zu freuen, reagierte Lucilie auf Eva zunehmend gereizt und wies sie oft schroff zurecht. Die Oberhebamme konnte sich ihren ungerechten Zorn auf den jugendlichen Eifer dieses Mädchens selbst nicht erklären.
4.
Denaro hörte einen Wolf aufheulen. Der Doktor wunderte sich, dass es in Tirol noch Wölfe gab. Als er die Jagdhütte beim kleinen Bergdorf Marienstein vor ein paar Jahren erworben hatte, hieß es, Bären und Wölfe seien in dieser Gegend schon seit »hundert Jahr« nicht mehr gesehen worden. Der Fünfundvierzigjährige ließ Mörser, Spritzen und Mohnkapseln auf dem Tisch liegen, nahm noch einen kräftigen Schluck Rotwein, griff zu seinem Gewehr, schlug die Tür der Hütte auf und sah in die nächtliche Bergwelt hinaus, doch das Tier war nicht mehr zu hören.
Die schneebedeckten Alpen glitzerten unter dem klaren Sternenhimmel. Denaro sah seinen Atem den Beschlag des Jägerstutzens bedecken und wieder verschwinden. Dazwischen spiegelte sich sein Gesicht in dem Metall, und Denaro dachte an die Worte der Fürstin, die ihn als »Haudegen alter Schule« bezeichnet hatte. Als kundiger Anatom hätte er sich präziser beschrieben: »Hervorstehende Backenknochen, eine hohe Stirn, gerade Nase, lebhafte Augen, markantes Kinn, volles Haar. Muskulöse Statur, überdurchschnittliche Größe. Furchtloses Auftreten.« Tatsächlich hatte ihn seit Jahren keiner mehr ängstlich gesehen, und Denaro überlegte, wo er seine Furcht im Laufe der Zeit verloren hatte. Mit »vermutlich auf dem Schlachtfeld« beendete er seine memmenhaften Überlegungen, beschloss, demnächst in Salzburg wieder die rothaarige Dirne aufzusuchen, mehr von dem süditalienischen Wein zu bestellen und ein neues Skalpell anfertigen zu lassen. Ein Uhu mit seinen mächtigen Schwingen glitt dicht über ihn hinweg, und die Gedanken fielen wieder von ihm ab, wie so oft hier draußen, wo er sich in der Abgeschiedenheit unter den majestätischen Bergen mit der Welt verbunden fühlte wie sonst nirgends.
Fast hätte Denaro den Kometen nicht bemerkt. Er erschien zunächst schwach, der Arzt kniff die Augen zusammen, um ihn erkennen zu können. Bald strahlte der Stern jedoch immer heller, und Denaro vergaß darüber auf Geräusche zu achten. Als der Himmelskörper schließlich ganz deutlich zu sehen war, lächelte Denaro. Alleine dafür, dieses Ereignis hier vor seiner Hütte sehen zu können, war es richtig gewesen, nicht an diesem lächerlichen Kongress in Paris teilzunehmen. Die Kollegen würden sicher eifrigst ihre gelehrten Theorien vertreten – und dabei im Grunde auch nicht mehr wissen als die ganzen Heiler und Quacksalber, die sie nur deshalb hassten, weil sie mit ihren praktischen Kenntnissen oft ein besseres Geschäft machten. Er selbst konnte sich zwar auch nicht damit rühmen, den Kern der Krankheiten zu kennen, aber er behauptete es auch nicht. Statt sich in sinnlosen Disputen zu ergehen, befreite er lieber Bauern und Gesinde von ihren Leiden. Er forschte lieber in der Abgeschiedenheit der Bergwelt oder sezierte interessante Leichen in Salzburg.
Denaro vermutete, dass der Komet auch in Frankreich zu sehen sein müsse. Er konnte sich aber nicht vorstellen, dass die werten Kollegen dafür jetzt Zeit oder Muße übrig hätten. Plötzlich hörte er ein Rascheln und drehte sich schnell, aber lautlos, mit dem Gewehr im Anschlag, um. Er sah ein Mädchen, das er von irgendwoher kannte, durch die Dunkelheit davonhuschen.
5.
Eine Woche nachdem Lucilie Eva eingestellt hatte, klärte sich der wolkenverhangene Aprilhimmel über München etwas auf, und man erwartete Professor Aigner in der Gebäranstalt. Seit Monaten hatte sich der Landshuter Hochschullehrer nicht mehr in München gezeigt und stattdessen nur Studenten und Assistenten zur Münchner Hebammengebäranstalt geschickt. Es war Teil des Abkommens, für das Lucilie Jahre gekämpft hatte und das sie vor neun Jahren mit dem Stadtrat geschlossen hatte: München stellte das Erdgeschoss eines Gebäudes zur Verfügung und entlohnte die Hebammen, damit Arme, Ledige, Huren und Inhaftierte dort entbinden konnten und neue Geburtshelferinnen in den Räumen ausgebildet wurden. Im Gegenzug durften an vier Tagen im Monat Studenten und Ärzte dort die weibliche Anatomie am lebenden Objekt studieren, bei Entbindungen mitwirken oder auch Eingriffe vornehmen.
»Nie«, hatte Lucilie damals auf den Vorschlag des Magistrats geantwortet, »nie im Leben lass ich zu, dass die Weiber sich dabei vor den Männern entblößen müssen!« Doch Anton und Professor Aigner hatten ihr gut zugeredet – mit einer eigenen Gebäranstalt hätte sie bayernweit, wenn nicht sogar deutschlandweit die historische Chance, ihr enormes Hebammenwissen zu beweisen und Schülerinnen fachgerecht auszubilden; den armen Weibern stünde eine kostenlose medizinische Betreuung zur Verfügung, und sie müssten nicht Kurpfuscher aufsuchen; außerdem könne man damit den vielen Kindsmorden vorbeugen, zu denen sich die Frauen hinreißen ließen, wenn sie in aller Heimlichkeit niederkamen. Lucilie hatte schließlich eingewilligt und hasste seitdem Dienstage.
Jeden dritten Dienstag des Monats kamen die Mannsbilder aus Landshut und betrieben hier ihre »Studien« für vier Tage. In der Früh schon bereitete sie die Schwangeren und Wöchnerinnen darauf vor, dass heute Mediziner kämen und die Frauen ihre natürliche Scham vor ihnen ablegen müssten. Mittags kamen die Ärzte und Studenten und schauten den Weibern in die Scheiden, betasteten ihre Brüste, operierten sogar manchmal und redeten über die armen Frauen wie Schlachtvieh – schon mehrmals waren die Weiber trotz ihres Zustands vor ihnen geflohen und hatten lieber alleine auf dem Feld hinter der Anstalt ihr Kind zur Welt gebracht, als sich den schamlosen Blicken und herablassenden Bemerkungen der Mannsbilder auszusetzen.
»Dafür habt ihr hier Kost, Logis und eine medizinische Betreuung umsonst«, beendete Lucilie ihre heutige Dienstagsankündigung, und die Frauen schienen sich seufzend in ihr Schicksal zu fügen.
»Darum also kommen bloß Arme, Ledige und Inhaftierte her!«, rief Eva entsetzt aus. »Die anderen können sich daheim eine Hebamme leisten!«
Lucilie strafte die Schülerin mit einem bösen Blick. »Kannst nicht deinen Mund halten?«, fragte sie unwirsch, und Eva blickte daraufhin verschämt zu Boden, nahm einen Kübel und ging Wasser holen.
Lucilie sah ihr nach, ja, genau so hatte sie sich auch darüber empört und dann doch mit der Wirklichkeit einen Kompromiss geschlossen. Und dabei hatte sie noch Glück, denn Professor Aigner, der zugleich der oberste Hausherr in der Gebäranstalt war, vertraute Lucilie vollkommen und ließ sie gewähren. Er verteidigte ihre Arbeit vor dem Magistrat und innerhalb der medizinischen Kreise, auch und vor allem nach Antons Tod. Denn seitdem ihr Mann, ein angesehener Apotheker der Stadt, vor einem halben Jahr gestorben war, trauten sich die Ärzte der Stadt bisweilen offen ihre Kompetenz zu bestreiten. Sie war an keiner Universität ausgebildet worden, und ihr fehlte ein »akademischer Rat« an ihrer Seite.
Lucilie stand vor dem Anstaltsbüchlein, das sie seit einer Woche nicht mehr aufgeschlagen hatte, und bekam Angst. Seit drei Monaten starben hier immer mehr Weiber, immer öfter musste man auch Neugeborene tot hinaustragen. Was wäre, wenn die Ärzte doch recht hatten und ihr eine solide wissenschaftliche Basis für ihr Tun fehlte? Lucilies Hände begannen zu zittern. Sie versuchte, ruhig durchzuatmen und vor den anderen ihre Furcht zu verbergen.
»Sie zittern ja!«, sagte plötzlich Eva neben ihr. »Ist Ihnen nicht gut?«
»Stell nicht andauernd so dumme Fragen!«, herrschte Lucilie sie an, und im nächsten Moment taten ihr die Worte leid. Eva schossen Tränen in die Augen, sie drehte sich um und trug die Wassereimer in den hintersten Teil des Saals, zu der fiebernden Wöchnerin. Lucilie schüttete Essig in einen Topf, den sie auf den Ofen stellte, und ging zum mittleren Fenster, das sie dem Protest ihrer Stellvertreterin Agnes zum Trotz öffnete. Frische Luft wäre hier dringend vonnöten, und die Essigdämpfe sollten schlechte Teilchen in der Luft vertreiben, begründete Lucilie ihre Handlung, und außerdem könne man dem bald eintreffenden Professor Aigner und seinen Studenten diesen Gestank nicht zumuten. Die große, flachbrüstige Agnes widersprach dem ungewohnt scharfen Ton Lucilies nicht. Sie und die anderen Hebammen gingen zur »Dienstagsordnung« über und schoben die drei Gebärstühle in einer Ecke zusammen; sie wiesen die Weiber an, sich hinzulegen; sie holten die beiden Geburtszangen aus dem Kasten und legten sie bereit; sie beschmutzten sich extra die dunklen Röcke mit Blut und Fruchtwasser, damit die Herren auch sehen würden, was sie schon alles gearbeitet hatten. Lucilie bemerkte, wie Eva dies staunend und genau beobachtete, und schaffte ihr an, nach der fiebernden Wöchnerin zu sehen.
Lucilie erklärte einer Hochschwangeren, wie sie bei Wehen zu atmen hatte, und folgte Eva, die der Fiebernden kalte Umschläge auf die Stirn legte und ihr einen Tee, den sie nach Lucilies Anweisung aus Holunderblüten zubereitet hatte, in kleinen Schlucken verabreichte. Eva hatte das neugeborene Mädchen der Wöchnerin auf den Arm genommen und summte ein Lied. Als Lucilie näher kam, verstummte Eva.
»Kannst ruhig weitersingen, das tut ihnen gut«, meinte Lucilie, doch die Schülerin legte stumm den Säugling wieder zur Mutter, erneuerte den feuchten Lappen und trat ein paar Schritte zurück, um der Oberhebamme nicht im Weg zu stehen. Die Fiebernde schien für einen Moment zu sich zu kommen und sah Lucilie fragend an.
»Kommen die Mannsbilder heut wieder?«, fragte sie schließlich, und Lucilie nickte.
Das Weib begann zu weinen. »Die stechen mich auf, das überleb ich nicht!«, sagte sie.
Sie musste noch vor ihrer Niederkunft etwas vom Gespräch der Studenten im vergangenen Monat mitgehört haben. Tatsächlich hatten die jungen Burschen bei einer anderen Fiebernden in Erwägung gezogen, durch die Scheide in den Bauch der Frau zu stechen, um die schlechten Säfte abzulassen.
»So ein Schmarrn«, beruhigte Lucilie die Kranke sogleich und nahm ihre heiße Hand. »Das waren dumme Studenten, die von nichts eine Ahnung haben. Heut kommt der Professor Aigner, der versteht sich wirklich auf Krankheiten.« Dass auch Professor Aigner weder eine Erklärung für das Kindbettfieber hatte noch eine wirkungsvolle Behandlung wusste, verschwieg Lucilie. Die Oberhebamme drückte die Hand der Kranken, lächelte ihr aufmunternd zu und schickte einen Stoßseufzer zum Himmel – möge der Herrgott ein Einsehen haben und dieses Frauenzimmer verschonen, es hatte elf Kinder daheim, und der Mann war in der Vorstadt Au von einem Flößer erschlagen worden.
Kalte, frische Luft erfüllte nun den ganzen Raum. Aus der hinteren Ecke schrien zwei Säuglinge mit einer noch dünnen Neugeborenenstimme, konnten jedoch schnell beruhigt werden.
Lucilie überlegte, ob sie nicht Bitterklee und Brennnessel mischen und daraus einen Wickel machen sollte, obwohl auch dieser nicht wirklich etwas gegen das Kindbettfieber ausrichten konnte. Das Weib fiel wieder in einen unruhigen Schlaf, einen Moment war es im Saal richtig still. Lucilie hörte Wasser auf den Boden klatschen und ein Geräusch, als würde man den Holzboden bürsten. Sie drehte sich um und sah Eva tatsächlich kniend den Eichenboden schrubben.
»Was machst denn du da?«, empörte sich Lucilie.
Eva hob trotzig den Kopf. »Putzen. Sie selbst haben gesagt, ich soll mich nützlich machen, wenn nichts Dringendes zu tun ist.« Die Schülerin arbeitete weiter.
»Aber doch nicht ausgerechnet heut!« Lucilie schüttelte den Kopf. Eva legte die Bürste zur Seite und stand auf.
»Frau Oberhebamme, jetzt möchte ich einmal wissen, was Sie gegen mich haben!«
Lucilie gab ihr keine Antwort darauf und erklärte stattdessen, dass man gerade an solchen Dienstagen sehen sollte, welche Spuren ihre Arbeit hinterließ, wie fleißig sie hier arbeiteten. Das wiederum geschehe nicht aus Eitelkeit, sondern weil der Magistrat die Anstalt hier finanziere und die Ärzte, speziell Professor Aigner, ihr Tun beurteilten.
»Und warum müssen sich die Weiber dann hinlegen?« Eva schien wirklich alles genau wissen zu wollen.
»Weil das die angemessene Lage für Kranke ist«, entgegnete Lucilie und fügte hinzu, »glauben die Ärzte. Und so können sie auch besser operieren, wenn es sein muss.«
»Aber Kinderkriegen ist doch keine Krankheit. Das ist doch ganz normal«, widersprach Eva.
Was für kluge Worte aus dem Mund einer Schülerin, die erst eine Woche bei ihr lernte!
»Das hast schön gesagt«, meinte Lucilie anerkennend, und Eva errötete vor Freude über das erste Lob der Oberhebamme. Sie bückte sich wieder und putzte weiter, die vorige Mahnung Lucilies schien sie vergessen zu haben. Lucilie ließ sie gewähren, sah noch einmal zur Fiebernden und zwang sich dann dazu, das Anstaltsheft aufzuschlagen, um auf den ärztlichen Besuch vorbereitet zu sein.
In den vergangenen drei Monaten, so zählte Lucilie, waren mehr Frauen hier an Kindbettfieber erkrankt und gestorben als im ganzen Jahr zuvor. Lucilies Hände zitterten, als sie das Heft wieder schloss. Alles Mögliche kam ihr in den Kopf: Enthielt eine der getrockneten Pflanzen, mit denen man hier Tees zubereitete, plötzlich giftige Substanzen? Hatte eins der Weiber, die ihren Körper verkauften, eine neue Krankheit eingeschleppt? Breiteten sich schlechte Säfte über die Luft aus? Lag es an den Vorhängen, die sie vor drei Monaten im Saal hatte anbringen lassen, damit die Frauenzimmer sich heimeliger fühlen konnten? Lucilie überprüfte ihre Aufzeichnungen: Die Toten hatten verschiedene Tees getrunken und verschiedene Salben bekommen; seit zwei Monaten war keine Unehrenhafte unter den Schwangeren; und an den Vorhängen konnte es auch nicht liegen, entbanden doch all die Weiber, die es sich leisten konnten, daheim auch mit Vorhängen. Gab es vielleicht doch schlechte Strömungen in der Luft, die das Wochenbettfieber hereintrugen? Sollten deshalb nicht die Fenster geschlossen bleiben, wie ihre Stellvertreterin stets forderte?
Lucilie stand bei der Kranken, die das Bewusstsein verloren hatte, als der dicke Doktor Rappenstein von hinten auf sie zutrat.
»Na, sind wir mit unserer Hebammen-Weisheit am Ende?!«, fragte Aigners Stellvertreter mit süffisantem Lächeln. Der Arzt mit dem Backenbart war bekannt für sein Vorgehen gegen Kurpfuscher, zu denen er bisweilen auch Bader, Wundärzte und Hebammen zählte.
»Ja«, gab Lucilie unumwunden zu und missachtete ihre Abneigung gegen den Doktor mit dem Stiernacken. »Schnell, schauen Sie!«
»Wenn es nicht schon zu spät ist«, entgegnete Rappenstein mit einem flüchtigen Blick auf die Sterbende. »Wenn Sie glauben, uns erst nicht rechtzeitig holen zu lassen, um hinterher unser Unvermögen demonstrieren zu können, dann wird das ein rechtliches Nachspiel haben!«
Lucilie blieb die Sprache ob dieser Unterstellung weg, ihr wurde schwindlig, und sie hielt sich am seitlichen Kasten fest. Rappenstein lachte laut dröhnend, als er sah, wie die Oberhebamme aus der Fassung geraten war. Sie solle doch nicht alles so bierernst nehmen, sagte er und klopfte Lucilie freundschaftlich auf die Schulter.
Umständlich erklärte Doktor Rappenstein daraufhin den Studenten den vom Menschen, also den Männern, abweichenden Körper der Frau. Die Mannsbilder studierten die Geschlechtsteile an der Sterbenden eingehend, bis Rappenstein das Weib zwar noch zur Ader ließ, aber dabei ausführte, dass dies wohl auch nicht mehr helfen würde. Man ließ einen Pfarrer holen, und der Arzt ging nach der Saaldurchsicht mit Lucilie zum Stehpult, um das Anstaltsbuch zu prüfen. Den dicken Mediziner schienen die zunehmenden Todesfälle nicht zu interessieren, er überprüfte lediglich die Herkunft der Frauen, denn nur Münchnerinnen oder solche, die in München geschwängert worden waren, durften nach Anweisung des Magistrats kostenlos aufgenommen werden. Er hatte nichts zu beanstanden, obwohl Lucilie die Dienstbücher oder polizeilichen Scheine der Weiber nie kontrollierte und es so ein Leichtes war, einfach etwas zu behaupten. Ihre Stellvertreterin und die anderen Hebammen hatten sie schon zu mehr Sorgfalt gemahnt, doch Lucilie lehnte dies ab, sollte doch einmal genauer geprüft werden, würde sie sich einfach dumm stellen und die Aufnahmen alleine auf ihre Kappe nehmen.
Heiter berichtete Rappenstein Lucilie schließlich von seinem Besuch in der Oper und der Begegnung mit dem König. Der Arzt stöhnte, dass die Tage in München nun besonders anstrengend seien, weil Professor Aigner den Stundenplan umgestellt habe und er vor dem Besuch der Gebäranstalt mit den Studenten jetzt in die Münchner Gerichtsmedizin ginge, wo er mit all den Neulingen die Leichen seziere, die der Amtsarzt nach seiner Beschau übrig ließ, denn in Landshut gab es zu wenige Tote für so viele Studenten. Mit der abschließenden Bemerkung, dass es in diesem Monat bei dem heutigen Besuch bliebe, weil man eine Exkursion nach Wien geplant habe, und dass es um Weiberleut, die sich zu etwas Besserem aufschwingen wollten, schlecht bestellt sei, verließ Rappenstein mit seinen Studenten die Gebäranstalt.
Abends trugen Eva und eine Magd die Tote hinaus. Lucilie fühlte sich ausgelaugt und leer. Achtundvierzig Stunden hatte sie – abgesehen von kleineren Schlafpausen – ihren Dienst versehen. Doch der wahre Grund der Erschöpfung, das wusste Lucilie, lag in ihrem Inneren. Sie spürte sich hilflos dem Tod, den Ärzten und einer Politik, von der sie nichts verstand, ausgeliefert. In Eva sah sie, welch einen Schwung jugendlicher Glaube zu geben vermochte. Lucilie dagegen hatte sich in ihrem Leben nie kraftloser und ängstlicher gefühlt. Sie würde noch die Zwillinge entbinden, morgen würde man sie nicht brauchen, da die Ärzte nicht kamen, es war an der Zeit, dass sie die ganze Gebäranstalt vergaß und heim zu ihrem Toni eilte.
6.
Denaro atmete schnell und stöhnte noch einmal auf, er empfand eine tiefe Befriedigung und drehte sich von dem Mädchen auf der Pritsche in der Jagdhütte herunter. Für einen Moment fiel ihm der Name des jungen Dings nicht mehr ein, dann erinnerte er sich, Marie hieß sie. Selten hatte er mit so einer Lust einen weiblichen Körper besessen. Marie war jung, dunkelhaarig, prall und »mit Eifer bei der Sache gewesen«, dachte Denaro. Sie war schon vor einer Woche hier aufgetaucht, sie hatte das Geräusch verursacht, das er für einen Wolf gehalten hatte. Dieses Mal war er so schnell zu ihr hingesprungen, dass sie nicht wieder davonlaufen konnte. Gewundert hatte er sich nur, dass sie so leicht, ganz ohne Worte, mit ihm in die Hütte ging und sich ausziehen ließ. Beschwor am Ende der Komet bei den Berglern einen Aberglauben, der es erlaubte, sich zwanzig Jahre älteren Männern hinzugeben?