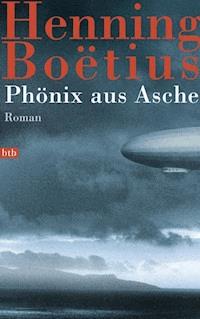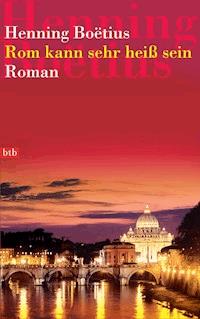Inhaltsverzeichnis
Inschrift
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Copyright
Ich bin das, was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin, mir selbst ein unerklärlich Rätsel, bin ich entzweit mit meinem Ich!
E.T.A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels
1
Es gibt ein Alter, in dem man sich vorkommt wie ein Baum, der abzusterben beginnt. Die Krone lichtet sich, die Rinde löst sich ab, die Wurzel verliert an Kraft. Das Knarren des Stammes im Wind hört sich verdächtig an, und das Holz bietet dem Borkenkäfer des Zweifels keinen Widerstand mehr.
Vielleicht versucht man dann, durch einen nach innen gerichteten Blick, die Jahresringe zu zählen. Und nicht nur zu zählen, sondern auch ihre Qualität zu begutachten, nach beginnender Fäulnis zu suchen. Schließlich sind die Ringe alle verschieden, denn keines der vergangenen Jahre glich dem anderen. In günstigen Jahren sind sie breit und von guter Konsistenz, in Zeiten großer Trockenheit eher schmal und brüchig.
In einer solchen Lebensphase war ich jetzt wohl. Ich war unlängst sechzig geworden. Meinen Geburtstag hatte ich in der Blauen Maus gefeiert. Viel Bier, viel Genever waren geflossen, alles auf meine Rechnung natürlich. Ich meine die freundlichen Schläge von Händen auf meinen Schultern immer noch zu spüren. Sie sollten etwas Tröstliches, Aufmunterndes haben, das machte sie so fatal. Offenbar hatte ich derlei Zuwendung inzwischen bitter nötig.
Die Blaue Maus in dem windschiefen Haus an der Gracht ist immer noch meine Lieblingskneipe. Sie ist für mich das eigentliche Herz von Groningen, dieser Stadt, die mir zuweilen vorkommt wie eine leichtlebige Matrone. Ich kenne einige Stammgäste seit Jahrzehnten und natürlich den Wirt, der immer noch ganz der Alte ist. Im Gegensatz zu mir schien er sich kaum verändert zu haben. Seine Glatze, sein glänzendes, rotes Gesicht, seine vierschrötige Gestalt strahlen Selbstvertrauen und innere Stabilität aus. »Was ist los mit dir, Piet«, sagte er. »Du wirkst auf mich wie ein leergeräumtes Grab. Da gibt es noch ein paar Knochen, aber ansonsten ist alles vorbereitet für den neuen Bewohner.« Er hatte zuweilen eine ziemlich drastische Art, sich auszudrücken.
»Eigentlich geht es mir ziemlich gut«, sagte ich. »Und doch auch wieder nicht, wenn ich meine allgemeine Lebenssituation betrachte.«
»Was meinst du damit?«
»Nun, ich meine die Art wie ich lebe, was ich so mache, was dabei herauskommt. Ich komme mir vor wie ein Schiff vor Anker, dessen Ladung verrutscht ist. Ich bewege mich nicht mehr voran und bin dennoch in der Gefahr zu kentern.«
»Verstehe. Und jetzt willst du einiges über Bord werfen, um wieder ins Lot zu kommen. Und dann willst du Anker lichten und Fahrt aufnehmen.«
»So ist es. Nur weiß ich leider nicht, was die Krängung verursacht und wie ich das verrutschte Stückgut über die Reling bekomme. Vielleicht liegt es daran, dass ich zu viele Kompromisse eingegangen bin, im Gefühlsleben genauso wie beruflich.«
Er lachte. »Mein Guter, das, was wir machen, ist immer von Kompromissen geprägt. Ist das Leben nicht überhaupt ein einziger Kompromiss zwischen Geburt und Tod?«
Ich nickte und blickte mich um. Die meisten Gäste waren bereits gegangen. »Du weißt es so gut wie ich, mein lieber Piet, in allem, was wir tun, steckt immer ein bisschen Geburt und ein bisschen Tod. Beides hält sich im Idealfall die Waage.«
Er stellte drei Schnapsgläser auf die Theke. Dann schenkte er sie randvoll mit Genever. »Die Runde geht auf mich. Ich trinke auf den Kompromiss. Du trinkst zwei. Einen auf das Leben und einen auf den Tod. Das wird dein Schiff wieder ein bisschen aufrichten.«
Nachdem der Wirt seinen Laden geschlossen hatte, gingen wir in die Innenstadt auf einen jener legendären Kneipenbummel der Wirtsleute, bei denen ich als junger Mensch so gerne mitgemacht hatte. Die Anzahl der Lokale in Groningen ist frappierend. Doch alle gleichen sich irgendwie. Bunte Lichter, milde Farben, sanfte Holztöne, rauchige Balken, kupferne Zapfanlagen. Überall wurde getrunken und gegen laute Musik angeredet. Es war wie auf einem Basar der Illusionen. Jeder sein eigener Gefallener, jeder sein eigener Erlöser.
»Auf welchem Planeten sind wir hier eigentlich«, schrie ich meinem Begleiter ins Ohr. Aus den Lautsprecherboxen kam lauter Rap.
»Dies ist das Ende der Welt«, schrie er zurück. »Der Abgrund, an dem wir stehen. Da geht es tief hinab in die Zukunft. Die Polkappen tauen, unsere Heimat wird bald verschwinden, eine Kleiwüste, Salzwiesen, das Vorland von Deutschland.«
Wir tranken unser Bier und jeder einen doppelten Genever. Dann gingen wir hinaus auf die regenglänzende Straße und folgten ihren bunten Pfützen zum nächsten Lokal, das gerade zumachte und dessen Wirt sich zu uns gesellte auf der Suche nach einem Trinkhafen, der noch offen war.
2
Ich hatte mit sechzig offenbar eine unsichtbare Lebensgrenze überschritten. Physisch fühlte ich mich älter, doch seelisch immer noch hinter meinen Jahren zurück. Das letzte Jahr hatte begonnen wie seine Vorgänger. Ich versuchte, jene fatale Unfreiheit der Freiheit zu genießen, keinen Beruf mehr auszuüben. Meine Arbeit als Spezialist für Auslandsfälle bei der Groninger Mordkommission hatte ich längst aufgegeben, ebenso wie meine albernen Versuche, immer noch die Frau meines Lebens finden zu wollen. Seit dem Tod meiner letzten großen Liebe, der Schottin Dale, und seit dem Ende meiner Beziehung zu Nina, einer Römerin, hatte ich mich zurückgezogen in ein komfortables Singleleben, das ich im Wesentlichen mit Hilfe des Geldes finanzierte, das ich geerbt hatte. Ich schwebte über der Erde, wie in einer Hängematte, die an zwei inzwischen toten Bäumen festgemacht war: meiner Mutter und meinem Vater.
Die Polizistin Dale war eine sehr emanzipierte Frau gewesen. Sie war das Opfer dunkler, verbrecherischer Kräfte geworden. Nina, die Kunststudentin, hatte ich während meines Versuchs, einen Fall in Rom zu lösen, kennen gelernt. Sie war eher eine Kindfrau, wie sie sich viele Männer erträumen. Sie war mir in meine Heimat gefolgt, aber sie hatte sich dort nicht wohl gefühlt. Der schwere Kleiboden des Schwemmlandes, aus dem die Niederlande bestehen, war nichts für Nina, ebenso wenig wie die Mentalität der Bewohner, die nur scheinbar locker, in Wirklichkeit aber einer depressiven Topographie abgerungen ist. Kein Wunder, dass Nina mich schon nach wenigen Monaten verließ.
Ich war also wieder allein. Eine Weile ging alles gut. Ich las viel, bewegte mich in der Natur, am liebsten mit dem Fahrrad, aß und trank gerne und ausgiebig. Der langsame Verfall meines Körpers, das Grauwerden der Haare, beunruhigten mich nicht. Auf wirkliche Nähe zu Menschen verzichtete ich, vielleicht aus Angst vor weiteren Enttäuschungen. Lediglich zu einem alten Bekannten, dem finnischen Kriminalinspektor Einar Berglund aus Rovaniemi, hielt ich sporadisch Kontakt. Ich hatte ihn vor etlichen Jahren kennen gelernt, als ich in Lappland war, um in einem dubiosen Mordfall zu ermitteln, der zwei Landsleute das Leben gekostet hatte. Einar hatte mir bei der Lösung des Falles geholfen. Er war ein ungewöhnlicher Mann mit klarem Verstand, sehr blauen Augen und einer langen roten Narbe im Gesicht, die von einem Messerstich stammte. Ich hatte von Anfang an seine lakonische, ehrliche Art sich auszudrücken, gemocht.
Wir hatten uns damals wieder aus den Augen verloren, wie das so üblich ist bei einer großen geographischen Entfernung zwischen den Lebensorten. Sie wirkt selbst im Zeitalter des Mobiltelefons wie eine emotionale Hürde. Doch hatte der Zufall uns wieder zusammengeführt, ausgerechnet in Rom, als ich dort jenen Fall bearbeitete, der mein letzter werden sollte. Diesmal überstand unsere Beziehung die anschließende räumliche Trennung. Ich besuchte Einar einmal im Jahr. Wir führten so etwas wie eine Männerfreundschaft.
Einars Ehe war vor langer Zeit zerbrochen. Er hatte wie ich inzwischen seinen Beruf an den Nagel gehängt und lebte zurückgezogen in einem Blockhaus in den finnischen Wäldern. Wenn ich ihn besuchte, gingen wir zusammen in die Sauna, badeten im kalten See, standen in hüfthohen Gummistiefeln in einem reißenden Lachsfluss und angelten mit der Fliege. Dann brieten oder räucherten wir unseren Fang, alles ohne ein Wort zu wechseln. Doch abends, wenn wir bei Bier und Aquavit oder einem Rotwein in Einars Hütte saßen, redeten wir umso mehr. Es ging meistens um Frauen, um unseren ehemaligen Beruf, um ungelöste Fälle oder um den fatalen Zustand der Welt, in der technischer Fortschritt und ideologischer Fanatismus zwei Mühlsteine bilden, zwischen denen alles Menschliche zu Staub zermahlen wird. Wir waren uns in der Beurteilung der Lage fast immer einig. Nur was die Frauen anging, waren wir eher Antipoden. Einar hielt sich seit dem Ende seiner Ehe heraus aus dem Geschäft mit den Hormonen, wie er sich ausdrückte. Ich dagegen hatte immer wieder Affären mit Damen, die kurzen Visiten in einem Land ähnelten, das mir kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewähren wollte. »Du weißt, wie Ameisenfallen konstruiert sind«, sagte Einar einmal. »Eine Dose mit einem speziell für Ameisen anziehenden Duftstoff und einem kleinen Loch. Die Ameisen kriechen hinein und finden nicht mehr heraus. Genauso funktionieren Frauen.« Ich wagte nicht, Protest einzulegen, denn ich wusste, mein Freund redete so aus persönlichem Verletztsein. Schließlich hatte ihn seine Frau verlassen und nicht er sie.
Ein anderes Thema unserer Gespräche war die Kriminalität und ihre Ursachen. »Die sogenannten echten Kriminellen sind nur die Spitze des Eisbergs«, sagte Einar einmal bei unserem letzten Treffen. »Wir alle sind auch kriminell. Allerdings gehören wir zu dem größeren Teil des Eisbergs, der sich unterhalb der Wasseroberfläche befindet. Das macht uns moralisch nicht gerade glaubwürdig. Sag, wie viele Morde hast du in Gedanken schon verübt?«
Ich antwortete nicht direkt darauf, sondern wagte stattdessen eine Hypothese: »Nach meiner Erfahrung als Psychologe gibt es hauptsächlich zwei Typen von Kriminellen. Die einen sind Vateropfer, die anderen Mutteropfer. Die Vateropfer haben Überich-Probleme. Sie erkennen Instanzen und Rituale nicht an. Sie fühlen sich verletzt von den Machtverhältnissen. Sie rebellieren deshalb gegen sie. Sie wollen im Grunde ihren Vater treffen, wenn sie eine Bank ausrauben oder jemanden umbringen. Mit diesem Typ des Kriminellen sympathisiere ich. Die muttergeprägten Kriminellen hingegen rebellieren nicht. Sie sind zerstört in ihrer moralischen und existenziellen Kompetenz. Sie sind Un-Ichs. Man könnte auch sagen, sie sind im Unterich gestört.«
»Unterich? Meinst du damit, was Freud das ›Es‹ nennt?«
»Nein«, sagte ich. »Das ist etwas völlig anderes. Das Unterich ist keine wie auch immer geartete kollektive Instanz. Es entsteht durch die persönliche Beziehung zur Mutter, während das Überich von den Vätern geprägt ist. Unterichgeschädigte sind arme, wahnsinnige Teufel, die mit gebrochenen Engelsflügeln durch die Welt geistern und Leute umbringen, weil sie brav sein wollen.«
Wir saßen nackt in der Sauna. Einar, dem die Schweißperlen über den stattlichen Körper rollten, schloss die Augen. Dann sagte er: »Und du? Wie steht es mit dir? Du hast mir erzählt, dass du ohne Vater aufgewachsen bist, aber mit einer äußerst dominanten Mutter.«
Er goss Wasser auf die Lavasteine, und feuchte Hitze brandete durch die kleine hölzerne Zelle. Dann begannen wir mit Birkenzweigen gegenseitig unsere Haut zu peitschen, bis sie rote Striemen aufwies wie bei Geißlern. »Ich bin nach langem Hin und Her im Niemandsland gelandet«, sagte ich. »Ich habe meinen Vater, wie du weißt, erst kurz vor seinem Tod kennen gelernt. Vielleicht hat mich das vor der Überichkriminalität gerettet. Und meine Mutter? Sie hatte großen Einfluss auf mich. Sie war schrecklich, ein egomanes, kettenrauchendes Monstrum. Doch hat sie mich wohl geliebt, allerdings auf eine ziemlich besitzergreifende Weise. Mein Unvater und meine Übermutter, das hat sich irgendwie gegenseitig aufgehoben, und das mag der Grund dafür sein, dass ich zwar nicht kriminell geworden bin, mich aber ziemlich schwer tue in Sachen Liebe und Beruf. Es gibt übrigens noch einen dritten Typus von Kriminellen. Den Elterngeschädigten. Er ist sowohl im Überich als auch im Unterich gestört. Das sind die Schlimmsten. Die Giganten des Bösen. Goebbels war so einer. Und Hitler natürlich auch.«
»Wieso war Goebbels elterngeschädigt?«
»Er hatte einen Klumpfuß, wie Beelzebub. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er seinen Eltern die Schuld an der Erkrankung gab, die zu dieser Behinderung führte. Den Klumpfuß teilt er übrigens mit einem anderen berühmten Bösewicht. Richard III. Schon ein seltsamer Vogel, dieser Goebbels. Selbst behindert, propagierte er die Euthanasie der Behinderten. Da steckt viel Suizidales dahinter. Ich vermute, Elterngeschädigte haben einen natürlichen Hang zum Selbstmord.«
Wir rannten zum See und sprangen ins kalte Wasser. Man fühlt sich in solch einem Moment wie eine brennende Fackel, denn die Kälte verwandelt sich für einige Sekunden in ihr Gegenteil. Später saßen wir in Einars Blockhaus. Mein Freund machte eine besonders gute Flasche Rotwein auf. Seitdem Einar von seiner italienischen Frau verlassen worden war, trank er keine italienischen Weine mehr. Dieser war aus Spanien und hieß Gaudium, »Freude«.
3
Immer wenn ich in Finnland gewesen war, fühlte ich mich für eine Weile besser. Neuer Lebensmut schien zu keimen, was sich daran zeigte, dass ich mich wieder um meine Topfpflanzen kümmerte, die vertrockneten beseitigte und die, die meine Gleichgültigkeit überstanden hatten, regelmäßig goss. Doch meine positive Stimmung schien selbst eine ziemlich zarte Pflanze zu sein. Jedenfalls ging sie irgendwann wieder ein, auch wenn ich sie so oft wie möglich gründlich wässerte. Und so schleppten sich meine Tage bald wieder wie sonst dahin. Es konnte unmöglich ein Rückfall in eine Midlife-Crisis sein, dazu war ich entschieden zu alt. War es etwa schon die Endlife-Crisis? Für die war ich eigentlich noch zu jung.
Ich beschloss, etwas grundsätzlich zu ändern. Ich wollte meinen wachsenden Lebensüberdruss mit einem Tapetenwechsel bekämpfen. Durch meinen früheren Beruf war ich oft im Ausland gewesen. Und immer hatte ich diese Reisen, trotz aller mit meinen Aufträgen verbundenen Probleme, als Jungbrunnen empfunden. War dieser Brunnen inzwischen versiegt? Ich nahm mir vor, es herauszufinden.
Doch welches Land kam in Frage? Welches Klima? Welche Mentalität? Ich telefonierte mit Einar und fragte ihn um Rat. »Was hältst du davon, wenn ich mich irgendwo in Finnland oder Norwegen niederlasse?«
Einar riet davon ab. »Die Gesellschaft hier im hohen Norden ist zwar einigermaßen liberal, und die Leute sind auch ziemlich nett. Aber unter der Oberfläche gibt es eine depressive Zone, die einem viel Kraft abverlangt. Du hast deine Erfahrungen selbst damit gemacht, weißt du noch, damals in Lappland. Das Leben verläuft hier oben in einem unnatürlichen Rhythmus. Im Sommer geht die Sonne nicht unter, im Winter nicht auf. Helligkeit, Dämmerung, Dunkelheit in viel zu großen Blöcken. Das spaltet bei vielen die Seele und das Hirn. Ein stark manischdepressives Temperament ist die Folge. Gehe lieber in den gemäßigten Süden. Das mediterrane Klima ist nach wie vor das beste der Welt. Versuch es mal mit Nordspanien, falls dir, wie mir, Italien zu italienisch ist. Die Spanier sind rauer. Sie sind die Finnen des Südens.«
Ich nahm Einars Ratschläge ernst. Auf jeden Fall musste es eine Großstadt sein. Kleinstädte waren mir aus tiefster Seele suspekt, denn sie sind meistens ein schlechter Kompromiss zwischen Dorf und Metropole. Ich kaufte mir einen guten Atlas und fuhr mit dem Finger über die Seiten. London? Paris? Madrid? Rom? Berlin? Ich kam zu keinem Ergebnis. Da kam mir der Zufall zu Hilfe.
Ich war häufiger Gast in einem kleinen Café, das bekannt für die Qualität seiner Getränke war. Kein Espresso sonst in Groningen hatte eine solche Crema, keine Milch war so perfekt aufgeschäumt. Zu verdanken war dies der Barista, einer schönen Spanierin. Trotz ihres attraktiven Äußeren hielt sie die Männer auf Abstand, was vermutlich an ihrem offensichtlichen Hang zu Ordnung und Sauberkeit lag. Sie putzte die Theke bei jeder Gelegenheit, entfernte die Zuckerkrümel und wienerte ständig die Espressomaschine mit einem großen Wolltuch. Sie sprach im übrigen fließend Niederländisch, und wenn man sich gut benahm und die Tasse ohne einen Fleck auf der Untertasse auf den Tresen zurückstellte, dankte sie es einem mit einem tiefen Blick ihrer holzkohleschwarzen Augen, in denen ein verborgenes, dunkles Feuer schwelte wie unter dem Erdhügel eines Köhlers.
Eines Tages traute ich mich, sie anzusprechen. »Aus welcher Gegend Spaniens sind Sie?«, fragte ich. Meine Stimme zitterte, als würde ihre Antwort über mein weiteres Leben entscheiden.
»Aus Barcelona«, sagte sie. Ihre Augen leuchteten auf, als sei frische Luft an die schwelende Kohle gekommen.
»Eine schöne Stadt?«
»Eine sehr schöne Stadt. Und vor allem: Sie liegt direkt am Meer. Welche Großstadt hat schon einen öffentlichen Strand, an dem man baden kann. Man steigt einfach in die Straßenbahn oder geht zu Fuß, und kurz darauf liegt man im Sand oder geht ins Wasser. Das nenne ich Lebensqualität.«
Ich sah sie vor mir. Sie lag auf einem kleinen, weißen Handtuch. Ihre brünette Haut glänzte von der Sonnencreme. Die gläsernen Wellen eines grünen Meeres servierten eine kühle Brise. In Wahrheit blickte ich auf die weiße Papierserviette, die neben der Zuckerdose auf dem Tresen lag, und auf den Reiseprospekt, den mir die Barista zugeschoben hatte. In diesem Moment entschied ich mich, es mit Barcelona zu versuchen.
4
Ich war so ungeduldig, dass ich schon am nächsten Tag mit einem teuren Linienflug von Amsterdam in die katalanische Metropole flog. Selbst meine Flugangst hielt sich diesmal in Grenzen. Ich fuhr mit dem Taxi in die Innenstadt, ließ mich vor einem Viersternehotel absetzen und nahm ein sündhaft teures Zimmer. Hastig verstaute ich meine wenigen Sachen im Schrank. Dann lief ich die berühmten Ramblas hinunter zum Hafen. Es war sommerlich warm. Ich hatte Hunger und Durst und ging in ein Lokal, das offensichtlich von Touristen lebte. Ich suchte mir auf der windigen Terrasse einen Platz, von dem aus ich wenigstens ein Stückchen Horizont in der Hafenausfahrt sehen konnte. Es war der vorderste Tisch. Das Meer war leider hinter Molen und Gebäuden versteckt. Man sah es nur durch einen schmalen Spalt. Es glich einem blauen, blitzenden Messer, das in einem steinigen Boden steckte.
Am Molengeländer standen fünf Chinesen. Sie hatten graue Anzüge an und lachten und tranken Wasser aus großen Flaschen. Überall auf der Welt scheint es inzwischen solche kleinen Gruppen lachender Chinesen in grauen Anzügen zu geben. Warten sie auf etwas? Auf den Untergang des Abendlandes vielleicht? Oder sind sie eine Art Vorhut?
Der Wind pfiff an dieser Ecke so stark, dass ich die Papiertischdecke mit Weinglas und Aschenbecher beschweren musste. Der Tisch hinter mir war frei, und da er windgeschützter lag als meiner, überlegte ich, dorthin umzuziehen. Doch bewegte sich jetzt eine andere auffällige Personengruppe auf ihn zu. Vier Leute, ein muskelbepackter Goliath mit Glatze und rundem Kindergesicht, der kurze Hosen und ein knappes T-Shirt trug, eine ältere Blondine mit groben Zügen, ein in Jeans und Flanellhemd gekleideter Mann, etwa Mitte vierzig, der wie ein Lehrer wirkte, und eine beleibte, junge Asiatin. Sie setzte sich abseits auf die Planken des Stegs und begann lautstark zu schimpfen. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber es klang deutsch. Die anderen drei besetzten den Tisch. Auch sie begannen laut zu reden, doch es war keine normale Sprache, eher unartikulierte Laute wie von Tieren oder Menschenaffen. Dabei fuchtelten sie mit den Händen. Nur der Lehrertyp streute immer wieder ein paar verständliche Wörter ein. Dann zeigte er auf die Chinesin und rief ihr zu, sie solle kommen. Als sie laut »Nein« brüllte, denn sie sei nicht verrückt, aber alle Deutschen seien blöd, ballaballa, erhob er sich und zwängte sich unter den Tauen hindurch, die die Sitze des Restaurants von der Brücke abgrenzten. Er ging zu der jungen Frau, nahm ihre Hand und zog sie hinter sich her, bis auch sie am Tisch saß, wobei sie weiter schimpfte und sich in bestem Hochdeutsch über die Dummheit der Deutschen beklagte. »Alle sind ballaballa, manche sind sogar balla, balla, balla, balla«, sagte sie. Der Goliath neben ihr grunzte und spannte seine Muskeln an. »Du hast es auch nur da, und nicht da«, sagte die Chinesin, und tippte erst auf den gewaltigen Bizeps und dann auf die Stirn ihres Sitznachbarn. Alle vier tranken Tee, während ich den schlechten, weißen Hauswein trank, frittierte Calamares aß und den Anzugchinesen dabei zusah, wie sie immer noch lächelnd auf etwas zu warten schienen. Da hörte ich hinter mir ein lautes, hemmungsloses Schluchzen. Ich drehte mich um. Es war der Muskelprotz. Tränen strömten über seine feisten Backen. Er hielt sich die Serviette an die Nase und schnäuzte sich lautstark. Die Lächerlichkeit der Situation deprimierte mich. Ich ließ mein Essen stehen und zahlte an der Theke.
Später ging ich über die Ramblas zurück. Es wurde dunkel und der Touristenstrom dichter. Ich kam an Buden voller Vogelkäfigen vorbei. Wellensittiche und Papageien machten einen Höllenlärm. Plötzlich bemerkte ich einen schwarzen Schatten vor mir, ein Monster, eine Harpyie, eines jener Mischwesen aus Frau und Vogel, die ihre scharfen Krallen in die Leiber der Menschen schlagen und sie ins Totenreich entführen. Doch als ich näher kam, sah ich, was es war: eine kleine, verwachsene Frau mit tief niedergekrümmtem Leib, schwarz gekleidet, der Oberkörper mit dem Kopf parallel zur Straße. Die Hüften ragten am höchsten auf, der übrige Leib war schräg nach unten verzogen, der Kopf nur wenige Zentimeter über dem Pflaster, von einem schwarzen Tuch fast ganz verhüllt, so dass nur eine lange spitze Nase zu sehen war. In der einen Krallenhand hielt das deformierte Wesen einen Becher, in dem die Bettelmünzen klapperten, in der anderen einen langen Stock, mit dem es den Weg ertastete. Das Groteske der Erscheinung wurde noch dadurch gesteigert, dass die Frau am ganzen Leibe zitterte und zuckte und sich in einer Art konvulsivischem Taumelgang zwischen den sie hoch überragenden Menschen vorwärtsbewegte. Goya hätte kein alptraumhafteres Geschöpf zeichnen können. Ich lief ihr nach und warf ihr ein großes Geldstück in den Becher, worauf sie den Kopf schief legte und mich aus winzigen, grauen Augen ansah, während ihr zahnloser Mund einen unartikulierten Laut ausstieß.
Am nächsten Tag besuchte ich den berühmten öffentlichen Strand der Stadt. Die Wellen waren wirklich so grün und gläsern, wie ich sie mir in jenem Groninger Café ausgemalt hatte. Dicht an dicht lagen halbnackte Körper und schmorten im Fegefeuer einer harten Sonne, als wollten sie sich so die Reinigung von ihren Sünden erkaufen. Die Wellen aber spendeten diesen ölglänzenden Leibern Trost und Absolution. Ja, es war ein katholisches Meer. So ganz anders als unsere trübe, kalte, evangelische Nordsee. Ich suchte eine handtuchgroße freie Stelle und bettete mich auf den glühend heißen Sand. Rechts und links neben mir lagen junge Spanierinnen. Sie trugen goldene Kreuze zwischen ihren nackten Brüsten und rauchten Zigaretten. Von mir nahmen sie keinerlei Notiz. Hinter ihren großen Sonnenbrillen vermutete ich leere Höhlen.
Nach drei Tagen hatte ich einen gewissen Eindruck von der Stadt und ihren Bewohnern. Ich kaufte mir ein kleines, rotes Notizbuch und hielt darin meine Beobachtungen fest, wohl wissend, wie subjektiv meine Urteile waren.
»Barcelona erinnert mich an eine Hure, die immer noch schön ist. Sie ist hektisch, weil sie die Male des Alters spürt. Also schminkt sie sich und übertreibt es damit wie alle alternden Huren. Sie hat alles dafür getan, um ihre Freier nicht zu enttäuschen. Sie hat sich liften lassen, hat sich sportlich betätigt, hat sich gesund ernährt. Sie kleidet sich vorteilhaft, doch dort, wo sie einst am schönsten war, am Busen des Meeres, trägt sie nun ein steifes Korsett aus Beton. Sie möchte zugleich geliebt werden und mit ihrer Schönheit Geld verdienen. Das geht auf Kosten der Seele. Daher versteckt sie sie so gut vor sich und anderen, dass man fast glauben könnte, sie habe keine. Wenn Siesta ist, zieht sich die Hure Barcelona für vier Stunden in ein Hinterzimmer zurück. Sie legt sich auf ein hartes Bett, eines, auf dem sie keine Freier empfängt, schließt die Augen und spürt, wie sie verfällt. Am Abend, wenn das Licht milde ist und ihre Runzeln glättet, macht sie sich auf, um die zu verführen, die bereit sind, sich mit ein wenig gekaufter Liebe über ihre inneren Abgründe hinwegtrösten zu lassen.«
Spät in dieser Nacht lief ich durch die Straßen und schrie: »Ihr habt alle kein Geheimnis, niemand hier hat eines. Und weil niemand ein Geheimnis hat, hat er auch keine Ruhe, keine Gelassenheit. Darum rennt ihr alle so geschäftig, darum seid ihr so hinter dem Geld her, hinter der Schönheit, hinter dem Erfolg. Ihr habt in Wahrheit keine echten Ziele, ihr seid tot wie der künstliche Fuchs, mit dem man die Meute bei Hunderennen auf Trab bringt.«
Wen meinte ich eigentlich mit »ihr«, wenn nicht mich selbst? Ich war betrunken. Es war mein letzter Tag in dieser Stadt mit der angeblich höchsten Lebensqualität auf dem Kontinent. Am nächsten Morgen nahm ich den Zug nach Paris.
5
Ich war schon einige Male in der Hauptstadt Frankreichs gewesen. Jedes Mal hatte mich dieses endlose Häusermeer mit seinen reißenden Menschenströmungen in Bann geschlagen. Doch schien mir diesmal für einen Einzelgänger wie mich die Gefahr des Ertrinkens allzu groß. Und empfand ich nicht inzwischen auch so etwas wie Heimweh? Wollte ich mich etwa schon wieder in meinem alten Bau verkriechen? Ich kaufte jedenfalls ein Ticket nach Groningen und wartete in einem Bistro am Gare du Nord auf die Abfahrt des Zuges. Er würde mich nach Brüssel bringen, wo ich den Nachtzug nach Bremen nehmen konnte, um am nächsten Morgen zurück zu sein. Der Thalys von Paris nach Brüssel fuhr kurz vor neun Uhr. Ich hatte also genügend Zeit, über mein vergebliches Bad im vermeintlichen Jungbrunnen einer Ortsveränderung nachzudenken.
Es war ein warmer Sommerabend. Die abnehmbare, hölzerne Fassade des Bistros war entfernt worden, so dass man halb auf der Straße saß und das Leben dort gut verfolgen konnte. Viele afrikanische Familien waren unterwegs. Es herrschte eine Stimmung wie auf einem Dorfplatz im Busch. Der Kellner, der die Tische auf dem Trottoir und im Inneren des Lokals bediente, wirkte wie ein genialer Schauspieler, der seine Rolle mit einer solchen Überzeugungskraft zu spielen vermochte, dass sie die Realität an Realismus noch übertraf. Unscheinbar von Statur und Physiognomie, ging er mit schnellen, präzisen Bühnenschritten von Tisch zu Tisch, nahm Bestellungen entgegen, entfernte abgegessene Teller, servierte neue, schenkte Gläser voll, alles mit einer von Routine, aber auch von Freude am Geschehen bestimmten Perfektion in den Bewegungen. An seiner Oberlippe klebten mehrere Zettel, Bestellungen und Rechnungen, die er an verschiedene Kunden verteilte. Es waren offenbar immer die richtigen Quittungen, die er mit der linken Hand präsentierte, während die rechte Wein nachschenkte oder leere Weingläser wie einen gläsernen Strauß von der fleckigen Tischtuchwiese pflückte. Jedes Mal wenn er an meinem Tisch vorbeikam, zwinkerte er mir zu, als bedürfte ich einer Aufmunterung.
Ich bestellte Bier und Lammkoteletts. Er notierte das Gewünschte auf einem Zettel und klebte ihn an seine Lippe. Als er das Getränk brachte, sagte er auf Englisch: »Sie sind auf der Suche, mein Herr. Ich empfehle Ihnen, nicht so schnell aufzugeben. Suchen ist immer gut, im Gegensatz zum Finden.« Er zwinkerte wieder, entfernte eine Rechnung von der Lippe und legte sie neben mein Glas.
Als er das Essen brachte, stellte ich ihm eine Frage: »Gibt es eine Stadt in Frankreich, in der Sie gerne leben würden?«
»Rouen«, sagte er.
»Und warum Rouen?«
»Sie hat von allem etwas. Ein bisschen alt, ein bisschen neu, ein bisschen klein, ein bisschen groß, ein bisschen sauber, ein bisschen dreckig, ein bisschen schön, ein bisschen hässlich, und vor allem, wissen Sie...« Er zwinkerte mir zu und eilte zum nächsten Tisch. Als er eine Weile später wieder vorbeikam, setze er seine Rede an der Stelle fort, wo er sie unterbrochen hatte. »... die Sache mit der armen Jeanne D’Arc hat der Stadt so etwas wie die Eleganz der Unmenschlichkeit gegeben. Verstehen Sie? Man hat das Mädchen gefoltert und dann auf dem Marktplatz verbrannt. Viele haben zugesehen, wie der Rauch über die Dächer abzog. Es roch nach Braten. Man kann es bis heute riechen. Inzwischen nennt man Straßen und Plätze nach der Ketzerin und verdient an all den Leuten, die zu spät zum Scheiterhaufen kommen. Es ist eine morbide Stadt, verstehen Sie. Gehen Sie unbedingt ins Beinhaus, wo man die Pesttoten begraben hat.« Er lächelte und steckte den Schein ein, den ich neben die Rechnung gelegt hatte. Als er mit dem Wechselgeld zurückkam, zog er einen Zettel von der Lippe, auf dem eine Adressse stand. »Da kann man gut und billig essen, mein Herr«, sagte er. »Und das Hotel nebenan ist auch zu empfehlen.«
Ich ging in den Bahnhof, gab meine Karte zurück und fuhr nach Rouen. Es war schon dunkel, als ich ankam.
6
Meine Erwartungen waren hoch, jedoch nicht zu hoch, wie ich mir einbildete, denn mein Barcelonaprojekt war sicherlich hauptsächlich an übertriebenen Vorstellungen gescheitert. Ich ging durch die Altstadt zu dem Hotel, das mir der Kellner empfohlen hatte. Es lag direkt neben dem Dom, dessen imposante Erscheinung teilweise hinter Plastikbahnen und Gerüsten versteckt war. Die Kathedrale glich einem schwer verletzten Körper, der Verbände und Schienen tragen muss. In der Tat schien eine Renovierung bitter nötig, denn der weiche Sandstein aus dem Seinetal hatte der Luftverschmutzung schweren Tribut gezahlt. Viele der Heiligenfiguren glichen Leprakranken.
Von meinem Zimmer im obersten Stock aus konnte ich durch große Fenster das Längsschiff sehen. Sein kompliziertes Strebewerk mit den zahllosen Türmchen, Fialen und Wasserspeiern verlieh dem Bau etwas von einem Luftschiff, das im Sog aufsteigender Winde an den Landeseilen zerrt. Ich legte mich aufs Bett und ließ mich von der Schwerelosigkeit erfassen. Als später die Scheinwerfer angingen, wurde aus dem Luftschiff ein Wal, der in grünem Wasser schwamm und durch den Trichter seines riesigen Maules
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Copyright © 2008 by btb Verlagin der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
eISBN : 978-3-641-02501-4
www.btb-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de