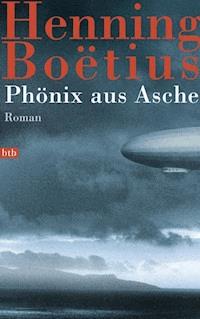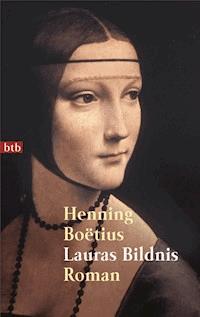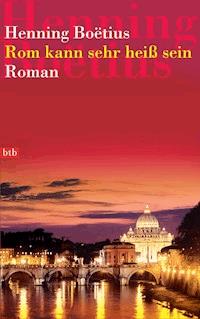
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Piet Hieronymus Reihe
- Sprache: Deutsch
Piet Hieronymus ist verliebt, zum ersten Mal seit Jahren: Seit seinen letzten Ermittlungen in Schottland führt der kauzige Kommissar eine Fernbeziehung mit seiner schottischen Kollegin Dale Mackay. Als diese eines Tages unerwartet bei ihm vor der Tür steht, ist er mehr als glücklich und verbringt mit ihr einige unbeschwerte Tage. Dann zieht Dale weiter, angeblich zu einem Fortbildungslehrgang nach Bern. Doch nach ihrer Abreise verlieren sich ihre Spuren: Sie meldet sich nicht mehr bei Piet, und auch telefonische Nachfragen ergeben keinen Hinweis auf Dale und ihren Verbleib. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Zutiefst beunruhigt, beschließt Piet Hieronymus, nach Bern zu fahren und dort selbst nach dem Rechten zu sehen. Es ist der Anfang einer langen Reise, die ihn schließlich bis nach Rom führt, mitten hinein in einen Sumpf aus Korruption und skrupellosen Machenschaften...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Henning Boëtius
Rom kann sehr heiß sein
Roman
Copyright
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2002 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Design Team München
ISBN 3-89480-776-8
www.pep-ebooks.de
Teil Eins1. Hieronymus2. Dale Mackay3. Franz Gala4. Der Mantel5. Das Brückenhäuschen6. Das Münster7. Puppenwelt8. Marcello Tusa9. Apero10. RückkehrTeil Zwei1. Abschied2. Aufbruch gen Süden3. Nina4. Das Wiedersehen5. Falsini6. Ein alter neuer Freund7. Die Cafeteria8. Das Konzert9. Die Audienz10. Monsignore Tanner11. Dermatitis solaris12. Abschied II13. Das Fest14. Das Labor15. Alfredo16. Suomenlinna17. Café Moskau18. Ein ungewöhnlicher SchrittÜber das BuchÜber den AutorCopyright
Teil Eins
1. Hieronymus
Jeder Mensch braucht seine Wüste. Sie muss nicht unbedingt aus Sand sein. Sie kann auch aus Wasser bestehen oder aus Häusern, aus Menschen, sogar aus einem selbst. Man könnte auch sagen, jeder Mensch braucht sein Patagonien, eine Landschaft, in der Schönheit und Unwirtlichkeit eine einmalige Verbindung eingehen. Ehe ich diese Lebensweisheit begriff, musste vieles geschehen. Vielleicht ist es besser, die Dinge der Reihe nach zu erzählen, obwohl ich wenig vom Nacheinander eines Ablaufs von Begebenheiten halte. Das konstante Vorrücken des Uhrzeigers täuscht etwas vor, das es eigentlich gar nicht gibt: Die Zeit ist alles andere als eine Straße, die nur in eine Richtung führt. Wer einmal in einer echten Wüste war, weiß, dass sich zwischen ihren endlosen Sanddünen, die sich alle so ähnlich sind, obwohl keine der anderen gleicht, das Gefühl für Raum und Zeit verliert. Aus dem Nacheinander wird unweigerlich ein Zugleich. Man fühlt sich, spätestens wenn das Abendlicht einsetzt und blaue Schatten die Dünenhänge emporwachsen, als sei man überall und nirgends und das für immer oder auch nur für einen Augenblick. Dieses endlose Rieseln der Sandkörner, das ein feines, fast unhörbares Geräusch erzeugt, verschüttet die Sekunden genauso wie die Jahre. Die Sanduhr, die schon in der Antike als Sinnbild für die Kürze menschlichen Lebens galt, ist in Wahrheit ein Symbol für die Ewigkeit. Wenn der obere Trichter leer ist, dreht jemand sie um, und alles beginnt von neuem.
Zur Wüste gehört wesensmäßig der Durst. Man erträgt ihre grausame Wirklichkeit nur, wenn man den Durst erträgt. Dort, wo es Wasser gibt, verwandelt sich die Wüste in ihr Gegenteil: in eine Oase. Das Problem in meinem Falle: Ich bin leider kein Asket, jedenfalls kein freiwilliger. Ich bin ein Oasenmensch. Ich lagere am liebsten neben der Quelle, in einem gewissen Abstand allerdings, der verhindern soll, dass ich in den Brunnen falle und ertrinke. Das gilt für die Liebe genauso wie für die Stillung meines Wissensdurstes. Asket zu sein ist eine mir völlig fremde Form der umgekehrten Völlerei; es ist eine Art negativer Hedonismus. Ich bin weder Asket noch Hedonist, sondern irgendetwas Undefiniertes dazwischen, wie eigentlich die meisten anderen Menschen auch. Unglücksvermeidung statt Glücksbesessenheit ist meine vornehmliche Lebensstrategie.
Vor einigen Jahren habe ich damit begonnen, mich mit meinem Namen zu beschäftigen. Namen sind auch in unserer aufgeklärten Zeit immer noch mehr als bloße Erkennungsmarken. Zuweilen scheinen sie ein magisches Substrat zu erhalten, das das Wesen oder das Leben des Trägers beeinflusst. Piet ist ein Allerweltsname. Er trägt sich angenehm wie eine kleine, leichte Maske der Anonymität. Ganz anders mein Nachname. Er ist ein Schwergewicht, er hat einen anspruchsvollen Klang. Und er ist wenig verbreitet, obwohl ihn Dürer durch seinen berühmten Kupferstich »Der heilige Hieronymus im Gehäus« auch den theologisch desinteressierten Zeitgenossen bis heute gegenwärtig hält. Vielleicht hat sich dieser Name so wenig durchgesetzt, weil jener große Gelehrte und zwielichtige Mann zum Symbol von Askese und Gelehrsamkeit wurde. Und wer will schon diese beiden Tugenden zu seinem erklärten Lebensideal machen!
Heute frage ich mich, warum mir nicht mein anderer großer Namensvetter ähnlich wichtig war wie der heilige Hieronymus: jener rätselhafte Maler aus Hertogenbosch, der den Zeugnissen nach ein ganz normales bürgerliches Leben führte und, wie manche vermuten, geschützt von dieser Fassade, Mitglied einer verbotenen adamitischen Sekte war, deren Anhänger auf ihren Séancen völlig nackt auftraten und sich obskuren Ausschweifungen hingaben. Seine Bilder jedenfalls wirken durch ihre bizarren Darstellungen von Albträumen, ihre Monster und Chimären auf uns heute so modern, dass manche in ihm einen Vorläufer des Surrealismus sehen wollen und andere die Psychoanalyse mit ihrer Methode der Traumdeutung bemühen, um seine Bilder zu verstehen. Hätte ich gewusst, wie sehr ich selbst in eine solche verstörende und schockierende Bilderwelt hineingeraten würde, ich hätte Hieronymus Bosch vermutlich bei weitem mehr Interesse entgegengebracht als dem Kirchenfürsten.
Eigentlich ist Hieronymus ein Vorname griechischen Ursprungs. Er lebt fort im englischen Gerome und im französischen Jérome, dessen berühmtester Träger Napoleon Bonaparte war, doch ich nehme an, nur seine Mutter durfte ihn so nennen. Hieronymus bedeutet »heiliger Name«, und auch dies passt nicht so recht in unsere unheilige Zeit. Der heilige Hieronymus ist jedoch von allergrößter Wichtigkeit für die Menschheitsgeschichte. Ohne ihn wäre sie vermutlich anders verlaufen. Er ist einer der vier großen Kirchenväter. Im Gegensatz zu den anderen dreien, Ambrosius, Augustinus und Gregor dem Großen, wirkt er bis heute nach, ohne dass uns dies bewusst ist. Seine Bearbeitung der alten lateinischen Bibel wurde als Vulgata zum Urbuch der Christenheit, zur geistigen Hausordnung der nordeuropäischen Religionen. Vor allem seine Übersetzung der Evangelien hatte und hat bis heute einen starken, wenn auch gleichsam unterirdischen Einfluss auf unser Lebensgefühl. Als im 16. Jahrhunderts die Reformation einen desorientierenden Einfluss auf die Gläubigen zu nehmen begann, beschloss die katholische Kirche auf dem Konzil zu Trient nicht von ungefähr, die Vulgata zur allein selig machenden Basis des Lebens und der Lehre zu erklären. Der heilige Hieronymus als Gegengift gegen die gefährlichen Einflüsse, die von Norden her über die Alpenpässe drangen! Aber Luther packte den Stier bei den Hörnern, indem er die Vulgata übersetzte, oder, besser gesagt, nachdichtete in einem von ihm teilweise erschaffenen Deutsch voller Abgründe und Schönheit. Also steckt Hieronymus insgeheim auch in der depressiven Theologie des Nordens, den rechthaberischen Appellen der Melancholiker nördlich der Alpen für die Schlichtheit der Lebensführung. Evangelisches und katholisches Denken spiegeln seitdem den Gegensatz von Askese und Hedonismus auf dem gleichen versilberten Glas. Es ist ein fast manichäischer Dualismus, den man auch metereologisch zu spüren vermeint, wenn man über die Alpenpässe fährt und dabei das raue Wetter der Nordseite der milden und duftgeschwängerten Luft der Südseite weicht.
Ich hätte mir lieber einen interessanten Vornamen und einen weniger seltenen Nachnamen gewünscht. Vielleicht hätte ich dann auch bei Frauen mehr Glück gehabt. Wenn die jeweilige Dame meines Herzens in einer Liebesstunde »Piet« zu mir sagt, dann ist es, als steche sie mit einer Nadel in einen Luftballon. Ich höre förmlich das feine Geräusch, mit dem die Luft aus meinen aufgeblasenen Gefühlen strömt. Stelle ich mich hingegen in einer offiziellen Situation mit Hieronymus vor, dann erstarrt alles um mich herum ein wenig. Am schlimmsten aber war es in meiner Kindheit. Ich wurde oft gehänselt wegen meines Namens. Und meine Mutter tat das Ihrige, indem sie mich »mein kleiner Hieronymus« titulierte, wenn sie mich auf ihre liebevoll gemeinte Art vernichtend rügte wegen irgendeiner Lappalie. »Mein kleiner Hieronymus hat wieder einmal seinen Teller nicht leer gegessen!« Vielleicht erklärt sich meine Körpergröße von über zwei Metern daher. Eine Art somatischer Aufstand meiner Körperzellen gegen die erniedrigende Mütterlichkeit meiner lieben Mama. Bis heute tue ich mich übrigens schwer, meinen Teller leer zu essen, die Suppe auszulöffeln, die ich oder andere mir eingebrockt haben. Nur Gläser leere ich konsequent bis auf den letzten Tropfen. Ja, ich bin wahrlich kein Asket, jedenfalls kein freiwilliger. Höchstens, dass die Umstände des Lebens mich kurz halten, mir halbwegs asketische Verhältnisse aufzwingen.
Ich habe mich aus all diesen Gründen eine Weile, wenn auch sehr laienhaft, mit dem Leben des heiligen Hieronymus befasst. Es heißt, dass er in die Wüste gegangen sei, um zu sich selbst und zu Gott zu finden. Auch ich habe meine Wüste gesucht, nicht um Gottes oder meinetwillen, sondern um des Lebens willen. Doch davon später.
Sophronius Eusebius Hieronymus scheint 347 nach Christus an der Grenze zwischen Ungarn und der Steiermark geboren und um 420 in Bethlehem verstorben zu sein. Dazwischen lag ein offenbar sehr bewegtes Leben, geprägt vom Zwiespalt zwischen Fleischeslust und dem Bedürfnis nach Reinheit und Wahrheit. Hieronymus reiste unentwegt, vielleicht um diesem Zwiespalt durch permanente Bewegung zu entgehen. Er floh ihn und ließ sich doch immer wieder auf ihn ein. Daher seine Unruhe, seine Aggressivität, seine Rastlosigkeit. Rom, Trier, Antiochia, Konstantinopel, dann wieder Rom waren die Hauptstationen seiner Reiselust oder Reisequal. Einmal soll er jedoch sesshaft gelebt haben: nach schwerer Krankheit in der syrischen Wüste von Chalkis nahe bei Aleppo. Hier unterzog er sich der Legende nach vier Jahre lang den härtesten Kasteiungen, ehe er innerlich gereinigt war, um sodann als Asket in Rom aufzutreten im Verein mit drei vornehmen Damen der besseren Gesellschaft und zweien ihrer Töchter, um hinfort Frömmigkeit und Enthaltsamkeit als Lebensmaxime zu verbreiten. So einer bist du also, dachte ich, als ich dies las. Fünf Frauen! Eine hat dir nicht gereicht! Diese Form der Askese würde auch mir gefallen! Doch leider fehlt mir dazu die charismatische Veranlagung, die Verführungskraft. Ich fürchte, ich bin auf eine nachdenkliche Weise durchschnittlich. Was ich noch am besten vermag, ist, einen Zustand der sanften Depression einzunehmen, den man früher mit dem leider aus der Mode gekommenen Begriff der Melancholie bezeichnet hat. Ich bin oft und gerne melancholisch. Vor allem in Hallenbädern und besonders intensiv in Wellenbädern. Ja, immer wenn ich ein solches Bad aufsuchen kann, nutze ich die Gelegenheit, angesichts dieses gefangenen Meeres künstlicher Wellen in Trübsinn zu verfallen. Ich schwimme nicht, ich sitze am Rand und schaue den zahllosen fröhlichen Menschen inmitten der grünen, gläsernen Brecher zu, die nicht vom Wind und der Strömung erzeugt werden, sondern von großen, mechanischen Kolben. Die Badenden tummeln sich in ihnen und merken gar nicht, dass sie auf eine Illusion hereinfallen.
Noch ein Wort zu Dürer. Man sagt, dass ich ihm ähnlich sehe, oder besser gesagt, ähnlich sah, als ich die Haare noch schulterlang trug. Jedenfalls jenen frühen Selbstporträts des Meisters, in denen er sich als Jesus stilisiert auf eine Weise, die unsere Vorstellung vom Sohn Gottes als einer Art Hippie so nachhaltig geprägt haben. Ich bin jetzt zu alt dafür und trage die Haare kurz, vielleicht weil sich die ersten grauen Strähnen in ihnen zeigen und weil ich signalisieren will, dass mein Erwachsenwerden kurz bevorsteht. Dabei halte ich mich eigentlich für einen ewigen Sohn und ich fürchte, ich werde diesen Status auch noch als Siebzigjähriger haben, wenn ich überhaupt so alt werde. Derzeit bin ich in keinem besonders angenehmen Alter. Es ist irgendwie undefinierbar. Irgendwie zwischen Jung und Alt, nicht Fisch und nicht Fleisch. Irgendwie irgendwo auf der Lebenslinie, von der man sagt, dass sie sich im Alter immer mehr krümmt, um schließlich in sich selbst zurückzukehren, dann, wenn man alterskindisch wird.
Ehemals praktizierender Psychologe, arbeite ich seit einigen Jahren als Sonderermittler bei der Groninger Polizei. Immer dann, wenn Landsleute im Ausland in kriminelle Handlungen verwickelt werden und die örtlichen Ermittler Probleme mit ihrer Arbeit haben, komme ich zum Einsatz. Es ist meine Aufgabe, mich an den Ort des Geschehens zu begeben, um außerhalb der häufig undurchschaubaren Ritualen folgenden und lokalen bürokratischen Konventionen unterliegenden Ermittlungen mein Glück zu versuchen. Ich reise also viel, wenn auch nicht aus jener erwähnten inneren Rastlosigkeit des heiligen Hieronymus, sondern aus beruflichen Gründen, die häufig wenig ersprießlich sind. Aber wo ich auch bin, ich habe mein Gehäuse dabei, mein Haus, mein Zimmer, das allerdings nicht so lichtdurchflutet ist wie das Gehäus' des heiligen Hieronymus auf Dürers Stich, und das auch nicht wie bei Dürer von einem schlafenden Löwen bewacht wird, dem Wappentier des großen Gelehrten. Mein Wappentier ist eher die Schnecke. Mein Gehäus' ist mein Charakter, in dem es eine dunkle, gewundene Treppe gibt, die hinab ins Unbewusste führt. Ich habe es immer bei mir, denn ich trage es auf dem Rücken. Wenn Gefahr droht, weniger im physischen Sinne, sondern durch gefühlsmäßige Ansprüche der Umwelt, ziehe ich gewöhnlich die Fühler ein und verschwinde über die Wendeltreppe meines Schneckenhauses tief in mich hinein. Ich habe nämlich eine Weichtiernatur. Dazu passt auch die von mir bevorzugte Untersuchungsmethode: hartnäckige, gezielte Passivität. Übrigens nicht zu verwechseln mit Untätigkeit! Ich vergleiche mich gerne mit einem Wünschelrutengänger, der sich auf nichts anderes zu konzentrieren hat als auf eine möglichst lockere, unverkrampfte Haltung seiner Hände. Sie sollen die Rute in einem labilen Spannungszustand halten, um sie so reaktionsfähig auf eventuelle Wasseradern im Boden zu machen. Nur geht es in meinem Fall weniger um die Motorik von Muskeln und Gelenken als um Verstand und Beobachtungsgabe. Doch auch sie müssen unverkrampft sein, einen labilen Spannungszustand zwischen Kalkül und Fantasie beziehungsweise zwischen Aufmerksamkeit und Abwesenheit einnehmen. Man darf bei einem Kriminalfall nicht zu ambitioniert auf der Suche nach Indizien und Motiven sein. Es kommt vielmehr auf ein schwer beschreibbares Gleichgewicht von Konzentration und Abgelenktsein an, das allein zur Entschlüsselung der Rätsel eines Verbrechens befähigt. Sterne sieht man auch am besten, wenn man leicht an ihnen vorbeiblickt.
Die wenigsten Verbrechen sind übrigens linearer Natur. Sie halten sich selten an kausale Abläufe nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung, wie sie angeblich das Motiv, die Tat und ihre Folgen miteinander verknüpfen. In den meisten Fällen ist eine solche Logik nur ein Faden unter vielen in einem Gewebe aus zahllosen miteinander verknüpften Bezügen. Täter sind eben keine Bürokraten. Opfer sind es viel eher, denn sie führen häufig ein geregeltes, bürgerliches Leben. Man sollte ein Verbrechen daher besser mit einem Teppich vergleichen, eng geknüpft aus längs und quer verlaufenden Fäden, aus Kette und Schuss. Das Muster schimmert auch auf der Unterseite durch. Schwer deutbare Ornamente erzählen möglicherweise eine Geschichte. Das gilt für die kleinen Ornamente am Rand genauso wie für die zentralen Rauten. Betritt man als Ermittler einen solchen Teppich, sollte man unbedingt auf die scheinbar unwesentlichen Details achten. Das Lächeln einer Frau auf einem Bahnsteig, die Bemerkung eines Mannes an der Hotelbar, der sich über sein Mobiltelefon beugt, auf dem er soeben eine Nachricht eingetippt hat, und der nun kaum hörbar murmelt: »Ich bin vielleicht zu weit gegangen.« Das können wichtige Knoten in jenem Teppich sein, zwar zeitlich und räumlich voneinander getrennt, jedoch durch unsichtbare Fäden miteinander verknüpft.
Wenn ich es mit einem neuen Fall zu tun habe, versuche ich nach Möglichkeit ein naives Gespür für die spezifische Knüpftechnik des jeweiligen Verbrechens zu entwickeln. Ich achte auf den Zustand der Fransen am Rand, auf die kleinen Ornamente, ehe ich mich dem Hauptmotiv in der Mitte nähere. Ich weiß aus Erfahrung, dass dieses Gespür im Verlauf der Ermittlungen immer weiter verloren geht, dass der analytische Verstand schließlich die Oberhand bekommt und damit auch eine Form der Logik, die einen allzu häufig blind macht für die feinen Nuancen sowohl der Wirklichkeit als auch eines Verbrechens. Ganz anders verhält es sich, wenn man als Opfer, Freund oder Angehöriger persönlich in ein Verbrechen involviert ist. Dann taugen alle diese Erfahrungen und Verhaltensmuster nichts mehr. Weder Logik noch Intuition helfen in diesem Fall weiter, weil man von anderen, wesentlich primitiveren Reaktionen beherrscht wird. Wut, Verzweiflung, Angst, Resignation zum Beispiel. Wenn man in eigener Sache ermittelt, wie ich es in diesem Fall tun musste, verliert man die Kontrolle über das Geschehen, man taucht in es ein, wird selbst zu einem Spielball und weiß nicht, wohin dieser noch rollt, wer ihn wirft oder fängt.
Zwei Dinge geschahen in diesem Jahr, die es denkwürdig im wahrsten Sinne des Wortes für mich machten: Ich hatte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine feste Freundin, und meine Mutter verschwand. Ich ertappte mich dabei, mich zu fragen, ob etwa zwischen diesen beiden Tatsachen ein versteckter Zusammenhang bestand, verwies dies aber sofort in den Bereich irrationaler Gefühle. Wahr ist allerdings, dass es meine Mutter immer irgendwie geschafft hatte, mich in meinen Beziehungsproblemen zu bestärken. »Du bist ein guter Junge«, pflegte sie oft zu sagen. »Du hast nur den großen Fehler, dich zu wichtig zu nehmen. Deshalb hält es auch auf die Dauer keine Frau mit dir aus. Dir fehlt eben die Demut des Normalen. Darin gleichst du deinem verstorbenen Vater.«
Warum hatte sie diesen Ausdruck gebraucht? Verstorbener Vater? Ich wusste doch schließlich, dass er schon lange tot war. Das Gespräch hatte im Altersheim stattgefunden, in dem sie seit einem Jahr wohnt. Ein modernes Heim, das den Insassen viel Freiheit lässt. Es wird dort häufig musiziert und Musik gehört. Operettenmelodien sind angeblich ein Mittel humaner Altenpflege. Meine Mutter hatte schon nach kurzer Zeit die Heimleitung gegen sich aufgebracht, weil sie in allen Bereichen zu dominieren versuchte. Sie zog Hip-Hop bei weitem den Operetten vor. Sie kleidete sich auch viel zu jugendlich aus meiner Sicht. »Ich nehme mich nicht wichtiger als andere«, hatte ich damals gesagt. »Das ist doch ganz natürlich, dass man sich wichtig nimmt«, widersprach sie. »Aber das hast du mir doch gerade vorgeworfen«, antwortete ich. »Es gibt eben unterschiedliche Arten, sich wichtig zu nehmen, mein Guter. Du willst doch nicht etwa leugnen, dass du überempfindlich bist?! Deine Bescheidenheit, auf die du so stolz bist, ist in Wahrheit eine Maske, hinter der du eine enorme Eitelkeit verbirgst. Jede Frau an deiner Seite wird dies ertragen müssen.«
Natürlich hatte sie wieder einmal Recht. Während ich heftig widersprach, nickte sie zufrieden, als erklärte ich gerade mein Einverständnis mit dem Bild, das sie von mir hatte. Schließlich sagte ich mit vorwurfsvoll erhobener Stimme: »Mutter, du verstehst mich nicht.« Deutlicher konnte man nicht kapitulieren, denn sie hatte nun die Möglichkeit zu einem ihrer üblichen Schlussworte: »Doch, doch, mein Sohn. Ich verstehe dich eher zu gut, mein lieber, armer Junge. Ich verstehe dich sogar besser als du selbst. Und eines musst du mir glauben, ich leide mit dir, wenn du wieder einmal eine unglückliche Beziehung zu einer Frau haben solltest.«
In Augenblicken wie diesen empfand ich reinste Mordlust. Ich war mitten in einem pervertierten Ödipuskomplex mit einem Vater, der meine Mutter war. Meinen leiblichen Vater habe ich ja kaum gekannt, denn er starb sehr früh an Leukämie, wie mir meine Mutter erzählt hat. Vielleicht eine Fluchtreaktion vor seiner Frau, dachte ich und grinste hilflos bei diesem Gedanken, während meine Mutter nach meiner Hand griff und sie tröstend streichelte.
Einen Tag nach jenem Gespräch verschwand sie. Die Polizei suchte sie vergeblich. Auch die Personenbeschreibungen im Radio und im Fernsehen brachten kein Ergebnis. Ich nahm eine Woche Urlaub und fuhr mit dem Auto herum, suchte alle Orte auf, von denen ich wusste, dass sie meiner Mutter etwas bedeutet hatten. Vergeblich. Sie hatte sich in Luft aufgelöst.
Eine Weile empfand ich echte Trauer. Dann mischte sich in dieses Gefühl so etwas wie Erleichterung, verbunden mit Schuldgefühlen. Sie war schließlich alt genug geworden und hatte ein erfülltes Leben gehabt, wenn man ihren eigenen Worten Glauben schenken wollte. Man würde ihre Leiche schon finden und einer würdigen Bestattung zuführen.
Das war natürlich völliger Unsinn. Tatsache war, dass ich mir meine Mutter einfach nicht tot vorstellen konnte. Vielleicht hatte sie nur einen Ausflug gemacht, wie schon einmal, als sie ohne Ankündigung nach Köln zum Karneval gefahren war. Und selbst wenn man mich demnächst in ein Leichenschauhaus holen würde, um sie zu identifizieren, würde ich den Anblick ihres entseelten Leibes für einen schlechten Scherz halten, für einen Gauklertrick. Denn ich wusste ja schließlich, dass sie unsterblich war, wenigstens so lange ich selber lebte. Erst mein eigenes Ende würde sie mit hinabreißen in den Abgrund des Nichts. Doch nicht einmal das erschien mir sicher.
Die andere Sache beschäftigte mich mehr. Ich hatte während meines letzten Falles – einer reichlich abstrusen Geschichte in Schottland – eine junge Kollegin kennen gelernt. Dale Mackay aus Inverness. Sie hat eine tiefe, resonanzreiche Stimme, sodass ich sie anfangs am Telefon für einen Mann gehalten hatte. Sie gehört zu diesen ungeheuer selbstbewussten Frauen, die in den letzten Jahren aus der langen Geschichte weiblicher Unterdrückung mit geradezu verblüffender Selbstverständlichkeit hervorgehen. Wir führten inzwischen über das Telefon so etwas wie eine heiße Fernliebe. Da wir übereingekommen waren, unsere Berufe nicht aufzugeben, hatten wir uns entschlossen, eine Art Seemannsehe einzugehen mit all ihren Vor- und Nachteilen. Wir sahen uns selten, aber das hielt unsere Verliebtheit frisch wie eine Rose, deren Stiel man immer wieder anschneidet. Andererseits war uns auch bewusst, dass dieser Zustand uns zwar die üblichen Gefühlserosionen durch die Alltagsverhältnisse ersparte, aber zugleich eine gewisse Fremdheit zwischen uns konservierte, die eines Tages zum Ende unserer Liebe führen konnte. Außerdem ist kein Rosenstiel unendlich lang.
Dale war in Schottland, als mich die Nachricht vom Verschwinden meiner Mutter erreichte. Ich rief sie an und erzählte die Neuigkeit im Stile eines Auslandskorrespondenten. »Mein armer Junge«, sagte Dale schließlich. »Sie wird dir fehlen. Schade, dass ich sie nie kennen gelernt habe.« Klang sie nicht bereits wie meine Mutter? Dale fragte, ob sie herüberkommen solle. »Nein«, sagte ich, »das ist nicht nötig. Mit dieser Sache muss ich alleine fertig werden.«
Ich wohne in der Villa meiner Mutter. Obwohl sie sie auf mich hat überschreiben lassen, fühle ich mich als Mieter. Ein Gärtner pflegt den Garten. Die Räume sind übertrieben sparsam möbliert. Ich habe es nicht verstanden, von ihnen richtig Besitz zu ergreifen. Ich habe keine Bilder aufgehängt, nur das vergilbte, von Stockflecken übersäte Foto meines Vaters, das ihn als einen blassen Mann zeigt mit einem ausdruckslosen Gesicht. Einen Ehrenplatz im fast leeren Wohnzimmer hat mein Fahrrad. Es ist kein gewöhnliches Fahrrad. Es ist ein so genanntes »Pedersen«. Dieses wunderschöne, bequeme Gefährt ist mehr ist als ein bloßes Transportmittel. Es ist Philosophie, Lebenshaltung, das sagen jedenfalls alle, denen so ein Fahrzeug gehört. Der dänische Brückenkonstrukteur Pedersen hat es gegen Ende des letzten Jahrhunderts entworfen und gebaut. Heute wird es immer noch hergestellt, in Christiania zum Beispiel, einer ehemaligen Hippieenklave in Kopenhagen. Der Rahmen besteht aus dünnen Rohren, nach den Gesetzen der Triangulation zu schmalen Dreiecken miteinander verbunden. Der Sattel schwebt an einem Riemen zwischen Lenker und hinterem Rahmen. Das Sitzgefühl ist völlig anders als bei einem normalen Fahrrad. Man schwebt eher als dass man fährt. Ein Zustand der Gelassenheit, der einen leicht das Ziel vergessen lässt, auf das man sich gerade zubewegt. Ich fahre dieses Rad nur noch selten. Zu weit habe ich mich von dem dazu passenden Gemütszustand entfernt. Meistens hänge ich tief über dem Lenker meines rostigen Hollandrades, wenn ich gegen Wind und Regen zur Arbeit fahre.
Eine Woche nach dem Verschwinden meiner Mutter glaubte ich plötzlich den Geruch ihres Parfüms zu riechen. In ihrem ehemaligen Schlafzimmer. Es war übrigens ein Männerparfüm. Am folgenden Abend – ich war gerade von der Arbeit zurückgekommen, die darin bestand, alte Spesenabrechnungen zu prüfen und zu frisieren, wo es mir nötig schien – klingelte es. Ich ging zur Tür, öffnete. Vor mir stand eine grazil gewachsene junge Frau mit unscheinbaren braunen Locken. Sie waren nass vom Regen. Ebenso das von Sommersprossen bedeckte Gesicht mit diesen fast unnatürlich himmelblauen Augen. Es war Dale. Dale Mackay aus Inverness.
Sie musste lachen, als sie meine Verblüffung sah. »Komme ich etwa ungelegen?«, sagte sie. »Hast du vielleicht Damenbesuch?«
»Ja«, sagte ich. »Meine Mutter. Zumindest war sie da als Geist. Sie hat ihr Parfüm hinterlassen.«
»Darf ich reinkommen?«
Jetzt erst merkte ich, dass ich immer noch in der Tür stand, mit leicht eingezogenem Kopf, was nicht nur an meiner Körperlänge lag und an der Höhe des Tührrahmens.
2. Dale Mackay
Dale und ich wohnten zum ersten Mal, seit wir uns kannten, richtig zusammen. Allein dies war schon Weihnachten, auch wenn es bis zu den Feiertagen noch ein paar Tage hin war. Wir schliefen auf der schmalen Matratze, die das einzige Möbelstück im Schlafzimmer war. Es gab keinen Schrank. Wir warfen unsere Kleider auf den Parkettboden. Wenn ich nachts neben meiner Freundin aufwachte, hatte ich das Gefühl, im Freien zu campieren. Ich hörte ihren Atem, spürte ihre Wärme wie eine sanfte Emanation der Natur und glaubte, den Tau auf dem Gras zu riechen.
Das Frühstück nahmen wir meistens in der spartanisch eingerichteten Küche ein. Es war wie Picknick. Einmal hielt ich Dales Hand und versuchte mit der Linken, ein Brötchen mit Honig zu bestreichen. Es fiel vom Teller auf den Boden, natürlich mit der klebrigen Seite nach unten. Dale lachte auf, setzte sich mir auf den Schoß und philosophierte: »Verliebte Männer erinnern an betrunkene Teddybären. Verliebte Frauen sind eher wie Schlangen kurz nach der Häutung. Verletzlich und müde.«
Ein anderes Mal gingen wir in eine Frühstückskneipe, aßen eine furchtbare Menge von Hackbrötchen und tranken schwarzen Kaffee dazu.
»Wie lange kannst du bleiben?«, fragte ich vorsichtig.
»Eine Reihe von Ewigkeiten, mein lieber Piet. Verteilt auf zwei Tage. Ich muss übermorgen in die Schweiz fahren.«
»Dienstlich?«
»So halb und halb. Meine Chefs haben beschlossen, dass ich einen Sprachkurs besuchen soll. Ich habe Holländisch vorgeschlagen und damit nur wieherndes Gelächter provoziert. Du kannst dir denken, warum.«
»Eigentlich nicht. Unsere Sprache ist schön.«
»Ja, das stimmt. Aber sie verniedlicht die Wirklichkeit, Piet. Katastrophen bekommen etwas Gemütliches, wenn auf Holländisch darüber berichtet wird. Ihr seid eben von alters her ein Kaufmannsvolk, das einfach alles, auch den Weltuntergang, in kleinen Portionen abwiegt.«
»Und jetzt sollst du lieber Schwyzerdütsch lernen, weil das eine brutale und sachliche Sprache ist. Das Schottisch der Alpen!«
»So ähnlich.« Dale lächelte. »Ich bin dazu auserkoren worden, meine Kenntnisse in den beiden wunderschönen romanischen Sprachen Italienisch und Französisch aufzufrischen. Du ahnst gar nicht, wie viel Italiener und Franzosen bei uns aufkreuzen. Offenbar ist Schottland zurzeit besonders in Italien der absolute Hit. Na ja, wer zu Hause so viel Sonne hat und so viel Kultur, der ist für diesen Masochismus natürlich prädestiniert.«
»Und darum gehst du in die Schweiz. Warum nicht nach Italien und Frankreich?«
»Weil in der Schweiz sowohl Italienisch als auch Französisch gesprochen wird. Ich gehe nach Bern. Es soll eine interessante Stadt sein. Und es gibt dort eine ausgezeichnete Sprachenschule.«
Ich war enttäuscht, eifersüchtig auf Bern und seine Bewohner, aber ich versuchte, gelassen zu wirken, und wechselte daher lieber das Thema.
»Wie geht es bei dir auf dem Revier? Immer noch die gleichen alten Kollegen? Der Glaskasten mit dem Blick auf die blaue Silhouette der Highlands?«
Dale seufzte. »Ich entbehre diesen Blick, Piet. Man hat mich in die Lowlands versetzt. Eine Beförderung, die im wahrsten Sinne des Wortes ein Abstieg ist. Ich bin jetzt Chief Inspector in Edinborough und zuständig für die südliche Region der Stadt sowie die angrenzenden ländlichen Bezirke. Eine langweilige Gegend, sag ich dir. Hügel, nichts als Hügel, aber solche ohne Größe, ohne Charakter, ohne Persönlichkeit. Es gibt wenig Erwähnenswertes. Aber die Kirche in Roslin würde dir gefallen. Sie ist wunderschön. Der dritte Earl of Orkney, Sir William Sinclair, hat sie bauen lassen. Weißt du noch? Die Orkneys? Spukt dir Christine immer noch im Kopf herum?«
Das Gespräch nahm eine aus meiner Sicht gefährliche Wendung. Christine Campbell, meine Freundin aus alten Tagen, wegen der es mich vor noch nicht allzu langer Zeit nach Schottland verschlagen hatte, war tot, aber sie verfolgte mich immer noch. Ich träumte häufig von ihr. Gleichsam aus Notwehr ging ich zu einer Gegenfrage über: »Warum hast du mir nichts von deiner Versetzung erzählt?«
»Piet«, sie streichelte mir übers Haar wie einem kleinen Jungen, »du weißt doch, dass wir übereingekommen sind, über dienstliche Dinge nicht zu reden, jedenfalls nicht am Telefon.«
Zwei Tage später fuhr Dale. Wir saßen eine Stunde vorher im Bahnhofsrestaurant und tranken abwechselnd Bier und Kaffee. Wir redeten nicht. Es war, als warteten wir gemeinsam als entfernte Verwandte eines gerade Verstorbenen auf den Beginn der Beerdigungszeremonie. Unsere Hände lagen ineinander. Asche zu Asche. Staub zu Staub.
»Glaubst du, dass das Weltall ewig expandiert oder dass es sich irgendwann wieder zusammenzieht?«, fragte Dale plötzlich.
Ich blickte sie an und versuchte, amüsiert zu wirken. »Ich hoffe, es zieht sich irgendwann wieder zusammen«, sagte ich. »Dann werden wir uns auf jeden Fall wieder treffen. Atomkern für Atomkern.«
»Eine Art Kernfusion, bei der sinnlose Energie frei wird«, sagte sie. »Weißt du was, Piet? Ich setze mich jetzt in den Zug und lese eine Frauenzeitschrift, bis er abfährt. Du verschwindest, sonst werden wir hier noch umkommen vor Abschiedsschmerz.«
Ich nickte. »Ruf mich so oft an, wie du kannst«, sagte ich noch. Unsere Lippen fanden sich noch einmal in einer Art Begegnung der Dritten Art. Wie Geister, deren Astralleiber ineinander verschwimmen.
Dale rief nicht an. Weder an diesem Abend, wie ich gehofft hatte, um mir zu sagen, dass sie gut angekommen sei, noch am nächsten Tag. Wahrscheinlich war sie viel zu beschäftigt, um sich zu melden. Dennoch kaufte ich mir einen Anrufbeantworter und hörte ihn vom Büro aus ständig ab. Als ein weiterer Tag und eine weitere Nacht verstrichen waren, ohne dass sich meine Freundin gemeldet hatte, rief ich bei ihrer ehemaligen Dienststelle in Inverness an. Dort verband man mich mit ihrem neuen Büro. Eine reservierte Stimme teilte mir mir, dass alles in Ordnung sei. Chief Inspector Dale sei auf Dienstreise. »Sie ist eine sehr selbstständige junge Dame, Mister Hieronymus«, sagte der Kollege. »Wir Männer sollten uns endlich damit abfinden, dass väterliche Gefühle Damen gegenüber inzwischen ein Anachronismus sind, ein Atavismus, ein Rückfall in prähistorische Zeiten.« Zweifellos war es ein Schotte mit Sinn für Humor. Ich bedankte mich für die Belehrung und legte auf.
Meine Zweifel daran, dass alles mit rechten Dingen zuging, blieben dennoch. Wenigstens hatte ich von ihrem schottischen Kollegen erfahren, dass die Sprachkurse im Gebäude der Universitätsbibliothek von Bern stattfanden. Ich rief dort an und wurde nach einigem Hin und Her mit Franz Gala, dem Leiter der Bibliothek, verbunden. Er schien ein sehr netter Mann zu sein. Sein dezentes Schwyzerdütsch wirkte augenblicklich beruhigend auf mich. »Ich werde mich nach dem Kurs und nach Ihrer Kollegin erkundigen«, sagte Gala. »Wenn Sie möchten, rufe ich Sie morgen früh an. Dann weiß ich sicher mehr.«
Ich bedankte mich. Diesmal schlief ich wenigstens bis vier Uhr morgens. Dann saß ich am Telefon und starrte es an wie ein schwarzes Monstrum aus den Weiten des Weltalls.
Um zehn Uhr rief Franz Gala endlich an. »Ihre Kollegin hat tatsächlich Kurse in Italienisch und Französisch belegt. Sie ist auch eingetroffen. Sie war bei einem Vorgespräch mit dem italienischen Sprachlehrer. Aber seitdem hat sie niemand mehr im Hause gesehen.« Diesmal wirkte sein Akzent nicht beruhigend, sondern wie Salz, das man in eine offene Wunde reibt.
Eine Stunde später saß ich im Zimmer meines Chefs. Ich war so außer Fassung, dass ich keinerlei diplomatische Floskeln benutzte, als ich ihm eröffnete, sofort dienstlich nach Bern fahren zu müssen. Mein Chef ist sehr empfindlich, wenn es um Kompetenzen geht. Er ist Kettenraucher, und er genießt es, seine Gesprächspartner durch längere Hustenanfälle aus dem Konzept zu bringen. Diesmal schien sein Hustenanfall kein Ende zu nehmen. Schließlich brachte er keuchend heraus: »Piet, du musst dich einfach damit abfinden, dass bei dir Damen verschwinden, und zwar immer dann, wenn du dich besonders um sie bemühst. Zuerst Christine Campbell auf den Orkneys, dann deine Mutter und jetzt deine schottische Kollegin. Du solltest als Magier arbeiten, du würdest bestimmt diesen Amerikaner in den Schatten stellen, wie heißt er noch, diesen... ich komm einfach nicht auf den Namen, er war mit einem deutschen Model zusammen... warte mal...« Er zündete sich eine Zigarette an und atmete mittels eines langen Lungenzuges tief durch. Augenblicklich verschwand sein Husten. Seine Stimme klang nun voll und klar. »Er hat den Namen irgendeiner Figur aus einem Dickensroman. Heißt er nicht Uriah Heep? Oder Oliver Twist? Ja, das ist es. Oliver oder David Twist. Ich sage dir, der lässt seine Damen nicht so elegant verschwinden wie du.«
Ich unterbrach ihn nicht, denn ich wusste, dass dies seine Spöttereien nur verlängern würde. »Wenn Dale Mackay wenigstens Holländerin wäre, dann würde ich dich sofort fahren lassen. Aber so sind die schottischen Kollegen zuständig und natürlich die in Bern. Ich habe gehört, die Berner Kriminalpolizei soll genauso langsam wie gründlich arbeiten. Mir hat mal einer einen Witz erzählt. Es ging um Lawinenhunde aus dem Berner Oberland. Warte mal, ich glaube, die Pointe war so, dass sie das Rumfässchen, das sie um den Hals tragen, selbst austrinken und dann einschlafen. Nein, es war etwas anderes, warte mal, gleich hab ich es.« Wieder bekam er einen Hustenanfall, der nicht enden wollte.
»Ich fahre, und wenn ich dazu kündigen muss«, sagte ich knapp.
Schlagartig hörte er auf zu husten. Er blickte mich milde lächelnd an.»Hat dich ganz schön gepackt, was? Ist sie gut im Bett?«
Ich hätte ihm die Zigaretten in den Rachen treiben können. Er lehnte sich zurück, hüstelte leicht und sagte: »Also gut, ich will mal davon ausgehen, dass ihr demnächst heiratet. Dann ist sie schon fast Holländerin. Hau ab, Piet, und suche sie. Ich erwarte in einer Woche deinen Bericht.«
Ich fuhr mit dem Abendzug nach Köln, um von dort eine frühe Verbindung nach Bern zu bekommen. Es wurde eine komplizierte Reise von insgesamt fast 18 Stunden Länge. Ich musste allein in Holland dreimal umsteigen. An Schlaf war nicht zu denken. In Köln verpasste ich den Anschlusszug um wenige Minuten. Ich hatte knapp eine Stunde Zeit bis zur Abfahrt des nächsten Eurocitys und beschloss, mir den Dom anzusehen. Wie ein kühles Raumschiff wirkte er. Ich glaubte, den Andruck in den Beinen zu spüren, als wir uns zu Orgelklängen erhoben, um die Umlaufbahn zu verlassen.
Ich habe noch nie eine Kirche erlebt, die ihrer Funktion so wenig angemessen ist wie der Kölner Dom. Das ist kein Haus Gottes, hier hat er nie gewohnt, wahrscheinlich, weil ihm dieses Appartement zu groß ist. Vielleicht liegt die Wirkung auch daran, dass dieser wuchtige Bau in einem falschen Ambiente steht. Die Betonplatte, auf der man ihn präsentiert, wirkt wie ein Tablett, oder wie eine Startrampe eben. Wie anders kommt da ein Dom wie der in Metz zur Geltung, weil er über einen würdigen Standplatz verfügt, aus dem seine Silhouette herauszuwachsen vermag wie eine magische Pflanze, die einem Licht entgegenstrebt, das zugleich in ihr ist. So kommt es, dass man die herrlichen Kirchenfenster im Dom zu Metz wie Öffnungen erlebt, die den Blick auf eine außerirdische Welt erahnen lassen, mystisch, unendlich tief und voller sanfter Farben der Erlösung. Die Fenster des Kölner Doms hingegen versperren den Blick. Sie gehen auf nichts hinaus, und das Tageslicht, das sie mühsam filtern, ist das einer lärmenden Stadt.
Endlich saß ich im Zug. Ich hatte kein Reisegepäck mitgenommen. Irgendwie wäre mir eine Zahnbürste oder ein Schlafanzug frivol vorgekommen. Nur für eines sorgte ich jetzt. Ich rief von meinem Mobiltelefon aus Franz Gala an und kündigte meine Ankunft in Bern für kurz nach fünfzehn Uhr an. Gala sagte, er würde sich außerordentlich über meinen Besuch freuen und mich selbstverständlich am Bahnhof abholen.
3. Franz Gala
Als ich total übermüdet in der Schweizer Hauptstadt ankam, in dieser grau-grünen Meerstadt ohne Meer, die so geträumt anmutet, dass man sie leicht für eine Illusion halten kann, war mein erster Eindruck, hier könnten überhaupt keine Verbrechen, zumindest keine grausamen geschehen. Überall gedeckte Farben, milde Grau- und Grüntöne, sanftes Rot. Alles von unspektakulärer Eleganz. Selbst die Penner schienen modischer gekleidet als anderswo, und die Punker wirkten wie geschmacklos arrangierte Schaufensterpuppen. Eine Welt, die den nostalgischen Eindruck einer leicht vergilbten Illustration aus einem alten Baedeker machte. Auch der Himmel passte sich an mit ein paar elefantengrauen Regenwolken vor einem Hintergrund aus blauem Satin. Und als die ersten dezenten Regentropfen fielen, begriff ich, dass man trotzdem nicht nass werden musste, dank der alle Straßenzüge begleitenden Arkaden, in deren Halbdunkel sich kleine Geschäfte voller kreativ dekorierter Kostbarkeiten aneinander reihten.
Das Einzige, was mir aufgefallen war, weil es weniger dezent wirkte als alles andere, war das Lächeln einer Frau auf dem Bahnsteig. Sie war jung und sah sehr gut aus. Ihre langen, glatten Haare waren frisch gewaschen. Sie war einfach gekleidet in Jeans und einen blauen Parka. Sie blickte nach oben und schien an etwas Schönes zu denken, denn sie hörte nicht auf zu lächeln. Vielleicht war es das Kind, das hinter der kleinen Wölbung ihres Bauches in ihr wuchs. Ich ging. Als ich mich umdrehte, lächelte sie immer noch. Ihre beiden Hände lagen behutsam gefaltet über ihrem Bauch.
Bern gleicht, zumindest was den mittelalterlichen Kern anbelangt, einer Insel, genauer gesagt, einer Halbinsel, die sich in einer Aareschleife erhebt, eindrucksvoll und ziemlich unzugänglich für den Fremden. Die Ufer sind steil, die Bebauung so eng und grau und kompakt und die Straßen so schmal, dass man meinen könnte, sich in einem unwegsamen Felslabyrinth zu befinden. Bern ist sauber und ordentlich. Dennoch gibt es offenbar recht viel skurrile Leute hier. Käuze, die sich der berüchtigten Schweizer Normalität durch Querköpfigkeit entziehen. In einem der Brückenhäuschen der Nydeggbrücke zum Beispiel wohnt ein Pianist, der mitten im Rauschen der Aare und des Verkehrs Bach spielt. Ein Uhrmacher baut Uhren ohne Zeiger und Zifferblatt, die er in seinem kleinen Laden in den Arkaden – oder Lauben, wie man hier sagt – ausstellt. Im unteren Teil der Stadt, der »Matte«, sprechen immer noch einige Leute eine silbenverdrehende Geheimsprache, das so genannte Mattenenglisch, das jedoch eher ans Holländische erinnert. Hier sind die Lauben so niedrig, dass man gebückt laufen muss, selbst wenn man nicht so groß ist wie ich. Die Läden sind noch seltsamer als in der Oberstadt. Zwei Bernhardiner sitzen im Schaufenster der Praxis einer Geruchs- und Farbentherapeutin. Gleich daneben sieht man durch die Scheibe das »Grab der ungelesenen Anzeigen«. Ein leerer, mit Zeitungsannoncen tapezierter Raum, in dem eine einzelne, von einem Spotlight angestrahlte rote Rose steht.
Ich nahm dies alles und noch einiges mehr bei meiner ersten Begegnung mit der Stadt wahr, einer Situation, die vergleichbar ist mit dem ersten Augenkontakt mit einem Menschen. Zuneigung oder Abneigung, Verliebtsein oder Gleichgültigkeit wurzeln zumeist in diesem allerersten Eindruck, den das Fremde auf uns macht. In diesem Fall ergab sich eine krause Mischung all dieser Gefühle. Bern zog mich an. Es stieß mich aber auch ab. Es faszinierte mich, und es ließ mich auf eine ganz seltsame Weise gleichgültig, so als wüsste ich, dass es eine Kulisse war, eine schöne zwar, aber doch geträumten Fantasien näher als der Realität.
Vielleicht lag diese ambivalente Reaktion auch daran, dass ich meine ersten Schritte durch Bern unter Anleitung eines speziellen Führers machte. Franz Gala. Gala war Schweizer, aber kein Berner. Er schien zu dieser Stadt eine Art Hassliebe, oder besser gesagt, eine von gewissen Abneigungen überlagerte dezente Zuneigung zu haben.
Gala erwartete mich am Bahnsteig, ein kleiner Mann mit wachsamen Augen, zu dem ich sofort Zutrauen fasste. Er reichte mir die Hand und drückte sie fest. »Einen schönen Namen haben Sie, Doktor Hieronymus. Er ist für mich voller geistesgeschichtlicher Assoziationen.«
»Woher kennen Sie meinen akademischen Titel?«
»Internet, Doktor Hieronymus. Ich weiß, dass Sie als Psychologe gearbeitet haben, ehe Sie bei der Polizei gelandet sind. Wir haben Ihre Dissertation über multiple Persönlichkeiten in unserem Archiv. Eine sehr interessante Arbeit. Man wechselt die Persönlichkeit wie das Hemd. Ein Leben wie in einem Kostümverleih. Eigentlich sehr angenehm. Haben Sie eigene Erfahrungen damit?« Er sah mich gutmütig lächelnd von der Seite an. Ich zog es vor, zu schweigen.
Wir gelangten in die Altstadt. Gala wies mit lässigen Kellnerbewegungen auf diese und jene Sehenswürdigkeit hin, die er mir mit Bemerkungen servierte wie »in der architektonischen Bedeutung weit überschätzt«, »im Grunde wenig bemerkenswert«, »höchstens von historischem Interesse«. Er machte die Stadt nach Kräften schlecht, aber eine gewisse Liebe zu ihr war dennoch zu spüren. Schließlich empfahl er mir ein Hotel in der Altstadt, dessen Preise günstig seien, was sich allerdings als Trugschluss herausstellte. Nun wird meine Hotelrechnung normalerweise zwar von meiner Behörde bezahlt, aber in diesem Fall war ich mir dessen keineswegs sicher. Mir war jedoch alles egal. Die Berner Stimmung hatte bereits von mir Besitz ergriffen, eine merkwürdige Form der Apathie, in der Preise in einer unbekannten Währung existierten. Gala drückte mir zum Abschied die Hand. »Ich erwarte Sie um acht Uhr in den Brückenstuben«, sagte er. Dann ging er, wobei sein grauer Mantel mehr und mehr mit den Häuserwänden und dem Gassenpflaster zu verschmelzen schien.
Im Hotel legte ich mich auf das frisch bezogene, kühle Bett, nachdem ich einen kurzen Blick aus meinem Zimmerfenster geworfen hatte, das auf einen düsteren Hinterhof ging. In seiner Mitte erhob sich ein Baumstumpf. Ich schloss die Augen und gab mich dem Gefühl hin, am Grunde des Styx dahinzutreiben wie ein von Vergangenheit voll gesogenes Stück faules Holz.