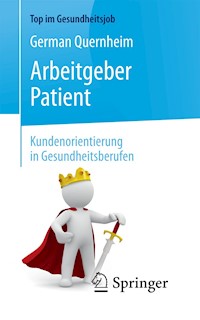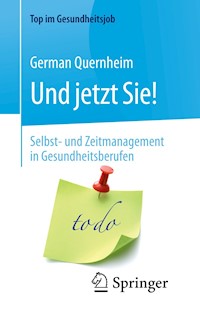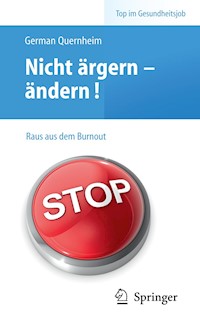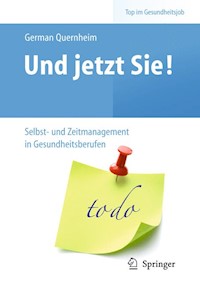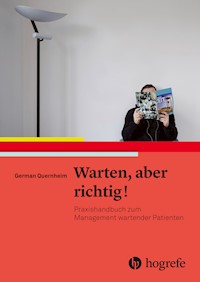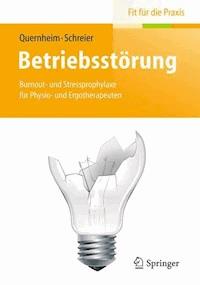35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Buch zeigt, wie wichtig Berufsstolz für Pflegende in Ausbildung, Lehre und Praxis ist. Die Autoren klären, welche Mechanismen und Strategien helfen, um diese Haltung zu entwickeln. Sie beschreiben die Facetten des Berufsstolzes mit Identität, Individualität, Leidenschaft, Mut, Selbstwert, Sinnhaftigkeit, Wissen und Bildung. Die Inhalte stärken professionell Pflegende und machen ihnen Mut, gegen chronische Belastungen und ethische Dilemmata aktiv vorzugehen und unwürdige Situationen zu ändern. Arbeitsporträts und Berichte aus der Praxis bieten konkrete Rollenmodelle und Umsetzungstipps. Die Autoren vermitteln die Grundlagen der Lobbyarbeit im Pflegeberuf. Sie zeigen Pflegenden, wie sie sich erfolgreich darstellen können und Selbstbewusstsein nach außen vermitteln und verkörpern können. Berufsstolz lässt sich in der Pflege nicht verordnen, anlesen oder kaufen. Aber die Autoren machen Mut. Sie geben konkrete Anweisungen und zeigen Pflegenden den Weg, wie sie mehr Berufsstolz entwickeln und Freude am zentralsten aller Empathie-Berufe gewinnen oder wiederbeleben können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Ähnliche
German Quernheim
Angelika Zegelin
Berufsstolz in der Pflege
Das Mutmachbuch
2., korrigierte Auflage
Mit Geleitworten von Jens Spahn, Franz Wagner (DBfK) und Sophie Ley (SBK)
Berufsstolz in der Pflege
German Quernheim, Angelika Zegelin
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld;
Christine Sowinski, Köln; Franz Wagner, Berlin; Angelika Zegelin, Dortmund
German Quernheim. Dr. rer. medic., Gesundheits- und Krankenpfleger, Diplom Pflegepädagoge (FH), Dozent, Trainer und Coach, Montabaur.
E-Mail: [email protected]
Angelika Zegelin. Hon.-Prof. em. Dr., Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe, Mag. Erziehungswissenschaft, Pflegewissenschaftlerin, Dortmund.
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z.Hd. Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Lena Marie Wimmel, Martina Kasper, Julien Lehmann
Bearbeitung: Martina Kasper
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Getty Images/mikanaka
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Illustration/Fotos (Innenteil): Jürgen Georg, Martin Glauser, Germann Quernheim, Thomas Kollner,
Michaela Friedhoff
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
2., korrigierte Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag, Bern
© 2021 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96192-7)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76192-3)
ISBN 978-3-456-86192-0
http://doi.org/10.1024/86192-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Grußwort von Jens Spahn
Geleitwort von Franz Wagner
Geleitwort von Sophie Ley
Einführung
Teil I: Berufsstolz
1 Pflegekunst
2 Berufsstolz und Pflegestolz
2.1 Scham und Berufswahl
2.2 Respekt
2.2.1 Symbole und Dienstkleidung der Pflege
2.2.2 Berühmte Pflegende
2.2.3 Pflegende in Romanen, Filmen und Serien
3 Facetten des Berufsstolzes
3.1 Selbstwertgefühl
3.2 Leidenschaft
Kommentar A. Zegelin
Bullshit-Jobs
3.3 Sinnhaftigkeit
Pflege orientiert sich an Werten
3.4 Mut und Motivation
Mut
Motivation
3.5 Identität und Individualität
3.6 Wissen und Bildung
Gastbeitrag
4 Auswirkungen des erlebten Stolzes
Gastbeitrag
Teil II: Pflege als Beruf
5 Das Wesen der Pflege
5.1 Vielfältigkeit
Stufen der Pflegekompetenz
5.2 Umfassender Ansatz
5.3 Alltags- und Lebensweltorientierung
5.4 Profession
Kommentar A. Zegelin
5.5 Caring und Comforting
Caring
Comforting
Going the extra mile
Beziehungsbasierte Pflege
Pflegetheorien
5.6 Beziehung und Eigenständigkeit
Eigenständigkeit
5.7 Kommunikation und Emotionsarbeit
Kommunikation
Emotionsarbeit
Mitleid und Mitfühlen
Freundlich sein zu jeder und jedem?
5.8 Wissensbestände
5.9 Detektivarbeit und Pflegedefinitionen
Detektivarbeit
Pflegedefinition
6 Fundierte Ausbildung
Verberuflichung
6.1 Akademisierung und Pflegebildung
Pflegebildung im akademischen Bereich
6.2 Erweiterte Wissensbereiche
Heilkunde-Übertragungsrichtlinie
6.3 Arbeit mit Helfern und Ungelernten
6.4 Neuere berufliche Einsatzorte
7 Aspekte der Pflegearbeit
7.1 Spaß und Freude
7.2 Arbeitszeiten
7.3 Zukunftssicherheit
7.4 Gehalt
Falsche Pauschalisierung
Bevölkerung über Bezahlung aufklären
8 Berufsfelder
8.1 Klassische Tätigkeitsorte in der Klinik
8.1.1 Tätigkeiten im Operationstrakt
8.1.2 Notaufnahme
8.1.3 Intensivpflege/Neonatologie
8.2 Klassische Tätigkeitsorte außerhalb der Klinik
8.2.1 Pflege älterer Menschen/Langzeitpflege
8.2.2 Ambulante Pflege
8.2.3 Privatpflege
9 Fort- und Weiterbildungen
Kommentar G. Quernheim
10 Pflege neu denken und studieren
10.1 Spezialisierungen im Übergang
10.2 Akademisierung international und national
Family-Health-Nurse, Community-Health-Nurse, School-Nurse
10.3 Zukunftstechniken
Kommentar G. Quernheim
10.3.1 Künstliche Intelligenz
10.3.2 Telepflege/Telenursing
10.3.3 Roboter
10.3.4 Augmented Reality-Brille: Utopie oder Zukunft?
11 Arbeitssituation im Ausland
Kommentar A. Zegelin
11.1 ICN-Kongress
11.2 Advocacy am Beispiel von Australien
12 Interprofessionalität
Gastbeitrag
Stolz beruflich Pflegender
Teil III: Belastende Arbeitsbedingungen
13 Widerstand regt sich
14 Ökonomisierung
14.1 Hintergrundwissen Gesundheitswesen
Finanzierung
Investitionen
14.2 Zu wenig Personal
Hoher Krankenstand
Kommentar A. Zegelin
14.3 Ursachen im Selbstverständnis
Jammerkreislauf
Coolout in der Pflege: Die Kälte-Studie von Karin Kersting
Teamkodex versus Berufsethos
Respekt und Würde
Unpolitisches Verhalten
14.4 Verknappung von Pflege
14.5 Über- und Unterforderung
14.5.1 Überforderung
14.5.2 Unterforderung
15 Angst vor Pflegebedürftigkeit wegen Personalmangel
16 Verbesserungsfähige Ausbildung
17 Image-Sexobjekt
18 Inkompetente Führung
19 Mangelnde Organisationsbereitschaft
20 Und nun?
Schöne neue Pflegewelt?
Kommentar Angelika Zegelin
Pflege 2060
Wie gehen Sie mit den in Kapitel 3 geschilderten Belastungen um?
Gastbeitrag
Statement Prof. Dr. phil. Gabriele Meyer
Wie sehen Sie den Einfluss von Berufsstolz auf die Pflegeentwicklung?
Gäbe es einen ausgeprägten, verbreiteten Berufsstolz, wäre es bestimmt einfacher, klar Position zu beziehen.
Wie schätzen Sie die Situation hierzulande ein?
Welche Ideen haben Sie zur Förderung von „Professional Pride“?
Teil IV: Was können wir tun?
21 Selbstverständnis
21.1 Ethische Kodizes
21.2 Präambel und ICN-Ethikkodex
22 Sprache und Ausdruck
22.1 Ansprache zu Patienten/Bewohnern
22.2 Ansprache zu uns selbst
22.3 Beschreiben Sie Ihr Pflegekonzept
Wie wirkt dagegen der nachfolgende Auftrag?
22.4 Fokussieren Sie die Genesung
Vermeiden Sie Zwang und Worte wie „müssen“ oder „sollen“
Verzichten Sie auf Verneinungen
Stimmen Sie sich dabei selbst positiv
22.5 Interprofessionelle Kommunikation
Beispiele für die Anwendung der SBAR-Regel
22.6 CareSlam und Humor
23 Aus der Stille die Stimme erheben
Nur eine Pflegerin
24 Botschaften
24.1 Zeigen Sie Flagge
24.2 Storytelling
Storytelling A. Zegelin
Ihre Botschaft: Ich bin stolz
24.3 Botschaften und Aktivitäten im Ausland
25 Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit
Kommentar A. Zegelin
Idee Vision zur Umsetzung Lobbyarbeit
Kommentar G. Quernheim
25.1 Image attraktiver gestalten
Kommentar A. Zegelin: Details herausarbeiten
25.2 Berufsprestigeskalen
25.3 Unsere Botschaften an die Pflegenden und unser Team
25.4 Verbesserung der Ausbildungsqualität
Ein neues Ausbildungsmodell
Verlorene Leidenschaft
Weitere Möglichkeiten
25.5 Skill- und Grademix
Mentoring
Am Ende von Aus- und Weiterbildung: Zeremonien
25.6 Wertschätzung und Führung
Horizontale Feindseligkeit
25.7 Hilfreiche Tools
Fallbesprechungen
Kollegiale Beratung
25.8 Unsere Botschaften an die Gesellschaft
25.9 Unsere Botschaft an Kommunen und Politiker
Dienstpflicht in der Pflege
25.10 Unsere Botschaften an die Medien
25.11 Unsere Botschaften an die Ärzte
Interne Öffentlichkeitsarbeit für unsere Berufsgruppe
25.12 Unsere Botschaft an die Arbeitgeber
26 Projekte und Kampagnen
Projekte
Kampagnen zum Tag der Pflege
Großkundgebungen
26.1 Hausinterne Öffentlichkeitsarbeit
Austausch mit allen Mitarbeitenden
Tafelbesprechung/Kurzmeeting
26.2 Krisenpläne und Personalausfallkonzepte
26.3 Bettensperrung
Kommentar G. Quernheim
27 Organisiert Euch!
Macht macht Stolz
27.1 Gewerkschaften
27.2 Berufsverband
27.3 Pflegekammer
27.4 Berufsregister
28 Zivilcourage zeigen und Mut entwickeln
28.1 Leistungsverweigerungsrechte
28.2 Dienst nach Vorschrift
28.3 Gefährdungsanzeige
28.4 Streiken
28.5 Whistleblowing
29 Betriebliche Einflussfaktoren
Gute Führung macht stolz
Tipps gegen den Jammerkreislauf
30 Arbeitgebermarkenbildung (Employer Branding)
Arbeitgebersiegel
Hochwertige Vermittlung
Gastbeitrag
Teil V: Was können Sie selbst tun?
31 Selbstwertgefühl/Selbstbild analysieren
31.1 Umgang mit Kritik
31.2 Biografische Reflexion
Selbst – was ist das überhaupt?
32 Selbstwertgefühl stärken
32.1 Vorbilder suchen
Kommentar A. Zegelin und G. Quernheim
32.2 Eigene Werte und Karriere
33 Aktives Mitglied werden
34 Halten Sie sich „Up To Date“
Journal Club
Jahres- oder Zielvereinbarungsgespräche
Unterstützer finden
Nehmen Sie Einfluss auf Ihre Arbeitszeugnisse
Tipps zur Auswahl von Fortbildungsangeboten und Studiengängen
35 Einstellungen, Haltung und Werte
35.1 Anders denken
35.2 Frustrationstoleranz
Pflegeausbildung fordert
Tipps zu realistischerem Denken
36 Körpersprache – Embodiment und Ihr Auftreten
Begriff Embodiment
Praktische Übung
Embodiment erarbeiten
36.1 Empfehlungen zu Auftreten und Haltung
Im Sitzen
Im Stehen
Erbse Krone
36.2 Gesten
36.3 Äußeres
37 Vorstellung, Namensschild und Visitenkarte
37.1 Geschwindigkeit und Training
38 Emotionsarbeit
38.1 Dreiteiliges Schichtenmodell
38.2 Weitere Übungen zur Emotionsarbeit
Berufliches Tagebuch
Der Vokabeltrick
Das Gefühlsmikroskop
39 Selbstmarketing
39.1 Personenmarke
39.2 Das Meisterstück: Ihr Elevator-Pitch
Tipps zur Gehaltsverhandlung
39.3 Selbstständige, Freiberufler und Unternehmertum (Entrepreneurship)
40 Sich distanzieren und schützen
40.1 Geistiger Neoprenanzug
40.2 Sich schützen
Veränderungen sind möglich
41 Schlussbemerkung
Eine herzliche Bitte
42 Nach-Corona-Wort
Berufsstolz in Pandemiezeiten
Auswirkungen der Pandemie
Folgen für die Pflegenden
Bildung in Coronazeiten
Wertschätzung
Fazit
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Handreichung für Lehrende, Anleitende und Führende der Pflegeberufe
Beispiele
Anregungen für theoretischen und praktischen Unterricht
Anregungen für Praxisanleitende
Anregungen für Führungskräfte, Teamleitungen
Autoren
Lebenslauf Angelika Zegelin
Lebenslauf German Quernheim
Wie es zu diesem Buch kam
Angelika Zegelin
German Quernheim
Professionelle Pflege und Selbstpflege im Hogrefe Verlag
Achtsamkeit, Selbstmitgefühl
Aggressionsmanagement, Bullying, Gewalt, Mobbing
Beziehungsarbeit
Empowerment, Speak up
Recovery
Naturheilkundige komplementäre Pflege, Greencare
Pflegeethik, Spiritual Care
Pflegekommunikation
Pflegekompetenz
Pflegemanangement
Pflegewissen
Positive Pflege
Stress, Coping und Resilienz
Sachwortverzeichnis
Landkarte „Berufsstolz in der Pflege“
|11|Danksagung
(Foto: A. Zegelin, G. Quernheim)
An unserem Buch haben viele Menschen mitgeholfen: erfahrene und weitergebildete Praktikerinnen und Praktiker, viele Expertinnen und Experten auch mit Studienabschlüssen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichten wir hier auf die Nennung vielerlei Titel und Ehrengraden.
Vielen Dank an die Textgeber der Arbeitsporträts: Marina Ufelmann (Intensivpflege), Karin Voss (Palliativpflege), Christoph Müller (Psychiatrische Pflege), Dorothea Hochner (Endoskopie), Sabine Hohmann (Neonatologie), Sonja Schiff (Pflege in einer Hausgemeinschaft) und Renate Kunz (Angehörigenberatung in kritischen Kliniksituationen).
Wir danken für die gelungenen Statements herzlich Gabriele Meyer, Hanna Mayer, Sabin Zürcher und Sabine Hahn, Markus Golla sowie Peter Bechtel.
Für Anregungen, Textpassagen und Fachgespräche danken wir Christel Bienstein, Tanja Segmüller, Christine Sowinski, Maja Storch, Tanja Pardela, Jörg große Schlarmann, Franz Wagner, Manuela Klupsch und Moritz Koster.
Während unserer Recherchen haben wir uns intensiv mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, haben dabei Inhalte diskutiert, benötigten deren Fachexpertise für genaue Informationen und erhielten dadurch gute Anregungen. Dafür ein herzliches Dankeschön an Frank Weidner, Theresia Frauenlob, Anne Meissner, Anneke de Jong, Gabriele Overlander, Lena Püsch, Rainer Ammende, Gertrud Stöcker, Christine Vogler, Elke Reinfeld, Volker Großkopf, Peter Nydahl, Carsten Hermes, Johanna Knüppel und der Arbeitsgemeinschaft Unternehmerinnen und Unternehmer des DBfK, Judith Seidel von der Pflegekammer Rheinland-Pfalz und Martina Schaar.
Insbesondere danken wir der DRK-Schwesternschaft Bonn für einen Produktionskostenzuschuss für die erste Auflage dieses Buches.
Abschließend danken wir Frau Martina Kasper für die Textredaktion, -formatierung und -indexierung sowie ihre Ideen und Vorschläge.
November 2019
German Quernheim und Angelika Zegelin
|13|Grußwort von Jens Spahn
(Foto: BMG/Maximilian König)
Es wäre zu schön, um wahr zu sein: Ein Buch, das den Pflegeberuf in der Rangliste der Berufswünsche auf Platz 1 katapultiert! Der Spitzenplatz wäre angemessen, wenn man die Bedeutung der Pflegekräfte für unsere Gesellschaft betrachtet: Wir brauchen sie, um eines unserer größten sozialen Versprechen, das wir uns als Gesellschaft selbst gegeben haben, täglich einlösen und vor allem in Zukunft aufrechterhalten zu können – hochwertige Versorgung für jeden, jederzeit. Aber zur Motivation gehört mehr als die Botschaft: Pflege ist ein krisensicherer Job. Viele haben ja das schon erlebt, was diesen einzigartigen Beruf ausmacht. Dennoch haben sie aufgehört. Wie können wir sie zurückgewinnen? Politisch haben wir einiges in Gang gesetzt, um in einer breiten Allianz die Arbeitsbedingungen Schritt für Schritt zu verbessern. Wenn dieses Buch Motivation für Pflege (wieder) zu wecken hilft, dann ist das ein wichtiger Beitrag. Unsere gesellschaftliche Wertschätzung der Pflegenden steht ganz sicher auch in Wechselwirkung mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Pflegende ihre Bedeutung – als eine für die Gesellschaft sorgende Berufsgruppe – artikulieren, sich organisieren und uns zeigen, wie stark sie gemeinsam sind. Dass man allen Pflegenden zu diesem „Stärke zeigen“ Mut machen möchte, hängt wiederum auch mit einem überaus sympathischen Zug dieser helfenden Menschen zusammen: Es gehört zu ihrem Arbeitsethos, sich für andere zurückzunehmen. Aber eben darauf können sie so stolz sein!
Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit
|15|Geleitwort von Franz Wagner
(Foto: Anette Koroll)
Proud to be a Nurse!
Stolz auf den eigenen Beruf zu sein fällt vielen Pflegenden heute schwer. Das hat fast nie etwas mit dem Beruf zu tun, sondern viel mit den Bedingungen, unter denen die Pflege heutzutage ausgeübt werden muss. Manchmal hat es in letzter Zeit auch mit anderen Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu tun – aber das liegt mehr an den Auswirkungen von Social Media auf zwischenmenschliches Verhalten.
Dabei ist Pflege immer noch ein wunderbarer Beruf mit einer riesigen Vielfalt an Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, es ist auch harte Arbeit – auch nachts und an Weihnachten – und tägliche Auseinandersetzung mit existenziellen Krisen von Menschen. Und die ganzen Aufgaben, die eklig sind. Dies ist aber schnell vergessen, wenn wir die Früchte unserer Arbeit ernten: manchmal nur ein Lächeln oder ein Patient mit Schmerzen kann schlafen oder die Hinterbliebenen können Abschied nehmen, obwohl das Bett dringend gebraucht wird.
Es ist ein großes Problem unseres Berufes, dass vieles unserer Arbeit so unsichtbar bleibt. Mit Wahrnehmen von Details und Empathie, Koordinieren der vielen Abläufe und dem Ausstrahlen von Sicherheit erreichen wir so viel. Diese „Kleinigkeiten“ machen aber die gefeierten großen Erfolge der Medizin oft erst möglich! Was wäre denn aus der ersten erfolgreichen Herztransplantation geworden, wenn es nicht Pflegefachpersonen gegeben hätte, die nach der Operation für eine gute Wundheilung, Mobilisation und Infektionsschutz aber auch Motivierung des Patienten gesorgt hätten?
Nicht umsonst werden Jahr für Jahr Pflegepersonen in Meinungsumfragen bei Vertrauen und ethischen Standards weltweit – auch in Deutschland – an die Spitze der Berufe gewählt! Unsere Fähigkeit, sich in die betroffenen Menschen hineinzuversetzen, die Situation mit ihren Augen zu sehen ist eine Stärke unserer Profession. Dann darauf richtig zu reagieren, zu entscheiden was am besten wirkt, wie die Betroffenen verstehen können, was los ist oder einen Weg finden, mit einer Einschränkung umzugehen oder trotz der Einschränkung ein gutes Leben zu führen, ist eine andere Stärke der Pflege.
Florence Nightingale sagte „Pflege sei Wissenschaft und Kunst“. Nach langen Jahrzehnten der Benachteiligung im Frauenberuf ist auch in Deutschland die Pflege an den Hochschulen angekommen. Immer mehr Pflegefachpersonen studieren ihr Fach. Ergebnisse der Pflegeforschung werden zunehmend politisch und gesellschaftlich wahrgenommen. Ein Stück weit ist Pflege an Hochschulen auch ein Gütesiegel für unsere Profession – unabhängig davon, ob man selbst studiert hat oder nicht.
Stolz auf den eigenen Beruf zeigt sich in den Geschichten, die wir erzählen. Nicht die Ge|16|schichten über die belastenden Arbeitsbedingungen oder die Nicht-Pflegenden schockierenden Details unseres Alltags. Ich habe in einem englischsprachigen Blog mal gelesen, „Pflegende seien Menschen, die nicht wissen, dass man beim Essen nicht über Körperfunktionen und -ausscheidungen spricht“. Nein, es geht um die scheinbar kleinen Erfolgserlebnisse, die für die Betroffenen so viel bedeuten können. Aber manchmal auch die großen Erfolgserlebnisse, wenn man frühzeitig eine sich anbahnende Krise erkannt hat und dadurch einem Menschen vielleicht sogar das Leben gerettet hat. Zwischen diesen Polen – ein dankbares Lächeln für einen Moment des Innehaltens einerseits und eine Entscheidung über Leben oder Tod durch Expertise aus Erfahrung positiv gewendet andererseits.
Pflegefachperson zu sein, stolz nach außen zu tragen ist wichtig. Sie sind nicht „nur“ Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Altenpfleger. Sie haben lange und hart dafür gelernt. Sie tun etwas Großartiges. Etwas, das viele andere nicht tun können – nicht im Sinne von „ich könnte das nicht, weil das so schlimm oder eklig ist“, sondern im Sinne von „ich bin dafür nicht qualifiziert!“.
Seien Sie stolz auf Ihren Beruf! Seien Sie auch wütend auf die, die diesen Beruf derzeit oft so unerträglich machen! Aber kämpfen Sie für unseren Beruf! Und vergessen Sie nicht, wie viel Schönes es auch heute noch gibt! Und wenn beim aktuellen Arbeitgeber Ihre Kompetenz und Leistung nicht genug geschätzt werden? Dann wechseln Sie an einen Arbeitsort, wo das anders ist! Das ist das einzig Gute am Mangel – die, die da sind, sind besonders wertvoll!
Proud to be a Nurse! Wir haben allen Grund dazu!
Berlin, im Oktober 2019
Franz Wagner
Präsident Deutscher Pflegerat
Bundesgeschäftsführer DBfK
|17|Geleitwort von Sophie Ley
(Foto: Sophie Ley)
Zeigen Sie Berufsstolz!
„Haben Sie den Mut, die Person zu sein, die Sie sind und entwickeln Sie die Eigenschaften weiter, die Sie ausmachen. Seien Sie sich bewusst, dass Sie für die Gesellschaft eine fantastische Arbeit leisten.“ Rosette Poletti, eine der Pionierinnen und „grande dame“ der professionellen Krankenpflege in der französischsprachigen Schweiz, erkannte bereits früh, wie wichtig Berufsstolz und Autonomie für die Entwicklung des Pflegeberufs ist.
Trotz der aktuellen Erfahrungen in der Bewältigung der Corona-Pandemie, die eindrücklich und vielfach die gesellschaftliche Systemrelevanz der Pflege sichtbar macht, stehen längst nicht alle Pflegenden selbstbewusst genug hinter ihrem Beruf. Auch die Aussenwahrnehmung ist oft zwiespältig. Neben der Bewunderung, dass überhaupt jemand diese Arbeit macht, halten sich hartnäckig althergebrachte Vorurteile. Selbst in politischen Debatten tauchen immer wieder und gegen besseres Wissen Stereotype auf, wie „Pflegen kann jede/r“ oder das teils historisch-religiös begründete und einem weiblichen Rollenverständnis entspringende Klischee des „dienenden und helfenden Engels“. Besonders beliebt ist nach wie vor das abwertende Bild des „diplomierten Füdliputzers“, wie schweizerdeutsch die schambehaftete Arbeit rund um Ausscheidung, Toilettengang und Intimpflege oft genannt wird. Auch die anzügliche und frauenverachtende Darstellung der „sexy Nachtschwester“ ist analog und digital nach wie vor weit verbreitet.
Nicht nur aus diesen Gründen ist es 200 Jahre nach der Geburt von Florence Nightingale ein Gebot der Zeit, dass Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner selbstbewusster auftreten. An Fakten und Wissen über die Wirksamkeit der pflegerischen Arbeit fehlt es nicht. Studien und unzählige Fallgeschichten beweisen, dass gut ausgebildete Pflegefachpersonen mit Aufmerksamkeit, Fachwissen, Erfahrung und Zuwendung auch in komplexen Situationen eine sichere und wirksame Pflege der Patientinnen und Patienten mit ausgezeichneten Resultaten erzielen. Mit genügend qualifiziertem Pflegepersonal liessen sich weltweit Milliarden an Gesundheitskosten einsparen. Der 2020 von der Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlichte „State of the World’s Nursing Report“ betont zudem, dass Investitionen in die professionelle Pflege nicht nur zur Erreichung der gesundheitsbezogenen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) beitragen, sondern auch zu Verbesserungen in den Bereichen Bildung, Gender, Arbeit und Wirtschaftswachstum.
Entgegen all dieser Fakten wird jedoch in der Pflege weiterhin gespart, und die Rahmen- und Arbeitsbedingungen sind vielerorts unbefriedigend. Die Folge ist ein weltweiter Mangel |18|an Pflegefachpersonen. Auch in der Schweiz steigt heute fast jede zweite Pflegefachperson wieder aus dem Beruf aus. Deshalb müssen dringend mehr Pflegefachpersonen ausgebildet werden, die Pflegenden mehr Zeit für ihre Patienten haben, bessere Arbeitsbedingungen geschaffen und der Pflegeberuf aufgewertet werden – alles Forderungen der hängigen Volksinitiative „Für eine starke Pflege“, für die der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) in nur acht Monaten 120 000 Unterschriften gesammelt hat.
Das vorliegende Mutmacher-Buch zeigt die vielseitigen Facetten des Berufsstolzes auf: Selbstwertgefühl, Leidenschaft, Sinnhaftigkeit, Mut und Motivation, Identität und Individualität sowie die Bedeutung einer fundierten Aus- und Weiterbildung. Entscheidend ist, dass Pflegefachpersonen hinstehen und klar und deutlich sagen, was sie dank ihrem Wissen und ihren Kompetenzen bewirken. Erfahrene Pflegefachpersonen müssen ihre Vorbildrolle wahrnehmen und den jungen Kolleginnen und Kollegen den Wert ihrer Arbeit aufzeigen. Stehen Sie zusammen mit Ihrem Berufsverband dafür ein, dass bessere Arbeitsbedingungen, mit denen sich Beruf und Familie vereinbaren lassen, angemessene Löhne und verlässliche Dienstpläne nicht leere Worte bleiben.
Mit „I’m just a Nurse“ brachte die amerikanische Journalistin und Autorin Suzanne Gordon bereits vor 20 Jahren in ihrem gleichnamigen Manifest ironisierend die oft wenig selbstbewusste Haltung vieler Pflegender auf den Punkt, und fügte hinzu: „I just make the difference between life and death“. Zusammen mit Bernice Buresh rief sie im Buch „From Silence to Voice“ (deutsch herausgegeben unter dem Titel „Der Pflege eine Stimme geben“) schon damals die Pflegenden auf, sichtbarer, hörbarer und einflussreicher zu werden.
Diese Botschaft ist heute wichtiger denn je: Als Pflegefachpersonen müssen wir uns – auch auf politischer Ebene – aufdrängen. Wir müssen uns unseren Platz erkämpfen und dürfen nicht darauf warten, bis wir für Diskussionen und Entscheidungen an den Tisch eingeladen werden. „Die Aufgabe der Pflege muss darin bestehen, Menschen zu stärken, sie zu begleiten, sie anzuerkennen, sie zu fördern in ihren eigenen Kompetenzen und Ressourcen“, schreibt der Ethiker Giovanni Maio. Das gilt nicht nur Ihre Patientinnen und Patienten, sondern auch für Sie selbst. Nur wenn Sie daran glauben, dass Sie wichtig sind, bringen Sie die Kraft auf, hin- und einzustehen für die Interessen all jener, deren „Advokaten“ Sie sind. Lassen Sie sich Ihren Stolz und Berufsstolz nicht nehmen!
Sophie Ley,
Präsidentin des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK
|19|Einführung
Pflege kann sich sehen lassen! Die Vergütung nach Berufsabschlussprüfung und während der Ausbildung ist gar nicht schlecht. Kaum ein anderer Beruf stellt einen solchen Wachstumsmarkt dar und bietet zugleich eine so hohe Zukunftssicherheit. Die Arbeit erfolgt im Schichtdienst, wie auch bei vielen anderen angesehenen Berufen, z. B. in der Medizin, bei den Fluglotsen, Bühnenberufen, Energiewirtschaft, Feuerwehr oder in der Informatik. Im Gegensatz zu manchen Selbstständigen arbeiten viele beruflich Pflegende regulär nicht mehr als 39 Stunden in der Woche. Und mal anders gefragt: Welche Bankangestellte hat auf Wunsch z. B. jeden Donnerstag frei? Manche Pflegende sind zufrieden, dass sie um 6:00 Uhr starten und bereits ab 14:30 Uhr Feierabend haben, um beispielsweise im Sommer zum Chillen an den See zu gehen oder andere Tagesaktivitäten umzusetzen. Viele genießen auch das lange Ausschlafen im Spätdienst. Gerade die Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsarbeit zeigt den Wert und die Dringlichkeit der Aufgaben. Kaum einer der angesagten Trend-Berufe kann eine vergleichbar hohe Sinnkomponente aufweisen – kurzum: Der Pflegeberuf hat enorme positive Aspekte. Diese möchten wir sichtbar machen!
In Deutschland arbeiten 5,6 Millionen Angestellte im Gesundheitswesen. Diese stellen arbeitsmarktpolitisch und wirtschaftlich eine bedeutende Gruppe dar (Destatis, 2019). Die Pflegebranche wächst und wächst. Wir haben in Deutschland inzwischen doppelt so viele Mitarbeiter wie 2011. Rund 1,2 Millionen Ausgebildete sind heute beruflich in der Pflege tätig. Dazu kommen ca. 140 000 Auszubildende. So hat sich allein die Zahl der Pflegenden in ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen zwischen 1999 und 2015 um rund 77 Prozent erhöht. Der Trend wird sich fortsetzen, weil mit steigendem Alter der Bevölkerung die Zahl der Pflegebedürftigen zunimmt. Ganz anders bei den Berufen, die durch neue Technologien ersetzt werden können und die es in zwanzig Jahren vermutlich gar nicht mehr geben wird, wie etwa Bank-, Büro- und Versicherungskauffrauen, Steuerberater, Verkäufer oder Elektroniker. Wer dagegen jetzt eine Pflegeausbildung oder ein Pflegestudium absolviert, hat tolle Aussichten auf attraktive Stellen, eine große Auswahl an Weiterbildungen und Studienmöglichkeiten im Markt der Zukunft und die Wahl, sich die besten Arbeitgeber auszusuchen. Gleichwohl verlassen viele Kolleginnen und Kollegen den Beruf frühzeitig. Obgleich schon Zehntausende – nein, Hunderttausende staatlich geprüfte Pflegende in den letzten Jahrzehnten den Beruf verlassen haben, steuerten die Politiker aller regierenden Parteien bis vor kurzem nicht wirksam dagegen. Zur durchschnittlichen Verweildauer im Beruf liegen sehr unterschiedliche Zahlen vor. Wir gehen davon aus, dass es keine validen Daten gibt, weil derzeit bundesweit nicht systematisch erfasst wird, wie lange Berufsangehörige nach ihrem Examen tätig bleiben. Tatsache ist allerdings auch, dass viele Pflegende schon länger im Berufsleben stehen. Die Pflegekammer Rheinland-Pfalz stellte 2019 fest, dass 60 Prozent ihrer Mitglieder über 41 Jahre alt ist.
Überstunden, eine außerordentlich hohe Anzahl an Krankheitstagen im Vergleich mit anderen Berufen und eine geringe Wertschät|20|zung lassen den Berufsausstieg als einzigen Weg aus einem manchmal jahrelang quälenden Dilemma erscheinen. Die Arbeitsbedingungen sind vielerorts desolat und unzumutbar. Das darf nicht verschwiegen werden. Deshalb werden wir das Thema Arbeitsbedingungen diskutieren (Teil III). Internationale Literatur haben wir zum Teil (durch unsystematische Recherche) berücksichtigt – dabei fällt auf, dass unser Thema in vielen Ländern breit bearbeitet wird. Tausende Beiträge scheinen bei einer Schlagwortsuche in den Datenbanken auf. Allerdings sind die Überschriften unterschiedlich. Mal geht es um Selbstverständnis, dann um Kompetenzen oder um professionelle Identität. Oft sind kleine Gruppen untersucht, mit verschiedensten methodischen Ansätzen, vielfach auch in speziellen Pflegesettings. Einen Mainstream zum Thema Berufsstolz, mit einer gut fundierten Theoriebildung, scheint es nicht zu geben. Darum bieten wir Ihnen hilfreiche Tools, was und wie Sie Veränderungen bewirken können (Teil IV und V). Wir haben heute Möglichkeiten, diese unerträglichen Verhältnisse umzugestalten! Auch die Politik hat endlich erkannt, wie wichtig die pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist. Viele Maßnahmen wurden und werden ergriffen. Pflege ist in Aktion! Mit diesem Buch möchten wir Sie ermutigen, echten und gesunden Berufsstolz zu entwickeln, sich auf den Kern der Pflege auszurichten, Ihre Arbeitsbedingungen zu reflektieren, und wenn nötig, zu verändern und erfolgreich, gesund und zufrieden Ihren Beruf zu genießen. Ferner möchten wir die frühzeitig aus dem Beruf Ausgeschiedenen bestärken, Pflege wohlwollend zu überdenken, ihre Berufsmotivation zu reaktivieren und einen neuen Versuch in einer spannenden und sinnvollen Tätigkeit zu wagen. Berufsangehörigen aus den zukünftigen Out-Berufen, die heute mit Schrecken feststellen, dass ihre Qualifikation in Zukunft wegfällt oder die im alten Beruf unzufrieden sind, geben wir mit diesem Buch wertvolle Impulse – um ein erstes Pflegepraktikum gut vorbereitet anzugehen. Sollten Sie Freunde oder Verwandte haben, die ggf. ihren Beruf wechseln möchten, bedienen Sie sich bitte bei uns. Nur nicht nachdenkende Kolleginnen und Kollegen handeln gegen eigenes Interesse und schaden sich mit Negativaussagen selbst: Denn wer soll dann noch in die Pflege kommen?
Entscheidend ist, dass Sie selbst positiv über ihren Beruf sprechen.
Schauen Sie selbstbewusst auf sich und Ihre bedeutsame Tätigkeit. Achten und spüren Sie bei der Betrachtung so vieler Facetten der Pflege auf eine Haltung von Stolz. Pflegen Sie dieses Pflänzchen und lassen Sie es bei ausreichend Wasser und Sonne zu kräftigen Stauden heranwachsen, die niemals vertrocknen. Freuen Sie sich darauf, Ihren Patienten und Bewohnern ein sinnreiches „Feelgood-Management“ zu bieten. Lassen Sie uns in der Pflege veraltete Traditionen offen und kontrovers diskutieren und argumentieren Sie mit nachvollziehbaren Botschaften. Im Buch finden Sie unzählige Anregungen dazu. Machen Sie unseren Wert für die Gesellschaft sichtbar, so dass auch die Politik weiter verstärkt darauf reagieren und die Arbeitsbedingungen verbessern wird.
Grundvoraussetzung für eine positive Veränderung unseres Berufs ist eine gesamt-gesellschaftliche Wertediskussion. Positive Aufmerksamkeit erzielen und skandalöse Berichterstattung vermeiden ist ein sinnvoller Weg. So werden wir zeigen, was eine qualifizierte Pflege unter menschenwürdigen Bedingungen leisten kann. Unser Buch verfolgt das Ziel, Sie anzuspornen und proaktiv eine Akteurin oder ein Akteur unseres wundervollen und gewichtigen Berufes zu werden. Praktizieren Sie für sich selbst und für unsere Berufsgruppe Lobbyarbeit und entfalten Sie damit echte politische Kraft. Wir brauchen Interessenvertretungen und Öffentlichkeitsarbeit durch Kolleginnen und Kollegen am Bett. Wer, wenn nicht wir, die Pflegefachpersonen, sind die Botschafterinnen und Botschafter unserer eigenen Professionalität?!
|21|Wir haben uns in diesem Buch für eine leicht verständliche und manchmal auch saloppe Sprache entschieden, um möglichst alle in der Pflege Tätigen anzusprechen. Zu einigen Themen stellen wir bewusst „Schwarz-Weiß-Bilder“, um exemplarisch anhand der Gegensätze zu verdeutlichen. Die Realität ist oft weniger extrem positioniert. So gibt es erfreulicherweise nur selten „einseitig ausbeutende Arbeitgeber“ oder „vollständig inkompetente Führungskräfte“.
Zur leichteren Lesbarkeit verwenden wir wechselseitig die weibliche und männliche Bezeichnung für die in der Pflege Tätigen, wir meinen damit selbstverständlich alle Leserinnen und Leser. Sie werden mal von „der Pflegerin“ und dann wieder von „dem Pfleger“ lesen. Da 85 Prozent der Pflegenden weiblich sind, verwenden wir entsprechend häufiger die Bezeichnung „Pflegerin“. Unter beruflich Pflegenden verstehen wir ausgebildete Berufsangehörige unterschiedlicher Qualifikation.
Um für Sie als Lesende den Text anschaulich, verständlich und interessant zu gestalten, haben wir im Buch Strukturelemente eingefügt. Arbeitsporträts sind Berichte von Kolleginnen und Kollegen. Diese detaillierten und spannenden Ausführungen zeigen die erforderlichen Kompetenzen der Intensivpflege, Endoskopie, Kinderkrankenpflege, Neonatologie, Palliativversorgung, Beratung, Praxisanleitung, Psychiatrie und Langzeitpflege. Sie finden die Arbeitsprotraits auf folgenden Seiten:
Arbeitsporträt 1 Schichtablauf in einer Hausgemeinschaft S. 29
Arbeitsporträt 2 Praxisanleitung S. 93
Arbeitsporträt 3 Neonatologie S. 18
Arbeitsporträt 4 Palliative Pflege S. 110
Arbeitsporträt 5 Endoskopie S. 196
Arbeitsporträt 6 Intensivstation S. 229
Arbeitsporträt 7 Beratung/Krisenintervention S. 265
Arbeitsporträt 8 Psychiatrische Pflege S. 293
Einige Pflegende aus der Praxis haben wir in Steckbriefen zum Thema Berufsstolz befragt, auch ihre Aussagen möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.
Interessant sind auch die sechs Kurzbeschreibungen zu Tätigkeitsfeldern in der Pflege:
Kurzbeschreibung 1 Notaufnahme S. 107
Kurzbeschreibung 2 Onkologische Pflege S. 107
Kurzbeschreibung 3 Ambulante Pflege S. 115
Kurzbeschreibung 4 Heimbeatmung S. 116
Kurzbeschreibung 5 Privatpflege S. 117
Kurzbeschreibung 6 Tagespflege S. 216
Schließlich finden Sie fünf Statements von berufserfahrenen und namhaften „Prominenten“ aus der Pflege, Menschen, die seit langem auch berufspolitisch unterwegs sind (S. 55, 59, 136, 178, 253).
Wir möchten Ihnen mit diesem Buch nicht nur Mut machen – sondern werden Ihnen (leider) auch Arbeit machen; denn es ist ein Arbeitsbuch geworden. Wenn sich das Dilemma der Berufsbelastungen ändern soll – müssen wir alle echt was tun! Um bei erfolgreicher Umsetzung auch ein stolzes Gefühl zu entwickeln, haben wir 62 Aufgaben eingeflochten. Wir laden Sie ein, diese zu lösen und sich dadurch Ihrer beruflichen Angelegenheiten bewusster zu werden. Dabei geht es um Denkaufgaben, Recherchen oder Befragungen – die Aufgaben bieten auch Möglichkeiten, sich innerhalb einer Gruppe auszutauschen. Das können bei Lernenden die Mitschüler oder Kommilitonen sein und bei den ausgebildeten Pflegenden die eigenen Teammitglieder. Es existieren manche Arbeitsbücher mit Leerzeilen, in die Leser hineinschreiben können. Darauf haben wir bewusst verzichtet. Wir empfehlen Ihnen stattdessen ein separates Heft, Lernjournal oder Tagebuch anzulegen. Darin können Sie Ihre handschriftlichen (analogen) Ergebnisse (Handlettering) bzw. für die Smartphone-, Tablet- oder PC-Fans Ihre digitalen Resultate (Bullet Diarying) notieren. Damit Sie die Übersicht über Ihre Ausarbeitungen behalten und zuordnen können, wurde jede Aufgabe mit einer Nummer versehen.
Unser Buch soll Balsam für das Ego engagierter beruflich Pflegender sein. Es ist wichtig, |22|die Beschäftigung mit dem Stolz nicht auf die gedankliche Ebene zu reduzieren, sondern einen emotionalen Zugang zur Bedeutung des Berufs zu suchen. Insbesondere sollen die Multiplikatoren in den Teams, also die Praxisanleiterinnen, Führungskräfte und die Lehrenden angesprochen werden. Für Lehrende erstellten wir im Anhang eine Handreichung zusammen mit Strategien und Ideen, um das Buch im Unterricht einzubauen. Trotz vieler Storys und Geschichten, die emotional den Bauch erreichen sollen, darf natürlich auch nicht der Kopf vergessen werden. Darum werden in den ersten Kapiteln auch die begrifflichen Bedingungen des stolzen Gefühls aufgezeigt.
Wir Autoren schreiben dieses Buch zu zweit. Im Anhang erfahren Sie die Hintergrundgeschichte und Lebensläufe von uns. Im Text gibt es einige Kommentare von uns, gekennzeichnet mit unseren Namen. Diese Kommentare weisen darauf hin, dass der andere Autor eine andere Meinung hat oder nicht über die gleichen Erfahrungsschätze verfügt. Wir möchten Ihnen diese unterschiedlichen Sichtweisen gerne transparent machen. Vielleicht ist es für Sie auch spannend mitzubekommen, dass wir nicht immer einer Meinung sind? Aber wir beide sind Feuer und Flamme und möchten überzeugtere Haltungen in der Pflege anstossen, um Ihnen den Reichtum unseres Berufs (noch mehr) zu verdeutlichen. Gerade in den letzten Kapiteln bieten wir viele Ideen, Anregungen und Hinweise, damit sich Ihr Berufsstolz weiter entwickeln kann.
Eine „Landkarte zum Berufsstolz“ steht als Download zur Verfügung: https://www.hogrefe.ch/downloads/berufsstolz
|23|Teil I: Berufsstolz
Es gibt keine allgemein akzeptierte Beschreibung von Berufsstolz, schon gar nicht in der Pflege. Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die versuchen, dies etwas umfassender zu beschreiben. Deswegen blättern wir hier einige Aspekte auf, die zum Berufsstolz gehören könnten: Selbstwert und Sinnfindung, Wissen und Leidenschaft, Mut, berufliche Identität und anderes. Stolz wird oft negativ konnotiert: aber Pflege braucht Berufsstolz! In einer Online-Umfrage „Was beschäftigt Pflegekräfte?“ gaben 85 Prozent der befragten Pflegenden an, stolz zu sein auf ihren Beruf (Scharfenberg & Teglas, 2019). Wir sind weit davon entfernt, überheblich aufzutreten – ganz im Gegenteil: Pflegende im deutschsprachigen Raum fühlen sich eher als „Mädchen für alles“, sie treten bescheiden zurück. Die Kunst der Pflege ist fast verloren gegangen, seitdem Pflegende immer mehr auf Handgriffe reduziert werden. Deswegen möchten wir hier ein starkes Plädoyer für Selbstbewusstsein geben.
Während unter Wertschätzung die positive Bewertung einer Person durch andere, also durch Kollegen, Patienten oder der Gesellschaft verstanden wird, bezeichnet Stolz das Gefühl einer ausgeprägten Zufriedenheit mit sich selbst. Das Wort Stolz entstammt dem Mit|24|telhochdeutschen „stolt“ und bedeutet „prächtig“ oder „stattlich“. Stolz und Zufriedenheit erreichen Sie im Beruf nicht nur, wenn Sie etwas tun, was Ihnen Freude macht. Berufsfindungspraktikanten und neue Auszubildende wissen meist schon nach kurzer Zeit, ob Ihnen das Setting der Pflege zusagt und ob es „ihr Ding“ ist. Stolz sind sie deswegen noch lange nicht, denn die Sache mit dem Berufsstolz beinhaltet mehr. Wenn Pflegende die subjektive Gewissheit haben, über eine besondere Fähigkeit zu verfügen oder eine herausragende Leistung erbracht zu haben, sind sie in dem Moment auf ihre eigene Leistung, ihr Team, ihren Arbeitgeber und/oder ihren Beruf stolz (Ciesinger, Fischbach, Klatt & Neuendorff, 2011). Arbeitszufriedenheit entsteht, wenn die Arbeitssituation positiv beurteilt wird; Berufsstolz hingegen beurteilt die persönliche Leistung, in welcher Art und Qualität der eigene Beitrag zur Wertschöpfung des Prozesses gehört. Er steht in enger Beziehung zur Selbst- und Fremdwertschätzung. Somit beschreibt Berufsstolz eine Haltung, die auf einer kognitiven Überzeugung basiert und von Emotionen begleitet ist.
„Stolz sein“ wird oft gleichgesetzt mit „sich selbst loben“ oder sich selbst überhöhen, was allgemein eher verpönt ist. Hier geht es ganz und gar nicht um das „hohle“ Aufblähen des eigenen Egos, sondern um ein wachsendes Bewusstsein und das Wissen um die umfassende persönliche und professionelle Fachlichkeit und ihren Stand(-ort) bzw. Standing. Stolz tritt auf, weil man selbst ein für sich bedeutsames Handlungsziel durch Kompetenz und deren Kontrolle erreicht bzw. überwunden hat (Fuchs-Frohnhofer, Isfort, Wappenschmidt-Krommus, Duisberg, Neuhaus, Rottländer, Brauckmann, & Bessin, 2012, S. 17). Sobald Ihre berufliche Tätigkeit gemäß den verbindlichen Regeln Ihrer Kunst umgesetzt wird und der Motivation entspricht, reift und wächst das positive Gefühl von Berufsstolz. Stolz erleben Sie, wenn Sie etwas gut können und Ihre pflegerischen Kompetenzen selbständig einsetzen und den Outcome, also das Ergebnis Ihrer Pflege qualitativ verantworten. Dabei ist wichtig, dass Pflegende die Ergebnisse ihrer Arbeit sehen, sowohl in einzelnen täglichen Aktivitäten der Patienten/Bewohner – als auch in Verbesserung der gesamten Lebenssituation. Interessant ist beispielsweise eine rehabilitativ orientierte Kurzzeitpflege. Aus einem Schweizer Altenheim wurde berichtet, dass ein Großteil der eingezogenen Bewohner durch die professionelle Pflege innerhalb weniger Wochen wieder in ihre eigene Häuslichkeit rückgeführt werden konnten. Dies machte die Pflegenden sehr selbstbewusst.
In vielen Branchen herrscht ein Mangel an Fachkräften, so z. B. im Handwerk, bei IT-Fachkräften, Bademeistern, Lehrerinnen oder Lokführern. Wenn es hier zum Stillstand oder Stau kommt, können bereits mehr als leichte Unannehmlichkeiten vorliegen. Wenn aber in Klinik oder Heim Pflege nicht stattfindet, kann es für die Patienten und Bewohner tödlich enden. Denn dann ist niemand da, der die Vitalzeichen kontrolliert und rechtzeitig eingreift; niemand, der auf die existenziellen Ängste und Krisen adäquat reagiert; niemand, der Patienten mit Trinken oder Essen versorgt. Im Extremfall kostet es Leben.
Pflegearbeit ist eine unaufschiebbare Reaktion auf direkte menschliche Bedürfnisse. Eine Beziehung inmitten der vielen Einflussbedingungen herzustellen ist jeweils eine einmalige „Schöpfung“, deswegen spricht man von „Pflegekunst“. Diese Leistung sollte sichtbar sein bzw. gemacht werden und nicht nur dann auffallen, wenn sie nicht erbracht wird. Wenn Ihr Beruf zudem noch gesellschaftlich gewürdigt wird, lässt Sie das wahrscheinlich mit „stolzer Brust erfüllen“. Und wenn Sie feststellen, dass Ihre Dienstleistung durch Ihre persönliche und fachliche Art, Qualität und Individualität nicht so einfach von einer anderen ausgeführt werden kann, ja, dann fühlen Sie Berufsstolz.
|25|1 Pflegekunst
Pflege ist Kunst, weil sie auf das Wissen über die Fachpflege, die kreative Übung im Tun, die Wahrnehmung des Gegenübers und der Vorstellung von guter Pflege gegründet ist. Den Satz „Nursing is science and art“ schrieb bereits 1859 Florence Nightingale nieder. Pflege ist ein Nähe-Beruf mit allen Chancen tiefer persönlicher Erfüllung (Maio, 2016). Durch das neue Pflegeberufegesetz (PflBG) erhält die Pflege endlich einen berufsrechtlich geschützten autonomen Status. Wer unabhängig handelt, ohne Fremdbestimmung eines anderen tätig wird, verfügt über Souveränität. Dafür definierte der Gesetzgeber für ausgebildete Pflegende die Vorbehaltsaufgaben, die ab sofort keine andere Berufsgruppe mehr durchführen darf oder anordnen kann. Das vielfältige Pflegewissen, die aktuellen Erkenntnisse der Pflegeforschung usw. geben Handlungsanleitungen vor. Zur Kunst wird Pflege, wenn die Gestaltung und das Aushandeln der Differenz zwischen dem Standard und den Bedürfnissen des individuellen Patienten erfolgreich sind. Über eine besonders gut gelungene Arbeit wird im Allgemeinen Stolz empfunden (Nydahl, Hermes, Hähnel, 2015). Wird der Pflegeprozess, also die schrittweise Methode die Pflege zu planen, als erfolgreich bewertet, kann sich Arbeitszufriedenheit einstellen. Wenn der Prozess besonders gut gelungen ist, auch Arbeitsstolz. Pflegende gestalten, um z. B. Pflegebedürftigkeit gezielt zu verbessern. Und das gelingt uns besonders im eigenverantwortlichen Bereich der oben erwähnten Vorbehaltsaufgaben. Dazu zählen die Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeverlaufs sowie die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege. Gerade die „Evaluation“ ist der am wenigsten umgesetzte Schritt des Pflegeprozesses. Dabei hätten wir Pflegenden damit viel mehr unsere Leistungen verdeutlichen können (Zegelin, 2015). Diese vorbehaltenden Tätigkeiten obliegen seit 2020 eindeutig nur uns Pflegefachfrauen und –männern und werden zukünftig in der Praxis sicherlich noch zu diversen Klärungsprozessen mit den ärztlichen Kollegen führen (Weidner, 2019). Denn nun bestimmt beispielsweise ausschließlich eine Pflegefachfrau, was zum individuellen Pflegebedarf des Bewohners gehört und nur sie entscheidet mit der Betroffenen und ihren Angehörigen z. B. über geeignete Dekubitus- oder Sturzprophylaxemaßnahmen. Der Gesetzgeber liefert hier den Rahmen und schränkt damit erstmals die ärztliche Berufsausübungsfreiheit begründet ein. Der Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe (BLGS) stellt sich die Frage, ob aufgrund der Absenkung des Niveaus der Altenpflegeausbildung gegenüber der Generalistik und der Kinderkrankenpflege zukünftige Altenpflegende überhaupt berechtigt sind, die vorbehaltenen Tätigkeiten zu übernehmen (BLGS, 2019). Pflege braucht enorme Fachkompetenz, denn sie muss priorisieren: Zu welchem der klingelnden oder sich gar nicht meldenden Patienten geht sie zuerst? Zu welchem Patienten schickt die Pflegerin den Arzt als nächstes? Dabei muss sie alle Patienten im Blick behalten mitsamt all ihren (zum Teil) existenziellen Bedürfnissen. Damit lässt sich Pflege nicht eindeutig nur auf Funktionen und Tätigkeiten festlegen. Leider hat die Formulie|26|rung „Verrichtungen“ im SGB XI bis heute einen unübersehbaren Schaden hinterlassen und Pflege völlig reduziert.
Pflege hat die Gestaltung des Alltags umfassend im Blick und erfordert vielfältige und sensible Umgangsformen und nicht nur ein fundiertes Hintergrundwissen, nicht zuletzt in psychologischer Hinsicht und ganz individuell über den ihr anvertrauten Patienten. Wer daran zweifelt, erinnere sich einmal an seinen letzten Arzt- oder Krankenhausaufenthalt: Was ist Ihnen besser in Erinnerung: Wie die Pflegefachperson die Spritze setzte oder wie (un-, freundlich, persönlich, ablenkend usw.) Sie von ihr dabei angesprochen wurden? Pflege ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses und hat nicht nur die Heilung im Fokus, sondern vielmehr die Qualität des gesamten Pflegeverlaufs. Im Englischen heisst es „Professional Pride“ oder „Professional Ambition“ – also auf ein bestimmtes Ziel gerichtetes berufliches Streben.
|27|2 Berufsstolz und Pflegestolz
Nurse Pride (englisch Pflegestolz) beschreibt den selbstachtenden und stolzen Umgang der Pflegenden mit ihrer eigenen Berufsidentität. Diese Kolleginnen arbeiten und sind dabei stolz, das erlebte Selbstgefühl ihres eigenen Wertes nach außen zu repräsentieren. Kurzum: sich so authentisch zu geben, wie sie sind. In den angloamerikanischen und skandinavischen Ländern tragen Pflegende T-Shirts mit wertschätzendem Aufdruck zu ihrer beruflichen Tätigkeit. Uns ist es aber auch genauso wichtig, hier den Pflegestolz der pflegenden An- und Zugehörigen zu benennen. Denn diese erleben bei erfolgreicher Interaktion mit ihren Nächsten auch eine Einstellung von Pflegestolz. Typische Zitate einer Ehefrau lauten: „Obwohl ich ja nie Pflege gelernt habe, bin ich stolz darauf, meinen gelähmten bettlägerigen Mann jetzt schon zwei Jahre zuhause ohne Druckgeschwür gut gepflegt zu haben“.
Die Haltung des Berufsstolzes entwickeln Berufsangehörige, während Pflegestolz von allen (auch ungelernten) Pflegenden entwickelt werden kann (Tab. 2-1).
Tabelle 2-1: Berufsstolz und Pflegestolz (Eigendarstellung)
Berufsstolz
Pflegestolz
Woraus resultiert die Einstellung?
Wissen durch professionelle Ausbildung und Sicherheit
Verantwortung
Zielgruppe
Berufsangehörige
Berufsangehörige und pflegende Angehörige
Bezug auf
Berufsausübung
Pflegetätigkeit
Dies bedeutet, sich im Gesundheitswesen vor anderen Berufen nicht verstecken zu müssen, sondern sich für die eigenen Fähigkeiten und Rechte einzusetzen und Pflichten verantwortungsvoll auszuüben. Berufsstolz umfasst das Gefühl starker Selbstachtung, verbunden mit der öffentlichen Anerkennung der Pflegetätigkeit. Besonders stolz sind Berufsangehörige, wenn die Bevölkerung mit Achtung auf ihren Beruf oder auf die Einrichtung, in der sie arbeiten, blickt. Stolz lässt sich nicht anerziehen, sondern setzt Wissen und Bildung voraus: Wenn Pflegende erkennen, dass sie etwas Besonderes oder Anerkennenswertes geleistet haben, erleben sie Gefühle von Zufriedenheit mit sich selbst. Dazu benötigen sie Fachwissen, um die Tragweite ihres Handelns bzw. Nicht-Handelns zu erkennen. Als Maßstab gilt die eigene und/oder gesellschaftliche Wertehierarchie. Nur wer selbstreflexiv ist, d. h. im Rückblick sein Berufsengagement der letzten Minuten oder des Tages betrachtet, kann einen solchen Stolz erleben. Damit fördern Sie positive Gedanken über sich selbst. Stolz entsteht auch, wenn Sie persönlich zu einer zukunftsträchtigen Sache beigetragen haben. Wenn Sie wissen, was Sie tun und warum Sie es tun, entwickeln Sie Stolz. So ist die Zunahme von Berufsstolz v. a. ein „Bewusstseinsprozess“. Wenn wir uns unserer Pflege-Fach|28|lichkeit und Expertise bewusst sind, können auch die positiven emotionalen Komponenten des Berufs- und Pflegestolzes spürbar werden.
Stolz ist sichtbar: In allen Kulturen signalisiert Stolz, etwa aufgrund einer gesellschaftlichen Position, durch gleichartige Gesten und Gebärden – wie aufrechte Körperhaltung, zurückgelegter Kopf, Arme mehr oder weniger ausgebreitet oder vom Körper gestreckt, den bedeutenden öffentlichen Status. Durch gefühlten Stolz lassen sich auch wirksamer berechtigte Arbeitsbedingungen gegenüber den Vorgesetzen einfordern. Im Buchteil V zeigen wir unter anderem, wie Sie durch Umsetzung neuer Einsichten und Tipps in Körpersprache und Embodiment nicht nur ihr Unterbewusstsein „übertreffen“, sondern auch Ihr Auftreten stolzer werden lassen.
Gefühle wie Stolz oder Ärger haben gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden. Überwiegt der Stolz den Ärger, reduzieren sich Stress, Erschöpfung und Überforderung. Eine stolze Mitarbeiterin verliert nicht die Kontrolle oder die Gewissenhaftigkeit bei ihrer Arbeit, sie erlebt Selbstwirksamkeitund Gefühle von Zufriedenheit, Freude und Kompetenz. Selbstwirksamkeit gilt als wichtiger Grundpfeiler unserer psychischen Gesundheit.
2.1 Scham und Berufswahl
Ein gegenteiliges Gefühl von Stolz kann Schamsein. Betroffene Kolleginnen schämen sich dann bei ihrer Berufsausübung und fühlen sich unwert. Schamgefühle isolieren uns von anderen, wir fühlen uns schwach, inkompetent und klein. Manchmal werden solche Kolleginnen auch als „bescheidene Leisetreter“ bezeichnet. Auch ist Stolz etwas anderes als Eitelkeit. Darunter versteht man die übertriebene Sorge um die eigene körperliche Schönheit, seine intellektuelle Größe oder seinen eigenen Charakter. Überzogener Stolz kann zu Leichtsinnigkeit, Leistungseinbußen im Team oder zur Isolation des Betroffenen bei seinen Kollegen führen. Falscher Stolz kann blind für eigene Fehler machen und zu Hochmut führen. Keinesfalls geht es uns hier um Selbstsucht und Narzissmus. Albert Einstein empfahl, weniger stolz auf die eigenen Leistungen zu sein – damit man mehr Leistungen erbringt, auf die man stolz ist (Schmidt-Salomon, 2019). Der Soziologe Richard Sennet schreibt, dass der Stolz auf die eigene Arbeit den Kern handwerklichen Könnens und Tuns bildet. Reiner Stolz gelte wie im Christentum auch im Judentum als Sünde, „weil man sich darin an die Stelle Gottes setzt, doch der Stolz auf die eigene Arbeit dürfte nicht unter dieses Verdikt fallen, denn das Werk besitzt eine unabhängige Existenz.“ (Sennet, 2008, S. 390). Wir favorisieren den gesunden Berufsstolzund gehen im Verlauf des Buches mehrfach darauf ein. Scham und Stolz sind stark mit Selbstwertregulationund der Interaktion mit der Umwelt verbunden. Gefühle des Stolzes können kommunikativ sein, denn sie verbinden uns mit anderen Menschen. Wir fühlen uns zugehörig als ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft. Das erspürte stolze Gefühl ist vielleicht eine im wahrsten Sinne des Wortes „Reaktion“ (wir reagieren auf etwas). Gemeint ist die Reaktion auf die aus Teilen der Gesellschaft oder anderen Berufsgruppen kommende absurde Meinung, die Tätigkeit als Pflegefachfrau sei etwas Minderwertiges, für das man sich zu rechtfertigen und schlimmstenfalls zu schämen habe. Eine solche Sichtweise bremst die eigene Motivation. Menschen schämen sich, wenn sie sich hilflos fühlen. Unser Leitbild ist der selbstbestimmte, machtvolle und produktive Mensch. Kranke möchten ihre Abhängigkeit vergessen machen. All dies färbt auch auf die Pflegenden ab. Dabei könnte diese Zuständigkeit positiv und diskret besser genutzt werden.
Menschen in der Entscheidungsphase, welche Ausbildung oder welches Studium sie anstreben, werden bei der Wahl zu Pflegeberufen mit vielerlei Vorurteilen konfrontiert. Dann gelten sie als (Sammlung von Vorurteilen, G. Quernheim): „Uncool, weil du Urinkellnerin bist, |29|musst anderen nur den Hintern abwischen, darfst täglich Erbrochenes wegputzen, hast immer intensiven Kontakt mit Blut, Eiter, Sputum und Körpersekreten, beim Waschen oder Untersuchungen arbeitest du mit Nackten, die todkrank sind oder sich bereits im Sterbeprozess befinden, bist Leibeigene von Ärzten und Verwaltung und ein Beruf für Männer ist Pflege schon gar nicht.“ Dazu kommt noch die Vorstellung: Irgendwie helfen die Pflegenden den Ärzten. Das Bremer Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) hat das Image der Pflegeberufe bei Jugendlichen untersucht und festgestellt, dass Pflege zu den Out-Berufen zählt (IPP, 2010). Manche Eltern raten ihren Kindern von dieser Berufswahl ab. Allerdings gibt es zahlreiche Hinweise, dass Kinder, deren Eltern in der Pflege tätig sind oder waren, bewusst den Beruf wählen, weil sie z. B. auf interessante Pflegeerzählungen aus Heim oder Klinik zurückgreifen und selbst nun auch eine extrem spannende Tätigkeit hautnah erleben wollen. Für die Berufswahl sind die eigenen Eltern entscheidender als die Berufsberatung oder die Noten in einem Schulfach (Bomball, Schwanke, Stöver, Schmitt & Görres, 2010, S. 28). Neben ihrer Vorbildfunktion geben Eltern ihrem Nachwuchs zum Teil ungefragt erste Hinweise, was im Beruf wichtig ist. Dieser Einfluss wurde 2016 wissenschaftlich in einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung festgestellt (https://www.iab.de/de/forschung-und-beratung/bereiche.aspx. Zugriff am 09.09.2019). Je höher das gesellschaftliche Ansehen des Berufs der Mutter ist, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch die Tochter in diese Richtung orientiert (Hampel, 2019).
Aufgabe 1
Was haben Ihre Eltern/Schulkameraden zu Ihrer Berufswahl gesagt?
In den nachfolgenden Kapiteln widerlegen wir jedes einzelne der obigen Vorurteile zu Pflegetätigkeiten. Sicherlich haben alle Berufe auch weniger angenehme Seiten. Wer systematisch in Theorie und Praxis qualifiziert wird, hat andere Wahrnehmungen: In der Ausbildung wird beispielsweise vermittelt, wie man ohne große Belastung z. B. Exkremente professionell entfernt. Einige Berufsangehörige bestätigen, dass sie vorher nie dachten, so etwas durchführen zu können, aber wer eine gute Anleitung erfährt, entwickelt professionelle und belastungsarme bis -freie Strategien. Spätestens nach dem ersten eigenen Kind geht es bei fremden Menschen noch einfacher. Jeder Einzelne von uns hat diese Pflegemaßnahmen als Säugling und Kind erlebt und wird später (hoffentlich) alt. Und wer soll sich dann fachkompetent um uns kümmern, wer kontrolliert, ob es uns nicht nur körperlich gut geht und wir nicht mit Kreislaufproblemen, sondern mit Ängsten oder unerfüllten Pflegebedürfnissen in eine Schieflage geraten? Zum Gesamtbild Pflege gehören die direktesten, lebensnotwendigsten Dienstleistungen am Menschen, die es gibt. Solche Dienstleistungen erfordern einen stabilen und integren Charakter. Das kann nicht jeder!
Die bekannte österreichische Pflegeautorin Sonja Schiff (2015) hat uns ein lebhaftes Arbeitsporträt aus einer Pflege-Hausgemeinschaft geschrieben. Wir möchten an dieser Stelle sehr gerne auf ihr inspirierendes und emotionales Buch hinweisen: „10 Dinge, die ich von alten Menschen über das Leben lernte“. Es zeigt in eindrucksvoller Weise, wie vielfältig Pflegeberufe sein können.
Arbeitsporträt 1: Schichtablauf in einer Hausgemeinschaft
Mein Name ist Anna Moser. Ich bin 52 Jahre alt und arbeite seit mittlerweile 24 Jahren im Pflegeheim einer mittelgroßen Stadt in Österreich. Nach meiner Diplomierung zur psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegerin im Jahr 1985 und einer Fachweiterbildung zur Anästhesieschwester habe ich rund zehn Jahre lang im OP-Bereich einer Neurochirurgie gearbeitet. Eigentlich war ich mit meiner |30|Arbeit recht zufrieden, doch dann musste meine Großmutter überraschend ins Seniorenheim einziehen und ich kam das erste Mal mit dem Fachbereich Altenpflege in Kontakt.
Rückblickend kann ich gar nicht richtig erklären, was damals mit mir passiert ist. Ich fand in diesem Pflegeheim einfach die Menschen und ihre Lebensgeschichten so spannend. Rechts neben dem Zimmer meiner Oma lebte eine 100-jährige ehemalige Opernsängerin und links von ihr der 95-jährige Bezwinger eines Siebentausenders. Ich war fasziniert. Bis zu diesem Zeitpunkt hielt ich die Pflege älterer Menschen für fachlich uninteressant. Mit dem Einblick, den ich durch meine pflegebedürftige Großmutter erlangte, änderte sich aber mein Blick auf dieses Fachgebiet. Ich sah die spannende Beziehungsarbeit, die in der Altenpflege geleistet wird, die interessanten Menschen, auf die man traf. Plötzlich fehlte mir diese Ebene in meiner Arbeit. Sie ist in der Anästhesiepflege einfach nur eingeschränkt möglich, nur punktuell, vor oder nach der Operation. Also absolvierte ich neben meiner Arbeit eine Fachweiterbildung in geriatrischer Pflege und besuchte einige Fortbildungen zum Thema Pflege bei Demenz. Dann bewarb ich mich in diesem gemeindeeigenen Pflegeheim, wurde genommen und nach so langer Berufstätigkeit komme ich immer noch gerne hierher in den Dienst.
Vor Jahren war unser Seniorenheim ein ganz normales Pflegeheim und es war manchmal wirklich schwierig, für die Menschen ein wohnliches Umfeld zu schaffen, welches ihnen Geborgenheit vermittelt. Aber vor einiger Zeit wurde der Umbau des Heimes geplant und unser Gemeinderat entschied sich dafür, ein neues Konzept zu wagen. Seit sieben Jahren besteht unser Seniorenheim nun aus sechs Hausgemeinschaften à 14 Bewohnerinnen und Bewohnern. Ich selbst arbeite in der Hausgemeinschaft „Salzkammergut“ im Erdgeschoss, die einzige Hausgemeinschaft mit eigenem Garten.
Im Mittelpunkt jeder Hausgemeinschaft steht eine große Wohnküche und das gemeinschaftliche Leben der Bewohner. Dieses Gemeinschaftsleben wird vor allem von den Alltagsmanagerinnen gestaltet. Sie organisieren für die Menschen den Tag, so kochen sie etwa zusammen mit den Bewohnern, sorgen für einen gut funktionierenden Haushalt und kümmern sich um Freizeitgestaltung. Das oberste Prinzip bei uns heißt Normalität, wir bemühen uns darum, den Bewohnerinnen trotz Pflegebedürftigkeit ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen. Nicht wir als Pflegepersonen und die Pflegearbeit stehen im Mittelpunkt, sondern die Bewohner mit ihren Wünschen ans Leben. Ich als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sehe mich dabei zuständig für ein gutes Ankommen im Heim und eine professionelle und menschliche Begleitung in den verbleibenden Lebensjahren. Die körperliche Pflege betrachte ich dabei vor allem als unterstützende Dienstleisterin, als eine Art Service, damit die Menschen hier im Heim gut leben können.
Heute Morgen bin ich zuständig dafür, dass die 91-jährige Maria Steger einen positiven Start in den Tag erlebt. Angekommen an ihrer Zimmertüre halte ich kurz inne und sammle mich. Mir ist es wichtig, in meiner Arbeit präsent zu sein, daher atme ich kurz durch und klopfe an. Ein helles „Herein, ich warte schon auf Sie!“ schallt mir entgegen, und ich betrete das Zimmer. Frau Steger ist vor einem Jahr bei einem nächtlichen Toilettengang schwer gestürzt und hat sich dabei eine Schenkelhalsfraktur zugezogen. Sie ist eigentlich wieder voll mobil, könnte alleine aufstehen, aber ihre Unsicherheit ist seit dem Sturz zu groß. Also liegt sie, wie immer, wartend im Bett und blinzelt mir fröhlich entgegen. Ihre Lebensfreude begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Schon seit sie eine junge Erwachsene war, leidet Maria Steger an einer chronischen Polyarthritis. Schmerzen begleiteten sie ihr gesamtes Leben. Und auch jetzt bei uns in der Hausgemeinschaft konnten ihre Schmerzen, trotz guter Schmerzmittelversorgung mit einem transdermalen Schmerzpflaster, nie ganz unter Kontrolle gebracht werden. Aber Frau |31|Steger trotzt mit eisernem Willen und Lebensfreude diesen Schmerzen.
Ich trete an ihr Bett, frage, wie sie geschlafen hat und ob sie Lust darauf hat zu duschen, was sie bejaht. Nachdem ich im Badezimmer für die Morgentoilette alles vorbereitet habe, stehe ich der Bewohnerin beim Aufstehen anleitend und mental stärkend zur Seite. Die ersten Schritte am Rollator sind unsicher, aber dann marschiert sie zielstrebig Richtung Bad.
Bevor Frau Steger am Duschhocker Platz nimmt, entferne ich das Schmerzpflaster vom rechten Oberarm, lege Duschgel und Handtuch bereit, schalte die Dusche ein und lasse die Bewohnerin kurz alleine, damit sie ihre morgendliche Dusche auch genießen kann.
Danach helfe ich ihr beim Abtrocknen, bringe das neue Schmerzpflaster nach Absprache am Oberschenkel an, creme ihr Rücken und Beine mit einer Lotion ein. Sie selbst kümmert sich um ihr Gesicht sowie Bauch und Brust. Abschließend versorge ich sie mit Inkontinenzmaterial und unterstütze sie beim Anziehen der Unterwäsche und Strumpfhose. Danach schnappt sich Frau Steger ihren Rollator und deutlich sicherer schreitet sie zu ihrem Kleiderschrank. Jetzt beginnt der für sie wichtigste Teil des Morgenrituals. Sorgsam wählt sie ihre heutige Garderobe aus, einen hellgrauen Glockenrock, eine rosafarbene Bluse mit großer Schleife und eine magentafarbene Strickjacke. Komplettiert wird das Outfit mit einer Perlenkette, Perlenohrringen und einem zarten Perlenring.
Als Maria Steger bei uns ins Heim eingezogen ist, habe ich mit ihr umfassende biografische Gespräche geführt. Dabei hat sie immer wieder davon erzählt, dass sie als letztes von zwölf Kindern geboren wurde und nie neue Kleidung erhalten hatte. Immer hätte sie die Kleider der anderen Geschwister auftragen müssen, nicht selten auch die der Buben. Frau Steger erzählte mir unter Tränen, wie sehr sie sich als Kind geschämt hatte und wie oft sie ausgelacht oder gehänselt wurde für die alte und oft unpassende Kleidung. Auch ihr Ehemann, mit dem sie über 60 Jahre verheiratet war, gönnte ihr nur ab und zu Kleidung. Er war, wie Frau Steger meinte, krankhaft eifersüchtig und hatte es am liebsten, wenn sie „in Sack und Asche“ herumlief. Erst seit er verstorben ist, kann Maria Steger in Sachen Schönheit tun und lassen, was sie will.
Im Pflegeteam haben wir daher beschlossen, dass sich Frau Steger jeden Tag wie eine Prinzessin fühlen darf. Wir ermuntern sie, sich gut zu kleiden und auch zwischendurch mal neue Kleidung zu leisten. Etwa viermal im Jahr geht sie jetzt mit einer ehrenamtlichen Helferin zum Shoppen und ihr strahlendes Gesicht bei der Rückkehr spricht Bände.
Stück für Stück zieht sich Frau Steger ihre Kleidung selbst an, ich bin vor allem anleitend, und nur wenn unbedingt notwendig, unterstützend tätig. Für Frau Steger ist Selbständigkeit wichtig. Der Grat zwischen Bevormundung und Hilfestellung ist bei ihr sehr schmal. Fingerspitzengefühl und eine gute Wahrnehmung ihrer Körpersprache sind in ihrer Betreuung wesentlich.
Anders bei unserem nächsten Ritual: Haare und Makeup! Hier möchte sie verwöhnt werden. Maria Steger nimmt Platz vor ihrem Kosmetiktisch. In den Zimmern der meisten Bewohnerinnen stehen Kommoden mit vielen Bildern von Kindern und Enkelkindern. Nicht so bei Frau Steger. Im Zentrum ihres Zimmers stehen der Kleiderschrank und der Schminktisch. Alles, was sie nie hatte im Leben, ist jetzt wichtig.
Ich lege ihr ein Handtuch über die Schultern und dann geht es los. Das dünne Haar wird durchgekämmt, dann toupiert und mit einer großen Portion Haarspray fixiert. Die Wimpern werden getuscht, Augenbrauen nachgezogen, ein Hauch Rouge kommt auf die Wangen, rosafarbener Lippenstift rundet das perfekte Makeup ab. Während des Schminkrituals läuft Musik von Zarah Leander, die wir beide sehr mögen. Wir hören „Nur nicht aus Liebe weinen“ und trällern gemeinsam „Kann denn Liebe Sünde sein“. So fängt der Tag gut an! Für Frau Steger, aber auch für mich. Ich mag unser Morgenritual.
|32|Danach gehe ich zum Ausgang des Zimmers. Frau Steger wirft noch einmal einen Blick in den Spiegel und ich bestärke sie mit einem „Sie sehen heute richtig toll aus!“ Als sie mit dem Rollator die Türe erreicht, frage ich „Bereit für den Tag?“ Frau Steger drückt ihren Rücken durch, richtet sich merklich auf und meint zwinkernd: „Bereit.“ Dann öffne ich und sie schreitet wie eine in die Jahre gekommene Prinzessin durch die Türe und marschiert in Richtung Wohnküche, wo sie von der Alltagsmanagerin und anderen Bewohnern begrüßt wird.
Am Weg zum nächsten Bewohner begegnet mir Kollegin Sabine S., eine Pflegeassistentin. Sie hat bereits Frau Anna Huber bei der Morgentoilette unterstützt. Die Bewohnerin ist insulinpflichtige Diabetikerin. Eigentlich könnte Sabine die ärztlich verordnete Dosis Insulin als Pflegeassistentin selbst spritzen. Aber heute ist für Frau Huber ein besonderer Tag. Sie hat Namenstag und will zum Frühstück unbedingt ein großes Stück von der Schokoladentorte essen, die eine Freundin am Vortag gebracht hat. Deshalb ersucht mich die Kollegin zu übernehmen, die anstehende Entscheidung muss eine diplomierte Pflegefachperson treffen.
Die Zimmertüre von Frau Huber steht offen, ich klopfe trotzdem kurz an und frage, ob ich eintreten darf. Sie begrüßt mich mit den Worten „Ich bin zu alt, um mir an meinem Namenstag keinen Luxus leisten zu dürfen!“ und erklärt mir damit, warum sie heute einmal kräftig über die Stränge schlagen möchte. „Das ist Sachertorte! Eine echte Sachertorte!“ argumentiert sie mit einem Lachen und dann erzählt sie mir von jenem Tag nach dem Krieg, an dem sie das erste Mal ein solches Stück Torte gegessen hat und schließt ab mit dem Satz „Das war ein wirklich großer Moment damals, richtig feierlich! Kann sich heute niemand mehr vorstellen.“
Also kontrolliere ich den Blutzucker, injiziere eine höhere Dosis Insulin und trage dies in die Pflegedokumentation ein. Danach frage ich: „Mit oder ohne Schlagobers (Schlagsahne)?“ und Anna Huber ruft: „Selbstverständlich mit Schlagobers! Sachertorte immer nur mit viel Schlagobers.“ Lachend wünsche ich Anna Huber heute viel Genuss und setze meinen Weg fort.
Als nächstes habe ich die Aufgabe, dem 75-jährigen Josef Schweiger in den Tag zu helfen. Bei diesem Bewohner bin ich als psychiatrische Pflegefachperson die Bezugspflegerin. Herr Schweiger wurde mir bei seinem Einzug zugeteilt, weil er eine psychiatrische Vergangenheit hat. Er ist schon seit vielen Jahren alkoholkrank und hat ein ausgeprägtes Messie-Syndrom. Bis vor zwei Jahren hat er selbständig zu Hause gelebt. Immer wieder beklagten sich Nachbarn über Geruchsbelästigung oder stolperten morgens am Weg zur Arbeit über den im Gang liegenden betrunkenen Mann. Als Herr Schweiger dann einen Schlaganfall hatte, wurde er nach dem Krankenhausaufenthalt und kurzer Rehabilitation direkt zu uns transferiert. Seine Wohnung im Sozialbau wurde geräumt, es musste sogar der Kammerjäger anrücken, weil in der Wohnung Ungeziefer gefunden wurde. Nur wenige sehr persönliche Gegenstände sind Herrn Schweiger aus dieser Zeit geblieben.
Josef Schweiger hat nicht nur der Schlaganfall, sondern auch der Verlust seiner Wohnung noch mehr aus der Bahn geworfen. Obwohl vom Schlaganfall nur eine leichte Schwäche seiner linken Körperseite blieb und er voll mobil war, hat er ein ganzes Jahr sein Zimmer, manchmal auch tagelang sein Bett, nicht verlassen und mit niemandem geredet. Deshalb haben wir damals in der Pflegeplanung festgelegt, dass Herr Schweiger, wann immer möglich, nur von mir und einer weiteren „psychiatrischen“ Pflegekollegin betreut wird. Es ging darum, sein Vertrauen zu erlangen und Kontakt aufzubauen.
Dann war er eines Tages verschwunden. Nach Stunden kam er mit dem Taxi angefahren. Stockbetrunken. Als die diensthabende Pflegekollegin ihm aus dem Taxi half und ins Zimmer begleitete, lallte er nur: „Ich bin kein Gefangener. Ich darf auch hier tun und lassen, was ich will.“
|33|Von diesem Tag an ging es bergauf mit Josef Schweiger. Der Bann war gebrochen. Als ich am Morgen nach seinem Verschwinden sein Zimmer betrat, sah er mich skeptisch an und meinte: „Sie sind aber ein hartnäckiges Luder. So einen wie mich meidet man doch!“ Ich war sehr gerührt in diesem Moment von diesem ersten wirklichen Kontaktaufbau von seiner Seite. „Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue, endlich Ihre Stimme zu hören“, antwortete ich und fügte hinzu: „Ich glaube, wir sind beide sehr hartnäckig.“ Danach besprachen wir seine Vorstellungen von seinem Leben bei uns im Heim. Er wollte trinken dürfen, sammeln dürfen, alleine sein dürfen. Sein Hauptargument: „Mich ändert keiner mehr auf meine alten Tage!“ Ich erklärte ihm, dass er das dürfe, aber Kompromisse eingehen müsste, weil er hier bei uns eben in einer Gemeinschaft leben würde.
Ein paar Tage später brachte ich meine Gespräche mit Herrn Schweiger in die interdisziplinäre Fallbesprechung ein. Aus meiner Sicht sollte Herr Schweiger offen trinken dürfen. Ich wollte das Trinken aus dem Tabu führen, gleichzeitig aber Stabilität erzeugen. Jeden Tag zwei Liter Rotwein, das hatte ich mit ihm ausgehandelt. Außerdem sollte er alles sammeln dürfen, außer Lebensmittel oder andere verderbliche Dinge. Und Herr Schweiger sollte niemals bedrängt werden, am gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen.
Meine Kollegen waren zuerst aufgebracht, v. a. wegen des Alkohols. Doch dann wurde im Team beschlossen, es drei Monate zu versuchen. Obwohl nicht immer alles läuft wie vereinbart, lebt Josef Schweiger weiter bei uns in der Hausgemeinschaft. Wir haben uns daran gewöhnt, dass seine Betreuung und Pflege immer eine Sache des Verhandelns bleiben wird. Er braucht den Widerstand. Gegen gesellschaftliche Regeln zu verstoßen ist Bestandteil seiner Lebensgeschichte. Insgesamt aber ist Herr Schweiger bei uns gut angekommen, er hat seine Rolle gefunden und manchmal kommt er sogar in die große Wohnküche, nimmt irgendwo alleine an einem Tisch Platz und beobachtet, mit einem Glas Rotwein in der Hand, das gemeinschaftliche Leben.
Als ich heute Morgen sein Zimmer betrete, ist Josef Schweiger zu meiner Überraschung schon bereit für den Tag. Er sitzt fertig angezogen in seinem, mittlerweile wieder bis fast unter die Decke vollgeräumten Zimmer und erklärt mir mit fester Stimme und ernstem Blick: „Heute fahr ich zum Flohmarkt und wehe es hindert mich jemand daran.“ Ich lache ihn an und sage: „Sie gehen also wieder auf die Jagd?“, worauf Herr Schweiger kurz blinzelt und meint: „Genau! Auf die Jagd!“
Danach bitte ich ihn darum, mir trotzdem noch schnell sein linkes Bein ansehen zu dürfen. Der Pflegeassistent Peter K., er hatte heute Nachtdienst, hat in die Pflegedokumentation eingetragen, dass er gestern, als er dem stark betrunkenen Josef Schweiger beim ins Bett gehen half, eine Wunde am linken Unterschenkel, beim Außenknöchel, gesehen hat. „Nur, weil sie es sind“, meint Herr Schweiger, reicht mir widerwillig seinen linken Fuß und fügt an: „Ich sollte ja schon am Flohmarkt sein. Sicher sind die besten Stücke jetzt schon weg.“
Die Wunde hat einen Durchmesser von rund 3 Zentimetern und sitzt genau am Knöchel. Sie ist stark entzündet. Ich erkläre Herrn Schweiger, dass ich auf die Wunde jetzt einen Schutzverband gebe, sie aber nach seiner Rückkehr vom Flohmarkt von unserer Wundmanagerin begutachtet werden muss. Ich tippe auf ein beginnendes Ulcus cruris, je schneller wir mit der richtigen Therapie beginnen, desto besser.
„Jaja, nach dem Flohmarkt und meiner ersten Flasche Rotwein bin ich bereit für Euch und Eure Qualen. Jetzt aber Ende mit dem Tamtam.“ Da ich Herrn Schweigers Ungeduld kenne, versorge ich das Ulcus kurz mit einer Wundsalbe und entlasse ihn in Richtung Flohmarkt. Im Pflegebericht vermerke ich seinen starken Geruch nach Urin und auch, warum heute keine Dusche möglich war. Außerdem beschreibe ich die Wunde und fordere eine fachliche Begutachtung durch die Wundmanagerin inklusive Absprache mit dem Hausarzt an.
|34|