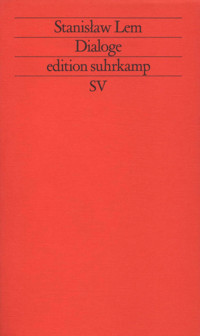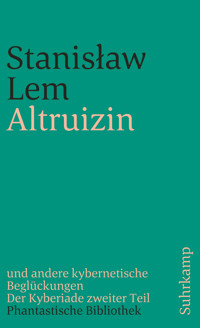13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stanisław Lem gilt vielen als der Science-Fiction-Autor schlechthin. Und doch ist hier noch ein ganzer literarischer Kosmos zu entdecken: Lem der Philosoph, der streitlustige Kritiker, Erfinder neuer Genres, Sprachkünstler und Romancier von Weltrang. Best of Lem versammelt Erzählungen und Kostproben sowohl der berühmten, vielfach verfilmten und millionenfach gelesenen und geliebten Bücher als auch unbekanntere, aber ebenso aufregende Glanzlichter aus den 50 Jahren Lem‘schen Schaffens. Nicht nur Fans von Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin oder Cixin Liu kommen dabei voll auf ihre Kosten. Angesichts einer Gegenwart, die mehr und mehr von Künstlicher Intelligenz und menschlicher Dummheit geprägt zu sein scheint, ist der große Misanthrop und Utopist Lem zu seinem 100. Geburtstag unbedingt wieder neu zu lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Stanisław Lem
Best of Lem
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Jan-Erik Strasser
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Der Mensch vom Mars
Das Hospital der Verklärung
Dialoge
Terminus
Solaris
Harey
Memoiren, gefunden in der Badewanne
Lolita oder Stawrogin und Beatrice
I
II
III
IV
Der Unbesiegbare
Summa technologiae
Chaos und Ordnung
Szylla und Charybdis – oder vom rechten Maß
Wie die Welt noch einmal davonkam
Zifferotikon
Das Hohe Schloß
Die Stimme des Herrn
Vorwort
Die neue Kosmogonie
Rien du tout, ou la conséquence
Der futurologische Kongreß
Golem
XIV
GOLEM
s Antrittsvorlesung
Dreierlei über den Menschen
Die Maske
Der Schnupfen
Lokaltermin
Lem über Lem
Beschwerde- und Antragsbuch
Tertio millennio adveniente
Nachwort: Der große Schlemm
I
. Ganz kurz: Leben und Werk
II
. Lems Genie
III
. Mögliche Vergangenheiten
IV
. Lem jetzt und in Zukunft
Textnachweise
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Der Mensch vom Mars
[…] »Sie sind, ohne es zu wollen … in eine sehr komplizierte Lage geraten.« Er schien jedes Wort auf die Waagschale zu legen. »Eines müssen Sie wissen: So wie Sie bis jetzt waren, werden Sie nicht mehr sein.«
Blitzschnell kam mir der Einfall, daß hier die Zentrale einer hervorragend organisierten Gang sei – oder vielleicht eine politische Gruppe von Faschisten oder etwas von der Art?
Aber wozu diese Bücher?
»Oder Sie werden hier gar nicht herauskommen, oder …«, er hielt inne. Sie betrachteten mich gelassen, aber ich spürte trotzdem eine gewisse Spannung.
»Oder?« fragte ich und wandte mich an den, der mir schon einmal eine Zigarette angesteckt hatte.
»Entschuldigung, darf ich Sie bitten? Wie Sie sehen, kann ich mich meiner Hände nicht bedienen und würde gerne rauchen.«
Er steckte mir langsam (alles machten sie langsam, es war lächerlich, aber zugleich schrecklich – als spielten sie eine Rolle auf der Bühne) eine Zigarette in den Mund und gab mir Feuer. Die anderen warfen einander Blicke zu – zum zweiten Mal.
»Oder Sie werden zu uns gehören …«, schloß der Mann mit dem Lorgnon. »Und es scheint mir, daß das der Fall sein wird.«
»Der Anschein kann trügen«, erwiderte ich und bemühte mich ebenfalls, langsam zu sprechen, nicht so sehr, um mich ihnen anzupassen, sondern eher, um den Cognacnebel zu beherrschen, der nach dem langen Hungern meine Sinne verwirrte.
»Darf ich wissen, worum es geht?«
Der Mann mit dem blassen breiten Gesicht, der bis jetzt geschwiegen hatte, hob den Kopf.
»Das können Sie natürlich nicht wissen«, sagte er in irgendwie entschuldigendem Tonfall. Und lauter: »Ihnen ist es doch nicht ganz egal. Unsere Devise ist einfach: gehorchen und schweigen.«
Ich muß zugeben, daß mich dieses Gespräch in einen sonderbaren Zustand versetzte. Als ich von dieser seltsamen Gesellschaft zum Verschwinden, gleichsam zum Tod verurteilt worden war, war mir bewußt geworden, daß meine Situation hoffnungslos war, doch die neue Wendung erweckte neue Kräfte in mir. Ein Mensch in auswegloser Lage wird apathisch, abgestumpft. Ein Hoffnungsstrahl aber genügt, und die Kräfte vervielfachen sich, alle Sinne werden bis zum Äußersten geschärft, und man wird zu einem einzigen gespannten Muskel, um das Leben mit den gewaltigsten Anstrengungen zu meistern. Das war auch bei mir der Fall. Während ich mit gedämpfter Stimme sprach, musterte ich gleichzeitig mit blinzelnden Augen die Umgebung und schätzte die einzelnen Entfernungen ab. Flucht? Warum nicht? Ja, das war der letzte Ausweg. Ich konnte nach einem massiven Aschenbecher greifen und ihn dem Anführer an den Kopf werfen, aber das wäre eine Dummheit. Weitaus besser wäre es, ihn gegen die große elektrische Lampe zu schleudern, die den Saal erhellte. Es ging lediglich darum, ob in der runden matten Kugel eine oder mehr Birnen glühten? Davon konnte alles abhängen. Gut, aber die Tür? Diese sonderbare Tür, die sich von selbst öffnete und schloß. Ich stand mit dem Rücken zu ihr und wußte nicht, ob sie eine Klinke hatte.
»Sie dürfen keine Fragen stellen …«, sagte langsam und mit Nachdruck der Mann mit dem bleichen, schweißüberströmten Gesicht und drückte die Zigarette in dem silbernen, ziselierten Aschenbecher aus. Er fegte ein unsichtbares Staubkörnchen von der Manschette und heftete plötzlich seinen kühlen blauen Blick auf mich.
»Erlauben Sie …«, ich lächelte und zuckte leicht mit den Achseln; dabei sah ich verstohlen zur Tür. Sie hatte eine gewöhnliche Klinke. Ich hatte das Gefühl, daß ich doch …
Ein Mann, der unserem Gespräch gar nicht zugehört zu haben schien, sagte auf einmal einige Worte in einer mir unverständlichen Sprache. Es waren Rachenlaute. Mein Gesprächspartner beugte sich über die Tischplatte und sagte schnell und leise:
»Sind Sie einverstanden?«
»Womit?«
Ich wollte um jeden Preis Zeit gewinnen.
»Sie haben die Wahl, entweder unserer …«, hier zögerte er. (Es mangelt ihnen wohl an Praxis, dachte ich. Das ist keine Gang. Dort haben sie andere Manieren.) »… Organisation beizutreten oder unschädlich gemacht zu werden.«
»Das heißt, auf Bodentemperatur abgekühlt, wie?«
»Nein«, sagte er ruhig. »Wir werden Sie nicht töten. Wir führen lediglich eine kleine Operation durch, nach der Sie den Rest Ihres Lebens ein Idiot sein werden.«
»Ja … Und was soll ich in der ›Organisation‹ tun?«
»Nichts, was Ihre Möglichkeiten übersteigen würde.«
»Geht es um etwas Gesetzwidriges?«
»Welches Gesetz meinen Sie?«
Ich war verblüfft. »Nun ja … unser amerikanisches Gesetz.«
»Zweifellos … manchmal«, antwortete er. Wie auf Befehl lächelten jetzt alle. Gasmasken, hätte man meinen können, die sich für einen Augenblick belebten. Ich machte eine langsame Fußbewegung, um durch die Drehung den Aschenbecher in mein Blickfeld zu bekommen. Schaffte ich es, ihn mit gefesselten Händen gegen die Lampe zu schleudern? Ich war kein schlechter Sportler. Im selben Augenblick beugte sich der Mann mit dem Lorgnon bis zu einem auf dem Tisch stehenden Oleander in einem schönen Jaspistopf hin und sagte einige Worte, die ich nicht verstehen konnte. Die Tür öffnete sich, und der Fahrer mit seinem Helfer erschien.
»Abführen – in den Operationssaal«, sagte der Anführer. »Und die Handschellen abnehmen.«
Der Fahrer trat zu mir her – der Schlüssel knirschte im Schloß. Im nächsten Augenblick versetzte ich ihm mit dem stählernen Armband der linken, noch gefesselten Hand einen Schlag an die Schläfe und gab ihm gleichzeitig einen Fußtritt in den Hintern. Er fiel um, ohne einen Laut von sich zu geben. Aber noch während sein großer Körper in meine Richtung fiel, faßte ich ihn am Kragen seiner Lederjacke und schleuderte ihn mit aller Kraft zwischen die Männer, die vom Tisch aufsprangen. Der riesige Körper stieß den Tisch um, einige Sessel kippten – ich wartete nicht ab, was weiter geschehen würde, sondern stürzte zur Tür. Sonderbarerweise schoß niemand. Der Helfer des Fahrers stand mit leicht gespreizten Beinen ruhig in der Tür, als wollte er plötzlich einen lange nicht gesehenen Bekannten begrüßen.
Ich schlug ihm mit der linken Faust an das Kinn, das heißt, ich zielte auf diese Stelle, doch er parierte meinen Schlag mit der Handkante, so daß ich einen scharfen Schmerz in der Hand verspürte, die unwillkürlich herunterfiel. Der Mann konnte Jiu Jitsu – das war fatal.
In diesem Chaos, als ich hinter meinem Rücken Schritte vernahm, die sich mir näherten, blitzte in mir die Erinnerung an den stämmigen kleinen Itchi-Hasam auf, der in Kyoto japanischen Kampfsport unterrichtete. In der letzten Lektion hatte er mich zwei Griffe gelehrt, die den Europäern unbekannt sind und die zum Tode führen. Es sind Schläge mit beiden Händen, von unten, die scherenartig die Kehle zertrümmern. Der, den ich mit der ganzen Kraft der Verzweiflung ausführte, gelang nur zum Teil. In dem Augenblick, als ich seinen gespannten Körper spürte, ergriffen mich starke Arme von hinten. Ich warf mich zu Boden, doch der Kampf dauerte nicht lange. Aus der Masse der bebenden Hände und Füße erhob ich mich, an den Kleidern festgehalten, und wurde sonderbarerweise zu Tisch gebeten.
Einer der nach Atem Ringenden schob mir einen Sessel zu, und als ich verdutzt und zittrig hineinfiel, schob mir der zweite eine lange Zigarette in den Mund, der dritte gab mir Feuer; und sie ließen sich alle bei mir nieder, wie zu einem geselligen Gespräch nach einer kurzen Pause.
Der Fahrer machte sich schnell davon, zusammen mit dem Helfer, der röchelte, Blut spuckte und sich die verletzte Kehle hielt.
Nach einer Minute des Schweigens sagte der Anführer:
»Sie haben die Prüfung bestanden … Sie gehören bereits zu uns.«
»All das war natürlich eine Komödie«, fügte er hinzu, als er meinen staunenden Blick bemerkte. »Wir haben Ihnen eine Chance gegeben, und Sie haben sie wahrgenommen.«
»Eine originelle Art und Weise …«, sagte ich und massierte mir den Oberarm. »Darf ich wissen, welche Scherze die Herren noch in petto haben? Mir als erfahrenem amerikanischem Reporter ist so etwas noch nie zugestoßen.«
»Das glaube ich Ihnen gern«, sagte der Mann mit dem bleichen Gesicht. »Erlauben Sie, daß ich Sie mit den Anwesenden bekannt mache: es sind Doktor Thomas Kennedy« – er wies auf den Mann mit dem Lorgnon – »hier Mr. Gedevani, Ingenieur Fink, und ich heiße Frazer.« Die Herren verbeugten sich und reichten mir die Hand. Ich wußte nicht, ob ich mich ärgern oder ob ich lachen sollte.
»Und ich heiße …«
»Das wissen wir, das wissen wir ganz genau, Mr. McMoor – Sie stammen aus Schottland, nicht wahr?«
»Meine Herren, bitte, genug der Scherze!«
»Wir verstehen Sie völlig«, sagte Frazer. »Nun, in kurzen Worten: So wie wir hier sitzen, sind wir eine Organisation, die eigentlich keine rein wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen oder gar« – er lächelte – »räuberischen Zwecke verfolgt. Glauben Sie nicht, daß wir Faschisten sind«, fügte er noch schnell hinzu, denn er erkannte, daß mein Gesicht länger wurde. »Wir sind auch kein Klub gelangweilter Millionäre.«
»Und wenn Sie eine ganze Stunde so fortfahren«, sagte ich bissig. »Ihr seid auch keine Gesellschaft für den Schutz entgangener Schnitzel oder ein Klub zur Versorgung der eigenen Tasche …«
»Es ist eine Sache, die schwer zu verstehen und noch schwieriger zu glauben ist«, sagte ein Mann in schwarzem Anzug mit schmalem Gesicht, das ein gepflegter silbriger Schnurrbart zierte. Der Präsident des Vereins hatte ihn Ingenieur Fink genannt. »Allem Anschein nach werden Sie sich für die Sache nicht nur näher interessieren, sondern ihr auch all das opfern, was wir geopfert haben.«
»Und das heißt?«
»Das heißt alles«, sagte er und stand auf. Die anderen hatten sich ebenfalls erhoben, und Frazer wandte sich an mich:
»Wollen Sie mir folgen? Ich muß Ihnen die Sache genau erklären.«
Ich verbeugte mich und folgte ihm über den schalldämpfenden dicken Teppich.
Wir kamen zur Tür, die sich von selbst öffnete, als wir zwei Schritte von ihr entfernt waren. Ich bemerkte, daß wir allein waren – die anderen Verschwörer (wie ich sie in Gedanken nannte) waren in der Bibliothek zurückgeblieben. Der Korridor führte zu mir unbekannten Treppen, die in einem Betonblock eingebaut waren: ohne Fensteröffnungen, schwer, massiv. An den Wänden glühten überall die matten quadratischen Lampen. Der Korridor im zweiten Stock glich ganz dem unteren – mein Führer ging mit mir zu der Tür, die auf der Plattform zu sehen war, öffnete sie und trat als erster ein.
Es war ein kleiner Raum, vollgestopft mit physikalischen Instrumenten und Büchern. An den Wänden hingen Landkarten – wie es mir schien, zeigten sie eine Wüstengegend –, und auf dem Fußboden standen verschiedene Globusse. Das Mobiliar bestand aus einem riesigen amerikanischen Schreibtisch, einigen Fauteuils und Tischen mit komplizierten Apparaten mit unzähligen Kathodenröhren.
Das fiel mir als erstes ins Auge, als ich mich, dazu aufgefordert, setzte und zu meinem Gastgeber hinüberschaute. Er war sonderbar konzentriert und ernst. »Mr. McMoor, ich bitte Sie sehr, verstehen Sie mich richtig, und wenn möglich, schenken Sie allem, was ich Ihnen zu sagen habe, Glauben. Ich werde später versuchen, Ihre Zweifel mit Hilfe anschaulicher Mittel zu zerstreuen.« Er machte eine ausladende Geste und fragte, während er eine Zeitung vom Tisch aufnahm: »Erinnern Sie sich, welches Phänomen sich vor drei Monaten am Himmel unserer Hemisphäre gezeigt hat?«
Ich zerbrach mir den Kopf. »Es kommt mir vor, als sei ein großer Komet erschienen oder auch ein Meteor – ich kann mich nicht recht entsinnen«, sagte ich. »Wir waren damals mit der Kapitulation Deutschlands beschäftigt – Astronomie samt Meteorologie waren Nebensache.«
»Genauso war es.« Mein Gesprächspartner schien hoch zufrieden. »Sie müssen wissen, daß ich Physiker von Beruf bin. Sogar Astrophysiker«, fügte er nachdenklich hinzu. »Der von Ihnen erwähnte Meteorit fiel an der Grenze von Nord- und Süddakota und löste Waldbrände aus. Auf einer Fläche von dreitausend Hektar wurde der Wald zerstört. Da ich in der Gegend war, machte ich mich auf, um mit den Kollegen vom Mount Wilson Observatorium die Absturzstelle des Meteors zu suchen. Es war eine zerklüftete Schlucht – dieser Himmelskörper schien sich den Gesetzen der Himmelsmechanik wenig zu fügen: er berührte die Erdkruste unter einem sehr kleinen Winkel, fast horizontal. Beinahe zwei Kilometer raste er über den Wald und riß eine Furche auf, die zwölf Meter tief war, er setzte Bäume in Brand und warf sie mit einer gewaltigen Druckwelle um, bis er sich in einen Hügel eingrub, dessen Gipfel bis zu einer Tiefe von mehreren Dutzend Metern abgetragen wurde. Die Hitze des immer wieder aufflammenden Waldes erschwerte den Zugang zu der Stelle, wo sich der rätselhafte Meteorit befand. Das Sonderbare daran war, daß wir in der Nähe keine Splitter von Meteoreisen fanden, überhaupt nichts, was uns über die Struktur dieses Gebildes hätte Aufschluß geben können. Mit Hilfe der herbeigeschafften Maschinen und Arbeiter gelang es mir, diesen Körper nach künstlicher Abkühlung auszugraben – von den verschiedenen Schwierigkeiten, die damit zusammenhingen, berichte ich Ihnen ein anderes Mal. Dieser Bolide ist zur Zeit hier, Sie können ihn am Tag sehen, sogar morgen. Er ist eigentlich kein Bolide …«, er zögerte.
»Ist es vielleicht ein Raketengeschoß aus Europa?« fragte ich. »Die Deutschen versuchten, sie abzuschießen, doch soviel ich weiß, nur auf die britischen Inseln.«
»Ja, es ist ein Raketengeschoß«, sagte Frazer. »Sie sind sehr scharfsinnig. Aber es stammt nicht aus Europa.«
»Japan?«
»Weder noch …«, und er wies auf die großen Weltkarten, die an der Wand hingen. Ich betrachtete sie sehr genau. Große sonderbare gelbe Flächen, gewundene, dunkle, gleichsam mit Wald bedeckte Massive, weiße Schneekappen auf den Polen – ich erkannte plötzlich ein winziges, engmaschiges Kanalnetz.
»Mars!« schrie ich fast.
»Ja, es ist ein Geschoß vom Mars«, sagte Frazer langsam und legte einen Gegenstand vor mich hin, den er behutsam aus einer Schublade geholt hatte.
»Und das ist die erste Nachricht von einem anderen Planeten …«
Auf der roten Schreibtischplatte lag eine blauglänzende Walze aus einer metallischen Substanz. Ich griff mit der Hand danach – sie blieb hängen.
»Ist das Blei?« fragte ich.
Mr. Frazer lächelte. »Nein, kein Blei … es ist ein auf der Erde sehr seltenes Metall: Palladium.«
Ich drehte den Verschluß langsam auf – sein Gewinde glänzte matt … Ich sah ins Innere: Es handelte sich um eine hohle Walze, die mit Pulver gefüllt war.
»Und was ist das?«
Frazer schüttete das Pulver auf ein Blatt weißes Papier, dann legte er das Papier auf eine weiße Platte, die an zwei Stativen befestigt war, und legte die Metallwalze darunter. Er bewegte sie einmal in die eine, dann in die andere Richtung. Ich glaube, ich schrie auf.
Auf dem Papier fügten sich die Pulverpartikel, wie Splitter, zu einer Zeichnung zusammen: zu einem Dreieck mit seitlich angefügten Quadraten. Der pythagoreische Lehrsatz. Darunter befanden sich drei kleine Markierungen, die Noten glichen. Frazer schüttete das Pulver sorgfältig in die Walze und legte sie in die Schublade. Dann sah er mich an, um zu prüfen, welchen Eindruck diese seltsame Vorführung auf mich gemacht hatte.
»McMoor, dieses Geschoß brachte nicht nur Nachrichten von einem anderen Planeten … sondern auch lebende Eindrücke.«
»Menschen vom Mars?«
»Wenn das die Menschen … im Geschoß befand sich ein ungemein komplizierter Mechanismus … Wie soll ich es Ihnen erklären? Mir fehlen die Worte. So etwas wie ein mechanischer Roboter … Sie werden ihn sehen … wir glaubten, die Rakete sei von einem Roboterpiloten gelenkt worden. Aber nein: Es zeigte sich, daß sich an einer gewissen Stelle im Zentrum etwas befindet – nicht zu glauben – kommen Sie, das müssen Sie sehen. Ich selbst beginne, an die eigene nervöse Verwirrung zu glauben, wenn ich das nur einen Tag lang nicht sehe …«
Wir gingen auf den Korridor hinaus. In meinem Kopf ging alles durcheinander, ich achtete nicht mehr auf die Umgebung, ich bemerkte nur, daß wir in den Aufzug stiegen, dessen Schacht in der Mitte des von den Treppen umgebenen Blocks gähnte. Die Fahrt war kurz. Unten war der gleiche Korridor – lang, nur dunkler, denn jede zweite Wandlampe brannte nicht.
Die Riegel knarrten, mächtige Türen, angeordnet in Form einer eisernen Schleuse, schoben sich langsam auseinander – ich trat hindurch. Ich verspürte einen schweren, unangenehmen Geruch. Ich hörte das schwache rhythmische Dröhnen einer Pumpe, verbunden mit dem Schmatzen des Öls in den Ventilen. Das Licht strahlte: Es war der Raum mit den stählernen Türen und einer tiefen Decke. In der Mitte waren zwei mächtige Holzstützen zu sehen und dazwischen, aufgebockt, lag eine formlose Maschine, schwarzglänzend und blauschimmernd. Sie sah aus wie ein Zuckerhut, der Metallspiralen zu Boden sinken ließ. Auf dem Boden glitzerten Nägel und Kiefernadeln. An verschiedenen Stellen waren hellere Streifen zu erkennen, die aussahen, als bestünden sie aus einer gläsernen Masse. Die Spitze des Kegels wies etwas Ähnliches wie eine Metallkappe oder eine große Schraube auf.
»Das ist der Mensch vom Mars«, sagte Frazer sehr leise. »Sehen Sie!« Er kam und drehte die Kappe langsam einmal in die eine, dann in die andere Richtung. »Hier ist der Behälter. Rühren Sie bloß nichts an«, fügte er erschreckt hinzu, als ich mich zu tief vorbeugte. Ich sah eine Birne, nicht größer als eine große Orange, die eine Vielzahl von Drähten aufwies, sie gingen von einem Pol aus.
»Oh, hier ist das Fensterchen …«
Tatsächlich, diese Stahl- oder Palladiumbirne hatte auf dem abgewandten Ende ein Fenster, das mit einer durchsichtigen Masse gefüllt war. Ich sah hinein. Dort war ein sehr schwaches, langsames, aber rhythmisches Blubbern zu sehen. In den Augenblicken des Zusammenballens sah es so aus, als bestünden die leuchtenden Streifen aus Gelatine oder Gallerte. In den Augenblicken des Dunklerwerdens waren einzelne, blaß leuchtende Punkte zu sehen, bis sie im nächsten Stadium in einem Blitz verschmolzen.
»Was ist das?« Unwillkürlich flüsterte ich.
»Er ist, so scheint mir, noch nicht zu Bewußtsein gekommen, oder vielleicht hat er bei der Landung etwas abbekommen«, sagte Frazer und setzte die Kappe auf. Er führte mich schnell auf den Korridor hinaus, drehte die Kurbel, die die dicke Stahlplatte der Tür versperrte, schaute sich erleichtert um – wo war der beherrschte Mann aus dem oberen Saal geblieben? – und sagte:
»Das, was Sie sahen, ist gerade das einzige Lebende … in ihm.«
»In wem?«
»Nun ja, in diesem Gast vom Mars … das ist eine Art Plasma – wir wissen noch nicht so richtig, was …«
Er beschleunigte den Schritt. Ich musterte ihn von der Seite, bis er den Kopf hob.
»Ich weiß, was Sie denken, aber wenn Sie gesehen hätten, was er tun … ja, so wie ich es gesehen habe – ich weiß nicht, ob Sie diesen Raum noch einmal freiwillig betreten würden.«
Mit diesen Worten zwängte er sich in den Aufzug.
Der Aufzug summte leise und stieg mühelos nach oben. In meinem Kopf rauschte es, ich spürte einen leichten Schwindel und griff nach der Türklinke. Plötzlich blieben wir stehen. Frazer blickte mich eine Weile forschend an, als wolle er den Eindruck prüfen, den diese ungewöhnliche Demonstration auf mich gemacht hatte … Dann öffnete er die Tür und ging als erster hinaus.
Wir waren wieder im ersten Stockwerk. Da wir in die der Bibliothek entgegengesetzten Richtung gingen, kamen wir zum Knick des Korridors. Dort endete die Mauer. Auf der rechten Seite sah ich die hohen, in die Betonrillen eingegossenen Glasplatten, die einen Teil des Raumes abtrennten, er sah aus wie ein astronomisches Observatorium. Frazer zog mich weiter zu einigen kleinen weißen Türen und klopfte.
Von innen rief eine leise, heisere Stimme: »Herein!« Wir betraten einen winzigen Raum, der mit Papieren vollgestopft war, und auf dem großen Tisch, auf den Fensterbänken, Stühlen und Schränken lagen Photos und Skizzen, so daß es mir vorkam, als reichte der Platz nur für den Zwerg, der zu unserer Begrüßung den Kopf vom Tisch hob. Es war ein interessanter Typ – ein alter Mann mit rosigem Gesicht, das mit graumelierten Stoppeln bedeckt war – man könnte sagen, ein Kinderbonbon. Auf diesem Gesicht, das immer wieder seinen Ausdruck wechselte, glänzte eine mächtige, goldgefaßte Brille, hinter der sich dunkle, durchdringende, gar nicht lustige Augen verbargen, sie standen zu seinem jovialen Aussehen im Gegensatz.
»Herr Professor, das ist der junge Mann, der gegen seinen Willen zu uns gekommen ist.«
»Haha, Sie sind es, Sie sind in unsere Falle geraten, wie?« begann der Alte und schob die Brille auf die Stirn. »Ich glaube, Sie werden noch Karriere machen.« Kritisch musterte er meine Kleidung, die, von den Spuren der kürzlichen Schlacht in der Bibliothek abgesehen, deutliche Abnutzungserscheinungen zeigte. »Bei uns werden Sie nicht verkommen. Ja, es ist eine wichtige Sache – setzen Sie sich bitte.«
Wir setzten uns. Auf Stühle, die mit Zeichnungen, Stößen beschriebener Bögen und Tafeln bedeckt waren.
»Also, es ist so … Mr. Frazer hat Ihnen bereits unseren hehe, hehe, unseren Gast gezeigt?«
Ich nickte.
»Man sollte es nicht glauben, was? Aha, ich weiß, ja … Was ich sagen wollte, also Sie wundern sich, was das für ein Mysterium ist und was es mit diesen Mauern und Schlössern im Gang auf sich hat.« Er lachte, hob die Brille auf, die heruntergefallen war, und sagte in einem ganz anderen Tonfall, gleichmäßig und ruhig, wobei er die Wörter mit erhobenem Zeigefinger betonte:
»Es ist so: Dieser Gast vom Mars … kann der Menschheit sehr viel Nutzen bringen … aber noch mehr Unglück. Es sind also einige Leute zusammengekommen und haben die nötigen Mittel für diesen Zweck aufgebracht: das Wesen des Ankömmlings kennenzulernen … eines Boten von einem anderen Planeten, sich mit ihm zu verständigen, herauszubringen, ob und wieviel er von uns weiß, welche technische oder geistige Überlegenheit er besitzt – um dies für das Wohl der Allgemeinheit herauszufinden oder um ihn gegebenenfalls zu vernichten.« Die letzten Worte sagte er, ohne den Ton zu heben, völlig ruhig, und gerade das verstärkte den Eindruck.
»Wir müssen uns selbstverständlich vor Neugierde schützen – in erster Linie vor der der Presse – unserer grandiosen Presse«, fügte er hinzu und zwinkerte spitzbübisch, wieder das joviale Onkelchen. »Haben Sie mich richtig verstanden?«
»Ich habe verstanden. Ich möchte jetzt fragen, ob und zu welchem Zweck ich Ihnen, meine Herren, behilflich sein kann. Ich besitze keine speziellen Fertigkeiten. Ich könnte mein Ehrenwort geben und abhauen. Ich gebe zu, diese Sache ist ungemein faszinierend und die Möglichkeit ihrer Beschreibung, wenn die Wahrung des Geheimnisses nicht mehr notwendig ist, würde mich unendlich reizen, aber ich glaube nicht, daß ich nur deshalb bei Ihnen bleiben muß, weil mich ein Zufall hierher verschlagen hat und ich sozusagen als Fremdkörper hier bleiben und das Schicksal des Fremden teilen muß: entweder hinausgeschleudert oder absorbiert zu werden.«
»Haben Sie Medizin studiert?« fragte der Professor und betrachtete mich aufmerksam.
Winzige Lichtpünktchen tanzten auf seiner Brille.
»Habe ich … ein paar Jahre lang.«
»Das sieht man gleich«, bemerkte er. »Was Ihr Weggehen von hier angeht: Ich weiß nicht, ob sich da etwas machen ließe. Bedenken Sie, daß eine solche Sensation in der Presse … so etwas Ungeheures …«
Ich richtete mich unwillkürlich auf, denn er winkte einige Male mit der Hand, als würde er etwas streicheln, und sagte: »Bitte seien Sie nicht beleidigt … ich stelle Ihr Wort nicht in Frage – das Wort eines Schotten«, er lächelte. »Aber wissen Sie, da ist der Spürsinn eines Reporters. Ich glaube übrigens, Sie werden uns nützlich sein und wir Ihnen um so mehr. Wir erwarten zur Zeit einen einzigen« – er zögerte –, »einen Ingenieur aus Oregon, der uns bestimmte Konstruktionsteile von unseren Freunden bringen soll. Wir haben zwar ein Team von hervorragenden Fachleuten, aber es mangelt uns an jemandem mit gesundem Menschenverstand« – wieder zwinkerte er mir zu –, »und ein solcher Verstand ist eine sehr feine Sache. Wir können ihn auch sehr gut brauchen … Haben Sie von der Konstruktion des AREANTHROPOS gehört?«
»Allerdings – nur hatte ich bislang noch nicht einmal Zeit, sie zu verdauen … auch habe ich den Areanthropos nur kurz gesehen.«
»Ich weiß, ich weiß … dort sitzen ist sowieso ungesund«, bemerkte der Professor leise, ohne mich anzusehen. »Wir wissen noch nicht, wie das wirkt. Es kommt mir vor, als sei es eine Art Strahlung – manche Körper glänzen in der Nähe des Apparates – und auch, während er aus dem Geschoß hervorgeholt wird.«
Ich sah ihn aufmerksam an. Der Professor schrumpfte irgendwie zusammen und zitterte.
»Aber lassen wir das … Sie werden schon noch Näheres hören.« Er hob plötzlich den Kopf.
»Sie müssen wissen, daß unser Spiel sehr gefährlich ist – dieser Apparat oder das Wesen oder das im Apparat eingesperrte Wesen – wir finden uns noch nicht zurecht – besitzt verschiedene sonderbare Eigenschaften und kann uns eine hübsche Überraschung bereiten.«
»Warum wollen Sie ihn nicht in Teile zerlegen?« raffte ich mich auf. Beide Männer verzogen das Gesicht.
»Leider, solche Versuche gab es …«, und, ohne mich anzusehen, »Sie müssen wissen, daß wir zu sechst waren … und jetzt sind wir nur noch fünf. Es ist nicht so einfach.«
»Jetzt wissen Sie fast genausoviel wie wir«, sagte Frazer leise. »Sind Sie mit den Bedingungen einverstanden, die wir stellen, das heißt, totale Freiheit, Gleichbehandlung eines jeden als Arbeitsgenossen und Ihr Wort, keinen Fluchtversuch zu unternehmen?«
»Wie denn das, Flucht, meine Herren?« sagte ich, »darf ich diesen Ort verlassen?«
Beide Männer lächelten. »Selbstverständlich nicht«, sagte Frazer. »Sie haben das doch nicht etwa geglaubt?«
»Also, ich bin einverstanden … aber ich gebe nicht mein Ehrenwort«, sagte ich. »Ein Wort, meine Herren, aber das werden Sie wohl nicht verstehen, wäre ein nicht zu überwindendes Hindernis. Ihre Mauern sind es nicht. Ich kann hier nach den Gesetzen leben, die Sie für sich gelten lassen.«
Und ich erhob mich.
Der Professor lächelte. Er holte eine bauchige goldene Uhr aus der Tasche und warf einen Blick darauf.
»Drei vor zwei … Ich meine, Sie haben für heute schon genug erlebt. Ich wünsche eine gute Nacht.«
Der Kopf sank ihm auf die Brust. Er sah und beachtete uns nicht mehr und schrieb lange Ziffernkolonnen nieder.
Frazer nahm mich an der Hand, wir traten in den Korridor hinaus. Das Lampenlicht war ein wenig blasser geworden. Ich verspürte eine Kälte im Inneren und eine große Niedergeschlagenheit. […]
Das Hospital der Verklärung
[…] In dieser Nacht kam niemand zum Schlafen. Die Selektion erbrachte ein recht zweifelhaftes Ergebnis: etwa zwanzig Kranke; und auch da konnte sich keiner verbürgen, daß ihre Nerven standhalten würden. Die inoffizielle Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer über den gesamten Komplex. Józef der Jüngere lief mit wehenden Kittelschößen umher, bemüht, dem Adjunkten keinen Schritt von der Seite zu weichen, und stammelte unausgesetzt etwas von Frau und Kindern.
Auf der Frauenstation tanzte eine halbnackte Menge mit dünnem, verzweifeltem Winseln in einer trüben Wolke von Staub und Bettfedern. Stefan und Staszek hatten die mageren Vorräte der kleinen Apotheke innerhalb von zwei Stunden fast völlig aufgebraucht, indem sie das bisher sorgsamst gehütete Luminal und Skopolamin mit vollen Händen verteilten, übrigens mit sehr mäßigem Erfolg. Stefan nahm selbst zwei Schluck aus der großen Bromflasche. Das forderte Rygiers Spott heraus, denn er zog den Spiritus allen Medikamenten vor. Etwas später beobachtete Stefan, wie sich Marglewski zum Tor hinausschlich, beladen mit zwei schweren Koffern und einem Rucksack, der vollgestopft war mit den Karteikarten zu seiner Arbeit über die Genies. Kauters verschwand noch vor Mitternacht in seiner Wohnung. Das Chaos wuchs von Minute zu Minute. Jeder Pavillon brüllte in einer anderen Stimmlage – Resultate aus dem Schrei vieler Kehlen. Stefan rannte ganz unsinnig mehrere Male auf sein Zimmer, wobei er an der Tür des Professors vorüberkam.
Ein schmaler Lichtstreifen schimmerte durch die Ritze. Aber kein Laut drang heraus.
Anfangs schien es undurchführbar, die Kranken auf dem Anwesen zu verstecken. Pajączkowski indes stellte die Ärzte vor vollendete Tatsachen, indem er kurzerhand elf Schizophrene im Gerätehaus und drei in seiner Wohnung unterbrachte. Die Tür verrammelte er mit einem Schrank, der dann wieder abgerückt werden mußte, weil der angeblich gesündeste Schizophrene einen Anfall bekam. In der Eile bröckelte beim Wegschieben des Schrankes ein beträchtliches Stück Putz ab, und Pajączkowski bemühte sich eigenhändig, die Stelle mit einem kleinen Vorhang zu verdecken. Stefan stürzte einige Male die Treppe hinauf in seine Behausung; wäre nicht die allgemeine Aufregung gewesen, dann hätte ihn der Anblick des Greises vielleicht freuen können, der da, ein Dutzend Nägel im Mund, auf einem von Józef krampfhaft festgehaltenen Stuhl balancierte und die Portiere festmachte. Es wurde verfügt, daß die Kranken nur bei den Ärzten versteckt werden sollten, die wenigstens zwei Zimmer besaßen. Also kamen lediglich Kauters und Rygier in Frage. Der letzte, der schon tüchtig angetrunken war, erklärte sich bereit, einige Leute aufzunehmen. Mittlerweile war Stefan in den Saal gegangen, um seinen jungen Bildhauer herauszuholen. Als er die Tür öffnete, geriet er in einen Haufen brüllender Menschen.
Lange Lakenfetzen wirbelten um die wenigen Lampen, die noch heil waren. Gellende Pfiffe und ein vielstimmiges Hähnekrähen übertönten das allgemeine Tosen. Und etwa alle zehn Sekunden der schrille Schrei, von einer schier berstenden Kehle ausgestoßen: »Der Punische Krieg findet im Schrank statt!« Durch Wolken übelriechender Federn watend, versuchte Stefan, sich an den Wänden entlang durchzuschlagen. Zweimal wurde er umgestoßen und stolperte Paścikowiak vor die Füße, der in unvorstellbar großen Sätzen über die Diele fegte, als wollte er die Schwerkraft überwinden.
Blind in ihrer Wut, vollführten die Wahnsinnigen diabolische Verrenkungen, prallten mit knirschenden Knochen gegen die Wände, krochen unter die Betten, unter denen dann ihre zappelnden Beine hervorragten. Nur weil Stefan ab und zu in der Ecke oder vor der Tür verharrte, gelang es ihm, den Saal zu erreichen, in dem der Junge schlief. Als er ihn gefunden hatte, mußte er von seinen Fäusten Gebrauch machen, um sich Ausgang zu verschaffen. Doch plötzlich sperrte sich der Junge weiterzugehen und zerrte Stefan zurück in die Ecke. Hier holte er unter dem Strohsack ein Paket hervor, das in ein grobes Tuch gehüllt war. Dann aber ließ er sich widerspruchslos zur Tür führen.
Stefan atmete auf, als er sich mit abgerissenen Knöpfen und mit Nasenbluten im Flur wiederfand. Das Gebrüll hinter der Tür wurde immer lauter. Er übergab den Jungen Józef, der in Marglewskis Wohnung ein Versteck einrichten half, und ging von neuem nach unten. Auf dem Treppenabsatz merkte er, daß er etwas in der Hand hielt: das Paket, das der Junge ihm anvertraut hatte. Stefan steckte es unter den Arm, nahm eine Zigarette und sah mit Schrecken, wie ihm beim Anzünden die Hände zitterten.
Als die versteckten Patienten schließlich vom dritten Anfall heimgesucht wurden, verabreichte Pajączkowski, der allgegenwärtig schien, jedem eine Dosis Luminal. Es graute schon, da konnten mehr als dreißig Kranke, in einen narkotischen Schlaf versenkt, endlich in den drei Wohnungen eingeschlossen werden.
Pajączkowski selbst vernichtete ihre Karteikarten, ohne Stefans ängstliches Händeringen zu beachten. Er stand vom Boden auf und schloß den Ofen, in dem er die Papiere verbrannt hatte. Während er sich die rußigen Hände abwischte, sagte er: »Das nehme ich alles auf meine Kappe.«
Dr. Nosilewska folgte dem Adjunkten auf Schritt und Tritt, blaß, aber beherrscht. Für Pfarrer Niezgłoba wurde in aller Eile die Stelle eines »Anstaltsgeistlichen« eingerichtet. Sein durchdringendes Flüstern war aus der dunkelsten Ecke der Apotheke zu hören. Er betete.
Stefan, der ziel- und planlos durch die Korridore raste, lief Sekulowski beinahe in die Arme.
»Hören Sie, Doktor«, rief der und hielt ihn am Mantel fest, »wäre es nicht möglich, daß man mir einen Arztkittel gibt? Sie wissen doch, ich bin in der Psychiatrie bewandert …«
Er lief hinter Stefan her, als wollte er mit ihm Fangen spielen. Stefan blieb schnaufend stehen und überlegte. Schließlich sagte er: »Warum nicht? Es ist sowieso alles einerlei. Wenn man's für den Pfarrer machen konnte, wird es auch für Sie gehen … Aber andererseits ….«
Sekulowski ließ ihn nicht ausreden. Jeder versuchte den anderen zu überschreien. So gelangten sie an die Treppe. Pajączkowski stand im Zwischenstock und erteilte den Pflegern die letzten Anweisungen.
»Und ich sage, man muß sie alle vergiften!« schrie Krzeczotek mit feuerrotem Kopf.
»Das wäre nicht nur Unsinn, sondern ein Verbrechen«, erwiderte Pajączkowski. Große Schweißperlen rannen ihm von der Stirn und glitzerten in den weißgefiederten Brauen. »Vielleicht wird Gott noch alles zum Guten wenden … was dann? So aber … setzen wir die dreißig unnötig der Gefahr aus, und uns mit!«
»Nehmen Sie doch diesen Rotzjungen nicht ernst«, warf Rygier verächtlich ein, der im Hintergrund stand. Aus seiner Kitteltasche lugte eine Flasche Spiritus.
»Sie sind ja betrunken!«
»Herr Adjunkt«, mischte sich Stefan ein, den Sekulowski in Pajączkowskis Nähe gedrängt hatte. »Die Sache ist die …«
»Nun, ich weiß nicht, ob das ratsam wäre«, meinte Pajączkowski, als er sich Sekulowskis Vorschlag angehört hatte. »Sie hätten sich doch lieber in meiner Wohnung verbergen sollen.«
Er wischte sich die Stirn mit einem weißen Tuch.
»Nun gut, von mir aus. Einen Augenblick, Frau Doktor … Liebe Kollegin, Sie haben ja schon Übung in solchen … Eintragungen …«
»Schon gut, ich eile, das Buch zu fälschen«, erwiderte die Nosilewska mit ihrer angenehmen, hellen Stimme. »Kommen Sie mit!«
Sekulowski trabte hinter ihr her.
»Ach so … noch etwas«, sagte Pajączkowski. »Jemand muß zu Kauters. Ich selbst möchte eigentlich nicht gehen … es paßt nicht so recht …«
Er wartete, bis die Nosilewska aus der Kanzlei zurück war. Sekulowski trieb sich bereits in Stefans weißem Kittel überall im Gebäude umher; sogar sein Hörrohr hatte er in die Tasche gesteckt. Als er jedoch vor der Verbindungstür zwischen den Gebäuden angelangt war und das Geheul der Verdammten hörte, floh er eilends in die Bibliothek.
Stefan war todmüde. Er sah sich im Flur um und machte eine resignierte Handbewegung. Dann schaute er aus dem Fenster, ob nicht schon der Morgen graute, und ging in die Apotheke, um einen Schluck Brom zu nehmen. Er kramte gerade zwischen den Flaschen in den Regalen, da näherten sich leichte Tritte.
Es war Łądkowski, der in seinem schwarzen, lose sitzenden Anzug auf der Schwelle stand.
»Magnifizenz ….?«
Stefans Anwesenheit schien dem Professor nicht zu behagen.
»Nein, ich brauche nichts. Gar nichts«, wiederholte er und blieb eine Weile an der Tür stehen.
Łądkowski war bleich und machte einen kranken Eindruck. Er vermied es, Stefan in die Augen zu sehen. Er machte eine Bewegung, als wollte er umkehren, legte sogar schon die Hand auf die Türklinke, trat dann aber kurz entschlossen ganz dicht an Stefan heran. »Ist … Zyankali da?«
»Wie bitte?«
»Ich meine, haben wir Zyankali hier in der Apotheke?«
»Ach so, ja natürlich«, murmelte Stefan, ohne seine Gedanken sammeln zu können. In seiner Bestürzung ließ er eine Dose Luminal fallen, die am Boden zerschellte. Er wollte sich bücken und die Scherben auflesen, richtete sich aber wieder auf und sah den Professor abwartend an. »Der Schlüssel hängt hier, Euer Magnifizenz … hier!«
Das Zyankali stand mit den anderen Giften in einem Wandschränkchen unter Verschluß.
Der Professor zog eine kleine Schublade heraus und wählte umsichtig ein leeres Pyramidonröhrchen. Dann nahm er einen Napf aus dem Fach, entfernte den Pfropfen mit einer Schere und streute vorsichtig etwa ein Dutzend weiße Kristalle in das Röhrchen, korkte es wieder zu und steckte es in die obere Jackentasche. Nachdem er den Schrank verschlossen und den Schlüssel an seinen Platz gehängt hatte, wandte er sich zum Gehen. Doch er drehte sich noch einmal um: »Bitte, sprechen Sie zu niemand darüber …«
Plötzlich ergriff er Stefans Hand, preßte sie mit seinen kalten Fingern und sagte halblaut: »Ich bitte Sie sehr darum.«
Hastig verließ er den Raum, schloß die Tür aber behutsam.
Stefan stand an den Tisch gelehnt; er spürte noch den Druck von Łądkowskis Fingern. Er besah sich seine Hand genau. Dann kehrte er an den Schrank zurück, nahm das Brom heraus und verharrte eine geraume Weile mit gehobener Flasche.
Vor kurzem noch hatte er Łądkowskis schmächtige Greisenbrust durch das halboffene Hemd gesehen. Jetzt wurde er die Erinnerung an das Märchen vom mächtigen König nicht los.
Dieser König herrschte über ein riesiges Reich. Seiner Stimme gehorchten Völker im Umkreis von tausend Meilen. Als er einmal erschöpft auf seinem Thron einschlief, beschlossen seine diensteifrigen Höflinge, ihn zu entkleiden und in die Schlafgemächer zu tragen. Sie nahmen ihm den Hermelinmantel ab, unter dem eine goldbestickte Purpurrobe leuchtete. Als sie auch diese abgenommen, prangte darunter ein Seidengewand, das mit Sonnen und Sternen besät war. Unter diesem schimmerte ein Kleid ganz aus Perlen. Das folgende war mit Rubinblitzen bestickt. So zogen sie ein Kleid nach dem anderen aus, bis ein großer funkensprühender Haufen vor ihnen lag. Da sahen sie sich entgeistert an und riefen laut: »Wo ist unser Herrscher?« Denn die unzähligen kostbaren Gewänder bargen keine Spur von Leben. Das Märchen hieß »Wie eine Zwiebel gehäutet wird oder Von der Majestät«.
Die Besprechung bei Kauters dauerte eine ganze Stunde. Endlich verstand sich der Chirurg zu einer sogenannten »splendid isolation«: Er wisse von nichts und wolle sich auch in nichts einmischen. Er sei ausschließlich über das unterrichtet, was im Operationssaal vor sich gehe. Sekulowski avancierte zum Arzt auf seiner Station. Dr. Nosilewska, die Stefan von dieser Unterredung erzählte, ließ nebenbei die Bemerkung fallen, Schwester Gonzaga habe bei Kauters auf zwei zusammengerückten Sesseln geschlafen. Schwester Gonzaga? Stefan war nicht einmal mehr imstande, sich zu wundern. Er fühlte sich wie gelähmt und sah alles durch einen leichten Schleier. Es war gegen sechs Uhr. Als er langsam durch den Korridor im Erdgeschoß ging, stieß er auf Rygier, der mitten im Flur auf einem Paralytikerstuhl saß. Vor ihm stand eine Flasche, die er immer wieder vorsichtig mit der Fußspitze anstieß, als wollte er sich an dem reinen Klang des Glases berauschen.
Stefan fiel der gespannte Gesichtsausdruck Rygiers auf, der einen bevorstehenden Weinkrampf vermuten ließ. Stefan wagte nicht zu sprechen.
Plötzlich schüttelte es Rygier so heftig, daß er hochsprang; er hatte vergebens versucht, einen Schluckauf zu unterdrücken.
»Wissen Sie nicht, wo Pajączkowski hingegangen ist?«
»In den Garten«, antwortete Rygier und schluckte erneut.
»Weshalb?«
»Mit dem Pfarrer. Sicherlich um zu beten.«
»Ach so.«
Als Sekulowski Stefan bemerkte, trat er aus der Bibliothek.
»Wo wollen Sie hin?«
»Ich muß mich ein bißchen ins Bett legen, ich habe einfach keine Kräfte mehr. Wir werden sie am Morgen noch brauchen können, meine ich.«
In dem weißen Kittel sah Sekulowski dicker aus als sonst. Der Gürtel war ihm zu kurz; er hatte ihn mit einem Stück Binde verlängert.
»Ich bewundere Sie. Ich … ich … könnte das nicht.«
»Ach was. Kommen Sie mit zu mir.«
Auf der Treppe bemerkte Stefan ein Paket, das an der Heizung lehnte. Richtig, das war ja von dem Jungen. Er nahm es an sich und wickelte es neugierig auf. Es war ein Kopf mit Stahlhelm, über der Oberlippe noch mit dem Steinblock verbunden, aus dem er geformt war. Die Augen gequollen und die Wangen aufgeblasen. Der unsichtbare, im Stein versunkene Mund schrie.
In seinem Zimmer stellte Stefan die Skulptur unsanft auf den Tisch, zog die Wolldecke vom Bett, schob einen Stuhl heran und ließ sich in die Kissen fallen. In diesem Augenblick stürmte Rygier ins Zimmer. »Hören Sie … Der junge Pościk ist da und will sechs Kranke mitnehmen. Er führt sie durch den Wald nach Nieczawy. Möchten Sie nicht mit, Herr Sekulowski?«
»Wer ist da?« Stefan bewegte nur tonlos die Lippen. Sein Flüstern ging unter in den Worten des Dichters: »Wer?« »Was für Kranke?«
Stefan richtete sich auf; er konnte der Schläfrigkeit nur mühsam Herr werden.
»Na, der junge Pościk, der Sohn von dem Elektriker … Er ist aus dem Wald gekommen und wartet unten«, sagte Rygier ungeduldig, dessen Rausch verflogen schien. »Er nimmt alle mit, die der Alte nicht mit seinem Luminal betäubt hat. Wie ist das, gehen Sie nun mit oder nicht?«
Der Dichter sprang erregt vom Stuhl auf. Seine Hände zitterten. »Mit den Verrückten zusammen? Jetzt gleich? Soll ich's wagen?« fragte er Stefan. Der antwortete nicht. Völlig überraschend war da ein Mensch aufgetaucht, der die ganze Zeit in seiner Nähe gewesen sein mußte, ohne daß er davon etwas geahnt hatte.
»Ich kann Ihnen in einer solchen Lage nicht raten …«
»Nach der Polizeistunde … und auch noch mit Verrückten …« überlegte Sekulowski halblaut. »Nein!« sagte er dann etwas lauter. Als Rygier zur Tür stürzte, rief er ihm nach: »Aber warten Sie doch!«
»Sie müssen sich entscheiden! Er kann nicht warten, es sind zwei Stunden Weg durch den Wald!«
»Was ist das eigentlich für einer?« Sekulowski fragte offenbar nur, um Zeit zu gewinnen. Seine Finger zerrten nervös an dem Knoten des Leinengürtels.
»Sind Sie taub? Ein Partisan! Eben eingetroffen. Dem Pajączkowski hat er gleich eine Szene gemacht, weil die Kranken von ihm Luminal bekommen haben …«
»Kann man sich auf den verlassen?«
»Das weiß ich doch nicht! Also gehen Sie nun mit oder nicht?«
»Und der Pfarrer?«
»Der bleibt hier. Also was?«
Sekulowski schwieg. Rygier zuckte mit den Schultern und rannte hinaus. Die Tür schlug krachend zu. Der Dichter folgte ihm einen Schritt und blieb wieder stehen. »Vielleicht doch …?« fragte er unschlüssig.
Stefan vermochte den Kopf kaum noch zu halten. Er murmelte etwas.
Daß der Dichter im Zimmer auf und ab ging und redete, hörte er zwar, aber er war nicht mehr imstande, den Sinn seiner Worte zu erfassen. Der Schlaf übermannte ihn. »Legen Sie sich doch hin!« konnte er noch sagen; dann schlief er auf der Stelle ein.
Ein greller Lichtstrahl weckte ihn. Ein Schlag traf seinen Arm. Er öffnete die Augen und rührte sich nicht; es war noch dunkel im Zimmer, denn er hatte am Abend die Jalousien heruntergelassen. Vor seinem Bett standen mehrere hochgewachsene Männer. Instinktiv hielt er die Hand vors Gesicht, denn einer leuchtete ihn mit der Taschenlampe an.
»Wer bist du?«
»Ach, laß ihn. Der ist Arzt«, rief von hinten eine Stimme, die Stefan bekannt vorkam. Er sprang auf. Die drei Deutschen gaben ihm den Weg frei. Sie trugen Wachstuchmäntel und hatten Maschinenpistolen geschultert. Die Korridortüre war offen. Schwere, eisenklirrende Tritte hallten von dort herüber.
Sekulowski stand in der Ecke. Stefan bemerkte ihn erst, als der Deutsche den Lichtkegel auf ihn richtete.
»Auch Arzt, wie?«
Sekulowski brachte hastig einige Sätze in deutscher Sprache heraus. Seine Stimme war brüchig. Sie schritten der Reihe nach hinaus. An der Tür stand Hutka. Er übergab die Ärzte einem Soldaten in schwarzer Uniform, der sie ins Erdgeschoß bringen sollte. Sie benutzten die Hintertreppe. In der Apotheke, vor der sich ein weiterer Schwarzuniformierter mit Gewehr aufgebaut hatte, fanden sie Pajączkowski, Nosilewska, Rygier, Staszek, Kauters und den Pfarrer vor. Der Mann, der Stefan und den Dichter begleitet hatte, schloß die Tür und musterte die Anwesenden lange. Der Adjunkt stand gebeugt am Fenster und wandte den anderen den Rücken zu, die Nosilewska saß auf einem Metallhocker, Rygier und Stefan hatten sich auf dem Tisch niedergelassen. Trotz des bewölkten Himmels war es hell; weiße Wolken schimmerten durch die gelichteten Baumkronen. Der Soldat verdeckte die Tür. Er hatte ein flaches, dunkelhäutiges Gesicht, aus dem brutal das Kinn herausragte. Sein Atem ging stoßweise; schließlich rief er aus: »Na, ihr Herren Doktoren, was habt ihr nun davon? Die Ukraine war, ist und wird immer sein, aber mit euch ist's aus!«
»Tun Sie Ihre Pflicht, wie wir die unsere getan haben, und sparen Sie sich Ihre Worte«, sagte Pajączkowski mit bewundernswert fester Stimme. Er richtete sich auf, drehte sich elastisch um und blickte den Ukrainer mit seinen grau umbuschten schwarzen Augen finster an. Er keuchte.
»Na, warte …«, stammelte der Soldat und hob die klobigen Fäuste. Da öffnete sich die Tür. Er bekam einen heftigen Stoß ins Kreuz.
»Was machst du hier? Rrraus!« brüllte Hutka. Er hatte den Stahlhelm auf, die Maschinenpistole hielt er, wie zum Schlag, bereit, in der linken Hand.
»Ruhe!« schrie er, obwohl alle schwiegen. »Sie bleiben hier sitzen, bis Ihnen anders befohlen wird. Niemand darf hinaus. Und ich sage noch einmal: Sollten wir einen einzigen versteckten Kranken finden, sind Sie alle dran.«
Er ließ kurz seine blassen Pupillen von einem zum anderen schweifen und machte kehrt. Da rief Sekulowski heiser: »Herr … Herr Offizier …«
»Was noch?« knurrte Hutka und reckte das sonnengebräunte Gesicht unter dem Stahlhelm hervor. Seine Hand lag auf der Türklinke.
»Man hat einige Kranke in den Wohnungen versteckt …«
»Was? Was?« Mit einem Satz war Hutka bei ihm, hatte ihn am Kragen gepackt und rüttelte ihn. »Wo sind sie? Du Gauner! Ihr alle!«
Sekulowski zitterte und ächzte. Hutka rief nach dem Feldwebel und befahl, das ganze Gebäude zu durchsuchen. Der Dichter, den Hutka noch immer am Kragen hielt, stammelte hastig mit überschnappender Stimme: »Ich wollte doch nicht, daß jetzt alle …« Er konnte die Arme nicht bewegen; unter dem würgenden Griff waren sie in den Achselhöhlen von den Ärmeln abgeschnürt.
Staszek sprang vom Tisch. »Herr Obersturmführer, das ist kein Arzt, das ist ein Kranker, ein Wahnsinniger!« rief er leichenblaß.
Jemand seufzte. Hutka war wie versteinert. »Was soll das? Du Saudoktor! Was heißt das?«
Staszek wiederholte in seinem holprigen Deutsch, Sekulowski sei ein Kranker.
Pfarrer Niezgloba duckte sich noch mehr in seine Fensternische. Hutka rollte die Augen. Er hatte begriffen. Seine Nüstern blähten sich. »Was für Gauner sind das, was für Lügner, diese Schweinehunde!« tobte er und schleuderte Sekulowski gegen die Wand. Die Bromflasche auf der Tischkante geriet ins Schwanken und fiel zu Boden, wo sie zerbarst. Der Inhalt ergoß sich über das Linoleum.
»Und das wollen Ärzte sein … Na, wir werden schon Ordnung schaffen. Zeigt eure Papiere!«
Ein Ukrainer, offenbar Unteroffizier, denn er hatte zwei Silberstreifen auf den Schulterklappen, wurde aus dem Korridor herbeigerufen und half bei der Übersetzung der Dokumente. Mit Ausnahme von Dr. Nosilewska hatten sie sie alle bei sich. Nosilewska ging in Begleitung eines Wachtpostens auf ihr Zimmer. Inzwischen war Hutka bei Kauters angelangt. Er besah sich seine Papiere länger als die der anderen und schien etwas milder gestimmt. »So, Sie sind also Volksdeutscher. Na schön. Aber warum haben Sie diesen polnischen Schwindel mitgemacht?«
Kauters erklärte, von nichts gewußt zu haben. Sein Deutsch war fehlerfrei, aber mit hartem Akzent.
Dr. Nosilewska hatte ihren Ärzteausweis geholt. Hutka winkte ab und wandte sich wieder Sekulowski zu, der noch immer halb versteckt hinter einem Schrank an der Mauer stand. »Komm her.«
»Herr Offizier … Ich bin nicht krank. Ich bin völlig gesund …«
»Bist du Arzt?«
»Ja … nein, aber ich kann nicht … ich werde …«
»Komm.« Hutka war jetzt ruhig, fast zu ruhig. Er schmunzelte gar; sein Umhang raschelte bei jeder Bewegung. Nun winkte er Sekulowski wie einem Kind mit dem Zeigefinger: »Komm.«
Sekulowski machte einen Schritt und fiel plötzlich auf die Knie. »Gnade, Gnade … ich will leben. Ich bin gesund.«
»Genug!« Hutkas Stimme überschlug sich. »Du Verräter! Deine unschuldigen verrückten Brüder hast du ausgeliefert …«
Zwei Schüsse knallten hinter dem Haus. Die Fensterscheiben zitterten gläsern, im Schrank klirrten die Instrumente.
Sekulowski umklammerte Hutkas Stiefel, die Schöße seines Arztkittels bauschten sich bei dieser Bewegung. In einer Hand hielt er noch das Gummihämmerchen.
»Franke!«
Wieder trat ein SS-Mann ein. Er packte Sekulowski mit solcher Macht an den Schultern, daß der Dichter, ungeachtet seiner Beleibtheit und Größe, wie eine Stoffpuppe hochgerissen wurde.
»Meine Mutter war Deutsche!« kreischte er, als er hinausgezerrt wurde, und versuchte krampfhaft, sich loszureißen, indem er sich an die Tür klammerte; doch wagte er nicht, die auf ihn niederprasselnden Schläge abzuwehren. Franke hob seine Waffe und begann, mit dem Kolben methodisch auf Sekulowskis Finger zu klopfen, die sich am Türpfosten festkrallten.
»Gnaaade! Heilige Mutter Gottes ….!« heulte Sekulowski. Dicke Tränen rannen über sein Gesicht.
Der SS-Mann verlor allmählich die Geduld. Er kam nicht los von der Schwelle, denn Sekulowski hatte sich wieder an die Türklinke gehängt. Er umfaßte ihn also, beugte sich vor, spannte alle Muskeln an und zerrte aus voller Kraft. Sie flogen bis in den Flur, wo Sekulowski polternd auf die Steinfliesen stürzte. Der Deutsche zeigte noch einmal sein verschwitztes Gesicht, das gerötet war von der Anstrengung. »Dreckige Arbeit!« sagte er und warf die Tür ins Schloß.
Das Fenster der Apotheke ging auf eine große Hecke hinaus, deren unebene Konturen Schatten in den Raum warfen. Etwas weiter abseits standen vereinzelt Bäume. Dahinter ragte eine blinde Mauer auf. Das Geschrei der Kranken und die heiseren Stimmen der SS-Leute drangen zwar gedämpft, aber deutlich herein. Plötzlich peitschten Gewehrschüsse in die angespannte Stille des Raumes. Sie fielen dicht, unterbrochen nur von einem dumpfen Laut wie von fallenden Säcken. Danach wieder Stille. Eine entsetzliche Stimme rief: »Wei-tere zwan-zig Figuuuren!«
Die Schüsse klatschten gegen die Mauer. Zuweilen kündete ein klagendes, hart abbrechendes Pfeifen, daß sich eine Kugel verirrt hatte. Dann wieder ratterte ein Maschinengewehr. Vorwiegend waren jedoch Einzelfeuerwaffen in Aktion. Wenn eine Pause eintrat, hörte man knirschende Schritte, den monotonen Ruf: »Wei-tere zwan-zig Figuuu-ren!«
Und dann zwei, drei Pistolenschüsse, hell und kurz, wie knallende Sektkorken.
Einmal erhob sich ein markerschütterndes Kreischen, das nicht aus menschlicher Kehle zu stammen schien. Dann wieder klang es aus den oberen Stockwerken wie Lachen und Weinen zugleich; es währte lange.
Die Ärzte saßen da, ohne sich zu rühren, und starrten wortlos vor sich hin. Stefans Sinne waren fast völlig abgestumpft. Anfangs konnte er noch einige halbwegs klare Gedanken fassen, etwa daß Hutka, dem doch jede Situation über den Kopf zu wachsen scheine, mit allem glänzend fertig werde … oder daß selbst der Tod sein Eigenleben habe … Diese letzte Überlegung jedoch wurde durch den gellenden Ruf eines SS-Mannes jäh unterbrochen; jemand versuchte wohl zu fliehen. Zweige knackten, das rote Herbstlaub vor dem Fenster rieselte dichter herab, und aus nächster Nähe hörte man keuchenden Atem und das Niederprasseln des im Lauf aufgewirbelten Kieses.
Ein Schuß schlug ein wie der Blitz. Ein Schrei bäumte sich auf und verröchelte.
Schnellfüßige Wolken, die alle Augenblicke ihre Gestalt wechselten, füllten den im Fenster sichtbaren Himmelsstreifen aus. Nach zehn Uhr verstummten die Schüsse, und eine Art Entspannung trat ein. Indes ratterten schon eine Viertelstunde später von neuem Maschinengewehre. Die Stille belebte sich wieder durch das Heulen der Wahnsinnigen und die heiseren Stimmen der SS-Leute.
Um zwölf Uhr vernahmen die Ärzte nur noch regelmäßige, schwere Schritte rings um das Haus. Ein Hund bellte. Eine Frau kreischte. Plötzlich sprang die Tür auf, die keiner mehr beachtet hatte, und der ukrainische Feldwebel trat ein.
»Raus, aber schnell!« rief er von der Schwelle. Hinter ihm tauchte der Stahlhelm eines Deutschen auf.
»Alle raus!« schrie der, die Stimme bis zum äußersten angespannt. Staub und Schweiß hatten sich auf seinem dunklen Gesicht vermischt, seine Augen waren trunken und unstet.
Die Ärzte gingen in den Flur; Stefan sah sich an Nosilewskas Seite. Keine Menschenseele. Nur in einem Winkel einige zerknitterte Laken auf einem Haufen. Lange, schwärzlich verwischte Spuren führten zur Treppe. Hinter der Biegung lag eine unförmige Masse, halb an die Heizung gelehnt: eine Leiche, völlig zusammengesunken, den Schädel gespalten; geronnene Blutzapfen waren daraus hervorgequollen. Eine knorrige, gelbe Ferse ragte unter dem kirschroten Anstaltsrock heraus bis in die Mitte des Korridors. Alle machten einen Bogen, nur der Deutsche, der als letzter ging, stieß den erstarrten Stumpf mit dem Stiefel beiseite. Stefan tanzten die Gestalten vor den Augen. Er mußte sich an Nosilewskas Arm festhalten. So gelangten sie in die Bibliothek.
Dort herrschte das Chaos. Auf dem Boden vor den beiden Schränken, die die Tür flankierten, türmten sich ganze Bücherstöße. Riesige Folianten, die herausgefallen waren, fächelten bei ihrem Eintreten sanft mit den Blättern.
Die zwei SS-Leute, die an der Tür gestanden hatten, traten als letzte ein und machten sich sofort auf dem bequemsten Platz breit, dem roten Plüschsofa.
Stefan flimmerte es vor den Augen. Ringsum schwankte der Boden, die Farben verblaßten, die Umgebung schrumpfte zusammen wie eine gesprungene Blase. Zum erstenmal in seinem Leben wurde er ohnmächtig.
Als er aufwachte, spürte er, daß er auf etwas Warmem und Elastischem ruhe: Nosilewska hielt seinen Kopf auf den Knien, während ihm Pajączkowski die Beine hochhielt.
»Was ist mit dem Personal?« fragte er noch ganz benommen.
»Sie haben die Leute schon am frühen Morgen nach Bierzyniec geschickt.«
»Und wir?«
Niemand antwortete. Stefan erhob sich, taumelte, fühlte jedoch, daß er seinen Schwächeanfall überwunden hatte. Draußen nahten Schritte; ein Soldat trat ein. »Ist Professor Lon-kow-sky hier?« fragte er.
Stille. Schließlich flüsterte Rygier: »Herr Professor … Euer Magnifizenz …«
Łądkowski, der noch immer vorgebeugt im Sessel saß, in derselben Haltung, in der die Stimme des Deutschen ihn überrascht hatte, richtete sich nun allmählich auf. Der schwere Blick seiner großen Augen glitt ausdruckslos über die Anwesenden hinweg. Dann stützte er sich auf die Lehne und stand mit einiger Mühe auf. Dabei griff er in die obere Jackentasche und holte mit zwei Fingern einen Gegenstand heraus. Der Pfarrer, ganz in Schwarz, in wogender Soutane, wollte auf ihn zueilen, aber der Professor wies ihn mit einer kategorischen Geste ab und strebte der Tür zu.
»Kommen Sie, bitte«, sagte der Deutsche und ließ ihm höflich den Vortritt.
Sie saßen schweigend, plötzlich hallte ganz nahe ein Schuß wider wie Donner in einem geschlossenen Raum. Es wurde unheimlich. Sogar die SS-Leute, die sich auf dem Sofa unterhielten, verstummten. Schweißgebadet rieb sich Kauters die Hände, bis die Sehnen quietschten, sein ägyptisches Profil zog sich zu einer gezahnten Linie zusammen. Rygier verzerrte den Mund wie ein Kind und kaute auf den Lippen. Nur die Nosilewska, die zusammengekauert dasaß – das Gesicht auf die Fäuste und die Ellenbogen auf die Knie gestützt –, sah ruhig aus. Ruhig und schön.
Stefan wurde übel in der Magengrube. Der ganze Leib weitete sich ihm vor Schweiß und wurde glitschig, ein ekelhaftes, feines Zittern überrieselte seine Haut. Als er die Nosilewska ansah, mußte er denken, daß sie auch im Tode noch schön sein würde, und der Gedanke barg eine Spur perverser Genugtuung.
»Es hat den Anschein, als ob … die uns alle …«, flüsterte Rygier Staszek zu.
Die Ärzte saßen in den roten Sesseln, nur der Pfarrer stand in der dunkelsten Ecke zwischen zwei Schränken. Stefan lief zu ihm.
Der Pfarrer murmelte vor sich hin.
»Sie … bringen uns um«, begann Stefan.
»Pater noster, qui es in coelis …«, sprach leise der Pfarrer.
»Das ist nicht wahr!«
»Sanctificetur nomen Tuum …«
»Sie irren sich, Sie lügen«, entgegnete Stefan heiser. »Es gibt nichts, nichts, gar nichts! Ich habe das begriffen, als ich ohnmächtig wurde. Dieses Zimmer hier und wir Menschen darin, das alles hier, das ist nur unser Blut. Wenn es zu fließen aufhört, beginnt alles schwächer und schwächer zu pulsieren, selbst der Himmel, ja auch der Himmel stirbt. Hören Sie, Pfarrer?« Er zupfte ihn an der Soutane.
»Fiat voluntas Tua …«, flüsterte Niezgloba.
»Nichts gibt es, keine Farben, keine Gerüche, nicht einmal Finsternis …«
»Diese Welt gibt es nicht«, erwiderte leise der Pfarrer und wandte Stefan sein wehleidiges, abstoßendes Gesicht zu.
Die Deutschen waren in lautes Lachen ausgebrochen. Kauters stand plötzlich auf und trat zu ihnen.
»Entschuldigen Sie«, sagte er, »aber der Herr Obersturmführer hat mir meine Papiere abgenommen. Wissen Sie nicht, ob …«
»Sie müssen schon etwas Geduld haben«, unterbrach ihn ein untersetzter, breitschultriger Mann mit rotgeäderten Wangen. Dann unterhielt er sich weiter mit seinem Freund: »Weißt du, das war, als die Häuser schon alle brannten und ich glaubte, dort gäbe es nur noch Tote. Da rennt dir doch plötzlich mitten aus dem größten Feuer ein Weib schnurstracks auf den Wald zu! Rennt wie verrückt und preßt eine Gans an sich. War das ein Anblick! Fritz wollte ihr eine Kugel nachschicken, aber er konnte nicht einmal richtig zielen vor Lachen – war das aber komisch – was?«
Sie lachten beide. Kauters stand zunächst unbeteiligt vor ihnen. Plötzlich jedoch verzog er ganz sonderbar das Gesicht und ließ ein dünnes, meckerndes »Ha, ha, ha!« hören.
Der Sprecher blickte unwirsch. »Sie, Doktor, warum lachen Sie? Da gibt's doch für Sie nichts zum Lachen.«
Auf Kauters' Wangen traten weiße Flecke. »Ich … ich …«, stammelte er, »ich bin Deutscher.«
Der SS-Mann musterte ihn halb von der Seite. »So? Na, dann bitte, bitte.«
Im Flur wurden Schritte laut; das konnte nur ein Deutscher sein, so stark, sicher und fest hallten sie.
»Sie glauben trotzdem … Pfarrer?« hauchte Stefan flehend.
»Ja, ich glaube.«
Ein hochgewachsener Offizier trat ein. Er war ihnen unbekannt. Die Uniform saß wie angegossen, der Schulterriemen schimmerte matt. Sein unbedeckter Kopf war lang und schmal, die Stirn edel, das Haar grau meliert. Mit seiner stahlgefaßten Brille blitzte er die Sitzenden an. Der Chirurg ging auf ihn zu, nahm Haltung an und streckte die Rechte hin: »Von Kauters.«
»Thießdorf.«
»Herr Doktor, was ist los mit unserem Professor?« fragte Kauters.
»Machen Sie sich keine Gedanken. Ich werde ihn mit dem Auto nach Bierzyniec bringen. Er packt jetzt seine Sachen.«
»Wirklich?« entschlüpfte es Kauters.
Der andere wurde rot und schüttelte den Kopf. »Mein Herr!«
Dann mit einem unerwarteten Lächeln: »Das müssen Sie mir schon glauben.«
»Und warum werden wir hier zurückgehalten?«
»Na, na! Es stand ja schon übel um Sie, aber unser Hutka hat sich doch noch beruhigen lassen. Sie werden jetzt nur noch bewacht, weil Ihnen unsere Ukrainer sonst etwas antun könnten. Die lechzen ja nach Blut wie die Hunde, wissen Sie.«
»So?« machte Kauters erstaunt.
»Wie die Falken … Man muß sie mit rohem Fleisch füttern«, sagte der deutsche Psychiater scherzend.
Jetzt trat auch Pfarrer Niezgloba näher. »Herr Doktor«, radebrechte er. »Wie ist das möglich: Mensch sein und Arzt und dann Kranke erschießen, totmachen!«
Im ersten Augenblick schien es, daß sich der Deutsche abwenden oder sich den aufdringlichen Menschen mit erhobener Hand vom Leibe halten wollte, aber plötzlich heiterte sich seine Miene auf. »Jede Nation«, sagte er in seinem tiefen Baß, »gleicht einem Tierorganismus. Die kranken Körperstellen müssen manchmal herausgeschnitten werden. Das war eben so ein chirurgischer Eingriff …«
Er blickte über den Pfarrer hinweg auf die Ärztin. Seine Nüstern blähten sich.
»Und Gott, Gott?« wiederholte der Pfarrer.
Da die Nosilewska noch immer schweigend und ohne eine Bewegung dasaß, sagte der Deutsche um einiges lauter, den Blick fest auf sie geheftet: »Ich kann es Ihnen auch anders erklären. Zur Zeit des Kaisers Augustus war in Galiläa ein römischer Statthalter, der übte die Herrschaft über die Juden aus und hieß Pontius Pilatus …«
Seine Augen loderten.
»Herr Stefan«, sagte die Nosilewska laut, »sagen Sie ihm bitte, er soll mich gehen lassen. Ich brauche keinen Schutz, ich halte es hier nicht länger aus …« Sie stockte.
Tief bewegt – zum erstenmal hatte sie ihn mit seinem Vornamen angeredet – gesellte sich Stefan zu der Gruppe. Der Deutsche verneigte sich höflich.
Stefan fragte, ob sie hierbleiben müßten oder gehen dürften.
»Sie wollen fort? Alle?«
»Frau Dr. Nosilewska möchte«, sagte Stefan ein wenig unbeholfen.
»Ach so. Ja, natürlich. Gedulden Sie sich bitte noch etwas.«
Thießdorf hielt Wort: Gegen Abend wurden sie freigelassen. […]
Dialoge
[…] philonous Sei mir gegrüßt, Hylas. Du eilst so schnellen Schrittes durch den Park, daß ich dich fast nicht eingeholt hätte. Weshalb nur habe ich gestern vergeblich auf dich gewartet? Wollten wir nicht einen Disput eröffnen über jene Perle der Erkenntnis, die sich Kybernetik nennt?
hylas Ach, lieber Freund, du ahnst ja gar nicht, welche Verwirrung du in meiner Seele mit deinen letzten Ausführungen angerichtet hast. Um das Maß vollzumachen, sagen meine Freunde, die Philosophen, dein wahres Ziel sei die Restitution des Irrationalismus, die Untergrabung des Vertrauens in die Erkenntnisfähigkeit des menschlichen Geistes, und daher sei alles, was du zum Schluß gesagt hast (ich gebe hier ihre Meinung wieder) – nur ein Rauchvorhang, weniger milde ausgedrückt: Ausflüchte.
philonous Was muß ich da hören?
hylas Die Wahrheit. Daher bin ich nach reiflicher Überlegung zu der Überzeugung gekommen, daß es das beste wäre, deinen ganzen Gedankengang nicht zu veröffentlichen, sondern, im Gegenteil, den Mantel des Vergessens über ihn zu breiten. Ich glaube, daß du meiner Meinung um so eher zuneigen wirst, da dieser Gedankengang seinem ganzen Wesen nach lediglich eine Negation war, er verneinte nur, weckte Unruhe und Zweifel, ohne dabei neue, fortschrittliche Werte zu begründen.
philonous