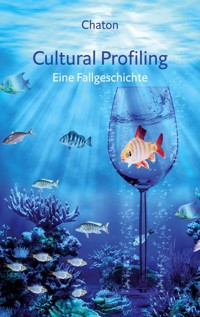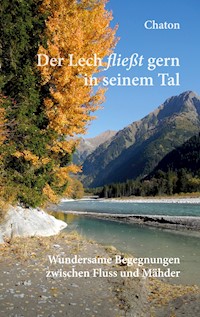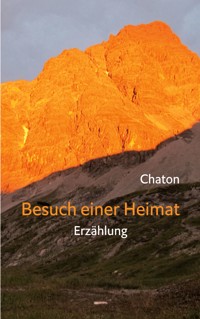
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich sollte der junge Larix mit seinem Vater Sommerferien in einem kleinen Lechtaler Bergbauerndorf verbringen. Doch er begegnet einer Welt, die ihn wundersam in ihren Bann zieht. Mehrere Jahre, zunächst mit dem Vater, später mit Kameraden während seiner Militärdienstzeit in Bayern, sucht er immer wieder das Dorf auf und findet eine ungewöhnliche Daseinsintensität. Die Idylle endet, als er nach Westdeutschland zurückkehrt. Studium und Arbeitsplatz, ein karges Leben in einer ungeliebten Gesellschaft. Das Dorf scheint vergessen. Jahre später wird die verdrängte Erinnerung wach und weckt den Wunsch, dieses Dorf wiederzusehen. Der Besuch ist ernüchternd. Die Bergbauern geben ihre Höfe auf und im Tal vollzieht sich der Wandel zur modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Dennoch spürt er in den verbliebenen Menschen das Wesen der damaligen Welt und gewinnt seine Gefährtin Elyna für seine Idee, das Dorf regelmäßig aufzusuchen. Ihre Aufenthalte werden zur Begegnung mit einer versinkenden Höfegemeinschaft, die über Jahrhunderte existierte und sich vom Bergbauernhof bis zur Hofburg im fernen Wien erstreckte. Zugleich wird die kommunikative Wildnis ihrer eigenen Welt zur Realität, die sie annehmen, wie die einstigen Pioniere die Wildnis des Tals. Eine erstaunliche Geschichte des Unterwegsseins in alten und neuen Zeichenräumen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Friedle in Dankbarkeit
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
In der Bahnsteighalle des Krefelder Hauptbahnhofs standen an jenem frühen Julimorgen des Jahres 1965 drei spärlich besetzte D-Zug-Wagen von ihrer Lokomotive verlassen auf Gleis zwei. Die rote Diesellok, die sie als Eilzug von der niederländischen Grenze hierhergezogen hatte, war abgekuppelt worden und hatte mit dröhnenden Motorgeräuschen und unter bläulichen Abgaswolken die Halle verlassen, war im Gleisgewirr des Bahnhofsgeländes verschwunden. Der fünfzehnjährige Larix verließ das Abteil und befand sich nun auf dem fast menschenleeren Bahnsteig. Er musterte die für seine Begriffe riesige Halle, eine typische, recht filigrane Eisenkonstruktion aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Dach bestand aus drei Kreissegmenten, einem mittleren, rechts und links von einem kleineren flankiert. Die Fronten des Hallendachs und der obere Teil des mittleren Gewölbes waren mit schmalen rechteckigen Scheiben verglast und sorgten für einen natürlichen Lichteinfall. Oberhalb der Bahnsteige hingen in Abständen Leuchtstoffröhren, die brannten, ohne einen Lichtschein zu verbreiten. Einige Reisende standen verstreut auf den entfernten Bahnsteigen und wirkten verloren. Kaum zwei Stunden zuvor hatten sich überall noch Scharen von Menschen zu ihren Arbeitsplätzen gewälzt. Gerade kam eine ältere Dame mit einem kleinen Koffer den Treppenaufgang aus der Unterführung empor. Als sie auf dem Bahnsteig angelangt war, blickte sie sich orientierend um und wandte sich nach links dem letzten der drei Waggons zu, den sie wenig später bestieg.
Der Junge vertrieb sich die Wartezeit, indem er den Abfahrtsfahrplan betrachtete. Der war auf gelbem Papier gedruckt und befand sich hinter der Glasscheibe eines auf zwei Metallfüßen stehenden Metallkastens in der Mitte des Bahnsteigs, gleich neben dem kleinen Kiosk für Erfrischungen, Reiseproviant und Zeitungen. Die Neonleuchte im Innern des Kastens erhellte den Plan und die toten, am Boden verstreut liegenden Insekten. Aufmerksam ging der Junge die fünf Spalten von links nach rechts und von oben nach unten durch. Bei den rot gedruckten D-Zügen verweilte er. Die Eilzüge – wenngleich ebenfalls rot gedruckt – und die schwarz gedruckten Personenzüge interessierten ihn weniger. D-Züge fesselten seine Aufmerksamkeit. Die steuerten ferne Ziele an. Ganz am Ende tauchten in dicken roten Lettern klangvolle Namen auf: Amsterdam, München oder Klagenfurt. Die Vorstellung, dass man hier, genau hier, wo er stand, nur durch ein paar Stunden getrennt, mit geheimnisvoll fernen Städten verbunden war, sorgte für eine angenehme innere Aufregung, für ein freudiges Gestimmtsein, auch wenn er selbst gar nichts Bestimmtes erwartete. Es war seine Traumferne, offenbar das imaginäre Gegenstück der gelebten Enge, der er unterworfen war, ohne sie bewusst wahrnehmen zu können. Das Erleben bedrückender Enge hatte in ihm die Vorstellung ferner Räume geweckt, die es zu entdecken und zu erkunden galt. Er stellte mit Befriedigung fest, dass sich der Eilzug, den er vor einer knappen Stunde mit dem Vater bestiegen hatte, hier in einen ranghöheren D-Zug verwandelte, der sie über Köln, Stuttgart und Ulm bis nach Kempten im Allgäu bringen würde. Dort würden sie umsteigen und schließlich ein winziges Tiroler Bergdorf aufsuchen. Vater hatte es „Boden“ genannt und Larix konnte mit dem Namen nichts verbinden. Alles lag noch außerhalb seiner Vorstellung.
Er wandte sich vom Fahrplan ab und hielt Ausschau nach der E-Lok. Denn hier begann das elektrifizierte Schienennetz. Seine kleine Heimatstadt hingegen lag an einer Nebenstrecke, die mit Diesellokomotiven befahren wurde. Vor wenigen Jahren hatte er noch Dampflokomotiven gesehen, schwarze Ungetüme, die langsam vorbeizogen, wenn er an der Bahnschranke unweit des Bahnhofs gebannt auf die riesigen eisernen Räder starrte, die sich vom zischenden Dampf umwoben und vom schweren Eisengestänge angetrieben, gemächlich drehten und eines nach dem anderen hinter der roten Klinkermauer des Stellwerks verschwanden oder auftauchten und sich in umgekehrter Richtung vorwärts schoben. Der kleine Bahnhof seiner Heimatstadt übte zeitweise eine gewisse Anziehungskraft aus. Er trieb sich mit einem Spielkameraden am Güterbahnhof herum, der aus einer kleinen Lagerhalle mit Rampe und Platz für einen Waggon bestand. Die Bediensteten arbeiteten mit Sackkarren und besaßen einen von Hand bewegten hydraulischen Hubwagen für die größeren Lasten. Das Gelände hinter dem Güterbahnhof war eine unbebaute, brachliegende Fläche voller Strauchwerk, Gebüschen und Brombeerranken, an deren Rand sich ein Abstellgleis mit Prellbock befand. Dort standen bisweilen zwei oder drei Waggons, fast ausschließlich kleine gedeckte Güterwagen mit roten Holzwänden, schweren Eisenbeschlägen und einer Schiebetür. Manchmal stand eine Tür offen und sie blickten in den leeren Waggon. Einmal trauten sie sich, einen Wagen zu entern. Sie musterten stumm seinen Innenraum mit seiner leicht gewölbten Metalldecke, den Lüftungsöffnungen oben an den Seiten und den Stahl streben der Wände. Unter ihren Füßen lagen staubige Holzbohlen, in deren Oberfläche schwere Lasten Rillen und Schleifspuren gegraben hatten. Alles erschien ihnen grob und überdimensioniert. Vorsichtig zogen sie sich wieder zurück und blickten verstohlen um sich. Niemand hatte sie bemerkt.
Wohl zehn lange Minuten, die seine Erwartung steigerten, tat sich nichts, außer dass auf der gegenüberliegenden Seite der Halle mit schrillen Bremsgeräuschen ein Personenzug einfuhr. Der Junge stellte auf dem weißen Fahrplan der Zugankunft fest, dass dieser Zug von Mönchengladbach kam und auf die Minute pünktlich war. Den Waggons entstiegen nur wenige Personen. Eine Lautsprecherstimme verkündete, dass der Zug hier ende und man nicht einsteigen solle. Endlich näherte sich auf seinem Gleis mit dröhnenden Geräuschen eine Rangierlok, die vier D-Zugwagen vor sich herschob. Mit einem Ruck, den die Puffer der Wagen lautstark quittierten und nach vorn weitergaben, hielten sie am hinteren Ende des Zuges. Eigentlich benötigte der Zug seine volle Länge erst ab Köln. Aber man hatte die Zusammenstellung des Zuges nach Krefeld verlagert, um den stark frequentierten Kölner Hauptbahnhof zu entlasten. Larix näherte sich dem Ort des Geschehens. Ein Bahnarbeiter im schwarzen Overall sprang zwischen die Puffer der Wagen, verschraubte den Kupplungsbügel des einen Wagens mit dem Zughaken des anderen und schloss Bremsdruckluftleitungen und Stromkabel an. Zwei Minuten später tauchte von der anderen Seite her eine dunkelblaue E-Lok auf, der Lokführer blickte von hoch oben – so schien es dem Jungen – den Kopf aus dem Seitenfenster gestreckt und brachte die Lok fast ohne Erschütterung mit ihren Puffern genau vor den Puffern des ersten Waggons zum Stehen. Der Junge hatte diesen Vorgang aus nächster Nähe betrachtet und dachte befriedigt: Das war Maßarbeit. Schon war der Bahnarbeiter wieder zur Stelle, sprang zwischen Lok und Waggon ins Gleisbett und verband Bügel und Zughaken, Druckluftbremsschlauch und Stromkabel.
Nun war es Zeit, ins Abteil zurückzukehren, wo sein Vater sich die Wartezeit mit dem Lesen der regionalen Tageszeitung vertrieb. „Gleich geht’s weiter“, sagte der Junge. Der Vater blickte kurz von seiner Zeitung auf und nickte. Gerade hatte er mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass diese linke Journalistin Meinhof vom Amtsgericht München zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Was hatte sie auch Franz Josef Strauß als „infamsten deutschen Politiker“ zu titulieren? Journalismus wollte das sein? Hetze und Beleidigung nannte er das. Überhaupt ging ihm dieses neue „Revoluzzertum“, wie er die politischen Studentenaktivitäten verächtlich nannte, gewaltig gegen den Strich. Lebte man jetzt in einer Demokratie, oder nicht? Natürlich in einer Demokratie. Es gab Parteien, Parlamente und es gab Gewerkschaften. Denen galt zwar nicht seine Zuneigung, aber er akzeptierte sie als „notwendiges Übel“. Er selbst hatte eine kleine, leitende Position inne, mit Personalverantwortung. In seiner Firma gab es keine Gewerkschaftsvertreter. Probleme regelte man direkt mit der Geschäftsleitung. Aber diese Leute mit den großen politischen Reden waren doch Studenten. Schöne Studenten waren das. Sollen etwas Vernünftiges studieren, anstatt zu demonstrieren.
Dass die politische Vergangenheit mancher Politiker nicht vom Nationalsozialismus unbefleckt war, war ihm schon klar. Aber das waren doch Einzelfälle, ein paar schwarze Schafe, die man beim Aussortieren nach dem Krieg übersehen hatte. Möglicherweise sogar bewusst. Man betrachtete sie als geläutert und hatte ihnen die Chance gegeben, sich als Demokraten zu bewähren. Die großen Verbrecher waren doch zur Strecke gebracht worden oder hatten sich selbst zur Hölle befördert, wie der Führer, sein Klumpfuß und sein fettes Schwein. Warum dieser Riesenwirbel? Und überhaupt, dieses kommunistische und kollektivistische Gedankengut, das diese Radikalen propagierten. Vier Jahre hatte er als Kriegsgefangener unter Stalins Bolschewismus zugebracht, hatte auch die Russen selbst gesehen. Besonders glücklich waren die nicht mit ihrem Regime. Ihm brauchte man nichts zu erzählen. Glück im Unglück hatte er gehabt, war nicht nach Sibirien verschleppt worden, sondern in einem Lager in der Ostukraine in der Nähe von Konstantinowka gelandet. Dort war die Überlebensrate etwas höher, weil man sich während der Erntezeit in den riesigen Sonnenblumenfeldern von den Kernen ernähren konnte. Und doch waren die meisten seiner Leidensgenossen krank und entkräftet gestorben wie die Fliegen. Die einfachen Russen hatte er als gutherzige Menschen erlebt, die selbst kaum genug zu essen hatten. Und er konnte es nicht begreifen, dass die Nazis diese Menschen als Untermenschen betrachtet und gnadenlos mit ihren Stiefeln wie Ungeziefer zertreten hatten.
Auf dem Bahnsteig war der Fahrdienstleiter in blauer Uniformjacke, mit roter Schärpe und Schirmmütze, Signalpfeife und Signalkelle in der Hand erschienen. Eine Lautsprecherstimme verkündete die bevorstehende Abfahrt des Zuges und bat um Vorsicht bei der Abfahrt. Der Zugschaffner lief von vorn nach hinten an den Waggons entlang, schloss mit lautem Knall letzte Wagentüren, enterte selbst den Zug und stand auf der unteren der beiden Metallgitterstufen des letzten Wagens, während er mit einer Hand schon die Tür am Griffbügel der Innenseite festhielt. Ein kräftiger Doppelpfiff, lang, kurz, dem Lokführer die grüne Seite des hochgereckten runden Signalschilds leicht winkend entgegengehalten und nach einigen Sekunden setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Ihr Wagen verließ fast unmerklich die Halle. Der blaue Himmel wurde sichtbar und die mit einer hellgrünen Patina bedeckte Kupferhaube des hohen Uhrturms leuchtete in der Morgensonne. Langsam zog das Bahnhofsareal mit seinen Gleisen, Hallen, Schuppen und abgestellten Lokomotiven und Waggons vorbei und fiel zurück, während der Zug stetig beschleunigte. Von Weiche zu Weiche nahm die Zahl der Gleise ab, schließlich hatte er seine Reisegeschwindigkeit erreicht und es ging in schneller Fahrt Richtung Köln.
Vor ein paar Jahren war der Junge bis Köln, ja sogar bis Bonn gekommen. Aber er erinnerte sich nicht so recht. In Bonn hatte seine Oma mütterlicherseits gewohnt, bevor sie zu ihnen gezogen war. Still und zurückgezogen lebte sie in ihrem Zimmer und wurde von seiner Mutter betreut. Vor drei Jahren war sie in ein Altenheim in Bonn gegangen, wo die Familie seiner Tante sich um sie kümmerte. Vergangenes Jahr war sie gestorben. Nur die Eltern waren zur Beerdigung gefahren und die älteren Geschwister. Er selbst bewahrte das Bild einer unendlich alten, schweigsamen Frau, die unentwegt strickte Unterhosen für die armen Heidenkinder in Afrika. Wenn sie aufblickte, schaute sie ihn mit einem wohlwollenden Lächeln an. Vielleicht war es dieser Blick, der sich ihm eingeprägt hatte. Denn man schaute sich wenig in die Augen, weil die Blicke nicht so frei waren wegen des Streites und Zwistes der Eltern und der Resignation in der Familie.
***
Die Bahnhofshalle zu Füßen des Doms war im Vergleich zum Krefelder Bahnhof geradezu gigantisch. Züge und Menschen füllten sie mit ihrer Gegenwart und dem Strom ihrer Bewegungen. Eine brausende Lärmglocke umhüllte das Geschehen. Lautsprecherdurchsagen an verschiedenen Punkten der Halle durchbrachen den Lärm, schienen die Anweisungen einer unsichtbaren Regie zu übermitteln. Nach wenigen Minuten ertönte nah und deutlich aus den Lautsprechern ihres Bahnsteigs die Ansage der Weiterfahrt. Vater sagte, dass sie auf der linksrheinischen Seite fahren würden und das Mittelrheintal sehr schön sei. Tatsächlich befand sich die Abteilseite des D-Zugwagens in Fahrtrichtung links, also dem Rhein zugewandt, und durch die große Scheibe bot sich ein umfassender Ausblick auf die Landschaft, in die sie langsam hineinfuhren. Kurz hinter Bonn wurde der breite Strom wieder sichtbar und seine Flusslandschaft begrüßte die Reisenden mit den Inseln Nonnenwerth und Grafenwerth. Larix folgte dem Rat des Vaters und wechselte auf die Gangseite, um einen Blick empor zur einstigen Burg Rolandseck zu werfen, von der nur noch ein Fensterbogen, Rolandsbogen genannt, ein Erdbeben überstanden hatte.
Vater kannte sich in dieser Gegend bestens aus. Aber er sprach eigentlich wenig über seine Jugend, seine Lehrjahre und überhaupt von der Zeit vor dem Krieg, die er in Bonn verbracht hatte. Einmal hatte er seinen Sohn mit nach Monschau genommen und ihm das Kolpinghaus gezeigt. Dort sei er häufig während seiner Lehre mit Kameraden gewesen. Aber wer waren diese Kameraden? Wo hatte der Vater überhaupt seine Lehre absolviert? Der Begriff „Borromäusverein“ wurde erwähnt. Der Junge hatte den Hinweis einfach zur Kenntnis genommen und es kam ihm nicht in den Sinn, Fragen zu stellen. Manchmal sprach der Vater von seinem Förderer und väterlichen Freund, wie er diesen Menschen nannte. Aber niemand in der Familie hatte den Mann je gesehen. Es fragte auch niemand nach. Die Lebensgeschichte des Vaters blieb unerzählt. Auch Mutters Geschichte fand selten Eingang in die familiären Unterhaltungen. Hinter der elterlichen Gegenwart breitete sich eine für Larix und seine jüngere Schwester unzugängliche Vergangenheit aus. Wurde über Familie und Verwandtschaft gesprochen, bewegten sich die Reden im anekdotischen Bereich. Man lebte in der Nachkriegszeit, ausgefüllt mit ihrer neuen Gegenwart. Die Vorzeit schien aus einer fragmentierten Realität zu bestehen, die einfach kein deutliches Bild ergab. Auch die älteren Geschwister sprachen kaum über ihre Vorkriegs- und Kriegszeit, besaßen ihre Kindheitserlebnisse, die an der Oberfläche ihres Daseins siedelten. Von englischen Besatzungssoldaten war die Rede und von ihrer Kantine, wo man ein Stückchen Schokolade erhaschen konnte. Immerhin hatte sich die Abneigung der Eltern den Nazis gegenüber deutlich mitgeteilt. Vater konnte sich bisweilen in Rage reden, wenn diese Zeit wieder einmal im Gespräch auftauchte.
Hinter Koblenz verengte sich das Rheintal. Der Fluss schlängelte sich in engen Windungen und wurde an beiden Ufern von steilen Hängen begleitet. An vielen Stellen zeigten sich kleine Felsvorsprünge. Langsam glitt der Waggon am Ufer entlang, schien an manchen Stellen Felswände zu streifen, in den Kurven kreischten die Räder. Verschiedene Tunnel nahmen allzu enge Radien aus der Strecke. Der Blick des Jungen haftete fasziniert an dieser wilden, mit Felsen durchsetzten Landschaft, entdeckte an den Hängen Gebäude inmitten terrassenförmiger Gärten. Und er beneidete die Menschen, die dort lebten, um diese schöne Landschaft, die immerzu um sie her war, während er vom Zug schon wieder weitergeführt wurde. Der Vater machte ihn auf Weinberge aufmerksam, die er aufmerksam betrachtete. An einigen Stellen reichten die vertikal gezogenen Rebenreihen dicht an die Gleise. Oberhalb des Ufers gegenüber erhob sich hell leuchtend auf einem bewaldeten Hügel die Marksburg. Überragt wurde die beeindruckende mittelalterliche Anlage von drei riesigen, eng beieinanderstehenden Schornsteinen. Errichtet Anfang des 20. Jahrhunderts, wusste der Vater. Die Ortschaft unterhalb der Burg hieß Braubach und in der Gegend wurde wohl seit der Römerzeit Silbererz, später bleihaltiges Erz abgebaut und verhüttet. Der schädliche Hüttenrauch wurde über Abgaskanäle den Berg hinaufgeführt und dann über die Schornsteine in die Luft abgegeben. Larix empfand den harten Kontrast zwischen Burg und Schornsteinen als eine Störung der Harmonien dieser Landschaft.
Der Zug arbeitete sich vor und durchfuhr Orte mit klingenden Namen wie Boppard, Sankt Goar, Oberwesel oder Bacharach. Vater kannte sie alle.
Gegenüber erhob sich der Felsen der Loreley und Vater zitierte Brentanos Ballade „Zu Bacharach am Rheine“, die eine Reminiszenz seiner Schulzeit war. Die Verse der ersten Strophe bekam er noch hin, dann zerbröckelte der Text und übrig blieb nur noch das eine oder andere Reimwort. Viel später würde Larix von Heinrich Heine hören, von der finsteren, alten Stadt Bacharach, wo man den Juden fingierte Ritualmorde in die Schuhe schob, um sie zu drangsalieren. Ja, das Rheintal hatte es in sich. Diese uralte Kulturlandschaft entrollte sich in immer neuen Bildern vor den gebannten Augen des Jungen. Und der Strom der Eindrücke wurde zur inneren Freude, die ihn durchfuhr wie der Zug dieses Land.
Es ging auf Bingen zu, vorbei am Mäuseturm auf einem Felsen mitten im Fluss. Der Sage nach hatte der grausame Bischof Hatto hier seine letzte Zuflucht gesucht. Doch er entkam nicht den Mäusen der Gerechtigkeit, die ihn bei lebendigem Leibe auffraßen. Bald fiel die Landschaft in die Plattheit und Flächigkeit zurück, die der Junge nur allzu gut kannte. Der Rhein verschwand aus dem Blickfeld, der Zug nahm wieder Fahrt auf und spulte monoton Kilometer ab. Wenn er einen entgegenkommenden Zug passierte, ließ der Luftdruck mit einem trockenen Wummern die Scheiben erzittern und den Waggon erbeben.
In Erinnerung blieb dem Jungen der Stuttgarter Hauptbahnhof, weil er ein Kopfbahnhof war, eine Bauform, die er noch nie gesehen hatte. Die Strecke hinauf zur Schwäbischen Alb breitete eindrucksvolle Landschaften aus. Die Geislinger Steige, sagte der Vater mit einer gewissen Hochachtung vor der mit engen Kurven und Tunneln gespickten Strecke. In Ulm wurde die E-Lok durch eine Diesellokomotive ersetzt für den restlichen, nicht elektrifizierten Streckenabschnitt nach Kempten.
***
Der damalige Kemptener Hauptbahnhof war ein kleiner Kopfbahnhof und befand sich kurz hinter der hohen Eisenbahnbrücke über die Iller, die auch ihr Zug überquert hatte. Vater und Sohn waren ausgestiegen und liefen langsam auf das Bahnhofsgebäude zu, erreichten die Galerie hinter den Prellböcken. In diesen ersten Momenten auf dem unscheinbaren Bahnsteig wurde im Bewusstsein des Jungen die Ankunft zur Ankunft in seiner Ferne, unendlich fern von jenem Jungen, der am frühen Morgen den Fahrplan auf dem Krefelder Bahnhof verschlang – die rot gedruckten Ziele vor Augen. Jetzt aber spürte er, dass hier eine Welt, seine Welt, ihren Anfang nahm. Eine helle Welt, die freundlich in sein Bewusstsein hineinblickte. Voller freudiger Erwartung lief er ihr entgegen, während er langsam den Bahnsteig hinunterging. Gewiss hätte er seine erwachende innere Welt auf Dauer mit Kempten und dem Allgäu verbunden, wenn ihn an jenem Tag der Weg nicht ein kleines, entscheidendes Stück weiter in ein winziges Dorf geführt hätte, um zu begreifen nach langer Zeit.
Vor ihnen begrüßte ein älterer Herr in kurzer Lederhose einen Reisenden, der mit ihnen den Zug verlassen hatte. Larix hatte noch nie einen erwachsenen Menschen mit einer Lederhose gesehen, die nicht einmal über die Knie reichte. Als Knabe hatte er eine kurze Lederhose getragen, aber ein Erwachsener? Offenbar ein Bewohner dieser Welt, die Larix gerade betrat. In einer Stunde ging es weiter mit dem roten Schienenbus nach Reutte. Sie verbrachten die Wartezeit in der Bahnhofsgaststätte, deren Innenausstattung aus so vielen Details bestand, denen der Junge staunend begegnete.
Die dunklen Holzvertäfelungen, die Holzstühle und Bänke, die klobigen Tische, die Malereien mit Hochgebirgsmotiven, die Gamskrucken und Hirschgeweihe an den Wänden. Und eine Kellnerin im Dirndl, die sie im Dialekt ansprach: „So, wos derf i eana bringa?“ Der Vater bestellte eine Tasse Kaffee und Larix fragte zaghaft nach einer Fanta. Der Vater wurde gesprächig und erzählte seinem Sohn, dass er nach dem Krieg fast eine Anstellung hier in Kempten bekommen hätte. Er habe schon die Zusage besessen, aber Mutter habe nicht weggehen wollen. Er habe nachgegeben und in einem kleinen Verlag und Druckhaus die Leitung der Buchbinderei übernommen. Warum hatte er nicht sein Projekt gegen den Willen seiner Frau durchgesetzt? Er wisse es nicht wirklich. Ihre Uneinigkeit hätte fast die Ehe gesprengt. Es gab andere Streitpunkte, doch dieser hatte ihrer Zweisamkeit einen gehörigen Schlag versetzt. Aber er war so schrecklich katholisch und voller Skrupel, die im Gewand der Verantwortung gekleidet waren. Eine Ehe musste unbedingt halten, allein schon der Kinder wegen, selbst wenn sie nur noch ein tristes Mosaik aus unzähligen notdürftig gekitteten Scherben war. Vater hatte schließlich klein beigegeben und seinen sozialen Traum begraben, den Traum des geachteten Bürgers in einer überschaubaren Stadt.
Während der Vater sprach, war es dem Jungen, als zöge dieser wundersam eine Welt aus dem Hut, die er bisher verborgen gehalten hatte und in der er sich mühelos zu bewegen schien. Vielleicht hatte er gespürt, dass ebendiese Welt, seine Evasion, die sonst niemanden in seiner Familie interessierte, ja die sogar bekämpft wurde, dieses seiner Kinder ansprach. Ja, vielleicht war dies das eigentliche Motiv, das ihn veranlasst hatte, den gemeinsamen Urlaub mit diesem Sohn, dem jüngsten seiner drei Söhne, zu verbringen. Es war die Hoffnung, dass aus den vielen Trümmern zerschlagener Wünsche und zermalmter Fantasie etwas wie eine tröstliche Blume erwachsen möge und er vielleicht selbst noch einmal zur Freiheit vordringen könne, die Schuhe der magischen Wanderung schnürend. Sein Blick musterte verstohlen diesen Jungen, der ihm immer wieder so unzugänglich erschien, so wenig mitteilsam. Manchmal glaubte er, in seinem Charakter die Kaltschnäuzigkeit der Mutter zu verspüren. Er ahnte, dass er selbst und seine Frau mit ihrem unglücklichen Eheleben voller Zwietracht und ewigem Streit ihre beiden Jüngsten zum Schweigen gebracht hatten. Sie waren verstummt und auf der Hut, anstatt sich ihnen vertrauensvoll zuzuwenden und ihr Herz zu öffnen. Und er hoffte, dass sein Kind ihn wenigstens an seinem Handeln erkennen möge, wenn es denn nicht mehr zum vertrauten Gespräch reichen sollte. Ja, er fühlte sich gerade diesem Kind gegenüber schuldig. Alle anderen schienen mit ihren Eltern abgeschlossen zu haben, aber auf dem Haupt dieses Jungen sah er die ganze Last ihres schlimmen Handelns versammelt und er wollte doch etwas tun, um die Bürde zu mindern, damit sie dem Kind nicht ein Leben lang wie die Kugelkette dem Sträfling am Bein geschmiedet bliebe.
Vor zwei Jahren hatte er den alten, sporadischen Kontakt mit seinem Freund aus Kempten wieder intensiviert. Vergangenes Jahr war er förmlich von zu Hause abgehauen, hatte zwei Wochen Urlaub bei seinem Freund verbracht. Sie waren häufig unterwegs gewesen bis nach Südtirol. Und der Freund hatte ihm das Lechtal gezeigt und eben jenes winzige Dorf in einem kleinen Seitental. Er war hingerissen, erkundigte sich nach Übernachtungsmöglichkeiten und fand ein einfaches Zimmer im Haus eines jungen Bergbauernpaares. Liebenswürdige Leute, ein glückliches Paar trotz aller harten Arbeit. Sie besaßen eine vierjährige Tochter und einen zweijährigen Sohn. Dieses Dorf strebten sie gerade an, dort wollten sie drei Wochen Urlaub verbringen. Als der Vater seinem Sohn den Vorschlag gemacht hatte, war dieser sogleich einverstanden gewesen. Die Vorstellung, hochalpine Touren zu machen, machte ihm keine Angst, im Gegenteil. Er war Touren aller Art gewohnt. Mit der Jugendgruppe machte er lange Fahrradtouren bis nach Holland.
Der Vater schlug vor, einmal in Kempten vorbeizuschauen, vielleicht während der Allgäuer Festwoche. Die sei wirklich sehenswert. Der Freund würde ihnen sicher die Stadt zeigen. Den sollte er überhaupt kennenlernen, das sei ein so lustiger und liebenswürdiger Mensch. Larix zeigte sich interessiert. Ein Blick auf die Uhr: Es war Zeit, zum Bahnsteig zu gehen. Der Zug werde wahrscheinlich mit Urlaubern gut besetzt sein. Und so war es. Inmitten von einem Berg aus Gepäckstücken aller Art ergatterten sie mit Müh und Not einen Sitzplatz ganz hinten im hinteren Wagen des aus drei Wagen bestehenden Schienenbusses. Natürlich wollte Larix stehen, nicht nur, weil es sich schickte, dem Vater den bequemen Sitzplatz zu überlassen, sondern wegen der besseren Rundumsicht, die er im Stehen genießen konnte.
Zu sehen gab es zunächst die sanft hügelige und grüne Landschaft des Ostallgäus mit ihren zahlreichen eingezäunten Weideflächen, einzelnen Höfen, kleinen Weilern und Dörfern. Überall, so schien es dem Jungen, standen Kapellen und Kirchen mit spitzen Türmen, wie er sie aus seiner Heimat kannte, oder mit alpenländischen Zwiebeltürmen. Gruppen träge grasender oder ruhender Kühe bevölkerten die Wiesen. Die Tiere besaßen ein hellbraunes, manchmal auch ein graues Fell im Gegensatz zu den schwarz-weißen Tieren daheim, die als schwarzbunte Holsteiner bezeichnet wurden. Da und dort konnte man schon einen Blick auf das Hochgebirge erhaschen, das noch sehr fern zu sein schien. Vater deutete auf eine markante, nicht allzu weit entfernte Erhebung. Das sei der Grünten, der Hausberg der Kemptener. Bundesstraße und Schienenstrang der einspurigen Bahnstrecke kreuzten sich mehrfach. Larix verstand den Unterschied zwischen Bahnhöfen und Haltepunkten. Letztere besaßen keine zusätzlichen Gleise und Weichen, sondern der Zug hielt einfach auf dem einzigen Gleis an. Kühe hätten übrigens Vorfahrt, scherzte der Vater, als der Zug inmitten einer Wiese anhielt. Ein geschotterter Streifen diente als Bahnsteig.
***
Der Schienenbus erreichte das Ende der grünen Hügellandschaft. Hinter Pfronten passierten sie die Grenze. Die Hügel verwandelten sich in bewaldete Kuppen, erste Felsen tauchten auf. Nachdem der Haltepunkt Ulrichsbrücke erreicht war, drangen sie langsam ins Innere der alpinen Welt vor. Mit einem Mal ragten wie aus dem Boden gezaubert zunächst spärlich und in einiger Entfernung hellgraue Felsmassive empor. Sie rahmten den flachen Talboden, der mit Wiesenflächen, kleinen Dörfern und verstreuten Holzhütten besetzt war. Zwischen dem hellen Grün des Tals und dem hellen Grau der Felsen hoch oben in der Gipfelzone breitete sich ein dunkelgrüner Gürtel aus Bäumen. Und als Larix seinen Vater fragte, wie denn Bäume auf fast senkrechten Flächen hoch oben wachsen könnten, erklärte ihm der Vater, dass dies keine Bäume mit Stämmen mehr seien, sondern sogenannte Latschen oder stammlose Bergkiefern, die noch höher als Bäume siedelten. An einigen Stellen blinkten in den Felsen kleine weiße Flächen, die der Vater als Schneefelder bezeichnete. Und als er hinzufügte, dass sie auf ihren Wanderungen noch an so manchem Schneefeld vorbeikommen würden oder es gar überqueren müssten, schlug das Herz des Jungen erwartungsvoll. Schnee mitten im Hochsommer – welch eine aufregende Vorstellung. Der Zug näherte sich seinem Ziel. Die Felsmassive waren zahlreicher und höher geworden, zugleich mündete das Tal in einen weiten Talkessel.
Da war der Reuttener Bahnhof, wo der kleine Strom der Touristen dem Zug entstieg und sich langsam durch das Bahnhofsgebäude auf den Vorplatz wälzte. „Jetzt sind wir in Tirol“, verkündete Vater mit fester Stimme, als wollte er mit diesem Satz etwas Aufrechtes zum Ausdruck bringen, so dauerhaft wie gewachsener Fels. Schon nahte der Postbus, ein echter Saurer, von Steyr in Lizenz gebaut, ein cremegelber Dinosaurier, mit einer riesigen Motorhaube, unter der ein Sechs-Zylinder-Dieselmotor werkelte, der 125 PS entfachte und maximal 80 km/h ziemlich qualmender und ohrenbetäubender Geschwindigkeit auf die Straße brachte.
„Das ist unser Bus“, rief der Vater. Als das Gefährt vor ihnen stand, bemerkte Larix auf der Seitenwand ein Wappen, einen wild dreinblickenden Adler, mit einer riesigen Zunge wie eine Flamme und mit einer goldenen Stadtmauer auf dem Kopf. Er hielt einen goldenen Hammer und eine goldene Sichel fest in den Klauen, und eine Kette, die seine beiden Fänge wie die Beine eines Sträflings gefesselt hatte, war zerbrochen. Was mochte mit diesem spannungsvollen Symbol gemeint sein? Das müsse das österreichische Staatswappen sein, erklärte der Vater. Aber die genaue Bedeutung der Symbolik wusste er auch nicht. Die zerbrochene Kette bedeute wohl das Ende der nationalsozialistischen Tyrannei.
Der Fahrer schaltete den Motor aus und kletterte die Stufen des vorderen Einstiegs hinunter, verschloss die Tür, öffnete mit einem Vierkantschlüssel die beiden Klappen des großen Kofferraums, in dem die Gepäckstücke der Reisenden verschwanden. Wer früher ausstieg, achtete darauf, dass sein Gepäck zuletzt verladen wurde. Vater und Sohn verstauten ihre beiden Rucksäcke und Koffer in der Mitte. Als das Gepäck an Bord war, setzte sich der Fahrer an seinen Platz und die Reisenden betraten einer nach dem anderen den Bus. Nachdem sie ihre Fahrscheine gelöst hatten, begaben sich die beiden nach hinten und fanden tatsächlich noch zwei freie Sitzplätze. Den Fensterplatz bekam Sohnemann, das war doch klar. Allmählich hatten sich alle an ihren Plätzen eingerichtet und es trat erwartungsvolle Stille ein. Plötzlich erwachte der Motor zu seinem explosiven Leben, an dem er alle Reisenden teilnehmen ließ, sowohl mit seinem auf- und abschwellenden Knurren als auch mit dem Vibrieren und Rütteln, das ihre Sitze zittern ließ und die Fahrgäste durchschüttelte. Und los ging die Fahrt.
Da war der Lech, den sie zweimal überquerten. Sein strömendes Wasser war hellgrün, mit vielen kleinen schimmernden Kronen und floss in einem breiten Geröllbett, das seine Mäander nicht ausfüllten. „Wenn er Hochwasser führt, nimmt er die ganze Breite seines Bettes ein und seine Farbe ist schmutzigbraun, weil er Erde mit sich führt, die ihm seine Zuflüsse aus den Hochtälern liefern“, bemerkte der Vater.
Offenbar beherrschte der Bus alle möglichen Fahrweisen, außer einer ruhigen Geradeausfahrt. Denn kaum kam er auf einem geraden Stück zur Ruhe, schwoll schon wieder die Motorbremse an. Der Fahrer trat beherzt aufs Bremspedal und legte den Bus in die Kurve, aus der das Gefährt vom Motor wütend beschleunigt wurde, um das nächste gerade Stück anzugehen. Es war mehr ein Ritt, denn eine Fahrt. Und man wusste nicht, ob der Lärm den Reisenden die Sprache verschlagen hatte oder das wüste Fahrgeschehen, das sich um sie her abspielte und aus dem es kein Entkommen gab. Man war dem Busfahrer und seinem Gefährt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Früheren Kutschenreisenden mochte es ähnlich ergangen sein. Larix schaute und schaute, während sich der Bus von Dorf zu Dorf vorarbeitete, immer tiefer ins Haupttal hinein. Das Tal nahm eine gewisse Enge an. Zu beiden Seiten rückten die Berge immer näher, so schien es ihm, ja sie wuchsen aus dem flachen Wiesengrund des Tals jäh empor. An manchen Stellen schien ein Berg am Rand einer Wiese gegenüber zu fußen und in greifbare Nähe zu rücken. Langsam leerte sich der Postbus, denn an jeder Haltestelle stiegen ein paar Feriengäste aus, kaum jemand aber stieg zu. Bei jedem Halt musste auch der Fahrer aussteigen und die Klappe des Gepäckraums öffnen. Den Motor ließ er derweil laufen, um ohne Zeitverlust gleich weiterzufahren.
Da war der kleine Talort Elmen, etwa zur Hälfte des Tals. Dort hielt der Bus mitten im Dorf, direkt neben einem Gasthof mit Namen „Kaiserkrone“. Vater und Sohn stiegen aus. Der Fahrer öffnete das seitliche Gepäckfach und sie nahmen ihre Rucksäcke und Koffer entgegen. Sie betraten das Gasthaus und blickten in den Gastraum, der gesteckt voll mit Menschen war. Ihre lebhaften Unterhaltungen erfüllten den Raum. Diese Gaststube war der erste Innenraum, den Larix in dieser Welt betrat. Die vielen Menschen, die junge, mit einem Dirndl wie ihre Kollegin in der Kemptener Bahnhofsgaststätte gekleidete Frau, die sich von Tisch zu Tisch bewegte, Bestellungen entgegennahm, leere Gläser und Geschirre wegräumte, gefüllte Gläser und Teller herbeischleppte. An einem Ecktisch saßen drei Einheimische, die an ihren einfachen Tirolerhüten zu erkennen waren, ansonsten jedoch einfache Arbeitskleidung trugen. Sie schienen ihre graugrüne Joppe ebenso wenig auszuziehen wie die niederrheinischen Bauern. Trachten, wie Larix sie von Bildern oder aus kitschigen Filmen kannte, gab es keine zu sehen. Die sollte er erst später kennenlernen, als er Bekanntschaft mit dem Festkalender dieser Welt machte.
Die Dialekte, alle miteinander oberdeutsch, doch zugleich unterschiedlich, die sich wechselseitig umflossen – das Leben der Ferne schien sich in dieser einen Stube versammelt zu haben und Larix in Empfang zu nehmen, ohne ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Er war einfach in einem Geschehen angekommen, hatte sich dazugesellt, noch ohne etwas davon zu verstehen. Doch er spürte, dass dieses Leben in seinem innersten Wesen freundlich und heiter war.
Vater hatte den Wirt entdeckt, fragte ihn, ob er telefonieren könne. Der Gasthof besaß in der Tat das einzige öffentliche Telefon des Dorfes. Nach einem kurzen Gespräch sagte er zu Larix, dass sie in einer guten halben Stunde abgeholt würden. Die letzte Etappe über zehn Kilometer und von 1000 Metern Höhe auf über 1300 Meter Höhe stand bevor. Es lohnte sich nicht mehr, sich an einen Tisch zu setzen, es gab ohnehin keinen freien Platz. So warteten sie vor dem Gasthaus. Der Vater setzte sich auf die Holzbank direkt neben dem Eingang, Larix betrachtete die Umgebung. Letzte Sonnenstrahlen beleuchteten die lange, leicht abfallende Dorfstraße. Ein kleiner Traktor mit rotem Chassis tuckerte vorbei und bog von der Straße ab, am Steuer saß ein jüngerer Bauer.
Nach einer guten halben Stunde näherte sich ein weiß-roter VW-Bus und fuhr auf den kleinen Parkplatz neben dem Gasthof. Ein groß gewachsener, knochiger Mann mittleren Alters stieg aus und begab sich zur Eingangstür. Vater sprach ihn an, ja, es war Albert, der sie abholen sollte. Albert war Gastwirt und sie würden in der Regel in seinem Gasthof frühstücken und zu Abend essen. Sie begrüßten sich und Larix wurde zum ersten Mal im Dialekt dieser Welt angesprochen, der in seinen Ohren einen angenehmen Klang besaß. Lange sollte er auf Hochdeutsch antworten, bis er allmählich selbst in diesen Dialekt verfiel, den er zwar nie fließend sprechen sollte, aber doch ausreichend gut. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass er über viele Jahre im Dialekt-Flickenteppich dieses Sprachraums unterwegs sein sollte und er von allen Seiten beeinflusst wurde, mal bayerische Aussprache, mal schwäbische, mal alemannische, mal Tiroler oder gar Südtiroler Klänge und eben hier die Mundart der Menschen des Lechtals.
Albert verlud ihr Gepäck in der Ablage über dem Heckmotor und bot den beiden die Beifahrerplätze an, denn der Wagen besaß auch vorn eine durchgehende Sitzbank. Er nahm am Steuer Platz, startete den Motor und fuhr los. Der Höhenunterschied von über 300 Metern, der den Talort vom Dorf trennte, wurde fast im ersten Aufschwung bewältigt, auf einer steilen Rampe an einer Felsmauer entlang. Das ging am besten mit einem ordentlichen Anlauf unten auf der Talsohle zum Dorf hinaus durch die Wiesen und dann im dritten Gang, gewissermaßen abgehoben wie ein startendes Flugzeug, links senkrechte Felswände, aus denen die Straße herausgesprengt worden war, rechts zügig wachsende Abgründe und zugleich tat sich ein wunderschöner Blick auf das Tal mit seinem Fluss auf. Im oberen Drittel der Steigung schaltete Albert in den zweiten Gang zurück. Am Übergang in eine scharfe Linkskurve wechselte er in den ersten Gang, was der Motor mit einem kurzen Aufheulen quittierte. Doch gleich hinter der Kurve wurde die Straße flacher und das Auto nahm wieder Fahrt auf. Die fast durchgehend einspurige Bergstrecke mit schmalen Holzbohlenbrücken und eng um die Felsen geführten Kurven absolvierte Albert zügig, mit der ganzen Routine des Einheimischen. Es herrschte auch kein Gegenverkehr bis auf einen Pkw, der rechtzeitig eine Ausweichstelle aufsuchte, sodass sie ungestört durchfahren konnten. Sie erreichten ein kleines Dorf, dessen Gebäude sich an steile Grashänge klammerten. „Bschlabs“ stand auf dem Ortsschild. Der Junge dachte amüsiert, wie viele Konsonanten in einer Silbe das kleine „a“ umgaben. Und er fragte Albert, wie denn die Bewohner von Bschlabs hießen. „Die hoaßen Bschlaber“, antwortete dieser, indem er dem „a“ einen leichten dumpfen Klang gab, der fast einem „o“ ähnelte. Schon nahm Albert wieder Fahrt auf und es ging an der kleinen Kirche mit Zwiebelturm rechter Hand weiter, immer tiefer in das enge Tal hinein. Hinter einer Haarnadelkurve stieg die Straße noch einmal steil an. Für einen Augenblick fiel der Blick zurück über das unsichtbare Lechtal hinweg gegen eine markante Gebirgskette. Schon bog die Straße nach links in kleinen Kurven eng an Felsen entlang, bis sich mit einem Mal vor ihnen und weiter unten ein kleiner, grüner Talboden mit einer Häusergruppe und einem Kirchlein zeigte. Eine winzige Bergbauernsiedlung, eng gefasst von steilen Gebirgen, deren unterer Teil bewaldet war. Das also war der Ort „Boden“. Und Larix leuchtete unmittelbar ein, dass mit dem Ortsnamen der Talgrund gemeint war, am Ende der Welt.
Es war Abend und das Dorf lag schon im Schatten, denn auf der Westseite erhob sich in unmittelbarer Nähe ein steiler, mit Latschen bewachsener Bergkegel, hinter dem die Sonne auch im Hochsommer früh versank. Albert bog in die Hauptstraße ein, die eigentlich nicht mehr als ein befestigter Fahrweg war. Zu beiden Seiten standen die Häuser der Dörfler, die damals überwiegend ihre hochalpine Viehwirtschaft betrieben. Feriengäste traten ohne Hast an die Seite und Albert bahnte sich vorsichtig eine Passage. Vor dem Haus von Reinhold und Lydia hielt er an. Lydia trat vor die Tür, erkannte Larix’ Vater, erkundigte sich nach dem Namen des Sohnes und begrüßte Larix. Man wechselte ein paar freundliche Worte. Schließlich stieg Lydia die schmale Treppe zum Obergeschoss empor und zeigte ihnen ihr Zimmer. Die Decke und die Wände waren mit Fichtenholzprofilen getäfelt. Knarrende Holzdielen bildeten den Boden, vor dem Doppelbett lagen einfache Flickenteppiche. Ein geräumiger Bauernschrank, ein Tischlein mit zwei Stühlen und zwei kleine Nachttische mit Schirmlampen vervollständigten das schlichte Inventar. An der Wand über dem Kopfende des Bettes hing ein geschnitztes Kruzifix. Ein mit Blumenmotiven besticktes Leinendeckchen lag auf dem Tisch, den eine Vase mit zwei Latschenzweigen schmückte. Zwei kleine Doppelfenster sorgten für etwas Tageslicht. Eine einfache Toilette, Dusche und Waschbecken befanden sich am Ende des schmalen Flurs gegenüber. Versteckt im kleinen Gebäude und mit der Rückwand zum Heuschober lag ihr Gästezimmer. Einen Steinwurf weit unterhalb strömte der Fundaisbach in seinem wüsten Bett aus Felsbrocken und Geröll.
***
In den 1960er-Jahren erlebten die Bergbauern einen wahren Ansturm von Gästen aus dem Allgäu und dem Schwäbischen. Mit Kind und Kegel nahmen Familien das Dorf in Beschlag. Auf der einzigen Dorfstraße herrschte ein entspanntes Kommen und Gehen, ein freundliches Treiben. Die Bauern vermieteten einfache Gästezimmer. Die Terrassen, Säle und Stuben der beiden Gasthöfe – einer am oberen Ende des Dorfes, der andere am unteren Ende – waren dicht besetzt. Und die Sonnenschirme trugen Namen, denen Larix zum ersten Mal begegnete: Gösser, Kaiser, Zipfer. Bezahlt wurde in Schilling und Groschen. Larix hatte schnell den Wechselkurs im Kopf: eins zu sieben. Für eine D-Mark erhielt man sieben Schilling. Die Zehn-Schilling-Münze wog schwer in der Hand.
Die Einheimischen selbst zeigten sich tagsüber eher selten. Sie gingen ihrer Arbeit nach, hatten oben am Berg zu tun. Auch ihre Kinder ließen sich nicht blicken, sie mussten in den Sommerferien den Eltern den ganzen Tag bei der Arbeit helfen. Anfangs suchte Larix vergebens einen Bauernhof, weil er eine ganz andere Vorstellung mitbrachte. Die Bauernhöfe seiner Heimat waren Gehöfte mit großen Scheunen und Ställen. Alle Gebäude besaßen ein festes Mauerwerk aus braunroten Ziegelsteinen und waren mit Tondachziegeln gedeckt. Große grün gestrichene Holztore, zumeist Schiebetore mit Eisenrollen auf schweren Eisenschienen, bildeten den Scheuneneingang. Im Inneren gab es hohe Heuschober, in denen er als Kind oft gespielt hatte. Zum Gehöft gehörte eine Obstbaumwiese mit Hühnern, Gänsen oder Enten. Die Bauern waren Landwirte und bewirtschafteten große Felder, bauten Korn, Kartoffeln und Rüben an. Sie besaßen eingezäunte Weiden für ihre Kühe und nicht wenige hatten einen Schweinestall mit einem Dutzend Tieren und mehr. Hier aber waren die Höfe winzig. Nur das Erdgeschoss bestand aus verputztem Mauerwerk – Ziegelsteine gab es nicht. Das Obergeschoss und die restlichen Gebäudeteile waren aus Holz. Überhaupt schien das ganze Dorf überwiegend aus Holz gebaut zu sein. Öffentliche Gebäude gab es zwei: eine winzige Grundschule mit einem Klassenraum und einer kleinen Lehrerwohnung im Obergeschoss sowie ein Kirchlein ohne Widum, denn man hatte es nicht zu einer Pfarrstelle gebracht.
In jenen Tagen, zwanzig Jahre nach Kriegsende, begegnete Larix der letzten Bergbauerngeneration, was er nicht wissen konnte und auch nicht ahnte. Es entstanden Kontakte mit den Dorfbewohnern. Da waren seine Hausleute, Lydia und Reinhold, die herzlich und aufgeschlossen waren. Lydia besaß ein fröhliches Wesen, ähnlich wie ihre Nachbarin schräg gegenüber, die Burgel, die zusammen mit ihren beiden Brüdern Oswald und Balthasar einen Drei-Geschwister-Hof führte. Frühstück und Abendessen nahmen Vater und Sohn regelmäßig im oberen Gasthof ein. Albert bediente zusammen mit seinem jüngeren ledigen Bruder Simon in der Gaststube. Simon war ein leutseliger Mensch und immer zu einem Scherz aufgelegt. Er verfügte über einen unerschöpflichen Fundus humorvoller und hintergründiger Bemerkungen, während Albert eher zurückhaltend war. Seine Frau Paula hatte reichlich in der Küche zu tun und ließ sich kaum blicken.
Xaver und Gertrud, die Eltern der beiden Brüder, wohnten in einem kleinen Haus gegenüber. Xaver war ein kauziger und hintersinniger Mensch mit einer Zipfelmütze, die mit seinem Kopf verwachsen zu sein schien. Er besaß eine quiekende Stimme und betrieb einen kleinen Gemischtwarenladen. Zur Eingangstür ging es zwei Stufen hinunter und man musste aufpassen, um sich nicht den Kopf am schweren Türbalken zu stoßen. Gleichzeitig galt es, die hölzerne Türschwelle zu überwinden, und zwar ohne zu stolpern. Gertrud erschien hinter der kleinen Theke und bediente die Kunden. Larix mochte diese liebenswürdige und stille Frau und sollte sich bei ihr so manche Tafel Milka Vollmilchschokolade holen.
Im Haus gleich unterhalb von Alberts Gasthof lebte der Bauer Betto, der ledig geblieben war wie sein verstorbener Bruder, mit dem er gelebt hatte. Abends kam er häufiger in die Gaststube, setzte sich an seinen Platz neben der Ofenbank und trank sein Viertele Roten. Alle wussten, dass er diesen Platz als seinen Stammplatz betrachtete. Albert achtete darauf, dass dieser Platz stets frei blieb. Wenn Betto sprach, schien er zugleich zu quäken. Seine fistelige Stimme hatte etwas Knatschiges und ähnelte der von Xaver.
Auch die verwitwete Bäuerin Agnes zählte zu den Menschen, die Larix damals bemerkte. Andere Bewohner erlebte er gar nicht oder nur aus der Ferne, wie Reinholds älteren Bruder, den Bergbauern Paul und seine Frau Lea, oder Fabio, den Wirt des unteren Gasthofs. Und manche schienen so zurückgezogen zu leben, dass der Junge sie gar nicht wahrnahm.
Larix begegnete all diesen Menschen respektvoll, nicht nur, weil er ein wohlerzogener Junge war, sondern weil er wirklich beeindruckt war von diesem Menschenschlag, der so ganz anders war als die Menschen seiner kleinen Heimatstadt. Hier herrschte eine komplett andere Kultur mit einer Ausstrahlung, die ihn berührte. Die äußere Gestalt der Menschen verschwand wochentags im Arbeitskittel und eigentlich schauten nur die von der schweren Arbeit groben Hände hervor und die von Wind und Wetter in Falten gelegten Gesichter. Larix kannte die Gesichter seiner Eltern. Wie oft hatte er ihre Züge und ihren Ausdruck gesucht und sich eingeprägt. Aber schon bei den anderen Familienmitgliedern und erst recht bei den vielen außenstehenden Menschen war die Intensität der Wahrnehmung längst nicht so tief in ihn gedrungen. Hier aber erschienen ihm die Gesichter der Menschen so unmittelbar und nah wie nie zuvor. Vielleicht spielte die räumliche Enge des Dorfes eine gewisse Rolle. Larix las in den Gesichtszügen und Augen dieser Menschen eine ihm unbekannte Grundstimmung, die diese Menschen untereinander verband. Zum ersten Mal wurde ihm die Unmittelbarkeit einer Gemeinschaft zuteil, die man Dorfgemeinschaft nannte.
Die Lebhaftigkeit der vielen Gäste trug zum Eindruck bei, dass hier eine intensive Öffentlichkeit herrschte und Dörfler wie Gäste gern miteinander sprachen, wann immer sich eine Gelegenheit bot. Bisweilen „schwäbelte“ es laut und ausgiebig, gern in Alberts Gaststube zur fortgeschrittenen Stunde. Das Dorf machte überhaupt einen gesprächigen Eindruck, was vielleicht daran liegen mochte, dass die Bewohner ihre Häuser beidseitig entlang der einzigen Straße hatten und man sich zwangsläufig einander auf dieser Straße begegnete. Das nachbarschaftliche Dasein hatte es allein schon räumlich nicht allzu schwer, sich zum Ausdruck zu bringen. Doch der Junge spürte, dass diese Nachbarschaft anders war als die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den Familien seiner Straße. Hinter ihr verbarg sich eine enge Gemeinschaft, von der er keine Vorstellung besaß.
Anfangs bekam er vom Leben der Dorfbewohner und insbesondere von der Arbeit der Bergbauern kaum etwas mit. Allerdings wurde ihm bewusst, dass diese Menschen hart arbeiten mussten. Das sich über den Sommer hinziehende Heumachen auf den Mähwiesen und in den hoch gelegenen Mähdern nahm die Bauern stark in Anspruch. An den Sonntagen und hohen Feiertagen versammelten sich die Bewohner zum Gottesdienst in der Kirche. Die Männer begaben sich traditionell auf die Empore mit einer kleinen Orgel, die leider niemand mehr spielte und die längst völlig verstimmt war. Die Frauen und Kinder nahmen unten in den Bänken Platz. Alle trugen ihr Sonntagsgewand und redeten in so tiefem Dialekt, dass Larix kein Wort mehr verstand. Es waren nicht nur die Laute als solche, sondern auch die vielen bergbäuerlichen Begrifflichkeiten mit ihren Zusammenhängen, die sich als Sprachbarriere auftürmten. Nein, diese Menschen hatten es nie für erforderlich gehalten, ihre Welt und ihre Worte ins Hochdeutsche zu übertragen. Und selbst der Pfarrer, der von Amts wegen verpflichtet war, die liturgischen Texte entweder in der deutschen Hochsprache oder in der lateinischen Sprache zu sprechen sowie in der Hochsprache zu predigen, gab sich keine Mühe, die dialektische Einfärbung seiner Aussprache zu verbergen. Im Gegenteil. Man spürte, dass er nach der Messe nicht nur sein Messgewand ablegen würde, sondern auch die Hochsprache, um mit seinen Schäfchen in der Sprache zu kommunizieren, die ihnen wirklich vertraut war, in ihrem Dialekt. Auch die Feriengäste mochten von ihren Mundarten nicht lassen. Vielleicht nahmen sie Urlaub von der Hochsprache, die in vielen Bereichen ihres Alltags unverzichtbar war. Alle verstanden die Hochsprache, nur bestanden kaum Anlässe, sie in den Mund zu nehmen. Die beiden Gasthäuser waren ständig gut gefüllt, am Wochenende sogar überfüllt, weil zahlreiche Tagesgäste aus dem Allgäu ins Dorf strömten. Mancher Gast musste sich gedulden und anstehen, bis wieder ein Tisch frei wurde. Im Bewusstsein des Jungen formte sich das Bild angenehmer Lebendigkeit. Das Dorf schien in einer Wolke der Gesprächigkeit zu schweben. Und sein Geschehen floss zu einem zeitlosen Strom ineinander. Chronometrische Zeiteinteilungen schienen den Alltag der Menschen nicht zu beherrschen. Die Sommergäste waren froh, nicht ständig die Uhr im Auge behalten zu müssen. Die Dorfbewohner hatten es nicht für nötig befunden, den kleinen Kirchturm mit einer Uhr zu versehen. Einen Wetterhahn benötigte man auch nicht. Stattdessen schloss ein einfaches, immerhin vergoldetes Kreuz auf einer vergoldeten Kugel die Spitze des quadratischen Kirchturms ab. Im Turm läutete eine kleine Glocke, deren Klang aus kaum zwanzig Metern Höhe das ganze Dorf erfüllte.
***
Vor ihnen dehnte sich das steile Schuttfeld aus gelbem Fleckenmergel und grobem Blockwerk unterhalb der engen Scharte. Einige verrostete Drahtseile am Boden, da und dort steckte ein alter Ringanker im Felsen. Rote Farbmarkierungen wiesen den Weg. Diese Passage war einfach durch und durch brüchig und in ständiger Bewegung. Im Juni, wenn die Alpenvereinshütte auf die Neueröffnung vorbereitet wurde, ging die Jugendgruppe der Sektion auch die Steige ab, um sie instand zu setzen. In diesem Anstieg zur Scharte mussten regelmäßig von der Schneeschmelze fortgetragene Markierungssteine wieder an ihren Platz gerückt werden oder – wenn sie verloren waren – durch neue markierte Steine ersetzt werden. Aber da waren die Spuren der Bergsteiger. Sie wiesen den wohl gangbarsten Weg zur Scharte empor, ein fast unsichtbarer, sich durch Geröll und über brüchige Felsstufen schlängelnder Steig. Vater kämpfte sich höher, hielt immer wieder inne und keuchte: „Kurze Stehpause!“ Larix, dessen junger Puls kaum schneller ging, blieb geduldig stehen, musterte die vor ihnen liegenden Passagen. Das Terrain war in der Tat ungemütlich, man musste wirklich trittsicher sein. Immerhin war es trocken, seit Tagen hatte es nicht geregnet. Bei Nässe verwandelte sich der Mergel in eine schmierige Rutschbahn und setzte sich im Profil der Bergschuhe fest. Vater benutzte einen Bergstock. Der Junge fand eine derartige Gehhilfe unter seiner jugendlichen Würde.
Unter ihnen breitete sich der riesige grüne Kessel des Hochtals, der von einem Gipfelhalbrund eingefasst wurde. Die Gipfel schickten kegelförmige, riesige Geröllhalden talwärts, aus denen die Gesteinsmassen der zerklüfteten Felsformationen emporragen. Das Grün des Talgrundes war übersät mit mächtigen Felsbrocken, die daran erinnerten, dass die Vegetation hier nur geduldet war und sich ihren Platz immer wieder neu erkämpfen musste. Vier Gipfel ragen besonders hervor: im Nordosten beginnend die Reichspitze, im Südosten die Schlenkerspitze, im Süden die markante Dremelspitze und schließlich im Westen die Parzinnspitze mit ihrem markanten Plattenpfeiler. Die Pflanzen hatten sich beharrlich emporgearbeitet und schließlich den Grund des Kessels mit ihrem Teppich überzogen und in Besitz genommen. Da und dort grasten Rinder – allein oder in kleinen Gruppen. Larix hatte schon mitbekommen, dass diese Tiere keine Milchkühe waren. Reinhold hatte ihm erklärt, dass es sich um Galtvieh, also junge Rinder im Alter bis zu drei Jahren, handelte. Andere Tiere hatte er Trockenvieh genannt. So wurden Milchkühe bezeichnet, die sich in der etwa zwei Monate dauernden Pause der Milchproduktion vor dem nächsten Kalben befanden. Deshalb gab es im Parzinn keine Alm.
Vater und Sohn wanderten in einem weiten Bogen der Scharte entgegen. An verschiedenen Stellen waren die winzigen Farbtupfer bunter Anoraks von Bergwanderern erkennbar. Sie waren unterwegs zu einem Gipfel oder einer Hütte. An schönen Tagen herrschte im Parzinn viel Betrieb. Die Hanauer Hütte war Ausgangspunkt zahlreicher Steige in allen Richtungen.
Unterhalb der Scharte legte der Vater eine Stehpause ein und musterte den steilen Anstieg. Dann setzte er sich wieder in Bewegung und arbeitete sich mühsam empor. Einmal rutschte ihm der linke Fuß weg, ein kleiner Schrecken, Gleichgewicht wiedergewonnen, nichts passiert. Sie befanden sich in unmittelbarer Nähe der Scharte. Vater und Sohn erklommen die letzten Meter und betraten den schmalen Felsenrücken. Geschafft. Erstes grandioses Panorama der heutigen Tour und Ausgangspunkt einer Panoramawanderung über den lang gezogenen Südrücken der Kogelseespitze, die sie als Tagesziel anstrebten. Sie machten eine ausgiebige Rast. Hier entstand ein Foto, das später in der Familie noch eine gewisse Berühmtheit erlangen sollte. Es zeigte den alten Herren bestens gelaunt, gelöst und heiter, umgeben vom Himmel und seinen geliebten Bergen, vom Stolz auf seine eigene Leistung durchdrungen. Die Körpersprache, sein Mienenspiel – eine vollkommen unbekannte Seite dieses Menschen, dessen Alltag aus zäh fließender Unterdrückung bestand und dessen Gesicht kaum ein Lächeln entsprang.
Weiter ging es über den sanft ansteigenden Rücken, Brüder, zum Gipfel, zur Freiheit. Ein letzter Aufschwung, ein paar felsige Stufen. Geschafft. Der Vater entbot seinem Filius ein kerniges „Berg Heil“. Sie drückten sich die Hand. Vater hatte sein heutiges Dach der Welt in über 2600 Meter Höhe erklommen. Und es war nicht ausgeschlossen, dass er in diesem Moment – als Nebengefühl seines Hochgefühls – allen Agenten seiner alltäglichen Ohnmacht eine über 2600 Meter lange Nase drehte. Gleichwohl zeigte sich die Bergwelt von ihrer schönsten Seite, ein fast azurblauer Himmel wölbte sich über nahe und ferne Gipfel, während sich die Falten der Täler in den Tiefen der Felsmassen zu verlieren schienen. Vater meinte, es gebe noch viele Touren in diesem Gebiet. Als sie sich schließlich im wahrsten Sinne des Wortes sattgesehen hatten an all dieser Herrlichkeit, trugen sie sich in das Gipfelbuch ein und machten sich an den Abstieg. Sie nahmen ein wenig von der Hochstimmung mit hinunter ins Tal, in das sie Stunden später sanft eintauchten, während um sie her die Zeichen menschlicher Gegenwart immer zahlreicher wurden. Schließlich erblickten sie das Dorf auf der gegenüberliegenden Bachseite, überquerten die Brücke aus groben Holzbohlen und erreichten die Dorfstraße, auf der zu dieser frühen Abendstunde zahlreiche Gäste ihren Quartieren oder den beiden Gasthäusern zustrebten.
***
Nach dem Abendessen streifte Larix gern in Turnschuhen in der Nähe des Dorfes umher. Es war noch früh am Abend und er näherte sich dem Bach, dessen gießendes und sprudelndes Wasser eine wundersame Geräuschglocke erzeugte, die, als er in das steinige Bachbett geklettert war, alle anderen Geräusche abwies. Jetzt hörte und sah er nur noch diesen Strom mit seinen in vielfältige Laute gehüllten Bewegungen. Die unbändige, schäumende Kraft zog unwiderstehlich den Blick auf sich. Larix bewegte sich im Bachbett, sprang von Stein zu Stein. Immer wieder hielt er nach Engstellen Ausschau, an denen er den Sprung auf die andere Bachseite versuchen konnte. An den Stellen, wo schwere, vom Wasser geglättete Felsbrocken sich eng gegenüberstanden, schnürten sie den Wasserstrom zusammen, der schmaler und zugleich tiefer wurde und eine unheimliche Gewalt ausstrahlte. In einem Gespräch hatten die Hausleute etwas vom Bluatschink erzählt, der angeblich unten im Lech hauste. Und wenn dieser Flussdämon auch hier oben auftauchte – aus den verborgenen Falten dieses Baches? Wer wusste schon, wie weit sich die Adern seines strömenden Reiches erstreckten? Dieser Bach besaß in seinem Unterlauf entlang des Dorfes ein vergleichsweise riesiges Bett, das jetzt im Hochsommer eine trockene Geröllwüste war. Wie mochte der Bach im Frühjahr aussehen?
Hoch oben flammten die Grate in den Strahlen, die von der untergehenden Sonne über einen westlich gelegenen Sattel geschickt wurden, während talauswärts über dem Geröllbett des Streimbachs ein paar dünne Nebelschleier träge lagerten. Alles schien enger zusammenzurücken, Häuser, Wiesen, Wälder und Felsen, und sich zu einer kompakten Wirklichkeit zu verdichten, die ihm wohl gesonnen erschien, zugleich jedoch ernst und unerbittlich ehrlich. Mit dieser Welt ließ sich weder spielen noch konnte man sie betrügen. Sie schien ungeheuer wahr zu sein, alles andere konnte in ihr nicht Bestand haben. Wenn du jetzt diesen Stein da verfehlst, dachte er, dann bekommst du ein Problem. Der Bach ist so stark, dass er dich mitreißt, zumindest wirst du dir schwere Schürfungen einfangen. Schließlich führte ihn die Risikoabwägung zum Entschluss, den Sprung an dieser Stelle nicht zu wagen, sondern einen anderen Übergang zu suchen. Dabei bewegte er sich bachaufwärts und näherte sich langsam dem mächtigen, vielleicht vier Meter hohen Holzwehr, das einst für den Betrieb einer Gattersäge errichtet worden war. Die damaligen Dorfbewohner hatten dieses Projekt jedoch aufgegeben. Nur die Ältesten besaßen noch Kindheitserinnerungen an den Bau dieser aus Baumstämmen gefügten Konstruktion. Der Eigenbedarf an Holz war zu gering und für mögliche Abnehmer von auswärts waren die Wege zu weit. Draußen kamen sie schneller und preisgünstiger an Schnittholz.
Am oberen Rand des Wehrs, nur wenige Zentimeter oberhalb des Wassers, angelangt, krallte sich Larix an der Felsnase fest, krümmte sich um den Felsen und hatte sich mit einem Tritt und einer geschickten Gewichtsverlagerung schon an Griff und Sims hinter das Wehr geschoben, wo sich bei normalem Wasserstand eine kleine, trockene Ausbuchtung befand. Links und rechts erhoben sich zwanzig Meter und mehr die Felswände der Schlucht, bedeckt mit Gesträuch und schmalen Tannen, die in den Felsen Fuß gefasst hatten. Die Stämme waren unten wie Kniestücke gebogen und wuchsen kerzengerade empor, als wäre es in ihnen angelegt, dass sie sich in der Vertikalen zu erheben hätten, aufrecht zur Sonne, zur Freiheit, zum Licht. Der Ort erweckte den Eindruck, seinen Besucher wie eine Kammer einzuschließen. Weiter oben schien das Wasser in einer Biegung aus aufgetürmten Felsen hervor zu purzeln. Larix liebte die unzähligen Gestalten der strömenden Bergbäche. Und dieser hier, der Fundais, war ein quicklebendiger Geselle, der es eilig hatte, sich in den Angerbach zu ergießen und mit ihm vereint als Streimbach die Reise in den Lech fortzusetzen. Er betrachtete das pulsierende Wasser des Baches und lauschte seinen Geräuschen, sah ihn arbeiten, unermüdlich und ebenso unermüdlich, wenngleich unendlich langsamer, wuchsen zu beiden Seiten die Felswände empor und wurden dennoch abgetragen, in Brocken und Geröll zerlegt, während der Unermüdliche sie eines Tages mitnahm in seinem Strom. Trotz seiner schäumenden Lebendigkeit schien der Bach mit einer grenzenlosen Geduld aufgeladen zu sein – unsichtbar, nur als monotones Geräusch für das Ohr verstehbar. Ja, er hatte Zeit. Mochte er sein Wasser noch so stürmisch zu Tal schicken, so barg sein kompakter Strom, der sich nicht vom Fleck zu rühren schien, eine Form von Ewigkeit.
Larix musterte die gelbgraue Felswand, an deren Fuß er jetzt stand. Sie war kaum zehn Meter hoch und an ihrer oberen Kante hatten sich Latschen und kleine Tannen festgekrallt. Doch genau unterhalb wölbte sich der Fels wie ein Wulst und bildete eine ernste Barriere für jeden Kletterer. Links hingegen besaß die Felskante gute Griffe, so erschien es dem Jungen. Denn sein Auge tastete sich schon am Felsen empor. Ja, das war ein interessanter Übungsfelsen. Vielleicht im nächsten Jahr. Vater hatte schon angedeutet, dass er sich einen erneuten Aufenthalt vorstellen könne. Für heute mochten ein paar Griffe und Tritte genügen, an denen sich der Junge ein paar Meter senkrecht emporarbeitete. Während er dem Überhang langsam näher rückte, stellte er fest, dass der Fels keineswegs geschlossen war, sondern in sich geborsten. Der eine oder andere Griff saß locker und er hätte manches Felsstückchen herausziehen können wie einen faulen Zahn. Unter dem sich wölbenden Fels hielt er mit klopfendem Herzen an. Sein Blick suchte vergeblich einen Lösungsweg, um das Hindernis zu überwinden. Die Dämmerung war unterdessen stärker geworden und der Junge kletterte vorsichtig zurück. Als er wieder unten vor der Felswand stand, blickte er noch einmal empor. Und obwohl er von der geologischen Wundertüte der Lechtaler Berge noch keine Vorstellung besaß, prägte sich ihm das Merkmal der Brüchigkeit ein. Diese zeigte sich nicht nur in den Halden und Karen, mit denen die Gipfel reichlich umlagert waren, sondern sie saß tief drin im Berg und begleitete den Bergsteiger und Kletterer auf Schritt und Tritt. Was hielt diese Brüchigkeit zusammen? Stützten sich die einen und anderen Schichten und Formationen und krallten sich an besonders massiven Felsen fest? Ein Gelände jedenfalls, das Umsicht und Vorsicht erforderte. Schon war er zurück an der Felsnase, packte mit festem Griff den Felsen an, zog den Bauch ein und streckte den Hintern vor. Mit einer kleinen seitlichen Gewichtsverlagerung überwand er den Felsvorsprung und setzte den linken Fuß auf den Rasen. Nun konnte er loslassen, fasste wieder Fuß auf der Wiese. Gemächlich lief er in der hereinbrechenden Dunkelheit zurück ins Dorf, das dabei war, sich langsam zur Ruhe zu begeben. Letzte Spaziergänger suchten ihre Quartiere auf.
***
Wie schnell nahte das Ende des Ferienaufenthaltes. Larix tat sich schwer mit dem Abschied. Am Vorabend der Heimreise suchte er die Einsamkeit und machte sich nach dem Abendessen auf einen kleinen Rundgang. Ja, es sah so aus, als wollte er das Dorf noch einmal umrunden und unter unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wenn er einen Punkt erreichte, von dem aus er gern schaute, so blieb er oft minutenlang versunken stehen und wusste nicht, ob er freudig gestimmt oder traurig war. Sein Blick hielt Zwiesprache mit den Bildern, die sich immerzu aufs Neue zum stillen Panorama fügten. Da war die allgegenwärtige Gebirgswelt und, eingefügt in ihr, der grüne Boden, den die Menschen geschaffen hatten. Der Urgrund des Daseins tat sich ihm auf. Er wanderte behutsam ein Stück weiter, um die verbleibende Restzeit zu dehnen, bog hinter Alberts Gasthaus auf einen kleinen Pfad ab, der ihn oberhalb des Dorfes hinausführte, bis er sich am Ortsausgang wieder auf dem Fahrweg befand, der das Dorf mit seiner Außenwelt verband: zum Tal hinaus und im Sommer zusätzlich hinauf auf das Hahntennjoch und hinunter ins Oberinntal.
So viele Eindrücke waren in den Wochen seines Aufenthaltes auf ihn eingestürmt und hatten ihn mit ihrer Dichte und Intensität durchdrungen. Das Dorf und seine Menschen sprachen ihn unmittelbar an, ja, schienen ihn zu faszinieren. Und über dieser kleinen Welt der Menschen erhob sich die riesige bizarre Felsenwelt, durch die sich ein unsichtbares Netz von Pfaden und Steigen schlängelte bis hinauf auf die höchsten Erhebungen. Diese obere Welt, wo die Natur mit niemandem die Herrschaft teilte, hatte den Jungen beeindruckt. Er nahm sich vor, die nötige bergsteigerische Kompetenz zu erwerben, um dort oben nach Herzenslust zu wandern, vielleicht auch ein wenig zu klettern.
Die Einheimischen besaßen bergsteigerische Erfahrung und kannten ihre Felsenregionen sehr genau. Reinhold, beispielsweise, war nicht nur Bergbauer, sondern Mitglied der Bergwacht. Von großen Einsätzen war man bislang verschont geblieben. Einmal, so hatte er erzählt, hatte er sich abseilen müssen, um einen Rucksack zu bergen, der sich davon gemacht hatte, weil der nachlässige Besitzer ihn nicht richtig abgestellt hatte. Auch betreute er – im Auftrag der zuständigen Alpenvereinssektion – einige Abschnitte der Steige oberhalb des Dorfes. Im Frühjahr waren Instandsetzungs- und Markierungsarbeiten erforderlich, speziell in der steilen Geröllrinne hinauf zum Scharnitzsattel. Ein paar Drahtseilsicherungen, um die gefährlichsten Stellen zu entschärfen, sollte die Sektion anbringen lassen. Larix konnte ihn jederzeit um Rat oder Auskunft bitten. Außerdem lernte er, sich bei ihm oder Lydia vor jeder Tour abzumelden. Ebenso wurde es zur Selbstverständlichkeit, sich bei den beiden nach den Wetteraussichten zu erkundigen.
Die Bergaktivitäten der Einheimischen waren überwiegend berufsbedingt. Niemand hatte die Zeit und Muße, sich wochenlang zum Vergnügen in den hochalpinen Regionen umzutun. Urlaub war für diese Menschen ohnehin ein Fremdwort. Nur im Winter, wenn das Arbeitsaufkommen geringer als im Sommer war, pflegten sie ihr großes Hobby: das Skifahren. Der einzige Bergsteiger und Kletterer im Ort war der krankheitshalber früh verstorbene Lehrer gewesen. Er hatte einige Erstbesteigungen in der Hornbachkette und im Parzinn durchgeführt. Vor zehn Jahren hatte er eine neue Route auf den formschönsten Gipfel des Gebietes, die Dremelspitze, gangbar gemacht. Man war ihm dankbar dafür, wollte man doch ein neues Kreuz aufstellen und die Route erleichterte den Materialtransport. Die verwickelte Führe erhielt den Namen „Kreuzroute“. Es hieß, er sei ein sehr feiner Mensch gewesen. Außerdem war er ein Erztiroler, denn er stammte aus dem Pustertal.
Wie schön die Abendstille und das sanfte Licht der Dämmerung das Dorf einhüllten. Morgen müsse er wieder heimfahren, dachte der Junge traurig, zurück in eine Heimat, die ihn nicht vermisste und die er nicht vermisst hatte. Entsprechend würde sich die Wiedersehensfreude in Grenzen halten. Mutter würde kurz von der Arbeit aufblicken und ihre Rückkehr registrieren, sich auf ihre Koffer stürzen und die Wäsche in Weiß- und Buntwäsche für die Waschmaschine sortieren. Und er wusste nicht, welche Tränen ihm die Augen füllten. Etwas Schmerzliches war ausgebrochen wie ein wildes Tier und durchzog seine Seele.
***
„So, fahrts scho wieda hoam? Hat’s dir bei uns gefallen?“, wandte sich die junge Bäuerin direkt an Larix. Und ob es ihm gefallen hatte, viel zu gut hatte es ihm gefallen. Aber heraus brachte er nur ein karges „Ja“ und fügte ein mühsames „Es war sehr schön“ hinzu. Wenn man nicht hinter diese Maske schaute, hätte man glauben können, die Ferien hätten ihn ziemlich gleichgültig gelassen. Spontane Gefühlsäußerungen waren noch nie seine Stärke. Die waren nie geübt worden. Und so blieb er auf seinen Gefühlen sitzen, anstatt sie mitzuteilen, was er sich einfach nicht traute. Doch die Frau lächelte darüber hinweg. Vielleicht hatte sie ja an anderen Zeichen bemerkt, wie wohl sich dieser Junge in all den Tagen gefühlt hatte.