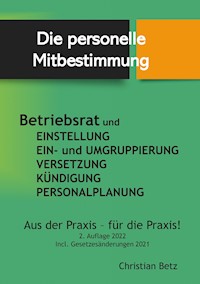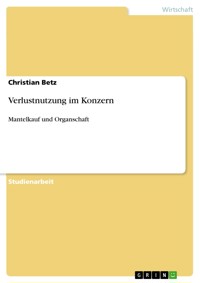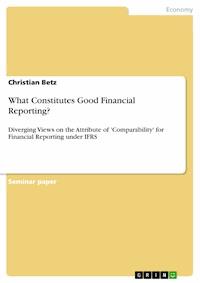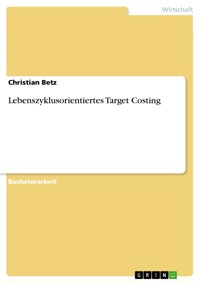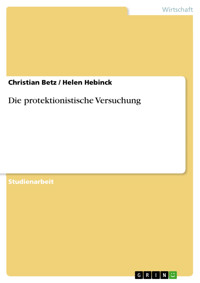Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Handbuch soll Betriebsräten helfen, mit dem Instrument der Einigungsstelle besser umzugehen und deren Möglichkeiten kennenzulernen. Der Autor verzichtet bewusst auf juristische Formulierungen und schreibt verständlichen Klartext. In einem ersten Schritt wird aufgezeigt, wann eine Einigungsstelle im betrieblichen Alltag angerufen werden kann. Dann wird der Ablauf eines Einigungsstellenverfahrens vom Scheitern der Verhandlungen mit dem Arbeitgeber bis hin zum Schiedsspruch pragmatisch und nachvollziehbar aufgezeigt. Diverse Musterbriefe und Betriebsvereinbarungen sind als Hilfestellung beigefügt. Ein besonderes Augenmerk hat der Autor auf die taktischen Möglichkeiten des Betriebsrats bei der Einberufung und Durchführung einer Einigungsstelle gelegt. Mit Hilfe dieses Handbuches sollen Betriebsräte, die noch nie oder selten ein Einigungsstellenverfahren durchgeführt haben, in die Lage versetzt werden, die Interessen der Belegschaft bestmöglich durchzusetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DANKE!
ES IST IN DER HEUTIGEN ZEIT NICHT MEHR SELBSTVER-STÄNDLICH, SICH FÜR SEINE BELEGSCHAFT AM ARBEITSPLATZ EINZUSETZEN.
DESHALB MÖCHTE ICH ALLEN MENSCHEN, DIE SICH FÜR IHRE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN EHRENAMTLICH IN BETRIEBS-ODER PERSONALRÄTEN ENGAGIEREN, DANK UND ANERKENNUNG AUSSPRECHEN.
GUT, DASS ES EUCH GIBT!
ÜBER DIESES BUCH:
Ich durfte in meiner beruflichen Laufbahn über 40 Jahre lang Betriebsräte in kleinen Familienbetrieben und in Großbetrieben bei Ihrer Arbeit begleiten. Dabei war ich Gast auf unzähligen Betriebs- Gesamtbetriebs- und Konzernbetriebsratssitzungen. Ich habe Betriebsräte vor den Arbeitsgerichten vertreten, auf Betriebsversammlungen referiert und ich wurde oft als externer Beisitzer in Einigungsstellen berufen.
Im Laufe dieser Aktivitäten habe ich den Eindruck gewonnen, dass viele Betriebsräte das mächtige Arbeitsmittel der betriebsverfassungsrechtlichen Einigungsstelle entweder gar nicht kannten oder nicht nutzten. Es war den Betriebsräten in vielen Fällen nicht bekannt, welche Möglichkeiten ein Einigungsstellenverfahren bietet. In Betriebsräteschulungen wird das Thema oft nur am Rande oder gar nicht behandelt.
Ich bin der Meinung, dass die Einigungsstelle die beste Form der Mitbestimmung ist, die in einer betrieblichen Demokratie angewendet werden kann. Der Spruch einer Einigungsstelle ist für den Arbeitgeber und den Betriebsrat bindend. Es handelt sich nicht um eine unverbindliche Empfehlung.
Aus diesem Grund habe ich begonnen, mit meinen Mitteln die Möglichkeiten von Einigungsstellen bekannter zu machen und dafür zu werben, dieses „Werkzeug“ effektiv einzusetzen.
Vom Inhalt her möchte ich praxisbezogen die Möglichkeiten von Einigungsstellen vom Scheitern der Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, über den Abschluss von Betriebsvereinbarungen bis hin zum Schiedsspruch aufzeigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Möglichkeiten einer Einigungsstelle bei der Arbeitsüberlastung und das betriebliche Beschwerderecht.
Ein besonderes Augenmerk habe ich auf die taktischen Möglichkeiten und das strategische Vorgehen des Betriebsrats bei der Durchführung von Einigungsstellenverfahren gelegt.
Schließlich sollen Musterbriefe und Mustertexte sowie aktuelle Betriebsvereinbarungen helfen, das Gelesene in der Praxis umzusetzen. Ich wünsche Euch viel Spaß und vor allem viel Erfolg dabei. Nur Mut!
Ihr werde die Einigungsstelle lieben
Christian Betz
INHALT
Was ist eine Einigungsstelle?
1.1. Die Mitbestimmung in Unternehmen
1.2. Die betriebliche Mitbestimmung
Wer sitzt in der Einigungsstelle?
2.1. Wie kommt die Einigungsstelle zusammen
2.2. Die Größe der Einigungsstelle
2.3. Der Vorsitz in der Einigungsstelle
2.4. Wie findet man eine Vorsitzende
Der Weg in die Einigungsstelle
3.1. Der Arbeitgeber will nicht verhandeln
3.2. Der Arbeitgeber verzögert die Verhandlungen
3.3. Die Verhandlungen hängen fest
3.4. Betriebsratssitzung wegen Einigungsstelle
3.4.1. Die Anträge in der Sitzung
3.4.2. Die Beschlüsse der Sitzung
3.4.3. Das Protokoll der Sitzung
3.5. Schreiben an den Arbeitgeber
Die Reaktion des Arbeitgebers
4.1. Der Arbeitgeber will keine Einigungsstelle
4.2. Der Arbeitgeber unternimmt nichts
4.3. Der Arbeitgeber akzeptiert den Vorschlag des BR
4.4. Der Arbeitgeber akzeptiert nichts
Das Beschlussverfahren vor dem Arbeitsgericht
Die Kosten der Einigungsstelle
6.1. Entgeltfortzahlung für interne Beisitzer
6.2. Honorar des Vorsitzenden
6.3. Honorar der externen Beisitzer
6.4. Höhe des Honorars
Der Ablauf der Sitzung der Einigungsstelle
7.1. Der Termin zur Sitzung
7.2. Der Ablauf der Sitzung
7.3. Die Abstimmung in der Sitzung
Nach der Sitzung der Einigungsstelle
8.1. Das Honorar des Vorsitzenden
8.2. Das Honorar der externen Beisitzer
Wann ist die Einigungsstelle erzwingbar
9.1. Eigene Belange des Betriebsrats
9.1.1. Betriebsräteschulungen
9.1.2. Freistellung von Betriebsräten
9.1.3. Sprechstunden des Betriebsrats
9.1.4. Anzahl Mitglieder im GBR
9.1.5. Schulungen JAV
9.2. spannend: Das Beschwerderecht
9.2.1. Der Ablauf einer Beschwerde
9.2.2. Wie geht es weiter?
9.2.3. Der Arbeitgeber ist anderer Meinung
9.2.4. Die Überlastung am Arbeitsplatz
9.3. Die soziale Mitbestimmung
9.3.1. Die Ordnung im Betrieb
9.3.2. Arbeitszeit
9.3.3. Überstunden und Kurzarbeit
9.3.4. Entgeltzahlungen
9.3.5. Urlaub
9.3.6. Technische Überwachung
9.3.7. Arbeits- und Gesundheitsschutz
9.3.8. Sozialeinrichtungen
9.3.9. Betriebswohnungen
9.3.10 Lohngestaltung
9.3.11. Vorschlagswesen
9.4. Die personelle Mitbestimmung
9.4.1. Personalfragebogen
9.4.2. Auswahlrichtlinien
9.4.3. Fort- und Weiterbildung
9.4.4. Außerbetriebliche Fortbildungen
9.5. Die wirtschaftliche Mitbestimmung
9.5.1. Mangelnde Info Wirtschaftsausschuss
9.5.2. Sozialplan und Einigungsstelle
9.5.3. Interessenausgleich und Einigungsstelle
Die externen Helfer/Sachverständigen
10.1 Wer ist so ein Sachverständiger?
10.2. Für welche Aufgaben?
10.3. Der Weg zum Sachverständigen
10.4. Wenn der Arbeitgeber nicht zustimmt?
Seminare zum Thema
Freistellung für Seminare
ANHANG
Musterbriefe und Betriebsvereinbarungen
Anmerkungen zu den Mustern
(
1) Einladung zu einer Betriebsratssitzung
(
2) Protokoll einer Betriebsratssitzung
(
3) Schreiben an den Arbeitgeber „Die Verhandlungen sind gescheitert“
(
4) Einleitung eines Beschwerdeverfahrens
(
5) Einladung eines Sachverständigen
(
6) Mustergeschäftsordnung für Betriebsrat
Anmerkungen zum Jahresarbeitszeitkonto
(
7) Betriebsvereinbarung „Jahresarbeitszeitkonto“.
(
8) Betriebsvereinbarung „Überlastung“
Der Autor
Stichwortverzeichnis/Index
Text Betriebsverfassungsgesetz
„Das Wort zum Sonntag“
Was ist eine Einigungsstelle?
Eine Einigungsstelle ist eine Schiedsstelle.
Die Einigungsstelle ist ein Gremium, das verbindlich entscheidet, wenn sich der Arbeitgeber und der Betriebsrat in einer mitbestimmungspflichtigen Angelegenheit nicht einigen können. Hier ist die gesetzliche Grundlage:
Betriebsverfassungsgesetz
§ 76 Einigungsstelle
(1) Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat ist bei Bedarf eine Einigungsstelle zu bilden. Durch Betriebsvereinbarung kann eine ständige Einigungsstelle errichtet werden.
(2) Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Seiten einigen müssen. Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn das Arbeitsgericht. Dieses entscheidet auch, wenn kein Einverständnis über die Zahl der Beisitzer erzielt wird.
(3) Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden. Sie fasst ihre Beschlüsse nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Bei der Beschlussfassung hat sich der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande, so nimmt der Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. Die Beschlüsse der Einigungsstelle sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden zu unterschreiben oder in elektronischer Form niederzulegen und vom Vorsitzenden mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen sowie Arbeitgeber und Betriebsrat zuzuleiten.
(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Einzelheiten des Verfahrens vor der Einigungsstelle geregelt werden.
(5) In den Fällen, in denen der Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt, wird die Einigungsstelle auf Antrag einer Seite tätig. Benennt eine Seite keine Mitglieder oder bleiben die von einer Seite genannten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so entscheiden der Vorsitzende und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe des Absatzes 3 allein. Die Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Betriebs und der betroffenen Arbeitnehmer nach billigem Ermessen. Die Überschreitung der Grenzen des Ermessens kann durch den Arbeitgeber oder den Betriebsrat nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Zuleitung des Beschlusses an gerechnet, beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden.
(6) Im Übrigen wird die Einigungsstelle nur tätig, wenn beide Seiten es beantragen oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind. In diesen Fällen ersetzt ihr Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nur, wenn beide Seiten sich dem Spruch im Voraus unterworfen oder ihn nachträglich angenommen haben.
(7) Soweit nach anderen Vorschriften der Rechtsweg gegeben ist, wird er durch den Spruch der Einigungsstelle nicht ausgeschlossen.
(8) Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass an die Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Einigungsstelle eine tarifliche Schlichtungsstelle tritt.
Warum der Dissens zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat besteht, spielt dabei keine Rolle. Es kann sein, dass sich die Parteien nicht über den Inhalt einer Betriebsvereinbarung einigen können. Es kann aber auch sein, dass der Betriebsrat eine Forderung stellt (zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung zu Reisekosten oder eine Parkplatzordnung) und der Arbeitgeber überhaupt keinen Handlungsbedarf sieht, also Verhandlungen rundweg ablehnt, frei nach dem Motto: „Das brauchen wir nicht“.
Ein typisches Beispiel für das Tätigwerden einer Einigungsstelle ist, wenn schon monatelang über eine Betriebsvereinbarung (zum Beispiel zum Thema Arbeitszeit/Jahresarbeitszeitkonto) verhandelt wird und der Arbeitgeber und der Betriebsrat keinen gemeinsamen Nenner finden (siehe Kapitel 8 „Die soziale Mitbestimmung“).
Ein anderes Beispiel wäre, wenn der Betriebsrat die offizielle Beschwerde eines Arbeitnehmers unterstützt (unhöflicher Vorgesetzter etc.), vom Arbeitgeber Abhilfe fordert und der Arbeitgeber nichts unternimmt (siehe Kapitel 9.2. „Beschwerderecht“).
Weitere Zuständigkeiten für Einigungsstellen sind Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat über betriebliche Fortbildungen oder über einen Sozialplan (= eine Abfindungsvereinbarung für zu kündigende Arbeitnehmer). Diese Möglichkeiten werden im Kapitel 8.5. „Die wirtschaftliche Mitbestimmung“ behandelt.
Aber auch „eigene Belange“ des Betriebsrats können in einem Einigungsstellenverfahren entschieden werden. Wenn es zum Beispiel um die Einrichtung von Sprechstunden des Betriebsrats oder um die Größe des Gesamtbetriebsrats geht (siehe Kapitel 9.1. „Eigene Belange des Betriebsrats“).
Bei einer Einigungsstelle handelt sich um eine Schiedsstelle. Nun gibt es Schiedsstellen, die den streitenden Parteien einen Vorschlag zur Beendigung von Streitigkeiten machen, der für die betroffenen Parteien unverbindlich ist. Dies ist bei einer Einigungsstelle nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Was eine Einigungsstelle beschließt ist verbindlich und muss in der Praxis umgesetzt werden. Sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Betriebsrat und den Arbeitnehmern. Rechtsmittel gegen den Spruch einer Einigungsstelle gibt es zwar, diese werden aber in der Praxis nicht oder kaum genutzt.
Ein typisches Beispiel für das Anrufen einer Einigungsstelle:
Der Arbeitgeber beantragt beim Betriebsrat, dass an einem Sonntag gearbeitet wird, weil eine Inventur durchgeführt werden soll. Der Betriebsrat ist der Meinung, dass eine solche Inventur auch während der regelmäßigen Arbeitszeit durchgeführt werden könnte. Jetzt folgen Verhandlungen und die Parteien (Betriebsrat und Arbeitgeber) können sich (trotz mehrere Verhandlungstermine oder aus Zeitnot) nicht einigen.
Das ist ein typischer Fall für eine Einigungsstelle. Beide Betriebspartner können nun zur endgültigen Entscheidung die Einigungsstelle anrufen. Diese entscheidet dann nach ihrer Sitzung und nach Diskussionen, ob am Sonntag gearbeitet werden darf oder nicht. Und zwar verbindlich!
Eine Einigungsstelle kann aber auch entscheiden, wenn sich ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin beim Betriebsrat über eine Überlastung am Arbeitsplatz beschwert, der Betriebsrat auf der Seite der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers ist und der Arbeitgeber diese Auffassung nicht teilt.
1.1. Die Mitbestimmung in Unternehmen
Es gibt im Arbeitsleben verschiedene Formen der Mitbestimmung. So gibt es eine gesetzlich vorgeschriebene Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Unternehmen. Ab einer Betriebsgröße von 2.000 Arbeitnehmern haben von der Belegschaft gewählte Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter Sitze im Aufsichtsrat. Die Anzahl der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter ist gleich groß. Darum spricht man von einer „paritätischen Mitbestimmung“.
Wegen der gleichen Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Gremium ist das „Zünglein an der Waage“ der oder die Aufsichtsratsvorsitzende. Diese Position muss von den Aufsichtsratsmitgliedern im ersten Wahlgang mit einer 2/3-Mehrheit gewählt werden. Wird diese Mehrheit nicht erreicht (was die Regel ist), entscheiden immer die Arbeitgeber (im Gesetz: Anteilseigner), wer der oder die Vorsitzende des Aufsichtsrats wird.
Logisch: Vorsitzender der Aufsichtsräte in unserer Republik ist beim Großteil aller dieser Gremien ein Arbeitgebervertreter. Wen wundert es?
Kommt es in einer Abstimmung während einer Aufsichtsratssitzung zu einer Stimmengleichheit, folgt eine zweite Abstimmung, bei der die oder der Aufsichtsratsvorsitzende dann zwei Stimmen hat.
Und das war es dann auch schon mit der schönen „paritätischen Mitbestimmung“. Die Mehrheit bei Entscheidungen, die sich gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richten, liegt damit fast immer auf der Arbeitgeberseite.
Dies hat sich in der Praxis insbesondere dann gezeigt, wenn in einer Aufsichtsratssitzung über Rationalisierungsmaßnahmen wie Outsourcing oder Betriebsschließungen abgestimmt wurde.
Die Rechtsgrundlagen für diese Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Aufsichtsräten sind im Mitbestimmungsgesetz zu finden.
1.2. Die betriebliche Mitbestimmung
Für Betriebsräte ist die Mitbestimmung deutlich besser geregelt, unter anderem durch die Einigungsstelle. Die Rechtsgrundlagen hierfür stehen im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Bei einer solchen Einigungsstelle auf betrieblicher Ebene entscheidet nicht die Arbeitgeberfraktion (wie im Aufsichtsrat), sondern letztlich eine neutrale Person, die mit dem Betrieb oder Unternehmen „nichts am Hut hat“.
Das ist eine sehr demokratische und gerechte Form. Zumindest in der Theorie.
Wie im Aufsichtsrat entsenden Betriebsrat und Arbeitgeber eine gleiche Anzahl von „ihren“ Vertretern in eine Einigungsstelle. Dadurch bestünde die Gefahr, dass bei Abstimmungen eine Patt-Situation entsteht, das heißt eine Stimmengleichheit (zum Beispiel: Drei Arbeitnehmer sind für einen Antrag und die drei Arbeitgebervertreter dagegen). Das hilft nicht weiter.
Der feine Unterschied zum Aufsichtsrat besteht jedoch darin, dass der oder die Vorsitzende einer Einigungsstelle kein Arbeitgebervertreter, sondern eine neutrale Person ist, die nicht im Betrieb arbeitet und auch keinen besonderen Bezug zur betroffenen Firma hat, also richtig neutral ist.
Die bedeutet, dass unbeteiligter und unbetroffener Dritter über betriebliche Belange entscheidet – und zwar verbindlich!
Das ist das Geheimnis von betrieblichen Einigungsstellen!
Wer sitzt in einer solchen Einigungsstelle und warum?
Betriebsverfassungsgesetz
§ 76 Einigungsstelle
(1) …
(2) Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Seiten einigen müssen. Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn das Arbeitsgericht. Dieses entscheidet auch, wenn kein Einverständnis über die Zahl der Beisitzer erzielt wird.
(3) …
Wenn es so weit ist, dass der Arbeitgeber oder der Betriebsrat ein Einigungsstellenverfahren eingeleitet hat, muss die Zusammensetzung der Einigungsstelle festgelegt werden.
Merke!
Eine Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Zahl von Beisitzern von jeder Seite und aus einem oder einer Vorsitzenden.
2.1. Wie kommt die Einigungsstelle zustande?
Der Betriebsrat und der Arbeitgeber entsenden jeweils „ihre“ Vertreter oder Vertreterinnen in die Einigungsstelle, ohne dass die „Gegenpartei“ ein Vetorecht hat. Das heißt, jeder der Betriebspartner kann autonom entscheiden, wer seine Interessen in der Einigungsstelle vertritt. Unumgänglich ist dabei, dass beide Parteien die gleiche Anzahl von Beisitzern in die Einigungsstelle entsenden. Deshalb müssensich Arbeitgeber und Betriebsrat auf die Anzahl der Beisitzer – also auf die Größe der Einigungsstelle – einigen. Bei Nichteinigung entscheidet das örtliche Arbeitsgericht.
Das BetrVG kennt keine Vorschriften, welche Voraussetzungen die Beisitzer einer Einigungsstelle vorweisen müssen. Es steht dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber vollkommen frei, wer „ihre“ Interessen in der Einigungsstelle wahrnehmen soll.
Deshalb müssen die Beisitzer keine Arbeitgeber-(Vertreter), leitende Angestellte oder Betriebsratsmitglieder sein. Einigungsstellenmitglied kann jede oder jeder werden. Es können zum Beispiel Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sein, die vom Streit (den die Einigungsstelle erledigen soll) betroffen sind oder Rechtsanwälte oder Gewerkschaftsvertreter oder Vertreter aus einem Arbeitgeberverband sein. Oder….
Jede Betriebspartei kann jede oder jeden in das Gremium entsenden. Autonom!
2.2. Die Größe der Einigungsstelle
In einem ersten Schritt müssen sich der Betriebsrat und der Arbeitgeber über die Größe der Einigungsstelle einigen. Können sich die beiden nicht über die Anzahl der Beisitzer einigen, entscheidet das Arbeitsgericht in einem Beschlussverfahren, das beide Seiten einleiten können. Die übliche Größe einer Einigungsstelle besteht in der Praxis aus zwei oder drei Vertretern von jeder Seite. Also vier oder sechs Beisitzer oder Beisitzerinnen. Doch davon später mehr. Wie schon gesagt: Es müssen nicht zwingend Betriebsangehörige sein. Der Betriebsrat kann zum Beispiel den Betriebsratsvorsitzenden und einen Gewerkschaftssekretär oder einen Rechtsanwalt entsenden. Umgekehrt steht es dem Arbeitgeber frei, zwei Vertreter seines Arbeitgeberverbandes zu benennen oder die Personalchefin und einen Rechtsanwalt. Es könnte auch der Onkel aus Lenggries berufen werden.
Arbeitgeber und Betriebsrat müssen sich also über die Größe der Einigungsstelle einigen. Eine Partei macht der Gegenpartei einen Vorschlag – zum Beispiel vier oder sechs Beisitzer. Die andere Partei ist dann entweder mit der Größe einverstanden oder macht einen Gegenvorschlag.
Das Schreiben des Betriebsrats an den Arbeitgeber wegen der Größe der Einigungsstelle könnte wie folgt formuliert werden:
MUSTERBRIEF an den Arbeitgeber wegen der Größe der Einigungsstelle:
An die Geschäftsführerin
der XY GmbH
Ort, Datum
Sehr geehrter Frau XY,
wie Ihnen der Betriebsrat bereits mitgeteilt hat, soll über die Betriebsvereinbarung „Jahresarbeitszeitkonto“ eine Einigungsstelle entscheiden.
Der Betriebsrat hat sich mit der Größe der Einigungsstelle befasst. Nach Auffassung des Betriebsrats soll die Einigungsstelle aus sechs Beisitzern
– also drei Beisitzern von Ihrer und drei Beisitzern von unserer Seite bestehen.
Sollten wir innerhalb der nächsten 7 Tage nicht von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Größe der Einigungsstelle einverstanden sind.
Für Rückfragen steht Ihnen der Betriebsratsvorsitzenden gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Anneliese Sorglos
Betriebsratsvorsitzende
Einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat über die Größe, kann dieser Punkt abgehackt werden.
Wenn sich die Parteien nicht über die Anzahl der Beisitzer einigen können, entscheidet das Arbeitsgericht in einem sogenannten Beschlussverfahren, wie viele Beisitzer in der Einigungsstell sitzen sollen. Dieses arbeitsgerichtlich Verfahren können sowohl der Arbeitgeber wie auch der Betriebsrat einleiten.
Schon in diesem Stadium kann sich der Betriebsrat von seiner Gewerkschaft oder einem Rechtsanwalt (Fachanwalt für Arbeitsrecht) vertreten lassen.
Achtung!
In diesem Falle muss der Betriebsrat einen Beschluss fassen, dass der Arbeitgeber die Kosten des Einigungsstellenverfahrens und der Rechtsvertretung zu tragen hat.
Die Gewerkschaften kennen in der Materie aus. Wenn ein Rechtsanwalt den Betriebsrat vertreten soll, sollte es schon einer sein, der Erfahrungen mit Beschlussverfahren und Einigungsstellen hat. Diese Anwälte gibt es nicht wie „Sand am Meer“. Wer keinen (arbeitnehmerfreundlichen) erfahrenen Fachanwalt kennt, fragt einfach beim örtlichen Arbeitsgericht oder beim DGB nach. Die kennen ihre „Pappenheimer“ und geben sicher einen Tipp.
Also: Entweder auf dem Verhandlungsweg oder nach einem arbeitsgerichtlich Beschlussverfahren steht fest, wie groß die Einigungsstelle sein wird.
2.3 Der oder die Vorsitzende der Einigungsstelle
Nachdem die Anzahl der Beisitzer – also die Größe der Einigungsstelle - geklärt ist muss ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende für die Einigungsstelle gefunden werden.
Für jede Einigungsstelle muss zwingend ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende gefunden werden. Diese Entscheidung müssen der Arbeitgeber und der Betriebsrat treffen. Es liegt im freien Ermessen des Betriebsrats und des Arbeitgebers zu bestimmen, wer den Vorsitz übernehmen soll. Die beiden Parteien müssen sich allerdings auf eine Person einigen. Und das ist in der Praxis gar nicht so einfach. Warum?
Ganz einfach: Weil der oder die Vorsitzende der Einigungsstelle bei einer Abstimmung mit Stimmengleichheit (zweimal ja, zweimal nein zum Antrag) das „Zünglein an der Waage“ ist und damit die entscheidende Stimme hat.
2.4. Wie findet man die oder den Vorsitzenden?
Eine der Parteien (Betriebsrat oder Arbeitgeber) macht einen Vorschlag, wer aus ihrer Sicht Vorsitzende/r der Einigungsstelle werden soll. Wenn der Betriebsrat aktiv wird, sollte darüber einen Beschluss gefasst werden. Wenn der Betriebsrat keine oder keinen kennt, der den Vorsitz übernehmen könnte, empfiehlt sich ein Besuch des örtlichen Arbeitsgerichts. Der Betriebsratsvorsitzende meldet sich an der Pforte an und fragt nach einem Arbeitsrichter, mit dem er über ein anhängiges Einigungsverfahren sprechen kann. Die gibt es bei jedem Arbeitsgericht.
Warum? Weil beim Großteil aller Einigungsstellenverfahren Arbeitsrichter als Vorsitzende tätig werden.
Wenn der Betriebsrat ein Kandidat oder eine Kandidatin gefunden hat, der aus seiner Sicht den Vorsitz übernehmen soll, teilt er diese Person dem Arbeitgeber mit.
Dies kann mit folgendem Musterschreiben geschehen:
MUSTERBRIEF an den Arbeitgeber zum Vorsitz
An den Geschäftsführer
der XY GmbH
Ort, Datum
Lieber Chef,
bereits mit Schreiben vom xx.xx.2023 hat Ihnen der Betriebsrat mitgeteilt, dass ein Einigungsstellenverfahren eingeleitet werden soll. Über die Anzahl der Beisitzer haben wir uns geeinigt. Nun hat sich der Betriebsrat mit der Person der oder des Vorsitzenden der Einigungsstelle gefasst. Nach Auffassung des Betriebsrats sollte den Vorsitz
die Richterin am Arbeitsgericht XY, Frau XY
Übernehmen.
Frau XY hat schon mehrere Einigungsstellen geleitet. Sollte der Betriebsrat
bis Montag, xx.xx.2023 (ca. 1 Woche)
nichts von Ihnen hören, geht der Betriebsrat davon aus, dass Sie mit dem Vorschlag einverstanden sind. Der Betriebsrat wird dann die bisherige Korrespondenz in der Angelegenheit an die Vorsitzenden übergeben.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Hubert Sorgenfrei
Betriebsratsvorsitzender
Mit diesem Schreiben setzt der Betriebsrat den Arbeitgeber unter Druck, da ein Termin gesetzt ist, der bei Nichteinhaltung Folgen hat.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten für den Arbeitgeber:
Der Arbeitgeber akzeptiert den Vorschlag des Betriebsrats oder er macht einen Gegenvorschlag. Das heißt er schlägt eine ganz andere Person vor.
Dann muss verhandelt werden.
Nun gibt es wieder zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1 - Einigung: Der Arbeitgeber und der Betriebsrat einigen sich über die Person des oder der Vorsitzenden. Dann werden die vorliegenden Unterlagen dem oder der Vorsitzenden übergeben.
Möglichkeit 2 - Nichteinigung: Einigen sich der Betriebsrat und der Arbeitgeber nicht über die Person der/des Vorsitzenden, entscheidet das örtliche Arbeitsgericht wer den Vorsitz in der Einigungsstelle übernimmt. Das geschieht in einem sogenannten Beschlussverfahren, das vom Arbeitgeber oder vom Betriebsrat eingeleitet werden kann.
Der Betriebsrat kann sich auch in diesem Fall von seiner Gewerkschaft oder von einem Anwalt vertreten lassen. Es ist aber problemlos, wenn der Betriebsrat ohne Rechtsvertretung selbst beim Arbeitsgericht erscheint, da im Beschlussverfahren der Vorsitzende Richter durch die Verhandlung führt.
Wichtig! Wenn es ein Anwalt sein soll, dann sollte es ein „Fachanwalt für Arbeitsrecht“ sein, der möglichst schon Erfahrungen mit Einigungsstellen und Beschlussverfahren hat. Wenn der Betriebsrat keinen entsprechenden Anwalt kennt: Einfach beim DGB anrufen. Dies kennen sich aus.
Im Großteil aller Fälle entscheidet das Arbeitsgericht in einem Verfahren die Größe und die Person der oder des Vorsitzenden. Nach dem arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren sind beide Parteien klüger: Die Einigungsstelle hat ein Gesicht.
Größe und Vorsitz sind geregelt. Das heißt, das Arbeitsgericht hat sinngemäß folgenden Beschluss verkündet:
… Die Einigungsstelle bei der Firma XY besteht aus sechs Personen, also drei Beisitzer von Seiten des Arbeitgebers und drei Beisitzer von Seiten des Betriebsrats.
Vorsitzende der Einigungsstelle wird die Richterin am Arbeitsgericht XY Frau XY werden…
Der Weg in die Einigungsstelle
Der Großteil aller betrieblichen Einigungsstellen entstehen, nachdem sich der Arbeitgeber und der Betriebsrat über einen mitbestimmungspflichtigen Tatbestand nicht einigen können, oder wenn der Arbeitgeber gar nicht bereit ist, über eine bestimmte Angelegenheit zu verhandeln oder wenn er die Verhandlungen bis zum „Sankt-Nimmerleinstag“ verzögert.
Exkurs!
Bei allen Fragen der „sozialen Mitbestimmung“ (Arbeitszeit, Überstunden, Betriebsordnung, Urlaubsgrundsätze usw.) hat der Betriebsrat ein Initiativrecht. Das bedeutet, er muss nicht warten, bis der Arbeitgeber auf ihn zukommt und eine neue Betriebsvereinbarung abschließen oder eine bestehende Betriebsvereinbarung ändern will. Der Betriebsrat kann „von sich aus“ beantragen, über eine Frage zu verhandeln. Das betrifft in erster Linie alle Tatbestände des § 87 BetrVG.
Betriebsverfassungsgesetz
§ 87 Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:
1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb;
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;
3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit;
4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;
5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird;
6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen;
7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;
8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist;
9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;
10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;
11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;
12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;
13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt;
14. Ausgestaltung von mobiler Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird.
(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
Der Betriebsrat kann also zum Beispiel fordern, dass neue Arbeitszeitmodelle eingeführt werden, oder dass eine Dienstwagenordnung abgeschlossen wird oder dass eine Vereinbarung getroffen wird, wie mit den Urlaubsansprüchen umgegangen werden soll. Der kluge Betriebsrat entwirft (auch gerne mit fachkundiger Hilfe) eine Betriebsvereinbarung zum jeweiligen Thema, übergibt die an den Arbeitgeber und fordert ihn zu Verhandlungen auf.
Beim Entwurf einer Betriebsvereinbarung sollte sich der Betriebsrat bei seiner Gewerkschaft oder bei anderen Betriebsräten bereits bestehende Modelle erbitten. Diese Vereinbarungen werden dann überarbeitet und den eigenen betrieblichen Ansprüchen angepasst. Aus taktischen Gründen sollten in dem Entwurf Forderungen stehen, die deutlich höher als das gewünschte Ergebnis sind, weil der Betriebsrat sonst bei den Verhandlungen keinen Spielraum mehr hat.
Eine Alternative dazu ist, dass der Betriebsrat einen Entwurf erarbeitet, der tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann. Dann muss aber dem Arbeitgeber mitgeteilt werden, dass kein Verhandlungsspielraum mehr besteht. Welchen Weg der Betriebsrat geht, hängt von der Person des Arbeitgebers ab.
Nachdem der Arbeitgeber den Entwurf der Betriebsvereinbarung erhalten hat, werden zwischen dem Betriebsratsvorsitzenden und dem Arbeitgeber Verhandlungen terminiert. Dann geht es zur Sache: Es wird über die Betriebsvereinbarung verhandelt.
Wenn alles gut läuft, finden die Parteien einen Konsens und können sich über Inhalt, Laufzeit und Nachwirkung der Vereinbarung einigen. Dann ist im BetrVG zwingend die Schrift-form vorgeschrieben. Eine mündliche Betriebsvereinbarung gibt es rechtlich nicht.
In der Praxis kommt es aber oft vor, dass sich die Parteien nicht einigen können. Oft ist über den Großteil der angestrebten Vereinbarung ein Konsens gefunden aber bei einer Kleinigkeit können sich die Parteien nicht einigen. Der Betriebsrat kann zu jedem Zeitpunkt das Scheitern der Verhandlungen beschließen. Eine „Mindestanzahl“ von Verhandlungen gibt es nicht.
Einige typische Beispiele für das Scheitern von Verhandlungen sind:
1. Der Arbeitgeber verhandelt nicht
2. Der Arbeitgeber verzögert die Verhandlungen
3. Die Verhandlungen sind festgefahren
Im Einzelnen:
3.1. Der Arbeitgeber will gar nicht verhandeln
Ein Beispiel: Im Betrieb gibt es eine starre Wochen- oder Monatsarbeitszeit. Der Betriebsrat ist der Meinung, dass dies nicht mehr zeitgemäß ist und beschließt im Rahmen einer Sitzung, den Arbeitgeber aufzufordern, über die Einführung einer gleitenden Arbeitszeit oder eines Jahresarbeitszeitkontos (Muster: siehe Anhang) zu verhandeln.
Zuerst sollte der Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung entwerfen, wie er sich die zukünftige Einteilung der Arbeitszeit vorstellt. Der kluge Betriebsrat holt sich einige Musterbetriebsvereinbarungen von anderen Firmen, von der Gewerkschaft oder von einem Sachverständigen. Diese Betriebsvereinbarung wird dann überarbeitet und an die praktischen Gegebenheiten angepasst.
Dieser Verhandlungsentwurf geht dann an den Arbeitgeber. Gleichzeitig wird er aufgefordert, über diese Vereinbarung mit dem Betriebsrat zu verhandeln. Das Ziel des Betriebsrats ist der Abschluss einer schriftlichen Betriebsvereinbarung, die vom Arbeitgeber und vom Betriebsratsvorsitzenden unterschrieben ist.
Dieser freundlichen Aufforderung kommt der Arbeitgeber nicht nach. Entweder er hat kein Interesse über das Thema Arbeitszeit zu verhandeln, oder er nimmt seinen Betriebsrat nicht ernst. Allerdings ist er vom BetrVG her verpflichtet, mit dem Betriebsrat zu verhandeln. Zwingend!
Darum muss der Betriebsrat handeln. Er schreibt an seinen Arbeitgeber einen Brief, sinngemäß:
An den Geschäftsführer
der XY GmbH
Ort, Datum
Lieber Chef,
bereits mit Schreiben vom xx.xx.2023 haben wir Sie aufgefordert, mit dem Betriebsrat über eine „Betriebsvereinbarung Gleitzeit“ zu verhandeln. Weiter haben Sie einen Entwurf des Betriebsrats zu einer solchen Vereinbarung erhalten. Gleichzeitig haben wir Sie gebeten, mit dem Betriebsratsvorsitzenden einen Termin zu vereinbaren, um über die Betriebsvereinbarung zu verhandeln. Trotz mehrmaliger Nachfragen ist es leider nicht zu einer Verhandlung gekommen. Wir möchten Sie deshalb auf diesem Weg noch einmal darum bitten, dass Sie mit dem Betriebsrat einen entsprechenden Termin vereinbaren.
Sollte dies in den nächsten Tagen nicht geschehen, wird sich der Betriebsrat auf der nächsten ordentlichen Sitzung mit seinem weiteren Vorgehen befassen und darüber entscheiden, ob ein Einigungsstellenverfahren eingeleitet werden soll“.
Der Betriebsrat würde dies bedauern, weil er der Meinung ist, dass eine solche Betriebsvereinbarung auf dem Verhandlungsweg abgeschlossen werden könnte. Für die Absprache eines Verhandlungstermins steht Ihnen der Betriebsratsvorsitzende zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Sorgenfrei
Betriebsratsvorsitzender
3.2. Der Arbeitgeber verzögert die Verhandlungen
Und wieder ein Beispiel aus der Praxis: Der Betriebsrat und der Arbeitgeber verhandeln schon seit einem Jahr über eine neue Betriebsvereinbarung zu Fragen der Betriebsordnung. Statt vieler kleiner Betriebsvereinbarungen zum Thema „Ordnung im Betrieb“ sollte nach Meinung des Betriebsrats eine einheitliche Betriebsordnung entstehen. Diese Vereinbarung sollte dann an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und an neu eingestellte Kollegen verteilt werden. Dabei geht es um Themen wie Parkplatzordnung, Dienstkleidung, Rauch- und Alkoholverbot usw. Oder um die Einführung von Arbeitszeitkonten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die Verhandlungen kommen und kommen nicht voran. Der Arbeitgeber zeigt kein großes Interesse.
Bereits vereinbarte Termine zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat wurden immer wieder kurzfristig abgesagt. Als es schließlich zu einer Verhandlung kam, verließ der Arbeitgeber nach einer kurzen Zeit mit fadenscheinigen Erklärungen die Debatte.
Der Betriebsrat ist nun mehrheitlich der Meinung, dass der Arbeitgeber die Verhandlungen verzögert, weil er kein Interesse an der Betriebsvereinbarung hat. Ein Ende der Verhandlungen ist nicht absehbar.
Auch in diesem Fall muss der Betriebsrat aktiv werden und den Arbeitgeber darauf hinweisen, dass dessen Verhalten nicht geduldet wird. Dies geschieht am besten schriftlich:
An den Geschäftsführer
der XY GmbH
Ort, Datum
Lieber Chef,
seit über einem Jahr verhandeln Sie mit dem Betriebsrat über den Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Betriebsordnung, in der wichtige Dinge für unsere Kollegen geregelt werden sollen. Leider kommen diese Verhandlungen nicht vorwärts.
Mehrmals haben Sie bereits vereinbarte Verhandlungstermine abgesagt. Vereinbarte Verhandlungen, haben Sie nach kurzer Zeit verlassen. Es ist für den Betriebsrat nicht mehr absehbar, dass diese Verhandlungen mit dem Abschluss einer Betriebsvereinbarung beendet werden können.
Dies möchte der Betriebsrat nicht weiter dulden. Aus diesem Grund wird sich der Betriebsrat auf seiner nächsten ordentlichen Sitzung mit seinem weiteren Vorgehen befassen und darüber entscheiden, ob die Verhandlungen für gescheitert erklärt werden und ob ein Einigungsstellenverfahren eingeleitet wird.
Der Betriebsrat bittet um Ihr Verständnis für diesen Schritt. Die Betriebsratsvorsitzende steht Ihnen selbstverständlich für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Regina Sorgenfrei
Betriebsratsvorsitzende
3.3. Die Verhandlungen über eine Betriebsvereinbarung etc. sind festgefahren
Es kommt in der Praxis oft vor, dass beide Parteien, nämlich der Arbeitgeber und der Betriebsrat zu Verhandlungen bereit sind, dass es aber trotzdem nicht weitergeht, weil es bei grundsätzliche Fragen keine Annäherung gibt.
Typisch ist zum Beispiel, dass bei Verhandlungen über ein Jahresarbeitszeitkonto kein Konsens mit dem Arbeitgeber gefunden werden kann, wer darüber bestimmt, wann Plusstunden abgebaut werden. Umstritten ist hier, ob der Arbeitgeber bestimmen darf, wann Plusstunden abgefeiert werden oder ob der Wunsch des Arbeitnehmers zu berücksichtigen ist? Und wer soll entscheiden, wenn sich der Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht einigen können?
Diskutiert und gestritten werden kann auch über die Frage, wie viele Plus- und Minusstunden angesammelt werden und in welchem Zeitraum diese abgebaut werden müssen und was passiert, wenn das Arbeitsverhältnis vorher beendet wird.
Über solche Probleme kann man stundenlang diskutieren und verhandeln und es erfolgt trotzdem keine Annäherung. Irgendwann sind alle Argumente ausgetauscht und die Parteien stehen wieder am Anfang. Ein Abschluss ist nicht in Sicht.
Irgendwann muss dann der Betriebsrat einen Schlussstrich ziehen und diese Entscheidung dem Arbeitgeber mitteilen, und zwar schriftlich:
An den
Geschäftsführer der XY GmbH
Ort, Datum
Lieber Chef,
seit über einem Jahr verhandeln Sie mit dem Betriebsrat über den Abschluss einer Betriebsvereinbarung zum Thema Arbeitszeitkonto.
Der Betriebsrat erkennt Ihre Bemühungen an, einen tragbaren Konsens zu finden. Allerdings ist der Betriebsrat der Meinung, dass aufgrund der verschiedenen Positionen eine Lösung am Verhandlungstisch nicht mehr möglich ist.
Dies soll keine Schuldzuweisung, sondern nur eine Feststellung der Tatsachen sein. Aus diesem Grunde ist es nicht zu vermeiden, dass die Entscheidung durch eine Einigungsstelle getroffen wird. Der Betriebsrat wird sich auf seiner nächsten Sitzung mit der Problematik befassen und sein weiteres Vorgehen beschließen.
Wir bitten um Ihr Verständnis. Der Betriebsratsvorsitzende steht Ihnen selbstverständlich für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert Sorgenfrei
Betriebsratsvorsitzender
3.4. Die folgende Betriebsratssitzung
In allen im vorigen Kapitel genannten Fällen ist der oder die Betriebsratsvorsitzende verpflichtet, das Problem „Weiterer Umgang mit der Betriebsvereinbarung XY“ auf die Tagesordnung einer der nächsten Betriebsratssitzungen zu setzen. Nur das gesamte Gremium des Betriebsrats kann entscheiden, wie es weitergehen soll.
Der Betriebsrat hat nur zwei Möglichkeiten: Er kann die Angelegenheit „knicken“ und nicht weiterverfolgen, also einschlafen lassen. Oder er kann den Abschluss der Betriebsvereinbarung über eine Einigungsstelle erzwingen.
Wenn der Betriebsrat mehrheitlich beschließt, dass ein Einigungsstellenverfahren eingeleitet werden soll, hat dies Folgen.
Da zu erwarten ist, dass in der Folge durch die Einigungsstelle Kosten für den Arbeitgeber anfallen, sollte der Betriebsrat bei der Beschlussfassung keine formalen Fehler machen, um die Beschlüsse gesetzeskonform zu fassen.
Formfehler in der Beschlussfassung würden unter Umständen zur Unwirksamkeit der gefassten Beschlüsse führen und das hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber anfallende Kosten nicht tragen muss oder dass gar ein Arbeitsgericht die Anträge des Betriebsrats wegen Formfeh-lern zurückweisen müsste.