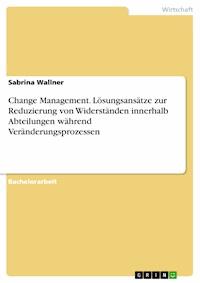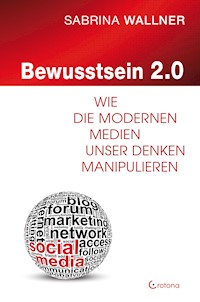
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Crotona Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit jedem Schritt in die digitale Gesellschaft wird die Gefahr größer, von Außenstehenden überwacht, kontrolliert und manipuliert zu werden. Die scheinbare Freiheit von Internet und sozialen Netzwerken ist eine trügerische. Dieses Buch liefert wichtige Entscheidungshilfen in diesem so lebensnotwendigen Prozess. In ihrer Schlussfolgerung geht. Ein aufrüttelndes Buch, das den Leser nach der Lektüre in einem Zustand "dynamischer Empörung" zurücklässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabrina Wallner
■
BEWUSSTSEIN 2.0
Wie die modernen Medien unser Denken manipulieren
SABRINA WALLNER
Bewusstsein 2.0.
WIE DIE MODERNEN MEDIEN UNSER DENKEN
■
■
■
SABRINA WALLNER wurde 1983 geboren und ist damit ein Kind des analogen Zeitalters. An die digitale Welt wurde sie durch eine mehrjährige Tätigkeit in einer Werbeagentur herangeführt. Die Leidenschaft zum geschriebenen Wort entwickelte sie mit ihrem Studium der romanischen Literaturwissenschaften an der Universität Konstanz. Seit 2012 arbeitet sie als freie Lektorin und hat zwei Jahre ausschließlich für dieses Buch recherchiert.
■
■
■
■
■
■
■
Weitere Informationen unter www.sabrina-wallner.de
ISBN(eBook) 978-3-86191-056-5
Deutsche Originalausgabe
© 2014 Crotona Verlag GmbH & Co.KG
Kammer 11 • D-83123 Amerang
Umschlaggestaltung: Annette Wagner
unter Verwendung von © kRies /117979906 – shutterstock.com
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
INHALT
Einleitung
1
Überzeugung, Beeinflussung und Manipulation
1.1
Manipulation und (biologische) Evolution
1.2
Manipulation und deren Akteure
1.3
Manipulation am Computer
1.4
Die Prägung des Menschen durch Technik
2
Steuerung und Manipulation
2.1
Technische Manipulation im Altertum
2.2
»Computer« als Hilfsmittel
2.3
Datenverarbeitung, Miniaturisierung und Steuerung: Vollendung der klassischen Mensch-Computer-Schnittstelle
2.4
Beginn der Vernetzung
2.5
Vernetzte Umgebung
3
Digitale Medien und der menschliche Körper
3.1
Die Wiederherstellung der einstigen Natur
3.2
Miniaturisierung der Geräte – Augmented Reality
3.3
Schnittstellen zwischen Mensch und digitalen Medien
3.4
Denkobjekte
3.5
Verdinglichung und Vermenschlichung
3.6
Ein möglicher Krankheitsfaktor
3.7
Technik und Krankheit
3.8
Ausgleich für das Selbst
3.9
Der Umgang mit Mobiltelefon und Wearables
3.10
Wo geht die Aufmerksamkeit hin?
3.11
Negiertes Interesse und das Selbst
3.12
Der ausgebrannte Mensch
3.13
Gewahrsein
3.14
Heilungsabsichten
3.15
Das vollkommene Selbst
4
Menschliche Intelligenz
4.1
Woraus besteht die menschliche Intelligenz?
4.2
Keine Förderung der Intelligenz – Der manipulierte Mensch innerhalb der Filter-Blase
5
Wirkungsorte der Manipulation
5.1
Computercodes
5.2
Sinneswahrnehmungen, Emotionen und Gefühle – Manipulation oder Inspiration
5.3
Empathie im Netz
5.4
Informationsflut durch Selbstoptimierung: Big Data
5.5
Zeit
5.6
Menschliche Wahrnehmung – Imaginationen und Selbst-Denken
5.7
Generation Schüler – Eine neue Alphabetisierung?
5.8
Computerspiele
6
Manipulation und Medienkonsum
6.1
Bilder
6.2
Worthülsen und Kommunikation: Die Generationen der digitalen Eingeborenen und Einwanderer
6.3
Public Relations und Werbung
6.4
Kommerzielle Technik als gefälschte Religion
7
Die Pluralität der Welten
7.1
Differenzierung zwischen »analog« und »digital«
7.2
Das Fenster zur Fiktion
7.3
Kultur der Simulation
7.4
»Schöne« vernetzte Welt: Facebook
7.5
Komplexe vernetzte Welt: Facebook
7.6
Der Mensch als soziales Wesen bei Facebook
7.7
Imaginative, virtuelle und reale Präsenz
8
Kultur des Teilens – Eine Verschiebung oder Entfremdung?
8.1
Mit-teil-ung
8.2
Mitteilung in der digitalen Kultur
8.3
Das digitale Medium als Gedächtnisort
8.4
Vervielfältigung/Kopiertechniken
8.5
Copy & Paste-Müll
8.6
Existenzielle Erfahrungen in Zeiten des Copy & Paste
8.7
Die verfälschten Welten
8.8
Existenzielle Erfahrung und Unmoral: Egoismus
8.9
Existenz und Bewusstsein: Der Zauber der Liebe
8.10
Der fragmentarische Mensch
8.11
Die Wahrhaftigkeit
8.12
Stalking im Netz
8.13
Gedenken in der Kultur des Teilens
8.14
Original und Kopie
8.15
Neues Schöpfertum durch Manipulation
8.16
Rückwärts-Geborenwerden
8.17
Zerstreuung oder Einsicht
8.18
Universales Gedächtnis
9
Manipulation und Freiheit
9.1
Freiheit als kulturelle Grundlage
9.2
Freiheit oder Freigiebigkeit?
9.3
Freiheit und Sicherheit
9.4
Investigativer Journalismus
10
Digitale Medien und Spiritualität
10.1
Spiegelerfahrung und Subjektivität
10.2
Spiegelerfahrung als Denkfigur
10.3
Digitale Medien als Spiegel: Ab-Bild im Internet
10.4
Der Mensch im Mittelpunkt seiner Wahrnehmung
10.5
Die bewusste Verbindung zwischen analoger und digitaler Welt
10.6
Natürlichkeit, Künstlichkeit und Subjektivität
10.7
Neue Medien: Realität oder Fiktion?
Epilog
Glossar
Bibliografie
Index
■■■■■
Welche Kurve läuft ein Hund, der seinen geradlinig weitergehenden Herrn von einem seitlichen Ort wieder zu erreichen sucht? […] Der Weg des »Ziels« […] [ist hier] mathematisch festgelegt oder, wie etwa beim Ansteuern des Mondes, genau berechenbar.
Bei der Flugzeugabwehr aber ist das [Ziel] kein gesetzmäßig wandelnder Stern, sondern ein Pilot, der bewusst und willkürlich die Bahn des Flugzeugs ändern wird, um den Geschossen zu entgehen.
Doch […] diese »Willkür« ist begrenzt, und zwar physiologisch, psychologisch und auch technisch begrenzt.
Wie weit lässt sich also die Bahn des Flugzeugs trotzdem voraussehen oder gar vorausberechnen? […]
Dazu bedurfte es […] genauerer Kenntnisse über das menschliche Verhalten und dabei entdeckten Norbert Wiener und […] Julian Bigelow die Bedeutung des »feed back«, der Rückkoppelung, die in der »automatic control« eine so entscheidende Rolle spielt […].1
■■■■■
Wir formen unsere Techniken, und unsere Techniken formen uns und unsere Zeit.
Unsere Zeit prägt uns, wir prägen unsere Maschinen, und unsere Maschinen prägen unsere Zeit. Wir werden zu den Objekten, die wir betrachten, aber sie werden zu dem, was wir aus ihnen machen.2
1 Flechtner, 8. (Die bibliografischen Angaben werden in den Fußnoten in abgekürzter Form vorgenommen, mit dem Verweis auf die Bibliografie am Ende dieses Buches.)
2 Turkle, Leben im Netz, 69.
EINLEITUNG
Mit dem Denken ist der ganze Mensch in seinem Verhalten und Handeln sowie in der Gestaltung seines Ichs verknüpft. Es ist die Wahrnehmung der subjektiven Realität, welche das Denken beeinflusst. Es ist aber nicht allein das Denken im naturwissenschaftlichen Sinne! Das Bewusstsein wächst ohne Manipulation über das naturwissenschaftliche Denken hinaus, hin zur schöpferischen Gestaltung der eigenen Subjektivität.
Das Vermögen, die eigene Subjektivität wahrzunehmen, kann Manipulation verhindern, kann aber auch durch Manipulation gemindert werden.
Umberto Eco beschreibt in seinem Essay Über Spiegel und andere Phänomene das Bild eines Knäuels, das sich übertragen lässt auf die – durch die Brille der digitalen Medien – erblickte Umgebung:
[Es] erscheinen Wahrnehmung, Denken, Bewusstsein der eigenen Subjektivität, Spiegelerfahrung und Semiose3 als Momente eines ziemlich unentwirrbaren Knäuels, als Punkte einer Kreislinie, auf der sich schwer ein Anfang bestimmen lässt.4
Die bewusste Wahrnehmung der eigenen Subjektivität ist für den analogen Menschen schon schwierig genug. Der vernetzte und manipulierte Mensch jedoch hat es noch schwieriger – oder vielleicht auch einfacher? Er kann die eigene Subjektivität nicht mehr wahrnehmen, weil durch die Manipulation das Denken binär oder analytisch wird, geformt durch Statistiken und Algorithmen. Durch das analytische Denken wird die Subjektivität in Objektivität verwandelt. Möglich ist diese Manipulation vor allem bei denjenigen Menschen, für welche das Analoge kaum oder gar keine Rolle mehr spielt. Die Umgebung und das eigene Selbst werden von diesem manipulierten Menschen als objektiv wahrgenommen. Diese digital geführte Wahrnehmung ist fragmentarisch. Durch Statistiken sowie binäres oder analytisches Denken ist nämlich ausschließlich ein kleiner Teil des wahren Ichs zugänglich.
Wo setzt also das Bewusstsein 2.0 an, wenn schon beim analogen Menschen kaum ein Anfang des Ich-Knäuels gefunden werden kann? Durch das Spiegelbild wird sowohl visuell als auch psychisch Selbstbewusstheit erschaffen. Dieses Bild ist visuell, laut Eco, ein Eins zu Eins-Abbild ohne »Übersetzung«.5 Aber schon allein durch das Kamera-Objektiv ist die Realität fragmentarisch oder verzerrt. Wie sieht die Wahrnehmung der eigenen Subjektivität, die ja auf Selbstbewusstheit baut, dann erst durch das digital bearbeitete Bild aus? Welche Rolle spielt die „Illusion von Realität“6 in der digitalen Sphäre?
Ich versuche in diesem Buch, das Ich-Knäuel zu ent-wickeln. Bei dieser Entwicklung im doppelten Sinne steht immer die Bildung von Bewusstsein im Mittelpunkt. Dieses Buch ist kein kulturpessimistisches. Im Gegenteil: Je bewusster ein Mensch ist, desto inspirativer und schöpferischer kann er mit der digitalen Kultur umgehen.
Wenn ich in diesem Buch vom vernetzten Menschen spreche, handelt es sich nicht unbedingt gleichzeitig um den manipulierten Menschen. Es gibt vernetzte Menschen, die das Digitale bewusst in ihren Alltag integrieren und sich aus ihrem Ich heraus führen lassen. Es gibt aber auch die manipulierten Menschen, die sich durch das Digitale leiten lassen und damit ohne Medienmündigkeit leben. Es sind Menschen, die jeder technischen Neuerscheinung hinterherhetzen, ganze Nächte in einer Apple-Store-Warteschlange verbringen, um nichts Neues zu verpassen. Ein gesunder Umgang mit Technik und mit dem Ich ist so nicht möglich.
Durch die rasche und intensive Verbreitung der digitalen Geräte7 und ihr Eindringen in immer mehr Aspekte des Alltags ist das Thema Bewusstsein 2.0 akuter denn je. Dabei liegt der Anfang des Verstehens beim Individuum: Erkennen sollte sich zunächst jeder selbst in seinem Umfeld mit den dazugehörigen Medien. Der Mensch kann sich selbst einen Spiegel aufstellen, um sich in seiner Umgebung wahrzunehmen. Wenn der Mensch der Technik nicht die Macht über die eigene Subjektivität überlassen will, muss er begreifen, was geschieht. Er muss das eigene Denken zu einem bewussten Denken transformieren, sich über die eigene Subjektivität im Umgang mit den Medien bewusst werden.
Der Mensch kann in privaten Situationen selbst entscheiden, ob er Medien nutzen will. In sozial-interaktiven Situationen wird er jedoch von verschiedenen Medien beeinflusst und ist zum Teil abhängig von ihnen. Dies gehört zur derzeitigen »Conditio humana«, durch die der Mensch Gefahr laufen kann, sein eigenes wahrhaftiges Ich aus den Augen zu verlieren. Musik berieselt den Menschen in der Öffentlichkeit, Fernsehbilder laufen in Geschäften über Bildschirme, Schnappschüsse von Familienausflügen werden stolz auf dem Handy umhergezeigt oder bei Facebook den Freunden und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bei Bewerbungen für eine Arbeitsstelle wird immer öfter von der Arbeitgeberseite her der Facebook-Account kontrolliert. Kameras in Schaufensterpuppen analysieren die Gesichtsausdrücke der potenziellen Käufer. Das Verhalten der Xbox-Nutzer wird über die Bewegungssteuerung namens Kinect beobachtet. Über die Google-Datenbrille Glass, ein digitales, computerisiertes Sehgerät mit Mikrofon und Kamera, können Videoaufnahmen aus der exakten Sicht und Bewegung des Trägers gemacht und umgehend ins Netz übertragen werden. Nicht nur Kühlschränke, Mülleimer und Häuser, sondern die ganze Umgebung des Menschen soll intelligent werden und Gedanken oder Verhalten der Nutzer lesen können. Wo bleibt dabei die Intelligenz und die Freiheit des Menschen – ein Grundstock zur Wahrnehmung der eigenen Subjektivität?
Wenn in diesem Buch von Manipulation die Rede ist, schließt das auch und vor allem die Umformung durch einen »technischen« Handgriff ein, denn hier wird nicht danach gefragt, wer der »Manipulator«8 ist – so etwas wie den großen »bösen« Internet- oder Elektronikkonzern, der es auf die »Seelen« der Internet-Nutzer abgesehen hat, gibt es nicht. Nach Schuldzuweisungen zu trachten, wäre kontraproduktiv für die Entwicklung eines bewussten Umgangs mit allen modernen Medien. Es wird in diesem Buch vielmehr erkundet, welche Strukturen manipulierend auf den Nutzer einwirken können, wenn dieser es zulässt. Dieses Buch dient auch keineswegs dazu, die digitalen Medien zu verteufeln oder einen Weg zu finden, ihnen zu entgehen. Diese Medien sind – mit ihren guten und schlechten Seiten – Teil unserer Welt. Wozu dieses Buch einen Anstoß geben will, ist Bewusstheit im Umgang mit den modernen Medien. Dabei sollte nichts pauschalisiert werden: Jedes Individuum steht in einem persönlichen Verhältnis zu den digitalen Medien, und jede Situation ist von jeder anderen zu differenzieren.
Es ist an der Zeit, das Bewusstsein zu erweitern und neue Denkwege zu finden:
Für ein besseres Erkennen unserer selbst müssen wir uns allen Denkwegen, bereits vollzogenen oder vielleicht möglichen, öffnen.9
Diese Offenheit gibt es in der bisherigen Diskussion über Medienmanipulation kaum. Viele der bisherigen Diskussionsteilnehmer sind streng ihrer eigenen Theorie verfallen.
Jedes Individuum sollte sich bewusst darüber sein, inwiefern es die digitalen Medien nutzen möchte oder muss, ob für Berufliches oder Privates. Niemand sollte sich durch blinkende Werbung oder ständiges E-Mail-Abrufen von seinem Ziel ablenken lassen. Interaktive Werbung im Netz oder der innere Drang nach Neuigkeiten und das damit verknüpfte Abrufen von E-Mails sind nur ein kleiner Teil einer möglichen Manipulation. Was noch hinter dem Begriff Manipulation steckt, wird im Folgenden erklärt.
Der vernetzte Mensch sollte kritisch sein und sich Fragen stellen, wie etwa jene: „Wann werde ich zur »Maschine« und handele automatisch, abgelenkt von meinem Ziel? Vermag ich es überhaupt, meine eigene Subjektivität bewusst wahrzunehmen, oder ernähre ich durch mein Denken und Handeln allein mein digitales Ich?“ Kritisches Denken ist notwendiger denn je. Der »analog-digitale« Mensch sollte versuchen, wach zu reflektieren, wenn es um das Vereinen dieser beiden Welten geht. Dazu muss ihm klar sein, wie Manipulation funktioniert.
3 Fachbegriffe werden am Ende dieses Buches im Glossar erklärt. Im Index sind die entsprechenden Seitenzahlen zu diesen Begriffen zu finden.
4 Eco, 27.
5 Vgl. ebd., 34.
6 Ebd.
7 Ich zähle zu den digitalen Medien alle Medien, die mit einem Computer verbunden sind, wie der smarte Fernseher, oder die mittels Computer erreichbar sind, inklusive Zeitung, Radio und Fernsehen. Ich zähle dazu auch originär analoge Medien, die heutzutage bildschirmbezogen existieren. Die meisten digitalen Medien bieten heute eine transmediale Erlebniswelt. Es sind die sogenannten tertiären Medien, in welche Primär- und Sekundär-Medien eingespeist sind: „Primäre Medien sind Sprache, Gestik und Mimik, »face to face«-, direkte Kommunikation. Sekundäre Medien sind solche, die eines technisch hergestellten Trägers bedürfen, während die Rezeption direkt, ohne technische Hilfsmittel, vor sich geht: Wand- oder Tafelbilder, Schrift- und Druckmedien, Grafiken, Fotografie. Tertiäre Medien haben einen technisch hergestellten Aufnehmer, Träger oder Sender sowie eine technisch vermittelte Rezeption: Telegraf/Telefon, Hörfunk, Film/TV, Multimedia.“ (Pross, Medienforschung, 10; 127-262; zitiert aus: Kerlen, 13f.) Auch analoge Werkzeuge und Geräte werden als Vorläufer und Integrationen (wie der Wecker) der digitalen Medien eine Rolle spielen, denn auch Werkzeuge und Geräte haben mediale Eigenschaften, wenn sie zum „Gestalten, Fixieren, Ordnen, Strukturieren, Speichern, Erinnern, Überliefern sowie Übermitteln“ (Kerlen, 14) dienen.
8 Wenn also im ersten Kapitel die Rede vom »Manipulator« ist, dann ist damit kein Konzern gemeint. Vielmehr zielt der Begriff »Manipulator« in diesem Kontext auf einen abstrakten Akteur, der an der Manipulation beteiligt ist; nicht auf eine spezielle Person oder einen einzelnen Konzern! Es bedarf dieses abstrakten Begriffes, um das Machtgefälle, das an einer Manipulation beteiligt ist, deutlich zu machen.
9 Pöppel, 8.
1
ÜBERZEUGUNG, BEEINFLUSSUNG UND MANIPULATION
1.1
Manipulation und (biologische) Evolution
Bis zu vierhundert Mal pro Tag10 wirken auf den heutigen Durchschnittsbürger Signale ein, die mindestens auf Beeinflussung hinauslaufen sollen. Plakate an der Bushaltestelle, an mit Brettern abgeschirmten Baustellen oder in Bildungseinrichtungen. Am schwarzen Brett sind Augen und Gehirn durch die Informationsflut in ihrer Höchstleistung gefragt, was den Input angeht. In der Fußgängerzone bekommt man Angebote wie »ein Zeitungsabonnement für zwei Wochen geschenkt«. Das ist jedoch die analoge Seite, um die es hier nur am Rande geht. Im »Digitalen« potenzieren sich die Informationen ins schier Endlose. Die vielen Informationen, die der Mensch selbst auf seinem Computer speichert, sind über plurale und simultane Fenster zugänglich.11 Über das Fenster zum Netz, den Internetbrowser, sind die Informationen simultan in potenzierter Form erhältlich – und nicht nur das, der Informationsstrom kehrt sich hier um in das Gegenteil von »erhältlich« oder »zugänglich«. Die Informationen strömen auf den Nutzer ein, ohne, dass dieser es will, und sie setzen sich über Cookies auf dem Computer fest. Über Cookies wird die personalisierte Werbung gesteuert, wodurch der Mensch mit Informationen eingedeckt wird, die auf seine Klicks – nicht auf ihn selbst – zugeschnitten sind. Durch diese Umkehrung der Machthierarchie – mit dem Klick gibt der Mensch die Macht über sich selbst in gewisser Weise ab – werden die digitalen Informationen zu einem Instrument der Manipulation, das die menschliche Aufmerksamkeit spätestens nach der Diagnose »Burnout« lahmgelegt hat. Der menschliche Denkraum erscheint in gewisser Weise durch das digitale Werkzeug namens Computer erweitert12, doch die Ströme innerhalb dieses Raumes kann der Mensch kaum kontrollieren. Nicht von ungefähr kommt die Bezeichnung »virale Werbung«. Wer einen digitalen Virus abwehren will, braucht sozusagen ein psychisches Immunsystem, das auf Bewusstheit im Umgang mit digitalen Medien basiert!
Ist man auf diese virale Flut nicht bewusst vorbereitet – hat man kein oder ein schwaches psychisches Immunsystem, das virale Angriffe aus dem Netz abwehren könnte – bricht die Psyche irgendwann zusammen. Wenn der Mensch sich seine biologischen Grenzen nicht bewusst macht, kommt er mit der sich ständig beschleunigenden Digitalisierung nur schwer zurecht.
Diese Erfahrungen mussten erst gesammelt werden. Keiner konnte vorausahnen, was die Digitalisierung mit dem Menschen machen würde. Obwohl das nicht ganz stimmt, wenn man einmal die Literatur betrachtet: Auf fiktiver Ebene beschreibt George Orwell im Jahre 1949 in seinem Roman 1984 so etwas wie Vorahnungen; und Benjamin Stein liefert im Jahre 2012 mit seinem Roman Replay fast schon eine Art fiktive Gegenwartsbeschreibung des transparenten, völlig durchschaubaren und digital manipulierten Menschen. Wie die Zukunft wirklich aussieht, kann nur mit Unsicherheit prophezeit, nicht mit Gewissheit vorhergesagt werden. Rückblickend ist jedoch eines sicher: Es gilt, sich ein Bewusstsein zu erschaffen, das durch das Wissen darum, was Beeinflussung von außen ist, entsteht und es ermöglicht, sich auf sein eigenes Ich, seine eigene Subjektivität, zu konzentrieren.
Es sollte ein Umdenken stattfinden, in dem das Individuum im Zentrum steht. Das heißt keinesfalls, dass das Individuum egoistisch werden muss. Es sollte jedoch lernen, seinen Fokus wieder auf sich selbst zu lenken, nachdem dieser – beeinflusst durch Industrialisierung und Digitalisierung – nach außen auf die Technik gelenkt worden ist.
Selbstverständlich ist es unmöglich, in einer Gesellschaft zu leben, ohne beeinflusst zu werden. Aber sobald die Beeinflussung negative Auswirkungen für das Individuum haben könnte, sollte das Bewusstsein 2.0 eingreifen, denn es kann sich um Manipulation handeln, wenn es um kommerzielle Technik geht. Wobei Manipulation noch mehr bedeutet als negative Auswirkungen für das Individuum. Manipulation ist eine absichtliche Beeinflussung des Mitmenschen zum eigenen Vorteil. Beeinflussen kann man andere auch unabsichtlich. Das wäre im Idealfall Inspiration innerhalb des Spektrums der Stärke, soweit es Beeinflussung betrifft.13 Inspiration steht auf der positiven, Manipulation auf der negativen Seite dieses Spektrums. Was die Absicht angeht, gibt es feinste Nuancen. Die Grenzen sind fließend. Konditionierter Einfluss steht sicherlich nahe bei der Manipulation, die Absicht ist jedoch nicht jeweils gleich stark. Geht es um Überzeugung, ist es nicht sofort klar, zu wessen Vorteil beeinflusst wird.
Eindeutig ist, dass Überzeugung nicht erst mit der Sprache aufkam:
Machen wir uns auf die Suche nach den frühesten Formen von Überzeugung, vorsprachlichen, vor-bewussten, vor-menschlichen Formen. Das verblüffende Ergebnis: Überzeugung ist nicht nur endemisch für jegliche irdische Existenz, sondern auch systemisch, als Teil der Ordnung der Natur und der Entstehung des Lebens.14
Für die vorsprachliche, vor-bewusste, vor-menschliche Form der Beeinflussung geht Dutton in der biologischen Evolution zurück und nennt als Beispiel für eine solche Form der Beeinflussung unter anderem den „Tanz der Honigbienen, wenn sie ihren Artgenossinnen den Weg zu einer Futterquelle weisen wollen“.15
Doch der Mensch steht heute an anderer Stelle der Evolution, er steht inmitten der Digitalisierung. An einer Stelle, an der er begreifen muss, dass Manipulation tatsächlich existiert! Bei Tieren läuft jegliche Form von Überzeugung instinktiv ab. Bei beiden jedoch ist es eine Sache des Überlebens, beim Tier physisch, beim Menschen heute vor allem (erst einmal) psychisch.
Der Mensch steht inmitten eines Kampfes um seine Aufmerksamkeit. Die menschlichen Sinne werden durch die digitalen Medien scheinbar unendlich gereizt. Die Reizung und Täuschung der Sinne ist auch ein Mittel zur Überzeugung in der Tierwelt. Durch Mimikry „ahmt ein Mitglied einer Spezies die Eigenarten einer anderen Spezies nach, um einen persönlichen Vorteil zu erlangen“.16 Diese Struktur teilen die Menschen nicht nur mit den Tieren, sondern der Mensch hat sie sozusagen von den Tieren geerbt und setzt diese heute in der Werbung ein:
Das Geheimnis guter Werbung besteht nicht darin, dass sie unsere rationalen, kognitiven Fähigkeiten anspricht, sondern dass sie sich direkt an die die Gefühle verarbeitenden Areale unseres Gehirns wendet. An uralte Strukturen und Mechanismen, die wir nicht nur mit den Tieren teilen, sondern de facto von ihnen geerbt haben.17
Diese uralten Strukturen sind nicht Teil des Bewusstseins, sondern Teil des menschlichen Unbewussten. Im Unbewussten, sozusagen »im Blut«, trägt der Mensch durch die Evolution die „biologische Basis für Beeinflussung“.18 Wenn es dem Menschen gelingt, diese Basis vom Unbewussten ins Bewusstsein zu holen, hat er dadurch gleichzeitig eine Basis für sein psychisches Immunsystem geschaffen. Es geht darum, ein Bewusstsein für den „kognitiven Prozess“19 zu erlangen, ein Bewusstsein darüber, wie das „Hirn die Welt bewertet“.20 Die Wahrnehmung der Umgebung funktioniert über Vorstellungen, Emotionen und Erinnerungen21:
Wenn man die Umgebung von Menschen lange genug manipuliert und sie mit Reizen überflutet, über die sie keine Kontrolle haben, dann werden sich früher oder später die Zuschreibungen ändern.22
Assoziationen und Bilder werden also im Kopf des Menschen durch Manipulation von Vorstellungen, Emotionen und Erinnerungen umgeschrieben. Das psychische Immunsystem muss deshalb Vorstellungen, Emotionen und Erinnerungen schützen – und das funktioniert über das Bewusstsein.
1.2
Manipulation und deren Akteure
Manipulation läuft in der heutigen Welt innerhalb des kognitiven Prozesses über den Kanal der Sprache, und es sind mindestens zwei kognitive Akteure beteiligt, deren Hirne die Orte für Manipulation »bereitstellen«. Die Sprache ist sozusagen Kanal und Vehikel, mit deren Hilfe Manipulation durch die Hirne fortbewegt wird. Die Sprache kann aber auch der Stein sein, der den Prozess zum Stillstand bringt.
Das sind die »demografischen Verbindungen« zwischen diesen beiden Akteuren. Zielorte des »Manipulators« sind insbesondere der Glaube des potenziellen Opfers, mit dem Emotionen und Ängste zusammenhängen:
Wenn man die Antikörperproduktion des Hirns gegen Glauben reduziert, und zwar lange genug, dass der Virus der Information, die […] [verbreitet werden soll], eindringen und sich festsetzen kann, dann gibt es keine Grenzen für Überzeugung. Das Problem besteht nur darin, dieses Immunsystem zusammenbrechen zu lassen.23
Nach der Lektüre von Duttons Gehirnflüsterer gewinnt man den Eindruck, als würde jeder Mensch manipuliert werden können, sofern sich der »Manipulator«, der machtvollere Akteur, an drei bestimmte Punkte halte: Aufmerksamkeit, Annäherung und Anbindung. Damit könne der freie Wille des »Opfers« geknackt werden.24 Mit diesen Bindungen, die aus den drei Faktoren folgen, entsteht ein Machtgefälle. Doch lässt ein Akteur das Ungleichgewicht zwischen machtvoll und machtlos gar nicht erst zu, dürfte Manipulation nicht greifen, zumindest theoretisch, denn Macht entsteht nur, wo das »Opfer« sich in die Opferrolle begibt und damit Macht erst zulässt, ansonsten existiert sie nicht.
Schwer wird Manipulation dann, wenn es um ein Individuum geht. Massen sind leichter zu manipulieren, da der Grundstock der Manipulation, die Beeinflussung, ein sozialer Vorgang ist25 und eine bestimmte Meinung in der Gruppe stärker werden kann:
Die Volksmeinung setzt sich zusammen aus überlieferten Vorurteilen, Symbolen und Klischees und den griffigen Sprüchen, die die Anführer dafür gefunden haben.26
In all diesen Fällen ist das einzige Heil-Mittel, den Fokus auf sich selbst zu richten, und gleichzeitig das Umfeld, im übertragenen Sinne, in einem diffusen Blick zu behalten, weil das Blickfeld so größer ist und damit auch die Möglichkeit zum Erkennen, zur Reflexion und zur Abwehr. Diese Technik ist auch in Kampfsportarten Mittel zur Wahrnehmung eines Angriffs von außen.
Doch jeder Mensch hat „psychologische blinde Flecken“27, die sogenannten Probleme mit sich selbst. An diesen Punkten ist das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein des Menschen zu schwach ausgeprägt. Wenn diese Punkte von den Algorithmen der Digitalisierung erst einmal erkannt werden, funktioniert die digitale Manipulation auch im menschlichen Gehirn. Doch so weit sind wir noch nicht – oder doch?
Zudem hat jeder Mensch nur eine bestimmte Kapazität, um Informationen aufzunehmen. Wird die Informationsflut zu groß, schaltet das Hirn auf »Standby«. In diesem Fall vermag es das Gehirn nicht mehr, die Informationen herauszufiltern, die wichtig sind für das, was man gerade macht.28 Handlungen werden in der Folge zum Großteil vom Unbewussten gesteuert. In das Unbewusste kann ein »Manipulator« eindringen, wenn das Bewusstsein – das mit dem psychischen Immunsystem verknüpft ist – »heruntergefahren« ist. Der »Manipulator« kann das potenzielle »Opfer« auf diese Weise kognitiv ablenken.29
Das geht noch leichter, wenn der »Manipulator« erst einmal Denkmuster erkennen kann. Die menschlichen Denkmuster fungieren im Gesamten wie eine Art Autopilot30, der den Menschen durch den Alltag führt. Es sind unbewusste Handlungen, die von den Denkmustern geleitet werden. Diese zeigen dem Menschen seine biologischen Grenzen auf, denn der Mensch meistert den Alltag nur dann, wenn er die kleinen, sich wiederholenden Dinge unbewusst bewältigt. Sobald zu den kleinen Dingen des Alltags auch digitale Aktivitäten gehören, wird der Autopilot ein potenzieller Wirkungsort des »Manipulators«. Zudem ist die Komplexität der Welt an manchen Stellen der Menschheitsentwicklung nicht zu erfassen, derzeit vor allem durch die rasche Entwicklung der Technik:
Wenn eine Welt, unsere Welt, viel zu komplex ist, um sie im Rahmen von Grundprinzipien zu erklären, das heißt, wenn die Welt für den menschlichen Geist zu komplex ist, als dass er sie als mentales Konstrukt aus Grundprinzipien entwickeln könnte, dann ist der menschliche Intellekt außerstande, ihre Wahrheit zu definieren. Wenn wir dies erkannt haben, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als durch die Welt zu navigieren, ihre Regeln aus konkreten Erfahrungen zu erlernen, sie zu erfühlen, an ihr teilzunehmen und sie zu benutzen. Indem wir unsere analytische Intelligenz ausklammern, können wir die Welt manchmal besser bewältigen. Der Computer eröffnet uns die Chance, dass wir durch Simulationen einen anderen erkenntnismäßigen Zugang zu ihr erhalten.31
Man muss an der vernetzten Welt teilnehmen, um zu erfahren, wer dieser potenzielle »Manipulator« ist und wer das potenzielle »Opfer«. Der Mensch muss die Vernetzung erleben und erfahren, was hinter der sich schnell entwickelnden Technik steckt. Er muss während dieses Prozesses auch begreifen, dass seine Welt immer mehr zur Simulation und damit das Fiktive immer mehr zur Wahrheit umgeformt wird. Diese schrittweise Übersetzung ist Teil der Manipulation!
1.3
Manipulation am Computer
In den ersten beiden Unterkapiteln wurde erörtert, wie Manipulation zwischen Menschen funktionieren kann. Nun soll allein der Computer im Hinblick auf den Begriff »Manipulation« beleuchtet werden.
Der Informatiker Joseph Weizenbaum beschreibt den Computer als eine Maschine, „die mit Symbolen manipuliert“32, die „logische Symbolmanipulationen“33 vornimmt – es ist jedoch immer der Mensch, von dem diese Manipulation ausgeht, denn er ist der Erbauer und Programmierer. Trotzdem hat der Computer eine gewisse Machtstellung inne, die wiederum auch vom Menschen und dessen Wahrnehmung sowie Zuschreibung herrührt.34
Technisch gesehen, beschreibt Weizenbaum die Manipulation am Computer wie folgt:
Die Funktion eines Computers besteht in der Manipulierung von Informationen, nicht nur in deren Übertragung von einer Stelle zur anderen. Und die Manipulierung von Informationen ist […] im Wesentlichen eine Sache der Transformation.35
Die Manipulierung oder Manipulation ist dem Computer also technisch integriert.
Um die Struktur der technischen Manipulation zu vervollständigen, muss noch zwischen dem analogen und dem digitalen Computer unterschieden werden. Die Turingmaschine ist ein analoger Computer, eine Rechenmaschine, welche die Symbolmanipulation analog sichtbar macht:
Eine Turingmaschine […] erhält die Information, mit der sie arbeiten soll, über ein Band zugeführt. Sie muss dieses Band nacheinander ablesen und neu bespielen. Ein moderner Computer hingegen speichert einen Großteil der Information, die er manipuliert, in seinem Inneren.36
Die manipulierten Informationen des digitalen Computers als unsichtbare Informationen sind die Grundlage für eine versteckt ablaufende Manipulation des menschlichen Unbewussten.
Diese technischen Gegebenheiten, vor allem die Transformation von Informationen und die versteckte Informationsmanipulation im Inneren des digitalen Computers, prägen den Menschen, der mit ihm arbeitet. Doch hat die Prägung des Menschen, ausgehend von technischen Werkzeugen, nicht erst mit diesen versteckten technischen Manipulationen im digitalen Computer ihren Anfang genommen.37
1.4
Die Prägung des Menschen durch Technik
Der heutige Mensch ist geprägt durch den enormen technischen Fortschritt. Sein Körper wird immer mehr von Technik durchdrungen werden, sein Geist ist es jetzt schon gänzlich. Doch woher rührt diese Prägung?
Der Mensch hat von Urzeiten an Werkzeuge gebaut. Das erste, das seinen Geist »technisch« geprägt und transformiert hat, war die Uhr:
Die Uhr ist nicht nur ein Mittel, um über Stunden Buch zu führen, sondern um den Handlungen der Menschen eine Gleichzeitigkeit zu verleihen […] seit dem 13. Jahrhundert gibt es zuverlässige Urkunden über mechanische Uhren, und 1370 ist in Paris von Heinrich von Wyck eine »moderne« Uhr nach einem vorzüglichen Entwurf gebaut worden. Mittlerweile gab es Glockentürme, und falls die neuen Uhren, wie das bis zum 14. Jahrhundert noch der Fall war, kein Zifferblatt und keinen Zeiger hatten, der die zeitliche in eine räumliche Bewegung umsetzte, so schlugen sie zu allen Ereignissen die Stunde mit der Glocke an. Die Wolken, die die Sonnenuhr lahmlegen konnten […] waren für die Zeitmessung kein Hindernis mehr: sommers und winters, bei Tag wie bei Nacht konnte man den gemessenen Schlag der Glocke hören. Das Instrument verbreitete sich schnell auch außerhalb der Klöster; und das gleichmäßige Schlagen der Glocken brachte eine neue Regelmäßigkeit in das Leben des Handwerkers und des Kaufmanns. Man kann fast sagen, dass die Glocken des Uhrturms das Leben in der Stadt bestimmten. Aus dem Messen der Zeit wurde die zeitliche Regelung der alltäglichen Verrichtungen, die zeitliche Kontrolle der Arbeitstätigkeit und die Rationierung der Zeit.38
Die Uhr, die heute gewohnheitsmäßig am Körper getragen wird, hat den Geist des Menschen – von dieser Zeit an bis heute – durch und durch geprägt. Mumford beschreibt dieses Werkzeug als die „entscheidende Maschine des modernen Industriezeitalters“.39 Diese Maschine, dieses Werkzeug hat dem Menschen eine Regelmäßigkeit gegeben, die von der Natur des Menschen gelöst stattfindet.40 Es ist sozusagen eine neue Ebene der Orientierung: Hat der Mensch sich vor der Prägung durch den Glockenschlag noch an natürlichen Ereignissen wie Sonnenauf- und Sonnenuntergang orientiert sowie am Krähen des Hahns, ist dies nach der Prägung des menschlichen Geistes durch den ständigen regelmäßigen Schlag nicht mehr »notwendig«.41 Die Aufmerksamkeit des Menschen ist durch den Glockenschlag umgelenkt worden, weg von der Natur, hin zu einem künstlichen, vom Menschen erschaffenen »Ereignis«, das mit Gleichklang und Verlässlichkeit von außen auf den Menschen einwirkt und seinem Geist eine Vereinfachung in der Ereignishaftigkeit bringt.42 Die Art des Ereignisses ist einfacher geworden und wirkt verlässlich Stunde für Stunde auf Körper und Geist ein. Das bringt den durch die Uhr geprägten Menschen auf eine andere Ebene – jene der Künstlichkeit. Zudem wird der Mensch mit den Stunden, Minuten und Sekunden durch eine abstrakte mathematische Maßeinheit geprägt, die den Geist für das naturwissenschaftliche Denken präpariert hat. Das naturwissenschaftliche Denken baut auf diese abstrakte mathematische Maßeinheit als Grundbaustein des modernen menschlichen Geistes auf.43 Teil dieses Grundbausteins ist eine gewisse Entmündigung des Menschen durch diese Maßeinheit: Bestimmt – wie Homer beschreibt – der Mensch vor der Prägung durch die Uhr seinen Tagesablauf selbst durch spezielle Ereignisse, „durch Arbeiten, die begonnen oder beendet wurden, wie das Einspannen (Morgen) und das Ausspannen (Abend) der Ochsen“, ist es nach der Prägung durch die Uhr eine Maschine, die Beginn und Ende eines jeden Arbeitstages einläutet.44 Doch natürlich – dies muss immer wieder betont werden – sind es die Menschen selbst, die diese Entmündigung historisch einleiteten und zuließen.45 Auf diese Prägung des menschlichen Geistes durch die abstrakte mathematische Maßeinheit baut eine neue Art der Wahrnehmung auf. Der Blick wandert weg von sich selbst, weg von der menschlichen Natur, hin zu einem künstlichen Werkzeug. Somit verändert sich mit der Wahrnehmung der Zeit auch die Wahrnehmung des Raumes.46 Vor der Prägung durch den Glockenschlag ist es der Mensch gewohnt, die „Gesetzmäßigkeiten in seiner Lebenswelt“ durch die Bewegung der Erde und durch den Einfluss der Gestirne auf die Erde wahrzunehmen.47 Mit dem Glockenschlag wird die Aufmerksamkeit auf den Glockenschlag gelenkt – dadurch wird die Ereignishaftigkeit in der Wahrnehmung des Menschen simpler. Der Gong wirkt auf das Unbewusste ein, es ist nicht mehr notwendig, die Natur bewusst zu lesen, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen.
Vor der Prägung durch den Glockenschlag nimmt der Mensch Raum und Zeit durch eine „Abfolge beständig sich wiederholender Ereignisse“ wahr.48 Mit der Prägung durch den Glockenschlag wird die Zeit zu einer Summe abstrakter mathematischer Einheiten, die den Raum in der Wahrnehmung des Menschen in gewisser Weise überdeckt49: Die Mathematik überdeckt die Natur. Man könnte auch anders herum argumentieren und sagen, die Uhr hätte den Menschen von einer Art Abhängigkeit von der Natur befreit.50 Von Befreiung oder gar Freiheit kann aber kaum die Rede sein, denn es ist dem Menschen eine neue Abhängigkeit entstanden – die vom Werkzeug Uhr. Diese Abhängigkeit ist insofern zu verstehen, als „das Hungergefühl als Anreiz zum Essen“51 verworfen und stattdessen die Mahlzeit eingenommen wurde, „wenn ein abstraktes Modell einen bestimmten Zustand erreicht hatte, das heißt, wenn die Zeiger einer Uhr auf bestimmte Marken auf dem Zifferblatt wiesen […], und dasselbe gilt für die Signale zum Schlafengehen, Aufstehen und so weiter.“52
Diese Abhängigkeit wird dem Menschen immer gegeben sein, sei es nun die Abhängigkeit von der Natur oder die Abhängigkeit von der Technik. Es sind die Lebensumstände, welchen der Mensch immer unterworfen sein wird, da er einen Bezug zu seiner Umwelt hat, über welche teilweise sein Bewusstsein sich formt.
Die Uhr bringt den Menschen auf eine neue Ebene der Wahrnehmung, auf eine von der Natur unabhängige, autonome Ebene.53 Über diese Autonomie ist die Macht des Menschen über die Natur zu erklären54, der Mensch hat sich mithilfe von Werkzeugen die Erde untertan gemacht, gleichzeitig aber eine neue Machthierarchie erschaffen. Das Werkzeug kann dem Menschen sein Leben diktieren, wenn der Mensch es zulässt – und er hat es zu Beginn des 20. Jahrhunderts in großem Maße zugelassen.
Mit der Industrialisierung vertiefte sich die menschliche Prägung durch seine Werkzeuge. Gab der Glockenschlag dem Handwerker noch eine neue Regelmäßigkeit im Arbeitstag, wie oben durch Weizenbaum dargelegt, wurde der Arbeiter während der Industrialisierung zu einer Arbeitsoptimierung durch den Sekundenschlag getrieben.55 Die Zeit wurde mehr und mehr zum Antrieb des Menschen. Als die erste Dampfmaschine um 1700 von Thomas Savery56 erbaut wurde, war „die Quantifizierung von Raum und Zeit bereits ins allgemeine Bewusstsein übergegangen“.57 Ergebnis der Prägung des Menschen durch die Dampfmaschine war also nicht mehr die Transformation des Bewusstseins, von der Natürlichkeit weg hin zur Künstlichkeit, sondern es war die radikale Veränderung der Gesellschaft58 im Äußeren:
Spätere Werkzeuge, zum Beispiel das Telefon, das Auto oder das Radio, trafen auf eine Kultur, die sich bereits an dem orientierte, was die Wirtschaftswissenschaftler als Schweineprinzip bezeichnen: Wenn irgendetwas gut ist, so ist mehr davon noch besser. Das Bedürfnis nach erweiterten Kommunikationskapazitäten und höheren Geschwindigkeiten, oft erst durch die neuen Geräte selbst in Verbindung mit neuen Marketingtechniken geweckt, ermöglichte deren weite Verbreitung in der Gesellschaft sowie die unter dem Einfluss der neuen Geräte immer schneller erfolgende gesellschaftliche Umwandlung.59
Es sind also Zeit und Geräte, die dem Menschen während der Industrialisierung von außen seinen Arbeitstag diktieren, daraus erwuchs der Taylorismus.60 Diese Komponenten transformieren den Menschen während der Industrialisierung zu einer Art Maschine, zunächst was die Arbeitsweise angeht; aber letztendlich prägen sie auch Arbeits- und Denkweise.
Mit dieser „Entfremdung des Menschen von der Natur“61 vor und während der Industrialisierung kommt die naturwissenschaftliche Denkweise voran, wie Weizenbaum beschreibt, und „als wir soweit gediehen waren, platzte der Computer in unsere Gesellschaft“.62
Die naturwissenschaftliche Denkweise bildet die Basis für die Manipulation, die heute vom digitalen Computer ausgehen kann. Es ist die neue, naturwissenschaftlich geprägte Welt, die digitale Abhängigkeit des Menschen von seinen Maschinen, die mit der Uhr ihren Anfang nahm. Die Gesellschaft, wie sie heute besteht, würde ohne digitale Maschinen zusammenbrechen.
Innerhalb dieser Abhängigkeit besteht natürlich ein Machtgefälle, und wenn alle anderen Voraussetzungen von beiden Seiten aus gegeben sind, wenn beide Akteure der Manipulation zustimmen (der eine bewusst, der andere unbewusst), dann ist eine Manipulation zwischen Mensch und Maschine möglich. Hier wird das Medium dann zur Plattform der Manipulation und zum „gestalteten Inhaltsträger zwischen Produzent und Rezipient, zwischen Gestalter und Nutzer“.63
10 Vgl. Dutton, 10f.
11 Vgl. Turkle, Leben im Netz, 41.
12 Vgl. ebd.
13 Vgl. zum Spektrum der Stärke von Überzeugungen: Dutton, 289.
14 Ebd., 22f.
15 Ebd., 24.
16 Ebd., 26.
17 Ebd., 31.
18 Ebd., 82.
19 Ebd., 83.
20 Ebd.
21 Vgl. ebd., 142.
22 Ebd., 190.
23 Ebd., 297.
24 Vgl. ebd., 87f.
25 Sam Harris; Sameer A. Sheth; Mark S. Cohen: „Functional Neuroimaging of Belief, Disbelief, and Uncertainty“, in: Annals of Neurology, 63(2) (2008), 141-147; zitiert aus: Dutton, 87; 305.
26 Bernays, 83.
27 Dutton, 89.
28 Vgl. ebd., 90.
29 Vgl. ebd.
30 Vgl. ebd., 95: Dutton bezeichnet den gesunden Menschenverstand als Autopiloten. Doch wird der Autopilot im allgemeinen Sprachgebrauch als unbewusstes Denkmuster angesehen, das den Menschen den Alltag bewältigen lässt, weil die Gehirnkapazität, die Kapazität des Bewusstseins, irgendwann an ihre Grenzen kommt; oder der Autopilot wird aktiviert, wenn der Mensch durch digitale Medien manipuliert wird. Alltägliche Handlungen, wie das Einschalten der Kaffeemaschine, macht der Mensch automatisch, er kann sich nicht jeden Tag von Neuem bewusst auf Handlungen konzentrieren, die nebenbei laufen müssen, um den Alltag zu meistern. Der gesunde Menschenverstand hingegen ist ein bewusstes Denkmuster, das den Menschen aus seinen Erfahrungen heraus lehrt, die richtige Entscheidung für einen bestimmten Moment zu treffen. Somit gibt es eine Handlungsstruktur, durch die der Mensch Zugriff auf das Unbewusste hat. Das ist wiederum die Intuition, die mit dem gesunden Menschenverstand verknüpft ist. Der Mensch ist also nicht grundlegend fremdgesteuert durch das Unbewusste, weil er mit der intuitiven Handlungsstruktur das Unbewusste in Bewusstheit umwandeln kann.
31 Turkle, Leben im Netz, 68f.
32 Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 107.
33 Ebd., 118.
34 Vgl. ebd., 9; 40.
35 Ebd., 112.
36 Ebd., 118.
37 Vgl. ebd., 9.
38 Lewis Mumford: Technics and Civilization, New York 1963, 13f.; zitiert aus: Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 43.
39 Lewis Mumford: Technics and Civilization, New York 1963, 14; zitiert aus: Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 42.
40 Vgl. Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 40.
41 Vgl. ebd., 45.
42 Vgl. ebd.
43 Lewis Mumford: Technics and Civilization, New York 1963, 15; zitiert aus: Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 43; 45.
44 Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 40f.
45 Vgl. ebd., 44.
46 Vgl. ebd., 40.
47 Ebd.
48 Ebd., 40.
49 Vgl. ebd.
50 Vgl. ebd., 45.
51 Ebd.
52 Ebd.
53 Vgl. ebd.
54 Vgl. ebd., 44.
55 Vgl. Schirrmacher, Payback, 19.
56 Vgl. Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 55.
57 Ebd., 47.
58 Vgl. ebd.
59 Ebd., 47f.
60 Vgl. Schirrmacher, Payback, 19.
61 Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 47.
62 Ebd., 46.
63 Kerlen, 9.
2
STEUERUNG UND MANIPULATION
2.1
Technische Manipulation im Altertum
Die heutige technische Datenverarbeitung, wie sie in Computern abläuft, wurzelt dreifach im Altertum: Erstens in abstrakten, geistig-logischen Konzepten, zweitens in der Mechanisierung des Rechnens und drittens in der technischen Automatisierung, also in der automatischen technischen Steuerung.64 In diesen drei Prozessphasen liegen Möglichkeiten zu Manipulationen. Im Altertum dienten beispielsweise Automaten, wie der automatische Türöffner Herons von Alexandria65, Priestern dazu,
im […] Volk Furcht und heilige Scheu vor ihren göttlichen Kräften [zu] erwecken […]. Der andächtige Gläubige, der zu Ehren seines Gottes ein Opferfeuer entfacht hatte, mag nicht schlecht gestaunt haben, als sich plötzlich, wie von Geisterhand bewegt, die Tempeltür öffnete und nach einiger Zeit automatisch wieder schloss.66
An diesem Beispiel ist die Funktionsweise der Manipulation klar erkennbar. Automaten wie dieser wurden hergestellt, um in den Menschen, die davon umgeben waren, bestimmte Gefühle hervorzurufen, die dem Hersteller oder dem Auftraggeber der Automaten zugutekommen sollten – in diesem Beispiel den Priestern, deren Macht und Einfluss sich durch Furcht und heilige Scheu ihrer »Schützlinge« vergrößert haben mag. Die Priester mögen vor der Zielgruppe dieser Manipulation gottähnlich gewirkt haben. Zielgruppe waren diejenigen, die sich der versteckten Technik nicht bewusst waren und mit größter Wahrscheinlichkeit keine technischen Kenntnisse besaßen. Heute sind wir in unserem Wissen über Technik und in unserem Bewusstsein ein großes Stück weiter, jedoch ist auch die Technik komplexer geworden. Wer begreift heute noch alle technischen Bezeichnungen? Nicht-Wissen ist immer ein Punkt, an dem Manipulation ansetzen kann. Die Folge der Manipulation ist dann – wie im zitierten Beispiel –, dass durch die hervorgerufenen Gefühle, durch Furcht und Scheu, der Manipulierte von seinem eigenen Ich entfernt wird. Das Selbstvertrauen fehlt beim Opfer der Manipulation. Das Selbst verlagert sich sozusagen durch Eingriff von außen, der über den Automaten ins Unbewusste des Manipulierten reicht. Natürlich wurden und werden Automaten oder Maschinen nicht nur mit der Absicht einer Manipulation gebaut oder erfunden, wie zum Beispiel der Abakus oder die Rechenmaschinen von Schickard oder Pascal. Diese sollten vielmehr dem Menschen als Hilfsmittel dienen.
2.2
»Computer« als Hilfsmittel
Der Begriff »Computer« stammt ursprünglich aus dem Lateinischen: Das Verb »computare« bedeutet »berechnen, zusammenrechnen«. Aus dem Lateinischen gelangte dieses Wort ins Französische, von dort ins Neuenglische, aus dem Neuenglischen wurde es schließlich im 20. Jahrhundert als Nomen ins Deutsche entlehnt.67
Im Prinzip kann also – durch die Wortherkunft – schon der Abakus als Computer bezeichnet werden. Ein Rechenbrett, das wohl in allen großen Kulturen bekannt ist und beim Rechnen bildlich und haptisch unterstützen kann – sollte dem Menschen ein Hilfsmittel sein. Auch die Rechenmaschinen, die im 17. Jahrhundert erfunden worden sind, sollten bei Berechnungen helfen. Wilhelm Schickard, ein Universalgelehrter aus Tübingen, erfand seine mechanische Rechenmaschine im Jahr 1623. Sie war „die erste urkundlich nachweisbare Rechenmaschine der Welt“ und erlaubte die Durchführung der vier Grundrechenarten.68 Diese Maschine69 sollte einer bestimmten Gruppe von Mathematikern komplexe Berechnungen erleichtern, die sie für Astronomen tätigten. Diese Mathematiker nannte man auf der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit »Computer«, es war zu der Zeit eine Berufsbezeichnung.70
Blaise Pascal erfand seine mechanische Rechenmaschine namens Pascaline im Jahr 1642 als Hilfsmittel für seinen Vater, er war Finanzverwalter. Pascaline erlaubte eine der vier Grundrechenarten, nämlich die Addition.71
Von da an erfuhren die Rechenmaschinen eine Weiterentwicklung. Im Jahre 1673 erweiterte Gottfried Wilhelm Leibniz
die Idee des Zählrades um eine wesentliche Möglichkeit, nämlich um die Multiplikation durch fortgesetzte und gezählte Addition. Hiermit wurde […] der Weg bereitet für einen noch heute benutzten mechanischen Rechenmaschinentyp.72
Diese ersten Rechenmaschinen sind weder technisch vollkommen ausgereift gewesen73 noch in größerer Stückzahl hergestellt worden. Erst im Zeitraum von 1774 bis 1790 wurden „die ersten Rechenmaschinen serienmäßig durch den schwäbischen Pfarrer Matthäus Hahn“ hergestellt.74Im Jahre 1837 hat auch Charles Babbage eine »Analytische Maschine« theoretisch entworfen. Diese Rechenmaschine wurde von Babbages Mitarbeiterin Ada Lovelace mit einer Sprache bedacht. Deshalb gilt sie als erste Programmiererin.75 Sie hat den Computer 1843 mit einer programmierbaren Rechenvorschrift, dem ersten Algorithmus, dem ersten Computerprogramm versehen76 und damit natürlich einen Grundstein für die Informatik gelegt, aber auch einen Grundstein zur Manipulation, wie sie heute algorithmisch basiert ablaufen kann.
Im Jahre 1850 kam die Tastatursteuerung hinzu, ein Teil der klassischen Mensch-Computer-Schnittstelle, als in England das erste Patent für eine tastaturgesteuerte Addiermaschine ausgestellt wurde. Mit der Industrialisierung und der gleichzeitigen Zunahme von Maschinen wurden immer mehr
Rechenmaschinen in Serie hergestellt. Die heutige Form als Tischrechenmaschine war nahezu erreicht. Es bedurfte nur noch der Verbindung mit dem Elektromotor, um die mechanische Rechenmaschine zu dem werden zu lassen, was sie bis in jüngste Zeit war: ein unentbehrliches Hilfsmittel […], das aus dem praktischen Leben kaum mehr wegzudenken ist.77
Steve Jobs, Mitbegründer von Apple, redete in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon davon, dass der Computer „die Effizienz des Geistes vervielfachen“78 würde – und mit einem bewusst eingesetzten Hilfsmittel vermag der Mensch das auch!
Die Benutzung einer Maschine als Hilfsmittel kann positive und negative Effekte haben. Die Maschine kann als Unterstützung für die Phasen herangezogen werden, in denen der Mensch sein eigenes System »herunterfährt«. Das heißt nicht, dass Maschinen grundsätzlich überlegen sind. Wenn überhaupt, dann nur punktuell, in dem Moment, in dem sie als Unterstützung herangezogen werden. Maschinen laufen technisch nie fehlerfrei, da sie ja von Menschen gebaut werden! Dieser Gedanke ist simpel, wird jedoch, was die Mensch-Computer-Schnittstelle anbelangt, immer wieder vergessen. Wenn sich der Mensch folglich bewusst darüber ist, dass Maschinen nicht überlegen sein können, ist der Mensch weiter selbstbestimmt, entweder als Erbauer der Maschine oder als derjenige, der sie zur Unterstützung heranzieht. Die Maschine kann unterstützen, aber sie kommt nicht von selbst auf den Menschen zu.
Das Denken sollte allein von seinem eigenen Kopf ausgehen, dabei kann die Maschine Hilfsmittel sein. Wenn dieses Bewusstsein nicht vorhanden ist und der Nutzer sich rein auf den Computer verlässt, verlagert er sein eigenes Denken nach außen. Dann ist der Computer nicht mehr nur Hilfsmittel, sondern Denkapparat (wobei sich der Mensch kleiner macht, als er ist). Genau an dieser Verlagerung und Verkleinerung kann Manipulation anknüpfen – technisch über den Algorithmus. Deshalb ist Bewusstheit darüber, ob der Computer noch Hilfsmittel ist oder schon Denkapparat, ein adäquates Mittel, um gesund mit der computerisierten Welt umzugehen.
2.3
Datenverarbeitung, Miniaturisierung und Steuerung: Vollendung der klassischen Mensch-Computer-Schnittstelle
Damit der Computer Hilfsmittel sein kann, muss er Daten verarbeiten können. Dies wurde und wird von Sekunde zu Sekunde komplexer. Ein Grundproblem zur Datenverarbeitung wurde von Alan Turing beschrieben, einem britischen Mathematiker und Kryptoanalytiker. Er erläutert in seiner Schrift On Computable Numbers, with an Application to the «Entscheidungsproblem» aus dem Jahre 1936 eine Maschine, die heute als Turingmaschine bekannt ist. Sie helfe, so heißt es in seiner Theorie, bei dem Entscheidungsproblem – ein Grundproblem aus der Informatik. Das heißt, diese Maschine ermittelt durch einen Algorithmus eine Entscheidung für ein Element einer Menge. Der Algorithmus ist durch diese Maschine analog sichtbar. Die Turingmaschine besteht aus einem Papierstreifen und einem mit Schreib-, Leseund Löschfunktion ausgestatteten Kopf, der auf dem Papierstreifen Symbole zu manipulieren vermag.79 Alan Turing hat diese Maschine in der Theorie ersonnen, um Berechenbarkeit zu beweisen. Eine solche Maschine kann, laut Turing,
jedes vorstellbare mathematische Problem […] lösen, sofern dieses auch durch einen Algorithmus gelöst werden kann.80
Wenn der Nutzer des Computers also mathematisch gedacht wird, kann er auch berechnet und damit manipuliert werden. Sobald Manipulation im Spiel ist, wird der Mensch nicht mehr gedacht, wie er wirklich ist, sondern wie er sein könnte. Es handelt sich in diesem Moment um eine Verschiebung des wirklichen Ichs – allerdings nur, wenn der Mensch nach dieser algorithmischen Hypothese handelt!
Was zum Wirkungskreis von Manipulation gehört, ist die Täuschung. Die Frage, ob der Mensch getäuscht werden kann, ist in Turings Imitation-Game zu finden. „Are there imaginable digital computers which would do well in the imitation game?“ Diese Frage stellt Turing 1950 in seinem Essay Computing machinery and intelligence.81 Mit dem hinter diesem Gedanken stehenden Experiment legte Turing den Grundstein für unsere heutigen digitalen Computer und implizierte den Täuschungsfaktor in die computerisierte Welt. In diesem sogenannten Turing-Test gilt der Computer als intelligent, wenn der menschliche Proband den Computer als Menschen sieht, nicht als Maschine. Das heißt, wenn die Maschine es vermag, den Menschen an sich so gut zu imitieren, dass der menschliche Proband die Maschine nicht als solche erkennt, vermag es die Maschine, den Menschen zu täuschen.82
Auch Turings Ansatz blieb theoretischer Natur. Gebaut hat den ersten Computer, mit elektromechanischen Bauteilen und rein dualer „Darstellung von Zahlen und Operationsbefehlen unter ausschließlicher Verwendung bistabiler Schaltelemente“, Konrad Zuse im Jahre 1941.83 Er vervollständigte sozusagen Alan Turings Theorie durch den praktischen Bau des ersten Computers.84 Das ist der Beginn der Digitalisierung und der Verbreitung von Algorithmen, der Grundlage der heutigen Datenverarbeitung – und der Vergrößerung der Oberfläche für Manipulation!
Diese Oberfläche wird noch größer durch die Miniaturisierung des Computers. Im Jahre 1982 wurde der C64 eingeführt, von Jack Tramiels erster Firma namens Commodore International. Diese Firma baute die ersten Microcomputer und brachte damit den Rechner auf den Schreibtisch. Der C64 ging mit mehr als zwanzig Millionen Stück in die Produktion. Die »Generation C64«, Jugendliche, die mit diesem Rechner programmieren lernten, gelten sozusagen als Vorfahren der heutigen digital Sozialisierten. Mit Tramiels zweiter Firma Atari wollte er einen Computer für die Masse auf den Markt bringen, einen Rechner, der billiger als der Apple Macintosh und auf gleicher Höhe mit dem von IBM war.85 Den damaligen CEO von Apple, Steve Jobs,
verärgerte Tramiel mit seinem Urteil über den Macintosh, dass dieser nur in Schönheitsboutiquen verkauft werden könne. Der 1985 erschienene Atari ST entpuppte sich als großer Wurf im Markt der Homecomputer. Er brachte seine Exfirma Commodore in große Schwierigkeiten. Trotz weiterer Anstrengungen, wie der entwicklung eines innovativen billigen Laserdruckers, gelang es Tramiel jedoch nicht, sein System bei den professionellen Anwendern zu etablieren.86
Auch Apple war ab dem Jahr 1979 dabei, einen Computer für die Masse zu entwickeln:
Ziel war [ein] preiswerter Rechner […], der wie ein Haushaltsgerät konzipiert war – mit eingebautem Bildschirm und Tastatur und fertig installierter Software – und eine grafische Benutzeroberfläche bieten sollte.87
Der Umstand, dass massentaugliche Computer wie Haushaltsgeräte konzipiert wurden, geht einher mit dem Verstecken der nackten Maschine – technische Manipulationen liegen so nicht mehr offen – sowie mit der grafischen Benutzeroberfläche. Beide Entwicklungen erlauben eine angenehme und bequeme Mensch-Computer-Schnittstelle:
Mit der exponentiell wachsenden Leistungsfähigkeit der Computerprozessoren wurde es möglich, [diese] sogenannten grafischen Benutzeroberflächen zu entwickeln, die die nackte Maschine vor dem Anwender verbargen.88
Die grafische Benutzeroberfläche sollte „die Programmzeilen und DOS-Abfragen ablösen, die Computerbildschirme so abschreckend aussehen ließen“.89 Wie auf einer Schreibtischplatte sollte man „zahlreiche Dokumente und Ordner ablegen können und dann einfach mit der Maus auf denjenigen klicken, den man öffnen wollte“.90 Mit der Simulation der Schreibtischplatte kamen die
Symbolschnittstellen, die den Rahmen eines Desktop und eine dialogische Kommunikation simulieren […]. Diese neuen Schnittstellen modellierten eine Art des Verstehens, die auf dem interaktiven Kennenlernen des Computers basierte – ganz ähnlich, wie man mit einer Person vertraut wird oder eine Stadt erkundet.91
Zwischen dem Benutzer und der Maschine stehen nun also „neue undurchsichtige Interfaces“92, die neuen der Kommunikation zwischen Mensch und Computer dienenden Schnittstellen, die das Mechanische oder das Maschinelle vor dem Benutzer verbergen. Stattdessen wird mehr und mehr das Menschliche innerhalb dieser Symbolschnittstellen herangezogen. Der Macintosh simuliert die physischen Bewegungen des Menschen. Er spiegelt sozusagen die Bewegung, die der Nutzer „manuell mit einer Maus auf einer glatten Fläche ausführt, auf dem Schirm durch ein Bildsymbol – meist ein Pfeil oder eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger“.93 Dieser Computer knüpft an der Intuition des Nutzers an und manipuliert so dessen Denken: