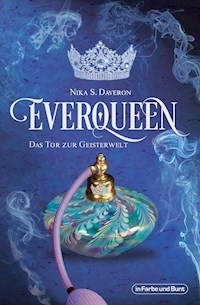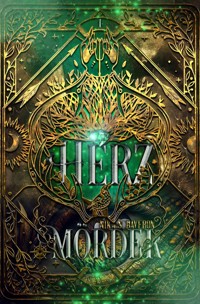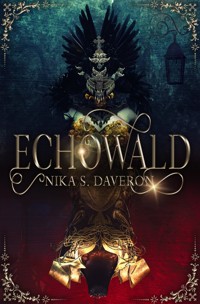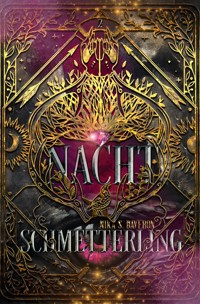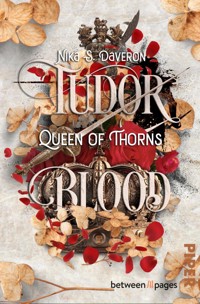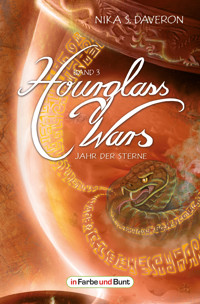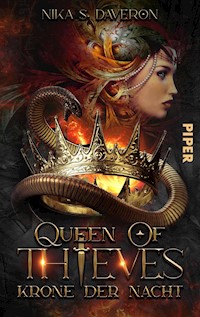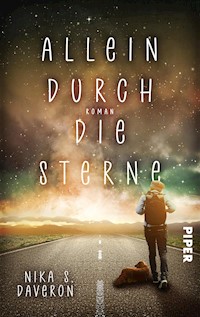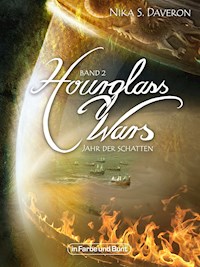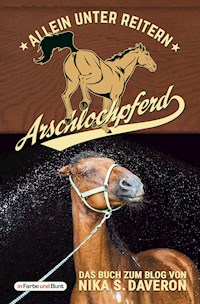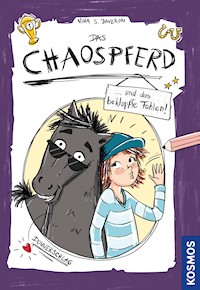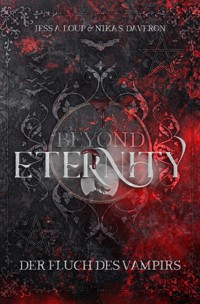
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Wenn du dein Herz an einen Vampir verlierst…** Andy braucht dringend Geld, denn nach dem Tod ihrer Tante ist sie nicht nur Waise, sondern auch völlig mittellos. Doch Jobangebote in New York sind rar und so nimmt sie die einzige Stelle an, die sich ihr bietet. Sie wird Kellnerin im »Wild Dog«, einer heruntergekommenen Bar mit schlecht gelauntem Besitzer und mehr als zwielichtigen Gästen. Die einzige Ausnahme: Dane, ein faszinierender, schweigsamer Mann, der Andys Herz schon bei der ersten Begegnung zum Aussetzen bringt – und sie in einen Strudel aus dunklen Geheimnissen und magischen Gefahren reißt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
No rest for the wicked!
Impressum:
Texte: Nika S. Daveron & Jess A. Loup
Umschlag: Nika S. Daveron (Bildmaterial: Adobe Stock: Elen Lane, klyaksun, SavingThrw, UMA, TUOO, apimook, Shutterstock: LaInspiratriz)
Korrektorat: Tamara Weiß
Für eine Auflistung der Triggerwarnungen im Buch »Beyond Eternity: Der Fluch des Vampirs«, können Sie Nika S. Daveron gerne per Mail unter: [email protected] oder über ihre Facebookseite https://www.facebook.com/NikaSDaveron kontaktieren.
Nika S. Daveron & Jess A. Loup
Beyond Eternity
Der Fluch des Vampirs
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Über die Autorinnen
Kapitel 1
Wie ein Schwarz-Weiß-Bild, dachte Andie und blendete das dumpfe Gemurmel um sich herum einfach aus. Ihr Blickfeld schien zu schrumpfen und sie sah nur noch das dunkle, feucht glänzende offene Grab, in das der cremefarbene Sarg soeben hinabgelassen wurde.
Der Schneeregen, der seit Tagen über das Land zog, bedeckte alles wie ein nasses, schweres Tuch, dämpfte die Geräusche und die eintönige Litanei des Pfarrers, der mit gesenktem Haupt vor ihr stand. Sie mochte Schnee, sie mochte auch Regen und ganz besonders mochte sie diesen kleinen, fast unbekannten Friedhof mitten in Brooklyn, auf dem heute Tante Dru ihre letzte Ruhe fand. Eigentlich war sie gar nicht ihre Tante gewesen, eher die Großtante ihrer Mutter und Andie stellte sich vor, dass sie sich jetzt im Sarg mehrmals wütend herumdrehte, weil ihr Name so verschandelt wurde.
»Andressa Filipa Franklin!«, hatte sie zu sagen gepflegt. »In meinem Haus dulde ich es nicht, wenn Schindluder getrieben wird!«
Für Tante Drusella Eugenie Erincourt, die sich damit gebrüstet hatte, dass sie einem alten englischen Geschlecht abstammte, das durch die barbarischen Kommunisten sein Vermögen und sein Land verloren hatte, war alles Schindluder. Schuld waren natürlich die Gewerkschafter. Und die Feministinnen. Die roten Khmer sowieso. Andie hatte nie verstanden, wie Kommunisten in England Fuß gefasst haben sollten, um Tante Drus Familie zu einer Flucht nach Amerika zu bewegen, aber als sie ein gewisses Alter erreicht hatte, war sie schlau genug gewesen, sich derartige Fragen zu ersparen.
Es ihrer Tante recht zu machen, hatte sie ohnehin nicht vermocht. Sie war zu in sich gekehrt, wenn sie schwieg, und zu patzig, wenn sie sprach. Sie hatte kein Benehmen – »Dein Vater, dieser Gewerkschafter! Er hat dir viel zu viel durchgehen lassen.« –, wählte ihre Kleidung zu freizügig (Andie hatte es einmal gewagt, ein Poloshirt zu tragen), war dumm, faul und ungehorsam. Sie bemühte sich nicht, ihrer armen Tante zur Hand zu gehen, war nie zu Hause, wenn man sie brauchte, und wenn sie es war, völlig nutzlos, weil sie nur über ihren Büchern gesessen oder vor sich hingeträllert hatte.
Andie seufzte lautlos und tauchte für einen Moment aus ihren Erinnerungen auf. Es hatte sich nichts geändert. Der Pfarrer intonierte noch immer eine Grabrede, von der sie annahm, dass Tante Dru sie ihm vorgeschrieben und mitsamt einem gewaltigen Obolus für die Kirche hinterlassen hatte. Die wenigen anderen Trauergäste, denen in dem matschigen Boden sicher die Zehen abfroren, hatten sich tief in ihre schwarzen Jacken und Mäntel vergraben und ihre Schirme vor ihr Gesicht gezerrt, als wollten sie die Welt, den heulenden Wind und die Schneeschauer von sich abgrenzen. Andie kannte keinen von ihnen und das war ihr nur recht so. Tante Dru hatte sich nie die Mühe gemacht, ihre Stimme zu senken, wenn eine ihrer seltsamen Bibelkreisfreundinnen kam. Sie erzählte ihnen von Andie, beschwerte sich, dass es ihre Großnichte gewagt hatte, zusammen mit ihrem Mann – »dem Gewerkschafter!« –, einen tödlichen Autounfall zu haben und ihr dieses unchristliche und undankbare Balg zu hinterlassen, um das sie sich als einzige Angehörige kümmern musste.
Auf dem Dachboden schaffte Andie sich eine Zuflucht. Versteckt von mächtigen, alten, mit Spinnweben bedeckten Truhen und einem antiken Sekretär, kuschelte sie sich in eine löchrige Decke, die sie hier oben hinter einem Dachsparren gefunden hatte. Jedes Wort hörte sie. Wie ein bösartiger, spitzer Pfeil bahnte sich die hohe, durchdringende Stimme Tante Drus immer einen Weg in ihr Gehör. Sie war erst sieben, als ihre Eltern starben, und brachte über ein Jahr lang keinen Ton mehr heraus, so geschockt war sie. Nicht nur, dass sie bei dem Unfall dabei war und alles mit ansehen musste, sie überlebte ihn ohne einen Kratzer, eine Tatsache, die ihr Tante Dru immer zum Vorwurf machte.
Doch auf dem Dachboden war sie sicher. Niemals, nicht ein einziges Mal, kam ihre Tante auf die Idee, sie dort oben zu suchen. Im Laufe der Jahre schlich sie sich immer dorthin, wenn sie die schrillen Beschwerden nicht mehr ertragen konnte, und hier war es auch, dass ihr ein altes Gesangsheft in die Hände fiel. Bis zu diesem Tag hatte sie dem Musikunterricht keine große Aufmerksamkeit geschenkt, doch als sie die vergilbten Blätter des muffigen Buches umblätterte, schien es ihr, als würde sie in eine andere Welt tauchen. Die Lieder und Gesänge waren so ausdrucksstark, gefühlvoll, so berührend – sie wollte und musste sie selbst singen können. Und Mr Algins, der alte Musiklehrer, war mehr als erfreut, als er das Interesse des zurückhaltenden Mädchens erkannte. Oft nahm er sich die Zeit, ihr nach dem Ende der Stunde Noten, Notenschlüssel und Taktfolgen zu erklären.
Seine Freude kannte keine Grenzen mehr, als sie sich zum ersten Mal traute ihm etwas vorzusingen. Tränen standen in seinen Augen, als sie vor der gesamten Klasse das Halleluja vortrug. Leise, ganz leise hatte sie begonnen, doch mit jedem Ton, mit jeder Strophe war ihre Stimme sicherer und kräftiger geworden und als sie endete, schwiegen ihre Klassenkameraden. Minutenlang. Ergriffen von einem ihnen scheinbar unerklärlichen Gefühl, das sie nicht zu beschreiben vermochten, welchem sie aber auch nicht durch ihren üblichen Spott Ausdruck verleihen wollten. Mr Algins war es auch, der sie mit zu einem alten Freund nahm, dem das kleine Sherman Theater gehörte. Mr Sherman war ein knurriger, alter Mann, mit einer Haut so braun und verrunzelt, dass man meinen konnte, sie sei Baumrinde, und Andie hatte anfangs Angst vor ihm.
Ihre Angst hielt jedoch nicht lange vor. Der kleine Mr Sherman war ein Goldstück, dem nichts mehr am Herzen lag, als ihre Stimme auszubilden. »Du hast großes Talent, mein Kind«, waren seine Worte. »Aber dafür musst du üben, üben, üben. Immer wieder.«
Und das tat sie auch. Jeden zweiten Tag machte sie sich auf den Weg zum Theater und schon mit siebzehn war ihre Stimme so ausgeprägt, dass sie nach Shermans Meinung jeder Opernsängerin das Wasser reichen konnte. Sie besaß die Fähigkeit, über vier Oktaven reine und klare Töne zu singen, und die Theaterleute hatten sie verehrt.
Andie seufzte. Ihr Traum, als Opernsängerin aufzutreten, war vorbei gewesen, bevor er richtig begonnen hatte. Ihre Tante hatte ihr von Anfang an verboten ihr »schreckliches Gesinge« zum Beruf zu machen und hatte ihr nur unter der Voraussetzung zu studieren erlaubt, dass sie »vernünftige« Fächer belegte. Offiziell war sie jetzt im vierten Semester Literaturwissenschaft, doch selbst das war ihr genommen worden. Tante Drus Testament, das ihr heute Morgen der Anwalt persönlich vorbeigebracht hatte, war eindeutig. Sämtliche Vermögenswerte von Tante Dru, einschließlich des von ihr verwalteten Geldes, das Andie gehört hatte, waren verschwunden. Es gab nichts zu erben. Tante Dru selbst hatte – entgegen ihren Worten – nie etwas besessen und sie hatte es sich nicht nehmen lassen, Andies Erbe großzügig für sich auszugeben.
Andie stand vor dem Nichts. Sie wusste nicht, wie sie das alte zweistöckige Haus halten sollte, in dem sie mit Tante Dru gelebt hatte, ja, sie wusste nicht einmal, wovon sie ab morgen leben sollte. Ihr letztes Geld war für die Sargträger draufgegangen und jetzt befanden sich in ihrer Tasche nur noch zwei Dollar und achtundachtzig Cent.
Der Schneeregen war in einen festen, heftigen Regen übergegangen. Ohne zu wissen, was sie tat, griff Andie nach einer Handvoll Erde und warf sie auf den Sargdeckel. Teilnahmslos beobachtete sie, wie es ihr die anderen Anwesenden nachmachten. Niemand von ihnen hielt es für nötig, ihr zu kondolieren. Andie strich sich eine nasse Strähne ihres lockigen Haares zurück, das in dem Zwielicht eher schwarz als dunkelrot wirkte, starrte einen Moment lang verloren in das Grab, in das die Friedhofsarbeiter hastig die matschige, schwere Erde schaufelten, und wandte sich ab.
Sie hatte Besseres zu tun, als um die Vergangenheit zu trauern. Sie musste ihren Lebensunterhalt verdienen.
***
Die Bar wirkte klein und schäbig. Eines der Lichter draußen war zerschlagen und so leuchtete von dem Schriftzug Wild Dog nur noch ld Dog. Die verwitterte Eingangstür hätte schon längst einen Anstrich nötig gehabt und das Rot blätterte ab. Es gab nur ein kleines Fenster, links von der Tür, doch es war abgedunkelt und gewährte keinen Blick nach drinnen. Andie atmete tief durch. Sie hatte bereits in vier Restaurants vorgesprochen, keines davon hatte sie gewollt, zu wenig Erfahrung. In den Bars war es genau das Gleiche gewesen und zuletzt war es ihr Äußeres, das einen Absagegrund darstellte.
»Nicht sexy genug«, hatte der Besitzer gesagt und sie ohne weitere Worte stehen lassen. Andie war darüber verärgert gewesen, denn was hatte er erwartet? Dass sie bei diesem Wetter im Bikini zum Vorstellungsgespräch erschien? Dann war der Ärger verschwunden. Es hätte sowieso nicht zu ihr gepasst. So war sie einfach nicht – keine dieser sexy Kellnerinnen aus Coyote Ugly, die sich tanzend ins Koma tranken und ihre Gäste scharf machten. Das vage Gefühl beschlich sie, dass das im Wild Dog wohl auch gefordert sein würde, jedenfalls wenn man sich den Laden von außen betrachtete. Aber eine andere Wahl hatte sie mittlerweile nicht mehr. Es gab keine weiteren Etablissements in ihrer näheren Umgebung und sie konnte sich die U-Bahn nicht mehr leisten. Doch eins stimmte sie positiv – an der maroden Tür klebte ein Zettel:
Aushilfe gesucht!
Andie nahm allen Mut zusammen und öffnete die rote Tür. Der Gestank von kaltem Rauch und schalem Bier stieg ihr in die Nase, doch erkennen konnte sie kaum etwas. Der Raum sah aus wie ein Kellergewölbe, Ziegelsteine an den Wänden und blanker Fußboden, der zig Kratzspuren aufwies von den vielen tausend Füßen, die hier im Laufe der Zeit ein- und ausgegangen waren.
»Mach die Tür zu«, knurrte jemand. »Wird sonst kalt.«
Andie gehorchte und schloss die Tür, die nun wie in einem Gruselfilm krächzte. Auch ohne die geöffnete Tür war es im Wild Dog kalt, sie konnte sogar ihren Atem sehen. Im hinteren Teil des Raums brannte Licht und als sich ihre Augen an das fahle Zwielicht gewöhnt hatten, konnte sie auch endlich ihre Umgebung wahrnehmen. Rechts von ihr gab es eine kleine Sitzecke am Fenster, ganz im Stil eines britischen Pubs, links von ihr waren die Theke und der schlauchartige Durchgang erleuchtet, der zum hinteren Teil der Bar führte.
Sie kam sich vor wie eine Motte, als sie dem Licht folgte und bald in einem viel größeren Gewölbe stand. Dort gab es mehrere Tische und eine kleine Bühne, auf der ein abgenutztes Piano stand.
»Wer bist’n du?«, sagte derselbe Jemand wie vorhin.
»Mein Name ist Andie. Ich komme wegen Ihrer Anzeige«, murmelte sie.
Der Mann saß mit dem Rücken zu ihr und starrte auf die leere Bühne, als warte er auf den Beginn eines Konzerts.
»Komm ma’ rüber«, nuschelte er. »Un’ setz dich. Ich kanns nicht leiden, wenn jemand die ganze Zeit hinter mir steht.«
Andie gehorchte und trat an den Tisch des Mannes heran.
»Setzen nich’ vergessen«, maulte er und tätschelte die Sitzfläche des Stuhls neben sich.
Sie räusperte sich und ließ sich auf dem kippeligen Stuhl nieder. Dann wagte sie den Mann anzusehen. Seine Augen waren blutunterlaufen und schwarz umrandet. Das Haar verfilzt und lang wie die Mähne eines Löwen. Andie schätzte ihn auf um die fünfzig, aber er mochte viel älter oder viel jünger sein. Seine Lippen waren dick und wulstig und verschiedene Tätowierungen zierten den Hals, seine Arme und die Finger. In beiden Ohren trug er diverse zusammengewürfelte Ohrringe. Er war kräftig und bullig. Wie ein Stier.
»Tag«, sagte er und reichte ihr die Hand. »Ich bin Bill Watling.«
Andie ergriff mit gemischten Gefühlen die große Pranke. »Andressa Filipa Franklin.«
»N’ ziemlich großer Name für ne so kleine Lady.«
»Nennen Sie mich Andie«, schlug sie hastig vor, damit der Kerl sie nicht gleich wieder vor die Tür setzte, nur weil ihm ihr Name nicht passte. »Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht.«
Er grinste. »Gut, also Andie. Aber was macht’n son Mädel wie du … na ja … hier?«
»Ich suche Arbeit.«
»Gibt Mami nicht genug Taschengeld?«, höhnte der Mann und seine Tätowierungen kräuselten sich, als sein ganzer aufgequollener Körper in Wallung geriet.
»Meine Mutter ist tot.«
»Un’? Meine auch.«
»Sie haben gefragt, ich habe geantwortet«, entgegnete Andie, die langsam ärgerlich wurde.
Doch zu ihrem Erstaunen lachte der Mann, der sich Bill nannte, eine Weile lautstark, sodass es Andie beinahe schon peinlich wurde und sie sich fragte, ob er nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Er hatte wohl noch nie so etwas Komisches wie sie gesehen.
»Bist schlagfertig«, sagte er, als er sich wieder eingekriegt hatte. »Das mag ich. Musst du hier sein, sonst fressen dich meine Kunden.«
Andie wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte, also schwieg sie und sah sich noch einmal im Raum um. Auf keinem der Tische stand Dekoration, alle hatten die gleichen maroden Holzstühle und auf jedem lag eine grüne Karte. Die Bühne beherbergte außer dem Piano ein paar altertümliche Scheinwerfer, die einem unter Garantie die Haut von den Knochen schmelzen konnten, und an den Wänden gab es ein paar Ölgemälde, die überhaupt nicht zu diesem Ort passen wollten. Das Bild links von ihr zeigte eine Jagdszene aus England, wo feine Lords auf hochbeinigen Pferden saßen, also genau die Art von Herren, die sich hier ganz sicher nicht blicken ließ.
»Was kannst’n du noch so außer kellnern?«
Wehmütig betrachtete Andie das Piano.
»Singen«, kam es, ohne nachzudenken, aus ihrem Mund.
»Singen, eh? Dafür ha’m wir schon ein Mädel. Zwei brauchen wir nicht.«
»Dann kann ich nur kellnern«, antwortete sie ehrlich.
Der Mann schien nachzudenken, seine Stirn warf Falten und sein ungepflegter Bart zitterte.
»Sing ma’ was«, brummte er schließlich.
»Was möchten Sie denn hören?« Andie war sich nicht sicher, was sie ihm vorschlagen sollte, denn wenn sie ein Stück aus Zar und Zimmermann sang, würde er sie vielleicht erneut auslachen. Das hier war kein Ort, wo man Lortzing zu schätzen wusste.
Ihr blieb der Mund offenstehen, als Bill verlangte: »Kannst’e was von Gershwin?«
Das war zwar keines der Lieder, die sie in letzter Zeit geübt hatte, aber sie beherrschte alles von Gershwin, denn ihr Lehrer, Mr Algins, war ein glühender Verehrer von ihm gewesen. Und es passte genau so wenig zu diesem Ort wie Zar und Zimmermann.
»Summertime?«, fragte sie nach.
Bill nickte und Andie eilte nach hinten auf die Bühne.
Das Piano war staubig und sah aus, als ob es seit Jahren nicht mehr angefasst worden wäre. Vorsichtig hob sie den Deckel und schlug ein paar Takte an. Das Ding war zwar grausig verstimmt, aber für das Stück reichte es noch. Und als Andie zu singen begann, verschwand der düstere Raum vor ihren Augen. Nichts als reine Glückseligkeit durchströmte sie, als sie die ersten Zeilen hauchte: »Summertime … and the livin’ is easy.«
Das Singen hatte ihr so gefehlt. Die letzten Wochen hatte sie weder die Möglichkeit gehabt noch war ihr danach gewesen, doch jetzt war es ihr, als fielen alle Sorgen von ihr ab, und sie konnte sich ganz der Musik hingeben. Sie schloss die Augen und sang ihr Lied und während sie das tat, kam ihr die Zukunft nicht mehr so schwarz vor.
»So hush little baby … don’t you cry.«
Die letzten Noten verklangen und verpufften im dunklen Gewölbe. Erst dann öffnete Andie wieder die Augen und starrte den Mann an, der da in der Dunkelheit saß und ihr applaudierte.
»Lange nich mehr so was Gutes gehört«, sagte er wohlwollend.
Lächelnd stieg Andie von der Bühne hinunter, immer noch ganz benommen von dieser tiefen Glückseligkeit.
»Wenn du willst, kannst’e einmal die Woche mi’m Piano auftreten. Spiel, was du willst, dir hört eh nur ’ne Handvoll zu. Das gibt dann extra Scheine.«
Andie traute ihren Ohren nicht. »Sie nehmen mich wirklich?«
»Klar. Wär’ bescheuert, wenn ich’s nicht täte. Aber mach was mit deinen Klamotten. Ich sag nich’, dass du nackt rumlaufen musst, aber ‘n hübsches Mädchen wie du kriegt mehr Trinkgelder, wenn’s sich zurechtmacht, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Was bekomme ich als Stundenlohn?«, fragte Andie, sich wieder daran erinnernd, warum sie überhaupt hier war.
»Fünf Dollar.«
Andie schluckte. Sie hatte nicht mit so wenig gerechnet.
»Ich brauche wirklich Geld«, stammelte sie.
»Dann hättest du dir’n anderen Job aussuchen sollen. Mehr verdienst’e auch anderswo nich’. Sei also nicht geizig mit Haut und mach mit den Besuchern mal ‘n paar Scherze, dann verdienst du problemlos das Dreifache. Wenn du singst, kannst’e dir ‘ne Tasse hinstellen. So läuft das eben hier.« Bill zuckte mit den Schultern. »Komm heut Abend und schau’s dir an. Wir öffnen um sechs und schließen, wenn der letzte Gast geht.«
Streng genommen blieb Andie keine andere Wahl. Und weil sie keine Alternative hatte, ergriff sie die ausgestreckte Hand von Bill und schlug ein.
Kapitel 2
Andie konnte es gar nicht erwarten, Tante Drus Haus endlich wieder zu verlassen. Sie war gegen Nachmittag zurückgekommen nach ihrem Gespräch im Wild Dog und hatte sich ein wenig auf ihr Sofa gelegt, sich aber nicht entspannen können, denn immer wieder suchten sie ihre Gedanken an Tante Dru heim, die jeden Moment hereinkommen könnte, um sie zu tadeln, weil sie mit ihren Schuhen auf dem guten Sofa lag.
Erst nachdem sie aufgestanden war, hatte sie gemerkt, wie absurd der Gedanke war, denn Tante Dru befand sich jetzt in ihrem Sarg und konnte sie nicht mehr ermahnen. Das war zumindest ein Silberstreif am Horizont. Und sie hatte einen Job. Das war Silberstreif Nummer zwei. Allerdings klangen ihr immer noch die Worte von Mr Watling in den Ohren: »Aber mach was mit deinen Klamotten.«
Am liebsten hätte Andie geschlafen, doch sie riss sich zusammen und durchwühlte ihren Kleiderschrank. Da gab es natürlich ein paar Röcke, aber die waren alle so schick, dass Tante Dru sie erlaubt hatte, und somit wohl nicht das, was sie suchte. Zuletzt entschied Andie sich dafür, einen gold-gemusterten Rock umzudrehen, dann war er nämlich einfach schwarz und passte ganz gut zu einer Kellnerin, die in einer Bar wie dem Wild Dog arbeitete. Dazu legte sie sich ein knallgrünes Tanktop raus, das sie noch nie getragen und eigentlich nur gekauft hatte, um Tante Dru zu ärgern. Für die Füße wählte sie ein paar Sandalen, von denen sie hoffte, dass sie ihr eine gewisse Eleganz verliehen.
Als sie sich im Spiegel betrachtete, erkannte sie sich kaum wieder. Zu ungewohnt war der Anblick, grün war zwar eindeutig ihre Farbe, es unterstrich ihre rote Lockenpracht, aber noch nie hatte sie so ausgesehen. Nicht einmal zu den obligatorischen Highschool-Partys. Erstaunt berührte sie den Spiegel, als könne sie das Bild mit beiden Händen ergreifen.
Nun, wenn das ihr Überleben sicherte, sollte es eben so sein. Und sooo schlecht sah sie ja auch gar nicht aus.
Gedankenverloren packte Andie ihre Handtasche. Die letzten zwei Dollar waren für ein Sandwich draufgegangen, wenn sie also morgen nicht hungern wollte, blieb ihr nichts anderes übrig, als im Wild Dog zu arbeiten. Zudem sagte sie sich, dass sie ja immer noch anderweitig nach Arbeit suchen könnte, sie musste schließlich nicht ihr Leben dort verbringen. Außerdem könnte es ja auch ganz nett sein. Singen durfte sie auch, was wollte sie also mehr? Wahrscheinlich fürchtete sie sich nur deswegen so, weil Tante Dru ihr beständig Panik vor Menschen wie Watling eingetrichtert hatte.
»Widerliche Schmarotzer, Abschaum der Gesellschaft, Hottentotten …« Tante Dru hatte viele Namen für solche Leute gehabt.
Sie seufzte tief, zog ihren Mantel über, nahm Schirm und Handtasche und ging aus dem Haus. Es regnete immer noch und ein Blick in den Briefkasten ließ sie schaudern.
Inkasso Burkes, entzifferte sie auf einem der Umschläge.
Großartig. Das Einzige, was Tante Dru hinterlassen hatte, waren Schulden. Andie öffnete den Umschlag nicht. Noch einen Tiefschlag konnte sie heute wirklich nicht verkraften. Entschlossen stopfte sie den durchnässten Umschlag zurück in den Briefkasten und kehrte dem Haus den Rücken. Vielleicht war es keine schlechte Idee, das Haus zu verkaufen und die Schulden ihrer Tante damit zu tilgen. Ob wohl noch etwas übrigblieb, damit sie eine Wohnung anmieten konnte? Sie beschloss, so bald wie möglich den Nachlassverwalter von Tante Dru anzurufen.
Die Sandalen waren schon nach ein paar Schritten durchweicht und sie bereute bitterlich, dass sie keine Strumpfhose angezogen hatte. Das hatte sie nun davon: Ein paar nasse Füße und vermutlich am nächsten Tag eine Grippe. Wenigstens lag das Wild Dog nicht weit weg von Tante Drus Haus – Andie weigerte sich beharrlich zu denken, dass es nun ihr Haus war – und so war sie zumindest zur Hälfte trocken, als sie die Bar betrat.
Glöckchen klingelten an der Tür, das hatte sie vorher gar nicht bemerkt und nun gab es auch mehr Licht, das von vergilbten Lampen herrührte, die auf und neben den Tischen standen und wirkten, als habe Watling sie alle vom Sperrmüll geholt. Dennoch verlieh das Licht dem Wild Dog eine wesentlich wärmere Atmosphäre als noch heute Mittag.
»Da bist’e ja«, sagte Watling, der hinter dem Tresen stand. »Dachte schon, du hättest’s dir anders überlegt.«
Andie schüttelte energisch den Kopf. »Warum sollte ich?«
»Nur so ein Gedanke«, entgegnete Watling vieldeutig und ließ sie vor dem Tresen auf einem Barhocker Platz nehmen. »Un’ hübsch gemacht haste dich auch. Bin ja ganz hin und weg von dir, Mädel.«
Andie nahm das als Kompliment, ging aber nicht darauf ein. »Werde ich allein arbeiten?«
»Nee«, nuschelte Watling und zündete sich eine Zigarette an. »Cally kommt nachher noch. Das is’ mein Barmädchen. Is’ ganz nett, aber ‘n bisschen vorwitzig. Kann kein Tablett tragen, deswegen bleibt se hinterm Tresen, wo ich ‘n Auge auf sie hab.«
»Sonst niemand?«, fragte Andie erstaunt.
»Nee. Wo denkst’n du hin? Wir ha’m hier nicht täglich Hunderte von Gästen.«
Allmählich entspannte sich Andie. Vielleicht war es gar nicht so übel, hier zu jobben. Die Arbeit klang nicht hart und auch nicht so, als ob sie keine freie Sekunde haben würde.
»Zigarette?«, fragte Watling und hielt ihr die Schachtel hin.
Andie schüttelte den Kopf. »Nein danke, ich rauche nicht.«
Watling zuckte mit den Schultern und schlurfte den Flur entlang, zu dem Gewölbeteil, der das Piano beherbergte.
»Was soll ich denn machen, bis die Gäste kommen?«, rief Andie ihm hinterher, die sich sehr verloren vorkam.
»Was du willst. Putzen brauchst’e den Laden nicht.«
Also blieb Andie auf dem Barhocker sitzen und starrte auf die Regale hinter der Theke, wo sich die Flaschen mit Alkohol stapelten. Das meiste davon war Whiskey, sofern sie die Etiketten der Flaschen richtig entzifferte. Watling hatte ihr ja mehr als deutlich gesagt, was er von Reinlichkeit hielt. Wenn Tante Dru nur sehen könnte, wo Andie sich jetzt aufhielt. Sie wäre in Ohnmacht gefallen, und zwar auf der Stelle. Über den Gedanken musste sie lachen.
»Was ist denn so komisch?«, fragte eine Stimme von der Tür.
Andie beeilte sich von ihrem Stuhl hinunterzukommen, denn sie nahm an, dass es sich um einen Gast handelte, und da war es unangebracht, beim Nichtstun erwischt zu werden. Doch dann blickte sie direkt in die Augen eines kleinen, schlanken Mädchens.
»Bist du die Neue?«, fragte sie neugierig.
»J… ja«, stotterte Andie.
Die Kleine mit den blonden Locken hielt ihr die Hand hin. »Calista Ray Thunderbolt. Für dich aber Cally.«
Andie musterte Cally interessiert. Sie war blond wie ein Engel, aber ihre Augen sahen beinahe schwarz aus. Sie hatte eine Stupsnase und wirkte kaum älter als vierzehn.
»Lass dich nicht täuschen«, sagte Cally, als sie ihren Blick bemerkte. »Ich bin alt genug, um hier zu arbeiten.« Wahrscheinlich wusste sie aus Erfahrung, was Leute dachten, wenn sie sie zum ersten Mal trafen.
Cally stellte ihre Tasche neben den Tresen und wuselte an Andie vorbei, um das schmutzige Holz zu wischen.
»Auch wenn Bill keinen Wert drauf legt, ich tue es schon«, flüsterte sie verschwörerisch und zog mit ihrem Lappen eine feuchte Spur über die Theke.
»Arbeitest du schon lange hier?«, erkundigte sich Andie.
»Kann man sagen, ja.«
»Und wie ist das so?«
»Wenn man sich an das Publikum gewöhnt hat, ist es schon ganz in Ordnung. Setz dich doch wieder. Was möchtest du trinken?«
»Nur ein Wasser, bitte.«
Cally stellte ihr ein erstaunlich sauberes Glas auf die Theke, doch als Andie danach greifen wollte, packte Cally abrupt ihre Hand.
»Was ist das da?«, fragte sie mit merkwürdiger Stimme.
Andie wusste nicht, was sie meinte. »Was?«
»Das«, sagte Cally gepresst und deutete mit der anderen Hand auf das kleine Muttermal an ihrem Zeigefinger, das eine längliche Form hatte.
Ihre Mutter hatte es einst kleine Schlange genannt und sie dann unter Zischlauten ausgekitzelt. Deswegen war Andie dazu übergegangen, das Muttermal ebenfalls so zu nennen.
»Das ist nur ein Fleck«, antwortete sie verwundert, denn Cally hatte ihre Hand immer noch nicht losgelassen.
»Entschuldige. Ich bin da nur etwas empfindlich. Das Muttermal sieht ungesund aus, du solltest es untersuchen lassen. Bei meiner Mutter haben sie den Hautkrebs erst sehr spät diagnostiziert und die hatte auch so eins.«
Callys Augen hatten einen merkwürdigen Glanz angenommen und schnell wandte sie sich ab und kramte in einem der tieferliegenden Schränke herum, sodass Andie sie nicht mehr sehen konnte. Seltsam. Cally hatte beinahe schon panisch ausgesehen … Aber danach so direkt fragen, wollte Andie nicht, denn die Kleine sah aus, als würde sie jeden Moment anfangen zu weinen. Um die Stille zu überbrücken, nahm sie einen tiefen Schluck aus dem Glas und war froh, als Cally sich wieder mit einem freundlicheren Gesicht blicken ließ.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie nun doch.
»Jaja … ist nichts«, murmelte die Angesprochene und begann damit, das Geld in der Kasse zu zählen.
»Ich wollte dir nicht zu nahe treten«, sagte Andie leise.
»Bist du nicht. Da kannst du nichts für. Lassen wir es einfach gut sein.«
Die Traube aus Glöckchen an der Tür läutete und die ersten Gäste traten ein. Andie hastete von ihrem Barhocker und begrüßte die drei Männer pflichtschuldig. Die Herren sahen aus, als hätten sie sich in der Tür geirrt, denn sie alle drei trugen schicke Maßanzüge und hatten die Haare akkurat gestutzt.
Andie führte sie zu einem Tisch in der Mitte des Pianoraums und nahm ihre Bestellungen auf. Mit der Liste im Gepäck eilte sie zurück zu Cally, die immer noch mit Putzen beschäftigt war.
»Drei Bier«, sagte Andie.
»Nimm dich ein bisschen zurück, nicht so schnell, sonst wollen das alle«, scherzte Cally, obwohl Andie sich nicht ganz sicher war, ob es sich hierbei wirklich um einen Spaß handelte.
In einem unglaublichen Schneckentempo kramte Cally drei frische Biergläser hervor und begann ganz langsam damit, sie zu füllen.
»Wir hetzen uns hier nicht so. Das gehört dazu. Und du brauchst sie auch nicht zu begleiten. Wir sind kein piekfeines Restaurant.«
»Entschuldige«, murmelte Andie und wurde rot. »Ich war noch nie in einer solchen Bar …«
»Schwamm drüber«, erwiderte Cally mit einem Grinsen. »Wenn du was trinken willst, nimm es dir einfach, du brauchst die Getränke nicht zu bezahlen.«
»Kannst du mir einen Orangensaft geben?«, fragte Andie.
»Wenn wir so etwas haben, ja«, entgegnete die Barkeeperin und tauchte wieder einmal hinter der Theke ab, nur um kurz darauf mit einem Glas für Andie wieder zu erscheinen.
Gierig stürzte Andie den Orangensaft hinunter, die letzten drei Tage hatte sie nur Leitungswasser getrunken, das abscheulich schmeckte.
»Vorsicht, sonst verschluckst du dich noch«, sagte Cally scherzhaft.
»Entschuldige«, keuchte Andie, als ihr die Kälte in die Haarspitzen kroch. »Ich habe nur lange nichts mehr getrunken, das Geschmack besitzt.«
»Keine Kohle?«, fragte Cally unverblümt.
Andie nickte. »Ich habe noch ein paar Cent.«
Mitleidig sah Cally sie an. »Ich habe ein paar Kekse unter der Theke. Wenn du willst, nimm dir welche.«
»Danke«, sagte Andie beschämt.
Was für ein mieses Gefühl, wenn man andere um etwas zu essen anschnorren musste.
»Hier, die Herren haben jetzt lange genug gewartet«, rief Cally und drückte ihr ein Tablett in die Hand. »Aber direkt kassieren, die vergessen sonst gerne mal zu zahlen.«
Andie machte sich auf den Weg zu den Gästen, während die Glöckchentraube erneut schellte und die Ankunft weiterer Besucher verriet.
***
Als Andie am Ende der Schicht ins Bett fiel, war sie so müde, dass sie auf der Stelle einschlief und erst wieder aufstand, als es bereits Mittag war. Sie hatte bis halb drei im Wild Dog gearbeitet und sich danach nicht einmal die Mühe gemacht, ihre Klamotten auszuziehen.
Draußen schien die Sonne durch die verschmierten Fenster, denn die letzten Wochen vor Tante Drus Tod hatte die Putzfrau ziemlich geschludert und Andie hatte sie sowieso nie in ihr Zimmer gelassen. Sie war sich sicher, dass Carla, das spanische Hausmädchen, für Tante Dru spioniert hatte. Aber jetzt gab es keine Carla und keine Tante Dru mehr und es hätte vielleicht sogar ein wirklich schöner Morgen werden können, wenn sie denn etwas zu essen im Kühlschrank gehabt hätte. Doch Watling hatte erklärt, dass die Trinkgelder immer erst am nächsten Tag ausgezahlt wurden und der reguläre Lohn erst am Ende des Monats, somit saß sie immer noch auf dem Trockenen.
Mit knurrendem Magen stieg Andie unter die Dusche und erschrak fürchterlich, als das Wasser kalt ihren Rücken hinunterprasselte. Hektisch zerrte sie am Regler und drehte ihn auf warm, doch es geschah nichts. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als sich kalt zu duschen, was sie nur so lange tat wie nötig, um dann schnell in ihren Bademantel zu springen. Wenn jetzt auch noch der Boiler kaputt war, dann konnte sie sich einsargen lassen! Sie hatte sich niemals in ihrem Leben so schlecht gefühlt. Nur kaltes Wasser, nichts zu essen, kein Geld in der Tasche, was geschah heute noch? Vermutlich würde Watling sie heute einfach wieder entlassen, es würde zumindest zu ihrem Tag passen …
Fröstelnd zog Andie den Bademantel enger und ging nach draußen, um endlich die Post von gestern reinzuholen. Dabei fiel ihr ein Zettel an der Tür ins Auge. Sie riss ihn herunter und nahm ihn mit nach drinnen, ohne den Briefkasten zu leeren. Kurz und knapp: Man hatte ihr den Strom abgedreht.
Was hatte sie dem da oben getan, dass er sie so bestrafte? Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich von dem Trinkgeld, das sie heute Abend bekam, ein paar Kerzen zu kaufen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollte, die Treppe hinunterzufallen, denn in ihrer Straße gab es nicht viel Licht von außen. Damit fiel also das leckere Hähnchen flach, das sie sich eigentlich hatte machen wollen, und stattdessen gab es wohl nur Callys Kekse und ein Sandwich. Seufzend warf sie den Zettel auf den Schreibtisch, wo sich die gesamten Rechnungen seit Tante Drus Tod stapelten, und ließ sich auf den Stuhl daneben fallen. Wo sollte sie nur all das Geld hernehmen? Selbst mit einem gut bezahlten Job konnte sie da nichts mehr retten. Schließlich warf sie noch einen Blick auf den Zettel – 280 Dollar. Unmöglich, die in den nächsten Tagen aufzutreiben. Und den Brief des Inkassounternehmens hatte sie auch noch nicht geöffnet, aber die Summe würde wesentlich höher sein.
Andie war klar, dass es mit Kellnern allein nicht getan war. Sie musste Watling überreden, an mehreren Abenden singen zu dürfen, nicht nur donnerstags. Sofern das überhaupt etwas einbrachte. Aber wie sollte sie ihn dazu bringen? Immerhin arbeitete sie erst einen Tag im Wild Dog und das andere Mädchen war bestimmt schon genau so lange da wie Cally Ray. Außerdem hatte sie diese dritte Person noch nicht kennengelernt, vielleicht würde sie es als Affront nehmen, wenn Andie sich in den Vordergrund drängte. Aber es nützte nichts, sie würde fragen müssen. Wenigstens nach zwei Abenden.
Sie warf einen Blick auf ihr Handy, doch das war aus und sie hatte keine Möglichkeit, es zu laden. Ach, aber warum schaute sie auch darauf? Es rief sie sowieso niemand an. Gerade einmal auf ein Dutzend Telefonnummern hatte Andie es gebracht, seitdem sie bei Tante Dru lebte, und die stammten nicht gerade von engen Freunden, sondern eher von notwendigen Bekanntschaften wie ihrem Zahnarzt, dem Buchladen um die Ecke und eben anderen Leuten, die sie nicht um Hilfe bitten konnte.
Also blieb Andie nichts anderes übrig, als auf ein Wunder zu hoffen.
Kapitel 3
Obwohl sie zu früh dran war, wartete Cally bereits auf sie. Im Wild Dog roch es plötzlich angenehm nach Hot Dogs und Andie konnte überhaupt nichts dagegen tun, dass ihr Magen knurrte.
»Ich wusste doch, dass du Hunger hast«, sagte Cally lachend und schob ihr einen dick eingewickelten Hot Dog rüber. »Und guck nicht so. Der war schließlich nicht teuer.«
Schnell bedankte sich Andie und stopfte den Hot Dog so unmanierlich in sich rein, dass Tante Dru wohl augenblicklich in Tränen ausgebrochen wäre. Manchmal fragte sie sich, ob sie irgendeinen Schaden genommen hatte, weil sie so oft an die verhasste Tante dachte. Nein, verhasst war auch gar nicht das richtige Wort. Eigentlich war Tante Dru ihr egal, doch es war so ungewohnt, nicht mehr unter ihrer beständigen Herrschaft zu leben, dass sie sich auch jetzt noch, so wie früher, fragen musste, ob der Tante gerade missfiel, was sie tat.
»Du bist aber echt hungrig«, stellte Cally fest.
Andie nickte. »Haben … Strom abgestellt …«, brachte sie zwischen ein paar Bissen hervor.
Cally verzog das Gesicht. »Du steckst ja echt in Schwierigkeiten.«
»Meine Großtante hat die Schwierigkeiten verursacht. Aber die hat sich geschickt aus der Affäre gezogen.«
»Wie das?«
»Sie ist gestorben«, erwiderte Andie kurz und lauschte ihren Gefühlen nach.
Es schmerzte erstaunlich wenig. Sollte man nach so vielen Jahren des Zusammenlebens nicht wenigstens Trauer empfinden? Doch das Einzige, das sie spürte, war leises Bedauern. Was stimmte mit ihr nicht? War sie so herzlos geworden?
»Oh …«, machte Cally. »Das tut mir leid.«
»Das braucht dir nicht leidzutun«, seufzte sie und meinte es auch so. Wenn Tante Dru je irgendwelche guten Seiten gehabt hatte, so hatte sie diese Andie nie gezeigt. Außer natürlich, als sie sie bei sich aufgenommen hatte.
»Und was machst du jetzt wegen des ganzen Geldes?« Die Glöckchen klingelten hinter Andie, doch Cally hielt sie fest. »Ich hab’ doch gesagt, dass du denen nicht direkt hinterherzurennen brauchst.«
»Ich weiß es noch nicht«, beantwortete Andie die Frage, als sich eine Hand neben sie schob.
Die Hand war hell und die Finger schmal, feingliedrig und … Andie fiel kein besseres Wort dafür ein: elegant. Die Fingernägel waren gepflegt und sauber geschnitten. Diese Hand passte nicht an diesen Ort, sodass Andie gar nicht wagte ihren Blick zu heben. Cally jedoch schien den Gast zu kennen.
»Ach, hallo! Das Gleiche wie immer?«
Offenbar hatte der Mann neben ihr genickt, denn die Barkeeperin mit den Engelslocken machte sich an einer Weinflasche zu schaffen und reichte ihm kurz darauf ein Glas mit Rotwein. Damit verschwand er aus ihrem Blickfeld.
»Komischer Kauz«, sagte Cally, während Andie ihm mit offenem Mund hinterherstarrte. »Kommt ständig her, sagt keinen Ton und bestellt immer Rotwein.«
»Hm«, machte Andie, weil sie darauf nichts zu erwidern wusste.
Sie erhaschte noch einen Blick auf ihn, bevor er um die Ecke bog und im Pianoraum verschwand. Er trug eine Lederjacke und eine schwarze Hose, doch wirkte das an ihm nicht so heruntergekommen wie bei Bill Watling, der zufällig genau das Gleiche trug. Bei dem Fremden sah das alles so … passend aus. Sein rabenschwarzes Haar wirkte ebenso gepflegt wie seine Hände und sein Gang war von Selbstsicherheit und Stärke geprägt. Wie er wohl von vorne aussah?
»Typen wie den findest du wie Sand am Meer«, brummte Cally und machte sich an der Kasse zu schaffen.
»Ich hab’ nicht … Also …«, stammelte Andie, sodass die Barkeeperin lachen musste.
»Natürlich nicht.«
»Sag mal, wer ist denn die Sängerin, die hier immer auftritt?«, fragte sie, um das Thema zu wechseln.
»Von der hältst du dich besser fern. Die ist furchtbar stutenbissig.«
»Ist sie heute Abend hier?«
Cally sah auf die Uhr. »Die kommt in zwei Stunden, dann klimpert sie ein bisschen auf dem Piano oder ihrer Gitarre und verschwindet zum Glück wieder. Sprich am besten gar nicht mit ihr, es lohnt sich eh nicht.«
Die Barkeeperin kramte in ihren Regalen umher und füllte dann Sirup in den Getränkeautomaten. Als die Maschine jedoch nicht wieder ansprang, fluchte sie ziemlich unfein und gab ihr einen Schlag.
»Wartest du kurz hier?«, fragte sie. »Ich bin gleich wieder da.«
Andie nickte und Cally verschwand im Pianoraum. Draußen hatte es schon wieder angefangen zu regnen und die Straßen waren wie ausgestorben. Kein Wunder an einem so verregneten Mittwoch. Vermutlich gab es heute nicht viel zu tun, gestern waren um diese Zeit schon viel mehr Kunden da gewesen. Sie ließ sich auf einem der Barhocker nieder und begann mit den Beinen zu wippen, eine Angewohnheit, die Tante Dru die Zornesröte ins Gesicht getrieben hatte. Das Glöckchen an der Tür bimmelte und zwei Männer traten ein, die problemlos bei den Hells Angels hätten sein können.
»Vier Bier«, krähte der eine mit dem Kopftuch.
»Kommt gleich«, antwortete Andie, wie Cally es ihr eingetrichtert hatte.
Die Kerle nickten und ließen sich am Fenster nieder, während sie auf Callys Rückkehr wartete. Doch als sie nach einer Weile nicht zurückkehrte, zapfte sie selber die vier Bier und brachte sie zu den Rockern an den Tisch.
»Hab’ dich noch nie hier gesehen«, grölte einer von ihnen.
»Ich bin auch noch nicht lange hier«, antwortete Andie und strich sich die roten Strähnen zurück, weil sie nicht so recht wusste, ob das ein Kompliment war oder nicht.
»Sei nich’ so unhöflich zu dem Mädel«, maulte der mit dem Kopftuch. »Frag erst ma’, wie sie heißt.«
Andie stotterte ihren Namen. Worauf wollten die Kerle jetzt hinaus?
»Ich bin Adler«, verkündete der Erste.
»Niemand auf dieser Welt heißt Adler«, erwiderte sie überrascht, doch die Männer knufften einander in die Seiten und lachten albern.
»Okay, darfst uns auch das nächste Bier bringen. Dachte schon, Bill hätte uns so ’ne Tussi vor die Nase gesetzt, die uns sagt, dass wir unsere Füße nicht aufn Tisch legen dürfen oder anderes blödes Zeug.«
»Würde ich nicht im Traum dran denken«, murmelte Andie und verschwand dankbar, als sie Cally nach sich rufen hörte.
»Nimm die bloß nicht ernst«, mahnte Cally. »Die haben nur Unsinn im Kopf. Aber sie geben gutes Geld, glaub mir. Und wo wir gerade bei Geld sind, hier dein Anteil von gestern.«
Cally schob einen Umschlag zu ihr herüber und als Andie ihn öffnete, staunte sie nicht schlecht: Fünfundsiebzig Dollar.
»So viel?«, fragte sie erstaunt.
»Ich hab’ ja gesagt, dass man hier für wenig Arbeit viel verdienen kann. Was denkst du denn, warum ich diesen Unsinn immer noch mache?«
Andie stopfte den Umschlag in ihre Hosentasche. Heute trug sie eine ausgewaschene enge Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Das war zwar nicht besonders sexy, aber sie wusste, dass die Jeans ihren Po betonte, und fand, dass sie nicht jeden Tag einen Rock tragen musste.
Währenddessen hatte Cally bereits ein Weinglas auf ihr Tablett gestellt.
»Bring das zu deinem Süßen.«
»Zu wem?«
»Na, zu dem Typen, dem du eben hinterhergeschmachtet hast.«
»Ich hab’ nicht …«, begann Andie entrüstet, aber Cally lachte nur und deutete auf den Flur zum Pianoraum. »Geh schon, der wartet jetzt lang genug auf Nachschub.«
Während Andie noch fieberhaft überlegte, was sie mit diesen fünfundsiebzig Dollar anfangen konnte, betraten weitere Gäste den Raum. Offenbar war das Wild Dog besser besucht, wenn es Livemusik gab. Obwohl Cally sie vor der Sängerin gewarnt hatte, war sie dennoch gespannt auf ihre Darbietung, schließlich interessierte sie sich für alles, was mit Gesang zu tun hatte.
Der Mann saß auf einem der hinteren Plätze, genau genommen dort, wo sie gestern noch mit Bill über die Konditionen ihrer Anstellung gesprochen hatte. Er war groß, aber schlank, und sie konnte nun sein Profil erkennen. Sein Gesicht war ebenmäßig und die Nase gerade, seine Lippen schmal und er schien darauf herumzukauen, als sei er ein wenig nervös. Doch das machte ihn für Andie nur greifbarer, denn sie hatte noch nie jemanden gesehen, der so überirdisch schön war. An seinem Kinn zeigten sich ein paar Bartstoppeln, doch die wirkten bei ihm nicht ungepflegt, sondern männlich. Sein schwarzes Haar hing ihm locker in die Stirn und verbarg seine Augen. Sein Blick ging irgendwo in die Ferne. Mit klopfendem Herzen näherte Andie sich und stellte das Tablett vor ihm auf den Tisch. Als er den Kopf hob und sie fixierte, war Andie, als blicke sie in zwei tiefe Seen, denn seine Augen waren strahlend blau. Die dichten Wimpern verliehen ihnen eine gewisse Melancholie und die hohen Wangenknochen ließen ihn aristokratisch wirken.
»Ihr Wein, Sir«, flüsterte sie beinahe.
Er nickte zum Dank und nahm das Glas vom Tablett runter, doch er sagte kein Wort zu ihr, sodass Andie gezwungen war, das leere Glas zu nehmen und seinen Tisch wieder zu verlassen. Mit hochroten Wangen floh sie zur Theke, um sich bei Cally zu verstecken.
»Was ist denn mit dir los? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen«, fragte Cally verwundert.
»Was weißt du über den Typen?«, plapperte Andie atemlos.
Das war ihr ja noch nie passiert! Wieso hatte der Mann es geschafft, sie so durcheinanderzubringen?