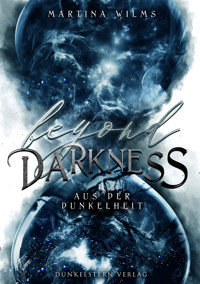Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dunkelstern Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: BEYOND
- Sprache: Deutsch
"Sieh mich doch an … sieh, wer ich wirklich bin. Ich bin ein Monster, so wie sie es immer gesagt haben. Wie du es gesagt hast. Eine jämmerliche, todbringende Bestie." Was gibt es Endgültigeres als den Tod? Mella ist gefangen in einer Spirale aus Schuld und Hass, die sie mit sich in die Tiefe zu ziehen droht. Einzig die Gier nach Vergeltung gibt ihr die Kraft, weiterzumachen. Doch die Rachsucht frisst sich in Mellas Seele wie Gift, bestimmt ihr Sein - und die Kontrolle zu verlieren, war noch nie eine gute Idee, wenn man am Abgrund tanzt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright 2022 by
Dunkelstern Verlag GbR
Lindenhof 1
76698 Ubstadt-Weiher
http://www.dunkelstern-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Für die Freiheit und die Menschlichkeit.
Inhalt
Triggerwarnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Triggerwarnung
Dark Romantasy ist ein Genre, das sowohl Romance- als auch Erotikelemente enthält, sich daneben aber auch grafisch mit düsteren, schweren Themen wie Gewalt, Folter, Mord, Trauer und tiefsten seelischen Abgründen auseinandersetzt.
Die in diesem Buch dargestellten Inhalte könnten auf sensible Leserinnen und Leser belastend wirken.
1.
Seine Lippen berühren meine Haut. Sanft, kaum der Berührung eines Schmetterlings gleich, und doch so intensiv, dass ich mich ihnen entgegenbiege. Mehr, oh, mehr davon.
»Mella.« Seine Stimme lässt mich vibrieren, jedes Mal, wenn ich sie höre, samtig und weich wie ein guter Cognac. Ich bade in seiner Wärme wie im Sonnenlicht. »Ich liebe dich.«
O Gott, wie oft habe ich mir gewünscht, diese Worte aus seinem Mund zu hören! Ich reibe meine Nase an seinem Hals, atme seinen Duft ein, der mich an das Meer erinnert, an den Geruch von Waldboden nach einem Regenschauer. Seine Bartstoppeln kratzen über meine Haut und lassen dieses wunderbare Prickeln zurück, direkt unter der Oberfläche.
»Ich dich auch, Lucas. So sehr.«
Er zerbröselt in meinen Armen, fällt in sich zusammen wie eine Sandburg in der Flut. Seine Augen sehen mich an, vorwurfsvoll, sind nichts mehr als blinde Spiegel, grau und leer. Gefühllos.
Weil er nichts mehr fühlt.
Weil da nichts mehr ist, was fühlen kann.
Norden, wispert der Wind und umschwärmt mich mit einer Sterbenskälte, wirbelt den Sand auf, der eben noch Lucas war. Norden, du nichtsnutziges Ding.
Die Stimme verhallt in meinen Ohren und ich starre in die schwarze Nacht. Kalt ist mir, so kalt. Ich ziehe die Decke hoch bis an mein Kinn und rolle mich zu einem Ball zusammen, bis das Zittern in meinen Muskeln langsam nachlässt.
Bald wird die Sonne aufgehen und ein neuer Tag beginnt.
Ein weiterer Tagohne ihn, einer von unendlich vielen. Er soll aus meinen Träumen verschwinden, so wie er aus meinem Leben verschwunden ist. Ich will nicht mehr an ihn denken. Nicht an sein Lächeln. Nicht an seine blitzenden Augen, eisblau und doch voller Wärme. Nicht an seine widerspenstigen Haare, so weich unter meinen Fingern, nicht an die Momente, in denen wir uns ganz nah waren. Nein, ich will nicht mehr von ihm träumen.
Ich will ihn wiederhaben.
Die Amseln singen ihr Morgenlied in der Hoffnung auf einen neuen, wunderschönen Spätsommertag, und ich könnte sie dafür töten. Ich will keine Normalität. Ich will keine Idylle. Ich will nur ihn.
Zu schwach für einen weiteren Tag schließe ich die Augen, und sofort umfängt er mich von hinten. Seine Wärme überspült meinen frierenden Leib. Er presst sich an meinen Rücken und sein Herz schlägt in seiner Brust, kräftig, regelmäßig. Lebendig.
Ich starre in die Dunkelheit und alles wird kalt. Seine Stimme ist nur ein Echo in meinem Kopf, eine vage Erinnerung an den Mann, der nur so kurz ein Teil von mir war. Sie wird das Erste sein, was ich von ihm vergesse.
Ein dünner Streifen aus tiefem Rot durchbricht die Finsternis und hinterlässt eine schmale Spur am Horizont. Rot wie sein Blut an meinen Händen. Kostbar und glitzernd im Mondlicht. Ich werde nie vergessen, wie es langsam auf meiner Haut abkühlte, wie es im Abfluss verschwand in diesen wunderschönen roten Wirbeln, als Tom es mir vom Leibe wusch.
Er hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Nicht ein einziges Mal. Jetzt, wo er für immer fort ist, höre ich diese Worte jede Nacht aus seinem Mund, in meinen Träumen, die so wunderschön sind, dass sie mich quälen, wenn ich wieder erwache. Und sie bedeuten gar nichts.
Ich zittere. Meine Stimme auch. »Ich wünschte, du wärst hier«, flüstere ich in den Schmerz und schließe die Augen.
Sein Lächeln ist so entspannt, so liebevoll, als hätten wir gerade miteinander geschlafen. »Das bin ich doch. Ich lasse dich nicht im Stich. Versprochen.«
»Und warum hast du es dann getan?«, schreie ich den neuen Tag an und werfe ein Kissen nach ihm. Es knallt gegen die Fensterscheibe und sackt auf der breiten Bank davor zu einem weißen, unförmigen Etwas zusammen, doch es kann diesen wunderschönen Sonnenaufgang nicht aussperren.
Ich will das nicht. Es darf keine wunderschönen Dinge geben, nicht nach dem, was geschehen ist. Langsam laufen die Farben ineinander, als ob ein Künstler zu viel Wasser auf ein Aquarell tröpfelt, und sie vermischen sich, bis nichts als ein tiefes Rot zurückbleibt.
»Scheiße.« Ich presse mir meine Handballen so fest auf die Augen, dass hinter meinen Lidern weiße Sternchen zerplatzen. Das Schicksal ist ein sadistischer Mistkerl, ein fetter, selbstgefälliger Sack aus reiner Schadenfreude, der sich vom Glück der Menschen ernährt und nicht zufrieden ist, bis er alles zerstört hat.
Hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass es möglich ist zu sterben und doch auf dieser Welt zu bleiben, ich hätte ihn ausgelacht oder wäre mit wild fuchtelnden Armen schreiend vor ihm davongelaufen. Die Tatsache, dass ich hier aufgewacht bin, in diesem Herrenhaus mit seinem unverschämt atemberaubenden Meerblick, nachdem ich drei Monate zuvor umgebracht worden war, hätte mich wohl mehr verstören sollen, als es am Ende wirklich der Fall war.
Nun bin ich für immer 29 Jahre alt und habe es nicht mal nach meinem Tod weit gebracht. Ich kann Lichtkugeln werfen, okay. Lichtwandeln klingt cool, zugegeben – es ist aber ziemlich nutzlos, wenn man nur in der Dunkelheit herumsteht und es nicht schafft, die Liebe seines Lebens zu retten.
Das Lächeln auf meinem Gesicht ist ein ungewohnter Gast in letzter Zeit. Die Liebe meines Lebens … ausgerechnet er musste es sein, der Einzige, in den ich mich nicht verlieben durfte. Mein Wächter, der Mann, der mir sein Blut gab, um mich zu verwandeln, zu retten, und damit eine brisante Verbindung zu mir schuf, die eine Todesgefahr für seine gesamte Blutlinie bedeutete, die nun auch meine ist.
Meine war.
Jetzt gibt es nur noch mich.
Denn Lucas ist tot und ich weiß einfach nicht, wie ich damit fertig werden soll.
∞
Keine Ahnung, wie lange ich heute Morgen versucht habe, mich in den Kissen zu ersticken, aber es hat offensichtlich wieder nicht geklappt.
Das energische Klopfen an meiner Zimmertür lässt mich nicht einmal zusammenzucken. »Geh weg«, murmele ich durch die Daunen und bewege mich keinen Zentimeter.
Es klopft lauter. »Mach die Tür auf, oder ich komme rein.« Toms Stimmehinter der dicken Holztür duldet keinen Widerspruch.
»Abgeschlossen«, informiere ich ihn dumpf.
»Das interessiert mich nicht sonderlich, wie du weißt.« Seine Stimme ist laut und klar. Er steht direkt neben meinem Bett.
Ich ziehe die Kissen von meinem Gesicht. »Ich sollte das Licht im Badezimmer brennen lassen, damit du dich nicht einfach hier reinschleichen kannst. Hast du noch nie etwas von Privatsphäre gehört?«
»Fühlst du dich so scheiße, wie du aussiehst?« Mit einem Ruck zieht er mir die Bettdecke weg.
Ich blinzle nicht einmal. »Wie außergewöhnlich liebenswürdig von dir.« Mit beiden Händen greife ich nach dem Onyx, der an einer Silberkette um meinen Hals baumelt, und halte mich daran fest. Die Kette meiner Mutter, schwarz wie sein Element. Alles, was ich noch habe von ihnen beiden.
»Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Du ersäufst hier in deinem Selbstmitleid und es kotzt mich an, wie schlecht es dir geht.« Vier Schritte braucht er bis zu meinem Fenster und er reißt es weit auf, lässt kühle Morgenluft herein. »Lass mich dir doch helfen, Mella.«
Ich kann nur müde lächeln. »Und wie? Willst du ihn mir vielleicht zurückgeben?«
Tom schluckt hart und schweigt.
Leise schnaube ich und schmiege meine Wange tiefer in die Kissen, mustere ihn, wie er da am Fenster steht. »Ja, das dachte ich mir.«
Sanft schüttelt er den Kopf. »Du musst mit dem Mist aufhören,Mella.«
»Was für ein Mist?«
»Ich kann ihn dir nicht zurückgeben.«
»Denkst du, das wüsste ich nicht?«, blaffe ich ihn an und schlucke die Tränen hinunter, die munter meine Kehle hinaufklettern. Mist, verdammt! Nicht schon wieder!
Doch Tom achtet gar nicht auf mich. Sein Blick wandert durch mein Zimmer, mustert die Haufen mit getragenen Klamotten, die überall verstreut herumliegen, und der besorgte Ausdruck auf seinem Gesicht schürt meine Wut wie ein plötzlicher Windstoß die Glut eines Lagerfeuers. »Ich nehme nicht an, dass du hier Modenschau gespielt hast, oder?«
Ich antworte ihm mit einem aussagekräftigen Schulterzucken und bleibe liegen, wo ich liege. Vor dem Fenster trällern die Amseln voller Inbrunst ihre Morgenlieder. Wenn die nicht gleich aufhören, pflücke ich sie mit ein paar Lichtbällen von ihren Ästen.
»Mella, los. Du liegst seit Wochen im Bett.«
Ich rühre mich nicht. »Und warum soll ich ausgerechnet heute aufstehen?«
Tom seufzt leise und hebt eine Jeans auf. »Um etwas zu tun. Irgendetwas. Um weiterzumachen.« Er dreht und wendet sie prüfend und nimmt eine zerknitterte Karobluse hoch, untersucht sie ebenfalls. Und dann – riecht er etwa daran? Missbilligend verzieht er das Gesicht und wirft mir beides zu. »Los, anziehen.«
Ich mache nicht einmal einen Versuch, die Sachen aufzufangen. Sie landen auf meinen nackten Beinen und wärmen mich wenigstens ein bisschen. Ob ich diese verfluchten Viecher dazu bringen kann, nie wieder vor meinem Fenster herumzugrölen? Ich hasse ihren Gesang, so melancholisch und sanft und scheiße.
Tom steht vor meinem Kleiderschrank und wühlt in einer Schublade. »Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich mal deine Unterwäsche in der Hand halte.« Er grinst zu mir hin.
Stumm starre ich ihn an und gebe mir alle Mühe, so tot auszusehen, wie ich mich fühle. Tief atmet er durch und lässt die Schultern sinken. »Willst du, dass ich dich anziehe?«
Ich angele nach der Jeans und der Bluse und quäle mich aus dem Bett. Auf dem Weg ins Badezimmer werfe ich sie zurück auf irgendeinen Haufen. Ich räume schon noch auf. Bestimmt. Wenn ich die Zeit dafür finde.
Tom hält mir kommentarlos Slip und BH hin und ich schnappe sie im Gehen aus seiner Hand. Er steht mir im Weg, blockiert den Kleiderschrank mit seinem großen, schmalen Körper. Ich schubse ihn zur Seite. Eine einzige, halbwegs saubere Jeans und ein dunkelgraues Shirt, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Eine ziemlich magere Ausbeute. Wie auch immer.
Ich rupfe die Sachen aus dem Schrank. Ein Kleiderbügel fällt heraus und landet scheppernd irgendwo auf dem Boden hinter mir.
Tom bückt sich danach. »Ich habe keine Lust mehr, dich jeden verdammten Tag so zu sehen, Mella.« Er spricht leise, als wäre ich ein Pferd, das mit aufgeblähten Nüstern vor ihm herumtänzelt.
Wortlos quetsche ich mich an ihm vorbei, verschwinde im Bad und knalle die Tür hinter mir ins Schloss, so laut ich nur kann. Soll er doch keine Lust dazu haben! Ich habe auch keine! Und wer fragt mich?
Er kann mich doch einfach liegen lassen, hier in meinem großen Bett, bis ich verschimmele. Was hat es ihn zu interessieren, wie es mir geht und was ich tue? Ich schmeiße Jeans und Shirt auf den Boden, dass links und rechts die Staubflocken nur so davonstieben, und suche meinen Blick im Spiegel.
Ich sehe immer noch aus wie ich. Wie sollte es auch anders sein? Ich werde nicht mehr älter, nicht eine verfickte Sekunde. Aber da fehlt etwas in meinen Augen. Leben? Lächeln? Alles an mir ist farblos.
Jedes Make-up wäre verschwendet, und so zerre ich mir meine Klamotten über den Leib und schleppe mich zurück ins Schlafzimmer.
Tom steht vor dem Fenster und sieht hinaus, genau wie Lucas damals, als ich ihn das erste Mal sah. Er hört mich kommen und dreht sich um. »Und? Geht’s dir besser?«
Wieder attackieren mich die Tränen, doch ich fange sie inmeiner Kehle ab und schlucke mehrfach, auch wenn es wehtut. Sie werden nicht gewinnen. Nicht hier. Nicht vor Tom, nicht schon wieder. »Was denkst du denn?«, würge ich hervor.
Er schüttelt den Kopf, die Augenbrauen zusammengezogen. Mitleid. Wie ich es hasse. »Was soll ich denn denken, Mella?« Seine Stimme klingt ganz sanft, so als redete er mit einem Kind. »Meine Güte, er ist länger tot, als er überhaupt in deinem Leben war.« –
Meine Lungenflügel beben unter dem verzweifelten Versuch, nicht loszuheulen. Das Blut rauscht in meinen Ohren wie ein Orkan. Kein Wort bringe ich heraus, und so starre ich ihn einfach nur an.
Kurz presst er die Lippen zusammen, kommt langsam auf mich zu. »Es war nur eine Affäre, Mella, nichts weiter.«
Der Kloß in meiner Kehle schmerzt fast noch mehr als seine Worte. Seit wann tut es weh, nicht zu weinen? Ich weigere mich, ihn anzusehen und starre auf die Knopfleiste seines Hemdes, als säße dort ein faszinierendes Insekt. »Hör auf damit«, wimmere ich. »Sei still.«
»Warum?« Er schüttelt den Kopf, legt seine Hände auf meine Schultern. »Ich versuche nur dir zu helfen.«
»Mir zu helfen? Indem du so etwas sagst?« Mein Stoß gegen seine Brust trifft ihn völlig unvorbereitet. »Wie kannst du es wagen, mir zu sagen, was ich fühlen soll? Spürst du es, jetzt in diesem Moment? Diese Leere, die ein Teil von dir wird, sich einbrennt in deine Eingeweide, wie ein Krebsgeschwür Besitz von dir ergreift und dein Denken und Handeln bestimmt, egal ob du wach bist oder schläfst?« Tränen laufen über mein Gesicht.
»Bullshit!«, schreit er mich an, doch ich sehe ihn genau, diesen Schmerz in seinen Augen. »Ihr hattet euren Spaß miteinander, das ist alles!«
»Spaß?« Wütend wische ich mir mit der Hand über die Wangen. Wieso zittert sie so? Ruckartig reiße ich sieherunter und versenke sie tief in meinen Hosentaschen. »Du denkst also, wir riskieren alles, nur weil wir ein bisschen Spaß haben wollten?«
»Verflucht, ihr kanntet euch kaum!«
Meine Kehle schnürt sich immer mehr zu. »Es ging nicht nur um Sex.«
»Ach nein? Worum denn dann?« Toms Augen verengen sich zu Schlitzen. »Ich warne dich, wenn du jetzt das L-Wort benutzt, kotze ich dir direkt vor die Füße!«
Ich fühle mich dumpf, geschlagen. Sämtlicher Atem entweicht meiner Lunge, und ich höre ihm zu, wie er zischend meinen Körper verlässt, langsam, quälend. »Ja«, sage ich mit einer Stimme, die nicht mehr wie meine klingt. »Dann werde ich es nicht benutzen.« Ich ziehe die Schultern hoch. »Ich will ja nicht, dass du noch mehr Widerlichkeiten von dir gibst.«
»Es waren doch nur ein paar Wochen, Mella.« Tom seufzt und schüttelt sachte den Kopf. »Ich kannte Lucas viele Jahrzehnte. Er würde dir das Gleiche sagen, wenn er hier wäre.«
Sein Name fährt mir wie ein Dolch ins Herz. Plötzlich schwankt der Sandsteinboden unter meinen Füßen und ich greife nach der Türzarge, als könnte sie mich vor dem Kentern retten. Weich schmiegt sich das glatte Holz an meine Handfläche, als wollte es mich trösten.
»Glaub mir einfach.« Tom sieht alles andere als triumphierend aus. Nur traurig. »Ich habe ihn schon unzählige Male so gesehen. Da war nichts. Nichts, das es wert ist, sich so darin zu verlieren, wie du es gerade tust.«
Meine Knie flattern. Hör auf, Tom, bitte. Es funktioniert nicht. Lass mich einfach in Ruhe.
»Ich weiß, wie er dich angesehen hat. Genau wie all die Frauen vor dir, deren Namen er innerhalb von Minuten wieder vergessen hatte.«
»Das ist nicht wahr«, protestiert diese fremde Stimme aus meinem Mund, fiepend wie ein geschlagener Hund. Seine Worte zerfressen mich wie Säure, höhlen mich aus.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen sieht er mich an. »Doch, das ist es, Mella, und das weißt du. Du musst es dir endlich selbst eingestehen.« Fast wirkt es so, als kämpfe er selbst mit den Tränen, dieser heuchlerische Mistkerl! Behutsam legt er die Hand auf meinen Arm. »Hak es ab.«
»Lass mich!« Ich stoße ihn so hart von mir, dass er rückwärts gegen einen der Sessel taumelt.
Er nimmt seinen Blick nicht von mir, und ich winde mich darunter wie ein Aal an Land. »Du musst ihn endlich loslassen!«
Ich will das nicht hören! Ich will nicht! Dankbar atme ich durch, als das Sirren meinen Verstand einnimmt, und dann verschwinde ich im Licht, während Tom vor mir herumfuchtelt und ich kein Wort mehr von dem verstehe, was er sagt.
Weg. Nur weg von hier!
∞
Es ist wunderbar still auf der Lichtung, auf unserer Lichtung. Keine Wolke steht am Himmel, er ist klar und so blau, wie seine Augen es waren. Staubpartikel flirren in der Luft, in ihrem Tanz nur gestört durch Insekten, die träge durch den sonnigen Tag summen. Immer noch ist es warm, auch wenn der Sommer eigentlich längst zu Ende sein müsste.
Sonnenstrahlen fallen durch die Baumwipfel, golden gefärbt von den gelblichen Blättern, und schenken dem Ort etwas Sakrales. Es ist fast so, als wäre ich in einer Kirche … wie überaus passend.
Das Moos schmiegt sich an meine Wange, ein wunderbar weiches, kühles Bett. Hier hat er gelegen, blutüberströmt, als ich ihm ein letztes Mal in die Augen sah. Längst haben der Wind und der Regen die letzten Körnchen seines Daseins weggespült, doch ich werde nie vergessen, wo er aus meinem Leben verschwand.
Ein Blütenblatt tanzt vom Himmel, weiß und zart wie die Unschuld. Sanft legt es sich auf das spiegelglatte Wasser. Träge hebe ich meinen Arm, lasse eine Lichtkugel erscheinen und zermahle es zu Staub.
Besser.
So ist es besser.
Ich rappele mich hoch, wische Grashalme und Moosreste von meiner Kleidung und konzentriere mich auf das Kribbeln unter meiner Haut. Eine so mächtige Kraft. Und so sinnlos, wenn man sie nicht im Griff hat.
∞
Mehrere in einer Reihe. Ja, ich kann es! Gut, sogar sehr gut. Tief atme ich ein, ziehe die Energie in meine Fingerspitzen und versuche es erneut. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Kurz nacheinander schlagen die Lichtkugeln in einen toten Baum ein. Mit jedem Treffer splittern Holz und Rinde ab, fliegen umher wie kleine Geschosse. Dunkle Rauchschwaden winden sich in die laue Spätsommerluft und ich muss grinsen. Es sieht aus, als hätte ich eine Obstschale in den Stamm gebrannt.
Ein Rascheln links von mir. Da! Ein Eichhörnchen! Kopfüber klettert es einen Baumstamm herab und springt auf den Waldboden, schnuppert suchend in die Luft. Wittert es den Brandgeruch? Seine schwarzen Knopfaugen glitzern aufgeregt, die Schnurrhaare zittern, und bevor ich weiß, was ich tue, hole ich aus: einmal, zweimal, dreimal.
Das Eichhörnchen springt hoch wie ein kleines Känguru und macht sich davon, so schnell es kann. Ich verfolge es mit meinen Blitzen, doch es verschwindet im Unterholz, bevor ich es erwische.
»Du musst die Bewegungen deines Gegners vorhersehen, sonst wirst du nie schnell genug sein.«
Ich wirbele herum.
Tom. Lässig steht er an die Felsspalte gelehnt. Sein Blick huscht hin und her zwischen mir und der Stelle, an der das Eichhörnchen im Wald verschwunden ist, und die Beunruhigung in seinen Augen ist nicht zu übersehen. Na wunderbar.
»Dein kleiner Trick hat nicht funktioniert, Tom.« Ich wende mich von ihm ab und öffne meine Handflächen zum Himmel hin. In jeder entsteht ein Lichtball, klein wie eine Erbse. O ja, ich bin eine Waffe, Lucas hat es immer gesagt. Und ich werde alle das Fürchten lehren, die es auch nur wagen sollten, sich mir in den Weg zu stellen.
»Ich denke doch. Immerhin lungerst du nicht mehr in deinem Bett herum.«
»Du solltest an deinen Schauspielkünsten arbeiten.« Vielsagend hebe ich die Augenbrauen. »Ich habe dir kein Wort geglaubt.«
Sein Blick ruht auf mir. »Dafür warst du aber ziemlich aufgewühlt.«
»Ja«, sage ich leise. »Weil ich allein die Vorstellung, dass auch nur etwas von dem wahr ist, was du sagst, nicht ertragen könnte.« Sorgfältig ziele ich auf den Waldsee, verfolge die Strömung eine Weile und lasse schließlich beide Kugeln gehen. Zischend treffen sie auf zwei gelbe Blätter, die sofort in Rauch aufgehen. O ja, verdammt! Es funktioniert! Ich kann zwei Ziele gleichzeitig treffen! Die Blätter verglimmen zu Asche. Schwarz vermischt sie sich mit dem Wasser, in dem sich das Blau des Himmels spiegelt. Es erinnert mich an seine Augen, wenn er aus den Schatten kam, und mein Herz ist gelähmt vor Schmerz.
»Du lernst schnell, Mella.«
»Nicht schnell genug.« Ich drehe mich nicht um. Die Ascheschlieren verlieren sich in sanften Wellen, und langsam bekomme ich meinen Atem wieder in den Griff. »Ich hätte ihn retten müssen.«
Tom seufzt leise. »Es war zu dunkel für dich. Du hattest keine Chance.«
Ich fahre zu ihm herum. »Das zählt nicht. Es hätte einen Weg geben müssen – es gibt immer einen Weg.« Wütend stoße ich meine Faust drohend in Richtung Boden. Ein gewaltiger Knall lässt mich zusammenzucken. Direkt neben meinem rechten Schuh ist das Moos verkohlt, leichter Brandgeruch steigt mir in die Nase. »Du liebe Güte.«
»O ja, das warst du.« Tom seufzt erneut und verzieht leicht das Gesicht. »Wir müssen deine Gefühle in den Griff bekommen, sonst fackelst du dich eines schönen Tages noch selbst ab.« Seine Stimme ist ernster als sonst. Ernster als früher. Kurz zögert er, dann greift er nach meiner Hand.
Tränen schießen mir in die Augen. »Ich schaffe das nicht ohne ihn, dieses Leben.«
»Du bist nicht allein.« Mit den Daumen wischt er meine Tränen fort. Neue strömen nach. Keine Chance, sie aufzuhalten, sie drängen einfach heraus. Tom verschwimmt vor meinen Augen zu einem fleischfarbenen Klumpen.
»Das ist mir egal! Scheißegal, ob ich die letzte Frau auf der Welt bin oder eine unter zehn Milliarden. Es tut weh, Tom, so weh, dass ich manchmal nicht mehr atmen kann! Als ob mein unverbesserliches altes Herz abstirbt und verwest und jeden Teil von mir mit dem Tod infiziert.« Ich schniefe und senke den Kopf. »Es stirbt in mir, während ich lebe. Wie kann das sein?«
Flach drückt Tom meine Hand auf meine Brust. »Spürst du das?«, fragt er leise. »Das ist dein Herz, dein wundervolles, liebendes Herz, und es schlägt, weil du da bist, Mella. Es wird immer schlagen.«
»Es schlägt für ihn.«
Er schüttelt den Kopf. »Nein, es schlägt für dich. Für niemanden sonst. Du bist nicht tot, und dass Lucas fort ist, wird dich nicht umbringen, glaube mir.«
Sein Name facht den Schmerz in mir an und er lodert hell wie ein Feuer im Wind. Ich werde ihn nie wiedersehen, ihn nie wieder berühren oder seine Stimme hören. Meine Kehle versteinert. Kein Atemzug passt mehr hindurch. »Warum habe ich es ihm nie gesagt?«
»Er weiß es.«
»Nein, verdammt! Nichts weiß er! Und er kann auch gar nichts mehr wissen, weil er tot ist! Ich will ihn wiederhaben!« Tief seufze ich. »Wenn ich ihn nur noch ei…«
»Jetzt komm mir nicht mit diesem Ich-will-nur-noch-einmal-Bullshit! Niemand will jemanden nur noch einmal!« Tom schnaubt und schüttelt erneut den Kopf, die Augen voller Schmerz. »Man bekommt nie genug. Nicht genug Zeit, nicht genug Worte, Blicke, Berührungen. Es wird immer etwas geben, was man mit dem, den man verloren hat, teilen will. Und genau das, was nie passieren wird, fehlt. Das ist es, was diese Löcher in unsere Herzen frisst. Verpasste Chancen, immer wieder, und kein ich-will-nur-noch-ein-Mal. Das ist nichtgenug, niemals genug. Sie fehlen, und die Krater in unseren Herzen mögen vernarben, aber sie heilen nie. Nicht, solange wir atmen.«
»Siehst du?« Ich lächele unter Tränen, ziehe leise die Nase hoch. »Das nehme ich dir jetzt ab.«
Kurz schließt Tom die Augen. »Er fehlt mir. Und ich vermisse Josephine und alle, die ich in den letzten Jahrhunderten meiner armseligen Existenz verloren habe. Aber die Wahrheit zu ignorieren, Mella, und die, die wir lieben, nicht loslassen zu können, macht alles nur noch schlimmer. Es vergiftet dein Dasein und die Trauer wird niemalsverschwinden. Du musst weitermachen – ohne ihn. Nimm deinen Schmerz, stell dich ihm und verwandle ihn in etwas, was dich dazu bringt, jeden Tag von Neuem aufzustehen.«
Die Welt um mich herum ist wie in Watte gehüllt. »Es fühlt sich einfach nicht so an, Tom. So endgültig. Ich habe das Gefühl, er ist nur auf einem Einsatz, und kommt jeden Moment zurück.«
»Mella«, haucht Tom. So viel Schmerz in seinen Augen, so viel Mitleid, dass mir übel wird.
Mit dem Handrücken wische ich mir die Nase ab. »Nein, Tom. Ist schon gut. Ich kenne die Wahrheit. Nur scheint mein Herz sie nicht glauben zu wollen.« Ich bücke mich und hebe meine Sweatjacke vom Boden auf, nur um irgendetwas zu tun.
»Die Société hat Häuser auf allen Kontinenten, Mella. Australien würde dir bestimmt gefallen. Nicht für immer – aber du musst wieder in die Spur kommen. Das hier ist doch kein Leben!«
»Leben …« Ich schnaube verächtlich. »Was ist so toll daran, wenn es nur aus Langeweile und Schmerz besteht? Was hält mich überhaupt noch hier? Es ist egal! Alles ist völlig egal! Ich bin die letzte meiner Blutlinie …«
Tom schenkt mir ein müdes Lächeln, doch die Sorge in seinem Blick kann er nicht vor mir verbergen. »Willst dudich selbst auslöschen, oder was?«
Ich zucke mit den Schultern. »Sag mir nicht, dass du nie darüber nachgedacht hättest!«
Er schnaubt leise. »Du weißt aber schon, für wen er gestorben ist, oder?«
Wie ein Peitschenhieb ziehen seine Worte über meine Eingeweide. »Wie kannst du …«
»Er hat das für dich getan, Mella. Er ist in diesem Tunnel aufgetaucht, am Ende seiner Kräfte, um dich da rauszuholen. Er wollte es selbst tun, obwohl er so schwach war, dass er kaum allein laufen konnte!«
Alles in mir krümmt sich zusammen und verkümmert wie eine Pflanze in der Wüste.
»Er hat sich für dich geopfert, weil du ihm so viel bedeutet hast, Mella, mehr als sein eigenes Leben! Wie kannst du auch nur daran denken, ihn so gering zu schätzen?«
Mit einem dumpfen Geräusch landet meine Jacke wieder auf dem Boden. »Scheiße«, flüstere ich erstickt.
Tom zieht mich in seine Arme. Fest drückt er meinen Kopf an seine Schulter. »Liebeskummer ist immer egoistisch, Mella. Und Trauer ist es auch. Wir sind wütend, weil wir das, wonach wiruns sehnen, nicht bekommen. Und auch nie bekommen werden.« Er legt seine Wange auf meinen Scheitel. »Du hast ihn bereits verloren.« Tom drückt mir einen Kuss aufs Haar. »Jetzt musst du weitermachen. Ich … ich habe mit Edith gesprochen.«
»Edith?« Erfolglos versuche ich, ihm meine Hand zu entziehen. »Sie soll sich ja von mir fernhalten!«
»Sie ist immer noch die Chefin der Société, Mella. Unsere beste Chance, Julians fixen Ideen ein Ende zu machen. Wenn nicht sogar die einzige.« Mit dem Daumen streicht er über meinen Handrücken, seinen Blick fest auf meine Augen gerichtet. »Wir könnten dich gut gebrauchen.«
Ich blinzle. »Trotz allem?«
Tom nickt und drückt meine Hand ein wenig fester. »Natürlich.« Mit dem Kinn deutet er auf den immer noch vor sich hin schwelenden Baum. »Deine Kräfte sind unfassbar.«
»Im wahrsten Sinne des Wortes.« Ich seufze und schüttele den Kopf. »Sie beherrschen mich. Hast du … hast du das Eichhörnchen gesehen?« Ein Kloß verspreizt sich in meiner Kehle, und ich könnte nicht sagen, ob das Ekel oder Angst ist, was sich in mir ausbreitet. Vielleicht beides.
Er lacht leise und senkt den Blick. »Natürlich habe ich es gesehen. Und es hat mir eine Scheißangst eingejagt.« Ich sehe sie in seinen Augen, als er wieder aufblickt. Sie ist echt. »Du musst über ihn hinwegkommen, und das sage ich dir nicht nur als dein Freund, dem du so sehr am Herzen liegst, Mella. Wenn du deine Kräfte beherrschst und nicht umgekehrt, wird dich Edith in der Société einsetzen und du bekommst deine Chance.«
Jede Unruhe in mir verlöscht wie die brennenden Blätter im See. Die Vorfreude darauf, endlich etwas tun zu können, vielleicht sogar Helena in meine Finger zu kriegen, lodert in mir auf wie ein Feuer im Windstoß.
»Aber ich kann das nicht einfach so abschalten, Tom. Ich weiß nicht, wie.«
»Gefühle sind nicht hilfreich.« Wieder drückt er meine Hand und lässt sie plötzlich los. »Verschwendete Gefühle noch viel weniger.«
Ich schlucke Stacheldraht, als mich die Trauer wieder hinterrücks angreift und zu überwältigen droht. Es tut weh, wahnsinnig weh, aber ich würge den Schmerz hinunter. »Du musst es ja wissen.« Die Energie flutet über meine Haut wie eine Impulswelle. Gut, dass er mich losgelassen hat!
»Ich werde dich trainieren.« Tom ignoriert meine Worte, so wie er immer alles ignoriert, was ihm nicht in den Kram passt. »Du wirst lernen, dein Talent im Schlaf zu beherrschen, und ich werde dir beibringen, dich in der Dunkelheit zu verteidigen. Doch das alles hat keinen Sinn, wenn du nicht aufhörst …«
Ich nicke und schlucke an meinen Tränen. »Zu trauern.«
Tom streicht mir einmal über die Wange, sanft, als wolle er unsichtbare Tränen fortwischen. »Genau.«
Langsam drehe ich mich um, mache ein paar Schritte auf den See zu. Hier habe ich ihn zum letzten Mal gesehen, getränkt von seinem Blut, kurz bevor er zu Staub im Wind wurde. Wie hört man auf zu trauern?
Mechanisch bücke ich mich und hebe eine Eichel auf, hole aus und versenke sie in dem schwarzen Wasser. Ein leichter Wind bläst mir ins Gesicht, und ich weiß, was die Kühle auf meinen Wangen bedeutet. Die Tränen. Immer holen sie mich ein. »Es ist erst wenige Wochen her. Zu kurz, um zu vergessen.«
Ich spüre Toms Wärme in meinem Rücken. »Am Anfang ist es immer am schlimmsten.«
Ich sehe Lucas vor mir, wie er sich krümmte und zusammenbrach, nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem wir jetzt stehen.
»Nachdem Josephine und die Mädchen gestorben waren, glaubte ich, den Schmerz nicht ertragen zu können. Ich war nicht mehr in der Lage zu atmen – jeder Atemzug ohne sie versetzte mir unerträgliche Stiche. Hier.« Tom legt sich eine Hand auf die Brust. Wieder lösen sich Blätter von ihren Zweigen, segeln langsam zu Boden. »Mir war nicht klar, dass es körperlich weh tut.« Er schluckt, und der Schmerz in seinen Augen ist so unerträglich, dass ich wegsehen muss.
Doch ich weiß, was er meint. Dafür, dass Lucas glaubte, wir hätten keine Seelen mehr, tut mir meine verflucht weh, jedes Mal, wenn ich an ihn denke.
»Ich habe darauf gewartet, dass der Schmerz irgendwann vorübergeht. Aber das tut er nicht. Er tut es einfach nicht.«
»Na wunderbar. Genau das, was ich hören wollte.« Shit.
»Aber das ist gut so.« Tom lächelt. Wie kann er jetzt lächeln? »Ich habe mit den Jahren gelernt, dass dieser Schmerz nichts anderes ist als Liebe. Für die Toten kann es kein schöneres Kompliment geben, als dass die, die zurückbleiben, um sie weinen.«
»Ich hasse weinen«, würge ich hervor und schlucke gegen die Tränen an, die meine Kehle hinaufkriechen.
Tom legt meine Hand auf seine, und ich spüre seinen Herzschlag, ganz ruhig und gleichmäßig. »Aber weinen ist gut. Es gibt uns Zeit zum Nachdenken, zum Erinnern. Es ist ein Abschied, und es wird dir helfen, loszulassen.«
»Bei Resa fühlte es sich so anders an.«
Leise schüttelt Tom den Kopf. »Deine Mutter hatte ihr Leben, Mella. Das war ihre Zeit. Und am Ende war ihre Zeit eben vorbei. Wie es bei jedem Menschen sein sollte.«
»Nur nicht bei uns.«
»Ja, nur nicht bei uns.« Er seufzt. »Es ist immer schmerzhaft, wenn jemand geht. Aber dieser Schmerz raubt uns alles, wenn wir es zulassen. Er hält uns gefangen an einem einsamen, unwirtlichen Ort.« Er lässt meine Hand los. »Du wirst Lucas nie vergessen, Mella. Doch du musst dich über den Schmerz erheben und ohne ihn weitergehen. Das ist der einzige Weg, für jeden von uns. Nach vorn. Ich bin ihn gegangen, und du wirst ihn auch gehen.«
Es ist nicht mein Trotz, der mich stumm bleiben lässt. Es ist der Schmerz und die Angst und die Verzweiflung, die mich von innen heraus auffressen und meine Zunge lähmen. Meine Trauer gehört mir, mir allein. Sie ist das Einzige, was ich noch von ihm habe.
Tom räuspert sich leise. »Ich kann dir nur meine Hilfe anbieten. Ob du sie annimmst, entscheidest du. Aber nur so kommst du in die Société.« Ernst sieht mich an. »Ich mache mir Sorgen um dich.«
Bitter lache ich auf. »Das brauchst du nicht. Ich lebe noch. Oder zumindest so etwas in der Art.«
An seinem traurigen Lächeln erkenne ich, dass er mich genau verstanden hat. »Dein Leben hat einen Sinn, Mella.«
Jetzt ist mein Lachen zynisch. »Und welchen, Tom? Niedliche kleine Eichhörnchen zu grillen und innerlich zu versteinern?«
Kaum merklich schüttelt er den Kopf. »Wir brauchen dich, Mella. Wenn du wüsstest, wie sehr.«
Ich zucke mit den Schultern und wende mich wieder dem See zu. »Und wofür? Entweder wird das Gute siegen oder das Böse. Ich bin dafür nicht wichtig.« Das Wasser hat sich mittlerweile wieder beruhigt. Glatt wie ein Spiegel liegt es da, ein Farbenspiel aus den schwarzen Schatten der Bäume und dem stahlblauen Himmel.
»Jeder ist wichtig. Ich …« Tom verstummt urplötzlich, und neugierig wende ich mich um. Er scheint über etwas nachzudenken, kämpft förmlich mit sich selbst. Schließlich sieht er auf, steckt mir auffordernd seine Hand entgegen. »Komm«, sagt er mit fester Stimme. »Ich will dir etwas zeigen.«
2.
Wo zum Teufel hast du mich hingebracht, Tom?«
Fauliges Wasser rinnt von den Wänden und bildet dunkle, glitschige Pfützen auf den Stufen einer engen, ausgetretenen Wendeltreppe.
»In unser Verlies.«
Meine Nackenhaare stellen sich auf. Verlies? Unser Verlies – wir halten sie im Herrenhaus gefangen? Nur wenige Meter unter mir hocken diese Schweine, die mir alles genommen haben?
»Ich will, dass du dir etwas ansiehst … oder vielmehr jemanden. Vielleicht verstehst du dann, warum es so wichtig es ist, weiterzumachen.«
Nacheinander klettern wir die Treppe hinunter, stets bemüht, nicht auszurutschen. Eine muffige Note, vermischt mit saurem Schweiß und einem Hauch von rostigem Eisen erfüllt die Luft.
Unten erwartet uns eine Metalltür, der schlammfarbene Lack darauf aufgebläht wie Blasen in einem Hefeteig. Tom zieht sie auf und bedeutet mir stumm, hindurchzugehen.
Hunderttausende von Schmetterlingen flattern in meinem Bauch umher. Warum fühlt sich diese beschissene Nervosität so an, als ob man verliebt wäre? Ich will das nicht fühlen! Nicht jetzt! Nie wieder! Einem Pistolenschuss gleich kracht die Tür hinter uns ins Schloss und ich zucke zusammen wie ein schreckhaftes Kind.
Kaltes Neonlicht beleuchtet einen langen Flur, nicht annähernd breit genug, um sich quer hineinzulegen. Zwanzig, dreißig Türen säumen die Wände, aneinandergereiht wie die abgenutzten Perlen einer zu oft getragenen Kette.
»Da sind sie drin? Julians Leute?« Mit dem Kopf deute ich den Gang hinunter.
»Die Blutsüchtigen und die Gestaltwandler, ja. Für die anderen mussten wir uns etwas Besonderes einfallen lassen.«
Meine Kehle schnürt sich so plötzlich zu, als hätte man mich im Weltall ausgesetzt. O ja, ich erinnere mich. Das schwarze Kellerloch, in dem sie mich gefangen hielten wie in einem Sarg tief unter der Erde. Ohne einen einzigen Lichtstrahl, mit dem ich irgendetwas hätte ausrichten können.
Unauffällig mustere ich Tom von der Seite. Damals war ich mir so sicher, dass er es war, der uns verraten hatte. »Was habt ihr euch für ihn einfallen lassen?«
Er sieht mich nicht an. »Für Lucas? Das willst du nicht wissen.« Tom setzt sich in Bewegung, den Blick starr nach vorn gerichtet. »Graves ist hier drin.« Er bleibt vor einer der Türen stehen und zieht einen Schlüsselbund aus der Tasche.
Ich lasse ihn stehen und laufe den Gang hinunter, von Tür zu Tür. Hinter kleinen, vergitterten Fenstern kauern schattenhafte Gestalten. Jede der Zellen ist belegt, und doch ist es gespenstisch still hier unten.
»Warum sind sie so ruhig?« Ich hätte erwartet, dass sie randalieren, schreien, flehen – aber nicht, dass sie so reglos dasitzen wie ein Stapel Holz und zu Boden blicken, sobald man ihnen in die dreckigen Gesichter sieht.
»Sie reden nicht. Keiner von ihnen, kein Wort.« Tom gesellt sich zu mir. »Als ob sie ein Schweigegelübde abgelegt hätten.« Beiläufig schiebt er eine Blende über das kleine Gitterfenster vor meiner Nase, als wollte er nicht, dass ich allzu genau hineinsehe. »Wir bekommen nichts aus ihnen heraus.«
Am Ende des Flures fällt ein schmaler Lichtstreif aus einem Türspalt. Warum ist sie nicht verschlossen wie die anderen? »Was ist da drin?«
Tom folgt meinem Blick und zupft an meinem Ärmel. »Komm, Mella, wir müssen zurück. Ich wollte dir jemanden zeigen.«
Interessiert mich nicht. Ich gehe in die andere Richtung, auf das helle Licht zu. Was ist das für ein Raum?
»Mella, du solltest nicht –«
Ich stoße die Tür weit auf und bade in gleißendem Licht. Reflexartig reiße ich meine Arme vors Gesicht, kneife die Augen fest zu. Die Energie pulsiert ungezügelt durch meinen Körper. »Scheiße, Tom! Sind das Flutlichter, oder was?« Meine Augen schmerzen, und ich habe alle Hände voll damit zu tun, die Kraft in meinem Körper unter Kontrolle zu bringen.
Ein beißender, chemischer Geruch schlägt mir entgegen, chlorartig, so ganz anders als der abgestandene Muff in den übrigen Zellen. »Lagert ihr hier Putzmittel? Verflucht, was ist das für ein Raum?«
Tom steht stumm in der Tür, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben. Keinen Schritt tut er mehr, als ob eine unsichtbare Wand ihm den Zutritt verwehrt.
Alle Wände und sogar die Decke und der Fußboden sind blendend weiß lackiert, hochglänzend. Keine Stelle, an der sich nicht das Flutlicht spiegelt. In der linken Ecke steht ein seltsamer Kasten mit Metallbügeln, ebenfalls weiß gestrichen. Ein Motor?
»Was …?« Vier Ketten hängen armdick und schwer von der Decke herab, an den Enden schmale, speckige Lederstreifen mit silbrigen Schnallen, und ich greife danach. »Fesseln …«, flüstere ich und fahre herum.
Tom steht nur da und kaut auf seiner Unterlippe, schluckt hart, die Hände zu Fäusten geballt.
Ich lasse die Kette los. Sanft klirrend schwingt sie hin und her, blinkt dann und wann in dem gleißenden Licht. »Tom?«
Er schluckt noch einmal und erwacht dann aus seiner Starre. »Schattenwandler«, sagt er leise, fast unhörbar und zuckt entschuldigend mit den Schultern.
Die Intensität der Flutlichter nimmt zu und nimmt wieder ab, als meine Fähigkeiten versuchen, aus mir hervorzubrechen. »Schattenwandler?«, flüstere ich. Der klinisch weiße Boden unter meinen Füßen gerät ins Wanken, und wie im Reflex breite ich beide Arme aus, als könnte ich mich irgendwo festhalten. »Hier habt ihr …« Ich sammle alle Kraft, die ich in mir habe, bevor ich es sage. »Ihn?«
Tief holt er Luft und nickt kaum wahrnehmbar, die Augen zu Boden gerichtet.
»O mein Gott«, hauche ich und nehme die Kette wieder hoch. Tränen tropfen von meinem Kinn und zerplatzen auf dem schlohweißen Beton zu glitzernden Diamantsplittern.
Leder. Dickes, hartes Leder, voller rotbrauner Flecken. Es muss sich hungrig in sein Fleisch gefressen haben, wenn er es auch nur wagte, sich zu bewegen. Das Licht flackert erneut, und fast schon zärtlich streichle ich über die Innenseite des Riemens. »Die Ketten sind so kurz.«
»Schattenwandler werden im Stehen angebunden. Damit …« Tom unterbricht sich und schluckt hart. »Damit sie keine Schatten werfen und darin verschwinden können.«
Mein Blick wandert zur Decke. Rundherum sind Scheinwerfer angebracht, es existiert kein Millimeter in dieser Zelle, der nicht voll ausgeleuchtet ist. Und der Kasten in der Ecke … ein Notstromaggregat, für alle Fälle.
»Alles wirft Schatten, allein die Falten in der Kleidung … und die dunklen Farben …«
Tom senkt den Blick, und etwas in mir sackt eine Etage tiefer. »Ihr habt ihm seine Sachen weggenommen und ihn so angekettet? Nackt?«
Er windet sich vor meinen Augen, als hätte er Schmerzen. »Ein Schattenwandler kann nun einmal jede Form von Dunkelheit nutzen.«
»Hör auf, immer von Schattenwandlern zu reden!« Schwere Schluchzer zerreißen meinen Körper. »Er war dein Freund, Tom! Wie konntest du das nur zulassen?«
»Ich hatte doch keine Wahl!« Er klingt verzweifelt. »Sie durften nicht misstrauisch werden. Wenigstens bei dir konnte ich etwas ausrichten. Wenn du wüsstest, was Helena eigentlich für dich geplant hatte … Ich habe sie davon überzeugt, dass diese Mühen nicht nötig wären, weil deine Kräfte noch nicht sonderlich stark ausgeprägt sind.«
Ich sehe es vor mir. Er, splitternackt, festgekettet und gleißendem Licht ausgesetzt. Was für mich die Rettung bedeutet hätte, muss für ihn die absolute Hölle gewesen sein.
Darum war er so schwach in jener Nacht. Das Licht entlädt ihn, und er hatte keine Chance, im Schlaf Kräfte zu tanken.
»Das ist kein Gefängnis. Das ist Folter.« Der Raum gerät ins Wanken wie ein in Seenot geratenes Schiff. Lass es nicht zu, Mella! Lass nicht zu, dass der Schmerz die Gewalt über dich gewinnt! Los! Halt dich fest! Denk! Denk, Mella!
»Helena«, flüstere ich tonlos, und es fühlt sich an wie eine Zauberformel. Der Schwindel erstirbt. Helena. Der glühende Klumpen in meinem Bauch war mir noch nie so willkommen. Ich werde dich kriegen, du Miststück. Warte nur ab. Und dann Gnade dir Gott.
Das Licht flackert wie in einer Disco. Tom tritt von einem Bein aufs andere. »Komm raus da. Es ist zu gefährlich. Du hast deine Gefühle nicht im Griff, und das verstehe ich auch, aber … wenn die Flutlichter durchbrennen, begraben dich Tonnen von glühend heißen Glasscherben unter sich.«
Ich blicke nach unten, auf die Lederfessel in meinen Händen. Vor wenigen Wochen hat sie sich um sein Fleisch gewunden. Um sein warmes, lebendiges Fleisch, das jetzt nur noch Staub ist.
»Komm schon«, wiederholt Tom leise. »Dafür sind wir nicht hergekommen.« Er verschmilzt mit dem Flur und ich folge ihm mechanisch zurück bis zu der ersten Tür.
Er zieht den Schlüsselbund erneut hervor. Mit einem schrillen Ächzen dreht sich der Schlüssel im Schloss und die Tür schwingt auf. In dem dunklen, fensterlosen Loch pralle ich gegen eine Wand aus abgestandener Luft. Auf dem feuchten Boden hockt ein zerlumptes Etwas, wie ein Jutesack, an dem die Ratten bereits ihre helle Freude hatten.
Ich deute auf das altersschwache Türschloss. »Ihr schließt nur einmal ab? Habt ihr keine Angst, dass sie euch entwischen?«
Das hier, dieser Abschaum, der vor mir kauert, könnte genauso gut Helena sein. Ein Lächeln huscht über mein Gesicht, doch es fühlt sich nicht glücklich an. Es bringt nichts, an sie zu denken. Noch habe ich sie nicht in meinen Fingern.
»Blutsüchtige, wie dieser hier?« Tom schüttelt den Kopf. »Nein, mit Sicherheit nicht. Setz sie ein paar Tage auf Diät und sie kommen nicht einmal mehr aus der Tür, wenn sie sperrangelweit offensteht. Hey! Graves!« Er stößt das dunkle Bündel mit der Schuhspitze an.
»Was?«
Meine Nackenhaare stellen sich auf. Diese Stimme!
Er hustet röchelnd und spuckt uns irgendetwas vor die Füße. »Verpisst euch! Von mir erfahrt ihr nichts!«
Ich kenne sie! Ich habe sie schon mal gehört! Langsam gehe ich vor ihm auf die Knie. Schlammige Feuchtigkeit dringt durch meine Jeans, klebrig, zäh und so kalt, dass meine Haut schmerzt. Ich packe sein Kinn und zwinge ihn, mich anzusehen. Er tut es, und keuchend stoße ich Luft aus. Er ist es, er ist es wirklich. Der Mann, der mich in Schach gehalten hat, der mich auslachte, nachdem wir ihnen ausgeliefert waren. In derselben Nacht, in der Lucas …
»Sieh mal an, das kleine Betthäschen.« Sein Gesicht ist unversehrt, doch das verkrustete Blut in seinen Stirnfalten bezeugt, dass das nicht immer so war. Gut so. Ein schiefes Lächeln verzerrt seine ausgetrockneten Lippen, dehnt die dünne Haut so stark, dass sie unter der Bewegung aufreißen. Kleine Perlen von Blut quellen hervor und gierig leckt er sie fort. »Wer hätte gedacht, dass wir zwei Hübschen uns so schnell wiedersehen?«
Sein Grinsen wird breiter, enthüllt nikotinfleckige Zähne. Sein Atem erinnert entfernt an Brackwasser, und ich würge die aufsteigende Übelkeit hinunter wie einen Kieselstein.
»Was macht die Liebe, mein Kleines? Schon Ersatz für deinen Wächter gefunden? Nein? Oh, ich würde mich sofort anbieten, falls du es brauchst, du Fotze!«
Ich hole aus und schlage ihm ins Gesicht. »Wag es nicht! Wage es bloß nicht, dich über mich lustig zu machen!« Sein Kopf fliegt zur Seite und meine Hand brennt von dem Schlag.
Wie ein Stehaufmännchen in einem Albtraum rappelt er sich sofort wieder auf und tastet nach der Platzwunde auf seiner Wange. Ein dünnes, rotes Rinnsal versickert in seinen ranzigen Bartstoppeln. Er verzieht die Oberlippe zu einem höhnischen Grinsen und schiebt sich seinen schmuddeligen Zeigefinger in die Wunde. Ohne mich aus den Augen zu lassen, leckt er daran, als wäre es das köstlichste Eis der Welt.
»O ja, du bist wirklich ein Heißsporn, nicht wahr?« Lachen rasselt in seiner Brust wie ein alter Dieselmotor kurz vorm Krepieren. »Hast ihn auch geschlagen, was? Hat ihn das auch so geil gemacht wie mich? Ist er gekommen, wenn du ihn mit deinen Fingernägeln bearbeitet hast? Hast du ihn zum Flehen gebracht, zum Schreien, deinen dummen, schwachen Wächter, Gott hab ihn selig?«
Meine Hand schnellt vor und legt sich um seine Kehle. Blendend weiße Sternchen rieseln vor meinen Augen herab. »Du Stück Scheiße«, röchele ich mit einer Stimme, die nicht mir gehört.
Sein Grinsen wird breiter. »Oder vielmehr der Teufel …«
»Hör auf!« Ich drücke fester zu.
Genüsslich leckt er sich über die rissigen Lippen. »O ja, mehr, du machst mich wirklich an, Baby …«
Die Welt verzerrt sich. Ich sehe nur noch seine Augen, grüne, dreckigeAugen, die mich verhöhnen, und ich möchte sie leiden sehen, möchte sehen, wie sie begreifen, wie die kleinen, feinen Äderchen in ihnen platzen, aus den Höhlen quellen und schließlich brechen.
»Mella!« Tom reißt mich mit einer solchen Gewalt nach hinten, dass ich ungebremst mit dem Hinterkopf gegen die Stahltür schlage.
Benommen ertaste ich eine klebrige Flüssigkeit zwischen meinen Fingern. Verdammt! Blut! Wie heftig hat dieser Idiot mich gegen die Tür geworfen? »Tom! Hast du sie noch alle?«
Tom reagiert nicht. Er kniet vor dem Gefangenen wie erstarrt und ignoriert mich vollkommen.
»Tom?« Ich rappele mich auf und krabbele auf allen vieren zu ihm hin, jeden Gedanken an den Schlamm verbannend, der zwischen meinen Fingern hindurchquillt. »Ich rede mit dir, du verfluchter Mistkerl! Spinnst du, oder was?«
Langsam dreht er sich zu mir um. Seine Pupillen glitzern schwarz im spärlichen Licht. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er mich an. »Was hast du getan?«
Ja, was habe ich denn getan?
Ich schiebe Tom zur Seite. Der Abschaum liegt am Boden. Keine Spur mehr von Überlegenheit oder Verachtung. Er windet sich in Zuckungen inmitten der graubraunen Matsche, fiept wie ein Hundebaby beim Ersäufen. Und dann sehe ich, was ich getan habe.
Große gelbe Blasen übersähen seinen Hals, prall gefüllt mit einer wässrigen Flüssigkeit. Zwischen all den Beulen ist seine Haut krebsrot und nässt, hängt in Fetzen hinunter und enthüllt hellrot glänzendes, rohes Fleisch. Der Gestank in der Luft erinnert mich schwach an ein Barbecue.
»O mein Gott«, flüstere ich und schlage mir beide Hände vor den Mund. Und dann muss ich lachen, und zwar so sehr, dass ich mich auf dem Boden krümme. Das Lachen frisst sich in meine Eingeweide, vibriert in jeder meiner Körperzellen.
Hörst du es, du Wichser? Wer lacht jetzt? Ich werde über euch triumphieren, über jeden von euch, und dann werdet ihr mich anflehen, euch endlich zu erlösen. Ja, unterschätzt mich ruhig!
Mein Gelächter dröhnt durch den totenstillen Zellentrakt. Die Wände werfen es zurück, und erst, als ich einen Blick in Toms entsetzte Augen werfe, spüre ich die Angst, diese Angst vor mir selbst, die tief in einer Ecke meiner Seele kauert und sich nicht traut, gegen den Wahnsinn anzutreten.
∞
»Rotwein?«
Wie ein Sack Mehl hocke ich auf dem Boden vor Toms Ohrensesseln, die Knie an meine Brust gepresst. »Und was soll der helfen?«
»Wein hilft nie.« Tom drückt mir ein gut gefülltes Glas in die Hand. »Aber er schmeckt wenigstens gut.«
Ich halte den Kelch in beiden Händen und schwenke ihn ein wenig. Der Wein wirbelt darin empor, hinterlässt ölige Tropfen an der gläsernen Wand. Eine wunderschöne, satte Farbe. Tiefrot. Wie sein Blut im Licht des Vollmonds.
Wie der Hals dieses Widerlings Graves, nachdem ich mit ihm fertig war. Eiskalte Nadeln stechen in jeden Millimeter meiner Haut. Ich ziehe die Beine noch enger an mich, umfasse meine Knie und versinke in den Anblick der rubinroten Flüssigkeit. Kalt ist mir, so kalt.
»Und? Wie ist er?« Tom stellt die Flasche auf den Tisch und hält sein Glas gegen die Sonne. Ihre Strahlen brechen sich darin und bringen das Rot noch mehr zum Leuchten.
»Köstlich.« Er erinnert mich an warme Sommerabende auf dem Balkon, Mückenkerzen in der Dämmerung und gute Gespräche, an Zeiten, in denen ich noch nicht in der Lage war, jemandem mit meiner bloßen Berührung Verbrennungen dritten Grades zuzufügen.
Tom sinkt vor mir auf den Boden. »Du hast gelacht, Mella.« Er flüstert fast. »Du hast ihn gequält und du fandest das lustig.«
Ich lege meine Lippen an das Glas und zucke als Antwort mit denSchultern. Was erwartet er von mir? Klar ist das grausam und widerlich, aber … nie habe ich mich so stark gefühlt. Unbesiegbar.
Tom schüttelt den Kopf und nimmt einen tiefen Schluck Wein, starrt vor sich hin.
Ich räuspere mich leise. »Ist er … Habe ich ihn umgebracht?«
»Nein, er ist ein Umbracor, seine Wunden werden heilen. Bald wird man nichts mehr davon sehen.«
»Hat es ihm wehgetan?«
Tom schnaubt und steht auf. »Natürlich hat es das, Mella! Du hast ihm die Haut vom Körper gebrannt.«
Etwas in mir macht einen Luftsprung. Ich weiß, ich sollte mich schlecht fühlen, aber … die Haut vom Körper gebrannt. Ein wohliger Schauer rieselt meinen Rücken hinab. Ah, wie sich das anhört! Ich muss keine Angst mehr haben. Vor niemandem. Keiner wird mich ungestraft gegen meinen Willen berühren, nie wieder!
Wie weich sich der Wein auf meiner Zunge anfühlt. Langsam rinnt er meine Kehle hinab, wie Balsam, wunderbar samtig, fast ein bisschen holzig, mit einer fruchtigen Süße und einem dezenten Hauch von … feuchter Erde.
Eine Welle der Übelkeit überrollt mich. Ich stelle das Glas vor mich auf den Couchtisch, beobachte, wie die tiefrote Flüssigkeit darin wilde Wellen schlägt.
»Ich werde nicht erlauben, dass du aus purer Selbstsucht alles zerstörst.« Tom sitzt nur da, das Glas in der Hand. Ich kann nicht sagen, ob das eine Drohung ist oder ein Versprechen. »Rache ist wie eine Fata Morgana, Mella. Aus der Ferne mag sie wie das Wunderbarste aussehen, das du dir vorstellen kann, doch wenn du sie endlich erreicht hast, lässt sie dich mit gar nichts zurück.«
»Das sagst ausgerechnet du?« Ich stoße ein bitteres Lachen aus. »Wo bist du denn anders als ich? Was sind deine edlen Motive, Julian zu bekämpfen?«
Seine Kiefermuskulatur arbeitet. »Ich widerstehe. Ich tue das alles nicht, um mich zu rächen. Ich will ihn aufhalten und nicht Genugtuung für etwas bekommen, was er mir angetan hat. Das, meine Liebe, ist der Unterschied.« Sanft schüttelt er den Kopf. »Mella, deine Selbstsucht wird noch dazu führen, dass Julian gewinnt. Das können wir nicht zulassen. Du musst das Spiel nach unseren Regeln spielen. Oder gar nicht.«
Regeln, Regeln, immer diese Scheißregeln! Wo haben sie mich denn hingebracht, diese Regeln? »Wie soll das gehen?«
Tom beugt sich verschwörerisch vor. »Bitte lass ihn los, Mella!«
Wie Säure brennt der Wein in meiner Kehle. »Und wie?«
Leise seufzend lehnt Tom sich wieder zurück. »Rede mit mir.«
»Lass mich in Ruhe, verdammt!«
Mit großen Augen starrt er mich an, als wäre ich gerade direkt vor ihm zu einem grünen Affen mutiert, und ein Lachen drängt aus mir hervor, als würde ich es erbrechen. Doch am liebsten würde ich losheulen, schreien, mein Glas gegen die Wand schmeißen oder mich von den Klippen in die Tiefe stürzen. »Therapiestunde mit Tom, oder was?«
»Nenn es, wie du willst.« Er verzieht keine Miene. »Du musst dich schon selbst aus der Scheiße ziehen. Aber ich helfe dir dabei, wenn du es zulässt.«
Die Enge in meiner Kehle schnürt mir jedes Wort ab. Ich stehe auf und dränge mich an ihm vorbei, haste hinüber zum Fenster. Es ist stickig hier drin. Luft, ich brauche Luft. Hastig, bevor die Übelkeit mich übermannt, stoße ich beide Fensterflügel auf und genieße die Kühle, die von draußen in das Zimmer dringt und mich sanft umfängt. Was wird passieren, wenn ich mich darauf einlasse? Was … was wird mit Lucas?
Das Licht war genauso eisig, als ich zum ersten Mal in diesen Park hinausschaute, vereinzelt wehten braune, starr gefrorene Blätter an den kahlen Ästen der Bäume im Wind. Und nun verfärbt sich das Laub bereits und wappnet sich dafür, erneut abzufallen und die Erde langsam für den Winter zuzudecken. Die Sonne versinkt im Meer, Zentimeter für Zentimeter, und nimmt jede Wärme mit sich fort. Es wird kühl. So kühl, wie es sich in mir anfühlt.
Tom steht auf. »Fällt dir diese Entscheidung wirklich so schwer?«
Was für eine bescheuerte Frage! Ich balle die Fäuste, grabe meine Fingernägel tief in mein Fleisch und heiße den Schmerz willkommen, der sich auf meine Hände konzentriert. Tränen brennen in meinen Augen. Schmerztränen. Wuttränen!
»Es wird dir besser gehen, das verspreche ich dir.«
Ich schnaube verächtlich und drehe mich zu ihm um. »Natürlich wird es das. Irgendwann.«
Er steht vor dem Sessel, das Glas Wein in seiner Hand, und sieht aus wie ein verschüchtertes Kind.
Ich rolle mit den Augen. »Irgendwann werde ich wieder lachen. Und mich vielleicht neu verlieben. Und eines schönen Tages wird der Schmerz vergangen sein und ich werde mich nur in Liebe und Dankbarkeit an ihn erinnern, richtig?« Tom sieht verwirrt aus, und plötzlich schlägt die Wut in mir Wellen, hoch, höher, als ich sie in Zaum halten kann. Voller Bosheit gönne ich ihm ein breites Grinsen. »Genauso war es bei dir, nicht wahr?«
Schmerz ergreift Besitz von seinen Augen, o Gott, und ich genieße es. Es tut so gut! Er nährt mich, sein Schmerz, lässt mich wachsen. Seine Frau, Josephine, und seine kleinen Töchter. Sie werden ihn nie loslassen.
Ich hasse mich dafür, ihn dorthin getrieben zu haben. Und gleichzeitig bin ich so froh, diese Trauer in seinem Blick zu sehen, diesen nie enden wollenden Schmerz des Verlusts, der mir zeigt, dass ich nicht allein bin mit dem, was in mir tobt, auch wenn er noch so sehr das Gegenteil behauptet.
»Wie kannst du es wagen.« Langsam schüttelt Tom den Kopf, die Augen dunkel vor Schmerz, ein einziger Vorwurf, und ich wache auf.
»Ich … o Gott, ich weiß nicht, was …« Mit beiden Händen fahre ich mir durchs Gesicht. »Was ist nur los mit mir?«
»Es ist diese Kraft. Du bist zu schwach für sie.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Zu schwach?«
Er schluckt hart. »Sie überwältigt dich, weil dein Geist mit etwas anderem beschäftigt ist. Erinnerst du dich noch an deine Pinguine?«
Mechanisch nicke ich.
»Du hattest deine Kraft noch nicht im Griff, und deshalb konnte sie mit dir machen, was sie wollte, dich fortbringen, ohne dass du etwas dafür getan hättest. Doch nun bist du so viel stärker, und das macht es gefährlich.«
»Ich will nicht gefährlich sein«, murmele ich. »Nicht für meine Freunde.«
Er nickt kaum merklich. »Ich weiß. Willst du deine Kraft kontrollieren?«
Stumm sehe ich ihn an. Ich weiß was nun kommt … aber ich will es nicht hören. Es wird einen anderen Weg geben – es muss ihn geben!
»Ich kann dich trainieren«, sagt Tom leise. »Ich bringe dir bei, dich zu konzentrieren, auf die Energie zu fokussieren, bis sie wieder dir gehört. Aber wir fangen klein an. Ich lehre dich das Kämpfen, bis du jedem von Julians Leuten im Schlaf gewachsen bist.«
»Und was wäre der Preis?«
Mit dem Anflug eines Lächelns schüttelt er den Kopf. »Es gibt keinen Preis. Dir wird es besser gehen … wenn du ihn hinter dir gelassen hast.«
Blaue Augen in blauem Licht. Meine Träume, Fantasien von Vertrautheit und Nähe, nichts als ein verzweifeltes Klammern an eine Wahrheit, die schlicht nicht wahr ist. »Glaubst du, mir ist nicht klar, wie viel leichter es wäre, eine unwichtige Affäre abzuhaken? So ist es aber leider nicht, Tom.« Meine Stimme klingt brüchig wie eine Sandburg in der Sonne, und ich wende mich von ihm ab, um mir die Tränen aus den Augen zu wischen. Schnell, bevor er sie sieht. »Natürlich werde ich es schaffen. Meinen Weg aus dieser Trauer finden. Irgendwann. Aber noch nicht jetzt.«
»Ich will dich nur beschützen.« Seine Stimme ist so leise, dass ich sie kaum noch verstehen kann. Eine unbändige Wut schwingt darin mit, kaum hörbar. »Diese beschissenen, unnützen Gefühle. Sie laufen ins Leere, doch dumm und naiv, wie wir sind, halten wir uns daran fest, auch wenn wir eigentlich ganz genau wissen, dass der Schmerz dann unerträglich wird.«
Ich sacke innerlich in mich zusammen und spüre im gleichen Moment seine Körperwärme in meinem Rücken wie einen schützenden Kokon.
Sanft berührt er meine Schultern. »Doch das wird nicht passieren, Mella.«
Ich drehe mich zu ihm um. In seinen Augen spiegelt sich dieselbe Qual, die ich empfinde. »Nein?«
»Nein.«
»Weil es nicht schlimmer werden kann, als es jetzt schon ist?«
Tom atmet tief durch. »Nein, Mella. Weil ich glaube, dass es nichts gibt, was du nicht ertragen kannst.«
Ich höre selbst, wie ungläubig das Lachen aus meinem Mund klingt. »Gott, ich wünschte, ich könnte mich stumpf trinken, diese Gefühle zum Schweigen bringen.«
Tom lächelt und geht zurück zum Tisch, holt unsere Gläser. »Frag mal, wer noch.«
Doch der Wein zeigt keine Wirkung. Kein Gift schlägt bei uns an, was streng genommen gut ist. Aber in Momenten wie diesen wäre es schön, sich aus der Realität ballern zu können.
Die rote Flüssigkeit in meinem Weinglas schwappt hin und her, wie ein Meer aus Blut, und ich nippe daran. Weich rinnt sie meine Kehle hinab. Mit jedem Schluck steigt eine Erinnerung in mir hoch, Augenblicke der Ruhe und Behaglichkeit, vage und blass, wie ein Gedicht, das man in Kindertagen auswendig gelernt hat.
Tom sieht hinaus auf die glitzernden Wellen, schweigt. Fast 700 Jahre ist er alt, und doch ist da immer noch etwas Jungenhaftes in seinem Aussehen, in dem Funkeln seiner Augen.
»Wie machst du das nur, Tom? Dass du nicht durchdrehst?«
Er erwacht aus seinen Gedanken und zuckt mit den Schultern, den Anflug eines Lächelns auf den Lippen. »Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine aggressiven Kräfte habe wie du.«
Ich muss an das silberhaarige Mädchen denken, das ich vor einiger Zeit im Park beobachtet habe. Sie verschwand vor meinen Augen in einem Lichtblitz. Ob sie das auch fertigbringt? Jemanden zu verbrennen? Und ich meine nicht, ob ihre Kraft das hergibt, vielmehr … könnte sie es?
Lucas lebte an diesem Tag noch. Und Julian war einfach nur Julian aus dem Archiv. Ich wusste nicht, dass er der Master ist, der mein Leben zerstören wird. Und das so vieler anderer auch, wie das des Mannes, der hier neben mir steht.
Sein Haar glänzt in der Sonne wie ein Weizenfeld. Er hält das Glas in der Hand, doch er rührt es nicht an. Keine Ahnung, wo er gerade mit seinen Gedanken ist.
»Du hast mir nie gesagt, was dein besonderes Dunkelkind-Talent ist, Tom.«
»Das ist keine große Sache.« Er zuckt mit den Schultern, blickt in die Ferne. »Ich kann mein Gegenüber durch eine simple Berührung erblinden lassen.«
Leise seufze ich. »Ich wünschte, du könntest meine Seele blind machen.« Ich bewege das Glas in meiner Hand, nur um die blutrote Flüssigkeit herumwirbeln zu sehen. »Werde ich es schaffen? Meine … Kräfte in den Griff bekommen?«
»Aber klar.«
Weiß er, was ich eigentlich sagen will?
Ein wenig ungeschickt legt er seinen Arm um mich und dankbar lehne ich mich an seine Schulter. Himmel, wie lange hat mich niemand mehr so festgehalten?»Ich werde dir dabei helfen.« Er legt seine Wange auf mein Haar, haucht einen leichten Kuss darauf. »Und dann bringe ich dich fort von hier. Weit weg, wo du ganz von vorn beginnen kannst.«
Von vorn?
Habe ich das nicht erst vor wenigen Monaten getan?
Und wie hat es geendet? Strahlende, eisblaue Augen blitzen in meiner Erinnerung auf.
Ich schütte Wein in meinen Mund und schlucke ihn hinunter, noch bevor das erdige Aroma eine Chance hat, sich zu entfalten.
∞
Manchmal ist es hier so ruhig, als hörte man den Tod, der in uns allen wohnt. Als ob das Herrenhaus tatsächlich leer und verlassen wäre. Wie ein Mausoleum, in dem nichts lebt außer ein paar Spinnen und Ratten, die heimlich in den Halbschatten ihr Dasein fristen.
Der dicke Teppich schluckt jeden meiner Schritte, und das ist mir recht. Ich will niemanden sehen und von niemandem gesehen werden.
Ein leises Klicken reißt mich aus meinen Gedanken. Keine drei Meter vor mir tritt ein Mann auf den Flur. Er ist ein wenig größer und wesentlich kräftiger gebaut als Tom. Wie Tom hat er blondes Haar, doch er trägt es lang und zu einer Art Hipster-Knoten am Oberkopf gebunden. Wer ist das? Und was zum Teufel hat er in diesem Zimmer zu suchen? Diesem Zimmer, unweit von meinem. Lucas’ Zimmer.