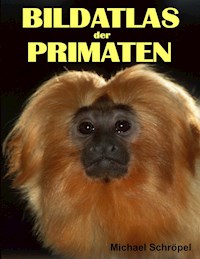
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Bildatlas ist eine aktualisierte Neuauflage der beiden 2012 erschienenen Bände über die Feuchtnasen- und die Trockennasenprimaten und umfasst nun alle heute der Wissenschaft bekannten Arten und Unterarten der Primaten mit einer kurzen Beschreibung ihrer Merkmale, der geografischen Verbreitung , ihrem Lebensraum, der Nahrung, der Fortpflanzung und ihrem Sozialgefüge sowie dem Gefährdungsstatus. Zudem sind jede Art und die meisten Unterarten grafisch dargestellt. Außerdem werden die Verbreitungskarten für alle beigefügt. Vor den Artbeschreibungen stehen für die größeren taxonomischen Kategorien einführende allgemeine Charakterisierungen. Insgesamt sind etwa 690 Primatenformen in diesem Buch behandelt. Es wendet sich an alle Interessenten für die Primatologie und gibt einen Überblick zur Vielfalt dieser Tiergruppe , die uns Menschen verwandtschaftlich am nächsten steht. Das Buch gibt auch Hinweise darauf, im Wildleben oder in Menschenobhut gesehene Affen schnell ein- und zuordnen zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 862
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Allgemeine Merkmale der Primaten
Klassifizierung, Evolution und Phylogenese der Primaten
Strepsirrhini (Feuchtnasenaffen)
Lemuriformes (Lemurenverwandte)
Cheirogaleidae (Katzenmakis oder Kleinlemuren)
Microcebus
(Mausmakis)
Mirza
(Riesenmausmakis)
Allocebus
(Büschelohrmakis)
Cheirogaleus
(Fettschwanzmakis, Katzenmakis)
Phaner
(Gabelstreifenmakis)
Lepilemuridae (Wieselmakis)
Lepilemur
(Wieselmakis)
Lemuridae (Eigentliche Lemuren)
Hapalemur
(Halbmakis oder Bambuslemuren)
Prolemur
(Breitschnauzen-Halbmakis)
Lemur
(Kattas)
Eulemur
(Echte Lemuren)
Varecia
(Varis)
Indriidae (Indriartige)
Avahi
(Wollmakis)
Propithecus
(Sifakas)
Indri
(Indris)
Daubentoniidae (Fingertiere)
Daubentonia
(Fingertiere)
Lorisiformes (Loriverwandte)
Galagidae (Galagos)
Otolemur
(Riesengalagos)
Galago
(Kleine Galagos)
Sciurocheirus
(Eichhörnchengalagos)
Galagoides
(Zwerggalagos)
Euoticus
(Kielnagelgalagos)
Lorisidae (Loris)
Arctocebus
(Bärenmakis)
Perodicticus
(Pottos)
Loris
(Schlankloris)
Nycticebus
(Plumploris)
Haplorrhini (Trockennasenaffen)
Tarsiiformes (Koboldmakis)
Tarsiidae (Koboldmakis)
Tarsius
(Sulawesi-Koboldmakis)
Cephalopachus
(Sunda-Koboldmakis)
Carlito
(Philippinen-Koboldmakis)
Simiiformes (Echte Affen)
Platyrrhini (Neuweltaffen)
Callitrichidae (Krallenaffen)
Saguinus
(Tamarine)
Leontopithecus
(Löwenaffen)
Callimico
(Springtamarine)
Callibella
(Zwergmarmosetten)
Cebuella
(Zwergseidenaffen)
Mico
(Amazonische Marmosetten)
Callithrix
(Atlantische Marmosetten)
Cebidae (Kapuzineraffenartige)
Cebinae (Kapuzineraffen)
Cebus
(Ungehaubte Kapuzineraffen)
Sapajus
(Gehaubte Kapuzineraffen)
Saimiriinae (Totenkopfaffen)
Saimiri
(Totenkopfaffen)
Aotidae (Nachtaffen)
Aotus
(Nachtaffen)
Pitheciidae (Sakiaffen)
Callicebinae (Springaffen)
Callicebus
(Springaffen oder Titis)
Pitheciinae (Sakiaffen)
Pithecia
(Sakis)
Chiropotes
(Bartsakis)
Cacajao
(Uakaris)
Atelidae (Klammerschwanzaffen)
Alouattinae (Brüllaffen)
Alouatta
(Brüllaffen)
Atelinae (Klammerschwanzaffen)
Ateles
(Klammeraffen)
Lagothrix
(Wollaffen)
Brachyteles
(Spinnenaffen)
Catarrhini (Altweltaffen)
Cercopithecoidea (Hundsaffen)
Cercopithecidae (Meerkatzenverwandte)
Cercopithecinae (Meerkatzenartige)
Allenopithecus
(Sumpfmeerkatzen)
Miopithecus
(Zwergmeerkatzen)
Erythrocebus
(Husarenaffen)
Chlorocebus
(Grünmeerkatzen)
Cercopithecus
(Buntmeerkatzen)
Macaca
(Makaken)
Lophocebus
(Schwarzmangaben)
Rungwecebus
(Hochlandmangaben)
Theropithecus
(Blutbrustpaviane)
Papio
(Paviane)
Mandrillus
(Backenfurchenpaviane)
Cercocebus
(Drillmangaben)
Colobinae (Stummelaffen und Languren)
Colobini (Stummelaffen)
Colobus
(Schwarzweiße Stummelaffen)
Piliocolobus
(Rote Stummelaffen)
Procolobus
(Grüne Stummelaffen)
Presbytini (Languren)
Semnopithecus
(Hanuman-Languren)
Trachypithecus
(Haubenlanguren)
Presbytis
(Mützenlanguren)
Nasalis
(Nasenaffen)
Simias
(Mentawai-Stumpfnasenaffen)
Rhinopithecus
(Stumpfnasenaffen)
Pygathrix
(Kleideraffen)
Hominoidea (Menschenaartige)
Hylobatidae (Gibbons)
Symphalangus
(Siamangs)
Nomascus
(Schopfgibbons)
Hoolock
(Hulocks)
Hylobates
(Echte Gibbons)
Hominidae (Menschenaffen und Menschen)
Ponginae (Asiatische Menschenaffen)
Pongo
(Orang-Utans)
Homininae (Afrikanische Menschenaffen und Menschen)
Gorilla
(Gorillas)
Pan
(Schimpansen)
Homo
(Menschen)
Literaturverzeichnis
Index der wisenschaftlichen Taxa
Vorwort
Die Primaten sind unter allen Lebewesen unsere nächsten Verwandten. Besonders aus diesem Grund erwecken sie bei vielen Menschen ein hervorragendes Interesse. Wir sehen in ihnen bewusst oder unbewusst viele Ähnlichkeiten mit uns im Aussehen oder im Verhalten, was den einen vielleicht beunruhigt oder andere fasziniert. Eine Qualle, eine Bänderschnecke oder eine Fruchtfliege sind uns so unähnlich, dass wir nur geringe Emotionen ihnen gegenüber aufbringen. Je näher uns ein Tier in der Phylogenie, im Entwicklungsstammbaum, steht, desto mehr Gefühle hegen wir dafür.
Aber, wie viele Menschen, einmal abgesehen von Fachleuten in der Zoologie, kennen schon die breite Vielfalt der verschiedenen Primaten? Die meisten können zwar bei ihrem Anblick sofort sagen, dass es ein Affe ist, aber viel weiter geht die Spezifizierung oftmals nicht. Der weitreichende Überblick über die heute bekannten etwa 475 rezenten Primatenarten und noch mehr Unterarten fehlt auch vielen mit Zoologie oder Tiergärtnerei beschäftigten Personen. Wenn schon für den Laien oder auch den Zoologen der Überblick über die Vielzahl der unterschiedlichen Affen schwerfällt, so trifft das sicherlich in noch stärkerem Ausmaß für die Feuchtnasenprimaten speziell zu. Das gab den Anlass, einen bebilderten Überblick über die Primaten zunächst in deutscher Sprache zu erstellen. So einen Überblick gab es bislang, zumindest im deutschsprachigen Raum, noch nicht. Es existieren im englischen Sprachraum textliche Übersichten (z.B. GROVES, 2001, 2005) oder nicht ganz vollständige Übersichten mit Fotos (ROWE, 1996), doch beinhalten sie selbstverständlich nicht die seit dieser Zeit neu beschriebenen Formen. Über die madagassischen Strepsirrhini geben MITTERMEIER et al. (2010b) einen umfassenden und aktuellen
Überblick mit Fotos und Zeichnungen. Gerade in den letzten Jahren seit 2000 wurde eine ganze Reihe neuer Formen der Feuchtnasenprimaten erstmals wissenschaftlich beschrieben, was unter anderem an der verstärkten Freilandforschung, aber auch an den Möglichkeiten der molekular-genetischen Untersuchungstechnik liegt. Die Feuchtnasenprimaten stehen uns Menschen zwar wissenschaftlich und auch emotional nicht ganz so nah, wie die „richtigen“ Affen, dennoch gehören sie aber neben diesen zu unseren nächsten Verwandten im Tierreich. Nach bisher noch unterschiedlichen Auffassungen der Wissenschaftler trennten sich die Feuchtnasenprimaten und die Trockennasenprimaten vor 64 bis 87 Mio Jahren von der gemeinsamen Primatenausgangsform (CHATTERJEE et al., 2009; PERELMAN et al., 2011). 2013 erschien mit dem Volume 3 von „The Handbook of the Mammals of the World” (MITTERMEIER et al.) ein umfangreiches Buch über die Primaten in englischer Sprache. Dennoch soll mein 2012 in deutscher Sprache erschienenes zweibändiges Buch „Bildatlas der Primaten – Feuchtnasenprimaten“ und „Bildatlas der Primaten - Trockennasenprimaten“ nunmehr in einem Band überarbeitet und aktualisiert herausgegeben werden.
In diesem Buch werden 478 Arten und 696 Taxa, angefangen von den Katzenmakis bis zum Menschen, vorgestellt. Alle Arten und viele der Unterarten sind in Zeichnungen abgebildet. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der systematischen Klassifizierung und den morphologischen Merkmalen der Formen. Es wird aber auch über deren geografische Verbreitung, die Lebensräume, die Ernährung, die Fortpflanzung und die Sozialstrukturen kurz berichtet. Zur geografischen Verbreitung gibt es Kartendarstellungen. Für die höheren systematischen Einheiten, wie Familie, Unterfamilie oder Gattung, sind allgemeine Angaben vorangestellt, die zumeist alle zugehörenden Arten betreffen.
Es wurde sich an den möglichst modernsten und gängigsten Systematiken orientiert. Aber die Systematik ist in der Biologie kein starres Gefüge, sondern kann sich immer wieder ändern, sofern neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazu kommen. So gibt es auch unter den Fachwissenschaftlern jederzeit gewisse Diskrepanzen, wie die eine oder andere Form eingeordnet werden soll.
Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass die systematischen Kategorien in der Biologie von uns Menschen geschaffen wurden, um unser Bestreben für ein Ordnungsgefüge zu befriedigen. Sie haben ganz sicher Vorteile bei der Erfassung der Vielfalt biologischen Lebens. Wir Menschen finden uns bei in Schubladen und Kästen untergebrachten und geordneten Dingen besser zurecht. Doch gerade bei der Definition des Artbegriffs gibt es immer mehr Widersprüche, je weiter die Forschung voranschreitet. Die lange Zeit Bestand habende Definition, dass es sich um getrennte Arten handelt, wenn sie sich nicht miteinander fortpflanzen (biologisches Artkonzept, biological species concept BSC: MAYR, 1942), ist durch viele „Ausnahmen“, auch unter natürlichen Bedingungen, ad absurdum geführt. Auch die Einschränkung, dass solche Arthybride selbst nicht fertil sind, kann inzwischen negiert werden. Beispiele unter Primaten liefern eindeutige Arten aus der Gattung Cercopithecus aus Afrika, wo oft zwei oder mehr Arten im gleichen Gebiet leben. Normalerweise kreuzen sie sich nicht. Aber es gibt Randbereiche, in denen die eine Art häufig, die andere selten ist. Dort kommt es mitunter zu Hybriden und sogar zu Hybridpopulationen (z.B. Cercopithecus mona x C. pogonias, C. mitis x C. ascanius, C. mitis x C. pogonias, C. nictitans x C. cephus) (DETWILER, 2002; TOSI et al., 2005). Aber auch bei vielen anderen parapatrischen oder sympatrischen Primatenarten wurde über natürliche Arthybride berichtet (z.B. bei Callithrix: ALONSO et al., 1987; FERRARI & MENDES, 1991; bei Alouatta: CORTÉS-ORTIZ et al., 2007; bei Macaca: TOSI et al., 2000, bei Papio: JOLLY, 1993; ZINNER et al., 2011). Mehr noch, durch Arthybride können in der Evolution auch neue Arten entstehen, wie das beispielsweise für Macaca munzala aufgrund molekulargenetischer Resultate angenommen wird (CHAKRABORTY et al., 2007). Durch Hybridisierung und Introgression zwischen Macaca assamensis und M. thibetana könnten die Vorfahren von M. munzala nach den Autoren entstanden sein.
Auch der in den vergangenen Jahrzehnten untersuchte genetische Unterschied zwischen zwei Arten (genetisches Artkonzept, genetic species concept GSC; BAKER & BRADLEY, 2006) führt nicht immer zum Erfolg. Neuerdings geht man vom phylogenetischen Artkonzept (phylogenetic species concept PSC, CRACRAFT, 1983) aus. Es fußt auf allen Merkmalen (bestimmte DNA-Sequenzen, morphologische und anatomische Ausprägungen, bestimmte Bluteiweiße usw.), die vollständig vererbt werden und bei jedem Individuum einer Art in gleicher Weise vorhanden sind. Beim phylogenetischen Artkonzept werden Lebewesen aufgrund ihrer Abstammung in monophyletischen Gruppen klassifiziert (Kladistik). Nach ISAAC et al. (2004) führt das aber gegebenenfalls zu einer „taxonomischen Inflation“ mit sehr vielen, teilweise nicht zu rechtfertigenden Arten. Ein Beispiel aus der Primatologie ist der Weißstirn-Kapuzineraffe (Cebus albifrons). Während ihn HERNÁNDEZ-CAMACHO & COOPER (1976), GROVES (2001, 2005) oder RUIZ-GARCÍA et al. (2010) als eine Art mit mehreren Unterarten ansehen, stellen BOUBLI et al. (2012) unter Verwendung des PSC neun distinkte Arten fest.
In der Biologie gibt es kein fixes System, sondern stetige und meist graduelle Veränderung in der Evolution. So gibt es in jeder Population einer Tiergruppe auch individuelle Unterschiede. Und am Taxonomen liegt es nun, ob er diese Unterschiede für wesentlich in der Klassifizierung hält. Das wird besonders markant bei polymorphen Formen, und manche Genotypen können je nach Umweltbedingungen abweichende Phänotypen hervorbringen und umgekehrt.
Wir können uns untereinander aber besser verständigen, wenn wir die Lebewesen, über die wir reden wollen, in bestimmte Kategorien bzw. Taxa einordnen. Die Phylogenese verwischt aber diese von uns geschaffenen Ordnungskriterien immer wieder. Eigentlich ist nicht fest determinierbar, wo eine Art aufhört und die andere anfängt. Tiere kennen den Artbegriff nicht. Auch bei ihrer Fortpflanzung geht es nicht um die Art oder Arterhaltung, sondern vielmehr um die Weitergabe und Erhaltung ihrer eigenen (individuellen) Gene.
Aus diesen Gründen kommt es unter den Systematikern auch immer wieder zu Diskussionen und unterschiedlichen Aspekten. Auch die in diesem vorliegenden Buch verwendete Systematik sollte daher nicht als statische und allein gültige verstanden werden. Sicher vertritt der eine oder andere Leser hier und da einen differenten Standpunkt. Dennoch wird das Buch hoffentlich einen informativen Überblick über die interessante Ordnung der Primaten bieten, zu denen wir Menschen schließlich auch gehören.
Mein besonderer Dank gilt denen, die mir Fotos zu Verfügung stellten. Sie sind namentlich in den Abbildungslegenden genannt. Mein Dank gilt aber auch dem Verlag, dass er sich meines Anliegens in so guter Form angenommen hat.
Zielitz, April 2015 MICHAEL SCHRÖPEL
Allgemeine Merkmale der Primaten
Die Primaten sind eine Ordnung innerhalb der Klasse der Säugetiere. Früher wurden sie häufig an die Spitze des Stammbaums dieser Klasse als höchst entwickelte Lebewesen gestellt. Sie spalteten sich in der Evolution aber recht frühzeitig ab und zeigen noch viele ursprüngliche Merkmale der Säugetiere. Nach molekular-genetischen Befunden steht ihnen die Ordnung der Pelzflatterer (Dermoptera) verwandtschaftlich am nächsten, die heute nur noch mit zwei Arten in Südostasien existiert. Die Evolution jeder Tierart erfolgt relativ unabhängig von der anderer Formen. So sind beispielsweise Huftiere oder Raubtiere nicht weniger hoch entwickelt als Primaten, eben nur in einer anderen Richtung. Viele Tiergruppen weisen sogar Spezialisierungen auf, die viel weiter gehen als die der Primaten.
Es ist schwierig, eindeutige und nur für diese Ordnung Primates gültige Merkmale zu definieren, obwohl viele ihrer Vertreter sicher als solche erkennbar sind. Die ursprünglichen Merkmale (Symplesiomorphien) eignen sich nicht oder nur sehr bedingt für die Charakterisierung, da sie auch bei anderen und keinesfalls näher verwandten Säugetieren auftreten können. Dafür kommen nur gemeinsam abgeleitete (synapomorphe) Merkmale in Frage. Das ist bei Primaten aber schwierig und komplex (ROOS, 2003). Mithilfe genetischer Merkmale ist die Charakterisierung etwas einfacher (ROOS, 2003).
Als allgemeine Merkmale gelten nach MARTIN (1990) folgende, die aber teilweise auch bei anderen Säugetierformen zu finden sind: 1. Hände und Füße oder nur eines der beiden distalen Extremitätenteile sind greiffähig und, wie ursprünglich, fünfstrahlig. Nur bei einigen Primatenarten können einzelne Finger oder Zehen reduziert sein (Klammeraffen, Colobus-Affen, Loris). Die große Zehe (Hallux) ist opponierbar (außer sekundär beim Menschen). Das wird auch als Hinweis gedeutet, dass sich die Primaten aus baumlebenden Formen entwickelt haben. 2. Die Finger und Zehen tragen in der Regel Plattnägel, während viele andere Säugetiere Krallen oder andere Formen, wie Hufe und dergleichen, aufweisen. Die Großzehe trägt bei allen Primaten einen Plattnagel. Andere Zehen oder Finger können bei einigen Formen der Primaten krallenförmige Nägel haben. Bei den Strepsirrhini endet die zweite Zehe stets in einer Kralle, der so genannten Putzkralle. Bei den Tarsiiformes tragen die zweite und dritte Zehe Krallen. Bei den Callitrichidae unter den Neuweltaffen sind die Nägel aller Zehen und Finger bis auf die Großzehe sekundär zu krallenartigen Gebilden geformt. 3. Die ventrale Haut der Finger und Zehen ist mit einer Papillarleistenhaut versehen, die zum einen festeren Griff oder Halt ermöglicht und zum anderen mit Meissnerschen Tastkörperchen ausgestattet ist, die das taktile Vermögen erhöhen. Dadurch haben Primaten einen individualtypischen Fingerabdruck. 4. Bis auf Ausnahmen wird die Lokomotion durch die Hinterextremitäten dominiert, die im Allgemeinen auch länger als die Vorderextremitäten sind. Ausnahmen bilden unter anderem typische Brachiatoren und Schwinghangler, wie beispielsweise die Gibbons. In aller Regel liegt der Körperschwerpunkt näher in Richtung der hinteren Gliedmaßen. 5. Der optische Sinn ist meist deutlich dominant über die anderen Sinne. Die Augen sind relativ groß und nach vorn gerichtet. Damit wird ein stereoskopisches Sehen ermöglicht. Das zeigen zwar auch andere Säugetiere (Carnivora), die sich als Prädatoren ernähren. Bei den Primaten kommt neben der wahrscheinlich ursprünglichen insectivoren Ernährungsweise außerdem die bessere Abschätzung von Entfernungen während des Kletterns im Baumgeäst als Vorteil des binokularen Sehens zum Tragen. Die Augen sind am Schädel zumindest in einen knöchernen Orbitaring (Strepsirrhini) oder sogar in eine geschlossene Orbitahöhle (Haplorrhini) eingebettet. 6. Der olfaktorische Sinn ist bei Primaten recht unspezialisiert, aber bei einigen dennoch recht gut. Vor allem bei den tagaktiven Haplorrhini ist er allerdings gegenüber vielen anderen Säugetieren schwächer ausgebildet. Oft wurde aber das Geruchsvermögen der Primaten unterschätzt. 7. Das Gehirn ist bei Primaten im Verhältnis zur Körpergröße gegenüber vielen anderen Säugetieren etwas vergrößert. Es ist eine bestimmte Großhirnfurche, die Fissura lateralis (Sylvian fissure, „Affenfurche“) zwischen dem Scheitel- und dem Schläfenlappen ausgebildet. 8. Während die ursprünglichen Säugetiere wahrscheinlich die Zahnformel 3/3 1/1 4/4 3/3 hatten, fehlt bei Primaten generell ein Schneidezahn. Das ursprüngliche Primatengebiss weist daher die Formel 2/2 1/1 4/4 3/3 mit 40 Zähnen auf. Rezente Primaten verloren des Weiteren einen Prämolaren, so dass die allgemeine und maximale Zahnformel nun 2/2 1/1 3/3 3/3 mit 36 Zähnen lautet. Bei einigen Vertretern der Primaten gibt es aber weitere Reduktionen unterschiedlicher Zähne. Die Catarrhini besitzen einen Prämolaren in jeder Kieferhälfte weniger und damit 32 Zähne, den Callitrichiden fehlt ein Molar. Die Wieselmakis (Lepilemuridae) haben keine oberen Schneidezähne, und das Fingertier (Daubentonia madagascariensis) weist mit nur 18 Zähnen die geringste Anzahl unter den Primaten auf. Es hat die Zahnformel 1/1 0/0 1/0 3/3. Die Molaren zeigen nur geringe Spezialisierungen. 9. Primaten haben relativ zu ihrer Körpergröße eine lange Tragzeit. Die kürzeste Tragzeit haben Katzenmakis (Cheirogaleidae) mit etwa 60 Tagen, die längste der Orang-Utan, der Gorilla und der Mensch mit knapp 9 Monaten. Es werden pro Geburt meist nur ein bis zwei Jungtiere geboren, deren Ontogenese bis zu Selbständigkeit und Geschlechtsreife im Vergleich zu anderen Säugetieren ähnlicher Größe lange dauert. Die Reproduktionsrate ist vergleichsweise gering. Die mütterliche bzw. elterliche Fürsorge für den Nachwuchs ist sehr intensiv. Bei nahezu allen Primatenarten werden die Jungen in der ersten Lebenszeit von der Mutter (seltener auch vom Vater oder anderen Gruppenmitgliedern) getragen. Primaten haben eine relativ lange Lebensdauer. Darüber hinaus zeigen Primaten noch weitere Merkmale, die aber eher ursprünglich und nicht spezifisch für diese Ordnung sind. Dazu gehören gut entwickelte Schlüsselbeine und ein Blinddarm. Die Hoden der Männchen liegen in einem Scrotum und damit außerhalb der Leibeshöhle. Der Penis ist freihängend. Bei Weibchen haben Harnleiter und Vulva eine getrennte äußere Öffnung.
Bei Primaten gibt es also kaum Merkmale, die nur für diese Ordnung und dann allgemein für alle Vertreter in ihr zutreffend sind.
Klassifizierung, Evolution und Phylogenese der Primaten
Die Ordnung der Primates untergliedert sich in zwei Unterordnungen mit den Feuchtnasenprimaten (Strepsirrhini) und den Trockennasenprimaten (Haplorrhini). Zu den Feuchtnasenprimaten wurden früher auch die Koboldmakis gerechnet, die heute zu den Haplorrhini gehören.
Die Strepsirrhini unterteilen sich weiter in die rezenten Teilordnungen der Lemuriformes und der Lorisiformes. Dazu kommen als ausgestorbene Teilordnung weiterhin wahrscheinlich die Adapiformes hinzu, die den Strepsirrhini in gewisser Weise ähnelten, aber deren Verwandtschaftsverhältnisse zu den heute lebenden Formen nicht völlig geklärt sind. Fossilfunde der Adapiformes stammen aus Nordamerika, Europa und Asien. Die ausschließlich auf Madagaskar vorkommenden Lemuriformes gliedern sich in mehrere Familien mit den Katzenmakis (Cheirogaleidae), Lemuren (Lemuridae), Wieselmakis (Lepilemuridae), Indriartigen (Indriidae), Fingertieren (Daubentoniidae) sowie den ausgestorbenen Riesenlemuren (Megaladapidae). Die in Afrika und Asien lebenden Lorisiformes bilden zwei Familien mit den Loris (Lorisidae) und den Galagos (Galagidae). Mitunter werden die Lorisidae auch als Loridae und die Galagidae als Galagonidae bezeichnet, doch nach den Richtlinien der International Commission on Zoological Nomenclature (2002) sollten die Originalnamen Lorisidae und Galagidae gültig sein.
Bei den Haplorrhini unterscheidet man neben einigen ausgestorbenen Teilordnungen die rezenten Koboldmakis (Tarsiiformes) und die eigentlichen Affen (Simiiformes). Für die Simiiformes wird auch häufig der Name Anthropoidea verwendet. GROVES (2001) befürwortet aber den Namen Simiiformes, weil früher mit Anthropoidea die Menschenaffen bezeichnet wurden. Außerdem ist die Endung der Teilordnung bei Simiiformes entsprechend der der Schwestergruppe Tarsiiformes. Während die Koboldmakis nur eine Familie Tarsiidae bilden, spalten sich die Simiiformes in zwei Gruppen mit namenlosem Rang auf: die Neuwelt- oder Breitnasenaffen (Platyrrhini) und die Altweltoder Schmalnasenaffen (Catarrhini). Die in Süd-und Mittelamerika lebenden Breitnasenaffen gliedern sich in fünf Familien mit den Krallenaffen (Callitrichidae), Kapuzinerartigen (Cebidae), Nachtaffen (Aotidae), Sakiaffen (Pitheciidae) und Klammerschwanzaffen (Atelidae). Die Schmalnasenaffen aus Afrika und Asien bilden neben einer Reihe ausgestorbener Überfamilien die der Hundsaffen (Cercopithecoidea) und der Menschenartigen (Hominoidea). Zu den Cercopithecoidea gehört lediglich die Familie Cercopithecidae mit den beiden Unterfamilien Meerkatzenartige (Cercopithecinae) sowie Stummelaffen und Languren (Colobinae), zu den Hominoidea die beiden Familien Gibbons (Hylobatidae) und Menschenaffen und Menschen (Hominidae). Letztere werden in die Unterfamilien Asiatische Menschenaffen (Ponginae) sowie Afrikanische Menschenaffen und Menschen (Homininae) unterteilt. Sowohl bei den Cercopithecoidea, als auch bei den Hominoidea gibt es weitere ausgestorbene Familien.
Während bis vor kurzer Zeit anhand fossiler Funde der älteste Primatenvorfahre (Purgatorius) auf etwa 65 Mio Jahre terminiert wurde, schätzen TAVARÉ et al. (2002) mit Hilfe verschiedener Methoden den ältesten Primaten auf etwa 81,5 Mio Jahre. Als eine große Schwierigkeit der zeitlichen Einschätzung gilt die geringe Anzahl fossiler Funde von frühen Primaten. Man nimmt an, dass bisher lediglich 7% ausgestorbener Primatenformen entdeckt und erfasst sind (ROOS, 2003). PERELMAN et al. (2011) sehen nach ihren molekulargenetischen Befunden aber ein noch höheres Alter der Primatenvorfahren mit etwa 92 Mio Jahren an, die sich vom gemeinsamen Stamm mit den Dermoptera und Scandentia abspalteten. Die Separierung von Strepsirrhini und Haplorrhini datieren sie bereits vor 87 Mio Jahren, relativ kurzzeitig nach Auftreten der ersten den Primaten zuzuordnenden Formen, CHATTERJEE et al. (2009) allerdings auf etwa 64 Mio Jahre und FINSTERMEIER et al. (2013) auf 66,2-69 Mio Jahre. Die Stellung und Evolution der Tarsiiformes, die im Eozän auch holarktisch verbreitet waren, ist nach wie vor bisher nicht eindeutig lösbar. Einige Autoren sehen sie als Schwestergruppe zu den Strepsirrhini (u.a. GROVES, 2001; EIZIRIK et al., 2004; CHATTERJEE et al., 2009), andere als Schwestergruppe zu den Haplorrhini (u.a. GOODMAN et al., 1998; GROVES, 2005; MATSUI et al., 2009; PERELMAN et al., 2011; FINSTERMEIER et al., 2013) und wieder andere als eigene separate Reliktlinie (ARNASON et al., 2002). Nach PERELMAN et al. (2011) erfolgte die Trennung zwischen Tarsiiformes und Simiiformes innerhalb der Haplorrhini vor vielleicht 81 Mio Jahren, nach CHATTERJEE et al. (2009) erst vor etwa 60-55 Mio Jahren von den Strepsirrhini und nach FINSTERMEIER et al. (2013) nach 63,1-64,8 Mio Jahren von den Simiiformes. Zwei mögliche Phylogramme nach hauptsächlich molekular-genetischen Befunden mit den Datierungen auf der Ebene der Familien bzw. Unterfamilien zeigt die Abb. 1.
Abb. 1. Phylogramme der Primaten bis zur Ebene der Familien und Unterfamilien nach molekulargenetischen Befunden von a) PERELMAN et al. (2011) und b) FINSTERMEIER et al. (2013) im Vergleich. Die wahrscheinlichen ungefähren Aufspaltungszeiten sind in Millionen Jahren dargestellt.
Unterordnung STREPSIRRHINI – Feuchtnasenaffen
Da die Feuchtnasenprimaten weit mehr für Säugetiere ursprüngliche Merkmale aufweisen als die Trockennasenprimaten, bezeichnete man sie früher als Halbaffen, also „noch nicht ganz vollständige, weniger entwickelte“ Primaten. Dennoch zeigen auch sie spezielle abgeleitete, synapomorphe Merkmale. Ihre Entwicklung ist nur nach Trennung vom gemeinsamen Vorfahren in eine andere Richtung gegangen.
Charakteristisch für die Unterordnung ist ein drüsenreicher Nasenspiegel, wie er auch für eine Reihe anderer Säugetiere (z.B. Hunde, viele Paarhufer usw.) typisch ist. Das Rhinarium wird stets durch eine Furche, das Philtrum, geteilt. Die meisten Feuchtnasenprimaten sind nachtaktiv. Die Retina der Augen zeigt eine reflektierende Schicht, das Tapetum lucidum, wie es beispielsweise von Katzen bekannt ist. Nur der Gattung Eulemur fehlt das Tapetum lucidum. Die Netzhaut hat jedoch im Unterschied zu den Haplorrhini keine Macula lutea und darin keine Fovea centralis, die Stelle des schärfsten Sehens. Die Augen werden von knöchernen Orbitaringen umfasst. Bei den Haplorrhini liegen die Augen in geschlossenen Orbitahöhlen.
Die Schneidezähne und Eckzähne des Unterkiefers bilden einen nach vorn gerichteten Zahnkamm aus insgesamt 6 Zähnen. Dieser typische Zahnkamm dient einerseits der Fellpflege, andererseits auch löffelartig zur Aufnahme weicher Fruchtanteile (GEISSMANN, 2003). Beim Fingertier mit nur einem ständig nachwachsenden Schneidezahn in jeder Kieferhälfte und fehlenden Eckzähnen ist der Zahnkamm sekundär verloren gegangen. Zwischen den mittleren Schneidezähnen des Oberkiefers existiert ein deutlicher Spalt, den die Trockennasenprimaten nicht aufweisen (Abb. 2).
Bei allen Strepsirrhini trägt die zweite Zehe eine so genannte Putzkralle, alle anderen Zehen und Finger hingegen Plattnägel. Die Putzkralle ist aber keine echte Kralle, sondern vielmehr ein lateral komprimierter und gebogener Nagel, ähnlich den „Krallen“ der Krallenaffen (Callitrichidae) unter den Haplorrhini. Meist sind der 4. Finger und die 4. Zehe am längsten ausgebildet. Eine Ausnahme bildet das Fingertier.
Abb. 2. Allgemeine Merkmale am Schädel von Strepsirrhini (leicht verändert aus GEISSMANN, 2003).
Alle Feuchtnasenprimaten haben einen zweihörnigen Uterus (Uterus bicornis), während Trockennasenprimaten, aber nicht die Koboldmakis, einen einheitlichen Uteruskörper (Uterus simplex) aufweisen. Die Plazenta der Strepsirrhini ist, wie bei vielen anderen Säugetieren, eine nondeciduate. Bei ihrer Lösung von der Uterusschleimhaut während der Geburt entstehen kaum Blutungen. Im Gegensatz dazu haben die Haplorrhini als synapomorphes Merkmal eine deciduate Plazenta. Während der Geburt kommt es zu Blutungen durch die Ablösung, weil Plazenta und Uteruswand enger miteinander verwachsen sind. Des Weiteren handelt es sich bei der Plazenta der Feuchtnasenaffen um eine epitheliochoriale, bei der die Blutzirkulationen des Embryos und der Mutter durch Membranen weitgehend getrennt erfolgen. Die Trockennasenprimaten besitzen eine haemochoriale Plazenta mit inniger Verbindung der Epithelien von Uterus und Embryohüllen mit intensiverem Blutaustausch. Die Feuchtnasenprimaten bringen meistens nur ein Jungtier pro Wurf zur Welt. Kleinere Formen, wie Microcebus, Cheirogaleus oder manche Galagoides können auch oft zwei oder drei Junge haben. Aber auch Otolemur und Varecia bringen häufig zwei Jungtiere zur Welt. Bei Cheirogaleus sind bis 4 Junge pro Wurf und bei Varecia sogar ausnahmsweise bis 5 Junge bekannt. Die Neugeborenen sind in der Regel im Vergleich zum Gewicht der Mutter leichter als die der Trockennasenprimaten. Ein Teil der Strepsirrhini gebärt in Verstecken (z.B. Baumhöhlen, selbst gebauten Nestern). Dazu gehören etwa die Cheirogaleidae, die Galagidae oder das Fingertier (Daubentonia) unter den nachtaktiven Formen, aber auch Varecia oder Hapalemur unter den tagaktiven Arten. Andere Feuchtnasenaffen gebären ihre Jungen ohne Versteck, wie z.B. Eulemur oder Lemur. Zu Ortswechseln werden die unselbständigen Jungtiere im Maul der Mutter getragen (z.B. Cherogaleidae, Galagidae, Varecia) oder am Bauch bzw. auf dem Rücken (z.B. Eulemur, Lemur, Loris). Bei einigen Arten werden Jungtiere bereits wenige Tage nach der Geburt zeitweise auf Ästen abgesetzt („geparkt“). Die Tragzeit schwankt artspezifisch zwischen etwa 55 und 190 Tagen, die Säugedauer zwischen 4 und 50 Wochen. Geschlechtsreif werden die Feuchtnasenprimaten je nach Art zwischen etwa 10 und 30 Monaten.
Feuchtnasenprimaten sind kleine bis mittelgroße Primaten. Zu ihnen gehören die kleinsten Primaten überhaupt mit den Mausmakis der Gattung Microcebus. Deren kleinster Vertreter (Microcebus berthae) hat eine Kopf-Rumpf-Länge von 9-9,5 cm und ein Körpergewicht von etwa 30 g. Der Indri (Indri indri) weist Kopf-Rumpf-Längen zwischen 64 und 72 cm sowie Körpergewichte zwischen 6,0 und 9,5 kg auf. Das Körpergewicht des vor weniger als 1000 Jahren ausgestorbenen Lemuren von Madagaskar (Megaladapis edwardsi) wird auf 45-85 kg geschätzt.
Die heutige Verbreitung der Strepsirrhini erstreckt sich über Afrika und Teile Südasiens (Lorisiformes) sowie auf Madagaskar (Lemuriformes) (Abb. 3). Es wird heute mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen, dass die Vorfahren der rezenten Feuchtnasenaffen in Afrika beheimatet waren, obwohl es ausgestorbene Formen, die eventuell zu den Strepsirrhini gerechnet werden können, auch in Eurasien und Nordamerika gab. In einer ersten Radiation dieser afrikanischen Vorfahren wurde offenbar die Insel Madagaskar besiedelt, auf der die Evolution dieser Tiere völlig unabhängig von den anderen Feuchtnasenprimaten zu den Lemuriformes erfolgte. Diese Teilordnung ist auf Madagaskar endemisch, wie viele der dort lebenden anderen Tiere auch. Madagaskar wurde bereits vor etwa 180 Mio Jahren von Afrika und Südamerika („West-Gondwana“) zusammen mit Indien und Australien („Ost-Gondwana“) getrennt. Die Trennung von „Ost-Gondwana“ erfolgte vor etwa 100 Mio Jahren. Seither ist Madagaskar eine Insel. Die Vorfahren der Lemuriformes besiedelten Madagaskar aber erst viel später, wahrscheinlich vor ungefähr 69-55 Mio Jahren. Sie müssen also einen fast 400 km breiten Ozeanstreifen überquert haben. Das wird heute am meisten einleuchtend mit einer Drift auf schwimmenden Inseln (Baumstämme) erklärt. Das vermögen allerdings wiederum nur Tiere, die über längere Zeit ohne Nahrung auskommen und ihren Stoffwechsel stark reduzieren können, also hibernierende Tiere. Solche gibt es auch heute noch unter den Lemuriformes bei einigen Cheirogaleidae.
Abb. 3. Geografische Verbreitung der Strepsirrhini. In Afrika und Asien kommen die Vertreter der Teilordnung Lorisiformes, auf Madagaskar ausschließlich die Vertreter der Teilordnung Lemuriformes vor.
In Afrika entwickelten sich aus den ursprünglichen Strepsirrhini die Lorisiformes und diese in zwei verschiedene Richtungen mit den Galagidae, die in Afrika verblieben, und den Lorisidae, die teilweise (Gattungen Loris und Nycticebus) später über Landverbindungen in Nordostafrika nach Südasien auswanderten. Die Gattungen Arctocebus und Perodicticus verblieben in Afrika.
Viele der Feuchtnasenaffen sind nachtaktive Tiere. Sicher daher sind ihre äußerlichen morphologischen Merkmale unter den verwandten Arten oft wenig auffällig unterschiedlich. So lassen sich manche Vertreter kaum eindeutig nach äußerlichen Merkmalen einer Form zuordnen, zumal es oft gewisse individuelle Variabilität gibt. Beispielsweise sind manche Galagos viel eindeutiger an ihren charakteristischen Rufen auseinander zu halten, als nach ihrem Aussehen. Auch die geografische Verbreitung hilft bei der Zuordnung. Besonders aber in der neueren Zeit liefern auch molekular-genetische Daten oft eindeutigere Zuordnungskriterien.
Teilordnung LEMURIFORMES – Lemurenverwandte
Die Lemuriformes bilden eine zwar vielgestaltige, dennoch monophyletische Gruppe, die wahrscheinlich aus einer Ausgangsform, die die Wanderung nach Madagaskar schaffte, entstanden ist.
Viele der Arten dieser Teilordnung haben eine saisonale Fortpflanzung mit oft nur kurzen Dauern des Östrus und damit der Kopulationsmöglichkeit. Entsprechend konzentriert sind dann auch die Geburten synchronisiert.
Lemuren können nahezu solitär, paarweise oder in Gruppen leben. Monogamie tritt nur bei einigen auf. Im Allgemeinen herrscht in Gruppen der Lemuriformes Weibchendominanz. Männchendominanz kommt nicht vor.
Bei den Lemuriformes werden fünf Familien unterschieden, wobei deren phylogenetische Beziehungen bisher noch recht wenig gesichert sind. Am frühesten hat sich wahrscheinlich die Familie Daubentoniidae mit der einzigen und hoch spezialisierten Art Fingertier (Daubentonia madagascariensis) vom gemeinsamen Stamm abgetrennt. Die weiteren Familien sind die Cheirogaleidae, Lepilemuridae, Indriidae und Lemuridae. ROOS (2003) und FINSTERMEIER et al. (2013) stellen einen Stammbaum mit der möglichen Aufspaltung der Familien und Gattungen auf (Abb. 4). Im folgenden Buch wird sich fast stets nach der Systematik von MITTERMEIER et al. (2008, 2013) orientiert.
Abb. 4. Vorläufiges Phylogramm der Familien und Gattungen der Lemuriformes mit den wahrscheinlichen Aufspaltungszeiten (kombiniert nach Angaben von ROOS, 2003, und FINSTERMEIER et al., 2013).
Familie CHEIROGALEIDAE – Katzenmakis oder Kleinlemuren
Die Cheirogaleidae zeigen noch viele ursprüngliche Merkmale der Strepsirrhini und haben auch die ursprüngliche Zahnformel aller Primaten mit 2/2 1/1 3/3 3/3. Es sind kleine Vertreter mit maximal 600 g Körpergewicht. Zu ihnen gehört auch der kleinste Primat (Microcebus berthae) mit lediglich 30 g Gewicht. Der Körper ist relativ langgestreckt, die Extremitäten aber nicht sehr lang. Der etwa körperlange Schwanz ist behaart und hat bei einigen Formen die Möglichkeit der Fetteinlagerung als Energiereserve. Alle Cheirogaleidae sind nachtaktiv und schlafen tagsüber in Nestern aus abgestorbenen Blättern, in Baumhöhlen oder auch in Höhlungen am Boden. Einige Arten haben längere jahreszeitliche Perioden (Trockenzeit) von stark gesenktem Stoffwechsel bei gesenkter Körpertemperatur (Torpor).
Zu den Cheirogaleidae gehören fünf Gattungen (Microcebus, Allocebus, Mirza, Cheirogaleus und Phaner) mit insgesamt bisher 34 bekannten Arten (MITTERMEIER et al., 2008, 2010b).
Gattung MICROCEBUS É. GEOFFROY, 1828 – Mausmakis
Zu dieser Gattung gehören die kleinsten Lemuriformes mit bisher 21 beschriebenen Arten. Bis vor relativ kurzer Zeit wurden nur wenige Arten unterschieden. So differenzierte MARTIN (1972) lediglich M. murinus und M. rufus. Außerdem wurden einige Unterarten genannt, die später als distinkte Arten anerkannt wurden. Erst seit den 1990er Jahren und besonders nach 2000 wurden durch intensivierte Felduntersuchungen und die Möglichkeit genetischer Analysen weitere Arten beschrieben. Wahrscheinlich werden in der Zukunft noch weitere Formen differenziert und entdeckt.
Mausmakis bewohnen unterschiedliche Waldhabitate (Primärwald, Sekundärwald). Es können mehrere Arten der Mausmakis oder Mausmakis mit anderen Lemuriformes sympatrisch vorkommen. Von anderen Cheirogaleidae unterscheiden sie sich besonders hinsichtlich der Größe. Am ehesten können Verwechslungen mit Allocebus trichotis vorkommen, da sich diese Form nur hauptsächlich durch die büschelartig behaarten Ohren unterscheidet. Mausmakis bevorzugen die unteren Baumetagen. Tagsüber schlafen sie in Baumhöhlen, dichtem Pflanzengewirr oder Nestern in kleinen Gruppen. Sie verzehren hauptsächlich Früchte, aber auch Insekten oder andere kleine Invertebraten.
Die Wohngebiete von 1-2 ha Größe überlappen sich sowohl zwischen Männchen als auch zwischen Weibchen. Oftmals gibt es zwei Geburtengipfel im Jahr. Es werden meist Zwillinge geboren, die nach einem knappen Jahr fortpflanzungsfähig sind.
Microcebus murinus (J. F. MILLER, 1777) – Grauer Mausmaki
Engl.: Lesser mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 12,9 (12-14) cm, Schwanzlänge 13,7 (12,6-15,2) cm, Gewicht 62,3 (58-67) g (RASOLOARISON et al., 2000). Das Fell hat oberseits eine vorwiegend braun-graue Färbung. Unterseits ist es weißgrau bis beigefarben. Hände und Füße sind ebenfalls weißgrau. Die relativ großen Ohren sind nahezu unpigmentiert.
Verbreitung: Westliches Madagaskar sowie in einer disjunkten Population in Südost-Madagaskar. Lebt stellenweise sympatrisch mit M. griseorufus, M. berthae und M. ravelobensis (MITTERMEIER et al., 2010).
Microcebus murinus (Foto: D. HARING)
Habitat: Tropische Trockenwälder im Tiefland, trockene Dornbuschgebiete, Galeriewälder.
Ernährung: Insekten, vor allem Käfer, aber auch Früchte, Blüten, Nektar und Gummiexsudate. Selten auch kleine Amphibien oder Reptilien.
Fortpflanzung: Die Paarungen erfolgen zwischen Weibchen mit mehreren Männchen und umgekehrt (RADESPIEL, 2000). Der Östrus erfolgt etwa aller 45-55 Tage zwischen September und März. Die Tragzeit dauert etwa 60 Tage. Meist werden zwei Junge geboren. Zwei oder mehr Weibchen bilden Fortpflanzungsgruppen und ziehen ihre Jungen gemeinsam auf (EBERLE & KAPPELER, 2006). Bisher bekanntes Höchstalter 18 Jahre und 2 Monate (WEIGL, 2005).
Sozialstruktur: Während sich Weibchen meist zu mehreren Höhlen oder Nester teilen, schlafen Männchen allein. Die Wohngebiete der Männchen sind meist doppelt so groß, wie die der Weibchen, aber die beider Geschlechter überlappen sich.
Gefährdungsstatus: gering bedroht (least concern nach IUCN Red List).
Microcebus griseorufus KOLLMAN, 1910 – Rotgrauer Mausmaki
Engl.: Reddish-gray mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 12,3 (11,3-13,2) cm, Schwanzlänge 14,3 (13,6-15,3) cm, Gewicht 62 (50-85) g (RASOLOARISON et al., 2000). Das Fell der Körperoberseite ist lichtgrau mit medianem zimtfarbenen Rückenstreifen, der sich auf dem Kopf teilt und zu den Augen führt. Auch der Schwanz ist vorwiegend zimtbraun. Die Bauchseite ist weißgrau.
Verbreitung: Süd- und Südwest-Madagaskar.
Habitat: wie M. murinus, aber nicht in Galeriewäldern.
Ernährung: Die Hauptnahrung sind Gummiexsudate, aber auch Insekten und Früchte. Bei reichlich Nahrungsangebot fallen die Tiere während des Tagesschlafs in einen Torpor.
Fortpflanzung: Die Fortpflanzungssaison ist von September bis Mai relativ lang. Kopulationen erfolgen im September und Januar. Sonst wie bei M. murinus.
Sozialstruktur: Weibchen und seltener Männchen können sich zu gleichgeschlechtlichen Kleingruppen zusammenfinden und solche Schlafgruppen bilden (GÉNIN, 2008).
Gefährdungsstatus: gering bedroht (least concern nach IUCN Red List).
Microcebus berthae RASOLOARISON et al., 2000 – Madame-Berthe-Mausmaki
Berthe’s mouse lemur
Taxonomie: Bei der Entdeckung dieser Form 1992 wurde sie zunächst als M. myoxinus betrachtet (SCHMID & KAPPELER, 1994).
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 9,2 (9,0-9,5) cm, Schwanzlänge 13,5 (13,4-13,8) cm, Gewicht 30,6 (24,5-38) g (RASOLOARISON et al., 2000), damit kleinster Primat. Die Körperbehaarung ist vorwiegend bräunlich mit einem dunkleren Dorsalstreifen, der sich auch über den Schwanz zieht. Die Bauchseite ist beigeweiß oder grauweiß. Der Kopf hat eine rötlichbraune Färbung. Um die Augen ist ein schwärzlicher Ring erkennbar. Die Ohren sind kurz.
Verbreitung: Kleines Gebiet im Westen Madagaskars (Kirindy Forest). Lebt sympatrisch mit M. murinus, aber beide Arten vermeiden den direkten Kontakt.
Habitat: Trockene, zeitweise laubabwerfende Wälder im Flachland.
Ernährung: Früchte und Gummiexsudate, aber auch süße Insektenexkretionen vor allem in der Trockenzeit.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: Überlappende Wohngebiete bei Männchen von etwa 4,9 ha, bei Weibchen von 2,5 ha (DAMMHAHN & KAPPELER, 2005).
Gefährdungsstatus: stark gefährdet (endangered nach IUCN Red List). Gehört zu den 25 am stärksten bedrohten Primatenarten (SCHWITZER et al., 2014).
Microcebus myoxinus PETERS, 1852 - Zwergmausmaki
Engl.: Peter’s mouse lemur, pygmy mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 12,4 (11-13) cm, Schwanzlänge 14,7 (13-16) cm, Gewicht 49 (37-64) g (RASOLOARISON et al., 2000). Das Körperfell ist hell rotbraun, auf der Ventralseite blass beige oder grau. Der Schwanz hat eine dunklere Spitze. Hände und Füße sind weißgrau.
Verbreitung: West-Madagaskar.
Habitat: Trockene, zeitweise laubabwerfende Wälder im Flachland.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Microcebus ravelobensis ZIMMERMANN et al., 1997 – Goldbrauner Mausmaki
Engl.: Golden-brown mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 12,7 (12-14) cm, Schwanzlänge 16 (14-17) cm, Gewicht 72 (59-110) g (RASOLOARISON et al., 2000). Das Fell ist oberseits braun mit leichter Scheckung, unterseits blass grau-beige. Der Schwanz wird zur Spitze dunkler. Es zeichnen sich dunkelgraue Augenringe ab.
Verbreitung: Nordwest-Madagaskar.
Habitat: Trockene, zeitweise laubabwerfende Wälder im Flachland, aber mit vielen Lianen.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: ähnlich dem von M. murinus (RADESPIEL et al., 2003).
Gefährdungsstatus: stark gefährdet (endangered nach IUCN Red List).
Microcebus bongolavensis OLIVIERI et al., 2007 – Bongolava-Mausmaki
Engl.: Bongolava mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 9-12,2 cm, Schwanzlänge 14,7-17,4 cm, Gewicht etwa 55 g (MITTERMEIER et al., 2010b). Sehr ähnlich M. ravelobensis, aber mehr grau, als braun.
Verbreitung: drei kleine Waldfragmente im Nordwesten Madagaskars.
Habitat: bisher nur Primärwald bekannt.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Microcebus danfossi OLIVIERI et al., 2007 – Danfoss-Mausmaki
Engl.: Ambarijeby mouse lemur, Danfoss‘ mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 12,7-13,6 cm, Schwanzlänge 16,6-17,3 cm, Gewicht etwa 63 g (OLIVIERI et al., 2007). Nach äußerlichen Merkmalen nur schwer von M. ravelobensis zu unterscheiden.
Verbreitung: Nordwest-Madagaskar.
Habitat: Flachlandwälder.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Microcebus margotmarshae LOUIS et al., 2008 – Margot-Marsh-Mausmaki
Engl.: Margot Marsh’s mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 11-12 cm, Schwanzlänge etwa 14 cm, Gewicht 41-50 g (LOUIS et al., 2008). Das Fell der Körperoberseite ist rötlich-orange, teilweise mit grauen Untertönen, das der Bauchseite ist weiß bis cremefarben. Der Kopf ist noch etwas leuchtender rot-orange. Um die Augen ziehen sich dunkelbraune Ringe.
Verbreitung: Bisher nur aus dem Antafondro-Wald in Nordwest-Madagaskar bekannt.
Habitat: Flachlandwald.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: bisher nicht in der IUCN Red List geführt.
Microcebus sambiranensis RASOLOARISON et al., 2000 – Sambirano-Mausmaki
Engl.: Sambirano mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 11-12 cm, Schwanzlänge 13,5-14,5 cm, Gewicht 38-50 g (RASOLOARISON et al., 2000). Auf dem Rücken ist das Fell braun-zimtfarben mit einem nur angedeuteten dunkleren Mittelstreifen. Die Bauchseite ist beige bis hellgrau. Der Nasenstreifen zwischen den Augen ist ebenfalls hellgrau. Um die Augen ziehen sich deutliche dunkle Augenringe.
Verbreitung: kleines Gebiet im Nordwesten Madagaskars (Sambirano-Region), aber die Verbreitungsgrenzen sind bisher nur ungenügend bekannt.
Habitat: Flachlandwälder, auch an Rändern von Kulturflächen.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: stark gefährdet (endangered nach IUCN Red List).
Microcebus mamiratra ANDRIANTOMPOHAVANA et al., 2006 – Nosy-Be-Mausmaki
Engl.: Nosy Be mouse lemur, Claire’s mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge im Mittel 12,7 cm, Schwanzlänge im Mittel 14,3 cm, Gewicht 50-60 g (ANDRIANTOMPOHAVANA et al., 2006; zit. in MITTERMEIER et al., 2010). Im Aussehen M. sambiranensis sehr ähnlich. Der Schwanz wird an der Spitze oft dunkler.
Verbreitung: auf der nordwest-madagassischen Insel Nosy Be und wahrscheinlich in einem kleinen Küstengebiet Madagaskars.
Habitat: keine artspezifischen Angaben.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Microcebus tavaratra RASOLOARISON et al., 2000 – Nördlicher Brauner Mausmaki
Engl.: Tavaratra mouse lemur, Northern brown mouse lemur
Merkmale: Kopf- Rumpf-Länge 12,6 (11,313,9) cm, Schwanzlänge 15,5 (14,5-16,7) cm, Gewicht 61 (48-84) g (RASOLOARISON et al., 2000). Das Fell der Körperoberseite ist bräunlich mit einem deutlich erkennbaren rotbraunen Dorsalstreifen von den Schultern bis zum Schwanz. Die Körperunterseite trägt beigeweißes bis hellgraues Fell. Der Kopf ist mehr rötlich behaart.
Verbreitung: kleines Gebiet in Nord-Madagaskar.
Habitat: trockene, teilweise laubabwerfende Flachlandwälder und Galeriewälder.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: stark gefährdet (endangered nach IUCN Red List).
Microcebus arnholdi LOUIS et al., 2008 – Arnhold-Mausmaki
Engl.: Montagne d’ Ambre mouse lemur, Arnhold’s mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 10-12,6 cm, Schwanzlänge 10,6-13,6 cm, Gewicht etwa 60 g (LOUIS et al., 2008). Die Farbe der Körperoberseite ist grau und rötlichbraun gemischt. Es zeichnet sich eine dunkelbraune Dorsallinie bis zur Schwanzbasis ab. Der Schwanz ist an der Spitze dunkelbraun. Die Körperunterseite ist cremefarben bis grauweiß. Der Kopf ist eher rötlichbraun gefärbt. Die Nasenseiten und Augenringe sind markant dunkelbraun.
Verbreitung: nördlichster Mausmaki, der bisher nur aus dem Montagne d’Ambre Nationalpark bekannt ist.
Habitat: montane Regenwälder.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: bisher nicht in der IUCN Red List geführt.
Microcebus mittermeieri LOUIS et al., 2006 – Mittermeier-Mausmaki
Engl.: Mittermeier’s mouse lemur
Merkmale: Neben M. berthae aus West-Madagaskar der kleinste Mausmaki und Primat mit Kopf-Rumpf-Längen von 8-9 cm und Gewichten kaum über 40 g (LOUIS et al., 2006). Das Körperfell ist bräunlich, auf dem Kopf mehr rot- oder orange-braun. Die Bauchseite ist grau-bräunlich-weiß behaart. Auf dem Schwanz zeichnet sich ein dunklerer Dorsalstreifen ab. Die Schwanzspitze ist schwarz.
Verbreitung: Nordost-Madagaskar; teilweise sympatrisch mit M. macarthurii (RADESPIEL et al., 2008).
Habitat: keine artspezifischen Angaben.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Microcebus macarthurii RADESPIEL et al., 2008 – MacArthur-Mausmaki
Engl.: Anjiahely mouse lemur, MacArthur’s mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 11-12 cm, Gewicht im Mittel 53 g (RADESPIEL et al., 2008). Die Körperoberseite ist dunkel rotbraun behaart mit einem dunklen Dorsalstreifen. Der Kopf erscheint mehr orange-braun. Die Wangen sind hell orange. Um die Augen zeigen sich dunkle Ringe. Die Bauchseite ist gelblich-grau bis cremeweiß. Der Schwanz wird an der Spitze etwas dunkler.
Verbreitung: bisher nur vom Ort der Erstbeschreibung in einem kleinen Gebiet im Nordosten Madagaskars bekannt.
Habitat: keine artspezifischen Angaben.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: bisher nicht in der IUCN Red List geführt.
Microcebus simmonsi LOUIS et al., 2006 – Simmon-Mausmaki
Engl.: Simmon’s mouse lemur
Merkmale: Relativ großer östlicher Mausmaki mit durchschnittlich 12,8 cm Kopf-Rumpf-Länge und 75-78 g Gewicht (LOUIS et al., 2006). Das Fell auf der Körperoberseite ist rotbraun oder orangebraun, das der Unterseite grauweiß oder weiß.
Verbreitung: kleines Gebiet im Nordosten Madagaskars.
Habitat: keine artspezifischen Angaben.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Microcebus lehilahytsara ROOS & KAPPELER, 2005 – Goodman-Mausmaki
Engl.: Goodman’s mouse lemur
Merkmale: Nur unwesentlich größer als der kleinste Mausmaki (M. berthae) mit Kopf-Rumpf-Längen von etwa 9 cm und Gewichten zwischen 45 und 48 g (KAPPELER et al., 2005). Das Fell der Körperoberseite ist rotbraun bis orange-rot, das der Körperunterseite cremeweiß. Die Ohren sind recht kurz.
Verbreitung: Osten des zentralen Madagaskars.
Habitat: natürliche Wälder, aber auch alte Eukalyptusplantagen (GANZHORN, 1987).
Ernährung: Früchte und Insekten.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Microcebus gerpi RADESPIEL et al., 2012 – Gerp-Mausmaki
Engl.: Gerp’s mouse lemur
Taxonomie: Der erst 2009 entdeckte Mausmaki wurde 2012 wissenschaftlich beschrieben (RADESPIEL et al., 2012). Es ist eine parapatrische und nahe verwandte Art zu M. lehilahytsara.
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge etwa 8,4 cm, Schwanzlänge ungefähr 14,8 cm und Gewicht bei 68 g und damit deutlich größer als M. lehilahytsara. Die Körperoberseite trägt ein graubraunes Fell mit einer diffusen rötlichen Rückenmittellinie und die Körperunterseite eine lichtgraue bis cremeweiße Behaarung. Die Extremitäten erscheinen an den Außenseiten etwas dunkler als das Körperfell. Der Kopf ist hell rotbraun, aber um die Augen herum dunkler. Die Ohren sind relativ klein. Der lange Schwanz ist oberseits dunkler graubraun, unterseits heller. Er kann Fett speichern. Verbreitung: Osten des zentralen Madagaskars. Bisher ist die Art nur vom Typfundort bekannt.
Habitat: primäre und sekundäre Flachlandwälder.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: bisher nicht in der IUCN Red List geführt.
Microcebus marohita RASOLOARISON et al., 2013 – Marohita-Mausmaki
Engl.: Marohita mouse lemur
Taxonomie: Der 2003 entdeckte und 2013 beschriebene Mausmaki unterscheidet sich in der Größe und genetisch deutlich von benachbarten Arten.
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 13,2-14,0 cm, Schwanzlänge 13,3-14,5 cm und Gewicht 64-89 g (RASOLOARISON et al., 2013). Die Form gehört damit zu den größeren Mausmakis. Das Fell der Körperoberseite ist rotbraun mit einem dunklen Dorsalstreifen von den Schultern bis zur Schwanzwurzel. Der Kopf ist heller rötlich. Um die Augen zieht sich ein dunkler Ring. Der Nasenrücken ist weißlich. Die Ohren sind relativ kurz, die Hinterfüße lang. Die Körperunterseite ist grau-beige. Die Hände und Füße tragen weißliche Behaarung.
Verbreitung: Die Art ist bisher nur aus der Gegend des Fundortes des Typexemplars im Marohita-Wald im Osten Zentralmadagaskars bekannt, südlich der Vorkommen von M. lehilahytsara und M. gerpi und nördlich der Areale von M. rufus und M. jollyae.
Habitat: Tiefland-Regenwald.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: stark gefährdet (endangered nach IUCN Red List).
Microcebus rufus (LESSON, 1840) – Roter Mausmaki
Engl.: Rufous mouse lemur, Brown mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge etwa 12 cm, Schwanzlänge 10,9-12,5 cm, Gewicht 39,5-48 g (KAPPELER, 1991; LOUIS et al., 2006). Kopf, Schultern und Arme sind rot bis rotbraun behaart, der übrige Körper oberseits und der Schwanz grau bis graubraun. Die Bauchseite trägt grauweißes Fell.
Verbreitung: Früher wurde die Verbreitung der Art in Ost-Madagaskar viel weiter angenommen. Durch die molekulargenetische Identifikation neuer Arten aus diesem Areal ist das Gebiet für M. rufus im südlichen Ost-Madagaskar viel kleiner.
Habitat: vor allem feuchte Flachland und Bergwälder bis 2000 m Höhe. Mitunter auch Sekundärwälder sowie Bambusdickichte, Eukalyptuswälder und Plantagen.
Ernährung: omnivore Ernährung. Hauptanteil bilden Früchte, aber auch Blüten, Gummiexsudate, Insekten und gelegentlich junge Blätter (ATSALIS, 1999a).
Fortpflanzung: Paarungszeit zwischen September und Oktober (Die Testes der Männchen nehmen in dieser Zeit sehr stark an Größe zu.). Nach 2 Monaten Tragzeit werden 13 Junge geboren. Bisheriges Höchstalter wahrscheinlich etwa 12 Jahre eines wildgeborenen Individuums (WEIGL, 2005).
Sozialstruktur: Die Wohngebiete der Männchen überlappen sich mit denen von zwei oder mehr Weibchen (ATSALIS, 1999b).
Sonstiges: Zwischen Mai und September (südlicher Winter) fallen die meisten Weibchen und einige Männchen in einen Torporstatus und verlieren in dieser Zeit 5-35 g Körpergewicht (ATSALIS, 1999b).
Gefährdungsstatus: gering bedroht (least concern nach IUCN Red List).
Microcebus jollyae LOUIS et al., 2006 – Jolly-Mausmaki
Engl.: Jolly’s mouse lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge ca. 13 cm, Gewicht ungefähr 60 g (LOUIS et al., 2008). Das Fell ist oberseits graubraun und unterseits hellgrau. Im Gesicht fallen dunkle Augenringe, eine weiße Nasenwurzel und weiß behaarte Unterkiefer auf.
Verbreitung: kleines Gebiet im zentralen Osten von Madagaskar.
Habitat: Küstenregenwälder, aber sonst bisher nicht untersucht.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Microcebus tanosi RASOLOARISON et al., 2013 – Anosy-Mauslemur
Engl.: Anosy mouse lemur
Taxonomie: Der 2007 entdeckte Mausmaki wurde 2013 wissenschaftlich beschrieben.
Merkmale: Mit 11,6-14,0 cm Kopf-Rumpf-Länge, 11,5-15,0 cm Schwanzläng und 48-60 g Gewicht zählt die Art zu den größeren Mausmakis (RASOLOARISON et al., 2013). Das Fell der Körperoberseite hat eine dunkelbraune Färbung, das der Unterseite ist stumpf beige bis grau. Von der Rückenmitte bis zur Schwanzwurzel zeichnet sich undeutlich ein dunkler Dorsalstreifen ab. Der Oberkopf ist dunkelbraun, das Gesicht heller rötlich-braun. Auch die Ohren sind braun. Zwischen den Augen markiert sich ein heller Fleck. Der Schwanz ist oberseits dunkler braun, unterseits mehr gelbbraun. Bei einer bekannten Population aus dem Manantantely-Wald ist die Schwanzbehaarung kurz, bei einer anderen aus dem Ivorona-Wald lang.
Verbreitung: Bisher ist die Art nur von dem Typfundort im Manantantely-Wald und im benachbarten Ivorona-Wald in der Region Anoys im Südosten Madagaskars bekannt.
Habitat: Tiefland-Regenwald.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: bisher nicht in der IUCN Red List geführt.
Gattung MIRZA GRAY, 1870 – Riesenmausmakis
Von den Riesenmausmakis sind bisher zwei Arten bekannt. Die bereits 1867 beschriebene südliche Art wurde zunächst der Gattung Cheirogaleus zugeordnet, später dann Microcebus. Aber die Vertreter von Mirza sind bedeutend größer und vor allem mit etwa 300 g viel schwerer als die Mausmakis. Riesenmausmakis sind nachtaktiv.
Riesenmausmakis leben nur im Westen Madagaskars und dort in trockenen, teilweise laubabwerfenden Flachlandwäldern. Sie ernähren sich omnivor. Den Hauptanteil bilden Früchte, Blüten und Knospen. Aber zu bedeutendem Anteil verzehren sie auch Baumexsudate, Insekten und Insektenexsudate, letztere vor allem in der Trockenzeit.
Mirza coquereli (A. GRANDIDIER, 1867) – Südlicher Riesenmausmaki
Engl.: Coquerel’s giant mouse lemur, southern dwarf lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge im Mittel 25 cm, Schwanzlänge etwa 31 cm, Gewicht 300-320 g (KAPPELER et al., 2005). Das Körperfell ist oberseits rotbraun, unterseits hell grau mit gelblicher Tönung. Der Schwanz wird an der Spitze dunkel.
Verbreitung: südlicher und mittlerer Teil West-Madagaskars. Insgesamt etwas disjunkt durch die Fragmentierung der Wälder.
Habitat: Trockenwälder im Flachland und bis 700 m Höhe.
Ernährung: wie bei Mirza beschrieben.
Fortpflanzung: Tragzeit etwa 3 Monate (MITTERMEIER et al., 2010). Es werden meist 2, seltener nur 1 Junges in einem Nest geboren. Die Jungen verlassen das Nest im Alter von etwa 3 Wochen. Sie werden von der Mutter im Maul getragen und während deren Nahrungssuche in der Vegetation „geparkt“. Im Alter von 3 Monaten ernähren sich die Jungen selbständig. Bisher bekanntes Höchstalter 17 Jahre und 5 Monate (WEIGL, 2005).
Sozialstruktur:M. coquereli lebt nahezu solitär, auch wenn sich die Wohngebiete mehrerer Individuen überlappen. Deren Kernzonen werden gegen Artgenossen verteidigt. In Schlafnestern werden allenfalls Mütter mit ihrem noch unselbständigen Nachwuchs zusammen gefunden. Jedes Individuum hat meist mehrere Schlafnester, die im Abstand von wenigen Tagen gewechselt werden (KAPPELER, 2003).
Gefährdungsstatus: potenziell gefährdet (near threatened nach IUCN Red List).
Mirza zaza KAPPELER & ROOS, 2005 – Nördlicher Riesenmausmaki
Engl.: Northern giant mouse lemur, northern dwarf lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge etwa 27 cm, Schwanzlänge 27-28 cm, Gewicht 287-299 g (KAPPELER et al., 2005). Das relativ kurzhaarige Fell hat oberseits eine graubraune und unterseits eine hellgraue Färbung. Die Ohren erscheinen etwas kürzer als bei M. coquereli.
Verbreitung: zwei getrennte Hauptverbreitungsgebiete im nördlichen West-Madagaskar.
Habitat: Trockenwälder im Flachland, aber auch Mango-, Cashew- und andere Plantagen.
Ernährung: wie bei Mirza beschrieben. Cashew-Früchte sind eine wesentliche Nahrungsquelle in der Trockenzeit.
Fortpflanzung: Ähnlich wie bei M. coquereli, aber mehrere Monate früher im Jahr (KAPPELER et al., 2005).
Sozialstruktur: wie bei M. coquereli beschrieben.
Gefährdungsstatus: potenziell gefährdet (near threatened nach IUCN Red List).
Gattung ALLOCEBUS PETTER-ROUSSEAUX & PETTER, 1967 – Büschelohrmakis
Büschelohrmakis bilden eine monotypische Gattung aus Ostmadagaskar. Die nachtaktiven Tiere sind nur geringfügig größer als die Vertreter der Mausmakis. Besonders kraniale Strukturen unterscheiden sie aber deutlich von diesen und führten zur Klassifizierung in eine eigene Gattung. Ein weiteres Charakteristikum sind die büschelartig behaarten Ohren.
Bis 1989 waren lediglich fünf Museumsexemplare der Büschelohrmakis bekannt. Erst danach wurden durch intensivierte Freilanduntersuchungen die Tiere auch in ihrem Lebensraum beobachtet (MITTERMEIER et al., 2010b).
Allocebus trichotis (GÜNTHER, 1875) – Büschelohrmaki
Engl.: Hairy-eared dwarf lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 13-16 cm, Schwanzlänge 14-20 cm, Gewicht 65-90 g (MEIER & ALBIGNAC, 1991). Das Fell hat oberseits eine grau-braune Färbung. Die Bauchseite ist weißgrau. Der Schwanz hat die Färbung des Körperfells, wird aber zur Spitze hin dunkler.
Verbreitung: Die tatsächlichen Verbreitungsgrenzen sind bisher nur ungenügend bekannt. Das Areal liegt im nördlichen Ost-Madagaskar.
Habitat: Regenwälder im Flachland.
Ernährung: Die Gebissstruktur, die gekielten Fingernägel und die lange Zunge weisen auf eine gummivore Ernährung, ähnlich der Gattung Phaner, hin. Es wurde im Wildleben aber auch die Aufnahme von Insekten, Früchten und Nektar beobachtet. A. trichotis vermag große Fettreserven für Trockenzeiten im Körper zu speichern (RAKOTOARISON et al., 1997).
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: meist solitär, aber auch in Paaren mit Jungtieren. A. trichotis scheinen relativ große Wohngebiete zu beanspruchen (5,4-15,4 ha) (BIEBOUW, 2009).
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Gattung CHEIROGALEUS É. GEOFFROY, 1812 – Fettschwanzmakis, Katzenmakis
Die Vertreter der Gattung Cheirogaleus sind relativ kleine, nachtaktive Lemuriformes, die äußerlich den Mausmakis ähneln, aber doch deutlich größer als diese sind. Sie sind dafür bekannt, dass sie für saisonale Perioden der Nahrungsverknappung und der Trockenzeit Fettvorräte besonders im Schwanz einlagern und diese Perioden dann in einem Torpor (Hibernation) verbringen. Dabei werden die Fettspeicher allmählich metabolisiert. Während dieser Zeit kann das Körpergewicht bis auf 50% absinken. Die Körpertemperatur im Zustand der Hibernation schwankt mit der im Tagesrhythmus variierenden Außentemperatur. Die Stoffwechselrate wird eingeschränkt.
Viele Jahre hindurch wurden lediglich zwei Arten anerkannt mit C. medius aus trockenen Wäldern des westlichen und südlichen Madagaskars und C. major aus feuchten Wäldern im Osten von Madagaskar. GROVES (2001, 2005) unterschied sieben Arten in zwei Artengruppen, die den oben genannten beiden Arten entsprechen. Zwei davon (C. minusculus und C. ravus) beschrieb er selbst. GROENEVELD et al. (2009) zeigten aber, dass C. adipicaudatus GRANDIDIER, 1868, ein Synonym von C. medius und C. ravus GROVES, 2000, ein Synonym von C. major sind. 2013 wurde eine weitere Art mit C. lavasoensis beschrieben (THIELE et al., 2013). Daher werden gegenwärtig sechs Arten anerkannt.
Fettschwanzmakis bewegen sich mehr quadruped und weniger springend im Geäst der Bäume. Sie bewegen sich auch häufig deutlich langsamer als Mausmakis oder auch Wieselmakis. Alle Arten zeichnet ein auffälliger dunkler Ring um die Augen aus. Sie ernähren sich hauptsächlich von Früchten.
Cheirogaleus medius É. GEOFFROY, 1812 – Westlicher Fettschwanzmaki
Engl.: Western fat-tailed dwarf lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 17-23 cm, Schwanzlänge 19-27 cm, Gewicht saisonal unterschiedlich zwischen 120 und 270 g (MÜLLER, (MÜLLER, 1999). Das Fell der Körperoberseite ist hellgrau und mitunter mit einem braunen Dorsalstreifen. Die Bauchseite ist cremefarben behaart. Es zeigt sich ein weißes Halsband, das an den Seiten fast bis zum Nacken reicht. Hände und Füße sind ebenfalls weißlich behaart.
Verbreitung: nahezu gesamter Westen und Süden von Madagaskar in Küstennähe.
Habitat: trockene, teilweise laubabwerfende Wälder und halbwüstenartige Gebiete.
Ernährung: Früchte, Blüten und Samen neben geringeren Mengen Insekten, Pflanzen- und Insektenexsudate. C. medius haben die Fähigkeit, etwa 6 Monate während des Südwinters und der Nahrungsverknappung in Hibernation zu verbringen.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben. Bisher bekanntes Höchstalter 23 Jahre und 3 Monate (WEIGL, 2005).
Sozialstruktur: oft kleine Familiengruppen aus dem reproduktiven Paar und dem Nachwuchs aus ein bis zwei Fortpflanzungsperioden (FIETZ, 1999). Es erfolgen aber häufig Paarungen außerhalb des Familienverbandes (FIETZ et al., 2000). Die Nachkommen wandern in beiden Geschlechtern aus ihren Geburtsgruppen aus.
Gefährdungsstatus: nicht gefährdet (least concern nach IUCN Red List).
Cheirogaleus sibreei (FORSYTH MAJOR, 1896) – Rückenstreifen-Fettschwanzmaki
Engl.: Sibree’s dwarf lemur
Taxonomie: Die Form wurde zwar bereits 1896 beschrieben, galt danach aber lange Zeit als Juniorsynonym von C. major. GROVES (2000) stellte sie aber anhand von Museumsexemplaren deutlich als distinkte Art heraus.
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 20,5-23,5 cm, Schwanzlänge 22,0-26,5 cm, Gewicht 219-359 g (BLANCO et al., 2009). Das Fell der Körperoberseite, des Kopfes und des Schwanzes ist graubraun, das der Unterseite cremefarben. Mitunter, aber nicht bei allen Individuen, zeichnet sich ein dunklerer Dorsalstreifen ab. An den Halsseiten zieht sich ein helles Halsband hoch, das sich aber nicht im Nacken verbindet. Die Augen sind von sehr breiten, schwarzen Ringen umgeben. Das Schwarz zieht sich an den Nasenseiten nach unten. Die Haut der Hände und Füße ist fleischfarben, aber oberseits mit graubraunen Haaren bestanden.
Verbreitung: Lange Zeit war die Art nur durch Museumsexemplare bekannt. Der Typfundort war östlich von Antananarivo. In den Jahren nach 2005 wurden Tiere in zentralen Gebieten Madagaskars gefunden (GROENEVELD et al., 2010; zit. in MITTERMEIER et al., 2010b).
Habitat: keine artspezifischen Angaben.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Cheirogaleus minusculus GROVES, 2000 – Kleiner Eisengrauer Fettschwanzmaki
Engl.: Lesser iron-gray dwarf lemur
Taxonomie: Die Form wurde lange Zeit als Vertreter von C. major betrachtet. GROVES (2000) stellte sie aber anhand eines Museumsexemplars deutlich als distinkte Art heraus.
Merkmale: Die Art ist lediglich von einem Museumsexemplar bekannt; daher keine exakten Maßangaben verfügbar, aber in der Größe zwischen C. major und C. medius liegend (GROVES, 2000). Das Fell hat eine eisengraue Färbung mit geringer bräunlicher Tönung und einem leicht angedeuteten Dorsalstreifen. Die Oberseiten der Hände und Füße sind weißlich behaart. Auch die Schwanzspitze ist weiß.
Verbreitung: Das einzige Museumsexemplar stammt aus Ambositra im östlichen zentralen Madagaskar.
Habitat: keine artspezifischen Angaben.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben.
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient nach IUCN Red List).
Cheirogaleus major É. GEOFFROY, 1812 – Brauner Fettschwanzmaki, Großer Fettschwanzmaki
Engl.: Greater dwarf lemur, Geoffroy’s dwarf lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 23-25 cm, Schwanzlänge 25-28 cm (GROVES, 2000), Gewicht saisonal unterschiedlich zwischen 250 und 500 g (FIETZ, 2003). Die Körperoberseite ist dunkel rotbraun oder graubraun behaart, die Körperunterseite hellgrau. Mitunter zeigt sich ein dunkelroter, schwach abgesetzter Dorsalstreifen. Der Nasenrücken ist hell.
Verbreitung: gesamtes östliches Madagaskar.
Habitat: Regenwälder im Flachland und Bergland bis 1800 m Höhe und ohne so starke saisonale Trockenzeiten, wie im Westen Madagaskars.
Ernährung: hauptsächlich Nektar, Früchte und junge Blätter, zu geringem Anteil Insekten (MITTERMEIER et al., 2010b).
Fortpflanzung: Die Paarungszeit beginnt kurz nach Beendigung der jährlichen Zeit des Torpors im Oktober/November. Nach etwa 70 Tagen Tragzeit werden meist im Januar 2-3 Junge in einem vom Weibchen gebauten Laubnest geboren. Sie sind behaart, aber zunächst noch blind. In der ersten Zeit werden sie von der Mutter im Maul getragen, aber schon bald auf deren Rücken (FIETZ, 2003). Bisher bekanntes Höchstalter 13 Jahre und 5 Monate (WEIGL, 2005).
Sozialstruktur: Prinzipiell eher solitäre Lebensweise, wobei die Weibchen Wohngebiete bis zu 4 ha Größe besetzen, die aber von denen der Männchen und wahrscheinlich auch juvenilen Tieren überlappt werden. Am Tage können in einer Baumhöhle oder einem Laubnest bis zu drei adulte Individuen gemeinsam schlafen.
Gefährdungsstatus: nicht gefährdet (least concern nach IUCN Red List).
Cheirogaleus crossleyi A. GRANDIDIER, 1870 – Rötlicher Fettschwanzmaki
Engl.: Furry-eared dwarf lemur, Crossley’s dwarf lemur
Taxonomie: Die Form wurde zwar bereits 1870 beschrieben, galt danach aber lange Zeit als Juniorsynonym von C. major. GROVES (2000) stellte sie im Zusammenhang mit seiner Revision der Gattung als distinkte Art heraus.
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 22-26 cm, Schwanzlänge 21-27 cm (GROVES, 2000). Das Fell ist oberseits rotbraun und heller als bei C. major. Besonders der Oberkopf erscheint rötlicher. Die Bauchseite ist weißgrau behaart.
Verbreitung: disjunkte, kleine Gebiete in Ost-Madagaskars, geografisch sympatrisch mit C. major, obwohl nicht in denselben Waldgebieten.
Habitat: keine artspezifischen Angaben, wahrscheinlich wie bei C. major.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben. Bisher bekanntes Höchstalter 8 Jahre und 8 Monate (WEIGL, 2005).
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: unbekannt, da ungenügend Daten vorhanden (data deficient).
Cheirogaleus lavasoensis THIELE, RAZAFIMAHATRATA & HAPKE, 2013) – Lavasoa-Fettschwanzmaki
Engl.: Lavasoa dwarf lemur
Taxonomie: Erst 2013 beschriebene, mit C. crossleyi verwandte Form, aber im Aussehen und genetisch different.
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge im Mittel 26 cm, Schwanzlänge 27 cm, Gewicht im Mittel 300 g (THIELE et al., 2013). Neben den schwarzen Augenringen ist die Haut auf der Nase und zwischen Augen und Nase dunkel pigmentiert. Auch die Ohren sind dunkel pigmentiert und kurz schwarz behaart. Die Krone und der Vorderkopf zeigen rotbraune Färbung. Der Körper ist vorn mehr rotbraun, nach hinten graubraun. Der Schwanz hat graubraune Behaarung.
Verbreitung: im äußersten Südosten Madagaskars in den Lavasoa-Bergen in drei kleinen Waldgebieten.
Habitat: Übergangszone von trockenem Dornwald zu feuchten Wäldern.
Ernährung, Fortpflanzung, Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben verfügbar.
Gefährdungsstatus: extrem gefährdet, wahrscheinlich kaum mehr als 50 Individuen (THIELE et al., 2013), aber noch nicht in der IUCN Red List geführt.
Gattung PHANER GRAY, 1870 – Gabelstreifenmakis
Die Gattung Phaner hat sich wahrscheinlich bereits sehr frühzeitig von der gemeinsamen Wurzel der Cheirogaleidae getrennt und zeigt gegenüber den anderen Gattungen auch viele Abweichungen und Spezialisierungen. Es sind die größten Vertreter der Familie Cheirogaleidae. Die Fellfarbe ist braun bis grau mit cremefarbener oder gelblicher Bauchseite. Charakteristisch für die Gattung ist ein deutlich abgesetztes schwarzes oder dunkelbraunes Dorsalband. Es entspringt in zwei Bändern über den Augen, die sich auf dem Hinterkopf oder Nacken zu einem Band vereinen (Gabelung). Der Dorsalstreifen kann bis zur Schwanzwurzel reichen. Die Schwanzspitze ist stets schwarz. Um die Augen zieht sich ein schwarzer Ring.
Gabelstreifenmakis ernähren sich zu weit überwiegendem Anteil von Gummiexsudaten der Bäume und zeigen dafür Spezialisierungen, die auch bei anderen gummivoren Primaten (Kielnagelgalagos – Euoticus oder Krallenaffen – Callitrichidae, und da besonders Vertreter von Cebuella und Callithrix) in ähnlicher Weise gefunden werden: Die Fingernägel sind gekielt und damit krallenartig für einen besseren Halt in der Rinde von Baumstämmen. Die Schneidezähne stehen stark nach vorn und sind kräftig ausgebildet. So vermögen sie die Rinde aufzubeißen, um den Exsudatfluss zu fördern. Sie haben eine lange Zunge. Der Blinddarm der Phaner-Arten ist vergrößert. Damit wird die fermentative Aufspaltung der Gummiexsudate ermöglicht.
Die nachtaktiven Gabelstreifenmakis leben monogam (SCHÜLKE, 2005) und gebären, im Unterschied zu den anderen Cheirogaleidae, zumeist Einlinge. Sie sind sehr stimmfreudige Tiere. Gabelstreifenmakis kommen diskontinuierlich in weiten Teilen der Wälder in West-, Nord- und Ostmadagaskar vor.
Bis 1991 galt die Gattung als monotypisch mit P. furcifer. GROVES & TATTERSALL (1991) differenzierten nach anatomisch-morphologischen Unterschieden zwischen den Populationen zunächst in vier Unterarten, bis GROVES (2001) diese als diskrete Arten führte. So werden heute vier Arten anerkannt. Es gibt aber durch aktuelle Untersuchungen Hinweise, dass eventuell weitere Formen differenziert werden müssen.
Phaner furcifer (DE BLAINVILLE, 1839) – Masoala-Gabelstreifenmaki
Engl.: Masoala fork-marked lemur, Eastern fork-marked lemur
Merkmale: artspezifische Maßangaben fehlen. Das Fell der Körperoberseite ist dunkel rotbraun, das der Unterseite cremefarben bis lichtgrau. P. furcifer ist die dunkelste Form der Gattung. Der schwarze Dorsalstreifen reicht nicht bis zur Schwanzwurzel, zeichnet sich aber sehr markant vom übrigen Fell ab.
Verbreitung: Nordost-Madagaskar einschließlich der Masoala-Halbinsel.
Habitat: tropische Feuchtwälder vom Flachland bis in 1000 m Höhe.
Ernährung: keine artspezifischen Angaben vorhanden.
Fortpflanzung: keine artspezifischen Angaben. Bisher bekanntes Höchstalter über 10 ½ Jahre, aber wahrscheinlich sogar über 20 Jahre (WEIGL, 2005).
Sozialstruktur: keine artspezifischen Angaben.
Gefährdungsstatus: nicht gefährdet (least concern nach IUCN Red List).
Phaner pallescens GROVES & TATTERSALL, 1991 – Westlicher Gabelstreifenmaki
Engl.: Pale fork-marked lemur, Western fork-marked lemur
Merkmale: Kopf-Rumpf-Länge 26,3±0,9 cm, Schwanzlänge 31,9±1,2 cm, Gewicht 327±1,2 g (SCHÜLKE, 2003). Das Fell hat eine lichtgraue Färbung mit leichtem gelblichen oder bräunlichen Anflug. Der Dorsalstreifen ist dunkel graubraun und etwas weniger scharf gegenüber dem übrigen Fell abgesetzt. Er reicht aber bis zur Schwanzwurzel.
Verbreitung: fleckenartig an der Westküste Madagaskars.
Habitat:





























