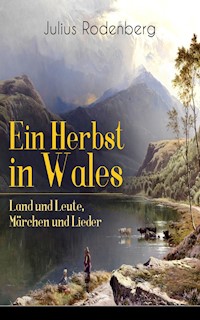Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vergangenheitsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Julius Rodenberg nimmt uns mit auf seine Spaziergänge durch das Berlin seiner Gegenwart und Vergangenheit. Er zeigt ein Bild des Wandels, bedingt durch die Industrialisierung und Urbanisierung, die sich im 18. und 19. Jahrhundert in Berlin vollzieht. So beschreibt Rodenberg Weide- und Wiesenflächen, wo heute geschäftiges Leben tobt. In schillernden Farben und reichen Anekdoten schildert er das Berliner Leben. "Bilder aus dem Berliner Leben" ist aber auch ein literarischer Spaziergang, in dem Rodenberg wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse Revue passieren lässt und uns in Lesekonditoreien und Cafés mitnimmt sowie Berliner Originale zum Leben erweckt. Diese neue E-Book-Ausgabe verfügt über einen umfangreichen, neu erstellten Anmerkungsapparat und ein ausführliches Personenregister sowie ein Straßenverzeichnis, welches dazu einlädt auf den Spuren Rodenbergs durch Berlin zu wandeln. Darüber hinaus wird diese digitale Ausgabe durch historische Aufnahmen und Bilder des modernen Berlins zur Veranschaulichung der urbanen Entwicklung und der beschriebenen Charaktere bereichert. 100% Sachbuchklassiker: vollständig, kommentiert, relevant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bilder aus dem Berliner Leben
Julius Rodenberg
Herausgegeben von:
Bettina Jander, Severin Richter-Devroe, Melanie Rücker, Maria Steeg, Nina Weisweiler,
Impressum
ISBN 978-3-86408-088-3 (epub) // 978-3-86408-089-0 (pdf)
Digitalisat basiert auf der Ausgabe von 1987.
Rodenberg, Julius, Bilder aus dem Berliner Leben, Berlin 1987.
Digitalisierung: Vergangenheitsverlag.
Die Marke „100% - vollständig, kommentiert, relevant“ steht für den hohen Anspruch, mehrfach kontrollierte Digitalisate klassischer Literatur anzubieten, die – anders als auf den Gegenleseportalen unterschiedlicher Digitalisierungsprojekte – exakt der Vorlage entsprechen. Antrieb für unser Digitalisierungsprojekt war die Erfahrung, dass die im Internet verfügbaren Klassiker meist unvollständig und sehr fehlerhaft sind.
© Vergangenheitsverlag, 2012 – www.vergangenheitsverlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die letzte Pappel
Sonntag vor dem Landsberger Tor
In den Zelten
Die Kreuzberger Gegend
Die frühen Leute
Der Norden Berlins
Im Herzen von Berlin
Unter den Linden
Personenverzeichnis
Straßenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Einleitung
„Es ist das bescheidene Geschäft oder Amt eines Chronisten, das ich beanspruche.” So erklärt Julius Rodenberg seinen Schreibstil in seiner Berliner Chronik „Bilder aus dem Berliner Leben”. Im Hinblick auf seine herausragenden Leistungen als Herausgeber der „Deutschen Rundschau” ist dieses literarische Werk Julius Rodenbergs bisher auf weniger Beachtung gestoßen. Er bietet uns jedoch eine detaillierte und eindrucksvolle Schilderung des Berliner Lebens vom Ende des 18. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
Das Besondere an den „Bildern” sind die Beschreibungen des alltäglichen Berliner Lebens, des einfachen Bürgertums und der gehobeneren Schicht des Literatur- und Kulturbetriebs sowie auch des tiefgreifenden Wandels des Stadtbildes. Rodenberg gewährt uns eine neue Perspektive auf die großen politischen, kulturellen und urbanen Ereignisse des Berlins dieser Zeit.
Für jeden, der Berlin schon einmal erlebt hat und die Stadt kennt, ist es eine Freude, gemeinsam mit dem Autor durch ihre Straßen zu wandeln und zu bemerken, was sich seit seinen Spaziergängen verändert hat und was bis heute noch immer beinahe gleich geblieben und leicht wiederzuerkennen ist. Auch Berlin-Neuentdecker kommen auf ihre Kosten und können sich der Hauptstadt auf eine völlig neue Weise annähern. Allen Berlin-Begeisterten wird es ermöglicht tiefer in den Werdegang des jungen Berlins zur europäischen Metropole einzutauchen und einen Teil seiner Geschichte mitzuerleben. Mit seinen Erzählungen greift Rodenberg zum Teil weit in der Zeit zurück, so dass man schließlich ein komplexes Bild vom Berliner Stadtleben des 18. und 19. Jahrhunderts und dessen Persönlichkeiten vor Augen hat. So gibt es Orte, die von Rodenberg noch als ländliche Gegenden mit Feldern und Wiesen beschrieben werden und heute längst zu bebauten und von Menschen wimmelnden Plätzen an Hauptverkehrsstraßen geworden sind. Auch Gegenden wie der Tiergarten mit dem Großen Stern und der Siegessäule in dessen heutiger Mitte, welche zu seiner Zeit kaum Veränderungen erfahren haben, spiegeln sich in seinen Beschreibungen wieder und laden ein Rodenbergs Wegen zu folgen. Ausführlich beschreibt er unter anderem auch die Entstehung der Kaiser-Wilhelm-Straße, der heutigen Karl-Liebknecht-Straße, und bedauert den Verlust vieler historischer Bauwerke, die für den Bau dieser wichtigen Verkehrsader weichen mussten. Die lebhaften und äußerst detailgetreuen Beschreibungen erwecken ein intensives Bild vor dem inneren Auge, so dass der Eindruck entsteht als stünde man selbst neben dem schwärmenden Erzähler und beobachtete gemeinsam mit ihm die Szenerie. Julius Rodenberg, selbst Wahlberliner und ein Kenner vieler europäischer Großstädte dieser Zeit, eröffnete sich dadurch auch ein immer wieder neuer Blickwinkel auf Berlin.
Das künstlerische, speziell das literarische, Leben der Stadt macht einen Schwerpunkt des Werks aus. Seine Spaziergänge führen ihn immer wieder zu Kirchplätzen und Friedhöfen, auf denen wichtige Persönlichkeiten des städtischen Kulturlebens ruhen. Von hier aus beginnt er seine Gedanken schweifen zu lassen und aus seinem tiefen Wissensschatz zu schöpfen. Er weiß ausführlich über jenePersonen zu berichten, unter anderem E. T. A. Hoffmann, den Berliner Verleger Friedrich Nicolai, Moses Mendelssohn oder die großen Damen der Berliner Salons, besonders Henriette Herz und Rahel Varnhagen. Auch der Aufstieg von Großindustriellen wie August Borsig wird von ihm leidenschaftlich beschrieben.
Die „Bilder aus dem Berliner Leben” zeichnen sich durch einen nahezu tagebuchartigen Schreibstil aus. Das mag unter anderem daran liegen, dass Julius Rodenberg seit seinem 20. Lebensjahr geflissentlich Tagebuch führte. Er sagt selbst, er habe die „Bilder” so verfasst „wie man ein Tagebuch schreibt”, wodurch es Rodenberg gelingt einen sehr persönlichen Einblick zu vermitteln. Auch sein feuilletonistischer Schreibstil, den Rodenberg sich in seiner jahrelangen Arbeit als Journalist angeeignet hat, spiegelt sich in seinem Werk deutlich wieder.
Rodenberg, den man heute zumeist nur als Herausgeber und Begründer der „Deutschen Rundschau” kennt, war ein ruhiger Mensch mit einer konservativen Haltung und einem großen Harmoniebedürfnis. Er glaubte an „soziale Harmonie” und an eine mögliche „freundschaftliche Annäherung” zwischen Bürgertum und Arbeitern. Dabei verschloss er weitestgehend die Augen vor den unschönen Seiten der Stadt und in der Rezeptionsgeschichte der „Bilder aus dem Berliner Leben” entstand der Vorwurf, er würde die durch die Industrialisierung hervorgerufenen Missstände ausblenden. Das Leid der Arbeiterbevölkerung sowie die aufkommende, ihr Recht einfordernde Arbeiterbewegung wurden von ihm in der Tataußer Acht gelassen. All dies ist jedoch kaum verwunderlich, wenn man seinen Lebensweg betrachtet. Der Schriftsteller führte ein angenehmes, unaufgeregtes Leben. Für ihn bestanden keinerlei Gründe an den bestehenden Verhältnissen etwas ändern zu wollen, so wie er sagt: „Das Bild eines mäßigen bürgerlichen Glücks ist mir das liebste von allen Bildern aus dem Berliner Leben.”
Er selbst sah sich als jemand, der „das Schauspiel menschlicher Tätigkeit betrachten darf wie ein unbefangener Zuschauer und nicht wie einer, der auf der Bühne selber etwas vorstellen will”. In dieser Aussage zeigt sich sein bescheidener und zurückhaltender Charakter: Julius Rodenberg suchte die Ruhe und sah dem bunten Treiben lieber vom Rand aus zu. Er konnte sich dennoch im höchsten Maße daran erfreuen. So wäre es für ihn undenkbar gewesen, auf seine täglichen Spaziergänge durch die Stadt zu verzichten, denen wir heute diese wunderbaren Erinnerungen an das alltägliche Berliner Leben verdanken, welche in anderen historischen Werken in dieser Art seltener zu finden sind. Er gibt uns nicht die Milieustudien eines Heinrich Zilles und äußert sich auch nicht staatskritisch wie Ernst Dronke. Er nimmt sich aber die Zeit, eine Entwicklung innerhalb Berlins zu beschreiben, die nicht von Armut und Repressalien geprägt ist und schildert auf seine spezielle Weise den städtebaulichen und kulturellen Werdegang der noch jungen Metropole.
Hier ist es interessant einmal einen Blick auf den Lebenslauf und die persönliche Entwicklung des Wahlberliners zu werfen: Julius Rodenberg wurde 1831 als Julius Levy und ältestes von sechs Kindern geboren. Er wuchs in einer wohlhabenden, literarisch interessierten jüdischen Familie auf. In demselben Jahr, in dem er sein Abitur in Rinteln machte, veröffentlichte er die Gedichtsammlung „Geharnischte Sonette für Schleswig-Holstein”, eine Sammlung von der Revolution von 1848 inspirierter, politischer Lyrik mit nationalistischem Eifer. Rodenberg strich sie jedoch im Nachhinein aus seiner Gesamtgedichtsammlung, da sie ihm zu radikal erschien.
In den folgenden Jahren absolvierte er ein Jurastudium, welches ihn zum ersten Mal nach Berlin führte. Schon im Alter von 23 Jahren verkehrte er in bekannten Literatenkreisen, denen Paul Heyse, Gottfried Keller, sowie die Brüder Grimm angehörten. Die Großstadt wirkte auf den jungen Studenten zunächst verwirrend und beängstigend, doch schon bald begann er mit seinen ersten Streifzügen durch die Stadt, die ihn sein Leben lang faszinieren sollte.
Ab 1854 arbeitete er in Marburg als Redakteur am Feuilleton des „Hannoverschen Kurier”. Im selben Jahr riet ihm sein Mentor, der Schriftsteller und Diplomat Karl August Varnhagen von Ense, zur Namensänderung und zur Konvertierung zum Christentum, wovon Rodenberg jedoch nur das erstere verwirklichte. Es folgten weitere Reisen, bei denen er oft als Korrespondent über die damals populären Weltausstellungen berichtete. Wichtigste Stationen waren London und Paris, wo er das Großstadtleben besser kennen lernte und seine Fremdsprachenkenntnisse vertiefte. Nach seiner Promotion in Marburg verlagerte sich sein Interesse weg von lyrischen Arbeiten hin zu Reiseberichten, die seine ersten größeren Erfolge wurden.
1859 erfolgte die endgültige Übersiedlung nach Berlin. Er arbeitete als freier Journalist für das Feuilleton der „Preußischen Zeitung, der „Breslauer Zeitung” und als Korrespondent für die Wiener „Presse” und knüpfte dadurch Kontakte zu national-liberalen Kreisen.
Auf einer Italienreise begegnete er Justina Schiff, Tochter eines reichen Fabrikanten, die er 1863 heiratete und mit der er eine Tochter, Alice Rodenberg, hatte.
Seine Laufbahn als Publizist begann 1862 mit der Herausgabe des „Deutschen Magazins”, einer monatlich erscheinenden Unterhaltungszeitschrift, die jedoch bereits nach zwei Jahren wieder eingestellt wurde. Anschließend übernahm er die Leitung der belletristischen Beilage der Frauen- und Modezeitschrift „Bazar”. 1867 gründete Rodenberg zusammen mit Ernst Dohm die Zeitschrift „Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft”, die er ab 1871 alleine weiterführte.
Mit Hilfe seines großen Netzwerks an literarischen und kulturpolitischen Kontakten, rief er im Jahr 1874 schließlich seine eigene Zeitschrift ins Leben: Die „Deutsche Rundschau”. Diese wurde vierzig Jahre lang von ihm persönlich redigiert und entwickelte sich zu seinem Lebenswerk. Sie etablierte sich zu einer anspruchsvollen, monatlichen Revue und wurde bald zum Forum der Intellektuellen der Gründerzeit. Es handelte sich um ein bürgerlich-konservatives Blatt, das den Anspruch erhob, gleichermaßen liberal wie national ausgerichtet zu sein. Die Zeitschrift förderte viele Autoren, die später teilweise zu Weltruhm gelangten, unter anderem Theodor Storm, Gottfried Keller, Paul Heyse, Conrad Ferdinand Meyer, Ernst Robert Curtius oder Theodor Fontane, mit dem Rodenberg einen regen Briefwechsel pflegte.
Neben seiner Tätigkeit als Publizist verfasste er weiterhin zahlreiche literarische Schriften, beispielsweise den dreibändigen Gesellschaftsroman „Die Grandidiers” (1878), der heute als sein Hauptwerk gilt. Die „Bilder aus dem Berliner Leben” wurden ebenfalls in drei Bänden herausgegeben undim Zeitraum von 1885 bis 1888 in der „Deutschen Rundschau” veröffentlicht. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Rodenbergs publizistische Tätigkeit in seinem Leben eine bedeutendere Position einnahm als seine schriftstellerische.
Im Jahre 1867 zog Rodenberg mit seiner Familie in die Margarethenstraße 1 in Berlin. Hier lud er sich abends gern eine Schar von Gästen ein, speiste mit ihnen und tauschte sich über das Kulturleben Berlins aus. Als Ehrung für seine 25-jährige Redaktionstätigkeit bei der „Deutschen Rundschau” verlieh man ihm 1899 den Professorentitelund er wurde 1911 zum Ehrenbürger der Stadt Rodenberg ernannt.
Julius Rodenberg starb am 11.7.1914 in seinem Wohnhaus in Berlin und wurde auf dem Zentralfriedhof in Friedrichsfelde begraben.
Heute jedoch erinnert kaum noch etwas an diesen leidenschaftlichen Verehrer der Stadt Berlin. Lediglich eine Straße und ein mittlerweile geschlossenes Gymnasium im Stadtteil Prenzlauer Berg sind nach ihm benannt worden, sowie eine Grundschule in seiner Heimatstadt. Doch es lohnt sich, ihn und sein Berlin in die Erinnerung zurück zu rufen und ihm auf seinen Spaziergängen durch diese faszinierende, lebendige Stadt zu folgen, wenn er fragt: „Wohin nun, mein Freund? Ganz Berlin gehört dir; entscheide, triff deine Wahl!”
Julius Rodenberg, Bilder aus dem Berliner Leben
Die letzte Pappel
(Dezember 1875)
Der Sturm von gestern nacht hat sie gefällt. Es war aber auch ein furchtbarer Sturm. Die Fenster klapperten, die Ziegel fielen von den Dächern, draußen war ein solcher Rumor und in meinem Schlafzimmer ein solcher Zug, dass ich zum ersten Male nach langer Zeit wieder in einer Schiffskajüte zu schlafen glaubte. Die ganze Nacht träumte ich von der See, und als ich einmal aufwachte – meine brave Schwarzwälder Uhr draußen auf dem Gange schlug gerade drei –, da war mir, als ob ich den alten Kapitän rufen hörte – den alten dicken Kapitän mit der roten Nase und den kurzen Beinen, denselben, mit dem ich vor Jahren einmal in einer ähnlichen Nacht unterwegs war, zwischen Leith und Hamburg –, und dann vernahm ich ordentlich das Ächzen des Schiffes und das Brausen der Wellen, und ein Ton war in der Luft, als ob ein Baum bräche, als ob Holz splittere ... »Mein Gott, mein Gott«, rief ich, »wir sind verloren« – und ich wollte mich eben anschicken, das sinkende Schiff zu verlassen, um in einem der Böte Rettung zu suchen, als ich zum Glück bemerkte, dass ich in meinem Bette sei und dass sich alles in guter Ordnung befinde, mit Ausnahme der Wettergardinen und Ringe, welche vor dem Fenster zusammen mit dem Winde klingelten und musizierten, dass einem der Schlaf wohl vergehen konnte. Doch es war Sphärenmusik, verglichen mit den Schrecken der heulenden See, welche sich mir so lebendig aufdrängten, dass ich nicht nur den gischtüberschäumten Steuerbord gesehen, das Tosen der Brandung gehört, das Gemisch von Salz und Teer gerochen, sondern auch gewissermaßen den Grog geschmeckt hatte, den ich gestern abend mit dem alten Kapitän getrunken. Der friedliche Zuruf meiner Uhr beruhigte mich indessen auch über diesen letzteren Punkt; es ward mir plötzlich klar, dass ich allerdings gestern abend Grog getrunken, starken Grog obendrein, aber nicht mit dem Kapitän – der, Gott weiß es, schon lange kein Schiff mehr führt. Ich schlief also wieder ein. Aber in derselben Nacht und um dieselbe Stunde ist sie vom Sturme gebrochen worden, die letzte Pappel.
Abbildung 1, Julius Rodenbergs Wohnhaus in der Margaretenstraße 1, 1935
Als ich zuerst in diese Gegend der Stadt kam, vor vierzehn oder fünfzehn Jahren, da waren mehr Pappeln hier; in der Tat, mehr Pappeln als Häuser. Das Haus, in dem ich jetzt wohne1, war noch nicht, und die Straße, in der es steht, war noch nicht, und alle anderen Straßen um sie her waren auch noch nicht. Gärten waren da, mit kleinen, niedrigen, einstöckigen Häuschen und gemütlichen Leuten darin, denen man in die Fenster sehen konnte, wenn man vorüberging. Man konnte sie, bei der Lampe, rund um den Tisch sitzen und ihr Abendbrot essen sehen, welches ihnen in der Regel ausgezeichnet schmeckte. Still war es hier wie auf dem Lande; Wagen kamen selten, und Omnibusse gab es noch nicht. Aber Pappeln gab es, die schönsten und die größten, die man sehen konnte; alte Bäume, die zur Zeit Friedrichs des Großen gepflanzt und schon stattlich in die Höhe gegangen sein und eine hübsche Allee bilden mochten, als er, in seinen späteren Jahren, in seiner Kalesche von Potsdam nach Schöneberg und von Schöneberg nach Berlin fuhr. Saatfelder waren damals zu beiden Seiten der Pappelallee und Wiesen und Gräben, und etwas davon war noch übrig vor vierzehn oder fünfzehn Jahren, wiewohl das Saatfeld hier und da schon hinter Holz- und Kohlenplätzen verschwand, die Wiesen sich in Baugrund verwandelten und die Gräben in einen Kanal, auf welchem Torfkähne gingen und demnächst der erste Apfelkahn erschien.
Wo der Apfelkahn erscheint in Berlins Gewässern, da darf man auf eine Wendung der Dinge gefasst sein; heute noch ein einsames Zeichen der vordringenden Kultur, wird er morgen oder übermorgen von neuen Häusern, neuen Straßen, neuen Menschen umgeben und in dieser sich überstürzenden Menge des Neuen das einzige Ding sein, welches mit einem gewissen Ausdruck von Alter, Stabilität und Ehrwürdigkeit seinen Platz behauptet.
Indessen litt die Pappelallee vorläufig keinen Schaden; sie gewann sogar durch die Nähe des Wassers einen malerischen Reiz mehr, und da, wo sie in einer Art von spitzem Winkel auf den Kanal stieß, lag ein Garten, der von allen Gärten in dieser Nachbarschaft der merkwürdigste war. Es war nur ein kleiner Garten; aber einen großen Raum müsste ich haben, wenn ich all seine Eigenschaften beschreiben wollte. Er war dreieckig; man musste, wenn man von der Straße kam, ein paar Stufen hinabsteigen, und man hatte, wenn man darin war, die Vorstellung, nicht nur in einem tiefen, sondern auch in einem niedrigen Garten zu sein, wenn so etwas von einem Garten gesagt werden kann. Denn die Bäume wuchsen hier nicht in die Höhe, wie Bäume sonst zu tun pflegen, sondern sie waren, ich weiß nicht durch welche Kunst, in die Breite gestreckt worden, so dass sie den ganzen Garten mit einem Geflecht von Zweigen bedeckten, durch welches zwar der Regen, aber niemals ein Sonnenstrahl dringen konnte. Dennoch war es ein schöner Aufenthalt, und halbe Sommernächte lang habe ich darin gesessen.
Ich vergaß zu sagen, dass es ein Bier- und Kaffeegarten war; doch das werden die Leser wohl erraten haben. Wie wäre ich sonst in den Garten gekommen? Fliederbüsche wüchsen an den Ecken des Gartens und erfüllten ihn, zur Zeit der Blüte, mit ihren süßesten Düften. Auch ein Hügel erhob sich nach der Wasserseite hin über den lückenhaften Bretterzaun, der den Garten umgab; und hier, wenn die Jahreszeit und das Wetter es erlaubten, pflegte sich an jedem Nachmittage, präzis vier Uhr, ein kleiner Kreis von Damen zu versammeln, welche, sobald sie ihre Sitze eingenommen, unaufhörlich strickten und unaufhörlich miteinander redeten. Ich habe mich, in jenen Tagen, oft darüber gewundert, was sie mit all den Strümpfen anfangen und woher sie all den Stoff zu ihren Gesprächen nehmen könnten. Doch sie müssen es wohl gewusst haben, und auch ich gewöhnte mich zuletzt daran wie an irgendeine andere gegebene Tatsache des Lebens. Denn ich war, wie gesagt, ein regelmäßiger Besucher, ich darf sagen, ein Stammgast des Gartens und lernte allmählich die Gesichter der übrigen Gäste kennen und in gebührender Reihenfolge ihre Namen, ihren Stand, ihren Charakter und bis zu einem gewissen Punkte, soweit es sich auf den Garten bezog, ihre Geschichte.
Schon am Schritt, wenn er noch draußen in der Pappelallee war, unterschied ich den alten Major von dem alten Regierungssekretär, die beide den Garten liebten und an jedem Tag an demselben Tische saßen, ohne jemals ein Wort miteinander zu wechseln. Dennoch, obwohl sie sich nicht einmal grüßten, bestand ein höchst intimes, auf das feinste Maß gegenseitiger Achtung gegründetes Verhältnis zwischen diesen beiden. Beide trafen fast gleichzeitig auf ihren Posten ein, beide teilten brüderlich unter sich die Zeitungen des Lokals, beide fuhren mit demselben Ingrimme auf, wenn irgendein anderer, mit dieser ihrer berechtigten Eigentümlichkeit unbekannt, ihnen ein Blatt streitig machen wollte, und beide, nachdem sie ihre Lektüre beendet, ihren Kaffee getrunken und ihre Zeche bezahlt hatten, erhoben sich kurz nacheinander vom Tisch und gingen, wie sie gekommen waren. So habe ich sie jahrelang beobachtet und immer von einem Tag zum anderen Tag erwartet, dass sie sich anreden würden. Doch das geschah nicht, so dass ich, wenn ich die Damen auf dem Hügel, die den Faden niemals verloren, mit diesen beiden Herren verglich, die ihn trotz täglichen Beisammenseins nicht anknüpfen wollten oder konnten, zwei der größten Gegensätze der menschlichen Natur vor mir sah.
Ferner waren ein paar Schachspieler da, verhältnismäßig junge Männer, aber mit einer guten Aussicht vor sich, in ihrem Amt älter zu werden: nämlich zwei königliche Gerichtsassessoren; ferner ein hagerer, knochiger alter Mann, der einen dicken Schal um den Hals und einen Sommerhut trug und nach der Aussage des Kellners (mit dem er sich regelmäßig jeden Tag eine halbe Stunde lang unterhielt) ein berühmter Gelehrter sei – in welcher Wissenschaft, konnte mir der Kellner nicht sagen, aber ich vermutete damals in irgendeiner von den schönen Wissenschaften, der Ästhetik oder Philosophie; ferner ein dicker Metzger, der, wie ich aus dem Wohnungsanzeiger erfuhr, auf Wollanks Weinberg wohnte und alle Tage den weiten Weg in seiner Equipage2 machte, um hier, vor dem, was damals noch das Potsdamer Tor war, Kaffee zu trinken und die Gerichtszeitung zu lesen.
Ich muss bemerken, dass diese Gesellschaft, die sich während des Sommers im Garten versammelte, in das kleine Haus rückte, sobald der Herbst gekommen war. Dieses kleine Haus, in welchem die Wirtschaft betrieben wurde, war in seiner Art ebenso merkwürdig wie der Garten. Ich begriff damals nicht und begreife noch heute nicht, wie zwischen diesen vier Mauern alles Platz hatte, was sich wirklich darin bewegte: die Kellner, die Köchin, die Gäste und, um das Beste zuletzt zu nennen, die Wirtin. Das Etablissement befand sich nämlich in weiblichen Händen. Die Wirtin, eine Witwe in reifen Jahren, ließ sich im Garten selten sehen, so dass Besucher, die nur während des Sommers kamen, kaum eine Ahnung von ihrer Existenz gehabt haben mögen. Dagegen waltete sie mit umso größerer Sorgfalt im Hause, und wer in das Innere desselben zugelassen und nach einer gewissen Probezeit in das Vertrauen der Wirtin aufgenommen war, der konnte sich nicht beklagen; der saß wie in Abrahams Schoß3. Das Meublement4 war zwar von der einfachsten Sorte (ich wende mich von meinem biblischen Bilde wieder zurück zu der kleinen Gartenwirtschaft); die Stühle hatten weder Polster noch Strohgeflecht, sogar einer hölzernen Bank erinnere ich mich. Allein niemand verlangte etwas Besseres, jeder war damit zufrieden und dankte Gott, wenn er, am Abend eintretend, seinen Platz unbesetzt fand. In diesem Punkte jedoch verstanden die Gäste der Gartenwirtschaft keinen Spaß, und ich entsinne mich noch sehr wohl des Spektakels, welchen der Professor machte, als eines Abends ein blonder, schüchterner Jüngling, der die Gesetze des Instituts nicht kannte und eigentlich nur aus Irrtum hineingeraten war, auf seinem Stuhle saß; sonst aber ging es sehr friedfertig und ordnungsmäßig her, einen Tag und Abend wie den andern. Öllampen brannten in dem langen, niedrigen und schmalen Gemach, welches dicht an die Küche stieß und in welchem die Gäste ihr Abendbrot erhielten, dampfend, wie es vom Herde kam.
Hinter dem Kellner her, in den späteren Abendstunden, machte die Wirtin die Runde, und es war ein Vergnügen, sie zu sehen, wie sie hier einen Augenblick stehen blieb und dort sich einen Augenblick niederließ; wie sie mit einer ungezwungenen Vereinigung von Zutraulichkeit und Würde in ihrem Benehmen an jeden einzelnen das Wort richtete und allen gleichmäßig das Gefühl des Behagens zurückließ. Wir jüngeren Adepten ihrer Wirtschaft nannten sie »Mutter«, und eine Mutter war sie uns, bedacht für Speise und Trank und sonstiges Wohlbefinden, bewandert in allen Angelegenheiten unseres täglichen Lebens, zuweilen mit einer kleinen Aufmunterung und zuweilen mit einem leisen Tadel; eine stattliche Person in einem baumwollenen Kleide, den glattgestrichenen Scheitel schwarz, mit kaum einem Verdacht von vordringendem Weiß, und das Gesicht voll, mit just einem Anflug von Kupfer, jenem vertrauenerweckenden Zuge der Gastlichkeit.
Übrigens gab es auch ein einziges Sofa im Zimmer; es war mit großgeblümtem Kattun5 überzogen und nach stillschweigendem Übereinkommen für den weiblichen Teil der Gesellschaft reserviert. Denn auch Damen kamen in das Winterlokal des Gartens; besonders eine Dame mit zwei Töchtern, einem Paar der hübschesten Wildfänge, die ich je gesehen. Die Dame, eine würdige Matrone, hatte im Sommer ihren Ehrensitz auf dem Hügel, wo sie, umgeben von ihren Freundinnen, die Präsidentin des kleinen Damenklubs zu sein schien. Aber sie wich auch im Winter nicht, wenn der Hügel verödet war, wenn die Bänke und Tische im Garten übereinandergehäuft standen, wenn die Pappeln ihre Blätter umhergestreut hatten und auf ihren kahlen Ästen sich die Krähen wiegten. Da kam die Dame mit den beiden Töchtern in das Gastzimmer, und da war es, wo die kleine Familie mein ganzes Herz gewann. Sie waren die glücklichsten drei Menschen, die mir in meinem Leben begegnet; sie sahen sich niemals an, ohne vor Vergnügen zu lachen, und freuten sich ihres Daseins auf jegliche Weise. Diese unmotivierte Heiterkeit gab mir häufig Anlass zum Verdruss; denn manch eine Stelle in den Reden des Landtags (die damals noch nicht so interessant waren, wie sie heute sind) musste ich zweimal, ja dreimal lesen, wenn das Gelächter plötzlich erscholl. Und ich muss es bekennen! – kaum hatten die beiden Mädchen, die eine von zwölf, die andere von zehn Jahren, bemerkt, dass ich ein verdrießliches Gesicht machte, wenn sie lachten, als auch ihre gute Laune sich verdoppelte und die Ausbrüche ihrer Lustigkeit sich verdreifachten. Was diese beiden kleinen Mädchen mir an den Augen absehen konnten, das taten sie, um mich zu ärgern, mit Auf- und Zuwerfen der Türen, mit Herein- und Hinauslaufen, mit allem, was man einem ordentlichen und gesetzten jungen Manne nur zufügen kann, der den Zug nichtliebt und ungestört seine Zeitung lesen will. Und was mich noch am meisten ärgerte, das war, dass einer von den beiden Schachspielern, anstatt gemeinschaftliche Sache mit mir gegen die Störenfriede zu machen, sie vielmehr in ihren Tollheiten noch unterstützte und namentlich an dem älteren Wildfang – dem ärgsten der beiden – sein ganz besonderes Wohlgefallen zeigte. Ich zweifelte nicht länger an der traurigen Wahrheit, dass ich ein Hauptgrund des Vergnügens für die beiden kleinen Mädchen und eine Hauptanziehung ihrer Besuche sei; diese wurden immer regelmäßiger und immer länger, und zuletzt schien die glückliche Familie ganz in dem Lokal zu wohnen. Des Nachmittags, wenn ich meinen Kaffee trank, waren sie schon da, und am Abend, wenn ich zu Nacht speiste, waren sie noch da. Die Mutter, eine brave Frau, hatte nicht Zeit, sich um ihre Töchter viel zu bekümmern, denn neben ihr im Sofa saß immer eine oder die andere von den Matronen des Hügels, und am Mittwoch, Sonnabend und Sonntag spielten sie Whist6. Die beiden kleinen Mädchen fingen an, mir den Garten zu verleiden, und ich versuchte, demselben fernzubleiben. Aber damals gab es noch nicht so viele Restaurationen wie heute; man hatte keine Wahl, und außerdem – ich bin schwach genug, es einzugestehen – die beiden kleinen Mädchen fehlten mir! Man gewöhnt sich allmählich auch an den Ärger, und nach einer Woche war ich wieder da.
Den Jubel hätte man hören sollen! An dem Tage stand die Türe keinen Augenblick still, als ob mein Wiedererscheinen auf gar keine bessere Weise hätte gefeiert werden können.
Außerdem hatten die beiden kleinen Mädchen eine neue Attraktion in Gestalt jenes Apfelkahns entdeckt, der damals ungefähr zuerst Anker warf im Kanal. Nun waren die Äpfel an der Tagesordnung; Äpfel mit Wangen, so rot und blühend, wie die der beiden Mädchen. Alle möglichen Spiele mit Äpfeln und um Äpfel kamen aufs Tapet, sie warfen sich – und mitunter auch mich – mit Apfelschalen, und ich hatte bei meinem Weißbier Zeit, über dieses Symptom nachzudenken.
Doch nicht allzulange; höchstens zwei bis drei Jahre. Da blieb eines Tages das ältere der beiden Mädchen aus. Es ging mir ordentlich wie ein Stich durchs Herz, als die gemütliche Frau, zum erstenmal, seitdem ich sie kannte, nur mit der jüngeren ihrer Töchter hereintrat. Sie schien nicht weniger glücklich und zufrieden, als sie es vorher war; aber mir fehlte sie – mir fehlte das muntere Lachen meiner kleinen Feindin. Denn auch die Schwester war verstummt, seit die Spielkameradin verschwunden, und zu meinem Schrecken bemerkte ich, dass sie lange Kleider trage.
Um diese Zeit begannen die Veränderungen, welche aus der geschilderten Gegend das gemacht haben, was sie heute ist. Ein paar Pappeln wurden gefällt, ein paar Häuser wurden gebaut – scheinbar ohne Zusammenhang. Aber mehr Pappeln und mehr Häuser folgten, und der Zusammenhang stellte sich bald genug heraus: es war auf ein neues Stadtviertel und eine vollkommene Vernichtung der ländlichen Allee abgesehen, und wir armen Gartenbewohner lebten, sozusagen, nur noch auf Wartegeld. Ich kann nicht beschreiben, wie das von Tag zu Tag weiterging; aber wiederum nach ein paar Jahren, da sah man den Unterschied. Da sah man Straßen mit Namen, die man bisher nicht gekannt; riesenhohe Gebäude, zwischen denen sich der dreieckige Garten und das winzige Haus fast lächerlich ausnahmen. Von allen Pappeln waren nur noch drei oder vier übriggeblieben, welche den Saum des Gartens begrenzten; aber auch in jenem selbst bemerkte man den Einfluss der Zeit. An dem Tische der beiden Freunde, die niemals in ihrem Leben ein Wort miteinander gesprochen, saß nur noch einer; der andere war gestorben. Von den beiden Schachspielern war der eine in die Provinz versetzt worden, und der andere war immer noch Assessor7. Der reiche Metzger von Wollanks Weinberg brachte seinen Sohn mit, einen stämmigen Burschen von sechs Fuß Höhe; nur der Magister der freien Künste war unverändert derselbe, trug seinen Sommerhut im Winter und seinen dicken Schal im Sommer, ein wahrhaft tröstliches Bild der Philosophie, zu der er sich bekannte.
Die Dame mit der einen Tochter kam zwar noch. Aber die letztere war eine sittsame Jungfrau geworden, welche die Augen niederschlug und besonders, seitdem der Sohn des reichen Metzgers im Lokal erschien. Es hatte sich nämlich im Laufe der Begebenheiten zwischen dem Magnaten8 von Wollanks Weinberg und der Dame vom Fliederhügel eine stille Freundschaft gebildet, die sich unversehens auf deren Kinder übertrug; und auch räumlich rückten sich die beiden Parteien näher, als der Metzger den Entschluss gefasst, den Boden seiner Väter zu verlassen und eines von den schönen neuen Häusern in der Straße zu kaufen, die damals noch die Grabenstraße hieß und nachmals Königin-Augusta-Straße genannt wurde, zur Erinnerung daran, dass Ihre Majestät an schönen Winter- und Frühlingsnachmittagen hier zu promenieren liebte.
Diese Dinge und noch manche andere ereigneten sich, als ich eines Abends an dem Tische in der Sofaecke, in welchem jetzt regelmäßig der Metzger mit seinem Sohn und die gemütliche Frau mit der hübschen Tochter zusammensaßen, eine zweite junge Dame wahrnahm, die schönste, die sich jemals in diesem Lokale gezeigt. Sie war elegant gekleidet, in der Mode der damaligen Zeit, und sie war ein so liebliches und zierliches Geschöpf, dass man das Auge nicht von ihr abwenden konnte – was außer mir auch noch der ledige Schachspieler zu empfinden schien, der in der Tat in einer seltsamen Aufregung war. Mehrmals hatte ich die junge Dame heimlich angeblickt, ohne mich auf sie besinnen zu können, als sie plötzlich – der ci-devant-Metzger9 musste wohl eine besonders komische Geschichte zum besten gegeben haben – laut auflachte. An diesem Lachen erkannte ich sie – es war dasselbe fröhliche Gelächter aus der Kinderzeit, das mich damals so geärgert und heute mit einem süßen Reiz der Wehmut an den ersten Apfelkahn und die entschwundenen Jahre und die gefällten Pappeln erinnerte. Doch mitten in ihrem Gelächter hielt sie inne, die ältere der beiden Schwestern – ihr Blick streifte den vereinsamten Schachspieler, und sie errötete, was zur Folge hatte, dass auch er ganz rot wurde.
»Aha, Mutter«, flüsterte ich der Wirtin zu, die in diesem Augenblick die Runde machte, »daraus kann etwas werden!«
»Aber sie müssen sich beeilen, wenn sie’s in diesem Lokal noch fertigbringen wollen«, erwiderte sie, »ich habe den Garten verkauft. Übrigens ist sie jetzt ein reiches Mädchen – sehen Sie nur, wie sie sich trägt –, sie hat einen reichen Onkel beerbt, der sie auf seine Kosten hat erziehen lassen, und er (mit einem Blick auf den Schachspieler) ist seit gestern Stadtrichter.«
»Eins wäre genug gewesen«, bemerkte ich.
Aber die Wirtin zuckte die Achseln, indem sie sich mit den Worten entfernte: »Na, so ‘n Berliner Stadtrichter!«
Unter so glücklichen Auspizien10 habe ich die kleine Gartenwirtschaft zum letzten Male gesehen. Ich verließ Berlin für mehrere Jahre, und als ich von meinen Reisen heimkehrte und unterwegs, fast im letzten Augenblicke noch, beinahe Schiffbruch gelitten hätte, wie ich im Eingang dieses wahrheitsgetreuen Berichts erzählt habe, da war das kleine Wirtshaus niedergerissen, der Garten als Baustelle eingehegt, wie man ihn heute noch sehen kann, und nur noch eine von den drei Pappeln, die letzte, stand am äußersten Rande desselben. Oft von meinem Fenster aus habe ich nach ihr ausgeschaut; aus seiner Höhe herab hat dieser alte Baum jahrelang auf mich niedergeblickt, wenn ich bei der Arbeit saß, und mir gleichsam ermunternd zugenickt, wenn ich von derselben aufstand. Oft in der Dämmerung sah ich seinen Wipfel hin- und herbewegt vom Abendwind, und dann war’s mir ordentlich, als ob er leise spräche oder sänge – als ob Lieder durch seine starken Äste zögen, Liebeslieder, Wiegenlieder, Lieder von häuslichem Glück und Frieden. Wie ein Andenken aus alter Zeit und eine Verheißung der Natur, die immer weiter hinausgetrieben wird aus dem steinernen Umfange von Berlin, war mir dieser Baum. Ich habe ihn geliebt, wie keinen zweiten Baum in Berlin – und heute ist auch er nicht mehr.
Als ich heute meinen Morgenspaziergang machte, da lag er da, geknickt, abgebrochen vom Sturm. Viele Menschen standen um ihn her, um den zerstückten Stumpf, der noch in seinem Tode einen frischen Erdgeruch ausströmte. Unter vielen anderen erkannte ich auch die beiden schönen Schwestern – ansehnliche Frauen jetzt und von einem halben Dutzend Kinder umgeben, welche beladen mit Paketen und Schächtelchen vom Weihnachtsmarkte kamen. Ich hatte sie lange nicht gesehen und von ihrem ferneren Geschicke nichts erfahren; aber es freute mich, dass wir uns wieder trafen, gleichsam bei dem Begräbnis dieses Baumes, der in ihre Kinderzeit und meine Jugend gerauscht. Die eine hörte ich »Frau Stadtgerichtsrat« titulieren, so dass nicht nur an ihrer Identität, sondern auch an dem erfreulichen Avancement11 ihres Gatten, des mehrerwähnten Schachspielers, kein Zweifel war. Was die andere betraf, so war sie so rund und behaglich, dass ich sie von allen Männern der Welt keinem lieber gegönnt, als dem Sohne des Metzgers von Wollanks Weinberg, der sie denn auch seit Jahr und Tag die Seine nennt.
Jetzt kam auch noch der Philosoph in Schal und Sommerhut. Er sah sich das, was man wohl die Leiche des Baumes nennen könnte, einen Augenblick an, erkundigte sich nach den näheren Umständen des beklagenswerten Ereignisses und spendete dann den Leidtragenden den einzigen Trost, welchen seine Wissenschaft zu bieten hat, dass nämlich Pappeln und Menschen sterben müssten, wenn ihre Zeit gekommen. Damit ging er, und auch ich nahm bewegten Herzens Abschied von der letzten Pappel.
Sonntag vor dem Landsberger Tor
(Juni 1880)
Einer meiner liebsten Sonntagsspaziergänge ist vor dem Landsberger Tor. Ich weiß wohl, dass das nicht die fashionabelste Gegend ist; und ich würde wahrscheinlich in einige Verlegenheit geraten, wenn mir dort plötzlich ein Bekannter begegnete und mich fragen wollte: »Wie kommen Sie hierher? Was haben Sie hier zu tun?« Ich wüsste nicht, was ich ihm antworten sollte. Doch das ist es eben, was mich dorthin führt: die vollkommene Gewissheit, einem Bekannten auf jener Seite der Stadt nicht zu begegnen. Ich könnte nach Sizilien oder dem Nordkap reisen und würde dort Bekannte treffen; ich bin auf der Insel Skye, der äußersten der Hebriden, nicht vor Bekannten sicher. Aber wenn ich vor das Landsberger Tor gehe, dann bin ich ein Fremder unter Fremden.
Oder – nein doch! Diese Menschen, Leute mittleren Standes zumeist, etwas mehr nach oben, etwas mehr nach unten, aber immer ordentliche Leute, bürgerliche Existenzen von der guten und bescheidenen Art, sind mir nicht fremd. Sie kennen mich nicht; ich aber kenne sie. Es macht mir das größte Vergnügen, sie zu beobachten, mit einem harmlosen Blick; an einem Tische mit ihnen zu sitzen, ein Wort aus ihrem Gespräch aufzufangen, ohne doch indiskret zu sein. Was gehn mich ihre Familienfreuden oder Sorgen, ihre häuslichen Feste oder Kalamitäten12 an? Was kümmert’s mich wohl, ob die dicke Bäckersfrau zu meiner Rechten morgen gutes oder schlechtes Wetter für ihre Wäsche haben und ob der ehrenfeste Mann, der zu meiner Linken nachdenklich hinter dem Glase sitzt, den Prozess, welchen er gegen einen halsstarrigen Nachbar führt, gewinnen oder verlieren wird? Und doch fühle ich mich auf eine gewisse zutrauliche Weise in ihre Geheimnisse eingeweiht und nehme den lebhaftesten Anteil daran. Es tut mir wohl, das Leben einmal von einer anderen Seite zu betrachten, als wir es im Westen der Stadt zu sehen gewohnt sind; unter solchen zu sein, welche sich niemals von den Angelegenheiten und Neuigkeiten der feinen Welt unterhalten, niemals einen von den Namen in den Mund nehmen, ohne welche wir uns kaum ein Gespräch denken können, und trotzdem ganz respektabel aussehen, ganz zufrieden sind und ihren Sonntag feiern, dass es eine Art hat.
Schon wenn ich in den Omnibus steige, der in die Richtung gegen Osten fährt, bin ich halb und halb unter meinen Leuten. Nicht am Wochentag: denn der mit seiner mannigfaltigen Geschäftigkeit wirft alles durcheinander, Nord, Süd, Ost und West. Aber am Sonntag ist es etwas anderes; da sieht man keine Frauen mit Taschen oder Körben, keine Männer mit Kasten oder Handwerksgerät. Wer am Sonntag fahrt, der fährt zu seinem Vergnügen, entweder er will einen Besuch machen, oder er kehrt von einem Besuch zurück, wie der junge Schlossermeister aus der Krautstraße, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern den Fond13 des Wagens einnimmt. Diese Leute reisen immer in großer Familie, aber sie nehmen aus Sparsamkeit so wenig Platz als möglich ein: der Mann hat das kleine Mädchen und die Frau hat den kleinen Jungen auf dem Schoß; sie sind bei Freunden in einer der neuen Straßen in der Nähe des Botanischen Gartens gewesen, haben die Taschen voll Kuchen und fahren nun recht fröhlich dahin durch die schönen Straßen und über die breiten Plätze des Westens von Berlin, die ihnen wie ein Wunder vorkommen (sie sind nämlich gebürtig aus Neuruppin; ein richtiger Berliner, und wenn er auch am Verlorenen Weg wohnte, wo noch so gut wie gar keine Häuser stehen, würde sich nicht wundern). Ich bin mit meinen Neuruppinern aus der Krautstraße noch nicht bis an den Dönhoffplatz gekommen, so kenne ich ihre ganze Geschichte, einschließlich der Geschichte der beiden Kinder. Es nimmt mich übrigens für das tüchtige Ehepaar ein, dass weder er noch sie mir ein Hehl machen aus den weniger lobenswerten Eigenschaften ihrer Sprösslinge: das kleine Mädchen sei immer neidisch auf den kleinen Jungen – eine Bemerkung, die allerdings durch die Tatsache bestätigt wird, dass die beiden winzigen Geschöpfe wieder Krieg angefangen haben und aufeinander losschlagen wegen eines Brezels, den der kleine Junge gerade in den Mund stecken will. Die Mutter, die den Frieden liebt, beschwichtigt das kleine Mädchen, indem sie die Hälfte des Kuchens ihm gibt. Aber diese Gewalttat empört wiederum das Herz des kleinen Jungen. Erst ist er still, dann gibt er einen Schrei von sich, dann noch einen und noch einen, und so fort, als ob er heute nicht mehr aufhören wolle. »Auf diese Manier schreit er manchmal die halbe Nacht durch«, sagt die bekümmerte Mutter; und man sieht es ihrem schmalen, überwachten Gesichtchen wohl an, dass sie die Wahrheit sagt. Wieder ein Zug, der mir an dem Papa gefällt: Er nimmt in seinem Herzen Partei für den Jungen, will’s ihm aber nicht zeigen, wegen der Mutter. »Er hat ja so recht«, sagt er, und dabei versetzt er ihm eins auf die Knöchel, dass der kleine Schreier (der diese Sorte von Liebkosungen wohl kennt) augenblicklich verstummt. Über dem Kopf seines Jungen aber sieht der Mann seine Frau mit einer triumphierenden Miene an, die zu sagen scheint: »Na, warte man! Wenn der erst groß ist! Der lässt sich auch nichts nehmen, was er einmal in der Hand hat!«
Am Mühlendamm steig ich aus; der Wagen fährt rechts, und ich gehe links. Dort drüben am Rande des weiten Beckens, welches hier die Spree bildet, liegt Neukölln, Neukölln am Wasser. Die Nachmittagssonne spiegelt sich in der schillernden Flut und beglänzt am Ufer die friedlichen Häuser – auch das darunter mit der breiten, schweren Fassade und dem massiven Torweg. Das Haus ist mir wohl bekannt, und in seinen dunklen gewundenen Gängen bin ich manchmal gewesen. Der alte Herr Grandidier14 hat dort gewohnt. Aber jetzt steht es einsam, andre Leute wohnen darin, und seine Fenster, die von der Sonne leuchten, winken mir nicht mehr. Die Herren vom Mühlendamm aber sind noch immer dieselben. Die haben zweimal Sonntag in jeder Woche, Sonnabend und Sonntag, und der Sonntag ist für sie der bessere Tag. Da dürfen sie noch obendrein rauchen. Sie sitzen vor den halbgeöffneten Türen ihrer Läden, aus alter Gewohnheit. Denn Geschäfte können sie nicht machen. Die schönen Uniformen mit den blanken Knöpfen, die goldbetressten Livreen15 und die Schlafröcke mit dem roten Unterfutter ruhen in der Verborgenheit. Aber eine Gardine wenigstens ist herabgelassen mit der Inschrift in großen Buchstaben: »Hier werden Fräcke verliehen«. Unter den steinernen Bögen der Arkaden ist es hübsch kühl, da sitzen sie wie vornehme Herren, die sich’s wohl einmal antun dürfen, mit dem Hut auf dem Kopfe und mit Pantoffeln an den Füßen und einer Miene von Weltverachtung, die ich nur an Sonntagnachmittagen an ihnen bemerkt habe.
Der Molkenmarkt liegt in tiefem Schatten, und Sonne ist nur an den grauen Mauern jenes Hauses16, in welches – glaub ich – die Sonne niemals hereinscheint. Oder ist eine von den vergitterten Zellen, in diesen eng umbauten Höfen, in welche von oben her zuweilen eine Botschaft des Lichtes dringt? Die Haupteinfahrt ist geschlossen, als ob auch das Verbrechen noch einen Rest von Scheu vor dem Sonntage hätte; durch einen halbgeöffneten Seiteneingang sieht man den Posten im Hofe schildern, und lässig auf der Treppe steht einer von den »Blauen«, wie die Schutzleute in der Sprache derjenigen heißen, die in beständigem Krieg mit ihnen leben. Sonntagnachmittag in einem Gefängnis – Sonntagnachmittag auf dem Molkenmarkt ... lass uns weiter wandern, lieber Leser.
Hier ist die Spandauer Straße, und hier leuchtet uns nach wenigen Schritten schon das Rathaus in all seiner Herrlichkeit entgegen, der Stolz des Bürgertums von Berlin. Das Rot dieses mächtigen Vierecks, flimmernd von Sonne, zeichnet sich wundervoll gegen den blauen Himmel ab, und sein Turm, ganz in Licht gebadet und golden angehaucht in dieser Stunde, steht recht wie ein Wahrzeichen da, nach dem der Wandrer sich richten kann. Er grüßt ihn, wenn er sich dem Zentrum der Stadt nähert, ihrem Herzen und belebten Mittelpunkt; und sein rötlicher Schein bei Tag, seine erleuchtete Uhr bei Nacht sind ihm lang noch erkennbar, wenn er sich gegen Osten oder Norden entfernt.
Heut ist die Königstraße still. Die Läden sind geschlossen und die Häuser wie ausgestorben. Nur sonntäglichen Spaziergängern begegnen wir. Aber wie sehr dies Berlin eine wachsende Stadt ist, eine Stadt, die sich beständig verändert, verschönert, vergrößert, das sieht man auch am Sonntag, wenn die Arbeit ruht. Die Königskolonnaden und die Königsbrücke sind noch da, ein bewundertes Werk aus der Zeit Friedrichs des Großen; aber die Sandsteinfiguren und die jonische Säulenlaube, die so schön waren, als sie noch rein und weiß waren, sind inzwischen ganz verwittert, unter der Brücke ist kein Wasser mehr, und sie selber wird auch bald nicht mehr sein. Auf dem trockenen Bette des weiland Königsgrabens erheben sich die Strukturen eines anderen Werkes, der Stadtbahn, welche so recht im Geist der neueren Zeit rücksichtslos fortschreitet durch unsere Straßen, zerstört, was ihr im Wege ist, und bald mit ihrem steinernen Ring uns umschlossen haben wird; auch eine Stadtmauer, aber eine andere, als die einst hier gewesen, eine, auf der Leben und Bewegung ist, die den Verkehr beschleunigt, welchen jene gehemmt hat. Oh, über die gute, alte Zeit, wo jeder noch seine Bequemlichkeit und seine Ruhe hatte! Wo das, was man jetzt die allgemeine Wohlfahrt nennt, den einzelnen noch nicht verhinderte, an die seine zu denken! Wo noch nicht so viel Menschen auf der Welt waren und diejenigen, die darauf waren, noch nicht so viel Lärm machten! Wo noch Ruhe war in den Straßen und Gemütlichkeit in den Häusern! Wo noch kein Gerassel von Omnibussen war und kein Geklingel von Pferdebahnen, keine Kanalisationsarbeit, welche jahrelang bald hier, bald da die Stadt aufwühlt und in tiefe Gruben und unübersteigliche Sandberge verwandelt.
Wer damals, vor hundert und etlichen Jahren, seinen Sonntagnachmittagsspaziergang hierher gemacht hätte, der würde noch keinen Alexanderplatz gesehen haben, sondern die Contreskarpe17 war da, und der Stelzenkrug18 war da, und ehrsame Bürger waren da, welche mit einem dreieckigen Hut und einem langen Zopfe, die tugendfesten Ehehälften am Arme, zu den umliegenden Gärten lustwandelten. Bedächtig war ihr Schritt und sauer der Wein, der sie dort erwartete; billig das Leben, geräumig ihre Stadt und die Zeit so wohlfeil wie ein gutes Abendessen, welches – wenn es aus drei wohlgekochten Gerichten, mit Butter und Käse, bestand – nach unserm Gelde 1 Mark 20 Pfennige kostete. Das einzige, was zu der Zeit teuer war, waren die Briefe, indem zum Beispiel ein Brief »ins Deutsche Reich« (muss bis Duderstadt19 frankiert werden) vierzig und einer nach Elsass und Lothringen sogar siebzig Pfennige kostete. Da sieht man, wie die Zeiten sich geändert haben. Außer Briefschreiben gibt es jetzt kein billiges Vergnügen mehr auf Erden; und dazu hält manch einer das noch nicht einmal für ein Vergnügen. Diese braven Philister und Pfahlbürger aber wussten, was sie taten: sie schrieben Briefe so wenig als möglich, aßen zu Abend so viel als möglich und dankten ihrem Schöpfer, dass er alles so herrlich eingerichtet habe. Vielleicht kam um diese Zeit aus einer Nebenstraße, »der Kaie längs dem Graben linker Hand«, ein Mann in der Mitte seiner Dreißig, in Kniehosen, mit einem göttlich frohen Gesicht, welches gleichsam noch glühte von dem Widerschein schöner Gedanken wie der Himmel über ihm von dem warmen Gold der Junisonne. Dieser Mann, wenn er Wein trinken wollte, ging nicht in die Gärten vor dem Tore der Stadt, sondern er begab sich in ihr Inneres. Denn er verstand sich auf einen guten Tropfen und liebte die gute Gesellschaft, und beides fand er bei Maurer in der Brüderstraße, wo die »Quartbouteille20 guten Pontac« zehn Silbergroschen und die BouteilleChampagner einen Taler kostete. Gute Zeit, glückliche Zeit, wo Lessing seine »Minna von Barnhelm21« schrieb und die Flasche Champagner einen Taler kostete! Die »Kaie längs dem Graben«, heute »Am Königsgraben« genannt, bestand damals aus lauter neuen Häusern; die sind inzwischen alt geworden, wo der Graben war, ist die Stadtbahn, und die Berliner Dichter, wenn sie just auch keine Stücke mehr schreiben wie Lessing, werden sich doch wohl hüten, da zu wohnen, wo er gewohnt hat.
Hier aber beginnt meine Gegend. Wo Lessing vorübergeschritten, rasselt ein Kremser22 aus Friedrichsfelde träge heran und stellt sich an dem Springbrunnen auf. Hier in Sonne getaucht, dort in Schatten gelagert, liegt der Alexanderplatz, und vor mir öffnet sich die Landsberger Straße. Keine neue Straße, nach dem heutigen Begriffe; jedoch auch keine sehr alte. Denn was ist alt in Berlin, wirklich alt, außer ein paar Kirchen? Die Landsberger Straße führt mitten hinein in die Königstadt23, und gleich links von ihr liegt ein Stück echten, alten Berlins, welches mit seinen Erinnerungen, wenn nicht mit seinen gegenwärtigen Gebäuden, weit in das Mittelalter zurückreicht: der Georgenkirchhof. Noch in der ersten Zeit des Großen Kurfürsten war hier nichts als diese Kirche, ein Kapellenbau aus dem 13. Jahrhundert, ein Pesthaus, nicht weit davon das Hochgericht, dazwischen einige Häuser, die Keimpunkte gleichsam und Ansätze künftiger Straßen, und ringsumher offenes Feld, Kornfeld und Heide, Gärten, Weinberge, Meierhöfe, ländliche Besitzungen in großer Zahl. Das Grün und der Wein und die Blumen, sowohl Flieder als Rosen, sind längst aus dieser Nachbarschaft verschwunden, in welcher jetzt eine fleißige Bevölkerung von Handwerkern wohnt; aber das Andenken an jene Tage des Wohlgeruchs und der Heckenwege lebt in den Namen des Grünen Wegs, der Wein-, der Blumen-, der Flieder- und der Rosenstraße fort. Damals war noch der heilige Georg der Schutzpatron dieser Gegend; nach ihm hieß das Hospital und die Kirche, welche Mitte des 17. Jahrhunderts völlig außerhalb der Stadt lagen: »Domus Sti. Georgii extra muros24«. Auf einem Plane der Stadt aus dem letzten Regierungsjahre des Großen Kurfürsten (1688) bemerkt man jedoch schon einige Bauten; in der Tat, seit dem Frieden von St.-Germain25 bevölkerte sich der Grund und Boden um die Kirche des heiligen Georg, und die entstehende Vorstadt ward nach ihm genannt: die St.-Georgen-Vorstadt. Aber die Häuser stehen noch in weiten Zwischenräumen, hier eins und dort eins, umgeben von großen Gärten; eine Landstraße führt hindurch, auf dem Plane bezeichnet als »Straße nach Landsberg«, und den Hintergrund schließen Sandhügel ab, so wie der Kreuzberg heute noch ist, nur breiter, ausgedehnter, den ganzen Horizont begrenzend, und mit vielen Windmühlen besetzt.
Nun aber kommt der Tag, wo der Sohn26 des Großen Kurfürsten sich feierlich zu Königsberg27 die Königskrone auf das Haupt setzt28, der 18. Januar 1701, und der andere Tag, der 6. Mai desselben Jahres, wo König Friedrich Wilhelm I. seinen Einzug hält durch das Georgentor, die Georgenstraße, die Georgenvorstadt. Vor dem jungen königlichen Glanze muss der heilige Georg weichen: das Georgentor wird seit jenem Tage das Königstor, die Georgenstraße die Königstraße und die Georgenvorstadt die Königstadt. Aber noch immer nennt sich nach ihm diese Parochie29 die Georgengemeinde, und sein Bild, ein güldner Reiter auf einem güldnen Rosse, sitzt hoch über der St.-Georgen-Apotheke in der Landsberger Straße. Den Namen dieser Straße, welche von allen anderen Straßen der ehemaligen Georgenvorstadt das Andenken ihres alten Heiligen so gut in Ehren hält, finden wir zuerst auf einem Plane aus dem Jahre 1710. Die gegenwärtig so beträchtlich lange Straße war damals noch recht kurz: Sie reichte nicht weiter als ungefähr bis zur heutigen Kleinen Frankfurter Straße. Jedoch für die Bewohner, die sich hier allmählich angesiedelt, war die St. Georgenkirche schon zu klein geworden: Wir müssen sie uns etwa denken wie die Gertraudenkirche30 auf dem Spittelmarkt, die Spittelkirche, die wir ja alle so wohl kennen, die verurteilt ist, vor der großen Berliner Pferdebahn zu sterben und die wir alle vermissen werden, wenn sie einmal nicht mehr da sein wird, obgleich sie nur ein winziges hässliches Ding ist.31Schöne Kirchen haben diese Köllner und Berliner der vorhohenzollernschen Zeit überhaupt nicht gebaut, große auch nicht. Wie konnten sie wissen, diese Fischer und Bauern, dass Berlin noch einmal etwas vorstellen werde! Glücklicherweise war viel Platz da; der war billig zu jener Zeit und ist es lange geblieben. Als ihnen die Kirchen zu klein wurden, rückten sie vor die Kirchen: Auf dem Spittelmarkt, der damals der Gertraudenkirchhof war, da, wo jetzt die intenduhr32 steht und die Schöneberger Omnibusse halten, ward jeden Sonntag mittags zwölf Uhr unter freiem Himmel gepredigt, auf dem Heiligengeist-Kirchhof standen drei Linden, unter denen man den Gottesdienst zelebrierte, und auf dem Georgenkirchhof waren eine Kanzel, Kirchenstühle und ein Chor errichtet. Erst unter Friedrich dem Großen war die Kirche gebaut, die wir heute sehen und deren Front die Jahreszahl trägt: »1779«.
Abbildung 2, Spittelmarkt, Anfang des 20.Jahrhunderts
Abbildung 3, der Spittelmarkt, 2012
Inzwischen war aber auch die Landsberger Straße nebst den umgebenden Straßen beträchtlich gewachsen; es waren just keine schönen Häuser, die man all hier erbaute, als alles umher noch plattes Land war; sie haben etwas vom märkischen Bauernhause, das mit dem behäbigen der gesegneteren deutschen Landstriche sich nicht messen kann, und nicht wenige von ihnen, in ihrem gegenwärtigen verwitterten Zustand und Verfall, sind noch schlimmer – Reste der Vergangenheit, denen man noch vielfach in Berlin begegnet, deren Fortexistenz man aber umso weniger begreift, als der Grund und Boden, den sie einnehmen, inzwischen so beträchtlich mehr wert geworden sein muss als die Gebäude selbst. Nichts kann unwohnlicher und weniger einladend sein als die langgestreckten Lehmhäuser dieser Art, die den Wanderer, bis in den Tiergarten hinein, daran erinnern, dass Berlin nicht immer die Stadt der Paläste gewesen, als die es uns heute erscheint. Niedrig, finster, mit nur einem Stock oder vielmehr Erdgeschoss mit vergitterten Fenstern, mit halb zugemauerten Fenstern, manchmal mit gar keinen Fenstern, sondern viereckigen Löchern, wie in einem Stall, stehen sie da, mit einer Miene von Trotz und Unabhängigkeit, zwischen den neueren Häusern, welche sie zu verdrängen keine Macht haben. Ob heute noch Leute darin wohnen? Ich glaube ja; und mehr als das: an einem derselben in dieser Gegend zum Beispiel habe ich ein Schild mit der Inschrift gesehen: »Salon für kleine und große Gesellschaften«. An einem andern, hinter dem übrigens sich ein weiter Hof befand, las ich: »Elegante Brautwagen, Chaisen33 zu Festlichkeiten«. Das muss ein fideles Volk sein in diesen miserablen Spelunken, die man hier in den Haupt- und Nebenstraßen noch überall erblickt.
Deutlicher, weniger fragmentarisch als in den meisten anderen Straßen Berlins meine ich in den einzelnen noch unterscheidbaren Stücken dieser Landsberger Straße, wie sie sich im Verlaufe von fast anderthalbhundert Jahren aneinandergefügt haben, den Fortschritt der Bauweise zu erkennen, von jenem Hause der äußersten Armseligkeit angefangen, aus welchem ehemals ganze Straßen bestanden, das sich aber jetzt nur noch in einzelnen Exemplaren erhalten hat. Von den Zwangsbauten Friedrich Wilhelms I., der, wie man weiß, »den Häuserbau gar sehr poussieret«, ist hier freilich nichts zu bemerken, weder im nüchtern bürgerlichen noch im Prunkstil; denn dieser König dehnte seine Spaziergänge, deren jeder seine getreuen Untertanen ein Haus kostete, nicht so weit aus, sondern beschränkte sich auf die Friedrichstadt34. Dagegen erblickt man hier manch ein hübsches Muster des dezenten Wohnhauses aus der späteren friderizianischen Zeit35, das sich heute noch zwischen seinen Nachbarn ganz freundlich ausnimmt und, ein- oder zweistöckig, mit seinem bescheidenen Zierrat von Blumen und Figuren in Stuck an den Wänden lange das typische geblieben zu sein scheint, bis das doppelt so umfangreiche der Regierungen Friedrich Wilhelms III. und IV. mit seinen drei Stockwerken erscheint und dort endlich, wo die Landsberger Straße sich breit und prächtig gegen die Friedenstraße öffnet, die mächtigen Gebäudekomplexe aufragen, welche charakteristisch für Berlins jüngste Entwicklung sind. –
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts war die Landsberger Straße schon bis zur Gollnowstraße vorgerückt. Darüber hinaus waren Gärten und Weinberge. Was die Gärten betrifft, so sind sie langsam erst in neuerer Zeit unter dem vordringenden Häuserbau verschwunden. Hier herum, in dieser damals ganz ländlichen Gegend, hatten vor hundert Jahren viele Berliner ihre Sommerwohnungen. Nicht weit von hier, nach dem Frankfurter Tore hin, in dem, was zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Lehmgasse war und heute die Blumenstraße heißt, hatte Lessings Freund, Friedrich Nicolai, sein Landhaus, welches der Enkel36 des trefflichen Alten in seinen »Jugenderinnerungen«37 so reizend und pietätvoll beschreibt. Die Blumenstraße erhielt ihren gegenwärtigen Namen nach den vielen Gärtnereien, die zu beiden Seiten hinter sehr primitiven Gartenzäunen in kleinen, bescheidenen Häusern angelegt waren; und noch in den zwanziger Jahren war es hier so still und einsam, dass man nach Sonnenuntergang kaum einen Menschen zwischen den dunkelen Hecken mehr antraf. Das holperige Steinpflaster und das Öllampenlicht reichten nur bis an den Grünen Weg – »der sternenklare Himmel glänzte über den stillen Gartenbäumen, und der Geruch der Bouchéschen Hyazinthenbeete wallte durch die kaum bewegte Luft«. Die Familie Bouché – heute noch eine illustre Gärtnerfamilie der französischen Kolonie – war hier allein durch vier bis fünf Mitglieder vertreten. Der Grüne Weg – jetzt eine sehr lange, vom Kleingewerbe bevölkerte, verkehrsreiche Geschäfts- und Fabrikstraße – ganze Strecken weit liest man Schild an Schild: »Wollenwaren, Châles und Tücher« – war damals, vor sechzig Jahren, wirklich noch ein schmaler, von Bretterzäunen eingefasster »Weg«, in dem kein Haus, aber auch nichts »Grünes« war, denn sogar das Unkraut wuchs daselbst spärlich. Wo jetzt die Häusermassen des Stralauer Viertels38 und der Luisenstadt39 einander an der Spree begegnen, waren damals auf dem rechten Ufer die Gärten, die wir Älteren teilweise noch gesehen und ebenso gut gekannt haben, wie den Sand und die dünnen Getreidefluren des Köpnicker Feldes40 auf dem linken. Aber an die Weinberge zu glauben fällt mir schwer. Ich habe niemals recht daran geglaubt, dass in diesen Weinbergen, von welchen in den alten Büchern fortwährend die Rede, wirklich Wein gewachsen ist. Doch muss dem wohl so gewesen sein, da der alte Friedrich Nicolai – der, was er sonst auch pekziert41, doch nicht gelogen hat – in seiner Beschreibung Berlins erzählt, dass in dem ehemals Feldmarschall-von-Derfflingerschen Weinberg, der in der Landsberger Straße lag, Anno 1740 die Weinstöcke erfroren seien. Was mich wundert, ist, dass sie nicht schon früher erfroren sind. Sollte man sich nicht unter den Himmel Italiens, in die lachenden Ebenen des Po oder in die gesegneten Gefilde der Brianza versetzt meinen, wenn man fortwährend von diesen crève-cœurs42, den Berliner Weinbergen unterhalten wird und ein paar Seiten weiter im Nicolai sogar noch liest, dass vor dem Landsberger Torrechter Hand eine Maulbeerplantage gewesen? Jetzt sind daselbst nur die Stallungen der Berliner Omnibusgesellschaft, und das scheint mir auch das rechte Ding für den rechten Platz zu sein. Hat Berlin sich wirklich so verschlechtert, oder fehlt es uns nur an dem Glauben, der bekanntlich Berge versetzt und es darum auch wohl mit Weinbergen und Maulbeerplantagen aufnehmen kann? Glückliche Vorväter! Sie bauten ihren Wein, sie spannen ihre Seide, und sie krochen hernach vergnügt in ihre kleinen Parterrewohnungen, die halb unter der Erde waren.
Ein Hauch des Altertümlichen schwebt um diesen Georgenkirchplatz, besonders an einem Sonntagnachmittag, wenn hier kein Durchgang und Verkehr ist, wenn die Kinder auf dem Rasen spielen und die alten Leute, welche nicht mehr von Haus gehen, auf den Bänken sitzen oder ein Genesender aus einem Fenster des Hospitals zu St. Georg43 dankbar in die Abendsonne schaut, deren immer mehr nach oben entschwebender Strahl jetzt an den beiden gegenüberliegenden Häusern die Worte funkeln lässt: »Kornmessersches Waisenhaus44«, »Rückersche Stiftung«. Mit dem Frieden der Kirche in der Mitte und der Ruhe des Sonntags und der Fröhlichkeit der Kinder und dem Geruch des frischen Grüns ringsum mischt sich ein Gefühl wie von der Nähe guter, hilfreicher Menschen, das in der Luft zu liegen scheint und so wohl zu dieser Stätte passt, die den Kranken, den Armen und den Waisen von jeher gewidmet war. Wo aber, in ganz Berlin, würde man nicht immer und immer wieder von diesem Gefühl ergriffen? Wenn man nur aufmerken will, wird man fast in jeder Straße den Spuren der Wohltätigkeit und des Erbarmens begegnen. Manchmal, wie in der Großen Frankfurter Straße, sieht man in einer einzigen langen Reihe, Haus bei Haus, diese Anstalten für alte und kranke Mitmenschen – und ich erinnere mich wohl der Zeit, wo sie ganz in Grün und Schatten standen, als das, was jetzt die »Große Frankfurter Straße« heißt, die »Frankfurter Linden« waren – wie die Straße heute noch vom Volke, das in solchen Dingen hartnäckig ist, und auf den Schildbrettern der dorthin fahrenden Omnibusse genannt wird, obwohl dort lange keine Linden mehr stehen. Sie wurden 1872 gefallt. Aber ich habe sie noch gesehen, diese hundertjährigen Bäume, Pappeln und Linden, welche der Gegend etwas so Friedliches gaben; und sie fehlten mir sehr, als ich nach Jahren wiederkam. Jedoch die Häuser, die sie vormals mit ihrem ehrwürdigen Laubdach schirmten, sind auch heute noch da – hoch, luftig, geräumig; meist Stiftungen verstorbener Bürger und vielfach solcher, die sich emporgearbeitet, Selfmademen, die für ihre ehemaligen Handwerks- und Standesgenossen in dieser fürstlichen Weise gesorgt haben. Die Grundeigenschaft des Berliner Herzens ist Güte: nicht jene schwächliche, die sich irgendetwas gefallen oder nehmen ließe, nein – da fällt mir mein kleiner Berliner aus dem Omnibus wieder ein –, sondern jene tatkräftige, die zu handeln bereit ist: ein offnes Herz und eine offne Hand. Kein Verschwender, ein vorsichtiger Rechner ist der Berliner, ein Quengler und Mäkler um jeden Pfennig, sei es in der Stadtverordnetenversammlung, sei es mit seinem Droschkenkutscher. Ein sparsamer Mann; aber manch ein enormes Vermögen oder Teil eines Vermögens, das er auf solche Weise rechtschaffen erworben, geht als milde Stiftung in das Eigentum der Stadt über, wenn er seine Tage beschließt. In einer solchen Stadt ist gut leben; denn man ist sich am Ende doch bewusst, selbst in dieser ganz modernen Zeit und mit all ihren Auswüchsen, unter braven Menschen zu sein – und der Mensch ist die Hauptsache, nicht die Zeit. Das ist es, was mich auf diesen meinen Wanderungen durch die Stadt so sehr anmutet: überall Menschen zu finden, mit denen sich ein trauliches Wort tauschen und im Vorübergehen reden lässt, ohne dass man voneinander zu wissen braucht mit den gesellschaftlich vielleicht unter uns Stehenden auf eine Weile zu verkehren, am Alltag sie bei ihrer Arbeit zu sehen und am Sonntag bei ihren harmlosen Vergnügungen, mich an einen Tisch mit ihnen zu setzen und selbst aus den Werken und Hinterlassenschaften der Verstorbenen eine Stimme zu hören, die mich nicht unbewegt lassen kann.