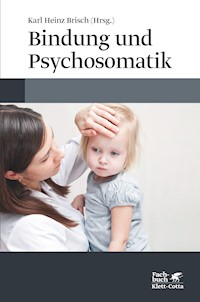
Bindung und Psychosomatik E-Book
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Schwangerschaft und die frühkindliche Erfahrung eines Menschen, insbesondere die Qualität seiner Bindungsbeziehungen, wirken nachhaltig bis ins Erwachsenenleben und stehen häufig im Zusammenhang mit psychosomatischen Erkrankungen. Die Autorinnen und Autoren stellen in diesem Band das Wissen um das Zusammenwirken von Körper, Seele, Geist und Umwelt dar. Einzelne Themen sind u.a. - Die Rolle der Gene bei der Entstehung psychosomatischer Erkrankungen - Die Rolle des Hormons Oxytocin - Bindung und traumatische Erfahrungen bei chronischen Schmerzen, Stress, Anorexie und ADHS - Bindungssicherheit und die Gesundheit des Herz-Kreislauf- Systems - Wege zur erfolgreichen Prävention psychosomatischer Störungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bindung und Psychosomatik
Herausgegeben von Karl Heinz Brisch
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Roland Sazinger, Stuttgart
Unter Verwendung eines Fotos von © NatUlrich / Fotolia.com
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94867-7
E-Book: ISBN 978-3-608-10754-8
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20255-7
Dieses E-Book entspricht der 1. Auflage 2015 der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Felix TretterBindungsforschung, Psychosomatik und ökosystemische Medizin
Arnold SameroffDiskontinuität: Ein Potential auf dem Weg in eine positive Zukunft Versuch einer integrativen Entwicklungstheorie
Christian SchubertPsychoneuroimmunologie über die Lebensspanne: Frühkindliche Traumatisierung und Entzündungserkrankungen im Erwachsenenalter
Kerstin Uvnäs-MobergBindungsunsicherheit und unzureichende Funktion des Oxytocin-Systems
Nevena VuksanovicTraumatische Erfahrungen, Stress und ADHS Was können wir von der Neuroendokrinologie lernen?
Egon GarstickDer Verlust der Bindung zum eigenen Körper in der Anorexie Wiederbelebungsversuch einer »eingebrochenen« bio-psycho-sozialen Adoleszenzentwicklung im interdisziplinären Behandlungsteam
Lachlan A. McWilliamsBindung und chronischer Schmerz Neue Ansätze in Forschung und Therapie
Ulrich T. EgleBindung und Schmerz Psychosomatische Behandlung des Fibromyalgie-Syndroms (FMS)
Robert G. Maunder, Gary E. Newton und Robert P. NolanBindungsunsicherheit, Regulation des autonomen Nervensystems und kardiovaskuläre Gesundheit Eine Studie zum Bindungsmuster erwachsener herzkranker Patienten
Karl Heinz BrischPsychosomatik, Bindung und Trauma in der Kinderklinik
Adressen der Autorinnen und Autoren
Vorwort
Am 12. und 13. Oktober 2013 wurde von der Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie am Dr. v. Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München eine internationale Konferenz mit dem Titel »Bindung und Psychosomatik« (»Attachment and Psychosomatics«) durchgeführt. Das Interesse an dieser Konferenz und die positiven Rückmeldungen waren für den Veranstalter außerordentlich ermutigend, so dass er die Beiträge dieser Veranstaltung mit der Herausgabe dieses Buches einer größeren Leserschaft zugänglich machen möchte.
Die Thematik des vorliegenden Konferenzbandes umfasst eine Vielzahl von Aspekten aus dem Bereich »Bindung und Psychosomatik«. Heute wird das bio-psycho-sozial-ökologische Modell zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit zwar weltweit diskutiert, es ist aber noch lange nicht grundsätzlich überall akzeptiert. Die psychosomatischen Forschungen und die klinischen Entwicklungen zur Behandlung von psychosomatisch kranken Patienten haben zu dieser Diskussion einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Wie erleben Patienten das Zusammenleben von Körper, Seele, Geist und Umwelt? Warum nehmen Gene, Schwangerschaft und frühkindliche Erfahrungen, insbesondere im Bereich der Bindungsentwicklung, nachhaltig bis ins Erwachsenenleben auf alle diese Bereiche einen entscheidenden Einfluss? Wie können wir Säuglinge, Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene, die ihr seelisches und soziales Leben über Körpersymptome zum Ausdruck bringen, zusammen mit ihren Bezugspersonen erfolgreich behandeln? Welche Rolle spielen die psychosomatische Diagnostik, Psychotherapie und Prävention im Kontext von chronischer Erkrankung? Wie ist eine erfolgreiche Prävention in Bezug auf psychosomatische Störungen möglich?
International renommierte Forscher, Kliniker und Pädagogen sowie Psychotherapeuten geben in diesem Buch Antworten auf diese Fragen und berichten über die neuesten Ergebnisse aus ihren Studien und ihre klinischen Erfahrungen.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren, dass sie ihre Beiträge für die Publikation zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank gilt Frau Ulrike Stopfel, die sehr engagiert, wie auch in den vergangenen Jahren, alle englischsprachigen Beiträge in exzellenter Qualität rasch übersetzt hat. Dank der hervorragenden Arbeit von Herrn Thomas Reichert konnten die einzelnen Manuskripte schnell editiert werden. Ein weiterer Dank gilt Herrn Dr. Heinz Beyer sowie Frau Ulrike Wollenberg vom Verlag Klett-Cotta dafür, dass sie sich mit großem Engagement für die Herausgabe dieses Buches beim Verlag eingesetzt und die rasche Herstellung gewährleistet haben.
Ich hoffe, dass dieses Buch allen hilft, die im Kontext von Therapie, Beratung, Begleitung und sozialer Arbeit für Menschen mit psychosomatischen Störungen tätig sind. Es soll auch denjenigen wichtige Anregungen geben, die mit der Prävention von Störungen in der Psychosomatik beschäftigt sind. Das Buch richtet sich daher an Psychotherapeuten, Kinderärzte, Kinderpsychiater, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, Kinderpsychologen, Psychiater, Sozialarbeiter, Pädagogen, Jugendhilfemitarbeiter und explizit natürlich an Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie allgemein an alle Therapeuten und Berater, die sich mit der Diagnostik und Behandlung von psychosomatischen Störungen in allen Altersgruppierungen – vom Säugling bis zum alten Menschen – beschäftigen. Ebenso sind alle angesprochen, die Menschen behandeln, begleiten, betreuen und für sie Verantwortung tragen, wenn diese unter psychosomatischen Symptomen und ihren Folgen leiden, wie etwa Krankenschwestern, Heilpädagogen, Erzieher, Ergotherapeuten, Krankengymnastinnen, Seelsorger, Lehrer, Umgangspfleger, Juristen, Politiker und Eltern. Möge dieses Buch allen, die in ihrem Kontext mit psychosomatisch kranken Menschen arbeiten oder für deren Entwicklung Sorge tragen, zahlreiche Anregungen geben, die sie in ihrer täglichen Arbeit fruchtbar umsetzen können.
Karl Heinz Brisch
Einleitung
Das vorliegende Buch fasst verschiedene Beiträge aus den Bereichen Forschung, Klinik und Prävention zusammen, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema »Bindung und Psychosomatik« beschäftigen. Es werden hierbei auch Ergebnisse aus der Grundlagenforschung vermittelt, die teilweise aus Längsschnittstudien gewonnen wurden. Außerdem wird anhand von Fallbeispielen anschaulich über Erfahrungen aus der klinischen Arbeit berichtet, um die therapeutischen Möglichkeiten und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie, Begleitung, Beratung und Prävention aufzuzeigen.
In einem einleitenden Überblicksartikel berichtet Felix Tretter über die Zusammenhänge zwischen Bindungsforschung, Psychosomatik und ökosystemischer Medizin. Aufgrund seiner eigenen breit angelegten Ausbildung ist er in der Lage, von der Medizin über die Psychologie bis zur Philosophie verschiedenste Perspektiven zu integrieren.
Arnold Sameroff hat zukunftsweisende Pionierarbeit geleistet, indem er aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrungen in der Entwicklungspsychologie ein integratives Entwicklungsmodell entwickelt hat. Er zeigt Risiko- und Schutzfaktoren auf sowie Möglichkeiten und Wege, die bei Kindern eine positive Entwicklung initiieren können, wobei sowohl anlagebedingte (nature) als auch umweltbedingte (nurture) Faktoren berücksichtigt sind.
Christian Schubert erforscht als Psychoneuroimmunologe seit vielen Jahren die Zusammenhänge zwischen frühkindlicher Traumatisierung und Entzündungserkrankungen im Erwachsenenalter. Er hat hierzu eigene Forschungsansätze entwickelt und diese über die Lebensspanne ausgedehnt und weiterverfolgt.
Kerstin Uvnäs-Möberg beschäftigt sich – als eine der international renommierten Oxytocin-Forscherinnen – in ihrem Beitrag damit, wie unzureichende frühe Fehlfunktionen im Oxytocin-System sich auf die Entwicklung des Bindungssystems auswirken können und hier zu Bindungsunsicherheiten führen.
Die Entwicklung der zunehmenden Anzahl von Kindern mit ADHS-Diagnosen hat Nevena Vuksanovic dazu veranlasst, eine bahnbrechende Studie zum Thema »Traumatische Erfahrungen, Stress und ADHS« zu entwickeln. Die Ergebnisse ihrer Forschung werden in ihrem Beitrag vorgestellt, besonders unter dem Aspekt der Beziehung zwischen genetischen Anlagen und Umweltfaktoren, hier besonders auch traumatischen Erfahrungen und frühen Stresserfahrungen des Kindes. Sie berichtet, wie diese Erfahrungen sich auch im neuroendokrinologischen System, hier besonders auf das Cortisol, auswirken.
In einer kasuistischen Fallvignette beschreibt Egon Garstick, wie der Verlust der Bindung zum eigenen Körper zu einer schwerwiegenden anorektischen Entwicklung bei einem Jugendlichen geführt hat. Er lässt den Leser daran teilhaben, wie es im Rahmen der Therapie möglich wurde, dass der Jugendliche während der Adoleszenz durch die Behandlung in einem interdisziplinären Team in der Kinderklinik wieder auf einen positiven Weg geführt werden konnte.
Viele Menschen leiden unter chronischen Schmerzen und werden als somatoforme Schmerzpatienten diagnostiziert. Lachlan McWilliams berichtet von seinen Forschungen und auch den therapeutischen Ansätzen, wie diese chronischen Schmerzerfahrungen mit frühen Bindungserfahrungen zusammenhängen und auf welche Weise hier therapeutisch erfolgreich für die Patienten interveniert werden kann.
Aus dem Bereich der Schmerzsymptome fällt ganz besonders das Fibromyalgiesyndrom (FMS) auf. Ulrich Egle hat seit vielen Jahren Erfahrungen in der Leitung einer Klinik und dem Aufbau eines klinischen Behandlungsteams und eines speziellen Settings, wie Menschen, die unter einem Fibromyalgiesyndrom leiden, erfolgreich behandelt werden können. Hierbei spielen die Beachtung von Schmerzsymptomen und die Berücksichtigung von Bindungserfahrungen eine große Rolle.
Robert Maunder, Gary Newton und Robert Nolan berichten aus ihren Studien mit erwachsenen Patienten mit einer Herzerkrankung. Sie haben deren Bindungssystem untersucht und sich einen Einblick verschafft, wie das autonome Nervensystem und die kardialen Funktionen in ihrer Regulation durch bindungsunsichere und unverarbeitete traumatische Erfahrungen beeinflusst werden.
Abschließend berichtet Karl Heinz Brisch in seinem Beitrag über die integrative Psychosomatik im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München. Er stellt sowohl die Arbeit in der Ambulanz, im Konsil- und Liaisondienst als auch das wegweisende Therapiemodell MOSES® vor, das aus einer stationären Intensivpsychotherapie besteht. Anhand eines Fallbeispiels wird erläutert, wie schwerst frühtraumatisierte Kinder, die unter Bindungsstörungen leiden, durch dieses integrative, intensive stationäre Behandlungsmodell wieder auf einen gesünderen Entwicklungsweg gebracht werden können.
Es wäre wünschenswert, dass es mehr Ansätze für Prävention und Therapie gäbe, die sehr früh schon bindungsorientiert psychosomatische Störungsbilder verstehen und neuere therapeutische Ansätze auf den Weg bringen könnten. Je früher Körpersymptome, wie etwa Schmerzen, als Ausdruck einer gesamten Störung im bio-psycho-sozial-ökologischen System des Patienten verstanden werden, umso gezielter und mit langfristiger Wirkung können auch Interventionen zu seinem Wohl durchgeführt werden.
FELIX TRETTERBindungsforschung, Psychosomatik und ökosystemische Medizin
Zum Verhältnis von Bindungstheorie und theoretischer Medizin
Die Bindungsforschung konnte bis heute überzeugend zeigen, dass unterschiedliche Bindungsverhältnisse bzw. Bindungsstile im Netzwerk der Beziehungspersonen des Kindes zu unterschiedlichen Risiken für spätere Erkrankungen führen können oder zumindest einen wesentlichen kausalen Anteil daran haben. Damit leistet die Bindungstheorie einen fundierten Beitrag zur theoretischen Pathologie und klinischen Salutogenese und auch zur praktischen Prävention, zumindest in Hinblick auf psychische Erkrankungen. Allerdings ist die Bindungsforschung, wie sie von Bowlby (2008) entwickelt wurde, in besonderem Maße interdisziplinär orientiert und hat demnach keine eindeutige »fachliche Heimat«: Sie beruht auf Ansätzen der Psychoanalyse, der Verhaltensbiologie, der Entwicklungspsychologie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es ist daher wissenschaftssystematisch interessant, entsprechend dem Tagungsthema BindungundPsychosomatik diese Verbindungen zu sondieren. Es soll in diesem Text versucht werden, verschiedene Aspekte der Bindungstheorie in den Rahmen einer übergreifenden, bis zur humanökologischen Perspektive reichenden Beziehungstheorie einzubinden, die sich in konkreter Form als »ökosystemische« Perspektive auf Gesundheit und Krankheit darstellt (Schaefer & Blohmke 1978; Tretter 1986, 1989a, 1998, 2008). Dies soll hier durch Querverweise zu unterschiedlichen Bereichen der theoretischen Medizin erfolgen.
Woran ist also anzuknüpfen? Bindung ist zunächst grundlegend dreidimensional zu konzipieren, sie entsteht sozial, beruht auf psychischen Mechanismen und weist biologische Korrelate auf. Die entsprechende Interdisziplinarität der Bindungsforschung regt daher dazu an, mögliche Brücken zu einer umfassenderen – allerdings nur vage existierenden – Theorie einer psychosozialen Medizin zu schlagen, vor allem weil die biologische Forschungsperspektive in der Medizin derzeit dominiert. Die Medizin heute verfügt damit über detailliertes (vor allem biologisches) Wissen und über spezielle, fokale Theorieansätze. Letztere haben allerdings meist nur den Charakter von Hypothesen. Es mangelt nämlich derzeit an zusammenfassenden und umfassenden Gesundheits-/Krankheitstheorien (Gross 1998). Waren es in den 1960er und 1970er Jahren vor allem psychosoziale Erklärungsansätze, so sind es seit längerem die biologischen Konzepte, die Gesundheit und Krankheit erklären sollen.
In dem heute aktuellen molekularbiologischen Bereich zeichnet sich allerdings derzeit zunehmend wieder das systemische Paradigma als Theorieoption ab, das sich in Netzwerkmodellen von molekularen Schaltwegen und Schaltkreisen in der Zelle darstellt. Aus abstrakter Sicht handelt es sich dabei um kausale Beziehungsnetzwerke zwischen Molekülen. Damit erhält der Begriff »Beziehung«, zumindest im Kontext systemischen Denkens, bei der Kausal-Analyse und Modellierung von vernetztenWirkungsbeziehungen bereits eine zentrale Bedeutung bei der Theoriebildung. Er bietet nämlich die Option, medizinische Sachverhalte gewissermaßen »beziehungstheoretisch« und damit fachübergreifend zu beschreiben. »Beziehung« ist ein strukturorientiertes Konstrukt, das ganz allgemein Beobachtungen verschiedenster Art gedanklich verbindet, also in unserem Fall die Beziehung oder das Verhältnis des Verhaltens des Kindes zum Verhalten der Mutter; hierzu gehört etwa die Sicherheit auf Seiten des Kindes, beim Schutzsuchen Schutz bei der Mutter zu finden (Grossmann & Grossmann 2004, S. 219). Eine solche mathematisch orientierte begriffliche Transformation, bei der »Beziehung« zunächst als Verhaltensoperation von A nach B angesehen wird und nicht auch das Verhalten von B nach A umfasst, führt letztlich dahin, dass eine systemtheoretische Perspektive mit ihren spezifischen Begriffen, Modellen, Methoden, Paradigmen und Theorien als Rahmen genutzt werden könnte (Tretter 2005; Ropohl 2012).
Auf diesen Grundüberlegungen aufbauend wird in diesem Beitrag nun versucht, eine umweltbeziehungstheoretische bzw. ökosystemische Perspektive aufzuzeigen, die zur Bindungstheorie gut passt und auf deren Basis auch Anregungen für übergreifende theoretische Anwendungen möglich sind. Dieses Vorhaben wird in mehreren Stufen dargestellt, bei denen jeweils ein Aspekt der Bindungstheorie zunächst angesprochen und abschließend jeweils ein Fazit gezogen wird: Im ersten Schritt wird besonders ausführlich auf die vorherrschende reduktionistische molekulare Medizin eingegangen, die sich aber zunehmend zu einer synoptischen Systemmedizin entwickelt, welche die molekularen Signalnetzwerke organübergreifend wahrnimmt und die klassische Perspektive einer organismischen Medizin biochemisch rekonstruiert (Tretter 2007). Der Bruchstelle zwischen Körperlichem und Geistigem folgend wird im nächsten Schritt der Bezug zur Psychosomatik (bzw. psychotherapeutischen Medizin) hergestellt, die ebenfalls einen Trend zum molekularbiologischen Reduktionismus zeigt. Die besondere Bedeutung der personellen Umwelt für das Bindungserleben legt allerdings die Konzeption einer »Sozio-Psychosomatik« nahe, die so aber nicht existiert. Deshalb wird der theoretische Bezug zum weithin bekannten »bio-psycho-sozialen Störungsmodell« untersucht (Engel 1977). Schließlich kann durch die Ausweitung des Umweltbegriffs und die Übersetzung des Bindungsbegriffs in eine Taxonomie des Beziehungsbegriffs eine ökologisch-systemische Perspektive skizziert werden (vgl. Tab. 1; Tretter 2008).
Tab. 1: Beispiele für integrative, mehrdimensionale Konzepte der Medizin in Stichworten
Psychosomatik (Adler et al. 2011): Wechselbeziehungen zwischen dem Psychischen und dem Somatischen; auch: »psychosomatische Medizin«
Soziopsychosomatik (Söllner 1989): Erweiterung der Psychosomatik um das Soziale
Psychotherapeutische Medizin (Rudolf & Henningsen 2013): Fokus auf psychotherapeutische Ansätze
Somatopsychik (Echterhoff 2013): Effekte somatischer Krankheiten auf die Psyche
Biopsychosoziales Modell (Engel 1977; Adler 2005): Ausdruck für eine mehrdimensional aufgestellte Pathologie
Psychosoziale Medizin (Buddeberg 2003): verbreiteter Ausdruck, Universitätsfach, häufig verwendet um medizinische Psychologie und Soziologie begrifflich zusammenzufassen; auch Thematisierung der Arzt-Patient-Beziehung
Ökologische Medizin (Tretter 1986): Mensch-Umwelt-Beziehungen und Gesundheit und Krankheit; humanökologische Basis
Systemmedizin (Tretter 1989a, 2005; Ahn et al. 2006a, b; Auffray et al. 2009): Anwendung der (molekularen) Systembiologie in der Medizin; integriertes Mehrebenen-Konzept von Mensch, Gesundheit und Krankheit
Bindungstheorie und die biologische Medizin
Die biologische Bindungsforschung hat Korrelate einer sicheren Bindung des Kindes, der Mutter oder allgemeiner: von Personen zu anderen Personen, gefunden, und zwar in Form eines erhöhten Oxytocin-Spiegels des Kindes oder des betreffenden Erwachsenen (Francis et al. 2004; Insel & Young 2001; Uvnäs-Moberg & Petersson 2005). Gehirngebiete, in denen eine hohe Dichte von Oxytocin-Rezeptoren bzw. Vasopressin-Rezeptoren vorliegt, sind für das Zustandekommen von Bindungserleben bzw. Bindungsverhalten relevant. Auf neurochemischer Ebene ist allerdings nicht nur Oxytocin, sondern sind auch Vasopressin, Opiate, Dopamin und Serotonin involviert (Insel & Young 2001). Es sind sicher noch andere molekulare Strukturen für diesen Zustand erforderlich, wie auch davon auszugehen ist, dass Oxytocin andere Funktionen ausübt und somit nur eine Art Farbstoff im bunten Bild des Beziehungserlebens der Person ist.
Die Neurobiologie bietet heute viele Fakten zu den biologischen Grundlagen psychischer Zustände und Prozesse und ihren Störungen, wie es eben Bindungserfahrungen sind. Sie ist ja mittlerweile die Grundlagenwissenschaft der Psychologie, Psychiatrie, Psychopathologie, Psychosomatik und Psychotherapie. Neurobiologen gehen dabei grundlegend davon aus, dass neues Verhalten durch wiederholte akute Aktivierungen des Gehirns zu morphologischen Konsolidierungen der betreffenden Trägerstrukturen führen: Neurone, die gemeinsam feuern, verdrahten sich auch (nach Hebb 1949). Demgemäß können sich elektrisch aktive Schaltkreise im Gehirn in ihren Verschaltungen wiederholt chemisch-morphologisch so verändern, dass sie eine besonders hohe Reagibilität gegenüber den betreffenden Umweltreizen zeigen. Das betrifft theoretisch auch die Stabilisierung der neuronalen Schaltkreise der Bindung. Von der weiteren psychoneurobiologischen Erforschung von Geborgenheit, Bindung, Lust, aber auch von Stress sind deshalb noch viele neue Details zu erwarten. Und daher ist eine gute Anschlussfähigkeit der Bindungsforschung an die biologische Medizin gegeben. Wegen der Wichtigkeit der zukünftigen Forschungsperspektiven soll dieser Bereich hier besonders detailliert erörtert werden.
Die molekulare Organmedizin
Die heutige Medizin nimmt in Empirie, Theorie und Praxis zunehmend die Form einer klinischen Molekularbiologie an, die das Krankheitsverständnis und die Therapiekonzepte auf molekulare Mechanismen zurückführt (Ganten & Ruckpaul 2007). Das ist, medizingeschichtlich betrachtet, ein weiterer tiefergreifender Schritt von der organismischen praktischen Medizin, die sich in der klinischen Praxis zur spezialisierten Organmedizin entwickelte, über eine laborgestützte Gewebsmedizin zur experimentellen Zellmedizin (z.B. Pathologie) und schließlich zur Molekularmedizin (z.B. molekulare Pathologie). Die klinische Realität, insbesondere in der Universitätsmedizin, wie sie in Chirurgie, Innerer Medizin oder Onkologie praktiziert wird, stellt sich zumindest so dar. Vor allem die Innere Medizin scheint eine Differenzierung und Spezialisierung erreicht zu haben, die jenseits der Zellpathologie von Virchow fast nur mehr auf der Ebene »molekularer Schalter« denkt und diskutiert. Das betrifft sogar die hier besonders interessierende Psychiatrie und auch die Psychosomatik, die zunehmend in diesen Forschungstrend geraten, wie ein Blick in Lehrbücher und auf Forschungsprofile von Lehrstühlen zeigt (z.B. Rüegg 2007).
Nach wie vor ist demnach die Genetik für die Medizin der große Hoffnungsbereich, mit dem die Erwartungen auf ein umfassendes kausales Verständnis von Krankheit und Gesundheit und deren Modulation durch gentechnologische Methoden verknüpft sind. Viele namhafte Genetiker haben diese Hoffnung bis etwa zum Jahr 2000 ungemindert genährt. Theoretisch wird dabei unterstellt, dass die Gen-Aktivität die Strukturen und Funktionen auf der Ebene der Proteine und der Zellen und damit der Gewebe, Organe und des Organismus vollständig »determiniert«. Es soll also eine gestufte und divergierende Bottom-up-Kausalität vorliegen.
All diese wissenschaftlichen Entwicklungen des atomistischen Top-down-Programms der empirischen Strukturforschung der Medizin, das von der Makro-Ebene des organismischen Verhaltens zur Ultra-Mikro-Ebene der Genetik und Molekularbiologie voranschreitet, sind empirisch sinnvoll und wertvoll. Allerdings muss dieses Forschungsprogramm mittlerweile nahezu durch eine methodologische Gegenbewegung, die wieder den Blick auf das Ganze kultiviert, ergänzt werden. Es ist also eine Bottom-up-Synthese erforderlich, welche die Zusammenhänge wieder rekonstruiert und damit das nötige integrative Funktionsverständnis ermöglicht. Das ist nicht zuletzt durch die Praxis-Problematik der unzulänglichen Wirkung (Non-Responder) und der unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln begründet, die beispielsweise aufkommt, wenn zwar gehirnzell-relevante Medikamente zur Behandlung psychiatrischer Erkrankungen eingesetzt werden, aber auch Nebenwirkungen auf Leukozyten und Hautzellen auftreten. Dabei muss die Frage beantwortet werden, wie die identifizierten molekularen und zellulären Einzelteile zusammenwirken, sodass der lebensfähige und erlebensfähige Organismus zustande kommt.
Systembiologie
Die Frage nach diesen Zusammenhängen kam Ende der 1990er Jahre auf, nach Beendigung des Human-Genom-Projekts. Die Enttäuschung war groß, als deutlich wurde, dass statt der 100000 erwarteten Gene nur ca. 25000 die Komplexität der Menschen bestimmen sollten. Es musste nun geklärt werden, wie die Gene den Organismus »aufbauen«, und zwar durch das selbstorganisierte Zusammenspiel der Aktivierung und Desaktivierung von Genen, die die verschiedenen Organisationsebenen wie die Zellen, das Gewebe, die Organe und den Organismus steuern und regulieren. Das betrifft auch die psychiatrische Genetik (Kendler 2013). Hiroaki Kitano publizierte dazu im Jahr 2002 in den Zeitschriften Science wie auch in Nature grundlegend und wirkungsmächtig die Kernmerkmale einer neuen »Systembiologie« (Kitano 2002a, b). Er machte deutlich, dass in dieser Forschungssituation zunächst nur die Bioinformatik weiterhelfen kann, die unterschiedlichen Aktivierungszustände der Gene zu identifizieren, die mit bestimmten Zellzuständen und -prozessen, wie beispielsweise dem Zelltod, assoziiert sind. Er skizzierte damit eine neue Forschungsperspektive, bei der die Mathematik nicht lediglich eine Nebenrolle in der Analyse komplexer molekularbiologischer Datensätze innehat, sondern bei computerbasierten Modellierungen im Wechselspiel mit der experimentellen Molekularbiologie eine Hauptrolle spielt. Wenig später wurden auch in Deutschland entsprechende Forschungsprogramme aufgesetzt (BMBF 2012).
Die grundlegenden Annahmen der Systembiologie hat kürzlich einer der europäischen Pioniere der klinisch relevanten Systembiologie, Denis Noble, in zehn Prinzipien zusammengefasst (s. Tab. 2).
Tab. 2: Die 10 Prinzipien der Systembiologie nach Denis Noble (2008)
Es wird deutlich, dass auch in der komplexitätsbewussten Systembiologie noch die Idee der Bottom-up-Kausalität vorherrscht und die Top-down-Kausalität nur randständig ist. In den letzten fünf Jahren wurde aber dieses unidirektionale Modell der Bottom-up-Kausalität deutlich infrage gestellt, insofern experimentell belegt wurde, dass es in Form der epigenetischen Faktoren auch eine wirkmächtige Top-down-Kausalität gibt, die sogar über ein oder zwei Generationen hinweg wirksam ist und somit einen zumindest rudimentären intergenerationalen Wissenstransfer zu bewirken scheint (Riddihough & Zahn 2010).
Diese Top-down-Kausalität ist in der Molekularbiologie eigentlich nichts grundsätzlich Neues, denn das Konzept der feedback-basierten Gen-Regulation wurde bereits in den 1950er Jahren durch das Regelkreismodell der Proteinproduktion von Jacob und Monod erkannt (Jacob & Monod 1961): Produkte der gen-induzierten Syntheseprozesse hemmen ihre weitere Produktion. Eine Top-down-Kausalität der Gen-Regulation ist auch in der Stressbiologie bekannt, insofern die vom Organismus als Stress erfahrenen Umweltereignisse generalisierte Abwehrreaktionen auslösen, die beispielsweise mit einem erhöhten Cortisolspiegel einhergehen. Dabei gelangt das Cortisol auch in den Zellkern, wo sich Rezeptoren befinden, die in Verbindung mit Cortisol als Transkriptionsfaktoren wirken und auf diese Weise die Genexpression steuern.
Daher ist die Biologie in ihrem Kern die Kybernetik biosysteminterner, vernetzter biomolekular konstituierter Schaltkreise. Entwickelt man diese Sichtweise Stufe für Stufe über die organismischen Organisationsniveaus hinweg weiter, dann kommt man zu der Netzwerksicht der Systembiologie und schließlich zur Systemmedizin.
Kritisch ist allerdings zu sehen, dass mit der molekularen Systembiologie gravierende Erklärungslücken verbunden sind: Sie kann auch nicht das Auftreten von Zellen, die Entstehung von Geweben, Organen und schließlich des ganzen Organismus »erklären«. Wir kennen nämlich die Biomoleküle lebender Systeme zwar im Einzelnen und in ihren multiplen Wechselwirkungen immer genauer, und so können wir Phänomene des Lebens – mit Nebenwirkungen – modulieren, aber wir können nicht Leben produzieren, ohne wieder auf Leben zurückgreifen zu müssen. In einer anderen Deutung kann man das Diktum von Viktor von Weizsäcker: »Um Lebendes zu erforschen, muss man sich am Leben beteiligen«, auch so sehen, dass nur die Beteiligung am Leben, aber nicht die Durchdringung des Wesens des Lebendigen möglich ist, ohne das Lebendige zu zerstören (v. Weizsäcker 1940). Zur Erklärung des Lebens müssen wir das Konzept der »Emergenz« verwenden, das besagt, dass ein Makrophänomen (z.B. Leben) nicht aus der Mikrostruktur (z.B. Molekülen) heraus erklärt werden kann.
Systemmedizin
Der Organmedizin ist heute der integrale Organismus abhanden gekommen. Betrachtet man diesbezüglich die klinische Medizin mit ihren somatischen Disziplinen, dann zeigt interessanterweise gerade das »Königsfach« Chirurgie, trotz der Organspezialisierung und der Kompetenz im Bereich der Prothetik, zumindest präoperativ und intraoperativ gemeinsam mit der Anästhesie, die auch das Gehirn im Blick hat, dass sie den ganzen Organismus, ja den ganzenMenschen versorgen muss (Siebert & Brauer 2010): »Operation gelungen, Patient tot«, ist genau die Situation, die der Chirurg, der prozessqualitätsbewusst denkt und handelt, vermeiden will, und zwar auch in Hinblick auf postoperative neurokognitive Störungen.
Auch im Bereich der Pathologie existiert ein für die Medizin bedeutendes, fächerübergreifendes Modell, das die medizininternen Bruchstellen der spezialisierten Pathologie und klinischen Medizin überwindet, nämlich das bekannte organismische Stresskonzept. Es erfasst den Zusammenhang zwischen erlebtem Stresszustand, Gehirn, Nebennierenrinde, peripheren Organen auf der Basis von neuronalen und molekularen Schaltkreisen mit Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin usw. als Mediatoren. Das Modell reicht bis zu den Methylierungsprozessen an der DNA und der konsekutiven Veränderung der Expression von Rezeptoren und anderen Signalmolekülen der Zelle, die zu persistierenden Veränderungen des zellulären Gefüges bzw. von humoralen bzw. neuralen Schaltkreisen führen können. Dieses umfassende Modell bekommt nun weitere Fundierungen durch die erwähnte molekulare Perspektive der Systembiologie. Gerade die medizinische Molekularbiologie hat nämlich zunehmend erkannt und verdeutlicht, dass alle Organsysteme über Moleküle zusammenhängen: Beispielsweise beeinflussen Zytokine auch Nervenzellen und zeigen somit, dass das Immunsystem mit dem Nervensystem funktionell gekoppelt ist. Das ist aber bereits lange über die gehirnbedingte Regulation des Cortisol-Spiegels bekannt. Auch bei Herzinfarkten ist mittlerweile der Zusammenhang mit der Depression auf molekularbiologischer Grundlage nachgewiesen (Nemeroff & Goldschmidt-Clermont 2012). Das Hormonsystem, das Immunsystem und das Nervensystem sind also auf das Engste miteinander verwoben. Diese Systeme fungieren als regulative Systeme für alle Organe. Damit wird auch klar, dass eine rezeptorfokussierte Forschung in der Pharmakologie einen zu eingegrenzten Blick hat, insofern vor allem Nebenwirkungen von Medikamenten in anderen Geweben bzw. Organen zeigen, dass eine Systemperspektive sinnvoll wäre (systemische Pharmakologie). Folglich bietet sich grundlegend das übergreifende Konzept einer Systemmedizin an (Tretter 1989a; Ahn et al. 2006a, b; Auffray et al. 2009; Mabry et al. 2008). Dabei ist vor allem der Weg von der molekularen Medizin zur Organmedizin schon gut erkennbar (Herz: Noble 2002). Die Einsicht in die Systemhaftigkeit des Organismus hat im Jahr 2010 die EU bewogen, ein Forschungsprogramm »Systems Medicine« (European Commission 2010) auszuschreiben. Sie hat damit einen wichtigen Schritt in Richtung einer molekularbiologisch basierten Ganzheitsmedizin getan. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung zog im Jahre 2012 nach und legte für Deutschland ebenfalls ein Forschungsprogramm zur »Systemmedizin« auf (BMBF 2012). Auch in der Psychiatrie zeichnet sich ein Ende des Top-down-Forschungsprogramms einer molekularen Medizin ab, indem allmählich die molekulare Welt der Zelle in Form des Genoms, Proteoms, Transkriptoms, Metaboloms usw., von denen die einzelnen molekularen Bestandteile jeweils weitgehend bekannt sind, eine molekulare Systembiologie der Nervenzelle und des Gehirns entstehen lässt (Tretter et al. 2010).
Zusammenfassend betrachtet, zeichnet sich also in Form der molekularen »Systemmedizin« eine systemische Perspektive des Organismus auf biochemischer Grundlage ab, die ein ganzheitsorientiertes Verständnis von Gesundheit und Krankheit ermöglichen wird (Tretter 2007). Kritisch ist allerdings zu sehen, dass auch die Systemmedizin durch das materialistische, substrat- und substanzzentrierte Erkenntnisprogramm der Biomedizin eine starke ontologische Reduktion des Menschen vornimmt. So wird grundlegend ignoriert, dass Bewusstseinsprozesse die somatischen Prozesse steuern können. Dieses Grundproblem der prospektiven Irreduzibilität des Psychischen auf das Physische bleibt auch für die Systemmedizin bestehen. Somit ist eine Systemmedizin nur dann eine »gute« Systemmedizin, wenn sie sich als »psychosoziale Systemmedizin« konfiguriert.
Als Fazit für die biologische Bindungsforschung ergibt sich im Hinblick auf die molekulare Medizin die Notwendigkeit, sich an die Methodik, die Theorien und die komplexen Datenbanken der Systembiologie anzuschließen, um bei der Konstituierung der sich entwickelnden Systemmedizin relevant mitwirken zu können.
Bindungstheorie und Psychosomatik
Die psychologische Bindungsforschung hat gezeigt, dass das Bindungsmotiv ein Grundbedürfnis des Menschen, aber auch von Tieren ist. Eng damit verbunden ist das Bedürfnis nachSicherheit. Das funktionelle Bedingungsgefüge dieser Bedürfnisse, wie auch das Verhältnis zum Bedürfnis nachAutonomie, ist nach wie vor noch nicht zufriedenstellend geklärt. Die psychologischen Mikroprozesse, die diese Disposition prägen, wurden von Norbert Bischof in dem »Zürcher Modell« kybernetisch abgebildet. Nach diesem komplexen Modell tritt Bindungsverhalten auf, wenn das Erleben von Abhängigkeitgrößer ist als das Erleben von Sicherheit, das seinerseits aus der Summe des Erlebens von Vertrautheit, Wichtigkeit und Nähe bestimmt ist (Bischof 1985). Auf dieser Ebene der modernen psychologischen Systemtheorie besteht für die Bindungstheorie noch eine Option zur Weiterentwicklung, aber auch für die Bedürfnistheorie der klinischen Psychologie, wie sie von Klaus Grawe auf der Basis seiner empirischen Studien formuliert wurde (Grawe 1998, 2004): Klaus Grawe geht von einer anderen Grundstruktur menschlicher Bedürfnisse aus und erkennt ein explizites Grundbedürfnis nach Bindung, darüber hinaus die Bedürfnisse nach Orientierung und Kontrolle, nach Lust und Selbstwert. Über die Wechselbeziehungen dieser Bedürfnisse wird auch von ihm verhältnismäßig wenig gesagt. Hier wird davon ausgegangen, dass ein Bedürfnis nach Orientierung angesichts des postnatalen sensorischen Informationschaos und ein Bedürfnis nach Kontrolle, getrieben durch das Bedürfnis nach Lust bei bestehender Unlust, die Grundbefindlichkeit des Neugeborenen charakterisiert. Bei Konkordanz der Befriedigung dieser Bedürfnisse steigert sich das positive Bindungserleben und damit auch der Selbstwert.
Nicht nur die externe reale Beziehung, sondern auch die innere Repräsentation des Beziehungsverhältnisses des Kindes zu seiner Bindungsperson ist dabei von psychologischer Bedeutung. Das Kind bildet nämlich eine dreielementige innere Repräsentation aus, und zwar von sich selbst, der Mutter (gewissermaßen zunächst als »Hauptelement« der Umwelt) und dem Beziehungssystem. Dieses »inner working model« (IWM; auch: inneres Arbeitsmodell) sorgt dafür, dass auch bei physischer Distanz der Mutter Bindungssicherheit erlebt werden kann, bildet zunehmend die Basis für die Autonomie bei explorativem Verhalten und hängt auch mit der individuellen Resilienz in Stresssituationen zusammen.
Nun stellt sich die Frage, wie gut die Bindungstheorie in den Rahmen von Theorien der gut etablierten Psychosomatik hineinpasst, die nicht nur die psychologischen Aspekte, sondern auch die biologischen Korrelate der Bindungserfahrung zu integrieren vermögen.
Psychosomatik, psychotherapeutische Medizin und psychosoziale Medizin
Der Gegenstandsbereich der Psychosomatik ist nach heutiger Auffassung die Betrachtung der Wechselbeziehungen von psychischen Prozessen und Zuständen und körperlichen Zuständen und Prozessen in Hinblick auf Gesundheit und Krankheit (Janssen et al. 2006). Zu dieser Definition ist aus wissenschaftsphilosophischer Sicht anzumerken, dass darin zwar ein Leib-Seele-Dualismus zu erkennen ist, dass aber diese integrierte Dualität, die diese Bereiche als distinkte und doch gekoppelte Entitäten sieht, nicht notwendigerweise einen ontologischen Dualismus impliziert, sondern nur einem methodologischenDualismus entspricht (Tress & Junkert-Tress 1997; Tretter & Grünhut 2010). So haben es auch die größten intellektuellen Anstrengungen der letzten 20 Jahre im Rahmen der »Neurophilosophie« nicht ermöglicht, psychische Phänomene, wie insbesondere das Bewusstsein, durch Kategorien der Physik oder anderer Naturwissenschaften »physikalistisch« oder »naturalistisch« zu »erklären« und entsprechend zu reduzieren (Tretter & Grünhut 2010). Extreme Versuche, das Bewusstsein als wirkungsloses Epiphänomen oder gar als Illusion des Gehirns zu begreifen, also die vollständige Naturalisierung des Geistigen vorzunehmen, vernachlässigen die Erfahrung, dass eine Absicht dazu führen kann, dass eine Bewegung vollzogen wird. Dieser phänomenale Sachverhalt wird als mentale Verursachung weiterhin zwischen Philosophen, Hirnforschern und Kognitionswissenschaftlern diskutiert. Auch wie es ist, eine Farbe zu erleben, gilt bisher als ungeklärt und bietet als sogenanntes Qualia-Problem weiterhin Diskussionsstoff in der Gehirn-Geist-Debatte. Auch beim Bewusstsein handelt es sich also um ein Phänomen der sogenannten Emergenz.
Aus diesem Grund ist eine ganzheitsorientierte Perspektive nur im Rahmen von Konzepten der integrativen Psychosomatik möglich, welche die zumindest methodologisch unabweisbare Dualität des Psychischen und des Somatischen differenziert und qualifiziert anerkennt und zugleich integrativ betrachtet und die bei kranken und gesunden Menschen in Forschung und Praxis angewendet werden kann. Dies entspricht der von Thure von Uexküll vertretenen Perspektive einer »integrierten Medizin« (v. Uexküll 1985; Adler et al. 2011).
Die Psychosomatik bzw. die psychosomatische Medizin hat allerdings eine komplexe, hier zu beachtende Diskussionsgeschichte (Janssen 2006). Sie ist historisch im Wesentlichen in der Psychoanalyse verankert. Dass somatische Erkrankungen durch den Zustand der Psyche verursacht werden können, ist schon länger bekannt. Aber erst Sigmund Freud hat über das Konstrukt der Konversionsyndrome eine Psychogenese somatischer Störungen klarer ausgearbeitet. Franz Alexander hat schließlich um 1950 unbewusste Konflikte als Ursache von Ulcus, essentieller Hypertonie, Colitis ulcerosa, Neurodermitis oder Asthma Bronchiale angesehen (Alexander 1951/1985). Dieses Konflikt-Modell ist aus heutiger Kenntnis nicht mehr voll vertretbar. Anstelle dessen hat das psychophysiologisch fundierte Stressmodell zur Ätiopathogenese psychischer und somatischer Krankheiten einen hohen Erklärungswert erlangt.
Die Psychosomatik erzwingt also nahezu, dass die Person bzw. der Mensch als psychophysische Einheit wieder in den Mittelpunkt der Betrachtungen der eigentlich symptomzentrierten Medizin gerückt wird. Anzumerken ist dabei, dass das Fach Psychosomatik im universitären Kontext wie auch in der Versorgung und der Weiterbildungsordnung auch mit der »psychotherapeutischen Medizin« in Verbindung gebracht wird (Rudolf & Henningsen 2013).
Als Fazit für die Bindungstheorie ist festzuhalten, dass die Psychogenese einer Stressvulnerabilität gut in den theoretischen Rahmen der Psychosomatik passt. Auch die Neurobiologie der Bindungstheorie passt sehr gut zur »Naturalisierung« der Psychosomatik. Zusätzlich wäre eine schulenübergreifende psychologische Konzeption aber hilfreich und noch zu entwickeln.
Bindungstheorie und bio-psycho-soziale Medizin
Der Befund der Bindungsforschung, dass die Qualität der dyadischen Mutter-Kind-Beziehung für das Bindungssystem bestimmend ist, verweist auf die Bedeutung der sozialen Umwelt für das Befinden des Individuums. Durch Erweiterungen der Bindungsforschung wurde auch anderen Beziehungspersonen des Kindes, wie dem Vater oder dem Kindermädchen, eine wichtige Rolle bei dem Aufbau des Bindungssystems eingeräumt. Im Kern bleibt das Bindungsphänomen zunächst ein familiäres Phänomen, nicht nur mit dyadischen, sondern auch mit triadischen oder polyadischen Strukturen. Beispielsweise findet sich im Hinblick auf Drogenprobleme in der Jugend oft ein spannungsvolles familiäres Bindungssystem mit einer das Kind stark bindenden Mutter und einem zurückweisenden Vater, ein Spannungsfeld also, dem sich der Jugendliche beispielsweise durch Drogenkonsum subjektiv gut entziehen kann.
Es fragt sich nun, welche »soziale Medizin« hier als theoretischer Rahmen zur Verfügung steht.
»Soziopsychosomatik« und das bio-psycho-soziale Modell
Wenn man gut begründbar zunächst von einer pragmatischen Irreduzibilität des Sozialen auf das Psychische ausgeht, dann wäre es naheliegend, zunächst eine – eigentlich nicht vorhandene – »Soziopsychosomatik« für die Integration des Sozialen zu beanspruchen. In der Psychosomatik selbst ist das Konzept der sozialen Umwelt nicht so explizit ausgearbeitet, wie man das zunächst erwarten würde. So existiert eine Soziopsychosomatik in ausgearbeiteter Form derzeit weder in der Forschung noch in der klinischen Praxis. Diese Fachperspektive war in den 1980er Jahren vereinzelt aufgerufen worden, konnte sich aber nicht durchsetzen (Bastiaans 1987; Söllner 1989).
Daher ist der Bezug zu dem »bio-psycho-sozialen« Störungsmodell von George Engel tragfähiger, vermutlich weil auch die theoretischen Annahmen weniger explizit sind als bei der durch die Psychoanalyse und die Psychodynamik geprägten Psychosomatik (Engel 1977). Dieses dreidimensionale theoretische Leitkonzept der Medizin bezieht Krankheit und Gesundheit nicht nur auf ihre biologischen und psychologischen Grundlagen, sondern auch auf die sozialen Rahmenbedingungen, wobei nicht nur an Einwirkungen des Sozialen auf den Menschen gedacht war, sondern auch Reaktionen des Menschen auf das Soziale, also Wechselwirkungen berücksichtigt werden (Egger 2005).
Allerdings ist zu bedenken, dass meist nicht zwischen dem Sozialen als System von Regeln und Personen als Umwelt (personale Umwelt) unterschieden wird. Auch wird zu wenig zwischen den verschiedenen Ebenen des Sozialen differenziert. Ein in dieser Hinsicht besonders hilfreiches Konzept, im Sinne einer Anatomie der sozialen Umwelt, hat allerdings Urie Bronfenbrenner konstruiert, indem er die Mikro-Umwelt als Lebensbereich des Lebewesens bzw. der Person definiert (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit usw.) und die Meso-Umwelt als Gefüge mehrerer Mikro-Umwelten begreift (Bronfenbrenner 1981). Das Exo-System versteht er als Bereich, der als Umwelt der Bezugsperson (z.B. Arbeitswelt die Eltern) das Öko-System der Person (z.B. des Kindes) mit beeinflusst, aber doch außerhalb der Einflussweite der Person liegt. Die Makro-Umwelt prägt schließlich als gesellschaftliche Rahmenbedingungen das Verhalten der Eltern in der Familie und damit auch das Erleben des Kindes (Bronfenbrenner 1981). Auf diese Weise entsteht, bildlich gesprochen, ein zwiebelschalenförmiges Netzwerkkonzept der sozialen bzw. personalen Umwelt der Person, insofern auch umfassendere Sozialsysteme und gesamtgesellschaftliche Bedingungen, wie etwa kulturelle Orientierungen, eine Valenz für die personale Bindung bzw. deren Sicherheitsbedürfnisse darstellen. Umwelt ist also ein System.
Was bedeutet »Umwelt«?
Es ist hier fortzuführen, dass die soziale Umwelt des Menschen nur einen Teilbereich seiner gesamten Umwelt ausmacht. Zusätzlich zur sozialen Umwelt sind nämlich natürliche Faktoren (Bäume, Pflanzen, Tiere usw.), zudem technische Faktoren Bestandteile der Umwelt, wie beispielsweise in Form einer Stadt als Lebensraum (urbane Umwelt) oder auch auf Mikroebene als Computerarbeitswelt; sie bilden einen Komplex einwirkender Faktoren, aber auch von Handlungsoptionen und -restriktionen, die gesundheitsrelevant sind. Für eine umfassende theoretische Perspektive der Medizin sind darüber hinaus das Klima, die Luftbelastung, geografische Faktoren, biotische Faktoren (Bakterien, Viren) usw. gesundheitsrelevant. Das bedeutet, dass die Ausweitung und Differenzierung des Umweltbegriffs unumgänglich ist, die Beschränkung auf das Soziale alleine ist unzulänglich.
Versucht man nun die Vielfalt der Verwendung des Begriffs »Umwelt« systematischer zu erfassen, dann sind zunächst die Aspekte »subjektiv« und »objektiv« zu differenzieren; das heißt, je nach Betrachter kann versucht werden, die objektive Außenwelt oder die objektive »Umgebung« zu beschreiben oder eben aufgrund von Äußerungen des Lebewesens die Umwelt subjektbezogen zu definieren. Auch kann der Nahbereich als »proximal« oder die weitere Umgebung als »distal« bezeichnet werden. Besonders bedeutsam ist die begriffliche Untergliederung in verschiedene Lebensbereiche wie Wohn-, Freizeit-, Familien- und Arbeits-Umwelt und dergleichen. Systematische Ausarbeitungen bezüglich der Umwelt des Menschen sind so gut wie nicht vorhanden, weswegen hier in einer Tabelle einige Dimensionen des Umweltbegriffs aufgelistet sind (Tab. 3).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Begriffe »soziale Umwelt« und »Umwelt« derzeit im internationalen medizinischen Forschungsbereich in äußerst trivialer Weise verwendet werden. Es wäre wichtig, wieder auf die differenzierte Forschung der 1970er Jahre von Urie Bronfenbrenner oder auf den Bereich der Humanökologie zurückzugreifen, die eine gute Basis wären, das Konzept weiter auszubauen.
Tab. 3: Einige Dimensionen des Begriffs »Umwelt« (vgl. Tretter 1989b)
Als Fazit für die Bindungsforschung deutet sich an, dass eine Ausweitung der Umweltperspektive mit einer Ausrichtung auf Objekte der kompensatorischen Ersatzbindung, wie es bei Jugendlichen, bei Erwachsenen und Senioren beispielsweise Pflanzen, Tiere oder auch Maschinen oder eben Drogen sein können, als äußerst interessant erscheint (Schindler 2013).
Bindungstheorie und die ökologische Perspektive
Die Bindungsforschung charakterisiert mit ihrem Konstrukt »Bindung« die Intensität, Persistenz, Frequenz und Qualität der Mutter-Kind-Beziehung: Enge, anhaltende, wiederholte und positive Kontakte sind empirische Korrelate dieses Begriffs. Das bedeutet hier, dass »Bindung« als eine Sonderform von interpersonellen »Beziehungen« oder besser des »Beziehungshaushalts« gedeutet wird. Diese begriffliche Korrespondenz von »Beziehung« und »Bindung« wurde zwar in der Geschichte der Bindungsforschung im Kontext der Kontroversen mit der klassischen Psychoanalyse ausdiskutiert, aber sie erscheint im Lichte der ökologischen Perspektive wieder als etwas perspektivenreicher (Bateson 1981). Geht man davon aus, dass der empirische Gehalt des Begriffs »Beziehung« als Summe beobachtbarer Verhaltenssequenzen jeweils das kontaktrelevante Verhalten – wie beispielsweise das Schreien des Kindes, die Zuwendung der Mutter, das Aufhören des Schreiens des Kindes usw. – betrifft, dann geht es, grob gesagt, um das »Beziehung-Suchen« und das »Beziehung-Geben« und um das interpersonelle Verhältnis, also die »Passung«, dieser wechselseitigen Aktionen. Die jeweilige »Beziehungsaktion«, das individuelle Verhalten, ist also ein Baustein der Beziehung, d.h. des »Beziehungsverhältnisses« oder des »Beziehungshaushalts«. Diese Interpretation entspricht dem ökologischen Grundkonzept des »Haushalts«. Dieses Beziehungsgefüge kann auch als »Wirkungsgefüge« verstanden werden, insofern Auswirkungen in Form einer Aktion (Schreien) als Einwirkungen auf die Mutter begreifbar sind, die wiederum Auswirkungen auf das Kind realisiert (Schutz und Wärme bieten) usw. Durch die folgenden (proximalen) Wechselwirkungen zwischen Mutter und Kind, das Verlangen und das Geben von Zuwendung, Schutz und dergleichen und die damit verbundenen Zustandsänderungen bei beiden Akteuren, bildet sich ein spezifisches Beziehungsmuster aus, das als Bindungssystem bezeichnet wird und gemäß der Bindungsforschung entsprechend der Bindungsorganisation typisiert werden kann. Beziehungstheoretisch formuliert liegt bei einer sicheren Bindung eine gute »Passung« vor. In dieser übergreifenden Sicht stellt sich der Mensch als ein Wesen dar, das sich in Beziehungsnetzwerken zu seiner Umwelt entwickelt. Mit dieser Sichtweise besteht ein guter Anschluss an die Erforschung sozialer Netzwerke (Häußling 2009) und die Theorie sozialer System (Luhmann 1984).
Das bedeutet grundlegend, dass der bei der Geburt aus der physischen Mutter-Kind-Einheit zur Individuation getriebene Mensch, von Unlustzuständen geprägt, zur Wiederherstellung positiver Befindlichkeit gedrängt ist. Damit lässt sich eine humanökologische Perspektive der Bindungstheorie begründen.
Humanökologie
Die Humanökologie lässt sich als die ökologische Perspektive in den Humanwissenschaften zusammenfassen (Knötig 1976; Tretter 1988; Glaeser 1989; Serbser 2004). Sie kam in den 1970er Jahren auf und fokussiert sich als »Individualökologie« im Kern auf die Beziehungen der Person zu ihrer Umwelt. Humanökologie ist somit die humanwissenschaftliche Variante der allgemeinen Ökologie. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Ökologie ursprünglich als Wissenschaft von den »Beziehungen des Lebewesens zur umgebenden Außenwelt« (Haeckel 1866) und kurz darauf als Wissenschaft vom »Haushalt der Natur« bezeichnet wurde (Haeckel 1870). Damit sind Stoff- und Energieströme zwischen Lebewesen und Umwelt gemeint, die sich bei systemischer Betrachtung als Kreisläufe darstellen und die die »Systemökologie« charakterisieren. »Haushalt« heißt in diesem Zusammenhang dann, dass das Verhältnis von Inputs zu Outputs betrachtet wird: Ist der energetische Output größer als der Input, dann liegt der Haushalt im negativen Bereich. Wenn der Input größer ist als der Output, dann ist die Bilanz positiv. In der Individualökologie entspricht dies beispielsweise den monetären Einnahmen und Ausgaben des Haushalts einer Person oder einer Familie. Allgemeiner formuliert bezeichnet im ökologischen Kontext der Begriff »Haushalt« das »Verhältnis von Beziehungen« des Organismus oder seine »Beziehungs-Beziehungen« zur Umwelt. Praktisch formuliert und auf die Bindungsthematik bezogen, handelt es sich um das Verhältnis von »Geben« und »Nehmen« oder »Geben« und »Fordern«, wie es oben bereits angesprochen wurde.
Zirkuläre Beziehungen Für die ökologische Perspektive ist im Rahmen der Beziehungstheorie der Umstand wichtig, dass Beziehungen des Lebewesens zur Umwelt häufig bidirektional verlaufen, also Schalt- oder Regelkreise sind. Kennzeichnend für den ökologischen Ansatz ist der »Beziehungszirkel« zwischen Lebewesen und Umwelt. Er wird konkreter in Hinblick auf vitale Funktionen bei Tieren als »Funktionskreis« (v. Uexküll 1909, v. Uexküll & Kriszat 1970), als beim Menschen identifizierbarer sensomotorischer »Gestaltkreis« (v. Weizsäcker 1940), als allgemeiner »Regelkreis der Lebensführung« (Schipperges et al. 1988) oder als »Situationskreis« (v. Uexküll & Wesiack 1988) bezeichnet.
Was die betreffenden systemisch orientierten Theorien anbelangt, stehen Gleichgewichtstheorien bzw. Theorien des diskreten Nichtgleichgewichts und Theorien im Vordergrund, die dynamische Prozesse im Fokus haben. Damit sind insbesondere systemtheoretischeGrundkonzepte für ökologische Theorien von großer Attraktivität. Ein Kernmodell ist das erwähnte Regelkreismodell, das das oft beobachtete Streben des Organismus nach Balance in einem qualitativ-kategorialen Rahmen gut abbildet. Insofern Systemtheorien im Allgemeinen Verhältnisse von kausalen Beziehungen zwischen System und Umwelt behandeln, kann der Begriff der »Beziehungen« bzw. der »Wirkungen« im Besonderen zum Ausgangspunkt wissenschaftlicher Betrachtungen gewählt werden. In Hinblick darauf sollen nun einige weitere Überlegungen zum Begriff »Beziehung« erörtert werden.
Was sind eigentlich Beziehungen? »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt«, und: »Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache«, so formulierte der Philosoph Ludwig Wittgenstein das Problem der analytischen Semantik (Wittgenstein 1963, Satz 5.6, S.118; Wittgenstein 2003, §43). In dieser Hinsicht gibt es wohl kaum einen abstrakteren Begriff, der einen größeren Umfang hat und in mehr Sprachwelten verwendet wird, als der Begriff »Beziehung«. Der Ausdruck »Beziehung« bedeutet grundlegend das Bezogensein, die Relation von etwas zu etwas anderem. Bereits in der Alltagssprache verwenden wir den Beziehungsbegriff, um unser Verhältnis zu anderen Menschen zu charakterisieren, es ist die Rede von guter oder schlechter Beziehung, von finanzieller oder emotionaler Beziehung, von Bindung und dergleichen, so als zöge die Person Fäden mit bestimmter Stärke, Elastizität oder Farbe zu ihrer personellen Umwelt.
Im hier naheliegenden Kontext der Psychoanalyse gibt es umfassende Diskussionen der Therapeut-Patient-Beziehung, wie sie beispielsweise von Thea Bauriedl besonders ausführlich erörtert wurde (Bauriedl 1984). In der Philosophie geht man grundsätzlich von der Bezogenheit als »Intentionalität« des Menschen aus, insofern seine Bewusstseinsakte auf bewusstseinsexterne Objekte bezogen sind. Die Ökologie zielt aber auf eine abstraktere Bedeutungsebene, wie sie etwa in der Mathematik vorliegt: Dort wird der Beziehungsbegriff im Rahmen der Mengenlehre mit dem Ausdruck »Relation« charakterisiert, in dem damit Beziehungen zwischen Elementen einer oder verschiedener Mengen bezeichnet werden (Bronstein et al. 2013, S.339). Auch der sinnverwandte Begriff »Struktur« kann so als Gefüge der Relationen oder der Beziehungen verstanden werden (Bronstein et al. 2013, S.339). Im Arbeitsgebiet der Statistik ist eine Beziehung bei einer Korrelation im Sinne einer Wechselbeziehung (»Interaktion«) gegeben. Die Korrelation erlaubt auch unter Umständen die Behauptung einer kausalen Beziehung. Dabei hat der Begriff der Wechselbeziehung, also der Interaktion, aus statistischer Sicht nur eine formale Bedeutung.
Beispielsweise wird in der aktuellen Gen-Umwelt-Interaktionsforschung kein verbindender kausaler Mechanismus identifiziert (Caspi et al. 2002): Es wurde beispielsweise festgestellt, dass ein großes Ausmaß frühkindlicher Misshandlung zu einer starken späteren Dissozialität führen kann, und zwar dann, wenn eine bestimmte Genvariante vorliegt, die stressrelevante Transmitter schlechter abbaut als bei Vorliegen einer anderen Genvariante. Dieser Genotypus hat aber einen protektiven Effekt gegenüber dem Auftreten dissozialen Verhaltens bei einem niedrigen Ausmaß frühkindlicher Misshandlung. Es liegt daher keine einfache kausale Beziehung im Sinne einer einsinnigen Wirkung der Gene vor, sondern es liegen kompliziertere Verhältnisse vor, unter Umständen mit »Cofoundern« (Ottman 1996). Dieser Sachverhalt lässt sich aber nur formal beschreiben, denn die Wechselwirkungen der einzelnen Organisationsniveaus des Organismus lassen sich nicht weiter spezifizieren. Also mit einem pointierteren Beispiel zum Verhältnis von beobachteter Korrelation und »mechanistischen Erklärung« ausgedrückt: Der Satz eines Sozialministers, dass die Renten sicher sind, kann den Spiegel von molekularen Stressmediatoren wie Noradrenalin oder Cortisol reduzieren, dazwischen sind aber Prozessstufen wie Spracherkennung, Selbstkompetenzerleben, individuelle Interpretation der Lebenslage, Zustand der Hypophyse, des Hirnstamms, des vegetativen Nervensystems und der Nebennierenrinde wichtige organismische Systemebenen, die nicht nur unidirektional, sondern bidirektional über Feed-back-Loops miteinander gekoppelt sind.
Diese wenigen Beispiele der Varianten des Begriffs »Beziehung« lassen erkennen, dass dieser – wie der Begriff »Umwelt« – mehrere relevante semantische Dimensionen aufweist. Versucht man diese Bedeutungsvielfalt systematischer zu betrachten, dann sind einige Aspekte besonders relevant (Tab.4; vgl. Tretter 2008):
epistemologische Aspekte:
Beziehungen sind zwar in jedem Fall Konstruktionen des Geistes, aber nicht nur: Zwei physische Objekte befinden sich nahe beieinander oder sind voneinander entfernt, eine zeitliche Beziehung besteht bereits in der Ko-Existenz, somit ist die raumzeitliche Bezogenheit auch eine elementare ontologische Kategorie. Es ist festzustellen, dass es
reale äußere Beziehungen
gibt, die sich etwa in der Interaktion zwischen Personen zeigen, aber dazu gibt es auch
innere Bilder
von dieser Interaktion, also das, was mit den »inner working models« in der Beziehungstheorie gemeint ist. Anders gesagt, ist zwischen
gelebten
und
erlebten
Beziehungen zu unterscheiden;
zeitliche Aspekte:
Vergangene Beziehungen determinieren teilweise gegenwärtige und zukünftige Beziehungen;
Ortsbezug:
Dieser Aspekt ist insofern besonders bedeutsam, als insbesondere lokale Landschaften, Häuser oder Quartiere eine Heimat sein können bzw. insofern als »Heimat« ein Erleben einer besonderer Ortsbezogenheit ist. Auch können Aufenthaltsorte ein »Territorium« sein, und umgekehrt sind Territorien Aufenthaltsorte. Bereits für Kinder sind »Nischen« in der Wohnung oder auch das Kinderzimmer entsprechende Territorien, in denen sie sich aufhalten wollen und Schutz haben. Bei Umzug oder Strukturveränderungen in der Wohnung treten nicht selten ähnliche Störungen auf wie beim Verlust einer Bindungsperson. Dieser Bezugsverlust entspricht im Extremfall der »Entwurzelung«.
Direktionalität:
Die Richtung einer Beziehung – »ich habe eine Beziehung zu A, aber A hat keine Beziehung zu mir, A reagiert nicht auf mich« – drückt die Gerichtetheit von Beziehungen aus. Der Beziehungsbegriff ist somit dialektisch: ein »Hin zu« B bedeutet ein »Weg von« A und korrespondiert mit dem Vektorkonzept des Feldpsychologen Kurt Lewin in seinem topologischen Konzept des »Lebensraums« (Lewin 1936, vgl. Miller 1986, Kruse et al. 1990).
Betrachtet man den Begriff des »Beziehungshaushalts« oder der »Beziehungsbeziehungen«, dann stellt sich in der psychotherapeutischen Praxis die Frage nach dem Verhältnis bzw. der »Reziprozität« der Geben-nehmen-Relationen zwischen zwei Personen: Wer liebt wen mehr, und woran kann man das erkennen? Allgemeiner formuliert, ist das Verhältnis der ökologischen Valenz der Umwelt und der ökologischen Potenz des Lebewesens als »Passung« zu beurteilen: Ist eine »Komplementarität« oder »Konkordanz« oder »Kongruenz« – als Kernkonstrukte der Ökologie der Beziehungen – gegeben? Das ist bedeutsam für die medizinische Ökologie, etwa im Kontext der Stresspathologie (s.u.).
Tab. 4: Einige Dimensionen des Begriffs »Beziehung« (vgl. Tretter 2008)
Zusammenfassend kann aus ökologischer Sicht ein Bild zum Beziehungsgefüge der Person skizziert werden, insofern ein virtuelles System von Sphären (oder Orbits) besteht, in denen sich Umweltobjekte befinden, deren Wichtigkeit und Bindungsvalenz durch Nähe innerhalb des Orbits charakterisiert ist. Die Person nutzt diese Umweltobjekte als Territorien, Schutzhüllen, als erweitertes Selbst und dergleichen.
Was bedeutet dies alles für den Begriff »Bindung«? Bindung ist im beziehungstheoretischen Sinn ein Beziehungsverhältnis einer Person zu einer anderen Person, das eine zeitlich relativ invariante hohe Intensität und/oder gute Qualität bzw. Modalität aufweist. Oder anders gesagt: Bei zeitlich invarianten, engen Beziehungsmustern kann von »Bindung« gesprochen werden.
Aus ökologischer Sicht ist »Bindung« aber nicht nur »interpersonell« bzw. »sozial« und nach Nähe, Stabilität, Balance (Geben/Nehmen) charakterisiert, sondern kann sich auch gegenüber anderen »Umwelten« – z.B. Landschaften als »Heimat« (z.B. Urlaubsorte) – zeigen. Das sind zwar Ersatzbeziehungen, die aber in zunehmend depersonalisierten Lebenswelten, wie sie in Millionenstädten gegeben sind, pathoplastische Bedeutung erlangen.
Ökologische Medizin
Die konzeptionelle Ausweitung der Medizin zu einer ökologischen Perspektive wurde in Deutschland bereits in den 1970er Jahren von einem der Begründer der modernen Sozialmedizin, Hans Schaefer, vorgeschlagen (Schaefer & Blohmke 1978): Schaefer fasste im Rahmen eines 2×2-Faktoren-Modells – Person: Psyche und Soma; Umwelt: Technik und Soziales – den pathogenen Einfluss von Ernährung als »Soziosomatik« begrifflich zusammen, ebenso wie er bei somatischen Störungen als Folge der Einwirkung von physiochemischen bzw. technischen Faktoren von der »Technosomatik« sprach. Die »soziopsychische« Wirkachse entspricht dem klassischen Modell vom psychosozialen Stress, zu »technopsychische« Wirkungen gehört beispielsweise der Lärm.
Dieses Modell berücksichtigt aber die Wechselbeziehungen zwischen Person und Umwelt zu wenig, etwa in Form der erwähnten »zirkulären Kausalität«, die bei der Pathogenese als besonders wichtig erachtet wird. Dies wird in Hinblick auf eine ökologische Konzeption des Stressmodells, die durchweg therapiepraktische Konsequenzen hat, deutlich: Die »Ökologie des Stress« (vgl. Hobfoll 1988) ergibt sich aus dem vierstelligen Beziehungsverhältnis aus Bedürfnissender Person im Hinblick auf die Kompetenzder Person, diese Bedürfnisse zu befriedigen, und zwar hinsichtlich der Angebote der Umwelt und den damit verbundenen Anforderungen der Umwelt, diese Angebote auch wahrnehmen oder ergreifen zu können. Beispielsweise setzen Forderungen an die Person, ihre Bedürfnisse durch Umweltangebote zu befriedigen, hohe (z.B. finanzielle) Kompetenzen voraus. Somit ist die die Belastung erlebende Person nicht nur Opfer, sondern auch Mittäter ihres Lebensgefühls, insofern die Ansprüche im Verhältnis zu den Kompetenzen zu hoch sind. Die Stressreduktion ist möglich durch Training oder Arbeit an den Kompetenzen, diese Barrieren zu überwinden, oder die Bedürfnisse werden reduziert, und/oder es werden andere Umwelten aufgesucht.
Im Hinblick darauf ist, für die Praxis der helfenden Berufe gedacht, ein basales Modell der »Regelkreise der Lebenswelt« recht hilfreich: Die Wirkgrößen »Lebenslage« als Umwelt, »Lebensplan« als Handlungspläne, »Lebensgefühl« als Befindlichkeit und »Lebensstil« als pathogenes Verhaltensmuster können in einen funktionalen Zusammenhang gesetzt werden. So ist das jeweilige klinische Problem eingebettet in ein Verhaltensmuster der Lebensführung (Lebensstil), das Ausdruck eines Lebensgefühls ist, das seinerseits aus dem Verhältnis von Lebensplan (Sollwert) und Lebenslage (Istwert) resultiert: Beispielsweise führen Pläne von Jugendlichen, autonom zu sein, angesichts der Noch-Abhängigkeit als Istwert zu individualisierten kompensatorischen Lebensstilen, die Zugang zu Subkulturen ermöglichen. Dies kann auch ein Pfad in die Welt der Drogen und der Drogenszenen sein. Bei der Therapie ist ein derartiges symptomübergreifendes Leitmodell im Sinne der »Ökologie der Sucht« sodann hilfreich (Tretter 1998).
Ökologie der Sucht
Versucht man nun dieses Rahmenkonzept auf ein klinisches Syndrom wie die Sucht anzuwenden, dann entsteht ein recht praxisnahes Orientierungsmodell. Es ist ein beziehungstheoretisches Modell, das die Bindungstheorie umformuliert und integriert, was hier aber nur schematisch skizziert werden kann (vgl. Tretter 1998): Die funktionelle Bedeutung des Bindungssystems, das physische oder mentale Nähe zu Bindungspersonen realisiert, ist angetrieben vom Bedürfnis nach Sicherheit bzw. von der (zumindest vielleicht pränatalen) Erfahrung des Zustandes der Sicherheit, der Ruhe, Entspannung. Der Aufenthalt bei der Bindungsperson ermöglicht dem Säugling bzw. dem Kleinkind weitere Operationen, die Umwelt zu explorieren, Neues auszuprobieren usw. Insgesamt fungiert die Bindungsperson als externe Regulationshilfe von Affekten und Motiven, sie hilft jedoch, auch Umweltzustände zu kontrollieren und Orientierungen in Bezug auf diese zu vermitteln. Damit ist die Bindungsperson für die innere und äußere psychische Homöostase, also für das Gleichgewicht der Affekte und Motive wie eben auch für das Gleichgewicht der Beziehungen relevant. Die im Laufe der Zeit gemachten Bindungserfahrungen werden in den inneren Arbeitsmodellen repräsentiert, etwa der Art, dass erfahren wird: Ich bin eine Person, die getragen, beschützt, unterstützt und der geholfen wird.
Eine sichere Bindung ist ein Schutzfaktor gegen Sucht und eine unsichere Bindung ein Risikofaktor für späteren Substanzmissbrauch. Primäre unsichere Bindungsmuster in der frühen Kindheit sind Risikofaktoren für eine starke Bindung an das Suchtmittel. Aus familiensystemischer Sicht findet sich bei Suchtkranken hingegen oft ein typisches Bindungsmuster mit einem ängstlich vermeidenden Jugendlichen, einer anklammernden Mutter und einem abweisenden Vater (Schindler 2013, S. 24). Schindler sieht aber wie andere Autoren in der Adoleszenz eine zweite Chance, insofern ein Schub der Autonomisierung auftritt und die Bindungsdefizite durch Peers kompensiert werden können. Insofern aber die drogenbezogenen Bezugsgruppen neue Bindungsvalenzen darstellen, ist dennoch ein deutliches Risiko für eine »Ersatzbindung« an die Substanz und an die Drogenszene gegeben.
In diesem Zusammenhang sind systemische, d.





























