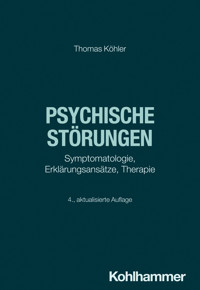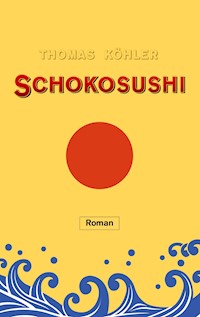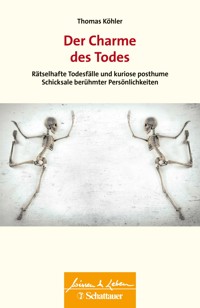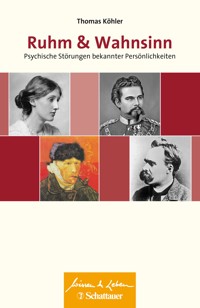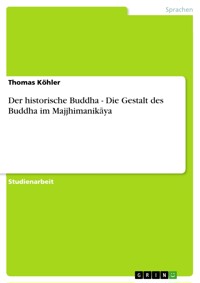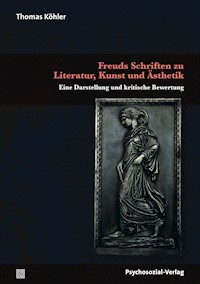30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Neuauflage des Bandes liefert eine aktuelle Einführung in die biologischen Grundlagen wichtiger psychischer Störungen, z. B. Demenzen, Schizophrenie, affektive Störungen, Angststörungen. Bedeutende biologische Befunde – u. a. in Bezug auf Hirnveränderungen und Störungen im Transmitterhaushalt – und darauf basierende Theorien zur Ätiopathogenese werden gut verständlich dargestellt. In der Neuauflage wurden insbesondere neue Erkenntnisse zu demenziellen Störungen, zu den Wirkweisen psychotroper Substanzen und zu neuen Behandlungsmöglichkeiten von Abhängigkeitserkrankungen berücksichtigt. Ein einführendes Kapitel widmet sich den Grundlagen der synaptischen Übertragung, den Eigenschaften der wichtigsten Transmittersysteme sowie den biopsychologischen Forschungsmethoden. Zu den einzelnen Störungen werden aktuelle Informationen zu Symptomatik, Verlauf, Epidemiologie, genetischen Faktoren sowie zu biologischen Befunden referiert. Darauf aufbauend werden biologische Erklärungsmodelle sowie biologische Interventionsverfahren – speziell die psychopharmakologische Behandlung – und ihre angenommenen Wirkmechanismen aufgezeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thomas Köhler
Biologische Grundlagen psychischer Störungen
3., überarbeitete Auflage
Prof. Dr. med. Dr. phil. Thomas Köhler, geb. 1949. Studium der Medizin, Psychologie und Mathematik in München. Tätigkeit als Arzt und anschließend Assistent am Psychologischen Institut der Universität Würzburg sowie am Fachbereich Psychologie der Universität Hamburg. 1990 Habilitation. 1997 Ernennung zum a. o. Professor. 2012 bis 2018 Vertretung der Professur für Klinische Psychologie an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Die erste Auflage des Buches ist 1999 im Thieme Verlag (Stuttgart) erschienen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Beate Hautsch, Göttingen
Format: EPUB
3., überarbeitete Auflage 2019
© 2005 und 2019 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2827-7; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2827-8)
ISBN 978-3-8017-2827-4
http://doi.org/10.1026/02827-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|5|Vorwort zur 3. Auflage
Erfreulicherweise ergibt sich nun die Gelegenheit, eine überarbeitete Version dieser Monografie auf den Markt zu bringen. Es ist eine traurige Erkenntnis, dass vieles, was in der letzten Auflage als einigermaßen gesicherte Erkenntnis präsentiert wurde, sich mittlerweile zwar nicht gerade als zweifelsfrei widerlegt, aber zumindest doch als nicht sicher bestätigt herausgestellt hat – und was noch deprimierender erscheint, auch plötzlich aus dem wissenschaftlichen Interesse gerückt ist. Diese Einsicht hat mich auch dazu gebracht, nun nicht mehr jede Einzeluntersuchung zu präsentieren, sondern den Text wesentlich zu entschlacken und nur mehr breiter akzeptierte Thesen und ihre (vielleicht nur vorläufigen) Belege zu skizzieren. Der frei gewordene Raum konnte andererseits sinnvoll dazu benutzt werden, neuere Forschungsmethoden vorzustellen und den seinerzeit wenig beachteten Demenzen ein größeres Augenmerk zu verschaffen.
Wie schon im Vorwort zur ersten und zweiten Auflage, soll noch einmal in aller Deutlichkeit die Intention dieser Monografie herausgestellt werden: Es handelt sich nicht um ein Nachschlagewerk für Fachleute (schon gar nicht für biologische Psychiater). Solche Werke, von denen im amerikanischen Sprachraum einige zum Thema der biologischen Psychiatrie existieren, sind erheblich umfangreicher, meist von einer Vielzahl von Autoren verfasst und meines Erachtens für nicht ausgesprochene Fachleute oft schwer verständlich. Hier soll hingegen eine Einführung in die biologischen Grundlagen psychischer Störungen gegeben werden, was die ausführlichere Behandlung von Sachverhalten erfordert, welche Kennern der Materie als ausgesprochen trivial erscheinen müssen; zudem sind zuweilen gewisse Vereinfachungen und Verkürzungen der komplexen Sachverhalte unvermeidlich.
Auch kann und soll nicht jeder biologische Aspekt jeglicher psychischen Störung dargestellt werden. Oft wurde versucht, zumindest diesbezügliche Andeutungen zu machen und in diesem Zusammenhang einschlägige Literaturhinweise zu liefern. Es ist zuzugeben, dass die zwar zahlenmäßig weiter reduzierten, jedoch immer noch recht zahlreichen Quellenangaben im Text nicht unbedingt die Lesbarkeit fördern. Andererseits soll und darf es sich nicht um eine populärwissenschaftliche Einführung handeln; augenblicklich liegen noch zu wenig gesicherte Erkenntnisse vor, um diese als Faktenwissen zu präsentieren, welches nicht mehr detaillierte Belege erfordert.
|6|Es ist sicher nicht überflüssig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass zahlreiche Medikamente – keineswegs immer vollständig, schon gar nicht bezüglich der diversen Handelsnamen – aufgeführt sind, dass dies jedoch nicht als Therapieanweisung zu verstehen ist. Zwar werden wiederholt Indikationen, Nebenwirkungen und Kontraindikationen genannt, dies aber unsystematisch und nicht zuletzt insbesondere zur Verdeutlichung biopsychologischer Zusammenhänge. Selbstverständlich ist vor dem Einsatz eines der genannten Medikamente genaueste aktuelle Information einzuholen.
Gemäß der Intention, ein nicht allzu umfangreiches Buch vorzulegen, wurde gegenüber den früheren Auflagen keine Erweiterung des Stoffumfanges vorgenommen – ausgenommen zu den Demenzen –, sondern hauptsächlich eine Aktualisierung versucht; dies betrifft insbesondere die Einarbeitung neuerer Erkenntnisse zu den Wirkweisen psychotroper Substanzen und zu neuen Behandlungsmöglichkeiten von Abhängigkeit, weiter zu Transmitterhypothesen von Schizophrenie und Depression, schließlich mussten Medikamente eliminiert werden, die heute nicht mehr im Handel sind, dafür neu hinzugekommene aufgeführt werden.
Dem Hogrefe Verlag danke ich für das Publikationsangebot und für wertvolle Hinweise und Korrekturen; besonders verbunden bin ich Frau Kerstin Kielhorn, die das Manuskript mit bemerkenswerter Gründlichkeit bearbeitet hat. Wie immer gilt ein Dank meiner lieben Frau Carmen, die unter erstaunlichem Wohlwollen (mehr oder weniger) freundlich wieder einmal die langwierige Abfassung einer Monografie begleitet hat.
Hamburg, im Januar 2019
Thomas Köhler
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte, Grundlagen und Forschungsmethoden der biologischen Psychiatrie
1.1 Geschichte der biologischen Psychiatrie
1.2 Biologische Grundlagen
1.2.1 Vorbemerkungen
1.2.2 Synaptische Übertragung
1.2.3 Bahnensysteme
1.2.4 Das „mesotelencephale Belohnungssystem“
1.2.5 Das vegetative Nervensystem und seine pharmakologische Beeinflussung
1.3 Methoden der biologischen Psychiatrie
1.3.1 Überblick
1.3.2 Bildgebende Verfahren
1.3.3 Spontan-EEG und evozierte Potenziale
1.3.4 Neurochemische und Rezeptorbindungsstudien
1.3.5 Pharmakologische Provokationstests
1.3.6 Bestimmung der Genexpression
1.3.7 Koppelungsstudien und molekulargenetische Methoden
1.3.8 Transgene und „Knockout“-Mäuse
2 Demenzen
2.1 Amnestisches, delirantes und demenzielles Syndrom
2.2 Demenz bei Alzheimer-Krankheit
2.2.1 Symptomatik; Verlauf; Diagnostik
2.2.2 Ersterkrankungsalter; Epidemiologie
2.2.3 Familiäre Häufung und Vererbung
2.2.4 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
2.2.5 Therapie
2.3 Weitere Formen von Demenz
2.3.1 Vaskuläre Demenz
2.3.2 Frontotemporale Demenzen und Pick-Krankheit
2.3.3 Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
2.3.4 Huntington-Krankheit
2.3.5 Demenz mit Lewy-Körperchen und Demenz bei Parkinson-Krankheit
2.3.6 Demenz bei HIV-Erkrankung (AIDS-Demenz)
2.3.7 Weitere Ursachen für demenzielle Syndrome
2.4 Zusammenfassung
3 Psychotrope Substanzen und assoziierte Störungen
3.1 Überblick
3.2 Alkohol
3.2.1 Allgemeines
3.2.2 Unmittelbare Wirkungen von Alkohol; akute Intoxikation
3.2.3 Alkoholtoleranz und Alkoholentzugssyndrome
3.2.4 Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit
3.2.5 Folgen des Alkoholmissbrauchs
3.2.6 Biologische Therapien von Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit
3.3 Opioide (Opiate)
3.3.1 Allgemeines
3.3.2 Unmittelbare Wirkungen der Opioide; akute Intoxikation
3.3.3 Opioidtoleranz und Opioidentzug
3.3.4 Opioidmissbrauch und Opioidabhängigkeit
3.4 Sedativa und Hypnotika
3.4.1 Allgemeines
3.4.2 Unmittelbare Wirkungen der Sedativa und Hypnotika; akute Intoxikation
3.4.3 Toleranz und Entzugssymptomatik
3.4.4 Missbrauch und Abhängigkeit
3.5 Kokain und Psychostimulanzien
3.5.1 Allgemeines
3.5.2 Unmittelbare Wirkungen von Kokain und Psychostimulanzien; akute Intoxikation
3.5.3 Toleranz und Entzugssymptomatik
3.5.4 Missbrauch und Abhängigkeit
3.6 Cannabis und synthetische Cannabinoide
3.6.1 Allgemeines
3.6.2 Unmittelbare Wirkungen von Cannabis und synthetischen Cannabinoiden; akute Intoxikation
3.6.3 Toleranz und Entzugssymptomatik
3.6.4 Missbrauch und Abhängigkeit
3.7 Halluzinogene
3.7.1 Allgemeines
3.7.2 Unmittelbare Wirkungen von Halluzinogenen; akute Intoxikation
3.7.3 Toleranz und Entzugssymptomatik; Missbrauch und Abhängigkeit
3.8 Nikotin und Tabak
3.8.1 Allgemeines; Überblick
3.8.2 Unmittelbare Wirkungen von Nikotin und Tabak
3.8.3 Toleranz und Entzugssymptomatik – Nikotinsucht und ihre Folgen
3.9 Flüchtige Lösungsmittel (Inhalanzien, „Schnüffelstoffe“)
3.10 Zusammenfassung
4 Schizophrenie
4.1 Symptomatik; Unterformen
4.2 Erstmanifestationsalter und Verlauf
4.3 Epidemiologie
4.4 Familiäre Häufung und Vererbung
4.5 Biologische Befunde
4.5.1 Morphologische Veränderungen
4.5.2 Funktionelle Veränderungen
4.5.3 Neurochemische und neuroradiologische Studien zu Transmittersystemen
4.5.4 Untersuchungen zu prä- und perinatalen Risikobedingungen
4.5.5 Neurologische und psychophysiologische Untersuchungen
4.6 Biologische Erklärungsansätze
4.6.1 Vorbemerkungen; die Entzündungshypothese der Schizophrenie
4.6.2 Die Dopaminhypothese
4.6.3 Die Glutamathypothese
4.6.4 Die Serotoninhypothese
4.6.5 Annahmen zur Ätiologie
4.7 Biologische Therapien
4.7.1 Nichtmedikamentöse Behandlung
4.7.2 Medikamentöse Therapie
4.8 Zusammenfassung
5 Affektive Störungen
5.1 Depressives und manisches Syndrom
5.2 Formen affektiver Störungen
5.3 Erstmanifestationsalter und Verlauf
5.4 Epidemiologie
5.5 Familiäre Häufung und Vererbung
5.6 Biologische Befunde
5.6.1 Morphologische Veränderungen
5.6.2 Funktionelle Besonderheiten
5.6.3 Rezeptorbindungsstudien
5.6.4 Neurochemische Studien
5.6.5 Untersuchungen zu hormonellen Regulationsstörungen
5.6.6 Schlafstudien
5.6.7 Immunologische Untersuchungen
5.7 Biologische Erklärungsansätze
5.7.1 Die Monoaminhypothese
5.7.2 Weitere Hypothesen
5.7.3 Annahmen zur Ätiologie
5.8 Biologische Therapien
5.8.1 Übersicht; Historisches
5.8.2 Antidepressiva
5.8.3 Weitere biologische Verfahren zur Behandlung depressiver Syndrome
5.8.4 Medikamente zur Phasenprophylaxe
5.8.5 Therapie manischer Syndrome
5.9 Zusammenfassung
6 Angst-, Zwangs- und Belastungsstörungen
6.1 Überblick
6.2 Phobien
6.2.1 Formen; Verläufe; Epidemiologie
6.2.2 Familiäre Häufung und Vererbung
6.2.3 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
6.2.4 Biologische Therapien
6.3 Panikstörung
6.3.1 Symptomatik; Verlauf; Epidemiologie
6.3.2 Familiäre Häufung und Vererbung
6.3.3 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
6.3.4 Biologische Therapien
6.4 Generalisierte Angststörung
6.4.1 Symptomatik; Verlauf; Epidemiologie
6.4.2 Familiäre Häufung und Vererbung
6.4.3 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
6.4.4 Biologische Therapien
6.5 Zwangsstörungen
6.5.1 Symptomatologie; Verlauf; Epidemiologie
6.5.2 Familiäre Häufung und Vererbung
6.5.3 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
6.5.4 Biologische Therapien
6.6 Posttraumatische Belastungsstörung
6.6.1 Symptomatik; Verlauf; Epidemiologie
6.6.2 Familiäre Häufung und Vererbung
6.6.3 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
6.6.4 Biologische Therapien
6.7 Zusammenfassung
7 Ess-, Schlaf- und sexuelle Funktionsstörungen
7.1 Vorbemerkungen
7.2 Essstörungen: Anorexia und Bulimia nervosa
7.2.1 Die Regulation des Essverhaltens
7.2.2 Symptomatik; Verlauf; Epidemiologie
7.2.3 Familiäre Häufung und Vererbung
7.2.4 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
7.2.5 Biologische Therapien
7.3 Schlafstörungen
7.3.1 Ablauf und Regulation des normalen Schlafs
7.3.2 Formen von Schlafstörungen; Symptomatik; Verlauf und Epidemiologie
7.3.3 Familiäre Häufung und Vererbung
7.3.4 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
7.3.5 Biologische Therapien
7.4 Sexuelle Funktionsstörungen
7.4.1 Der sexuelle Funktionszyklus
7.4.2 Sexuelle Funktionsstörungen: Einteilung und Überblick
7.4.3 Appetenzstörungen
7.4.4 Störungen der Erregung
7.4.5 Orgasmusstörungen
7.4.6 Ejaculatio praecox
7.4.7 Dyspareunie
7.5 Zusammenfassung
8 Persönlichkeitsstörungen; Störungen der Geschlechtsidentität und der Sexualpräferenz
8.1 Überblick
8.2 Persönlichkeitsstörungen
8.2.1 Allgemeines
8.2.2 Schizotype Persönlichkeitsstörung (schizotype Störung nach ICD-10)
8.2.3 Borderline-Persönlichkeitsstörung
8.2.4 Dissoziale (antisoziale) Persönlichkeitsstörung
8.3 Störungen der Geschlechtsidentität und der Sexualpräferenz
8.3.1 Überblick
8.3.2 Transsexualismus
8.3.3 Pädophilie
8.4 Zusammenfassung
9 Intelligenzminderung; Entwicklungsstörungen; psychische Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend
9.1 Vorbemerkungen
9.2 Intelligenzminderung
9.2.1 Definition; Symptomatik; Unterformen
9.2.2 Epidemiologie
9.2.3 Familiäre Häufung und Vererbung
9.2.4 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
9.2.5 Biologische Therapien
9.3 Frühkindlicher Autismus
9.3.1 Definition; Symptomatik; Verlauf
9.3.2 Epidemiologie
9.3.3 Familiäre Häufung und Vererbung
9.3.4 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
9.3.5 Biologische Therapien
9.4 Hyperkinetische und Aufmerksamkeitsstörungen
9.4.1 Definition und Symptomatik
9.4.2 Erstmanifestationsalter und Verlauf
9.4.3 Epidemiologie
9.4.4 Familiäre Häufung und Vererbung
9.4.5 Biologische Befunde und Erklärungsansätze
9.4.6 Biologische Therapien
9.5 Zusammenfassung
Literatur
Sachregister
|13|1 Geschichte, Grundlagen und Forschungsmethoden der biologischen Psychiatrie
1.1 Geschichte der biologischen Psychiatrie
Direkteren Bezug zur heutigen biologischen Psychiatrie haben Arbeiten etwa aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, beispielsweise jene, in denen die Beziehung zwischen Progressiver Paralyse und Syphilis diskutiert wurde. Der von Krafft-Ebing 1897 geführte Nachweis, dass Inokulation von Eiter aus syphilitischen Geschwüren bei Paralysepatienten nicht zur Infektion führte, sie also bereits zuvor mit dem Erreger konfrontiert gewesen sein mussten, lässt sich mit Recht als Geburtsstunde der modernen biologischen Psychiatrie betrachten.
Bereits zuvor finden sich modern anmutende, heute weitgehend in Vergessenheit geratene biologische Auffassungen, so die neurochemischen Theorien psychopathologischer Zustände von Theodor Meynert oder Freuds neurophysiologisches Modell der Neurosenbildung, wie im erst posthum veröffentlichten „Entwurf einer Psychologie“ niedergelegt (siehe Köhler, 2014b, S. 24 f.). Weitere Beiträge zur biologischen Psychiatrie stellen etwa die Versuche kortikaler Lokalisation von Sprachstörungen (und damit von Sprachzentren) durch P. Broca und C. Wernicke dar.
Als biologisch-psychiatrisch relevante Entdeckungen des frühen 20. Jahrhunderts lassen sich die Erkenntnisse zur Neurotransmission, die Einsichten in Struktur und Funktion des limbischen Systems, die Entwicklung der Elektroenzephalografie durch Berger, daneben die aus psychochirurgischen Eingriffen abgeleiteten Modellvorstellungen zu morphologischen Korrelaten psychischer Auffälligkeiten nennen. Auch die Entwicklung wirkungsvoller, wenngleich damals in ihren Wirk|14|mechanismen schlecht verstandener biologischer Therapien, insbesondere Insulinschock und Elektrokrampftherapie, kann hier nicht unerwähnt bleiben.
Moderne biologische Theorien psychischer Störungen bauen insbesondere auf den mittlerweile weit fortgeschrittenen Kenntnissen über die Neurotransmission und ihre pathologischen Veränderungen auf; somit wird man sinnvollerweise den Anfang der biologischen Psychiatrie in heutiger Gestalt in jene Zeit legen, wo einerseits eine deutlich verbesserte pharmakologische Beeinflussung psychischer Zustände möglich wurde, andererseits zusehends Anstrengungen unternommen wurden, diese Beeinflussung auf dem Hintergrund biochemischer Modelle zu verstehen. Als Zeitpunkt ließe sich deshalb die Entdeckung der antipsychotischen Eigenschaften des Chlorpromazin 1951 und die Formulierung der aus den Nebenwirkungen der Neuroleptikabehandlung abgeleiteten Dopaminhypothese der Schizophrenie ungefähr ein Jahrzehnt später angeben. In etwa den gleichen Zeitraum, die späten 1950er-Jahre, fällt die Entdeckung der antidepressiven Eigenschaften des Imipramin durch R. Kuhn und die Entwicklung der Katecholaminmangelhypothese der Depression durch J. Schildkraut.
1.2 Biologische Grundlagen
1.2.1 Vorbemerkungen
Das biologische Wissen, das zum Verständnis der Grundlagen psychischer Störungen nötig ist, umfasst v. a. Kenntnisse von Genetik, Anatomie, Hormonregulation und Neurotransmission. Sie werden – da größtenteils elementar – als gegeben vorausgesetzt bzw. in den einzelnen Kapiteln nachgetragen. Lediglich die synaptische Übertragung zwischen Neuronen, die Lage gewisser Bahnen, schließlich die Struktur und Funktion des „Belohnungssystems“ sollen als detailliert benötigtes Grundlagenwissen bereits vorab genauer besprochen werden. Gewisse Auslassungen, Vereinfachungen und Ungenauigkeiten im knappen hier gesetzten Rahmen mögen mit Nachsicht betrachtet werden.
1.2.2 Synaptische Übertragung
Abbildung 1: Synaptische Übertragung
Nach der Art der Übertragung unterscheidet man elektrische und chemische Synapsen. Bei den ersteren fließt direkt Strom über verbindende Ionenkanäle vom prä- ins postsynaptische Neuron. Sie sind im ZNS seltener als die chemischen Synapsen, und nach bisherigen Erkenntnissen spielen deren Veränderungen als Korrelat psychischer Störungen keine Rolle.
|16|Bei chemischen Synapsen befindet sich zwischen prä- und postsynaptischem Neuron ein Zwischenraum, der nicht elektrisch überbrückt werden kann (synaptischer Spalt). Zur Weiterleitung der Information werden daher in der präsynaptischen Zelle Stoffe freigesetzt (Transmitter oder Neurotransmitter), die den Spalt überqueren und sich am postsynaptischen Neuron anlagern können.
Tabelle 1: Einteilung der Neurotransmitter
Transmitterkategorie
Beispiele
Ausgangsprodukt
Monoamine
Serotonin
Dopamin
Noradrenalin
Adrenalin
(Histamin)
L-Tryptophan
L-Tyrosin
L-Tyrosin
L-Tyrosin
(L-Histidin)
Aminosäuretransmitter
Glycin
Glutamat
GABA
Glycin oder Serin
Glutamin oder Ketoglutarat
Glutamat
|17|Acetylcholin
Acetylcholin
Cholin und Acetat (aktivierte Essigsäure)
Peptide (Neuropeptide)
Endorphine
Substanz P
Aminosäuren
Weitere hochmolekulare Transmitter
Adenosin (Transmitter aus Gruppe der Nucleoside)
Anandamid (endogenes Cannabinoid aus der Gruppe der Lipidtransmitter)
Diverse Ausgangsstoffe
Lösliche Gase
CO, NO
Die Peptidtransmitter sind die wichtigste, aber keineswegs einzige Gruppe hochmolekularer Transmitter. Ebenso dazu gehört u. a. Adenosin sowie diverse Transmitter mit Lipidstruktur (z. B. das „endogene Cannabinoid“ Anandamid; vgl. Kap. 3.6). Diese hochmolekularen Transmitter, die im Sinne einer „Koexistenz“ zusammen mit niedrigmolekularen aus der präsynaptischen Zelle ausgeschüttet werden können, verändern weniger unmittelbar das Membranpotenzial, sondern greifen tiefer in den Zellstoffwechsel ein (insbesondere die Proteinsynthese durch Steuerung der Genexpression) und haben deshalb die Funktion von Neuromodulatoren. Ein weiteres biogenes, u. a. als Transmitter fungierendes Amin ist Histamin. Die Blockade von Histaminrezeptoren, wie es bei der Behandlung von Allergien geschieht oder als Nebenwirkung zahlreicher Psychopharmaka vorkommt (z. B. von trizyklischen Antidepressiva, Antipsychotika) hat einen deutlich sedierenden Effekt. Eine jüngst entdeckte Transmittergruppe, deren Wirkmechanismen zunehmend besser verstanden werden, sind lösliche Gase wie Stickstoffmonoxid (NO), das u. a. an Gefäßen eine Rolle spielt.
Zum Themenkomplex erregende und hemmende Synapsen, erregende und hemmende Transmitter existieren oft falsche Vorstellungen. Ob die Freisetzung eines |18|Transmitters an der postsynaptischen Nervenzelle eine Depolarisation (Erregung; unmissverständlicher: Exzitation) auslöst oder eine Hyperpolarisation (Dämpfung, Inhibition), hängt von den Eigenschaften der Synapse ab (genauer der Rezeptoren, siehe unten). Es gibt deshalb nicht eigentlich erregende und hemmende Transmitter, sondern nur erregende und hemmende Rezeptoren. Allerdings treffen einige Transmitter bevorzugt auf hemmende Rezeptoren und werden daher etwas ungenau selbst als hemmende Transmitter bezeichnet. Der wichtigste im ZNS ist GABA; ein vornehmlich oder ausschließlich erregender Transmitter ist hingegen Glutamat.
Die Produktion der Transmitter geht nach Aufnahme von Ausgangsprodukten aus dem Extrazellulärraum im präsynaptischen Neuron vor sich.
Die Aminosäuretransmitter Glycin, Glutamat und GABA lassen sich mit der Nahrung aufnehmen, werden in der Regel jedoch in den Neuronen synthetisiert, und zwar Glycin aus Serin, Glutamat aus einem Zwischenprodukt des Zitronensäurezyklus (α-Ketoglutarsäure). GABA (Gamma-Aminobuttersäure; englisch: gamma-aminobutyric acid) entsteht aus Glutamat durch Abspaltung einer der beiden Carboxylgruppen.
Abbildung 2: Synthetisierung von Monoaminen aus Aminosäuren
Monoamine unterscheiden sich von Aminosäuren also durch das Fehlen einer Carboxylgruppe. Somit sind sie nicht mehr liquorgängig und lassen sich bei Mangelzuständen den Neuronen nicht direkt zuführen. Hingegen passieren ihre Vorstufen die Blut-Hirn-Schranke und können deshalb zur Anregung der Transmitterproduktion verabreicht werden (Aminpräkursoren). Bekannt in diesem Zusammenhang ist die Gabe von L-Dopa zur Beseitigung des Dopaminmangels bei der Parkinson-Krankheit.
Acetylcholin wird mittels des Enzyms Cholinacetyltransferase aus Cholin und aktivierter Essigsäure gebildet. Letztgenannte fällt im Körper laufend an, ersterer Stoff wird mit der Nahrung aufgenommen. Insbesondere bei der Alzheimer-Krankheit vermutet man einen Acetylcholinmangel (vgl. Kap. 2.2.4).
Peptidtransmitter bestehen durch die Verbindung von Aminosäuren; ihre Synthese geschieht im Neuron. Als weitgehend ungeladene Moleküle können sie die Liquorschranke nicht passieren.
An Rezeptoren können sich jedoch auch andere Substanzen anlagern, was man pharmakologisch zu nutzen versteht. Diese Stoffe üben teils Wirkung wie die Transmitter aus, beeinflussen also in derselben Weise das Membranpotenzial; man spricht von Transmitteragonisten (in diesem Fall von direkten). Beispiel wäre die Besetzung bestimmter Acetylcholinrezeptoren durch Nikotin mit gleichen Effekten wie Acetylcholin (beispielsweise vegetativen); Nikotin wirkt also cholinagonistisch.
Andere Substanzen hingegen können an den Rezeptoren antagonistisch wirken, d. h. der Transmitterwirkung entgegenarbeiten. Bekanntes Beispiel hierfür sind die Neuroleptika (Antipsychotika), die Dopaminrezeptoren besetzen, ohne postsynaptische Veränderungen hervorzurufen. Sie blockieren damit die Bindungs|20|stellen für die eigentlich biologisch dafür vorgesehen Liganden (die Dopaminmoleküle), erschweren also die Weiterleitung von Erregung der präsynaptischen Zelle (vgl. Abb. 3).
Abbildung 3: Wirkung eines Antipsychotikums auf die Neurotransmitterübertragung
Pharmakologisch bedeutsam ist die Unterscheidung zwischen Ionenkanal- und G-Protein-gebundenen Rezeptoren: Die Besetzung eines (postsynaptischen) Rezeptors durch einen geeigneten Transmitter (oder einen anderen, am Rezeptor agonistisch wirkenden Stoff) führt durch Einstrom oder Austreten von elektrisch geladenen Teilchen zur Veränderung des Membranpotenzials am postsynaptischen Neuron. Im Falle einer Depolarisation treten vermehrt Natrium- oder Calciumionen in die Zelle ein; bei einer Hyperpolarisation strömt Kalium aus oder es erfolgt ein Eintritt negativ geladener Chloridionen in den intrazellulären Raum. Ermöglicht wird dies durch Öffnung der entsprechenden Ionenkanäle. Nach der Art, wie die Rezeptorbesetzung zur Öffnung von Ionenkanälen führt, unterscheidet man zwei Typen von Rezeptoren (vgl. Tab. 2).
Bei den Ionenkanal-gekoppelten (ionotropen) Rezeptoren bewirkt die Besetzung der Bindungsstelle direkt die Öffnung der Kanäle. Ein Beispiel dafür ist der GABAA-Rezeptor; dieser sitzt einem Proteinkomplex auf, welcher einen Chloridionenkanal umgibt; durch Besetzung des Rezeptors mit einem GABA-Molekül verändert der Proteinkomplex seine Struktur und öffnet den Kanal (zum GABAA-Benzodiazepin-Rezeptorkomplex vgl. Kap. 3.4). Auch die Rezeptoren für die anderen Aminosäuretransmitter wie Glutamat und Glycin sind oft direkt an einen Ionenkanal gekoppelt.
|21|Tabelle 2: Gegenüberstellung ionotroper und G-Protein-gebundener Rezeptoren
Ionenkanal-gekoppelte (ionotrope) Rezeptoren
G-Protein-gekoppelte (metabotrope) Rezeptoren
Beispiele
GABAA-Rezeptor
Einige Glutamat-Rezeptoren (etwa der NMDA-Rezeptor)
Nikotinerger Acetylcholin-Rezeptor
GABAB-Rezeptor
Einige Glutamat-Rezeptoren
Muskarinerger Acetylcholin-Rezeptor
Sämtliche Rezeptoren für Dopamin und Noradrenalin
Großteil der Serotonin-Rezeptoren
Opioid-Rezeptoren
Prinzip
Direkte Öffnung des Ionenkanals nach Rezeptorbesetzung durch Liganden (speziell den zugehörigen Transmitter)
Rezeptorbesetzung führt indirekt über Second-messenger-Prozesse (nachgeschaltete Signaltransduktion) zu Veränderung des Ionenkanals
Insbesondere: Abspaltung eines G-Proteins, Aktivierung oder Hemmung der Adenylylcyclase mit Beeinflussung der Bildung von cAMP
Beendigung des Prozesses durch Phosphodiesterase
Pharmakologische Beeinflussung
Anregung durch externe Liganden mit ähnlicher Wirkung wie Transmitter
Blockade des Rezeptors
Wie ionotrope Rezeptoren
Zusätzlich: Beeinflussung der nachgeschalteten Signaltransduktion (z. B. durch Lithiumsalze, Phosphodiesterasehemmer)
Häufiger sind G-Protein-gekoppelte oder second-messenger-gekoppelte oder metabotrope Rezeptoren. Hier führt die Besetzung der Bindungsstelle durch einen geeigneten Liganden erst über eine Reihe von Zwischenschritten zur Veränderung von Ionenkanälen. Vereinfacht ausgedrückt, verändert sich in einem dem Rezeptor benachbarten Komplex ein G-Protein, welches die Bildung weiterer Botenstoffe (second messengers) veranlasst, die sich ineinander umwandeln (second messenger-Kaskade) und deren Endprodukt schließlich am Ionenkanal die Öffnung bewirkt. Der ganze Vorgang wird oft als nachgeschaltete Signaltransduktion zusam|22|mengefasst. Es gibt verschiedene G-Proteine, die jeweils spezifisch für den Rezeptortyp sind und auch zu verschiedenen Formen der Signaltransduktion führen. Beispiele für G-Protein-gekoppelte Rezeptoren sind die für Dopamin, Noradrenalin und Serotonin (wobei ein Subtyp der letzteren eine Ausnahme macht). Eine Anzahl psychoaktiver Substanzen, etwa die zur Prophylaxe affektiver Störungen eingesetzten Lithiumsalze, wirken nicht auf Rezeptorebene, sondern auf der nachgeschalteter Signaltransduktionsprozesse.
Vielfach finden sich an den Außenseiten der präsynaptischen Membran Rezeptoren, die spezifisch für den dort ausgeschütteten Transmitter sind und die präsynaptische Zelle über dessen Konzentration im Spalt informieren. Die stimulatorische Besetzung von Autorezeptoren für Monoamine führt zu geringerer Transmitterproduktion und/oder zu verminderter Ausschüttung im präsynaptischen Neuron.
Wenig bekannt ist, dass es extrasynaptische Rezeptoren gibt, speziell NMDA-Rezeptoren, die nicht durch präsynaptisch ausgeschüttetes, sondern durch „freies“ Glutamat stimuliert werden, was neuromodulatorische Effekte hat. Übermäßige Stimulation (etwa bei toxisch erhöhtem Glutamat) kann durch vermehrten Calcium-Einstrom zum Zelltod führen (Zhou et al., 2015).
Pharmaka, die einen Rezeptor aktivieren, also agonistisch an den postsynaptischen Rezeptoren wirken, können somit durch ihren Effekt am entsprechenden präsynaptischen Autorezeptor gleichzeitig antagonistisch wirken; dies führt, wie bei den verschiedenen prä- und postsynaptisch lokalisierten Subtypen von Serotoninrezeptoren, zu höchst komplexen und keineswegs immer verstandenen Wirkungen. Umgekehrt können Medikamente durch Blockade präsynaptischer Autorezepto|23|ren agonistisch wirken, ein Mechanismus, der – neben der Monoamin-Wiederaufnahmehemmung – u. a. für die trizyklischen Antidepressiva diskutiert wird (vgl. Kap. 5.8.2).
Meist existieren verschiedene Subtypen von Rezeptoren, die alle vom betreffenden Transmitter selbst aktiviert werden, sich aber in ihren pharmakologischen und molekularbiologischen Eigenschaften unterscheiden. Bekanntestes Beispiel sind die muskarinergen und die nikotinergen Acetylcholinrezeptoren. Erstere befinden sich u. a. an parasympathisch innervierten Effektororganen und können sowohl durch Acetylcholin wie Muskarin, jedoch nicht durch Nikotin, aktiviert werden; nikotinerge Rezeptoren sitzen u. a. an den postganglionären Neuronen im vegetativen Nervensystem und lassen sich durch Acetylcholin und Nikotin, nicht aber Muskarin stimulieren. Pharmakologisch unterscheidbare Rezeptoren weisen auch molekularbiologische Unterschiede auf und sind zudem unterschiedlich im Nervensystem verteilt.
Vom Dopaminrezeptor sind im Augenblick fünf, mit D1 bis D5 indizierte, Subtypen bekannt. Die meisten Antipsychotika zeigen besonders große Affinität zu den D2-Rezeptoren, weniger zu denen anderen Typs. D1- und D5-Rezeptoren werden als D1-ähnliche Dopaminrezeptoren bezeichnet, die anderen zur Gruppe der D2-ähnlichen zusammengefasst. Die Rezeptortypen unterscheiden sich sowohl pharmakologisch durch verschiedene Bindungsaffinität diverser Agonisten und Antagonisten als auch molekularbiologisch: Die Reaktion mit D1- und D5-Rezeptoren führt zur Aktivierung eines stimulierenden G-Proteins (Gs) und damit zur Stimulierung von Adenylatcyclase (mit der Folge vermehrter Bildung von cAMP); die Reaktion mit anderen Subtypen führt zur Aktivierung eines inhibitorischen G-Proteins (Gi), worauf die Adenylatcyclase gehemmt wird. Sie verteilen sich zudem unterschiedlich im ZNS; weiter sind einige von ihnen nur postsynaptisch, andere nur präsynaptisch verteilt (Beaulieu et al., 2015).
Noradrenalinbindungsstellen unterteilt man in alpha- und beta-Rezeptoren, letztere wieder in die Typen β1 und β2. Bei den α-Rezeptoren werden die Subtypen α1 und α2 unterschieden, von denen es weitere Unterformen gibt. α2-Rezeptoren kommen auch präsynaptisch als Autorezeptoren vor.
Ausgesprochen kompliziert sind die Verhältnisse bei den Serotonin(5-HT)-Rezeptoren. Man kennt augenblicklich sieben Subtypen 5-HT1 bis 5-HT7, wobei manche davon weitere Unterformen besitzen. Sie unterscheiden sich sowohl pharmakologisch wie molekularbiologisch erheblich: So ist der 5-HT3-Rezeptor im Gegensatz zu den anderen direkt an einen Ionenkanal gekoppelt. Ein Großteil der 5-HT-Rezeptoren liegt sowohl prä- wie postsynaptisch. Dies macht es verständlich, dass Substanzen wie Buspiron, die agonistisch auf mehrere der Subtypen von Serotonin-Bindungsstellen wirken, einen höchst komplizierten klinischen Effekt haben.
Von den GABA-Rezeptoren unterscheidet man zwei Subtypen, den schon genannten GABAA-Rezeptor, der Ionenkanal-gekoppelt ist, und den (weniger gut untersuchten) metabotropen GABAB-Rezeptor. Der lange als dritter Typus von GABA-Bindungsstellen aufgefasste GABAC-Rezeptor wird heute als Sonderform des GABAA-Rezeptors betrachtet.
|24|Auch vom Glutamatrezeptor existieren mehrere Unterformen, diverse metabotrope sowie Ionenkanal-gekoppelte. Zu letzteren gehört der NMDA-Rezeptor; er wird so bezeichnet, weil er nicht nur durch Glutamat, sondern auch durch N-Methyl-D-Aspartat zu aktivieren ist. Es handelt sich dabei um einen Calcium-Kanäle kontrollierenden, kompliziert aufgebauten, erregenden Rezeptor.
Die beiden Subtypen der Bindungsstellen für Acetylcholin, die nikotinergen und die muskarinergen, wurden schon genannt. Nikotinerge Rezeptoren befinden sich an den ganglionären Synapsen sowohl des sympathischen wie des parasympathischen Nervensystems, zudem an der motorischen Endplatte; muskarinerge Bindungsstellen sind an den vom Parasympathikus innervierten Effektororganen zu finden. Im ZNS kommen beide Typen vor.
Damit die durch ihre Ausschüttung erzeugten Effekte nicht anhalten und weitere Erregungsübertragung erschweren, müssen die Transmitter rasch aus dem Spalt entfernt werden. Dies geschieht unspezifisch durch Diffusion in Teile des extrazellulären Raums (sowie Aufnahme durch Gliazellen), durch Wiederaufnahme in das präsynaptische Neuron, schließlich durch enzymatische Spaltung (nach Wiederaufnahme oder im synaptischen Spalt). Die Transmitter unterscheiden sich hierin (vgl. Tab. 3).
Tabelle 3: Inaktivierung der Transmitter und deren pharmakologische Beeinflussung
Transmitter
Art der
Inaktivierung
Pharmakologische
Beeinflussung
Bemerkungen
Monoamine
Wiederaufnahme ins präsynaptische Neuron (Reuptake), dort Abbau durch MAO (Monoaminoxidase)
Reuptake-Hemmung (Hauptwirkmechanismus trizyklischer Antidepressiva und selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer)
MAO-Hemmung (Prinzip der zur Depressionstherapie eingesetzten MAO-Hemmer)
Abbau von Noradrenalin und Dopamin auch durch COMT
COMT-Hemmstoffe von geringer Bedeutung (evtl. zusätzlich zu L-Dopa bei Parkinson-Krankheit)
Acetylcholin
Zerlegung im synaptischen Spalt durch Acetylcholinesterase
Acetylcholinesterasehemmer (zur Behandlung von Alzheimer-Demenz)
|25|endogene Opioide
Zerlegung im Spalt
Augenblicklich bedeutungslos
GABA
Vornehmlich durch Wiederaufnahme ins präsynaptische Neuron
Aufnahmehemmung durch 4-Methyl-GABA
Therapeutisch augenblicklich eher bedeutungslos
Glycin, Glutamat
Diffusion; Reuptake
Augenblicklich noch wenig bedeutsam
Acetylcholin wird nicht unverändert wieder aufgenommen, sondern im synaptischen Spalt mittels des Enzyms Acetylcholinesterase zerlegt. Die Hemmung dieses Enzyms mittels der bei Morbus Alzheimer eingesetzten Acetylcholinesterasehemmstoffe erhöht daher die synaptische Verfügbarkeit des Transmitters. Ebenfalls noch im Spalt abgebaut werden die Peptidtransmitter.
Anders geschieht die Inaktivierung der Monoamine. Ein gewisser Anteil von Dopamin und Noradrenalin wird im Spalt mittels des Enzyms Katecholamin-O-Methyltransferase (COMT) abgebaut. Der Großteil der Monoamine wird jedoch wieder in die präsynaptische Zelle aufgenommen (Reuptake). Dabei handelt es sich um einen aktiven Transportprozess durch ein Carrierprotein, welches an einer bestimmten Bindungsstelle die Anlagerung des Transmittermoleküls gestattet. Reuptake von Noradrenalin und Serotonin wird v. a. durch trizyklische Antidepressiva gehemmt, spezifisch das von Serotonin durch selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Die Folge ist eine verlängerte Verfügbarkeit der Transmitter im Spalt, also ein agonistischer Effekt.
Inaktivierung von GABA geschieht durch Reuptake sowie anschließenden intrazellulären Abbau durch GABA-Transaminase. Glutamat und Glycin dürften teils durch Diffusion aus dem Spalt gelangen; für beide ist aber auch ein aktiver Transport nachgewiesen.
1.2.3 Bahnensysteme
Die mittels eines bestimmten Transmitters übertragenden Neuronen sind nicht zufällig im ZNS angeordnet, sondern in bestimmten Bahnensystemen gebündelt.
Die dopaminergen Bahnen gehen großteils vom Mittelhirn (Mesencephalon) aus, und zwar von seinem ventralen Teil (Tegmentum). Hier sind zunächst die nigrostriatalen Bahnen zu nennen, die von der Substantia nigra zum Striatum ziehen (vgl. Tab. 4). Sie haben v. a. motorische Bedeutung; die Symptomatik der Parkinson-Krankheit ist weitgehend auf eine Störung dieser Bahnen zurückzuführen; auch durch Neuroleptika induzierte Bewegungsstörungen lassen sich über Veränderungen in diesem Neuronensystem erklären, in diesem Fall durch die Blockade von Rezeptoren im Striatum.
Tabelle 4: Übersicht der dopaminergen Bahnen
Bahn
Ursprung
Ziel
Bedeutung
Bezug zur Pathologie
Nigrostriatale Bahn
Substantia nigra des Mittelhirns
Striatum (Teil der Basalganglien)
Aktiviert Striatum, erleichtert Motorik
Bei Störung u. a. Parkinson-Syndrom
Mesolimbische Bahn
Ventrales Tegmentum des Mittelhirns
Limbische Strukturen, z. B. orbitofrontaler Kortex, Amygdala, Hippocampus
Aktiviert limbisches System
Überaktivität Grundlage schizophrener Positiv-Symptomatik?
Mesokortikale Bahn
Ventrales Tegmentum des Mittelhirns
Neokortikale Strukturen, z. B. präfrontaler Kortex
Unklar; Aktivierung und damit Förderung von Denkprozessen?
Rolle bei schizophrener Minussymptomatik?
|27|Mesotelencephales dopaminerges Belohnungssystem
Ventrales Tegmentum des Mittelhirns
Nucleus accumbens
Aktivierung mit Dopaminausschüttung in Nucleus accumbens Grundlage von Lustempfinden
Substanzab-hängigkeit als Folge von Minderaktivität?
Tuberoinfun-dibuläres System
Tuber cinereum (Hypothalamus)
Infundibulum (Hypophysenstiel)
Hemmt Prolactinsekretion aus Hypophyse
Bei Blockade Hyperprolactinämie
Ebenfalls vom mesencephalen Tegmentum nehmen Bahnen ihren Ausgang, die in verschiedene Teile des limbischen Systems (u. a. frontoorbitalen Kortex, Hippocampus, Amygdala) ziehen (mesolimbische Bahnen) oder in neokortikalen Arealen, speziell im präfrontalen Kortex, enden (mesokortikale Bahnen); mesolimbische, mesokortikale und nigrostriatale Bahnen werden zuweilen als mesotelencephale Bahnen zusammengefasst. Überaktivität insbesondere der mesolimbischen wird als biologisches Korrelat der Positivsymptomatik der Schizophrenie angesehen; entsprechend versucht man, die Übertragung an zugehörigen Synapsen zu unterdrücken. Teile der mesotelencephalen Bahnen, insbesondere jene, die zum Nucleus accumbens ziehen, haben zudem Bedeutung bei der Entstehung angenehmer Gefühle und sind an der Vermittlung der euphorisierenden Drogenwirkung beteiligt (zum mesotelencephalen dopaminergen Belohnungssystem, vgl. Kap. 1.2.4).
Daneben gibt es kürzere dopaminerge Bahnen, von denen lediglich die tuberoinfundibuläre erwähnt sei: Sie zieht vom Hypothalamus (genauer: vom Tuber cinereum) zum Hypophysenstiel (Infundibulum); die Aktivierung dieser Neuronen reduziert die Ausschüttung des Hormons Prolactin aus der Hypophyse. Die Blockade dieser Übertragung führt daher zu vermehrter Prolactinsekretion mit eindrucksvollen Folgeerscheinungen, z. B. Brustwachstum und Milchabsonderung auch bei Männern (vgl. Kap. 4.7.2).
Die Zellkörper noradrenerger Neurone liegen weiter kaudal im Hirnstamm, nämlich im Locus caeruleus, der Projektionen v. a. in Teile des limbischen Systems entsendet. Biopsychologisch spielt seine Aktivierung wohl eine Rolle bei der Entstehung von Panikattacken; auch Symptome des Alkoholentzugsdelirs werden so erklärt.
|28|Das serotonerge Transmittersystem nimmt seinen Ausgang von diversen Teilen des Hirnstamms, wobei besonders die in der Medulla oblongata gelegenen Raphe-Kerne zu nennen sind. Die Neurone laufen in verschiedene Teile des limbischen Systems, andere ziehen ins Rückenmark und Mittelhirn. Seine Aktivierung spielt bei einer Vielzahl biopsychologisch interessanter Vorgänge eine Rolle, u. a. bei der Induktion von Schlaf und der Hemmung der Leitung in aufsteigenden Schmerzbahnen.
Die Kerne der mittels Acetylcholin übertragenden (cholinergen) Bahnen sind vergleichsweise diffus angeordnet. Ein Großteil der Neurone, die zum Kortex ziehen, haben ihren Ausgangspunkt im Nucleus basalis Meynert des Vorderhirns; sie spielen eine wichtige Rolle bei Gedächtnisprozessen, sind beispielsweise bei der Alzheimer-Krankheit vermindert.
1.2.4 Das „mesotelencephale Belohnungssystem“
Das mesotelencepahle Belohnungssystem spielt eine große Rolle bei der Erzeugung angenehm empfundener Zustände oder, weniger mentalistisch formuliert, bei Belohnung oder Verstärkung. So wird die euphorisierende Wirkung psychotroper Substanzen durch seine Aktivierung erklärt.
Die Existenz eines solchen Systems legten Beobachtungen bei Versuchstieren nahe, die mittels implantierter Elektroden die Möglichkeit haben, durch Hebeldruck einzelne Hirngebiete elektrisch zu stimulieren (intrakranielle Selbstreizung). Dies geschieht exzessiv besonders dann, wenn die Elektrodenspitzen an Bahnen zu liegen kommen, die vom ventralen Tegmentum des Mittelhirns in den Nucleus accumbens ziehen. Bei letzterer Struktur handelt es sich um ein unscheinbares Kerngebiet im Endhirn nahe der Basalganglien, das erst in den letzten Jahren stärker beachtet wurde. Die Bahnen, deren Aktivierung diesen angenehmen Effekt hervorruft, sind dopaminerg; eine Blockade von Dopaminrezeptoren im Nucleus accumbens führt im Allgemeinen zur Beendigung der Selbstreizung.
Nachdem man mittels der reichlich artifiziellen, jedoch methodisch sehr sauber durchgeführten Selbstreizungsversuche die Anatomie und Physiologie solcher „belohnender“ Strukturen einmal erkannt hatte, lag es nahe, ihre Bedeutung für Suchtverhalten zu untersuchen. Dabei ließ sich feststellen, dass die Selbstapplikation beispielsweise von Heroin oder Kokain bei Labortieren ebenfalls diese Bahnen aktiviert und damit zu vermehrter Ausschüttung von Dopamin in den Nucleus accumbens führt; auch der Konsum von Alkohol und weiteren psychotropen Substanzen hat diesen Effekt. Dass die genannten dopaminergen Bahnen hierbei seine wesentliche Bedeutung haben, ist u. a. daraus zu ersehen, dass die Blockade der Dopaminrezeptoren im Nucleus accumbens oder die Zerstörung der vom Mittelhirn ausgehenden Neurone in der Regel die Selbstapplikation vieler Drogen unterbindet. Unklar ist weitgehend, wie die psychotropen Substanzen zur Aktivie|29|rung dieser dopaminergen mesotelencephalen Bahnen führen; denkbar ist Stimulierung von Rezeptoren im ventralen Tegmentum, bei deren Besetzung die dopaminergen Neurone stärker zu feuern beginnen. Dies könnten etwa Bindungsstellen für Opioide oder Serotonin sein, sodass also zwischen Drogenapplikation und Dopaminausschüttung in den Nucleus accumbens bei den meisten psychotropen Substanzen noch ein weiteres Transmittersystem geschaltet sein müsste.
Auch die angenehmen (verstärkenden) Wirkungen anderer Reize können über Aktivierung des geschilderten Systems erklärt werden. Blockiert man dieses, so haben ansonsten angenehm empfundene Tätigkeiten häufig keine verstärkende Wirkung mehr. Es gelingt dann nicht mehr, durch Belohnung mittels Nahrung Verhalten operant zu konditionieren (siehe die in Köhler, 2010, S. 269 f. angeführten Belege).
1.2.5 Das vegetative Nervensystem und seine pharmakologische Beeinflussung
Das vegetative Nervensystem (VNS) dient der Regulation innerer Vorgänge, z. B. der Verdauung, der Herz-Kreislauf-Tätigkeit oder der Konstanthaltung der Körpertemperatur (vgl. Abb. 4). Es hat enge funktionelle Verbindungen mit den Hormonen, sodass häufig vom neuroendokrinen System gesprochen wird. Konventionsgemäß unterscheidet man am VNS die beiden großen Subsysteme Sympathikus (sympathisches Nervensystem) und Parasympathikus (parasympathisches NS).
Das sympathische Nervensystem nimmt seinen Ausgang von den mittleren Abschnitten des Rückenmarks und endet an den Zellen innerer Organe, diverser Drüsen (z. B. Schweiß-, Speichel-, Tränendrüsen), der Blutgefäße und an den Lichteinfall und Akkommodation steuernden Muskelfasern des Auges (im Weiteren allgemein als Effektororgane oder Erfolgsorgane bezeichnet). Das parasympathische Nervensystem entspringt teils im Hirnstamm, teils im untersten Abschnitt des Rückenmarks und endet ebenfalls an den oben genannten Organen – wobei die Schweißdrüsen und vermutlich diverse Blutgefäße nur von sympathischen, nicht jedoch parasympathischen Fasern erreicht werden.
Die vegetative Regulation der Gefäße ist kompliziert. Die eigentlichen kontraktilen Anteile der Blutgefäße, die v. a. in Arterien und Arteriolen sitzenden Muskelzellen, werden offenbar nur von sympathischen Fasern erreicht. Das Endothel, die innere Gefäßschicht, wird hingegen auch von parasympathischen Fasern versorgt und besitzt deshalb muskarinerge Acetylcholinrezeptoren; bei deren Stimulierung setzen die Endothelzellen NO (Stickstoffmonoxid) frei, welches die Muskulatur der Gefäßwände erschlaffen lässt. Die früher zu lesende Behauptung, die Weite der Gefäße werde ausschließlich durch lokale Faktoren (z. B. Konzentrationen saurer Stoffwechselprodukte) und den Sympathikus geregelt, gilt deshalb als überholt. Unklar bleibt, ob die endothelvermittelte, parasympathisch gesteuerte Erweiterung an allen Blutgefäßen im Körper eine Rolle spielt.
Abbildung 4: Vegetatives Nervensystem
In erster Näherung lassen sich die Effekte von Aktivierung des sympathischen NS mit Feuerung seiner Neurone und von parasympathischer Aktivierung antagonistisch vorstellen: Die Feuerung sympathischer Neurone erhöht die Pulsfrequenz, die parasympathischer verlangsamt sie; Sympathikusaktivierung führt zur Erweiterung von Bronchien und Pupillen, Aktivierung des Parasympathikus dort zu Verengungen; bei sympathischer Aktivierung wird die Tätigkeit des Magen-Darm-Trakts gehemmt, bei parasympathischer gefördert. Nicht an allen Effektororganen |31|besteht ein regelrechter Antagonismus; so bewirkt etwa an den Drüsen des Bronchialsystems eine Aktivierung beider Systeme die Produktion von Schleim, der sich aber in Konsistenz und Zusammensetzung unterscheidet (viel dünnflüssiger Speichel bei parasympathischer Aktivierung, Produktion geringer Mengen zähen Speichels bei sympathischer). Wichtig für das Verständnis der anticholinergen Nebenwirkungen gewisser Medikamente (speziell trizyklischer Antidepressiva und zahlreicher Antipsychotika) ist die Tatsache, dass parasympathische Aktivierung die Kontraktion der Blasenmuskulatur anregt (und damit die Harnentleerung fördert), während sympathische Aktivierung diese hemmt. Zudem bewirkt parasympathische Aktivierung die Nahakkommodation der Linse, weshalb bei Gabe anticholinerg wirkender Pharmaka Akkommodationsstörungen auftreten können (zu den Wirkungen von Sympathikus und Parasympathikus an einzelnen Organen bzw. Organsystemen; vgl. auch Tab. 5). Generell ist verstärkte sympathische Aktivität v. a. dann festzustellen, wenn eine Auseinandersetzung mit der Umwelt stattfindet (z. B. Arbeit, Kampf, Flucht), parasympathische Aktivierung hingegen speziell in Zeiten der Regeneration.
Für das Verständnis pharmakologischer Effekte am VNS entscheidend ist eine anatomische Besonderheit, nämlich dass die Neurone nicht ohne Unterbrechung von Rückenmark und Hirnstamm zu den Effektororganen ziehen, sondern dazwischen eine Umschaltung auf eine neue Nervenzelle passiert. Da diese Umschaltung (d. h. die synaptische Übertragung der Erregung des ersten auf das zweite Neuron) typischerweise in Ganglien (knotenartigen Strukturen mit Neuronenzellkörpern und Synapsen) geschieht, wird das vom Hirnstamm oder Rückenmark ausgehende erste Neuron präganglionäres Neuron genannt, das im Ganglion beginnende, das Effektororgan erreichende zweite Neuron postganglionäres. Dabei wird nicht ein präganglionäres Neuron auf genau ein postganglionäres Neuron umgeschaltet; vielmehr erreicht jedes präganglionäre Neuron durch Verzweigung seines Axons zahlreiche postganglionäre Neurone, und jedes postganglionäre Neuron bildet Synapsen mit vielen präganglionären Nervenzellen. Somit liegen sowohl im sympathischen wie im parasympathischen Nervensystem jeweils zwei Synapsen (mit teilweise unterschiedlichen Transmittern und verschiedenen Rezeptortypen) vor, nämlich die Synapse zwischen prä- und postganglionärem Neuron sowie die zwischen postganglionärer Nervenzelle und Effektororgan – wobei es sich eigentlich nicht um zwei, sondern um zahllose Synapsen handelt, die lediglich auf zwei verschiedenen Ebenen liegen.
Die Zellkörper der präganglionären parasympathischen Neurone sitzen großteils im Hirnstamm; ihre Axone ziehen zusammen mit drei Hirnnerven (N. oculomotorius, N. facialis, N. glossopharyngeus) in den Gesichtsbereich, wo sie in Ganglien auf postsynaptische Neurone umgeschaltet werden; letztere enden an Tränen- und Speicheldrüsen sowie der inneren Augenmuskulatur. Parasympathische Fasern vom Hirnstamm in den Brust- und Bauchraum ziehen im N. vagus (dem 10. Hirnnerven), der somit u. a. Lunge, Leber, Magen, Dünndarm und oberen Dickdarm (einschließlich seines quer verlaufenden Abschnitts) versorgt. Die Umschaltung dieser Fasern erfolgt nicht in Ganglien, sondern diffus im Gewebe in unmittelbarer Nähe des Effektororgans. Die Beckenorgane, also Harnblase, Genitalien und unterer Dickdarm, werden hingegen von parasympathischen Fasern aus dem Sakralmark (dem untersten Rückenmarksabschnitt) versorgt, welche mit den Beckennerven ziehen und in Nähe des Erfolgsorgans umgeschaltet werden. Die Um|33|schaltung von prä- auf postsynaptisches Neuron geschieht beim Parasympathikus (wie beim Sympathikus) mittels Acetylcholin, wobei die Rezeptoren wiederum nikotinerg sind. Rauchen regt folglich auch den Parasympathikus an (z. B. mit der Folge verstärkter Magen-Darm-Tätigkeit). Der Transmitter an den Synapsen zwischen postganglionären Neuronen und Effektororganen ist beim Parasympathikus Acetylcholin; anders als in den Ganglien sind die Rezeptoren hier aber muskarinerg (vom Typ M2 am Herzen, M3 an der glatten Muskulatur der übrigen inneren Organe und an den Drüsen); dies hat zur Folge, dass die Blockade muskarinerger Acetylcholinrezeptoren (wie sie beispielsweise den anticholinergen Nebenwirkungen trizyklischer Antidepressiva zugrunde liegt), v. a. die parasympathische Aktivität hemmt und damit zu einem Überwiegen des antagonistischen sympathischen Nervensystems führt. Tabelle 5 gibt unter gewisser Vereinfachung (auszugsweise) die Wirkungen der beiden Systeme an den wichtigsten Organsystemen an.
Tabelle 5: Wirkungen von Sympathikus und Parasympathikus
Effektororgan
Wirkung
Bemerkungen
Sympathikus
Parasympathikus
Auge
Erweiterung der Pupille
Steuerung der Fernakkommodation
Verengung der Pupille
Steuerung der Nahakkommodation
Daher nach Einnahme von Anticholinergika oft Schwierigkeiten beim Lesen
Speicheldrüsen
Bildung zähen Speichels
Bildung großer Menge flüssigen Speichels
Mundtrockenheit durch Anticholinergika
Herz
Frequenzerhöhung, Steigerung der Auswurfmenge
Senkung der Frequenz
Verzögerung der Überleitung
Frequenzsenkende Wirkung von Betablockern
Blutgefäße
Kompliziert angesichts der verschiedenen Rezeptortypen für Noradrenalin und der gleichzeitigen hormonellen Beeinflussung
In der Summe: eher Verengung
Indirekt erweiternd (über Freisetzung von NO aus dem Gefäßendothel)
Möglicherweise unterschiedliche Verhältnisse in den Organsystemen (z. B. Hautgefäße, Muskelgefäße)
Regulation der Gefäßweite auch anhand lokaler Faktoren
|34|(Gewebshormone, Stoffwechselprodukte)
Bronchien
Durch Stimulation von β2-Rezeptoren erweiternd
Verengend
Bronchodilatierende Wirkung von β2-Mimetika (Asthmasprays)
Magen-Darm-Trakt
Hemmung der Verdauungstätig-keit
Förderung der Verdauungstätigkeit (durch Anregung der Darmmuskulatur, Stimulierung von Verdauungsdrüsen)
Als anticholinerger Effekt Dämpfung der Verdauungstätigkeit (Obstipation; im Extremfall Darmlähmung) – Tätigkeit auch durch Darmnervensystem reguliert (weitgehend unabhängig von Sympathikus und Parasympathikus)
Harnblase
Erschwert Austreibung von Harn
Erleichtert Entleerung durch Kontraktion der Blasenmuskulatur und Öffnung des den Eingang verschließenden Sphinktermuskels
Als anticholinerger Effekt zuweilen Schwierigkeiten beim Harnlassen bis zu Harnverhaltung
Genitalien
Ejakulation
Erektion (indirekt über Gefäßendothel Öffnung der Gefäße zu den Schwellkörpern)
|35|Somit lässt sich das vegetative Nervensystem in verschiedener Weise pharmakologisch beeinflussen (vgl. auch Tab. 6). Agonisten an den nikotinergen Acetylcholinrezeptoren der vegetativen Ganglien (beispielsweise Nikotin selbst) erhöhen sowohl die Aktivität des sympathischen als auch des parasympathischen Subsystems, womit sich die Wirkungen weitgehend (nicht immer) aufheben.
Substanzen, welche muskarinerge Acetylcholinrezeptoren stimulieren (z. B. die eine Pupillenverengung und Anregung der Darmtätigkeit bewirkenden Pharmaka Pilocarpin oder Carbachol), führen zu erhöhter parasympathischer Aktivität, u. a. in Form verlangsamter Pulsfrequenz und Bronchialverengung. Stoffe, welche muskarinerge Acetylcholinrezeptoren blockieren (Anticholinergika), dämpfen das parasympathische NS (wirken parasympatholytisch) und fördern damit indirekt im Allgemeinen die Sympathikuswirkung. Substanzen, welche adrenerge Rezeptoren an inneren Organen stimulieren, verstärken sympathische Reaktionen (sind Sympathomimetika, z. B. Adrenalin). Solche, nach deren Einnahme sich die Aktivität abschwächt, werden Sympatholytika genannt. Wegen der antagonistischen Wirkungen der beiden Systeme entspricht einem Mimetikum für das eine System weitgehend – keineswegs immer vollständig – im Hinblick auf die Effekte ein Lytikum für das andere System.
Bei den Mimetika unterscheidet man wiederum direkte Stimulatoren von Bindungsstellen (z. B. Adrenalin, Nikotin, Muskarin) und indirekte Mimetika, die, beispielsweise durch Hemmung der Inaktivierung die Übertragung an den Synapsen, verstärkende Effekte haben (z. B. Acetylcholinesterasehemmer als indirekte Parasympathomimetika).
So führt Atropin, ein bekanntes Anticholinergikum und Parasympatholytikum, zu erhöhter Pulsfrequenz, Erweiterung der Bronchien, Öffnung der Pupille sowie zu verminderter Aktivität im Magen-Darm-Trakt und schwächerer Kontraktion der Blasenmuskulatur, zudem zu Mundtrockenheit und (über die zwar ausschließlich sympathisch innervierten, aber mit muskarinergen Acetylcholinrezeptoren ausgestatteten Schweißdrüsen) zu verminderter Schweißproduktion. Erwähnt sei, dass viele Antipsychotika und insbesondere die trizyklischen Antidepressiva als Nebenwirkung muskarinerge Acetylcholinrezeptoren blockieren, also dem Atropin vergleichbare anticholinerge Effekte haben; beispielsweise werden im Extremfall Darmlähmungen als Nebenwirkungen beschrieben.
Hat also ein Parasympatholytikum (wie Atropin) Effekte, die (weitgehend) denen einer Aktivierung des Sympathikus entsprechen, ergeben sich umgekehrt bei Anwendung von Sympatholytika Wirkungen, die sich auch bei parasympathischer Aktivierung finden, z. B. nach Gabe von Betablockern Absinken der Pulsfrequenz.
|36|Tabelle 6: Stimulatoren und Inhibitoren von Sympathikus und Parasympathikus
Sympathikus
Stimulatoren
Adrenalin, Noradrenalin, selektive β2-Stimulatoren (therapeutisch, v. a. zur Bronchodilatation)
Amphetamine und Kokain (indirekt durch Erhöhung synaptischer NA-Mengen)
Nikotin
Bemerkungen
Wegen unterschiedlicher (nor)adrenerger Rezeptortypen komplizierter Effekt
Nikotin greift am Ganglion an; daher u. a. parasympathische Wirkungen, welche sympathische teils aufheben (Ausnahme: Herz-Kreislauf-System; dort sympathische Effekte)
Inhibitoren
α-Rezeptorenblocker: Blutdrucksenkung durch Blockade postsynaptischer α1-Rezeptoren in der Gefäßmuskulatur)
Betablocker (möglichst gezielt für β1): Senkung von Pulsfrequenz und Blutdruck
Diverse indirekt wirkende Sympatholytika, z. B. Reserpin, Clonidin
Ganglienblocker
Bemerkungen
Kompliziert (unterschiedliche Typen adrenerger Rezeptoren)
α2-Rezeptoren großteils präsynaptisch
Bei β-Blockern Gefahr der Bronchokonstriktion (Asthmaanfälle!)
Reserpin führt zur NA-Verarmung im präsynaptischen Neuron
Clonidin stimuliert u. a. präsynaptische α2-Rezeptoren, führt so zu verminderter NA-Ausschüttung
Bei Ganglienblockern weitgehend Aufhebung sympatholytischer u. parasympatholytischer Effekte, im Gefäßsystem überwiegt Sympatholyse (Blutdrucksenkung)
Parasympathikus
Stimulatoren
Acetylcholin (ACh), Carbachol, Pilocarpin (direkt an ACh-Rezeptoren beider Typen)
Arecolin, Muskarin (direkt an muskarinergen ACh-Rezeptoren)
Nikotin (direkt an nikotinergen ACh-Rezeptoren)
Cholinesterasehemmer (z. B. Physostigmin, Rivastagmin): indirekt durch Erhöhung synaptischer ACh-Konzentration
Bemerkungen
An Ganglien heben sich stimulatorische Effekte der Systeme (weitgehend) auf
Muskarin und Arecolin stimulieren nur muskarinische ACh-Rezeptoren, daher ausschließlich parasympathische Effekte (Ausnahme: Schweißdrüsen)
|37|Parasympathikus
Inhibitoren
Atropin, Scopolamin (Blocker muskarinerger ACh-Rezeptoren)
Anticholinerg wirkende trizyklische Antidepressiva und Antipsychotika (Blocker muskarinerger ACh-Rezeptoren)
Bemerkungen
Ganglienblocker haben ebenfalls parasympatholytische Effekte, welche durch die sympatholytischen aufgehoben werden (letztere überwiegen, außer im Magen-Darm-Trakt)
Letzterer Effekt therapeutisch bedeutungslos
Das in vielen Darstellungen des VNS vernachlässigte Darmnervensystem (allgemeiner: Eingeweide- oder auch intramurales Nervensystem) sei wenigstens erwähnt. Es besteht aus Geflechten von Neuronen in den Wänden des Magen-Darm-Kanals, die – vergleichsweise unabhängig von sympathischer oder parasympathischer Aktivität – die Tätigkeit der Verdauungsorgane regeln (z. B. anhand deren Füllungszustandes). Dieses Eingeweidenervensystem enthält in großer Menge Serotoninbindungsstellen. Pharmaka, die auf Serotonin wirken, beeinflussen daher auch die Magen-Darm-Tätigkeit.
1.3 Methoden der biologischen Psychiatrie
1.3.1 Überblick
In den folgenden Kapiteln werden Befunde präsentiert, aus denen sich biologische Modelle psychischer Störungen ableiten. Die dabei verwendeten Methoden sind v. a. bildgebende (neuroradiologische) Verfahren zur Darstellung morphologischer oder funktioneller Besonderheiten im ZNS, Provokationsstudien zum Nachweis veränderter Reaktionen im neuroendokrinen System, Bestimmung von Transmitterkonzentrationen in Körperflüssigkeiten und Rezeptorbindungsstudien zur Erforschung von Besonderheiten der synaptischen Übertragung, weiter Koppelungsuntersuchungen und molekulargenetische Methoden zur Bestimmung der Erblichkeit psychischer Störungen sowie Identifizierung beteiligter Gene. Um eine Darstellung dieser Methoden im Rahmen der einzelnen Kapitel zu vermeiden, seien sie hier knapp skizziert. Obwohl wiederholt auf die Ergebnisse von Tierversuchen zurückgegriffen wird, insbesondere bei der Darstellung des „Belohnungssystems“ und der Drogenwirkungen, kommen tierexperimentelle Vorgehensweisen nicht zur Sprache. Auch psychophysiologische Untersuchungsmethoden können nicht behandelt werden. Eine Ausnahme bilden wenige einführende Worte in die Erhebung und Auswertung von Spontan-EEG und evozierten Potenzialen.
|38|1.3.2 Bildgebende Verfahren
Tabelle 7 gibt einen Überblick über verschiedene bildgebende Verfahren.
Tabelle 7: Bildgebende Verfahren
Verfahren
Prinzip
Sichtbarmachen von
Bemerkungen
Computertomografie (CT)
Zahlreiche Röntgenaufnahmen in Schichten
Ergebnisse miteinander verrechnet
Strukturen
Auflösungsvermögen nicht optimal
Hohe Strahlenbelastung
Funktionelle Veränderungen nicht nachzuweisen
Kernspintomografie (MRI, NMR)
Bestimmung der Ablenkung von Wellen durch Magnetfelder
Technik wie CT
Strukturen
Höheres Auflösungsvermögen
Geringe Strahlenbelastung
Kostenintensiv
Funktionelle Veränderungen nicht nachzuweisen
Positronen-Emissions-Tomografie (PET)
Messung der Emission eingebrachter (in Gewebe einlagernder) Substanzen
Funktionellen Veränderungen
Hohe Strahlenbelastung
Mäßige zeitliche und räumliche Auflösung
Funktionelle Kernspintomografie (fMR-Tomografie)
Misst Ablenkung durch Magnetfeld von Sauerstoffatomen (Anreicherung in aktivem Gewebe)
Funktionellen Veränderungen
Geringere Strahlenbelastung, höheres Auflösungsvermögen als PET
Einbringen von Substanzen nicht erforderlich
Nahinfrarotspektroskopie (NIRS)
Misst Hirnaktivität anhand von Sauerstoff im Hämoglobin
Funktionellen Veränderungen
Keine Strahlenbelastung
Nicht invasiv (Einbringen von Substanzen nicht erforderlich)
Das Verfahren wird natürlich nicht nur zur Darstellung des Gehirns benutzt, sondern auch anderer Organe. Die kraniale Computertomografie wird deshalb oft mit CCT abgekürzt.
Geringere Strahlenbelastung bei besserer Auflösung bietet die Kernspintomografie (Magnetic Resonance Imaging =MRI; auch MRT). Vereinfacht gesagt, werden Wasserstoffatome mittels eines Magnetfelds in Schwingungen versetzt, deren Stärke durch den Grad der Beeinflussung von Radiowellen gemessen wird. Da die Schwingungen von Dichte und Zusammensetzung des Gewebes abhängen, lässt sich dessen Struktur darstellen. Einzelne Strukturen treten ähnlich gut hervor wie in einem fixierten anatomischen Präparat. Die Nachteile sind v. a. hohe Kosten. Auch hier werden nur Strukturen sichtbar (zur funktionellen Kernspintomografie; siehe unten).
Weiter gibt es Methoden zum Nachweis funktioneller Besonderheiten. Ein gebräuchliches bildgebendes Verfahren zur Darstellung der Hirnaktivität ist die Positronen-Emissions-Tomografie (PET). Dabei werden radioaktiv markierte Substanzen zugeführt, deren Anhäufung in bestimmten Hirnarealen durch die von ihnen emittierte Strahlung (Positronen) sichtbar gemacht wird. Beispielsweise lässt sich Desoxyglukose mit einem Fluorisotop markieren; im Gehirn lagert es sich aufgrund der Ähnlichkeit mit Glukose (Zucker) in besonders stoffwechselaktiven Gebieten an. Da es langsamer als Glukose abgebaut bzw. eliminiert wird, zeigt sich dort über längere Zeit radioaktive Strahlung. So lässt sich z. B. untersuchen, welche Hirnpartien in besonderem Maße bei Problemlösungsaufgaben beteiligt sind. Das räumliche Auflösungsvermögen des Verfahrens ist vergleichsweise schwach, ebenso das zeitliche; somit sind nur langsame Veränderungen zu erkennen.
Auf der PET-Methode basieren auch Rezeptorbindungsstudien. Dabei wird ein radioaktiv markierter Stoff zugefügt, der hohe Affinität zu bestimmten Bindungsstellen besitzt, etwa N-Methylspiperon, welches das Kohlenstoffisotop C11 enthält und sich gut an Dopaminrezeptoren bindet.
Zunehmend häufiger eingesetzt wird funktionelle Kernspintomografie (fMRT), welche auch funktionelle Veränderungen nachweist. Eine erhöhte Sauerstoffversorgung führt zur Veränderung der magnetischen Eigenschaften der betreffenden Hirnareale; daher stellt sich gut aktiviertes Gewebe anders dar als wenig aktiviertes. Der |40|Vorteil gegenüber den PET-Verfahren liegt in der besseren zeitlichen wie räumlichen Auflösung; zudem muss kein Stoff zugeführt werden, um die metabolische Aktivität sichtbar zu machen.
1.3.3 Spontan-EEG und evozierte Potenziale
Durch Elektroenzephalografie lassen sich mittels Elektroden an der Kopfhaut elektrische Potenziale im Gehirn, v. a. vom Kortex, ableiten. Das Wellenmuster der resultierenden „Hirnstromkurve“ (Spontan-EEG) zeigt außer eventuellen pathologischen Veränderungen, etwa bei epileptischen Anfällen in Form von „spikes and waves“, hauptsächlich den Aktivierungszustand im Gehirn: Ein hochfrequentes, niedrigamplitudiges Wellenmuster (beta-Wellen) indiziert erhöhte Aktivierung, alpha-Wellen mit niedrigerer Frequenz Entspannung im Wachzustand; die langsameren theta-Wellen entsprechen zumeist Einschlafen oder leichtem Schlaf, Wellen im sehr langsamen delta-Bereich kommen bei Erwachsenen nur im Schlaf vor. Ein Anteil von delta-Wellen von 50 % oder mehr charakterisiert Tiefschlafstadien. In der biologischen Psychiatrie liegt der wichtigste Einsatz des EEGs in der Schlafforschung.