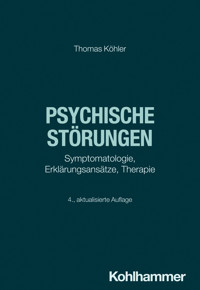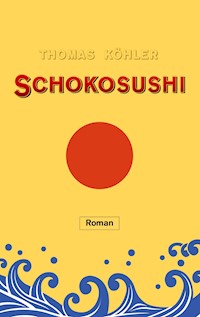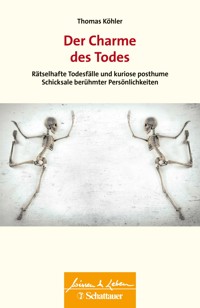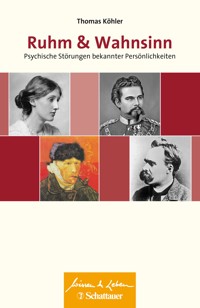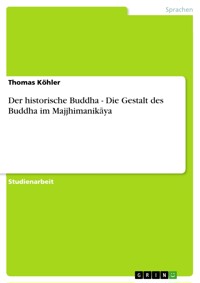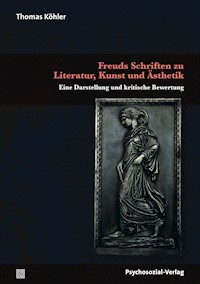19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Wissen & Leben
- Sprache: Deutsch
- Berauschend vielschichtig: Alkohol und Drogen evolutionär, historisch, gesellschaftlich und medizinisch betrachtet - Aktuell: Wie gefährlich sind moderne Drogen? Der Rausch ist universell betörend: Nicht nur Menschen, auch Tiere wissen Substanzen zu schätzen, die "high" machen. So turnen sich Delfine mit kleinen Mengen Kugelfisch-Gift an, und viele Pflanzenfresser lieben in besonderem Maße Früchte, die teils vergoren sind. Erwiesen ist, dass unsere Vorfahren seit den frühen Anfängen der Menschheit diverse pflanzliche Produkte nicht nur zu rituellen oder therapeutischen Zwecken, sondern auch zum Heben der Stimmung konsumierten. Das Buch schildert zum einen die Wirkungen und Wirkweisen psychotroper Substanzen, zum anderen die Geschichte ihres Gebrauchs und Missbrauchs. Ein zentrales Kapitel ist dem Alkohol gewidmet, der bekanntlich nicht nur fröhliche Feste mitgestaltet, sondern auch zu schwersten Abhängigkeiten und Erkrankungen führt. Der Autor berichtet über die Trunksuchtepidemien zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern sowie die staatlichen Maßnahmen gegen sie. Und dass geniale Schriftsteller wie E.T.A. Hoffmann, Hans Fallada, Joseph Roth oder Ernest Hemingway zugleich berühmte Trinker waren, zeigt, wie nah Genie und Sucht beieinanderliegen können. Geraten Sie in einen Leserausch über Halluzinogene bei magischen Praktiken, als Bestandteil der Hexensalben, als biologische Erklärung des Werwolf-Mythos und als Verursacher von "Massenpsychosen". Lernen Sie die körperlichen und psychischen Folgen des Konsums von modernen Psychostimulanzien wie Kokain, Amphetamin oder Crystal Meth kennen und sehen Sie an Opiaten, Cannabis und Narkosemitteln, wie sie zugleich schaden und nutzen. Dieses Buch richtet sich an Alle kulturhistorisch, psychologisch und psychiatrisch interessierten Leser; Psychiater und Psychotherapeuten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thomas Köhler
Die Zeiten verfliegen wie im Rausch
Eine kurzweilige Geschichte von Alkohol, Drogen und ihren Konsumenten
herausgegeben von Wulf Bertram
Wulf Bertram, Dipl.-Psych. Dr. med, geb. in Soest/Westfalen, Studium der Psychologie, Medizin und Soziologie in Hamburg. Zunächst Klinischer Psychologe im Universitätskrankenhaus Hamburg Eppendorf, nach Staatsexamen und Promotion in Medizin Assistenzarzt in einem Sozialpsychiatrischen Dienst in der Provinz Arezzo/Toskana, danach psychiatrische Ausbildung in Kaufbeuren/Allgäu. 1985 wechselte er als Lektor für medizinische Lehrbücher ins Verlagswesen und wurde 1988 wissenschaftlicher Leiter des Schattauer Verlags in Stuttgart, 1992 dessen verlegerischer Geschäftsführer. Im gleichen Jahr gründete er zusammen mit Thure von Uexküll und medizinischen Fachkollegen die Akademie für Integrierte Medizin, deren Vorstand er seitdem angehört. Aus seiner Überzeugung heraus, dass Lernen ein Minimum an Spaß machen müsse und solides Wissen auch unterhaltsam vermittelt werden kann, konzipierte er 2009 die Taschenbuchreihe »Wissen & Leben«. Bertram hat eine Ausbildung in Gesprächs- und Verhaltenstherapie sowie in Psychodynamischer Psychotherapie und arbeitet neben seiner Verlagstätigkeit als Psychotherapeut in eigener Praxis.
Für sein Lebenswerk, seine »wissenschaftlich fundierte Verlagstätigkeit im Sinne des Stiftungsgedankens«, wurde Bertram 2018 der renommierte Wissenschaftspreis der Margrit-Egnér-Stiftung verliehen, deren Ziel es ist, zu einer humaneren Welt beizutragen, in welcher der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit im Mittelpunkt steht.
Impressum
Prof. Dr. med. Dr. phil. Dipl.-Psych. Thomas Köhler
Oberstraße 98
20149 Hamburg
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besonderer Hinweis
Die Medizin unterliegt einem fortwährenden Entwicklungsprozess, sodass alle Angaben, insbesondere zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren, immer nur dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches entsprechen können. Hinsichtlich der angegebenen Empfehlungen zur Therapie und der Auswahl sowie Dosierung von Medikamenten wurde die größtmögliche Sorgfalt beachtet. Gleichwohl werden die Benutzer aufgefordert, die Beipackzettel und Fachinformationen der Hersteller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Spezialisten zu konsultieren. Fragliche Unstimmigkeiten sollten bitte im allgemeinen Interesse dem Verlag mitgeteilt werden. Der Benutzer selbst bleibt verantwortlich für jede diagnostische oder therapeutische Applikation, Medikation und Dosierung.
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Schattauer
www.schattauer.de
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von © Shutterstock/chippix
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-40018-2
E-Book: ISBN 978-3-608-19173-8
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-29157-5
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Vorwort
1 Zur Einführung: Wirkung von Alkohol und Rauschdrogen
1.1 Begriffsklärungen
1.2 Wirkungen und Wirkmechanismen der Substanzen
1.2.1 Biologische Grundlagen
1.2.2 Akute Effekte
1.2.3 Verzögerte Wirkungen und langfristige Effekte
1.3 Toleranz und Entzugserscheinungen
1.4 Abhängigkeit und ihre Grundlagen
2 Alkohol: Sein Segen und sein Fluch
2.1 Was ist Alkohol?
2.2 Historisches
2.3 Pharmakologische und klinische Grundlagen
2.3.1 Aufnahme und Verstoffwechselung
2.3.2 Wirkungen
2.3.3 Toleranz und Entzugserscheinungen
2.4 Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit (Alkoholismus)
2.5 Berühmte Alkoholiker
3 Opioide: Ihre Inhaltsstoffe und synthetischen Verwandten
3.1 Was sind Opioide?
3.2 Historisches
3.3 Pharmakologische und klinische Grundlagen
3.3.1 Aufnahme und Verstoffwechselung
3.3.2 Wirkungen
3.3.3 Toleranz und Entzugserscheinungen
3.4 Missbrauch und Abhängigkeit
3.4.1 Praktiken des Opioidkonsums
3.4.2 Missbrauch und Abhängigkeit
3.4.3 Behandlung
3.5 Berühmte Opiatabhängige
4 Kokain: Von den Cocablättern zu Koks und Crack
4.1 Was ist Kokain?
4.2 Historisches
4.3 Pharmakologische und klinische Grundlagen
4.3.1 Aufnahme und Verstoffwechselung
4.3.2 Wirkungen
4.3.3 Toleranz und Entzugserscheinungen
4.4 Missbrauch und Abhängigkeit
4.5 Berühmte Kokainisten
5 Psychostimulanzien: Ein zweischneidiges Schwert
5.1 Was sind Psychostimulanzien?
5.2 Amphetamine
5.2.1 Unterformen
5.2.2 Historisches
5.2.3 Pharmakologische und klinische Grundlagen
5.2.4 Missbrauch und Abhängigkeit
5.2.5 Berühmte Amphetaminkonsumenten
5.3 Methylphenidat
5.4 Koffein
6 Cannabis und Cannabinoide: Was dröhnt, ist nicht automatisch auch gesund
6.1 Was sind Cannabinoide?
6.2 Historisches
6.3 Pharmakologische und klinische Grundlagen
6.3.1 Aufnahme und Verstoffwechselung
6.3.2 Wirkungen
6.3.3 Toleranz und Entzugserscheinungen
6.4 Missbrauch und Abhängigkeit
6.5 Berühmte Cannabiskonsumenten
7 Die wundersame Welt der Halluzinogene (Psychedelika)
7.1 Was sind Halluzinogene?
7.2 Historisches
7.3 Klassische Halluzinogene
7.3.1 Wirkprinzipien
7.3.2 Meskalin und der Peyote-Kaktus
7.3.3 LSD
7.3.4 Psilocybin und die Magic Mushrooms
7.3.5 DMT und Ayahuasca
7.3.6 Bufotenin und die psychedelischen Effekte von Krötensekreten
7.3.7 Die Samen von Windengewächsen
7.4 Anticholinergika
7.4.1 Was sind Anticholinergika?
7.4.2 Anticholinergika als psychotrope Substanzen
7.5 Der Fliegenpilz
7.6 Aztekensalbei (Zaubersalbei, Salvia divinorum)
8 Partydrogen – ob das immer gut geht?
8.1 Was sind Partydrogen?
8.2 Historisches
8.3 Ecstasy
8.4 Psychedelische Narkosemittel (Dissoziativa)
8.4.1 Phencyclidin (PCP)
8.4.2 Ketamin
8.5 Badesalze
8.6 Gamma-Hydroxybuttersäure
9 Schnüffelstoffe und andere Inhalanzien: Die Drogen der Ärmsten und Kleinsten
9.1 Vorbemerkungen
9.2 Historisches
9.3 Flüchtige Lösungsmittel (Schnüffelstoffe)
9.4 Freie Gase und Aerosole
9.5 Flüchtige Nitritverbindungen
9.6 Inhalationsnarkotika
Glossar
Literatur
Weitere Quellen
Sachverzeichnis
Vorwort
Dass zum Thema Drogen bereits eine Reihe von Büchern existiert, ist natürlich allgemein bekannt – allein vom Verfasser gibt es zwei einschlägige Monografien (s. S. 228 und unten). Das Thema ist zum einen kulturhistorisch interessant, zum anderen biopsychologisch, denn die durch solche Substanzen hervorgerufenen Zustände haben wesentliche Einblicke in die biologischen Grundlagen psychischer Störungen geliefert. Hinzu kommen die gesellschaftspolitischen, volkswirtschaftlichen und natürlich therapeutischen Aspekte solcher »Süchte«.
Wenn nun ein weiteres Buch hinzugefügt wird, so einerseits deswegen, weil ein Teil der diesbezüglichen Literatur sich vornehmlich an Fachleute richtet – daher für die Betroffenen oder ihre zwangsläufig damit konfrontierten Angehörigen nicht ausreichend verständlich ist; andererseits sind viele Darstellungen sehr (zu sehr) populärwissenschaftlich abgefasst und enthalten der Leserschaft durch den so gut wie vollständigen Verzicht auf die Darstellung biochemischer Grundlagen wesentliche Informationen vor, welche die Einordnung der Rauschdrogen erleichtern und ihre Effekte und Nebenwirkungen erst verständlich machen.
Hier wird nun der schwierige und sicher nur bedingt zur allgemeinen Zufriedenheit gelungene Versuch unternommen, beiden Anliegen in gewisser Weise gerecht zu werden: Einerseits sollen biopsychologische Grundlagen so aufbereitet werden, dass man durch Kenntnis ihrer Wirkungen auf die verschiedenen Neurotransmittersysteme die Drogen (inklusive Alkohol) miteinander besser in Verbindung bringen kann, andererseits soll die geschichtliche Bedeutung der Substanzen herausgestellt und anhand einzelner Biografien illustriert werden, wie sehr ihr Konsum Lebensschicksale bestimmt hat. Das Glossar soll Hilfe insofern geben, als dort einige wichtige Begriffe ausführlicher erläutert sind als im Text.
Was die erwähnten eigenen Monografien betrifft, so ist das 2014 im dgvt-Verlag erschienene Buch Rauschdrogen und andere psychotrope Substanzen eindeutig der ersten Kategorie zuzuordnen: Alle (bis dahin bekannten) relevanten Drogen (inklusive Alkohol, Tabak und Beruhigungsmittel) werden in ihren Wirkungen und Wirkmechanismen beschrieben, wobei der Schwerpunkt der Darstellung auf der gegenwärtigen Suchtproblematik liegt. In dem bei Beck 2008 erschienenen kürzeren Werk Rauschdrogen – Geschichte, Substanzen, Wirkung wurden hingegen eher die kulturhistorischen Aspekte betont. Gedanken aus beiden Arbeiten sind in die vorliegende Monografie naturgemäß eingeflossen, wobei dies der Lesbarkeit zuliebe nicht immer ausdrücklich gekennzeichnet wurde.
Auch hier nun musste selbstverständlich eine Beschränkung des Umfangs und damit eine Eingrenzung der Thematik erfolgen. Da es zur Kulturgeschichte des Rauchens zahlreiche Arbeiten gibt und Tabak mit seinem Hauptwirkstoff Nikotin zwar Abhängigkeit erzeugt sowie bekanntermaßen gesundheitsschädigend ist, aber nicht in wesentlicher Weise das Verhalten verändert, wurde dieser nicht behandelt; auch Rauschdrogen wie Kawa-Kawa, Betel oder Khat, die in anderen Kulturkreisen eine große, bei uns hingegen keine Rolle spielen, wurden nicht dargestellt.
Wulf Bertram, mit dem ich schon seit Jahrzehnten eine anregende Zusammenarbeit genießen kann, hat bei seinem letzten Besuch in Hamburg bei der Findung der Thematik sehr geholfen. Frau Nadja Urbani hat in vorbildlicher Weise die Entstehung der Arbeit begleitet, mir wertvolle Literaturhinweise gegeben und schließlich mit Formulierungsvorschlägen zu einer sehr verbesserten Endfassung beigetragen. Frau Mihrican Özdem hat hervorragende Lektorierungsarbeit geleistet, und meine liebe Frau Carmen hat mich immer wieder beim Durchlesen daran erinnert, dass dieses Büchlein auch von jenen mit Gewinn gelesen werden sollte, die nicht ein Studium der Medizin, Biologie oder Pharmazie absolviert haben.
Hamburg, im Februar 2019
Thomas Köhler
1 Zur Einführung: Wirkung von Alkohol und Rauschdrogen
1.1 Begriffsklärungen
Der Begriff »Rauschdrogen« (1)(1)ist nicht klar definiert, ebenso wenig die alternativ sich anbietenden Bezeichnungen »Drogen(1)«, »Rauschmittel«, »Rauschgifte« oder »Suchtmittel«. In der Pharmakologie wird unter »Droge« eine (meist getrocknete; von dröge = trocken) Zubereitung aus Pflanzen bezeichnet. Eine solche wäre beispielsweise Flos Chamomillae, Kamillenblüte mit dem entzündungshemmenden Chamazulen als wichtigem Inhaltsstoff. Die umgangssprachliche Bedeutung ist hingegen eine gänzlich andere: ein (in aller Regel illegales) pflanzliches oder synthetisch hergestelltes Produkt, welches in angenehmer Weise Stimmung, Wahrnehmung, Empfinden und Denken verändert, oft einen regelrechten Rauschzustand erzeugt; das bekannteste Rauschmittel jedoch, nämlich Alkohol(1), wird im allgemeinen Sprachgebrauch nicht als Droge bezeichnet (ebenso wenig Nikotin(1)(2) und Koffein) – weil diese Substanzen, wenigstens hierzulande, legal erworben werden können. Gleichfalls missverständlich ist die Bezeichnung »Rauschgifte« (wie sie etwa in der Zusammensetzung »Rauschgiftdezernat« oder »Rauschgifttoter« auftaucht). Rauschdrogen sind nicht stärker toxisch (giftiger) als andere Arzneien. Es sind vielmehr ihre spezifischen Effekte (etwa Realitätsverkennung, (1)Aggressivität) und insbesondere mögliche Abhängigkeitsentwicklungen(1)(1)(1) (Süchte), derentwegen sie besondere Beachtung durch den Gesetzgeber erfahren. Da jedoch keineswegs alle Rauschdrogen zwangsläufig zur Sucht führen, sondern manche – wie beispielsweise Alkohol oder Kaffee – von den meisten Konsumenten sehr kontrolliert eingenommen werden, ist auch die Bezeichnung »Suchtmittel«(1) für diese wenig sinnvoll. »Betäubungsmittel«(1) ist erst recht kein treffender Ausdruck. In letztere Gruppe, die im allgemeinen Verständnis durch starke analgetische und/oder psychische Funktionen herabsetzende Wirkungen charakterisiert ist, gehören nämlich keineswegs alle Rauschdrogen: Dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG; s. Kasten)(1) unterstellt sind Opioide(1) und Cannabinoide(1) (beide tatsächlich eher »betäubend«), daneben aber viele Psychostimulanzien(1) (insbesondere Amphetamin(1) und Methamphetamin),(1) die im Gegenteil die psychische Aktivität erhöhen, zudem diverse halluzinogene Substanzen, welche sogar eine extrem sensitivierte Wahrnehmung und Empfindung bewirken.
Präziser und inhaltlich am wenigsten vorbelastet, umgangssprachlich allerdings ungebräuchlich, ist der Terminus psychotrope (psychoaktive) Substanz,(1) der auch in den klassifikatorisch-diagnostischen(1) Systemen ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen, Kapitel V [F]) und DSM-5(1) (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) verwendet wird.
Das Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
Das Betäubungsmittelgesetz(2), mit vollem Namen »Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln«, regelt in Deutschland den Umgang mit bestimmten psychotropen Substanzen (wie ausgeführt, sehr missverständlich als Betäubungsmittel bezeichnet); es löste 1971 das alte Opiumgesetz(1) aus dem Jahre 1930 ab. Letzteres bezog sich übrigens – anders als im Namen impliziert – keineswegs allein auf Opiate, sondern schloss u. a. Kokain und indischen (1)Hanf (also Cannabisprodukte) ein. Der Begriff »Betäubungsmittel« ergibt sich ausschließlich aus der Anlage, wo diese Substanzen aufgelistet sind. Dazu gehören neben den lange schon dort angeführten Opioiden – übrigens keineswegs allen – viele Psychostimulanzien(2) wie Amphetamine(2) und das zur Behandlung von (1)ADHS eingesetzte Methylphenidat (etwa Ritalin®).(1) Weiter aufgeführt sind Halluzinogene(1) wie LSD(1) und Psilocybin(1), zudem Cannabinoide(2) sowie diverse Designerdrogen(1) (etwa 3,4-MDMA = Ecstasy(1) oder das in vielen »Badesalzen« enthaltene Mephedron).
Die(1) Betäubungsmittel werden in drei Kategorien eingeteilt:
nicht verkehrsfähige,
verkehrs-, aber nicht verschreibungsfähige,
verkehrs- und verschreibungsfähige.
Letztere Gruppe umfasst Substanzen, die sich legal therapeutisch einsetzen lassen und mittels spezieller ärztlicher Rezepte in Apotheken zu erhalten sind. Dazu gehören viele zur Schmerzbekämpfung eingesetzte Opioide(2) (z. B. Morphin(1), Hydromorphon(1), Oxycodon(1), Fentanyl(1), Pethidin(1), Methadon), Methylphenidat, zudem THC(1), der Hauptwirkstoff von Cannabis sativa(1), der u. a. gegen Symptome der multiplen Sklerose (etwa schmerzhafte Spastik) eingesetzt wird. Ihre Verschreibung hat nach der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV)(1) zu erfolgen; dies bedeutet u. a., dass die Rezeptformulare von einer bestimmten Behörde anzufordern sind, das ausgefüllte Rezept in drei Ausführungen (d. h. mit zwei Durchschlägen) vorliegen muss – von denen einer beim Arzt und einer in der Apotheke verbleiben (und mehrere Jahre aufbewahrt werden müssen), und auf einem Einzelrezept lediglich die Verordnung einer Höchstmenge zulässig ist.
Zur zweiten Gruppe gehören Substanzen, die zwar als solche nicht verschrieben werden dürfen, jedoch zur Herstellung verschreibungsfähiger Medikamente dienen können; ein Beispiel dafür ist Methamphetamin(2). Nicht verkehrsfähige Substanzen dürfen überhaupt nicht in den Handel gebracht und schon gar nicht verschrieben werden, so 3,4-MDMA (Ecstasy).(2) Was beim ersten Lesen überrascht, jedoch einen guten Grund hat, ist, dass der Konsum einer Substanz per se keine Straftat darstellt; auch ihr Besitz zum Eigenbedarf wird bei geringen Mengen – die von Nation zu Nation und in Deutschland zwischen den Bundesländern schwanken – nicht automatisch verfolgt. Herstellung und Besitz einer größeren Menge zum Vertrieb, speziell mit einer Gewinnerzielungsabsicht, hat hingegen schwerwiegende juristische Konsequenzen.
1.2 Wirkungen und Wirkmechanismen der Substanzen
1.2.1 Biologische Grundlagen
Drogeneffekte – die der Inhalanzien(1) (Schnüffelstoffe)(1) möglicherweise ausgenommen – lassen sich in aller Regel durch einen Eingriff in die Übertragung von Reizen von einer Nervenzelle zur nächsten erklären. Häufig besetzen die psychotropen Substanzen(1) nämlich Bindungsstellen (Rezeptoren), die für natürliche Überträgerstoffe (die Neurotransmitter)(1)(1) vorhergesehen sind, und ahmen dabei entweder als Agonisten deren Wirkungen nach (z. B. Morphin an Rezeptoren für endogene Opioide)(1)(1) oder verhindern diese als sogenannte Antagonisten (beispielsweise Phencyclidin = PCP(1) = angel dust(1) oder Ketamin(1) an Rezeptoren für den Transmitter Glutamat).
Wer es genauer wissen will . . .
Die Erregungsübertragung an den Synapsen(1), Verbindungen zweier Nervenzellen (Neuronen), geschieht in aller Regel chemisch, indem das zuerst erregte (präsynaptische) Neuron Botenstoffe (Transmitter)(1) in den synaptischen Spalt freisetzt, von wo aus sie zur postsynaptischen Nervenzelle diffundieren. Typischerweise schüttet – vereinfacht formuliert – jede Nervenzelle nur einen einzigen Transmitter aus, nach welchem sie sich klassifizieren lässt: So verwendet ein dopaminerges Neuron als Botenstoff ausschließlich Dopamin, ein cholinerges allein Acetylcholin zur Übertragung. Um ihre Wirkung entfalten zu können, müssen sich die Neurotransmitter mit Proteinkomplexen der postsynaptischen Membran verbinden (den Bindungsstellen oder Rezeptoren). Diese sind für die einzelnen Transmitter spezifisch; man spricht deshalb beispielsweise von Dopamin- oder Acetylcholin-Rezeptoren(1)(2)(1) (von denen jedoch immer mehrere Subtypen existieren). Als Folge der Andockung von Transmittermolekülen an Rezeptoren kommt es zur Herauf- oder Herabsetzung der Empfindlichkeit der postsynaptischen Zelle. Im ersten Fall spricht man von erregenden, im anderen Fall von hemmenden Synapsen. Damit eine erneute effiziente Erregungsübertragung gewährleistet ist, müssen die in den synaptischen Spalt ausgeschütteten Transmitter rasch wieder daraus entfernt werden. Dies geschieht entweder durch Zerlegung der Transmittermoleküle im Spalt selbst, etwa bei Acetylcholin, oder (häufiger) durch Wiederaufnahme der intakten Botenstoffe in das präsynaptische Neuron (Reuptake);(1) dazu dienen sogenannte Carrierproteine (Transporter). Letztere Form der Inaktivierung ist charakteristisch für die Monoamintransmitter(1) Dopamin(1), Noradrenalin(1) und Serotonin(1), gilt aber auch für die Aminosäuretransmitter(1) GABA (Gamma-Aminobuttersäure)(1) und Glutamat(1). Durch die Verhinderung der Wiederaufnahme (mittels einer Blockade der Transporter) wird das postsynaptische Neuron häufiger von diesen Botenstoffen erreicht, womit sich die (2)synaptische Übertragung verstärkt (indirekter Agonismus); so beruht die Wirkung der psychostimulatorisch wirkenden Substanz Kokain vornehmlich auf einer Reuptake-Hemmung(1)(1) für die Monoamintransmitter Dopamin und Noradrenalin.
Die meisten Transmitter können – abhängig von der Art des Rezeptors – sowohl erregend wie hemmend wirken. Eine Ausnahme macht GABA, die stets hemmend wirkt. Ausschließlich erregend ist hingegen Glutamat; die Besetzung seiner verschiedenen Typen von Bindungsstellen (u. a. des später genauer beschriebenen NMDA-Rezeptors) führt zu erhöhter Erregbarkeit der postsynaptischen Zelle. Einige psychotrope Substanzen (beispielsweise Phencyclidin und Ketamin, wahrscheinlich auch Alkohol) lagern sich NMDA-Rezeptoren(1) an, schwächen dabei deren Leistungsfähigkeit, wirken somit antagonistisch an diesen Typen von Synapsen.
1.2.2 Akute Effekte(1)
Wegen dieser Wirkungen wird typischerweise der (1)Konsum der Substanzen begonnen; besondere Bedeutung hat dabei die Hebung der Stimmung (Euphorisierung(1)). Wenn Erwin Sommer, der »Held« in Falladas »Der Trinker« (1964, S. 14), schreibt, »Ich hob das Glas zum Munde und trank es bedächtig. Schluck für Schluck, ohne einmal abzusetzen, leer. Es schmeckte frisch, prickelnd und leicht bitter, und indem es meinen Mund passierte, schien von ihm etwas von einer Helle und Leichtigkeit zu hinterlassen, die vorher nicht gewesen war.« so schildert er treffend eine milde Form der Euphorisierung(2), die Erzeugung einer angenehmen, »wohlig-fröhlichen« Stimmung, die im Extremfall (wie bei Injektion von Opioiden) ein nicht zu übertreffendes Hochgefühl darstellt. Dieser (2)Effekt ist wesentlich für die Entwicklung einer Sucht (eines Abhängigkeitssyndroms)(1) verantwortlich.
Wer es genauer wissen will . . .
Als Mechanismus nimmt man eine verstärkte Feuerung mittels Dopamin(2) übertragender (dopaminerger) Neuronen an, die vom Mittelhirn (Mesencephalon) in das Telencephalon (Endhirn) ziehen. Von besonderer Bedeutung sind dabei Bahnen, die am Nucleus accumbens(1) enden, einem unscheinbaren paarig angelegten Kern an der Großhirnbasis. Die Besetzung der dort lokalisierten Dopaminrezeptoren(2) veranlasst beispielsweise Tiere dazu – auch unter Inkaufnahme unangenehmer, etwa schmerzhafter Reize –, sich die Substanzen selbst zu verabreichen. Zerstörung dieser Bahnen führt in der Regel zur Beendigung dieser »Selbstapplikation«. Nur bedingt geklärt ist, wie diese dopaminergen Bahnen zur Feuerung angeregt werden. Eine plausible Annahme ist, dass einige psychotrope Substanzen (beispielsweise Opioide) Rezeptoren an Neuronen im Mittelhirn besetzen und diese aktivieren.
Abbildung 1-1 zeigt das mesotelencephale dopaminerge Belohnungssystem(1)(1).
Abb. 1-1 Das mesotelencephale dopaminerge Belohnungssystem (aus Köhler 2014a)
Einige Substanzen wirken zudem anregend (psychostimulierend). So schreibt S. Freud(1) in seiner frühen Arbeit »Ueber Coca«:
»Während dieses [. . .] Cocainzustandes tritt das hervor, was man als wunderbare stimulierende Wirkung der Coca bezeichnet hat. Langanhaltende, intensive geistige oder Muskelarbeit wird ohne Ermüdung verrichtet [. . .].« (Freud, 2004/1884, S. 63)
Dieser (3)Effekt, der oft mit objektiver Leistungssteigerung und erhöhter Wachheit einhergeht, ist ebenfalls häufig ein wesentliches Konsummotiv, speziell von (1)(1)Kokain(1) und anderen psychostimulatorisch wirksamen Substanzen, im harmlosesten Fall Koffein(1), zunehmend häufiger jedoch von Amphetamin(3)(1)und(1)(1)Methamphetamin (Crystal Meth).(3)(1)
Wer es genauer wissen will . . .
Sie dürfte auf Verstärkung der noradrenergen, eventuell auch der dopaminergen Übertragung basieren. So setzen (2)Amphetamine aus der präsynaptischen (2)Zelle vermehrt die genannten Transmitter frei; Kokain(2) wirkt u. a. als Reuptake-Hemmer(2) für Dopamin(3) sowie Noradrenalin(2) und erhöht durch verminderte Entfernung der Transmitter aus dem synaptischen Spalt dort deren Konzentration.
Auch der gegenteilige (2)Effekt(2) tritt bei manchen psychotropen Stoffen auf, nämlich eine Sedierung (Beruhigung)(1), die typischerweise mit Anxiolyse(1) einhergeht, also einer Reduktion von Angst. Zitieren wir noch einmal Erwin Sommer aus Falladas »Trinker«, der soeben ein Glas Schnaps geleert hat:
»Der Frühlingstag empfing mich mit sonniger Wärme und leichtem, seidenfeinen Wind, aber als ein Verwandelter kehrte ich in ihn zurück. Aus der Wärme in meinem Magen war eine Helligkeit in meinem Kopf emporgestiegen, mein Herz pochte frei und stark. [. . .] Meine Sorgen waren von mir abgefallen. ›Es wird sich alles schon einmal regeln‹, sagte ich mir heiter und schlug den Weg heimwärts ein. ›Warum sich jetzt schon darüber plagen‹.« (Fallada, 1964, S. 15)
Einen solchen Effekt haben als Ziel die Sedativa(1). Wie gesehen, wirkt auch Alkohol, v. a. in nicht allzu hohen Dosen und speziell bei nervöser Grundstimmung, sedierend-anxiolytisch, also beruhigend und angstlösend (»Erleichterungstrinken(1)« oder, wie Wilhelm Busch es so treffend ausdrückt: »Es ist ein Spruch von altersher, wer Sorgen hat, hat auch Likör.«).
Wer es genauer wissen will . . .
Als ein wichtiger Mechanismus wird ein Angriff am kompliziert gebauten Rezeptor für den hemmenden Transmitter GABA angenommen; dabei wird entweder die Wirkung von GABA verstärkt (etwa durch die Benzodiazepine(1)), oder es erfolgt eine direkte Öffnung von Ionen-Kanälen durch die Substanz (wie mutmaßlich bei den über Jahrzehnte als Schlafmittel gebräuchlichen Barbituraten(1)). Eine Hemmung am NMDA-Rezeptor(1) für den erregenden Transmitter Glutamat(2) dürfte ein weiterer Mechanismus der Sedierung sein, daneben die Blockade bestimmter Typen von (1)Histamin-Rezeptoren(1).
Zahlreiche Substanzen, insbesondere die in der Umgangssprache als »Rauschdrogen« bezeichnete (z. B. LSD(2), Meskalin(1), Psilocybin(2), der Hauptwirkstoff der »magic mushrooms«,(1) in vielen Nachtschattengewächsen(1) enthaltene Substanzen wie das Scopolamin(1) in der Engelstrompete(1), »Dissoziativa(1)« wie Ketamin(2), auch Cannabinoide), weisen halluzinogene (psychedelische) (1)Effekte(1)(1)(1)(1) auf(1), bewirken also eine Akzentuierung von Sinneseindrücken, im Extremfall bis hin zur Erzeugung unkorrigierbarer Wahrnehmungen nicht vorhandener Dinge. So beschreibt Albert Hofmann, der Entdecker von LSD, seine Erfahrungen nach Einnahme folgendermaßen:
»Jetzt begann ich allmählich das unerhörte Farben- und Formenspiel zu genießen, das hinter meinen geschlossenen Augen andauerte. Kaleidoskopartig sich verändernd drangen bunte, phantastische Gebilde auf mich ein, in Kreisen und Spiralen sich öffnend und wieder schließend, in Farbfontänen zersprühend, sich neu ordnend und kreuzend, in ständigem Fluß. Besonders merkwürdig war, wie alle akustischen Wahrnehmungen, etwa das Geräusch einer Türklinke oder eines vorbeifahrenden Autos, sich in optische Empfindungen verwandelten. Jeder Laut erzeugte ein in Form und Farbe entsprechendes, lebendig wechselndes Bild.« (Hofmann, 1982, S. 33)
Die Sinneseindrücke(2) kann man zwar als halluzinatorisch bezeichnen, sie sind jedoch nicht Halluzinationen(1) im psychiatrischen Sinne, von deren tatsächlicher Realität der Patient überzeugt ist. Vielmehr handelt es sich um Pseudohalluzinationen, wo der Konsument sie als Drogeneffekte erkennt. Echte (1)Halluzinationen können zwar vorkommen – dann oft bei diesbezüglich ohnehin Belasteten –, sind aber eher selten. Der Vorschlag, die Substanzen deshalb besser als »Psychedelika(1)« (die Seele öffnende Stoffe) zu bezeichnen, hat sich jedoch nicht durchgesetzt.
Wer es genauer wissen will . . .
Die Mechanismen sind vielfältig und bestenfalls sehr bedingt geklärt; offensichtlich sind mehrere Transmittersysteme beteiligt. Klassische Halluzinogene wie LSD stimulieren bestimmte Typen von Serotoninrezeptoren(1); die psychoaktiven Stoffe in Nachtschattengewächsen(1) sind Anticholinergika(1), blockieren also Bindungsstellen für Acetylcholin (und verstärken damit indirekt die Wirkungen des Transmitters Serotonin); die Effekte der Dissoziativa(2) (beispielsweise Ketamin) werden durch eine Blockade von NMDA-Rezeptoren(2) erklärt.
Tabelle 1-1 (vereinfacht nach Köhler, 2014b, S. 23) fasst die psychischen Effekte zusammen.
Tab. 1-1 Unmittelbare psychische Effekte bei Konsum psychotroper Substanzen(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
Substanz
Euphorisierung
Sedierung
(1)Antriebssteigerung
Halluzinogene Effekte
Alkohol
+
+
(+)
–
(1)Opioide
++
+
–
(+)
Sedativa
(+)
++
(+)
–
(3)Kokain
++
–
++
(+)
Psychostimulanzien
++
–
++
(+)
Cannabinoide
+
+
(+)
+
Halluzinogene
+
–
(+)
++
Nikotin
+
+
+
–
(1)Inhalanzien
(+)
(+)
(+)
(+)
–: tritt in der Regel nicht auf; (+): kann auftreten; +: tritt mit gewisser Regelmäßigkeit auf; ++: tritt regelmäßig und stark auf
In der Regel wirken psychotrope Substanzen auch auf das vegetative Nervensystem, beeinflussen beispielsweise Herz-Kreislauf-Aktivität, Verdauung oder (1)Pupillenweite. Meist werden diese Nebenwirkungen als störend empfunden (jedoch in Kauf genommen), zuweilen allerdings gezielt solche Effekte gesucht: So ist die appetitzügelnde Wirkung der Amphetamine oft der erste Anlass für ihren Missbrauch. Vegetative Begleitreaktionen geben häufig Hinweis auf die Art der konsumierten Droge (etwa kleine Pupillen bei Opioideinnahme, weite (2)Pupillen(1) u. a. nach Konsum von Kokain, (1)Amphetaminen, Ecstasy sowie den meisten Halluzinogenen). (3)Körperliche Nebenwirkungen(1) sind häufig für die Todesfälle im Zusammenhang mit Drogenkonsum verantwortlich; so sterben Heroinabhängige nicht selten an Lähmung des Atemzentrums, Kokain- oder Amphetaminkonsumenten an (1)Herzrhythmusstörungen oder Schlaganfällen.
Übrigens . . .
Einige psychotrope Substanzen haben auch analgetische (schmerzstillende) (1)Effekte(1). Hauptsächlich deswegen wurden die Opioide in die Medizin eingeführt, und nicht selten entwickelt sich bei Patienten mit chronischen Schmerzen wegen der begleitenden Euphorisierung(3) ein chronisches Konsummuster bis hin zu Abhängigkeit. Zumindest bestimmte Formen von Schmerzen werden zudem von Cannabinoiden gelindert; das Dissoziativum Ketamin ist ein ausgesprochen wirksames Analgetikum. Eine gewisse schmerzlindernde Wirkung wird auch dem Alkohol nachgesagt.
1.2.3 Verzögerte Wirkungen und langfristige Effekte
Neben den akuten Wirkungen lassen sich nach Einnahme vieler Drogen verzögerte Effekte(1) beobachten; bekannt sind der Alkoholkater(1) und die alkoholische (1)Amnesie ((1)Filmriss);(1) ausgesprochen interessant und in ihrem Wirkmechanismus noch nicht annähernd geklärt sind die bei Halluzinogenen(1) und(1) Cannabinoiden(1) beschriebenen Flashbacks(1), das Wiedererleben der Drogeneffekte lange nach letztem Konsum.
Regelmäßige Einnahme psychotroper Substanzen über längere Zeit zieht oft diverse Veränderungen nach sich. Besonders bemerkenswert ist ein Nachlassen der Wirkung (Toleranz). Eng damit verknüpft ist das Auftreten von Entzugserscheinungen(1), also von Reaktionen, die sich nicht allein als fehlender Drogeneffekt erklären lassen, sondern Verhaltensweisen darstellen, die vor Konsumbeginn nicht vorhanden waren und auf drogeninduzierten Veränderungen basieren. Bekannt sind das eindrucksvolle Opioidentzugssyndrom(1) sowie das zuweilen lebensbedrohliche Delirium tremens bei Alkoholentzug(1)(1).
Ebenfalls eine Folge von Umbauprozessen als Reaktion auf die konstante Drogeneinwirkung ist das Abhängigkeitssyndrom(2) – v. a. umgangssprachlich als »Sucht«(1) bezeichnet. Es ist durch Toleranzentwicklung(1) und Entzugssymptomatik sowie durch weitere Merkmale charakterisiert (s. Kap. 1.3). Schließlich sind die bei fast allen Drogen mehr oder weniger stark auftretenden körperlichen und psychischen Schäden nach längerer Einnahme zu nennen, die in der Regel nicht allein Effekte ihrer psychotropen Wirkungen sind, sondern häufig auf andere Faktoren zurückgeführt werden, beispielsweise auf die zellzerstörenden Eigenschaften von Alkohol (etwa Leberschäden und Veränderungen im Nervensystem), die Erhöhung der Kreislaufaktivität durch Amphetamine und Kokain, auf Infektionen beim Spritzen von Opioiden.
1.3 Toleranz und Entzugserscheinungen
Der Begriff »Toleranzentwicklung«(2)(1) bezeichnet das Phänomen, dass nach wiederholter Einnahme bei gleicher Dosis die Wirkung geringer wird. Bei manchen Substanzen ist dies sehr ausgeprägt; so vertragen zuweilen Opioidsüchtige bis zum Hundertfachen der für Unerfahrene tödlichen Dosis.
Beispiel
Der Schriftsteller Hans Fallada(1) trank zeitweise mehrere Flaschen Kognak pro Tag und spritzte sich 10 oder mehr Morphinampullen.
Üblicherweise unterscheidet man zwei Formen von Toleranz: Bei(1) der metabolischen (2)Toleranz ist der Abbau der Substanz gesteigert, womit ein geringerer Anteil an die Wirk-Orte (speziell das Gehirn) gelangt. Diese Toleranzform tritt beispielsweise nach längerem Alkoholkonsum auf, indem abbauende Enzymsysteme aktiviert werden. Davon wird die funktionelle (1)Toleranz(2)unterschieden, die meist durch Veränderung an den Synapsen zustande kommt ((1)Rezeptortoleranz)(1) oder auf veränderte Aktivität in den Zielorganen zurückzuführen ist (zelluläre (1)Toleranz). (2)Es ist erstaunlich, wie nüchtern manche Konsumenten trotz großer einverleibter Alkoholmengen wirken.
Wieder können wir zur Illustration den Trinker Erwin Sommer zitieren, der – nach einer Zecherei mit Dorfbewohnern ohnehin schon gut abgefüllt – von zwei wohl gesonnenen Ärzten im Auto in eine Entzugsanstalt gebracht werden soll:
»Ich hielt es nicht mehr aus. Mit einem Blick vergewisserte ich mich, daß die beiden Herren vor mir in ein eifriges Gespräch vertieft waren; ich zog die Flasche aus der Tasche, entkorkte sie vorsichtig und tat ein paar kräftige Schlucke. Aber ich hatte nicht an den Rückspiegel über dem Führersitz gedacht.
›Nicht zu viel jetzt, und nicht zu hastig, mein lieber Herr Sommer‹, sagte Dr. Mansfeld und hob vom Steuer eine mahnende Hand.
›Wir hätten nachher gerne noch ein vernünftiges Wort mit Ihnen gesprochen.‹
[. . .]
Von da an war ich ganz ruhig und gesammelt. Der eben getrunkene Schnaps verlieh mir neue Kraft und Konzentration. Ich hatte ein festes Ziel vor Augen; diese Unterredung fürs erste unter allen Umständen zu vereiteln. [. . .]
Das Auto fuhr und fuhr [. . .] und noch immer hatte sich keine Möglichkeit geboten, als Teilnehmer an dieser Fahrt auszuscheiden. Dann aber kam aus dem Fuhrhof von Hases einer seiner großen Lastzüge mit zwei Anhängern etwas überraschend hervor. Schon, während der Doktor den Wagen auf die linke Straßenseite hinüberriß, dabei scharf bremsend, hatte ich leise die Wagentür geöffnet, nun, da der Lastzug passiert war, und der Arzt schon wieder Gas gab, sprang ich leicht ab, einen Augenblick taumelte ich, rannte vorwärts neben dem Wagen, drohte zu fallen und hatte mich gefangen. Ich stand, winkte mit der Hand dem Wagen nach, den Passanten vorgebend, dieses plötzliche Aussteigen sei mit Wissen der Insassen geschehen, und schritt dann rasch, rechts von der Straße abbiegend, am Zaun des Fuhrhofs hoch, zu einer kleinen, verfallenen Kolonie [. . .]. Ich schüttelte mich innerlich vor Lachen, daß die beiden weisen Ärzte von ihrer Expedition nichts heimbrachten als die Schuhe eines Trinkers.« (Fallada, 1964, S. 51)
Bei der (3)zellulären (besser: gegenregulatorischen) (1)(1)(1)Toleranz werden Mechanismen entwickelt, welche dem Substanzeffekt entgegenwirken. Diese gegenregulatorische Toleranz spielt eine wichtige Rolle für die Entzugssymptomatik(2)(1) und das Bedürfnis nach der Substanz: Hält nämlich die Gegenregulation länger als der Drogeneffekt an, würde sich nach Abstinenz ein Ungleichgewicht einstellen, das erst durch Substanzzufuhr beseitigt wird. Interessante Überlegungen gehen davon aus, dass diese Gegenregulation zuweilen klassisch konditionierbar ist, d. h. schon angesichts von Reizen einsetzt, die mit dem Drogenkonsum assoziiert sind (etwa der übliche Ort des Konsums), und dass sich unter diesen Bedingungen das Substanzverlangen verstärkt. Noch implikationsreicher ist die Überlegung, dass bei Abwesenheit der üblichen mit der Drogeneinnahme verbundenen Stimuli, beispielsweise bei Konsum an ungewohnten Örtlichkeiten, die Substanzeffekte stärker sind, nachdem der konditionierte Anteil der Gegenregulation wegfällt. Interessant ist die Beobachtung, dass die tödlichen Heroinüberdosierungen(1) überzufällig häufig dann passieren, wenn die Junkies aus ihrer gewohnten Umgebung vertrieben wurden.
Wird nach längerer und regelmäßiger Substanzeinnahme die Menge reduziert oder der Konsum völlig eingestellt, können äußerst eindrucksvolle (mitunter lebensbedrohliche) Entzugssymptome auftreten; sie lassen sich im Allgemeinen durch erneute Zufuhr der gewohnten Substanz (etwa Morphin) beseitigen. Ausbildung von Entzugserscheinungen und (2)Toleranzentwicklung sind häufig, aber nicht zwingend gekoppelt.
Übrigens . . .
Die eigentlichen Entzugssymptome(3) sind von Rebound-Phänomenen(1) zu unterscheiden, Symptomen, zu deren Beseitigung die Substanz eingesetzt wurde und die mit der Abstinenz zurückkehren. Beispiele wären die Wiederkehr von Schlafstörungen nach Absetzen eines Schlafmittels oder ein Aufkommen von Müdigkeit und Schlafbedürfnis, die durch Amphetamine(4) unterdrückt wurden und nach Ende des Konsums ausbrechen. Hingegen sind echte Entzugssymptome körperliche Neubildungen, waren vor dem Substanzkonsum nicht vorhanden und treten erstmalig bei Abstinenz nach längerer Einnahme auf. Das wohl eindrucksvollste Beispiel sind epileptische Anfälle, die bei diesbezüglich nie belasteten Personen nach dem Absetzen von Alkohol- oder Benzodiazepinen(2) auftreten können – weshalb ein solcher, etwa bei einem Krankenhausaufenthalt, weder von den Patienten noch von ihren Angehörigen schamhaft verschwiegen werden sollte.
Die Mechanismen der Entzugssymptomatik sind nur sehr unzureichend geklärt. Es ist eine plausible Annahme, dass durch die regelmäßige Substanzzufuhr der Organismus entsprechende Gegenmaßnahmen entwickelt hat, sodass bei Fehlen der Substanz ein nicht sofort zu kompensierendes Ungleichgewicht entsteht.
1.4 Abhängigkeit und ihre Grundlagen
Sinnvoll – leider oft nicht konsequent durchgeführt – ist die Unterscheidung zwischen schädlichem Gebrauch (Missbrauch) von Substanzen und regelrechter Abhängigkeit(1)(2), denen wahrscheinlich unterschiedliche Prozesse zugrunde liegen.
Das Abhängigkeitssyndrom(3) ist durch Toleranzentwicklung und (körperliche) Entzugssymptomatik charakterisiert sowie durch weitere Merkmale, nämlich unbezwingbare Gier(1) nach der Substanz (Craving), mangelnde (1)Kontrollfähigkeit bezüglich der Umstände und der konsumierten Menge, Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Substanzkonsums, fortgesetzte Einnahme trotz bekannter, eventuell schon auffälliger körperlicher oder psychischer Schäden. Nicht alle müssen gleichzeitig vorliegen, um ein Abhängigkeitssyndrom zu diagnostizieren.
Beispiel
Als eindrucksvolles Beispiel für die Vernachlässigung anderer Interessen möge der verdiente Altkanzler Helmut (1)Schmidt dienen, dem man zunächst, wider alle Vorschriften, das Rauchen in Fernsehstudios weiter gestattete. Als dies nicht mehr zu machen war, wurden seine Auftritte deutlich seltener.
Für die Entstehung von Abhängigkeit wurden verschiedene, jedoch nur bedingt befriedigende Erklärungsansätze entwickelt. Lerntheoretische Modelle betonen zum einen den positiv verstärkenden (belohnenden) Effekt der Drogeneinnahme (im Sinne einer angenehmen Wirkung); zum anderen wird angenommen, dass der Substanzkonsum über eine Vermeidung oder die Beendigung von Entzugssymptomatik belohnend wirkt (»negativ verstärkend« ist). Dieses Modell greift insofern eindeutig zu kurz, als dies für alle Personen gelten müsste, die mit den Substanzen einmal Bekanntschaft gemacht haben, während erfahrungsgemäß – beispielsweise bei Personen, die Opiatanalgetika(1)(1) eingenommen haben – lediglich ein Teil abhängig wird. Auch werden nicht wenige Abhängige wieder rückfällig, wenn nach Monaten oder Jahren der Körper entgiftet ist und die Vermeidung von (unmittelbarer) Entzugssymptomatik als Einnahmemotiv wegfällt; zudem stellt der Rückfall in das Suchtverhalten mit den verbundenen Konsequenzen in aller Regel einen ausgesprochen aversiven Stimulus dar, welcher die angenehmen kurzfristigen Effekte der Drogeneinnahme langfristig weitaus übertreffen sollte. Es wäre also noch zu erklären, warum bei bestimmten Personen die Drogeneffekte so stark sind, dass ihnen gegenüber alle anderen Konsequenzen in den Hintergrund treten.
Psychische Störungen(1) und Suchtverhalten
Unbestreitbar bestehen gewisse Beziehungen zwischen psychischen Störungen und Suchtverhalten(1). Gehäuft kommt Substanzmissbrauch bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung vor; auch depressive Störungen oder Ängste sind häufig mit Konsum psychotroper Substanzen assoziiert, speziell von Sedativa (Beruhigungsmitteln). Die Einnahme stellt oft einen Versuch der Selbststimulation(1) oder Selbstmedikation(1) dar. Wenig überzeugend belegt ist übrigens die lange sehr populäre, psychoanalytische These einer oralen Persönlichkeitsstruktur(1) bei Abhängigen.
Biologische(1) Modelle führen die Suchtanfälligkeit vornehmlich auf eine genetische Disposition(1) zurück, die sich in gesteigerter Empfänglichkeit für die positiven Wirkungen der Substanz und/oder als Unempfindlichkeit für ihre negativen Effekte manifestieren könnte. Da wesentliche Drogenwirkungen über das dopaminerge System(1) vermittelt werden, liegt es zudem nahe, bei Substanzabhängigen Besonderheiten von Genen anzunehmen, welche die Ausbildung von Rezeptoren oder Transporterproteinen für besagten Transmitter determinieren. Diese Personen wären also u. a. dadurch gekennzeichnet, dass das Belohnungssystem(1) durch die üblichen Stimuli (Essen, Fernsehen usw.) nicht genügend angeregt wird, sodass eine zusätzliche Stimulierung gesucht wird.
Die (eher selten von dauerhaftem Erfolg gekrönte) Therapie der Substanzabhängigkeit(1) wird in den einzelnen Kapiteln ausgeführt und sei daher hier nur angedeutet. Erste Schritte sollten Beendigung des Konsums und Entgiftung(1), also die Entfernung der Substanz aus dem Körper sein. In vielen Fällen ist dabei mit einer Entzugssymptomatik(1) zu rechnen, die häufig medikamentös behandelt werden muss. Idealerweise nur anfänglich – bei einem Großteil der Süchtigen jedoch de facto für Jahre oder gar ein Leben lang – führt man eine (1)Substitutionstherapie(1) durch, wobei ein verwandter Stoff verabreicht wird (etwa Methadon(1) statt Heroin) oder die Substanz in anderer Darreichungsform angeboten wird (beispielsweise Nikotin als Pflaster oder Kaugummi statt im Tabak).
Nach abgeschlossener Entzugstherapie(1) – sofern keine Dauersubstitution stattfindet – gilt es, den Rückfall zu verhindern, was allein mit psychotherapeutischen Mitteln nur selten erreicht wird; deshalb kommen zunehmend Anti-Craving-Medikamente(1) zum Einsatz, also Stoffe, welche die Gier (das »Craving«) (2)nach der Substanz verhindern sollen; im Falle von Alkohol sind dies Opiatantagonisten wie Naltrexon(1)(1)(1)(1) oder das in seinem Mechanismus unklare Acamprosat(1). Seltener werden heute aversiv wirksame Medikamente eingesetzt, die bei erneuter Einnahme der Substanz zu unangenehmen körperlichen Reaktionen führen und so den Rückfall verhindern sollen.
Wie erwähnt, wird die Substitutionstherapie oft nicht auf die akute Phase des Entzugs beschränkt, sondern weiter, oft lebenslang, fortgesetzt. Dahinter steckt die Überlegung (bzw. bittere Erfahrung), dass viele Abhängige nie auf den Stoff verzichten können und es daher sinnvoll ist, ihn zumindest in weniger schädlicher Form zuzuführen (z. B. ein Opioid nicht intravenös zu verabreichen, sondern oral), zudem die Notwendigkeit der illegalen Substanzbeschaffung zu beseitigen.
2 Alkohol: Sein Segen und sein Fluch
2.1 Was ist Alkohol?
Die Bezeichnung (1)Alkohol(2) bezieht sich streng genommen auf eine ganze Stoffklasse, nämlich Kohlenwasserstoffverbindungen, bei denen (mindestens) ein H-Atom durch eine OH-Gruppe (Hydroxygruppe) ersetzt ist. Dazu gehört u. a. Methanol (Methylalkohol)(1) mit der Summenformel CH3OH, Ethanol (Ethylalkohol, Äthanol)(1) mit der Summenformel C2H5OH, weiter etwa Propanol(1) oder Propylalkohol(1) (C3H7OH). Wesentliche Bedeutung als psychotrope Substanz hat lediglich Ethanol, sodass man oft in gewisser Nachlässigkeit Ethanol (Äthanol) mit Alkohol gleichsetzt.
Wer es genauer wissen will . . .
Bei der (1)Gärung fällt in unbedenklichen Mengen auch Methanol an. Beim Destillieren schlägt dieser sich aufgrund seines tieferen Siedepunkts zuerst nieder. Dieser »Vorlauf« muss verworfen werden, was bei unsachgemäßem Brennen häufig nicht geschieht. Die Gefahr geht v. a. von den Metaboliten Formaldehyd und Ameisensäure aus. Speziell Formaldehyd stellt ein starkes Nervengift dar und führt oft zum Tode, in geringeren Dosen zur Erblindung.
Ethanol hat ein spezifisches Gewicht von 0,79 g/ml, ist somit etwa um 20 % leichter als Wasser. Die Konzentration alkoholischer Getränke wird üblicherweise in Volumenprozent(1) (Vol %) angegeben. Ein Liter eines Getränkes mit 40 % enthält also 400 ml (1)Alkohol; die dort enthaltene Alkoholmenge beträgt dementsprechend 0,79 × 400 g = 316 g.
Während die Herstellung von (1)Industriealkohol (beispielsweise für Reinigungsmittel) durch Anlagerung von H2O an Ethen geschieht, werden alkoholische Getränke(1) mittels natürlicher Gärung gewonnen. Dabei wird die in Früchten oder anderen Pflanzen enthaltene Glukose (C6H12O6) bzw. andere Monosaccharide (oft erst nach Aufbereitung aus Stärke, der Lagerform von Sacchariden) schrittweise in Ethanol umgewandelt. Der Vorgang geschieht mithilfe von Enzymen, die sich in (1)Hefepilzen finden. Da diese in der Natur in größeren Mengen vorkommen (etwa an der Schale von Weintrauben), gären Früchte häufig spontan – man riecht dies oft, wenn man an Fallobst vorbeigeht, und viele Tiere berauschen sich auf diese Weise, warten nicht selten sogar mit dem Verzehr so lange, bis die Früchte ausreichend Alkohol enthalten.