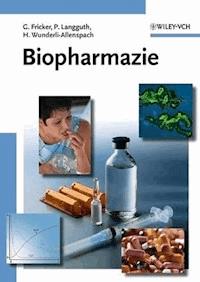
62,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Durch die jüngste Änderung der Approbationsordnung für Apotheker hat die Bedeutung der Biopharmazie in Forschung und Lehre weiter zugenommen. In diesem vollständig neu konzipierten Lehr- und Handbuch behandeln renommierte Autoren sämtliche Themen der Biopharmazie entsprechend den neuen Anforderungen. Aktuell und übersichtlich, richtet sich das Grundlagenwerk an Pharmazeuten in Wissenschaft und Industrie, aber auch an Studenten, die besonders von den integrierten Übungsteilen profitieren.
Die Hauptkapitel zu den Grundlagen der Physiologie und Pharmakokinetik werden ergänzt durch Abschnitte zu Anwendungen der Biopharmazie in der Arzneimittelentwicklung und in der Klinik. Zu topaktuellen Themen wie Prodrugs und Drug Targeting referiert der Band den Stand der Forschung. Für Praktiker hält er außerdem ein Kapitel zu Computerprogrammen in der Biopharmazie bereit.
Auch Studenten hat das Buch eine Menge zu bieten: Zahlreiche Übungsaufgaben sowie Verständnisfragen mit den dazugehörigen Antworten erlauben eine effektive Lernkontrolle und damit eine optimale Prüfungsvorbereitung.
Der Band folgt der Terminologie der Europäischen Pharmakopöe 2001. Das ausführliche Glossar enthält mehr als 100 Begriffe. Außerdem werden über 130 pharmakokinetische Abkürzungen und Symbole erklärt, so dass das Buch auch als Nachschlagewerk genutzt werden kann.
Das Autorenteam hat sich einiges vorgenommen: Ihr Buch soll das Referenzwerk der Biopharmazie werden, für Studenten und Dozenten der Pharmazie, Pharmazeuten und Pharmakologen ebenso wie für Praktiker in der Pharmaindustrie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 823
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Geleitwort
I Grundlagen der Biopharmazie
1 Einführung
2 Physiologische Grundlagen – Biologische Membranen und Barrieren
2.1 Biologische Membranen
2.2 Membrantransport
2.3 Pharmakokinetisch relevante Membranbarrieren
2.4 In vitro-Modelle der Resorption und Permeation
3 Statistische Grundlagen der Versuchsplanung
3.1 Systeme
3.2 Modelle
3.3 Statistische Methoden als Regressionstechniken
3.4 Modelle mit ausschließlich kategorialen Faktoren, Varianzanalyse, ANOVA
3.5 Prinzipien der Versuchsplanung
3.6 Äquivalenz und Signifikanz
4 Grundlagen der Pharmakokinetik
4.1 Kinetik von Arzneistoffen
4.2 Berechnung pharmakokinetischer Parameter aus klinischen Messdaten mittels Kompartiment-Modell
4.3 Berechnung pharmakokinetischer Parameter aus klinischen Messdaten mittels statistischem Modell
4.4 Absorption
4.5 Verteilung
4.6 Biotransformation
4.7 Exkretion
4.8 Pharmakokinetische Charakterisierung von ArzneistofTen – die Kernparameter
4.9 Infusion
4.10 Mehrfachdosierung
4.11 Erstellen von Dosierungsschemata
4.12 Dosierungsanpassung bei Niereninsuffizienz
II Anwendungen der Biopharmazie
5 Angewandte Biopharmazie und Pharmakokinetik in der Arzneimittelentwicklung
5.1 Physikalisch-chemische Grundlagen der Absorption: Biopharmazeutisch relevante Wirkstoff-Eigenschaften
5.2 Biotransformation
5.3 Biopharmazie der Applikationsorte und -arten
5.4 Bioverfügbarkeit und Bioäquivalenz
5.5 In-vitro Prüfung der Wirkstofffreigabe
5.6 In-vitro-/in-vivo-Korreiation (IVIVC)
6 Angewandte Pharmakokinetik in der Klinik
6.1 Pharmakokinetik-/-dynamik-Korrelationen (PK/PD)
6.2 Arzneimittelwechselwirkungen
6.3 Pharmakokinetik bei Risikopatienten
7 Ausgewählte Beispiele Arzneiformen-bezogener Pharmakokinetik
7.1 Perorale Darreichungsformen mit veränderter Wirkstofffreisetzung
7.2 Parenterale Arzneiformen
7.3 Systemische Therapie mit nasalen Darreichungsformen
7.4 Therapeutische Systeme
7.5 Biopharmazie pulmonaler Arzneiformen
8 Drug Targeting und Prodrugs
8.1 Drug Targeting
8.2 Prodrugs
9 Computerprogramme in Biopharmazie und Pharmakokinetik
9.1 Validierte Software
9.2 Software für Pharmakokinetik und Biopharmazie
9.3 Schlussfolgerungen und Ausblick
9.4 Auswahl an Software
10 Literatur
11 Glossar
Anhang I – Symbole Pharmakokinetik und Proteinbindung
Anhang II – Lösungen zu den Fragen
Register
Autron:
Prof. Dr. Peter Langguth
Universität Mainz
Institut für Pharmazie, Biopharmazie und Pharmazeutische Technologie
Staudingerweg 5
D-55099 Mainz
Prof. Dr. Gert Fricker
Universität Heidelberg
Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie
Im Neuenheimer Feld 366
D-69120 Heidelberg
Prof. Dr. Heidi Wunderli-Allenspach
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Institut für Pharmazie
Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich
Mit Beiträgen von:
Prof. Dr. Hildegard Spahn-Langguth
Spessartstr. 85
D-63599 Biebergemünd
Dr. Martin Holz
Nelkenstr. 5
D-79395 Neuenburg am Rhein
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung. Trotz sorgfältiger Recherchen konnten möglicherweise nicht in jedem Fall Rechteinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtinhaberschaft geführt werden, wird die bei wissenschaftlichen Verlagen übliche Vergütung gezahlt.
Bibliografische Information
Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2004 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Print ISBN 9783527304554
Epdf ISBN 978-3-527-66264-7
Epub ISBN 978-3-527-66263-0
Mobi ISBN 978-3-527-66262-3
Vorwort
Die Pharmazie muss sich auf ihrem Weg zu einer modernen Biowissenschaft ständig alt bekannten und neuen Herausforderungen stellen. Neben Fragen zur Synthese, Qualitätsbeurteilung und pharmakologischen Wirkung von Arzneistoffen sowie der Herstellung von Arzneiformen treten zunehmend Fragen nach der Beeinflussung der Wirksamkeit eines Arzneistoffs durch die Arzneiform sowie nach Abhängigkeiten zwischen der Wirkung von Arzneimitteln einerseits und der Verteilung von Wirkstoffen aus der Arzneiform im Organismus anderseits in den Mittelpunkt des Interesses. Diese Thematik ist Gegenstand der Biopharmazie, die damit eine zentrale Bedeutung im Prozess der Arzneimittelentwicklung vom molekularen Design bis hin zur klinischen Anwendung erlangt.
Den Autoren des vorliegenden Buches liegt es am Herzen, dem/der Studierenden wie auch dem Fachmann/der Fachfrau im Beruf, sei es in der öffentlichen Apotheke, in der Klinikapotheke, der Industrie oder einer Behörde, einen Überblick über diese expandierende pharmazeutische Disziplin zu vermitteln und ihnen ihren multidisziplinären Charakter anhand ausgewählter Schwerpunkte anschaulich darzulegen: Neben physiologischen Themen, wie dem Aufbau von Zellmembranen und der Diskussion von zellulären Transportmechanismen nimmt die Besprechung pharmakokinetischer Phänomene breiten Raum ein. Die Autoren führen in die mathematischen Grundlagen der Pharmakokinetik und der statistischen Versuchsplanung ein und zeigen anhand von Beispielen die Anwendung dieser Grundlagen in der Praxis auf. Die Möglichkeiten moderner Arzneiformen werden ebenso diskutiert wie in-vitro-/in-vivo-Korrelationen oder der Einsatz elektronischer Datenverarbeitung bei der Berechnung pharmakokinetischer Parameter.
Die vorliegende Einführung in die Biopharmazie soll dem Bedürfnis des/der Studierenden Rechnung tragen, sich über dieses wichtige Fachgebiet schnell zu informieren. Deshalb wurde bewusst auf komplizierte pharmakokinetische Modelle und ihre mathematische Herleitung verzichtet. Vorausgesetzt werden muss beim Leser allerdings die Bereitschaft zum Nach-Denken. Dieser für jedes naturwissenschaftliche Verständnis notwendige Prozess soll dadurch erleichtert werden, dass die dargestellten Grundlagen mit weiterführenden Literaturzitaten und jedes Kapitel mit Übungsfragen versehen wurden, anhand derer der/die Studierende seine erworbenen Kenntnisse selbst überprüfen kann.
Die Fertigstellung eines Buches ist ohne vielseitige Hilfe nicht möglich. Der Dank der Herausgeber gilt den Mitarbeitern ihrer Arbeitskreise und den Co-Autoren einzelner Kapitel, deren Hilfe wesentlich zur Fertigstellung des Buches beigetragen hat. Besonders erwähnt werden sollen Dr. Stefanie D. Krämer (ETH Zürich), Dr. Susan Kober und Isabell Schöttle (Univ. Mainz). Darüberhinaus gebührt besonderer Dank den Mitarbeitern des Verlags Wiley-VCH, allen voran Dr. Andreas Sendtko, für zahlreiche sachdienliche Verbesserungsvorschläge, die sorgfältige redaktionelle Arbeit und die sehr angenehme Zusammenarbeit. Die Autoren waren bei der Planung des Buches zuversichtlich, es könne alle Gebiete der Biopharmazie umfassen und gleichzeitig auf dem neuesten Stand der Forschung sein. Während der redaktionellen Konzeption mussten sie jedoch erkennen, wie schwer dieses Ziel bei der schnell fortschreitenden Entwicklung des Fachgebiets zu erreichen ist. Sie sind sich bewusst, dass der eine oder andere Wunsch offen bleiben wird, und sind deshalb für kritische Hinweise und Anmerkungen dankbar.
Mainz, Heidelberg, Zürich, im Januar 2004
Die Autoren
Geleitwort
Professor Dr. F. H. Dost wurde von der Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik (APV) aufgrund seiner großen wissenschaftlichen Verdienste auf dem vom ihm initiierten Gebiet der Pharmakokinetik zum Korrespondierenden Mitglied ernannt. Nach seinem Tod veranstaltete ihm zu Ehren die APV im Februar 1987 in Würzburg ein internationales Symposium, bei dem seine Schüler nochmals das Werk ihres Lehrers Revue passieren ließen. Am Ende des Symposiums überreichte mir als dem damaligen APV-Präsidenten seine Witwe, Frau Felicitas Dost zum Dank eines der wenigen noch verfügbaren Exemplare des von Dost 1953 herausgegebenen Buches „Der Blutspiegel“, das ich wie einen Augapfel hüte.
50 Jahre nach dem Erscheinen dieses Standardwerkes der Pharmakokinetik liegt mir nun die erste Ausgabe der „Biopharmazie“ vor, das von dem jungen Autorenkollektiv P. Langguth, G. Fricker und H. Wunderli-Allenspach herausgegeben wird. Auch in diesem neuen Lehrbuch nimmt die Dos’sche Pharmakokinetik immer noch eine wesentliche und zentrale Stellung ein, aber in den letzten 50 Jahren hat sich das Gebiet der Biopharmazie so rasch und stürmisch entwickelt, dass es heute eines der zentralen multidisziplinären Fächer für den Apotheker in der Praxis und für den Wissenschaftler in Forschung und Lehre und in der forschenden Industrie darstellt und einen fundamentalen Beitrag zum Verständnis der Wirkung von Arzneistoffen und Arzneimitteln liefert.
Das Buch ist hervorragend und gut verständlich geschrieben. Es berücksichtigt die physiologischen Grundlagen des menschlichen Körpers ebenso wie die klassischen experimentellen pharmakokinetischen Modelle sowie die neuesten Erkenntnisse bei biologischen Membranen mit ihren Transportsystemen. Auch dem Verlag gebührt großer Dank für das übersichtliche Layout des Buches, das ebenso zum Verständnis des Inhalts beiträgt wie die flüssig und verständlich geschriebenen Beiträge der Autoren mit den vielen illustrativen Abbildungen.
Es ist diesem hervorragendem Buch zu wünschen, dass es innerhalb kurzer Zeit eine weite Verbreitung innerhalb der pharmazeutischen Wissenschaften an der Hochschule und in der pharmazeutischen Industrie erfährt und dass es, wie „Der Blutspiegel“ für die Pharmakokinetik, für lange Zeit das Standardwerk für die Biopharmazie bleibt.
Marburg, im März 2004
Hans E. Junginger
I
Grundlagen der Biopharmazie
1
Einführung
Die Entwicklung moderner Medikamente setzt neben dem grundlegenden Verständnis der Chemie von Wirkstoffen, ihrer pharmakologischen Eigenschaften und der Herstellungsverfahren von Arzneiformen auch fundierte Kenntnisse über die Biopharmazie der angewandten Arzneimittel voraus. Diese bildet somit einen der Grundpfeiler jeder medikamentösen Therapie.
Das vorliegende Buch soll dem Studierenden und interessierten Leser eine Einführung und einen Überblick über die wichtigsten Teilgebiete der Biopharmazie geben und ihm helfen, dieses Fach im Kontext der anderen pharmazeutischen Disziplinen zu verstehen.
Die Biopharmazie beschäftigt sich mit der Beeinflussung der Wirksamkeit eines Arzneistoffs durch die Arzneiform. Dazu werden die Abhängigkeiten zwischen der Wirkung von Arzneimitteln im Organismus (Pharmakodynamik) einerseits und andererseits die Einflüsse des Organismus auf den Arzneistoff (Pharmakokinetik) betrachtet (Abb. 1.1). Wird der Weg eines Arzneistoffes zu seinem Wirkort aufgezeichnet, erscheint die Biopharmazie eingebettet zwischen Pharmazeutischer Technologie und Pharmakologie, wobei sie mit beiden Fachgebieten beträchtliche Überschneidungen aufweist. Sie pflegt einen multidisziplinären Ansatz: Zu ihren Grundlagen zählen Anatomie, Physiologie, Biochemie, Mathematik, Statistik, Informatik, physikalische Chemie und Bioanalytik, um die Wichtigsten zu nennen. Nur mit dem Wissen um physikochemische Stoffeigenschaften, Aufbau von Zellmembranen, biologische Barrieren oder mechanistische Aspekte biologischer Transportprozesse lassen sich die komplexen Zusammenhänge der Biopharmazie verstehen. Grundlagen dazu werden in diesem Buch vermittelt.
Abb. 1.1 Wechselwirkungen zwischen Arzneistoff und Organismus.
Eines der zentralen Elemente der Biopharmazie ist die Pharmakokinetik, d. h. die Lehre von den Konzentrationsveränderungen von Wirkstoffen im Organismus in Abhängigkeit von der Zeit, wobei normalerweise das Blut als das wichtigste Messkompartiment angesehen wird. Die Stärke der Pharmakokinetik, deren Grundprinzipien 1953 von Dost formuliert wurden, liegt im quantitativen Ansatz. Doch erst durch die Entwicklung empfindlicher Analysemethoden für Arzneistoffe und deren Metabolite innerhalb der letzten 50 Jahre gelangte dieses Fachgebiet zur heutigen Bedeutung. Während sich die Pharmakodynamik mit der Wirkung eines Arzneistoffes auf ein Zielmolekül, eine Zielzelle oder ein Zielorgan befasst, subsummiert die Pharmakokinetik die biologischen Einflüsse des Organismus auf den Wirkstoff (Abb. 1.2). Die sich überlagernden Teilprozesse Aufnahme (Absorption), Verteilung (Distribution), Biotransformation (Metabolismus) und Ausscheidung von unverändertem Arzneistoff (Exkretion) werden unter dem Begriff ADME zusammengefasst. Darüber hinaus spielt die Liberation von Arzneistoffen aus der Arzneiform in der Biopharmazie eine wichtige Rolle, womit der ursprüngliche Begriff zu LADME erweitert wird. Entsprechend den physikalisch-chemischen Eigenschaften lassen sich mit einer Kombination von in-vitro- und in-vivo-Experimenten für jeden Wirkstoff pharmakokinetische Stoffeigenschaften bestimmen. Daneben werden häufig Ergebnisse aus in-vitro-Versuchen zur Vorhersage des in-vivo-Verhaltens von Arzneistoffen und -formen eingesetzt (in-vitro-/in-vivo-Korrelation). Die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat diese Erkenntnisse unlängst in ihren Richtlinien für die pharmazeutische Industrie zur Anwendung des „Biopharmazeutischen Klassifizierungssystems“ (BCS) für die Einsparung von Bioäquivalenzstudien umgesetzt.
Abb. 1.2 Grundlagen und Anwendungen der Pharmakokinetik.
Die Anwendungen der Biopharmazie, speziell der Pharmakokinetik, sind vielfältig: (1) in der Pharmazeutischen Technologie bei der Entwicklung und in-vitro- sowie in-vivo-Prüfung von Arzneizubereitungen, (2) für die Überprüfung der Bioverfügbarkeit und für Bioäquivalenzstudien sowie für die EDV-gestützte Planung und Auswertung von klinischen Studien, (3) für die Erstellung und Optimierung von Dosierungsschemata, (4) in der Pharmakologie und Toxikologie bei der Aufstellung von Beziehungen zwischen Arzneistoffkonzentrationen und pharmakologischen Effekten, (5) für die Abschätzung der Wirksamkeit von Prodrugs und innovativen Arzneiformen (6) in der Pharmakogenetik, sowie (7) für die Erfassung von Arzneimittel-Wechselwirkungen (pharmakokinetisch bedingte Interaktionen) (Abb. 1.3).
Viele der genannten Aspekte sind in diesem Buch, in dem sowohl Grundlagen wie auch Anwendungen der Biopharmazie vorgestellt werden, berücksichtigt. Das Spektrum der Darstellungen reicht von leicht nachvollziehbaren, deskriptiven Beschreibungen bis hin zu komplexen Zusammenhängen, beispielsweise im Bereich der statistischen Versuchsplanung und -auswertung, die in der modernen Arzneimittelentwicklung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Dem interessierten Studierenden werden darüber hinaus zu jedem Teilgebiet der Biopharmazie Übungsaufgaben angeboten.
Abb. 1.3 Biopharmazie im Kontext.
b2
Physiologische Grundlagen – Biologische Membranen und Barrieren
2.1 Biologische Membranen
Auf dem Weg vom Resorptionsort zum Ort ihrer Wirkung müssen die meisten Wirkstoffe eine oder mehrere Membranen durchqueren, z. B. Plasmamembranen der Enterozyten bei der Resorption aus dem Magen-Darm-Trakt, die Membranen der Gefäßendothelzellen beim Übertritt ins Gehirn oder die Sinusoidalmembran bei der Aufnahme in der Leber aus dem Pfortaderblut. Wenngleich Membranen von unterschiedlicher Dicke und Struktur sind, und innerhalb verschiedener Membranen völlig unterschiedliche Prozesse ablaufen, so gibt es doch wesentliche Strukturmerkmale, die allen biologischen Membranen gemeinsam sind. Diese Strukturmerkmale werden in den folgenden Abschnitten behandelt. Aufbau und Funktion von Membranbarrieren, die bei der Resorption, Verteilung oder Elimination eine Rolle spielen können, sowie Besonderheiten des Wirkstofftransports durch bestimmte Organe werden diskutiert. Weiterhin werden in vitro-Modelle zur Untersuchung von Membrantransportprozessen vorgestellt.
2.1.1 Lipiddoppelschicht
Die Entwicklung der Plasmamembran stellt einen der entscheidenden, lebensnotwendigen evolutionären Entwicklungsschritte dar. Sie definiert die Zelle und bildet die Barriere zwischen Zellinnerem und Außenmilieu. Allen Membranen gemeinsam ist die 4–5 nm dicke Phospholipiddoppelschicht (Lipidbilayer; ca. 5 × 106 Lipidmoleküle/μm2 Membran), in die Proteine, Cholesterin und Glycolipide mit unterschiedlichen Funktionen eingelagert sind, wobei die beiden Hälften der Lipiddoppelschicht meist asymmetrisch aufgebaut sind (Abb. 2.1).
Abb. 2.1 Vereinfachte dreidimensionale Darstellung eines Ausschnitts aus einer Zellmembran, die aus einer Lipiddoppelschicht besteht, in die Membranproteine eingelagert sind.
Die Phospholipide bestehen in der Regel aus einer polaren Kopfgruppe und zwei hydrophoben Kohlenwasserstoffketten mit einer Länge zwischen 14 bis 24 C-Atomen, wobei eine der Ketten meist eine oder mehrere Doppelbindungen enthält (Abb. 2.2).
Abb. 2.2 Struktur von Phosphatidylcholin als Beispiel für ein Phospholipid; (a) Strukturformel, (b) raumfüllendes Modell. Die Fettsäure am 2 C-Atom des Glycerinkerns enthält eine starre cis-Doppelbindung, während die Einfachbindungen der Kohlenwasserstoffkette relativ frei rotieren können. In der Membran kommt es zu einer laminaren Anordnung der Ketten. Cholin am polaren Kopf des Phospholipids ist schraffiert gekennzeichnet.
Die Lipiddoppelschicht ist kein statisches Gebilde, sondern besitzt eine fluide, dynamische Struktur. Mit Hilfe spektroskopischer Verfahren, z. B. der Spinresonanzspektroskopie, lässt sich zeigen, dass individuelle Phospholipidmoleküle innerhalb einer Monolayerseite etwa 106–107-mal pro Sekunde die Position mit ihrem Nachbarmolekül tauschen. Ein Platztausch mit einem Molekül in der gegenüberliegenden Hälfte der Lipiddoppelschicht (sogenannter flip-flop-Mechanismus) ist dagegen ausgesprochen selten und tritt nur ungefähr alle 1–2 Wochen einmal auf. Wesentlichen Einfluss auf die Membranfluidität hat Cholesterin, das in eukaryotischen Zellen in etwa gleicher Menge wie Phospholipide enthalten ist. Cholesterinmoleküle sind so in die Lipiddoppelschicht eingelagert, dass ihre Hydroxylgruppe zur polaren Kopfgruppe der Phospholipide hin orientiert ist, während das planare Steroidringsystem den Teil der Kohlenwasserstoffketten unterhalb der Kopfgruppen immobilisiert. Glycolipide, also Lipide, die ein Oligosaccharid in der polaren Kopfgruppe enthalten, befinden sich ausschließlich in der äußeren Hälfte der Lipiddoppelschicht. Zu ihnen zählen die Ganglioside, die einen oder mehrere Sialinsäure-Reste (N-Acetyl-neuraminsäure) in der Kopfgruppe enthalten.
2.1.2 Membranproteine
Fast alle Plasmamembranen enthalten außer Phospholipiden auch Proteine, wobei die in die Lipidmembran eingelagerte Proteinmenge je nach Zelltyp zwischen 25 und 75% variiert. Diese Proteine üben wesentliche Funktionen den Membranen aus. Sie sind für das Empfangen und die Abgabe von chemischen Signalen oder für den Stofftransport verantwortlich, sie sind an der Ausbildung von Zell – Zell-Verbindungen beteiligt, oder sie bilden die katalytische Oberfläche für enzymatische Reaktionen. Dabei können sie entweder nur in eine der beiden Lipidschichten eingelagert sein (sogenannte periphere Membranproteine) oder die ganze Membran mit ihren hydrophoben Domänen einfach oder mehrfach durchqueren (sogenannte integrale Membranproteine). Mit ihren hydrophileren Kopfgruppen ragen sie in die wässrige Umgebung auf der Außenseite und/oder Innenseite der Membran. Diese integralen Proteine werden auch als Transmembranproteine bezeichnet.
2.1.3 Membrankohlenhydrate
Kohlenhydrate sind in Plasmamembranen als Oligosaccharidketten entweder an Proteine (Glycoproteine) oder – in geringerem Ausmaß – an Lipide (Glycolipide) gebunden. Der Kohlenhydratanteil in einer Membran beträgt ca. 2–10 Gewichtsprozent, wobei Glycoproteine mehrere Oligosaccharidketten besitzen können, Glycolipide aber nur einen Rest tragen. Zellmembranen tragen Oligosaccharidketten ausschließlich auf der Zellaußenseite, während die Oligosaccharidreste von membranumgrenzten intrazellulären Organellen ausschließlich zur Innenseite dieser Kompartimente hin orientiert sind. Die Oligosaccharide der äußeren Zellmembran sind Bestandteil der sogenannten Glycokalix, wobei diese außerdem Glycoproteine und Proteoglycane enthält, die nur adsorbiert, aber nicht kovalent an Membranbestandteile gebunden sind.
2.2 Membrantransport
2.2.1 Mechanismen des Transports
Die Lipiddoppelschicht der Zellmembran kann nur von ungeladenen Molekülen durch Diffusion durchquert werden und stellt für die meisten polaren Moleküle eine undurchdringbare Barriere dar. Deshalb wurden im Lauf der Evolution spezielle Transportwege entwickelt, um polare Moleküle wie Nährstoffe oder Stoffwechselprodukte durch Membranen zu schleusen und die intrazelluläre Ionenhomöostase (Tab. 2.1) zu gewährleisten.
Der Transport kleiner Moleküle erfolgt dabei über Transmembranproteine, während Makromoleküle oder Partikel über zytotische Mechanismen in Zellen aufgenommen oder durch diese hindurchgeschleust werden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























