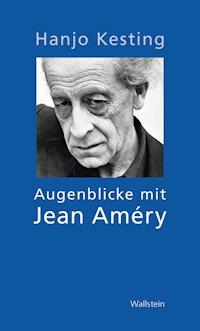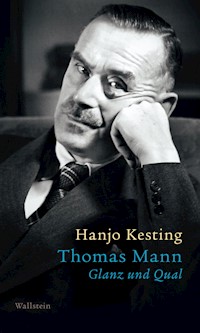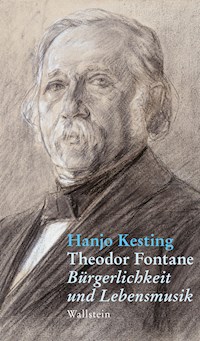Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Streifzug durch die Operngeschichte und das Wechselspiel zwischen Text und Musik – so unterhaltsam wie anregend. Nur selten in der Operngeschichte gab es glückliche Partnerschaften zwischen den Komponisten und ihren Textdichtern. So tauchen auf Verdis 27 Opernpartituren die Namen von vierzehn Librettisten auf. Der Wettstreit um den Vorrang von Ton oder Wort durchzieht die gesamte Geschichte der Oper. Im 18. Jahrhundert übte Pietro Metastasio seine uneingeschränkte Herrschaft aus – Kesting nennt ihn »den einflussreichsten Operndichter der Geschichte". Seine Textbücher wurden an die tausendmal vertont, auch noch von Mozart, der eigentlich die Auffassung vertrat, in der Oper habe die Poesie »der Musick gehorsame Tochter" zu sein, und in Lorenzo Da Ponte seinen einzigartigen Librettisten fand. Das 19. Jahrhundert brachte Textdichter wie Eugène Scribe, Felice Romani und Arrigo Boito hervor, nicht zuletzt den Sonderfall Richard Wagner, der sein eigener Textdichter war. Im 20. Jahrhundert stellten sich Autoren von Rang wie Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Jean Cocteau und W. H. Auden in den Dienst der Komponisten. Bertolt Brecht, auch er ein fleißiger Textlieferant für das Musiktheater, ließ in der »Dreigroschenoper" zum Schluss den reitenden Boten des Königs erscheinen: »Damit ihr wenigstens in der Oper seht, wie einmal Gnade vor Recht ergeht."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanjo Kesting
Bis der reitende Botedes Königs erscheint
Über Oper und Literatur
Für Jürgen, den frühesten Gefährten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2017
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf
ISBN (Print) 978-3-8353-3126-6
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4171-5
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4172-2
Inhalt
Wort und TonZu einem Thema der Operngeschichte
I18. Jahrhundert
Der Fürst der LibrettistenPietro Metastasio
Der wahre Phönix MozartsLorenzo Da Ponte
Die Kunst, durch Kontraste zu wirken»Die Zauberflöte«
II19. Jahrhundert
Höllenvision aus Biedermeierminiaturen»Der Freischütz«
Der vergessene MeisterFelice Romani
Die Dioskuren der Großen OperGiacomo Meyerbeer und Eugène Scribe
Verdis unentbehrlicher GeselleFrancesco Maria Piave
Verdis später GlücksfallVerdi und Arrigo Boito
»Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan«Goethes »Faust« auf der Opernbühne
Im musikalischen Dufte meiner Schöpfung berauschtWie gut sind Wagners Operntexte?
Die Liebe ist ein rebellischer VogelProsper Mérimée und Georges Bizet
IIIOperette oder Die kleine Oper
Der Mozart der Champs-ÉlyséesJacques Offenbach
Der Genius der leichten MuseJohann Strauß
Der Abgesang der OperetteRalph Benatzky und das »Weiße Rössl«
IV20. Jahrhundert
Der Dichter als LibrettistHugo von Hofmannsthal
»Die schweigsame Frau«Zur Uraufführung der Oper von Richard Strauss
»Welch sonderbarer Trödelkram steht hier heute zum Verkauf!«Igor Strawinsky und die Oper
Bis der reitende Bote des Königs erscheintBertolt Brecht und das Musiktheater
Die Wahrheit des SingensWystan Hugh Auden, der letzte Operndichter
Anhang
Nachweise
Personenregister
Werkregister (Opern, Operetten, Musiktheater, Ballette)
Wort und TonZu einem Thema der Operngeschichte
Ich suchte die Musik zu ihrer wahren Bestimmung zurückzuführen, die darinnen besteht, die Poesie zu unterstützen, ohne die Handlung zu unterbrechen oder sie durch unnützen und überflüssigen Schmuck zu erkälten.
C. W. Gluck
… bey einer opera muß schlechterdings die Poesie der Musick gehorsame Tochter seyn. – warum gefallen denn die Welschen kommischen Opern überall? – mit allem dem Elend was das buch anbelangt! – weil da ganz die Musick herrscht – und man darüber alles vergisst.
W. A. Mozart
Der Irrtum in dem Kunstgenre der Oper bestand darin, daß ein Mittel des Ausdruckes (die Musik) zum Zwecke, der Zweck des Ausdruckes (das Drama) aber zum Mittel gemacht war …
Richard Wagner, Oper und Drama
Der große Primatkampf zwischen Wort, Musik und Darstellung … kann einfach beigelegt werden durch die radikale Trennung der Elemente.
Bertolt Brecht
Wenige Zitate reichen aus, um das Grundthema dieses Buches zu umreißen. Im Kern geht es um das Verhältnis von Text und Musik, von Wort und Ton in der Oper oder, um Richard Wagners Begriffe zu verwenden, um das Verhältnis von Oper und Drama. Jahrhundertelang wurde über diese Frage mit Leidenschaft gestritten, der Streit ist so alt wie die Oper selbst. Ihre Geschichte dauert bereits länger als vierhundert Jahre, aber es gelang nur in seltenen Fällen, dass Textautor und Komponist einvernehmlich zueinanderfanden, dass der Librettist wusste, was der Musiker wollte, und der Musiker glücklich war mit dem, was der Textdichter ihm geliefert hatte. Mozart, wiewohl er zwanzig Bühnenwerke schrieb, suchte manchmal lange, ehe er den passenden Text fand. Am 7. Mai 1783 schrieb er an Vater Leopold: »Nun hat die italienische opera Buffa al[l]hier wi[e]der angefangen; und gefällt sehr … ich habe leicht 100 – Ja wohl mehr bücheln durchgesehen – allein – ich habe fast kein einziges gefunden mit welchem ich zufrieden sein könnte; – wenigstens müsste da und dort vieles verändert werden. – und wenn sich schon ein Dichter mit diesem abgeben will, so wird er viel[l]eicht leichter ein ganz Neues machen. – und Neu – ist es halt doch immer besser.« Beethoven hatte nur einmal Glück bei der Suche nach einem Textdichter, Weber meist Pech, denn wenn seine nach dem Freischütz geschriebenen Werke Oberon und Euryanthe trotz zum Teil großartiger Musik nicht reüssierten, dann lag es an den unglücklichen Textbüchern. Man kann nachlesen, wie Verdi und Puccini ihre Librettisten traktierten, aber auch Mendelssohn und Brahms bemühten sich vergeblich um eines der begehrten »Büchlein«, wie die Übersetzung von Libretto lautet, wörtlich: »kleines Buch«. Der Name enthält wenn nicht eine leichte Geringschätzung, so doch eine Klassifizierung: Ein Textbuch war eben kein Buch, kein vollwertiges Werk, das aus sich heraus bestand, sondern ein Hilfsmittel, eine Larve, aus der erst die Musik den bunten Schmetterling hervorlockt. Ein Libretto von Giovanni Battista Casti aus dem Jahr 1786, das für Antonio Salieri, den Mozart-Rivalen, bestimmt war, hieß denn auch: Prima la musica e poi le parole.
Zuerst die Musik, dann die Worte – der Autor als Diener des Komponisten. Das war nicht immer so gewesen, und später wurde es keineswegs die unbedingte Regel. Dass jedoch der Streit um den Vorrang von Wort oder Ton zum Gegenstand einer Oper werden konnte, zeigt, wie heftig die Frage zeitweise umstritten war. Salieris einaktiges Operndivertimento schlug bei seiner Wiener Premiere einen anderen Einakter aus dem Felde, der am selben Abend gegeben wurde, Mozarts Schauspieldirektor. Den Text des Abbé Casti entdeckte Stefan Zweig, als er unter den Libretto-Schätzen des Britischen Museums in London einen neuen Stoff für Richard Strauss suchte, mit dem er soeben – 1935 – Die schweigsame Frau herausgebracht hatte. Strauss war sofort fasziniert. Zweig, inzwischen in England lebend, kam freilich als Librettist nicht mehr in Frage. Die Nationalsozialisten hatten ihrem Renommierkomponisten einen jüdischen Mitarbeiter einmal durchgehen lassen, ein zweites Mal schien ausgeschlossen. Strauss, der durch seine mit Zweig gewechselten Briefe sein Amt als Präsident der »Reichsmusikkammer« verloren hatte, versuchte daraufhin, den politisch genehmen, poetisch aber dürftigen Theaterhistoriker Joseph Gregor als Textautor zu gewinnen, der indes kaum geeignet war, seine Wünsche zu erfüllen. Im September 1939 – der Zweite Weltkrieg hatte begonnen und die deutschen Truppen eroberten gerade Warschau – schickte er dem Dirigenten und Münchner Opernintendanten Clemens Krauss einen Brief, in dem er von seiner langen Laufbahn als Opernkomponist fast schon Abschied zu nehmen schien: »ich mag eigentlich keine ›Oper‹ mehr schreiben, sondern möchte mit dem de Casti so etwas ganz Ausgefallenes, eine dramaturgische Abhandlung …, eine theatralische Fuge (auch der gute alte Verdi hat’s am Schluß des ›Falstaff‹ nicht lassen können) – denken Sie an Beethovens Quartettfuge – das sind so die Greisenunterhaltungen! – schreiben! Ob Gregor so was leisten kann – ich kann’s noch nicht sagen. Bis heute hat er’s noch nicht verstanden, was ich eigentlich will: keine Lyrik, keine Poesie, keine Gefühlsduselei –: Verstandestheater, Kopfgrütze, trockenen Witz!«
In der Tat erwies sich Joseph Gregor außerstande, das alte Textbuch Castis in ein brauchbares Libretto zu verwandeln. Strauss, der zeitweise sein Interesse schon verloren zu haben schien, kam bei Kriegsbeginn auf Castis Textbuch zurück, weil er den krassen Kontrast zur politischen Wirklichkeit, der in dem geschmäcklerischen Erörtern einer opernästhetischen Frage lag, offenbar nicht scheute, vielleicht sogar wünschte. Durch Clemens Krauss und den Komponisten stark verändert, erlebte Prima la musica e poi le parole unter dem Titel Capriccio. Ein Konversationsstück für Musik Ende Oktober 1942, während gerade die Schlacht um Stalingrad tobte, seine gespenstisch-unfröhliche Uraufführung in München. »Noch einen Schritt, und wir stehen vor dem Abgrund«, singt der Graf in diesem Stück. Damit war nicht das große Völkermorden gemeint, sondern die Kluft zwischen Wort und Ton in der Oper.
Ob der Text gut oder schlecht sei, findet der Graf, sei bedeutungslos, es verstehe ihn ohnehin niemand. Gewisse Wagner-Hörer, die keine Wagner-Kenner sind, werden ihm beipflichten. Auch die Worte des Theaterdirektors, alle Schuld treffe den betäubenden Lärm des Orchesters, die Sänger seien gezwungen zu schreien, finden sicher viel Sympathie, nicht zuletzt unter den Besuchern mancher Opern von Richard Strauss. Dass fremdsprachige Operntexte ihren Sinn dem ungeübten Hörer ohnehin nur in groben Umrissen preisgeben, versteht sich von selbst. Strauss und Krauss verlegten die Handlung ihres Stücks ins 18. Jahrhundert, in die Zeit der Gluck’schen Opernreform. Der Hinweis auf die Unverständlichkeit des Textes stellt insofern einen Anachronismus dar, als es damals und noch lange danach üblich war, das »Büchlein« mit in die Oper zu nehmen und bei Kerzenschein zu verfolgen, was in den Rezitativen vor sich ging und welchen traurigen oder heiteren Affekt eine Arie ausdrückte, der man dann ohne die Mühe des Nachlesens lauschen konnte. Diese Praxis verlor sich im Lauf des folgenden Jahrhunderts, und so blieb es bis weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Tage von Donizetti und Meyerbeer, in denen die satirische Zeitschrift Punch im Gefolge einer Finanzdebatte den Wert einer Pfundnote wie folgt beschreiben konnte, lagen in der Zeit von Richard Strauss schon lange zurück.
A pound, dear father, is the sum
That clears the opera wicket:
Two lemon gloves, one lemon ice,
Libretto and your ticket.
Außer Vaters Opernkarten und einem Pfund für Ausgaben wie neue Handschuhe und Pausen-Erfrischungen war demnach der Kauf eines Textbuches unerlässlich. Es war die Zeit, in der große Librettisten wie Felice Romani und Eugène Scribe aufs sorgfältigste an ihren Textbüchern tüftelten. Ob man sich den Musikbühnenbetrieb früherer Epochen mit Primadonnentyrannei, unterbezahlten Musikern und überladenen Dekorationen, ganz zu schweigen von den Kastraten des 18. Jahrhunderts, zurückwünschen soll, ist eine Frage, die man getrost verneinen kann, auch wenn man heute mit der Tyrannei der Regisseure nicht glücklicher ist. Aber das Interesse an dem, was auf der Bühne vor sich ging, war zu Glucks und Mozarts Zeit wie in der von Meyerbeer und Donizetti keineswegs geringer, eher höher als heute.
Dabei ist zumindest dem Hörer von Opernplatten und -CDs der Blick ins Booklet mit beigefügtem Libretto heute wieder geläufig geworden, und selbst die Opernhäuser zieren sich nicht mehr, den Text der Oper synchron auf Schrifttafeln mitlaufen zu lassen, nicht nur bei fremdsprachigen Texten, sondern, wenn sie es gut mit dem Publikum meinen, auch bei Wagner und Strauss. Das hat das Interesse für die Texte der Oper gefördert, nicht unbedingt für die Autoren dieser Texte. Man mache eine simple Probe. Es fällt sicher nicht schwer, sich auf ein Dutzend der bedeutendsten Opern zu einigen. Nehmen wir zum Beispiel Monteverdis Orfeo, Mozarts Don Giovanni, Beethovens Fidelio und Webers Freischütz, von Wagner Tristan und Isolde, von Verdi La Traviata, Carmen von Bizet, Hoffmanns Erzählungen von Offenbach, Puccinis La Bohème und Strauss’ Rosenkavalier, Debussys Pelléas und Mélisande und Alban Bergs Wozzeck. Gegen diese Auswahl wird kaum jemand etwas einwenden, obwohl manche persönliche Vorliebe anders ausfallen mag. Nun erheben sich Fragen: Sind das zugleich zwölf der besten Textbücher? Oder – viel einfacher – wer kennt die Verfasser dieser zwölf Libretti? In den Fällen Rosenkavalier und Don Giovanni weiß der interessierte Opernbesucher, dass Hugo von Hofmannsthal und Lorenzo Da Ponte die Texte schrieben. Wagner, das ist ebenfalls geläufig, schrieb außer den Noten auch selber die Worte, die er später vertonte. Zu Wozzeck kennt man die Vorlage, das Stück von Georg Büchner, während Maurice Maeterlinck als Autor des Schauspiels Pelléas und Mélisande kaum noch geläufig sein dürfte. Aber wurden diese Stücke im Originaltext vertont oder in einer Bearbeitung? Und wer legte hier Hand an? Wer schrieb den Text zu Fidelio, wer das Libretto zu La Bohème? Nicht schwer zu erraten, dass Hoffmanns Erzählungen auf einigen Erzählungen des deutschen Romantikers beruht, aber wer machte daraus ein Operntextbuch? Über La Traviata ist allgemein bekannt, dass die Oper auf den Roman Die Kameliendame von Alexandre Dumas zurückgeht, aber wie wurde aus dem Roman ein Libretto? Fragen über Fragen – nur der Kenner der Materie kann Auskunft geben. Der normale Opernbesucher würde im Zeitalter der Fake News zweifellos folgende Aussage akzeptieren: »Da Weber keinen geeigneten Operntext fand, schrieb er das Libretto zum Freischütz kurzerhand selbst und wurde dadurch das Vorbild für Wagner.«
Wenig Gewissheit herrscht auch bei der Frage, ob nach Wagner, der sein eigener Textdichter war, die meisten Komponisten doch wieder Librettisten beschäftigt haben. Tatsächlich ließen sich Richard Strauss, Puccini, Ravel, Strawinsky oder Henze Textbücher schreiben, andere waren Selbstversorger: Tschaikowsky, Schreker, Pfitzner, Busoni, Hindemith, Alban Berg, Schönberg, Prokofjew, Orff oder Krenek. Wieder andere schwankten zwischen fremden Texten und eigenen Versuchen, Janáček und Schostakowitsch zum Beispiel.
Um einige grundsätzliche Fragen aufzuwerfen: Libretti sind in der Regel mehr als die Summe der von den Sängern gesungenen Worte. Sie als bloßen Text zu bezeichnen raubt ihnen die entscheidende Dimension des Bühnenspiels, des Dramas. Wie baut der Verfasser sein Stück auf? Wie geht er mit der Geschichte, die dem Stück zugrunde liegt, zum Beispiel mit einer geschichtlichen Begebenheit, um? Kommt es ihm auf Plausibilität des Ablaufs oder nur auf schöne Arien an? Wie sehen die Charaktere aus, sind es Menschen oder Marionetten? Und wie verhält sich der Text zur zeitgenössischen Wirklichkeit? Operntexte entstehen ja in bestimmten geschichtlichen Situationen und Wirklichkeiten, die sich immer weiter von uns entfernen, aber heute auf die Bühne gebracht werden müssen. Kann man das in späteren Aufführungen ignorieren, indem man die Stücke aktualisiert oder gar verändernd in sie eingreift?
Man nehme zum Beispiel Mozarts Le Nozze di Figaro. Raum und Zeit sind hier im Text Da Pontes genau aufzufinden, in der Theatervorlage von Beaumarchais noch deutlicher. Sevilla, mehrfach erwähnt, liegt nicht irgendwo in der Nähe, sondern laut Beaumarchais »à trois lieus«, also drei Meilen, entfernt. Das Schloss ist nicht irgendein beliebiges, sondern hat einen Namen: »Aguas-Frescas«, ein Wohnsitz also, wo es frisches, reines Wasser gibt. Vermutlich wurde es so genannt, weil die meisten Leute in der Umgebung mit weitaus weniger köstlichem Nass vorlieb nehmen mussten. Der Graf tritt in den ersten beiden Akten nach dem Willen des Dramatikers im Jagdkostüm auf, zum Zeichen seines Standes: »La corruption du cœur ne doit rien ôter au bon ton de ses manières«, heißt es im Personenverzeichnis des Stücks – »die Verdorbenheit seines Herzens darf nicht den guten Ton seiner Manieren schmälern«. So kennzeichnet ihn der Dichter, so lassen ihn auch Da Ponte und Mozart auftreten, als Aristokraten unmittelbar vor der Französischen Revolution, die bei Erscheinen der Oper nur noch fünf Jahre entfernt war. Wie man den Grafen daher, seiner Korruptheit wegen, nicht als harmlosen Falstaff im andalusischen Adelsmilieu spielen darf, so lässt sich aus ihm auch kein brutaler Vertreter des Spätkapitalismus machen, der Diener und Frauen etwa so traktiert wie Brechts Puntila den Knecht Matti und seine Mägde. Man darf ihn nicht zum bloßen Schürzenjäger in einer Phantasiezeit in einem Schloss Irgendwo machen. Alles in Mozarts Oper hat seine genau definierte Zeit, seinen bestimmten Ort, nicht zuletzt einen historisch benennbaren sozialen Konflikt. Aber die Regisseure unserer Tage gehen nach Belieben damit um, sei es, dass sie wie Peter Zadek das Stück in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts, die Zeit der Brecht’schen Dreigroschenoper, verlegen, sei es, dass sie eine Affäre zwischen dem Grafen und Susanna konstruieren, unbekümmert darum, dass sie damit der Gesamtanlage des Stücks, der komplizierten Intrige und Gegenintrige, die Grundlage entziehen. Zwar gibt es heute viele Opernaufführungen, in denen auf die Wiederherstellung der jeweiligen Originalpartitur der größte Wert gelegt wird, gleichzeitig aber wird mit dem Originaltext nach ziemlichem Belieben umgesprungen. Ein Streben nach Werktreue, das neben dem Bemühen um eine historische Aufführungspraxis der Musik nur annähernd vergleichbare Anstrengungen im Umgang mit dem Text aufweist, ist jedenfalls nicht zu erkennen.
Daran tragen die Textdichter selber einen Teil der Schuld. Unter den Verfassern der »Büchlein« gab es oft ebenso viele Amateure, wie es Quacksalber gab unter den Ärzten jener Zeit. Wer sich niemals zugetraut hätte, Stücke auf die Sprechbühne zu bringen oder es schon vergeblich versucht hatte, hielt sich immer noch für fähig, das dramatische Gerüst einer Oper zu liefern. Da Opernaufführungen nicht selten Renommier-Ereignisse der Mächtigen waren, von diesen zum Eigenlob oder zur Selbstfeier angesetzt, nimmt es nicht wunder, wenn manchmal die Opernstoffe und Textbücher gleich mitverordnet wurden. Es kam sogar vor, dass die Mächtigen selbst zur Feder griffen. So verfasste Zarin Katharina II. für ihren Hofkomponisten das Textbuch zu Oleg tritt die Herrschaft an, einer Haupt- und Staatsaktion aus der russischen Geschichte. Papst Clemens IX. schrieb – noch als Kardinal Giulio Rospigliosi – das Libretto für Stefano Landis Oper Il Sant’Alessio. Und Friedrich II. von Preußen reihte sich unter die Textdichter ein, indem er für Carl Heinrich Grauns Oper Montezuma in französischer Sprache das Libretto entwarf, das Giampietro Tagliazucchi dann in italienischen Versen auszuführen hatte.
Kein Wunder, dass die bürgerlichen Nachfahren in der Rolle des Opernmäzens ebenfalls Hand anlegten, wenn es um die Texte ging. Sowohl Giulio Ricordi aus dem Mailänder Musikverlag, der das für beide Seiten ertragreiche Bündnis mit Verdi einging, als auch Ludwig Strecker, Geschäftsführer im Hause Schott & Söhne in Mainz, der die Partitur von Wagners Parsifal für die höchste bis dahin in Deutschland für ein Musikwerk gezahlte Summe erwarb, – beide sind mit eigenen Beiträgen in der Geschichte des Librettos verzeichnet. Ricordi wirkte als dichtender Geburtshelfer bei dem schweren Geschäft mit, das Textbuch zu Puccinis Manon Lescaut zu verfassen. Nicht weniger als fünf Namen von Textdichtern stehen heute auf der Partitur, darunter der Komponist selbst, ein durch viele Köche nicht verdorbener, wenn auch kaum perfekt angerichteter Brei.
Wenn also scheinbar jeder sich im Verseschmieden versuchen konnte, lag es nahe, dass die Komponisten irgendwann zu dem Ergebnis kamen, in Wirklichkeit könne es niemand, sie selbst ausgenommen. Im 20. Jahrhundert ist dies fast zur Regel geworden, von Busonis Doktor Faust bis zu Olivier Messiaens Saint François d’Assise, von Alban Berg, der sich die Textbücher zu Wozzeck und Lulu nach den Theaterstücken von Büchner und Wedekind selbst einrichtete, bis zu Arnold Schönbergs Moses und Aron. Diese Oper ist Fragment geblieben und endet mit dem Zusammenbruch des Moses, der das rettende Wort nicht findet: »Unvorstellbarer Gott! Unaussprechlicher, vieldeutiger Gedanke! Läßt du diese Auslegung zu? … So bin ich geschlagen! So war alles Wahnsinn, was ich gedacht habe, und kann und darf nicht gesagt werden!« Daran schließt sich Moses’ verzweifelter Ausruf: »O Wort, du Wort, das mir fehlt« – sinnreiche Anspielung auf den vom Textdichter verlassenen Komponisten und damit auf das Grundthema der Operngeschichte überhaupt.
Es war Jean Paul, der ausgerechnet in Wagners Geburtsjahr 1813 visionär den »Gesamtkünstler« voraussagte, als er schrieb: »Denn bisher warf immer der Sonnengott die Dichtergabe mit der Rechten und die Tongabe mit der Linken zwei so weit auseinander stehenden Menschen zu, daß wir noch bis diesen Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper zugleich dichtet und setzt.« Aber Wagner, für seine Operntexte ebenso gerühmt wie verspottet, war keineswegs der erste Dichterkomponist. Vor ihm verließ sich schon Albert Lortzing nur auf sich und seine Erfahrung als Sänger, Schauspieler und genauer Kenner der Bühne. Vor Lortzing hatte bereits Rousseau 1752 seinen Dorfwahrsager (Le devin du village) selbst geschrieben, ehe er ihn vertonte. Die geistige Tradition Frankreichs, kritisch geprägt, kannte schon immer die Diskussion um die dramatische Form auf der Musikbühne. In diesem Land, das nie als Eldorado der Musik gegolten hat, beklagten bereits im 17. Jahrhundert mehrere Autoren die Mängel der Oper und forderten, sie solle als »musikalisches Drama« den Dichter und Musiker, »in einer Person« vereinigt, zum Autor haben: »Die Musik sei Gehilfin der Poesie, anstatt diese wie eine Sklavin zu halten!«, schrieb etwa La Bruyère. Diderots Ansichten über das musikalische Drama brachten bereits das Gesamtkunstwerk in Sichtweite, mindestens theoretisch. Und Rousseau war ein weiterer illustrer Vorläufer Wagners, als er in seinem Dictionnaire de la musique 1753 schrieb: »Die Tragödien der Alten waren wahre Opern, die griechische Sprache war musikalische Deklamation. So wurden alle Gattungen, nicht nur die Tragödie, gesungen. Die Dichter sagten am Anfang: Ich singe. – Es gilt die Lösung dieses Problems: zu bestimmen, bis zu welcher Grenze man die Sprache singen und die Musik reden lassen kann. Von einer guten Lösung desselben hängt die ganze Theorie der dramatischen Musik ab.« Das könnte ganz ähnlich bei Wagner stehen, auch wenn Rousseaus Dorfwahrsager, rein musikalisch betrachtet, von Wagners Tristan noch weiter entfernt ist als in literarischer Hinsicht Klopstocks Gedicht über den Zürchersee von Melvilles Moby Dick. Die wahren Dichterkomponisten waren Kinder der Romantik und ihrer Tendenz, alle Künste zu verschmelzen und das Einzelne im Ganzen aufgehen zu lassen. Mit dem Auftreten Wagners geriet sogar in Frankreich die klassische Hochschätzung des Wortes gegenüber allen anderen Ausdrucksmitteln, an der selbst die Romantiker um Victor Hugo nicht hatten rütteln können, zum ersten Mal ins Wanken. Gérard de Nerval, der französische Faust-Übersetzer, der geistigen Anlage nach der »romantischste« aller Franzosen, hatte seine kühnen Visionen noch in sprachlich traditionelle Formen gebettet, und selbst Baudelaire hatte es nicht gewagt, die klassische Dichtungsform anzutasten. Bei Wagner aber sah sich der maßvolle Formkünstler der Fleurs du mal mit einem Mal einer neuen Formenwelt gegenüber und redete der künstlerischen Entgrenzung das Wort: »Wenn man dieser glühenden, despotischen Musik lauscht, scheint es einem bisweilen, als sähe man, in die Finsternisse gemalt, traumzerrissen, die schwindelerregenden Bilder wieder vor sich, die das Opium hervorruft … ich könnte mir leicht vorstellen, daß man in nicht zu ferner Zukunft sehen wird, wie nicht nur neue Schöpfer, sondern sogar Männer von längst beglaubigtem Ansehen gewisse Ideen, die Wagner in Umlauf gesetzt hat, sich auf diese oder jene Weise zunutze machen und glücklich durch die von ihm geschlagene Bresche ziehen werden. In welchem Geschichtsbuch hat man denn je gelesen, daß eine große Sache durch einen einzigen Streich zugrunde gegangen sei?« Wesentliche ästhetische Erkenntnisse, in Vergessenheit geratene oder von anderen Tendenzen verdeckte, waren durch Wagners Wirken wieder aktuell geworden.
Ein Spätromantiker wie Pfitzner, der zur Welt kam, als Wagner mit Macht seine Wirkung zu entfalten begann, sah sich völlig außerstande, einen Operntext von fremder Hand zu komponieren oder etwa gar unter Bedingungen eine Oper zu schreiben, wie sie hundert Jahre zuvor nicht wenige Komponisten unter dem Diktat der Theaterunternehmer akzeptieren mussten. In einem Vertrag des römischen Teatro Argentina hieß es, der Komponist verpflichte sich, »die zweite Buffo-Oper der Saison zu komponieren und in Szene zu setzen, und zwar dasjenige Libretto, welches ihm … übergeben wird, dieses Libretto sei neu oder alt. Der Komponist verpflichtet sich ferner, seine Partitur Mitte Januar, also in drei Wochen vorzulegen und dieselbe den Stimmen der Sänger anzupassen, indem er sich weiter verpflichtet, nötigenfalls alle Änderungen darin vorzunehmen, welche sowohl für die gute Aufführung der Musik als auch für die Bequemlichkeit und die Ansprüche der Sänger nötig sein werden.«
Dieser Vertrag liest sich eher wie eine Bereitwilligkeitserklärung, den Tiber auf einem Drahtseil zu überqueren, nicht wie ein Opernkontrakt. Auf das Textbuch schienen beide Seiten keinen Pfifferling zu geben. Die Premiere erlebte denn auch einen unbeschreiblichen Reinfall. Einer der Sänger soll auf der Bühne gestürzt und seine Arie im Liegen gesungen haben, während obendrein eine im Textbuch nicht vorgesehene Katze zur Belustigung des Publikums durch die Szene wanderte. Der Komponist überließ bereits am zweiten Abend das Dirigieren einem Kollegen. Doch nun lief alles glatt, und die Aufführung endete in Ovationen. Wäre das Stück oder auch nur das Textbuch heute noch tantiemenpflichtig, der Autor könnte von den Aufführungen in aller Welt gut leben. So nämlich kam Rossinis Barbier von Sevilla zur Welt.
Die Entstehung dieser Oper scheint all denen Recht zu geben, die ein Libretto für nicht mehr halten als für ein Rollfeld, von dem die musikalische Phantasie des Komponisten nach Belieben abheben kann wie ein souveräner Flugkörper. Dem steht die lebenslange Klage von erfahrenen Opernmeistern wie Verdi und Puccini entgegen. Bei ihnen reichte die Überzeugung, ohne ein erstklassiges, professionelles und inspirierendes Libretto falle ihnen nicht eine einzige Note ein, bis weit ins Abergläubische. Man stritt sich um Opernstoffe und Textbücher und war nicht selten bereit, erfolgversprechende Libretti anderen Komponisten abzujagen. Temistocle Soleras Textbuch mit dem Titel Nabucco wurde zum Beispiel von Otto Nicolai nicht akzeptiert, dadurch war es frei für Verdi, der damit seinen ersten großen Erfolg erzielte. Sobald ein Libretto gedruckt erschien, galt es in einer Zeit ohne geregeltes Urheberrecht als vogelfrei. Metastasio, der große, sein ganzes Zeitalter beherrschende Librettist des 18. Jahrhunderts, wurde für die dutzendfachen Vertonungen mancher seiner Operntexte nicht etwa ebenso oft entlohnt. Der Librettist war also darauf angewiesen, dass sein Text von einem möglichst berühmten und fähigen Komponisten benutzt wurde, um späteren Vertonungen entgegenzuwirken. Das versprach dem Verleger des Textbuches eine hohe Auflage, erleichterte dem Textautor die Verhandlungen um das Honorar. Beide, Komponist und Textdichter, waren in dieser Weise aufeinander und auf den Erfolg angewiesen.
Selten gab es glückliche Partnerschaften, die über lange Zeit hielten. Manche Komponisten wechselten ihre Librettisten so oft wie Beethoven seine Wohnungen in Wien. Auf Verdis siebenundzwanzig Opernpartituren tauchen die Namen von vierzehn Librettisten auf, dabei sind Bearbeitungen und Doppelautorschaften nicht mitgerechnet. Seine langjährige Zusammenarbeit mit Francesco Maria Piave war eine Begegnung auf ungleichem Niveau, in der Piave als Dienender agierte und nur die persönliche Freundschaft das immer wieder aufkeimende Missvergnügen milderte. Dass Verdi sich am Ende seiner langen Laufbahn in Arrigo Boito einen jüngeren Komponistenkollegen als Textautor heranzog, gelang wohl nur aufgrund der überragenden Stellung, die er im Musikleben Italiens inzwischen erreicht hatte. Nur Vincenzo Bellini genoss das Glück eines dauerhaften Bündnisses mit seinem Textdichter Felice Romani, bis es dann über seiner vorletzten Oper doch zum Zerwürfnis kam, weil Romani notorisch alle Fristen versäumte. Und Hugo von Hofmannsthals vielgerühmte Liaison mit Richard Strauss war die heikle Verbindung eines Verletzlich-Schwierigen mit einem genialen Grobian, bei allen glänzenden Erfolgen zutiefst bestimmt von Missverständnissen, in denen das tiefere Missverhältnis der beiden immer wieder Ausdruck fand. Brecht und Weill wiederum, die Glückskinder der Dreigroschenoper, überwarfen sich bereits bei ihrem nächsten Projekt, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Wie Mozart und Da Ponte es miteinander hielten, wissen wir nicht, da keine unmittelbaren Zeugnisse ihrer Zusammenarbeit existieren, die gemeinsam geschaffenen Werke ausgenommen. Da Ponte rühmte in seinen Memoiren zwar Mozarts »göttliches Genie«, aber da war der Komponist von Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte bereits vierzig Jahre tot und sein Genie aller Welt bekannt.
Vom Genie eines Librettisten wurde selten oder nie gesprochen, bei ihnen reichte es aus, wenn sie, wie Da Ponte und Boito, ihr Handwerk verstanden. Die großen Textdichter der Operngeschichte haben meist keinen Anspruch auf hohe Podeste, wie sie Goethe und Goldoni, Molière und Puschkin zukamen. Da dieser Name gefallen ist: Puschkin hat eine tiefe Spur in der Operngeschichte hinterlassen. Wenn gesagt worden ist, die ganze russische Literatur komme aus Gogols Mantel (womit nicht nur die Erzählung dieses Titels gemeint war), dann lässt sich mit gleichem und noch größerem Recht sagen, die ganze russische Oper komme aus dem Mantel Puschkins. Ihre klassischen Werke beruhen fast ausnahmslos auf Dramen, Märchen und Poemen dieses Dichters: Glinkas Ruslan und Ludmila, Mussorgskys Boris Godunow, Tschaikowskys Pique Dame und Eugen Onegin und noch Rimski-Korsakows Märchen vom Zaren Saltan und Der goldene Hahn. Puschkins dichterische Kraft und sein weitreichender Einfluss waren stark genug, sogar das Schisma zu überbrücken, das sich zwischen den nationalrussischen Komponisten des »Mächtigen Häufleins« und ihren nach Westeuropa orientierten Kollegen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auftat. Er gehört zu jenen Autoren, die nach einem Wort Fontanes wie große Ströme sind, auf denen »die Nationen fahren und hineinsehn in die Tiefe …« Damit kann kein Librettist sich messen, nicht einmal Metastasio. Einige haben immerhin einen Sonderruhm genossen. Über siebzig Bände umfasst die Gesamtausgabe der Werke von Eugène Scribe, ebenso viele Libretti hat er verfasst: für Komponisten wie Meyerbeer, Halévy, Boïeldieu, Verdi und Donizetti sowie gleich achtunddreißig für Daniel-François-Esprit Auber. Man hat Scribe den »Metastasio des 19. Jahrhunderts« genannt, denn wie sein Vorgänger hat er als Librettist seine ganze Epoche beherrscht. Er besaß eine regelrechte Libretto-Fabrik mit einer Schar von Mitarbeitern, ganz ähnlich wie der ältere Dumas eine Romanfabrik betrieb, um die wachsende Nachfrage nach Kolportageromanen zu befriedigen. Für einen Autor allein war die Arbeit zu viel, also taten sich Gespanne zusammen: Jules Barbier und Michel Carré zum Beispiel, die drei große Bühnenerfolge schufen: 1859 Faust für Charles Gounod, sieben Jahre später Mignon für Ambroise Thomas, schließlich 1881 Les contes d’Hoffmann für Jacques Offenbach. Das entsprechende Theaterstück hatten sie allerdings schon dreißig Jahre früher geschrieben. Auch Bizets Carmen war das Resultat einer solchen Librettisten-Gemeinschaft. Henri Meilhac und Ludovic Halévy, der Neffe des Komponisten, hatten sich hier zusammengefunden, nachdem sie zuvor bereits Offenbach mit Textbüchern versorgt hatten. Meilhac, der Bibliothekar, und Halévy, ein Inspektor im Innenministerium, verrichteten ihre Arbeit für die Opernbühne im Nebenberuf, nachdem sie vergeblich versucht hatten, auf dem Sprechtheater Fuß zu fassen. So erhaschten sie auf diesem Umweg einen Zipfel der Unsterblichkeit. Doch gab es unter den Operndichtern auch unerlöste Prinzen, die auf ihren Textbüchern sitzen blieben. Der Singspielautor Goethe war der berühmteste unter ihnen.
Wort und Musik haben in den Opern des 19. Jahrhunderts selten gleichen Rang eingenommen. Der Text hatte meist der Musik gehorsamer Diener zu sein. Peter Hacks hat den Sachverhalt in seinem Versuch über das Libretto mit den Worten ausgedrückt: »Für die Theorie ist es derjenige Teil der Oper, auf den einzugehen nicht lohnt.« Nur am Beginn und am Ende der Libretto-Geschichte stehen Textautoren, die im vollen Sinne des Wortes Dichter waren und in die Geschichte der dramatischen Poesie gehören: Pietro Metastasio und Francesco Maria de’ Calzabigi im 18., Hofmannsthal und Brecht im 20. Jahrhundert. Dazwischen steht der Sonderfall Richard Wagner. Jahrzehntelang galt es als ausgemacht, dass man seine Musik bewundern, die Verse aber geringschätzen müsse oder zumindest ungeniert geringschätzen dürfe. Dabei lassen sich gerade bei ihm – noch weniger als bei anderen Komponisten – Wort und Ton nicht trennen, gemäß seiner brieflichen Äußerung: »Ehe ich dann darangehe, einen Vers zu machen, ja eine Szene zu entwerfen, bin ich bereits in dem musikalischen Dufte meiner Schöpfung berauscht …« Heute braucht man nicht unbedingt ein eingeschworener Wagnerianer zu sein, um seine Texte ernstzunehmen. Sie stellen streckenweise ideale Libretti dar, auch wenn Wagner dieses Wort verschmähte und selbstbewusst von Dichtungen sprach. Darin kann man ihm an vielen Stellen beipflichten, nirgends mehr als in den Meistersingern, die nicht nur dramaturgisch ein Geniestreich sind, sondern poetische Perlen enthalten, die sogar die »Frankfurter Anthologie« Marcel Reich-Ranickis schmücken durften.
Mein Freund, in holder Jugendzeit,
wenn uns von mächt’gen Trieben
zum sel’gen ersten Lieben
die Brust sich schwellet hoch und weit,
ein schönes Lied zu singen
mocht vielen da gelingen:
der Lenz, der sang für sie.
Kam Sommer, Herbst und Winterzeit,
viel Not und Sorg’ im Leben,
manch ehlich Glück daneben:
Kindtauf, Geschäfte, Zwist und Streit: –
denen’s dann noch will gelingen
ein schönes Lied zu singen,
seht: Meister nennt man die!
Im dritten Akt der Götterdämmerung hat der sterbende Siegfried, aus dem Vergessen auftauchend, diese Verse zu singen:
Brünnhilde! Heilige Braut!
Wach’ auf! Öffne dein Auge!
Wer verschloß dich wieder in Schlaf?
Wer band dich in Schlummer so bang!
Das erinnert an das Ende von Kleists Amphitryon, wenn der Titelheld von seiner Frau Abschied nimmt:
Alkmene! Meine Braut! Erkläre dich:
Schenk’ mir noch einmal deiner Augen Licht!
Überhaupt wäre es lohnend, den Bezügen zwischen Wagner und Kleist, nicht nur zwischen der liebesrasenden Penthesilea und der zaubertrankkundigen Isolde, genauer nachzugehen. Kleists Amphitryon kam 1961 unter dem Titel Alkmene als Oper in Berlin heraus, komponiert von Giselher Klebe, der auch das Textbuch selbst verfertigt hatte. Er hielt sich ebenso eng an die Dichtung wie ein Jahr zuvor Ingeborg Bachmann in ihrer Fassung des Prinzen von Homburg für Hans Werner Henze. Kleists Verse in ihrer unwiderstehlichen Prägung wird ein Librettist unserer Tage so wenig zu verändern oder zu ersetzen wagen wie die Librettisten des 19. Jahrhunderts die Verse Goethes. Die Unterschiede zwischen Klebe und Bachmann sind dennoch frappierend. Klebe stellt um, deklariert Dialoge zu Duetten, gekürzte Monologe zu Arien, er komponiert eine Nummernoper fast in traditioneller Form. Ingeborg Bachmann dagegen gliedert ihren Stoff mit dramatischem Geschick ungleich wirkungsvoller, wobei sich die preußische Staatsaktion allerdings als sehr viel librettotauglicher erweist als die antike Komödie der erotischen Verwirrung. Aber das gehört eben auch zum Handwerk des guten Librettisten: der sichere Blick für den geeigneten Stoff, aus dem Opern zu verfertigen sind.
Die Zahl an Textbüchern, die im Laufe von vier Jahrhunderten entstanden, ist kaum genau anzugeben. In der Musikabteilung der Kongressbibliothek in Washington liegt die Sammlung Schatz, die allein zwölftausend Libretti umfasst, überwiegend aus der Zeit vor 1800. Auf der Insel San Giorgio Maggiore, gegenüber dem Dogenpalast von Venedig, werden in der Fondazione Cini die Schätze der Sammlung Rolandi aufbewahrt, zweiunddreißigtausend Libretti, und die Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom beherbergt nicht weniger als dreiundzwanzigtausend. Weitere Sammlungen befinden sich in Paris, Brüssel, London, Bologna, Florenz, Neapel, München und Wolfenbüttel. Die Librettologie, wenn sie je in den Rang einer regulären Wissenschaft aufsteigen sollte, muss bei fast hunderttausend Textbüchern aus vierhundert Jahren um ihre Zukunft nicht besorgt sein – es ist genug Stoff für Doktoranden in weiteren vierhundert Jahren.
Das Libretto, die »zehnte Muse«, wie Patrick J. Smith es in seiner Geschichte dieser Kunstform genannt hat, war oft Gegenstand erbitterter Fehden, peinlicher Eifersüchteleien und unwürdiger Diebstähle. Es war ein weiter Weg von Ottavio Rinuccini, dem Textdichter Peris und Monteverdis, bis zu Luciano Berio, der 1979 in einem Vortrag über »Musik und Dichtung« von einem seiner Werke sagte, darin sei ein Text von James Joyce musikalisch so eingeschmolzen«, dass es »nicht länger möglich sei, zwischen Wort und Klang zu unterscheiden.« Nicht nur Librettisten werden sich dadurch in ihrer Standesehre verletzt sehen, auch ein Komponist wie Gluck wäre dagegen auf die Barrikaden gegangen.
Es kann nicht verwundern, dass in Fällen, in denen der Streit um den Vorrang von Wort oder Ton auf der Musikbühne selbst stattfand, die Krone selten eindeutig vergeben wurde. Schließlich waren an diesen Opern ein Komponist und ein Librettist beteiligt. Clemens Krauss und Richard Strauss, die den alten Streit wieder aufnahmen, lassen am Ende von Capriccio die Frage offen, die sich anhand der Oper von Casti und Salieri ergab. Deren Titel lautete zwar Prima la musica e poi le parole, aber ganz so eindeutig wollten die erfahrenen Opernpraktiker das Resultat nicht sehen. Casti, Lehrer für Rhetorik und Verfasser politischer Satiren, und Salieri, der das Operngeschäft von der Pike auf gelernt hatte, enden mit einem Kompromiss, denn Kapellmeister und Dichter, Primadonna und Buffo-Sängerin, die vier teilnehmenden Figuren ihres Einakters, vereinigen sich zum Happy End, nachdem sie in adligem Auftrag ein neues Werk in nur vier Tagen auf die Bretter gebracht haben. Die Praxis siegt über alle Theorie, wenn es im Schlussensemble einmütig heißt:
Il vate, il maestro
Risveglino l’estro.
La seria, la buffa
Non faccian baruffa.
»Der Dichter, der Meister beleben die Geister, ob ernst oder heiter, wir sind keine Streiter.« Alle geloben Freundschaft, zumindest so lange, bis der Vorhang fällt und die Arbeit an einer neuen Oper beginnt.
I18. Jahrhundert
Der Fürst der LibrettistenPietro Metastasio
Seine Dramen zu lesen ist verhängnisvoll. Man darf sie niemals anhören, außer im Zusammenhang mit der Musik.
Stendhal
Henri Beyle aus Grenoble, der sich als Schriftsteller Stendhal nannte, begann seine literarische Laufbahn mit einem Buch, das er in wenigen Frühjahrswochen 1814 in Paris einem Kopisten diktierte und unter dem Namen Louis Alexandre César Bombet herausbrachte. Es trug den umständlichen Titel Briefe aus dem österreichischen Wien über den berühmten Komponisten Joseph Haydn, vermehrt durch ein Leben Mozarts und Betrachtungen über Metastasio und den gegenwärtigen Zustand der Musik in Italien. Das Buch war von der ersten bis zur letzten Seite ein Plagiat, mit dem Stendhal zum ersten, aber nicht zum letzten Mal die Maxime Molières befolgte: »Je prends mon bien où je le trouve« (»Ich nehme mir mein Gut, wo ich es finde«). Was war der Grund des fragwürdigen Unternehmens? Vermutlich wollte Stendhal, nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und bevor er erneut nach Italien aufbrach in eine ungewisse Zukunft, seinem Leben durch die literarische Tätigkeit einen neuen Sinn geben. Das gelang im Ganzen gesehen und führte zuletzt zu Meisterwerken der Romankunst wie Rot und Schwarz und Die Kartause von Parma. Das Debütwerk über Haydn, Mozart und Metastasio erwies sich allerdings als Misserfolg, denn es verstrickte Stendhal nicht nur in Auseinandersetzungen mit den plagiierten Autoren, sondern es wurden auch lediglich einhundertsiebenundzwanzig Exemplaren verkauft. Trotzdem kann das Buch als Beleg dafür dienen, dass Pietro Metastasio, der unumschränkte Herrscher unter den Librettisten des 18. Jahrhunderts, dreißig Jahre nach seinem Tod noch immer ein großer Name war. Erst einige Zeit später setzte die Epoche der Geringschätzung ein, von der er sich bis heute nicht völlig erholt hat. Wann immer ein Grund dafür gesucht wird, dass etwa Mozarts letzte Oper La clemenza di Tito nicht mehr an die Erfolge von Le Nozze di Figaro, Don Giovanni oder Die Zauberflöte heranreicht, die Verfasser von Opernführern und Opernlexika sind sich einig: Es habe, sagen sie, an Metastasios Textbuch gelegen. Zur Zeit der Komposition sei es mehr als ein halbes Jahrhundert alt gewesen, geschrieben für eine ganz andere Opernform, eine längst tote. Mozart selbst, sagen sie, habe den Untergang der prunkvoll-steifen Barockoper mit verursacht. Auf ihren Grabsteinen stünden die Namen Figaro und Così fan tutte. Unter ihnen hätte der alte Metastasio nicht wieder hervorgeholt werden dürfen.
Nun hatte Mozart aber nicht nur nichts gegen Metastasio, vielmehr kannte er ihn gut und schätzte ihn. Die Schwester des Komponisten hat berichtet, dass sich beide des Öfteren in Wien trafen. Metastasio verwendete sich für Mozart, als ein Wiener Theaterdirektor die Aufführung der Oper La finta semplice hintertrieb, für die der zwölfjährige Komponist einen kaiserlichen Auftrag erhalten hatte. Mozart gab Metastasio mehrfach Proben seiner Improvisationskunst am Cembalo. Vor allem aber vertonte er dessen Libretti, außer dem späten Titus schon in früher Zeit Il sogno di Scipione (Scipios Traum) mit sechzehn Jahren in Salzburg und Il re pastore (Der König als Hirte) mit neunzehn Jahren, ebenfalls in Salzburg.
Wichtig ist, dass in beiden Fällen der Text geändert wurde, zu Lebzeiten Metastasios, also mit dessen Wissen. Der Librettist erklärte sich sogar bereit, einen Text von Giovanni de Gamerra für Mozart umzuändern, was ebenfalls für seine Wertschätzung des jungen Komponisten spricht. Noch wichtiger scheint, dass alle genannten Opern zu fürstlichen Jubelanlässen komponiert wurden. Dafür galt damals eben nichts als geeigneter als ein »dramma per musica« oder eines der »feste teatrale« von Metastasio. Die Textwahl der Böhmischen Stände für La clemenza di Tito erschien Mozart ganz normal. Der Rückgriff auf eine »opera seria«, eine ernste Barock-Oper, bereitete dem Komponisten, der damals gerade an der Zauberflöte arbeitete, keine Schwierigkeiten, auch wenn der berühmte Librettist und Herrscher seines Jahrhunderts bereits seit neun Jahren tot war. Fragen der dramatischen Wahrscheinlichkeit waren für ihn zwar nicht irrelevant, aber kein unüberwindliches Hindernis. Entsprach Così fan tutte, die Verwechslungskomödie, in der zwei junge Aristokraten sich verkleiden, um jeweils die Braut des anderen zu verführen, der Forderung nach Wahrscheinlichkeit? Es war dem Namen nach eine »opera buffa«, die zwei betrogene Betrüger aufbot nebst einem Philosophen als Anstifter und einer Zofe als Fallenstellerin. Das alles mündete in ein Happy End, obendrein in C-Dur, aber nur nach einem unerhörten Spiel der Gefühle zwischen Lüge und Wahrheit, in dem die Personen des Stücks wie in Treibsand den Boden unter den Füßen verloren haben. Der Ausgang war nicht viel wahrscheinlicher als der Gnadenerweis des Kaisers Titus, der seinen Feinden, die früher seine Freunde waren, verzeiht, obwohl sie ihn gerade noch hatten ermorden wollen. Opernschlüsse dieser Art beenden jede zweite Handlung, die Metastasio in Verse setzte. Großmut rangierte als oberste Fürstentugend, oder vielmehr: Sie sollte es. Man überhört heute allzu leicht die appellierende Mahnung, die in solchen damals geläufigen Schmeicheleien steckte. Einen Fürsten der Barockzeit bei seiner Krönung oder Hochzeit mit einem huldvollen Kaiser der Antike zu vergleichen hieß nicht, dass solche Huldigungen aus der Gewissheit kamen, der Fürst würde sich genauso wie sein antikes Vorbild verhalten. Es konnte nur heißen, dass man dringlich wünschte, er möge es tun, weniger im Interesse des Herrschers als in dem der Beherrschten.
Was La clemenza di Tito anging, wurde Metastasios Text auf Mozarts Wunsch von Caterino Mazzolà, dem Dresdner Hofpoeten, umgearbeitet, verwandelt in eine wirkliche Oper, eine »vera opera«, wie Mozart eigenhändig in sein Werkverzeichnis eintrug. So ward aus dem alten Rock ein neuer. Den Text der Finalszene und des Chores hat Mazzolà geändert, ohne aber das vorausgehende Rezitativ des Kaisers auch nur in einem einzigen Wort anzutasten. Denn hier verkündet Titus den Entschluss, seinem aufwallenden Zorn entgegen alle Verschwörer zu begnadigen. Die für die Wertvorstellungen Metastasios wichtigen Vokabeln tauchen darin in seltener Häufung auf: la virtù, die Tugend der Pflichterfüllung, la clemenza, die Tugend der Großmut, ferner die Festigkeit und die Selbsttreue, schließlich – da spricht der in Wien exilierte Römer Metastasio – das Ansehen der Vaterstadt:
Sia noto a Roma
Ch’io son l’istesso, e ch’io
Tutto so, tutti assolvo e tutto oblio
Rom soll es wissen,
dass ich bleibe, der ich bin, und dass ich
alles weiß, alles vergebe und alles vergesse.
Mozart war nicht der letzte, der einen Text von Metastasio vertonte. Auch Cherubini, Donizetti und Conradin Kreutzer stützten sich auf seine Libretti, obwohl sie schon fünf oder sechs Jahrzehnte zurücklagen, und noch 1819 komponierte Giacomo Meyerbeer für das Teatro Regio in Turin das Libretto der Semiramide riconosciuta, das Metastasio neunzig Jahre zuvor verfasst hatte. Man kann daran seinen Rang und seine überragende Stellung ablesen, die noch bis ins 19. Jahrhundert nachwirkte. Gute Opernverse gab es zwar vor und nach Metastasio, aber kein Librettist vorher und nachher erreichte jemals seinen Einfluss auf die Komponisten seiner Zeit. Seine Textbücher waren bestimmt für die Kunst äußerst virtuoser Sänger, darunter berühmte Kastraten. Ihre dramatischen Situationen bieten meist fünf bis sechs Charaktere auf, die in tragische Interessenkonflikte (in der Regel zwischen Liebe und Pflicht) geraten und in ihrem überlegten Handeln als typische Vertreter des Zeitalters des aufgeklärten Absolutismus anzusehen sind. Metastasios Sprache war getragen von der Idee der edlen Einfachheit: Die wohlklingenden, vokalreichen und klar gegliederten Arientexte boten den Komponisten eine ideale Grundlage für musikalische Vertonungen, häufig mit reicher Ausgestaltung der poetischen Bilder und dramatischen Situationen.
All das war Metastasio nicht an der Wiege gesungen worden. Der einflussreichste Operndichter der Geschichte wurde buchstäblich auf der Straße entdeckt, aufgelesen von einem Musikkenner, der ihn singen hörte und beschloss, den Knaben ausbilden zu lassen. Sein Vater, Felice Trapassi, war aus Assisi nach Rom gezogen, wo der Sohn 1698 geboren wurde. Der ihn adoptierte, Gian Vincenzo Gravina, dachte freilich weniger daran, aus ihm einen Dichter zu machen, auch wenn ihm die Leichtigkeit aufgefallen war, mit der der Zehnjährige im Gemüseladen seines Vaters Verse und Reime erfand und dazu sang. Gravina sah in seinem Schützling, den er zum Erben bestimmte, mehr einen Juristen oder Staatsmann, womöglich einen Kirchenfürsten. Also studierte Pietro, der den Namen Metastasio – die griechische Entsprechung von Trapassi, »überschreiten« oder »wechseln« – erhielt, außer den Klassikern und Philosophen auch Rechtskunde und Theologie. Mit sechzehn bekam er die niederen Weihen, was damals nicht unbedingt auf eine Priesterlaufbahn vorauswies, sondern eine soziale Absicherung enthielt. Die Kirche war eben ein mächtiger Brotherr.
Gravina starb, ehe er den Ruhm seines Schützlings bewundern und auskosten durfte. Dieser verjubelte in ein paar Jahren das Vermögen seines Patrons, fünfzehntausend Scudi, aber nach reuevoller Fron in einer Anwaltspraxis in Neapel hatte er das Glück, einen neuen Förderer zu finden, eine Förderin diesmal: Marianna Benti Bulgarelli, unter dem Namen »La Romanina« als Sopranistin landesweit gefeiert. Sie war vermögend, einflussreich und verheiratet, wichtige Voraussetzungen für die ältere Protektorin eines jüngeren Mannes. Statt der Gesetzestexte nahm sich Metastasio nun die Regeln von Harmonie und Kontrapunkt vor. Sein Lehrer Nicola Porpora, zwölf Jahre älter, gehörte zu Neapels berühmtesten Komponisten und hat später eine ganze Reihe der Libretti seines Kompositionsschülers vertont.
In Begleitung der Romanina kam der junge Mann durch ganz Italien und sammelte Theatererfahrungen. Metastasio war kein blutleerer Schreibtischpoet, zu dem ihn später das 19. Jahrhundert gelegentlich herabwürdigte. Als Wiener Hofpoet war er weit davon entfernt, die Komponisten kraft seiner Stellung dazu zu zwingen, artifiziell gedrechselte Verse unverändert zu vertonen. Er hatte den Opernbetrieb bereits aufs Genaueste kennengelernt, ehe er seinen ersten Operntext schrieb. Hatte er bis dahin Gedichte und Dramen verfasst, so wandte er sich mit fünfundzwanzig Jahren dem Libretto zu. Das erste beschränkte sich noch darauf, ein Textbuch von Domenico David aus dem 17. Jahrhundert zu bearbeiten. Doch schon das zweite Libretto, sein erstes selbständiges Werk, wurde ein sensationeller Erfolg und etablierte den jungen Mann als Autorität in seinem Fach. Im Teatro San Bartolomeo in Neapel kam, vertont von Domenico Sarro, im Februar 1724 die Oper Didone abbandonata heraus, über die von Aeneas, dem späteren Gründer Roms, verlassene Königin von Karthago und tragische Heldin der Verse Vergils. Die Gazzetta di Napoli schrieb über das Ereignis:
Am Abend wurde die Premiere einer neuen Oper, »Didone abbandonata«, mit allgemeinem Beifall aufgenommen von einem Publikum, das in großer Zahl herbeigeströmt war wegen des Textes eines berühmten Autors, wegen der Musik von Kapellmeister Sarro und wegen der Sänger. Unter ihnen ragte Cavaliere Nicolò Grimaldi heraus, ausgezeichnet als Aeneas, ferner die virtuose Marianna Benti Bulgarelli als Dido und die virtuose Antonia Merighi als Jarba. Die Schönheit des Werkes wurde gesteigert durch die Kostüme der Sänger und die Bühnenbilder, sämtlich in bestem Geschmack, vor allem das letzte, eine täuschend echte Wiedergabe des Brandes von Karthago. Der Erfolg der gesamten Inszenierung ist der umsichtigen und kompetenten Leitung des Theaters zu danken.
Ein aufschlussreiches Zitat, nicht zuletzt dafür, wie wenig sich der nichtssagende Inhalt mancher Musikkritiken samt einschmeichelnder Nachfrage um Freikarten bei den Bühneninstanzen durch die Jahrhunderte geändert hat. Prima la scenario, poi la musica e le parole – das Spektakel war wichtiger als Musik und Textbuch, von letzterem wurde nicht einmal der Name des Verfassers genannt, vielleicht aus Missgunst gegen den Günstling der Primadonna.
Wie ungleich auch immer die Gewichte der Kritik verteilt waren: Es gab riesigen Beifall. Metastasio erlebte drei Dutzend weitere Vertonungen dieses Librettos, und noch vier Jahre nach dem Tod des Textdichters komponierte Luigi Cherubini seine Didone abbandonata, die gleichzeitig mit Mozarts Figaro herauskam.
In der Erstvertonung durch Domenico Sarro erschien Metastasios frühes Meisterwerk knapp vier Wochen vor Giulio Cesare, einem der größten Erfolge Händels in London, vier Jahre vor dem unerwarteten Dolchstoß, den die populäre Beggar’s Opera von Gay und Pepusch dem italienisch orientierten Musiktheater des deutschen Komponisten versetzte.
Nun folgte eine Metastasio-Vertonung der anderen: Siroe, Ezio,Alessandro nell’Indie,Demetrio – die Premieren überschlugen sich. Nicht immer freilich garantierte der Name des Librettisten einen Erfolg des musikdramatischen Endprodukts. Händels Version des Ezio zum Beispiel war ein Fehlschlag und lief am Theater am Haymarket, der langjährigen Londoner Hochburg des Komponisten, nur ganze fünf Abende. Damit spielte man auch damals nicht einmal die Kosten der Kulissen ein. Die Handlung der Oper spielt in Rom, nach dem Niedergang des Hunnenkönigs Attila, kurz vor dem Untergang des Römischen Reiches. Der Sieg des Feldherrn Ezio erregt den Neid des Kaisers Valentinian. Der römische Patrizier Maximus, dessen Frau der Kaiser vergewaltigt hat, bittet Ezio, ihm bei dem Versuch zu helfen, den Kaiser zu beseitigen. Als der Plan scheitert, lenkt Maximus den Verdacht des Kaisers auf Ezio und plädiert für dessen Tod, in der Absicht, das Volk, bei dem der Feldherr sehr beliebt ist, gegen den Kaiser aufzuwiegeln. Daraus schuf Metastasio eine Liebesintrige, in die noch verschiedene andere Figuren verwickelt sind. Im Gegensatz zur historischen Vorlage, wonach der Kaiser Ezio hinrichten ließ, wird der Feldherr am Ende freigesprochen, wie es die Dramaturgie der opera seria vorsah – die Milde des Kaisers war nicht allein auf Titus beschränkt.
Niemand machte den Librettisten für den Fehlschlag des Ezio verantwortlich, zumal der Text in London erheblich geändert worden war. Noch reichte der Einfluss Metastasios nicht bis in die englische Metropole. Sein Libretto zu Ezio wurde übrigens ein Vierteljahrhundert später – da war er längst Hofpoet in Wien – von Christoph Willibald Gluck für die Prager Karnevalssaison des Jahres 1750 ein weiteres Mal vertont, zwölf Jahre bevor er in Wien seine Reformoper Orfeo ed Euridice herausbrachte. »Lui ha un fuoco meraviglioso, ma pazzo«, »Er hat ein wunderbares Feuer, ist aber verrückt«, soll Metastasio bei dieser Gelegenheit über den jungen Gluck gesagt haben.
Der Ruf nach Wien erreichte ihn 1730, im Alter von zweiunddreißig Jahren. Von nun an war er, wie gesagt worden ist, ein Gefangener in Seide. Sein Vorgänger im Amt des kaiserlichen Hofpoeten, Apostolo Zeno, war selbst einer der großen Librettisten seiner Zeit. Als gebürtiger Venezianer hatte er Metastasio in einem wichtigen Punkt vorgearbeitet. Die in seiner Heimatstadt benutzten Operntexte erschienen ihm ungenügend, zu wenig anspruchsvoll. Er pflichtete seinen Kollegen bei, die in vielen Vorworten zu ihren Libretti über den Zustand des Operntheaters klagten. Dort herrsche allein die Geldgier der Impresari, und jedermann verletze ungestraft die Gesetze des Dramas. Zeno widersetzte sich diesen Tendenzen, indem er sich an das klassizistische Theater Frankreichs, an Autoren wie Racine und Corneille, anlehnte. Von Haus aus Historiker, im Besitz einer wertvollen Sammlung alter Münzen, trieb Zeno genaue Quellenstudien, ehe er ein Textbuch verfasste. Selten nahm er eine fiktive Person hinzu, und wenn er es tat, entschuldigte er sich im Vorwort: »Sestia, die Tochter des Fabrizius, die zusammen mit anderen Römern von Pyrrhus gefangengenommen wird, ist hier eingeführt worden, damit sich eine Liebesgeschichte entwickeln kann, ohne die heutzutage kein Stück sein Glück machen kann.«
Geschrieben 1729, in Zenos letztem Jahr als Hofpoet in Wien. Auch an diesem Befund hat sich in der Folgezeit bis in unser Jahrhundert kaum etwas verändert. Immerhin verschaffte Zeno dem hohen Stil nach französischem Vorbild Geltung, und damit ging eine stärkere Betonung der moralischen Conclusio einher. Das war nicht dazu angetan, den Librettisten ihr Geschäft zu erleichtern. Die Handlung sollte plausibel sein, musste aber nach schier ausweglosen Konflikten zwischen Pflicht und Neigung am Ende eine befriedigende Lösung präsentieren. Die einfachste Weise, den dramatischen Knoten zu durchschlagen, schied dabei von vornherein aus: der Tod. Die barocke Opernbühne war noch nicht das Musiktheater Wagners, Verdis und Puccinis. Einem Fürstensohn, der zur Feier seiner Hochzeit eine Oper in Auftrag gab, war es schwerlich zuzumuten, am Ende der Aufführung, bevor er die Loge mit dem Brautgemach vertauschte, eine Bühne voller Leichen vorzufinden. Gerade in Südeuropa suchte man die Oper nicht auf, um zu schluchzen, sondern um sich zu unterhalten. Der französische Opernreisende Charles de Brosses hat berichtet – es ist die Zeit um 1740 –, was man in den Pausen und während der Rezitative meist zu tun pflegte. In Mailand spielte man Pharao, in Rom Schach, in Venedig schaute man dem Treiben der Gondolieri zu, in Florenz – vornehm wie immer – wurde ausgiebig gespeist. Kein höheres Lob für den Librettisten als das, man habe seinen Versen sogar dann zugehört, wenn gerade keine Arie erklang.
Zeno war einer der ersten, dem gelegentlich zugehört wurde. Er verstand es, seine Helden am Ende einer Oper in genau dem Punkt nachgeben zu lassen, in dem sie zweieinhalb lange Akte hindurch niemals auch nur in Gedanken hatten weichen wollen. Natürlich erkannte er die Unwahrscheinlichkeit manch plötzlich aufgegebener Leidenschaft, mancher Tyrannen-Einkehr nach vorausgegangener Grausamkeit und Härte. Im Vorwort seines Librettos zu Venceslao, uraufgeführt in Venedig 1703, verteidigt er die Kehrtwende des Königssohnes, der von seinem Vater – dem Titelhelden – zum Tode verurteilt wird. Der Sohn Kasimir hat seinen Bruder ermordet, unwissentlich freilich, im Verlauf einer Rivalität um eine Prinzessin, die Kasimir nach dem Willen des Königs nicht heiraten soll. Eine Geschichte nach dem Geschmack der Zeit mit schuldiger Unschuld, Vater-Sohn-Konflikten und Brüderrivalitäten, ein bisschen Kain und Abel bzw. Romeo und Julia inclusive. Sie findet dennoch ein glückliches Ende, denn Kasimir nimmt einfach eine andere zur Frau und wird daraufhin begnadigt. Böhmische Geschichte, zubereitet alla veneziana. Zeno, der Librettist, verteidigte den glücklichen Ausgang gegen den Vorwurf der Unlogik und Unwahrscheinlichkeit: »Der plötzliche Wechsel im Charakter des Kasimir widerspricht weder den Moralgesetzen noch den Lehren der Dichtkunst. Es ist wahr, dass ein böser Mensch nur unter großen Schwierigkeiten zu einem guten wird. Die Abgründe der Sünde wie die Höhen der Tugend erreicht man nur schrittweise. Ein Sinneswandel wird jedoch manchmal auch ausgelöst durch die Furcht vor dem drohenden Tod oder die Angst vor großem Schrecken.«
Zeno kehrte mit nur einundvierzig Jahren Wien den Rücken und kehrte nach Venedig zurück. Sein Nachfolger Metastasio bezog das Haus eines neapolitanischen Freundes spanischer Herkunft namens Nicolò Martinez und verbrachte dort den Rest seines Lebens – das waren immerhin noch zweiundfünfzig Jahre. Gehalt und Pension wurden kaiserlich bemessen, abgesehen von dem, was die Romanina ihm bei ihrem Tode 1734 vermachte: fünfundzwanzigtausend Scudi, ein großes Vermögen. Metastasio schlug das Erbe aus. Er mochte seine Stellung am Wiener Hof nicht gefährdet sehen durch den Eindruck, der ausgehaltene Liebhaber einer Sängerin gewesen zu sein. Er hatte sich schon geweigert, sie mit nach Wien zu nehmen. Obendrein galt es, Rücksicht zu nehmen auf die lebende Gönnerin, die Gräfin d’Althann, gleichfalls Marianna mit Vornamen, vermögend, einflussreich, verheiratet usw. Als Metastasio auch diese Freundin durch den Tod verlor, umsorgte den Librettisten fortan die Tochter des Hauses Martinez, wieder eine Marianna, die dritte des Namens. Nicht nur seine Libretti, sagten die Spötter, seien alle gleich.
Im Jahre 1733 veröffentlichte Metastasio zwei seiner erfolgreichsten Opernbücher: L’Olimpiade und Demofoonte. L’Olimpiade (nicht zu verwechseln mit Spontinis Olimpie nach Voltaire) treibt vor dem Hintergrund olympischer Spiele (der Antike natürlich) die Ausweglosigkeit zweier Liebespaare auf eine raffiniert ausgeklügelte Spitze. Ein Freund kämpft in der Maske des anderen um den Preis, der in der Königstochter besteht, sozusagen Meistersinger und Götterdämmerung in einem, wie ja überhaupt beim Durchlesen vieler Libretti offenkundig wird, dass Opernkonfigurationen seit den Tagen Zenos und Metastasios nicht viel Neues unter der Sonne erlebt haben. Kompliziert wird es in diesem Fall dadurch, dass beide Freunde die Königstochter lieben.
Demofoonte, gleichfalls eine Liebesodyssee, zuerst vertont von Antonio Caldara, nimmt im Schaffen Glucks und Mozarts eine besondere Stellung ein. Gluck errang damit 1742 in Mailand, acht Jahre vor dem Prager Ezio – seinen ersten großen Erfolg; und Mozart hat zwischen 1779 und 1782 nicht weniger als sieben Arien aus Metastasios Textbuch einzeln vertont. Nachdem damit die Hauptarbeit einer Oper bereits getan war, verwundert es, dass er sich nicht die Mühe machte, daraus ein komplettes Werk zu gewinnen. Aber dem sechsundzwanzigjährigen Mozart war eine Handlung, über der ein Orakelspruch hängt, der von den handelnden Personen lediglich falsch ausgelegt wird, etwas zu mechanisch konstruiert, zumal er gerade mit Idomeneo den entscheidenden Schritt getan hatte, sich musikdramatisches Neuland zu erobern. Das hinderte ihn nicht, sich aus weiteren Libretti von Metastasio einzelne Perlen herauszuholen, aus der Didone abbandonata ebenso wie aus Ezio. Besonders schätzte er die Arie des Königs Kleisthenes aus L’Olimpiade. In ihr bahnt sich die Lösung der verworrenen Situation an, weil der Vater in einem der Widersacher gegen seine Pläne den eigenen, verloren geglaubten Sohn zu erahnen beginnt und dies dem Alcandro, seinem Vertrauten, eröffnet:
Alcandro, lo confesso,
Alcandro, ich gestehe,
Stupisco di me stesso.
ich staune über mich selbst.
Il volto, il ciglio,
Das Antlitz, die Miene, die Stimme
La voce di costui nel cor mi desta
erregen in meinem Herzen
Un palpito improvviso,
eine unwillkürliche Bewegung,
Che le risente in ogni fibra il sangue
die das Blut in allen Adern spürt.
Fra tutti i miei pensieri
In allen meinen Gedanken
La cagion ne ricerco,
suche ich den Grund,
E non la trovo.
und finde ihn nicht.
Che sarà, giusti Dei,
Was ist’s, gute Götter,
Questo ch’io provo?
das mir widerfährt.
Non sò d’onde viene
Ich weiß nicht, woher
Quel tenero affetto,
jenes zärtliche Gefühl rührt,
Quel moto che ignoto
jene unbekannte Regung
Mi nasce nel petto,
die in meiner Brust entsteht,
Quel gel, che le vene
jener Schauer, der mir
Scorrendo mi va.
durch die Adern läuft.
Nel seno destarmi
In meiner Brust spüre ich
Sì fieri contrasti
so heftige Gegensätze,
Non parmi che basti
für die mir bloßes Mitleid
La sola pietà.
nicht Grund genug zu sein scheint.
Mozart hat diesen Text zweimal vertont: 1787 für den Bassisten Ludwig Fischer, der in der Premiere der Entführung aus dem Serail den Osmin gesungen hatte; und bereits neun Jahre zuvor hatte er die Arie für Sopran gesetzt, als er seiner damaligen Liebe Aloysia Weber, der Schwester seiner späteren Frau Constanze, ein Bravourstück schreiben wollte. Die Texte Metastasios waren für solche Glanznummern nicht nur besonders geeignet, sondern eigens dafür gedacht. In den Arien trat der Librettist hinter den Komponisten zurück, sofern dieser die dramatische Struktur und die Rezitative unangetastet ließ – das war die stillschweigend getroffene Absprache, der heimliche Kontrakt.
Die Komponisten flogen nur so auf Metastasios Arien. Zählt man in Non sò d’onde viene einmal die Vokale und Konsonanten, so sagt deren zahlenmäßiges Verhältnis etwas über den Zauber seiner Poesie aus. Doppelkonsonanten einfach gezählt, entfallen in diesen zehn Zeilen auf fünfundsiebzig Konsonanten siebenundsechzig Vokale. Musikalischere Gebilde lassen sich kaum denken, und gar im Zeitalter der Koloraturen. Zudem sind diese Gebilde komplexer als die Sprache vermuten lässt, auch wenn der König Klystenes, äußerlich betrachtet, nicht mehr sagt als: Ich weiß nicht, wie mir geschieht, es kann doch nicht nur Mitgefühl sein, was ich empfinde.
Es ist eine der berühmten Arien, in denen Metastasio die Handlung angeblich stillstehen lässt und seinem Sänger einen fulminanten Abgang verschafft, nachdem dieser ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Leidenschaft, einen »Affekt«, gut oder schlimm, sanft oder wild, zum Jubel des Publikums ausgesungen hat. Aber ist es nicht zugleich ein Weitertreiben der Handlung – der inneren Handlung womöglich –, wenn der Zuschauer und Zuhörer im Verhältnis einer Bühnenperson zu einer anderen eine wichtige Veränderung spürt? Prinzipiell besteht kein großer Unterschied zwischen einer scheinbar statischen Arie von Metastasio, aus der das Publikum erfährt, dass der König und sein Widersacher in einer engen, noch geheimnisumwitterten Beziehung zueinander stehen, und – zum Beispiel – dem Geständnis Don Josés: »Carmen, je t’aime!« in Bizets Oper, einer Arie, der niemand Bühnendramatik abspricht. Hinzu kommt, dass der Wettstreit der Komponisten um eine neue, bessere Vertonung der immer gleichen, lockenden Verse von Metastasio zweifellos eine Bereicherung der damaligen Opernbühne darstellte. Das Publikum kannte den Stoff, kannte sogar den Text, es verglich die Musik, fühlte sich angeregt zu kritischem Vergleich, was die Komponisten beflügeln musste. Mozart schrieb an seinen Vater, den musikalischen Vertrauten, vor dem er keine Berufsgeheimnisse zu hüten brauchte, über die erste Vertonung von Metastasios »Alcandro, lo confesso«: »Ich habe auch zu einer übung, die aria, non sò d’onde viene etc., die so schön vom Bach componirt ist, gemacht« – er meint Johann Christian Bach, einen von Johann Sebastians Söhnen – »aus der ursach, weil ich die vom Bach so gut kenne, weil sie mir so gefällt, und immer in ohren ist; denn ich hab versuchen wollen, ob ich nicht ungeacht diesen allen imstande bin, eine Aria zu machen, die derselben von Bach gar nicht gleicht? – – sie sieht ihr auch gar nicht, gar nicht gleich. Diese Aria habe ich anfangs dem Raff zugedacht, aber der anfang gleich schien mir für den Raff zu hoch, und um ihn zu ändern gefiel er mir zu sehr, und wegen sezung der instrumenten schien er mir auch für einen Sopran besser, mithin entschloss ich mich diese Aria für die Weberin zu machen.«
Ein unschätzbarer Blick in die Werkstatt, den man nicht mit der Bemerkung abtun kann, hier habe Mozart lediglich das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Die lange Rechtfertigung läuft darauf hinaus, dem Vater – der seinen Metastasio kannte – zu erklären, warum hier eine berühmte Bass-Arie für Sopran gesetzt wurde. Naiv sagt Mozart: Es lag am melodischen Einfall – was er bescheiden »den Anfang« nennt. Der lag zu hoch. Kein Wunder, mit der Stimme der Weberin im Kopf fiel ihm nichts für den Sänger Anton Raaff ein. Das holte er erst neun Jahre später nach, als die Weberin nur noch die Schwägerin war. Dennoch: Wie ist Mozart hier verfahren? Zuerst war da Metastasios Text, benutzt wahrscheinlich nach der Turiner Ausgabe, die Graf Firmian, der österreichische Generalgouverneur in Mailand, dem angereisten vierzehnjährigen Landsmann Mozart 1770 geschenkt hatte. Die Verse inspirierten den »Anfang«. Der war so gut, dass Mozart ihn nicht ändern mochte. Die Melodie lag für einen Bass zu hoch, das traf sich gut. Und sie klang besser als die »vom Bach«, obwohl er die liebte und nur schwer aus dem Ohr verlor. Auch Johann Christian Bach hat nicht die ganze L’Olimpiade vertont. Mozart und er kannten sich seit der London-Reise des achtjährigen Wunderkindes und sahen sich später in Mailand wieder. Sie spielten Hexenkunststücke zusammen, Sonaten, in denen je einer nur jeweils einen Takt spielte, dann der andere den nächsten und so fort. Den älteren Freund in einer seiner beliebtesten Bravourarien zu überbieten – mit demselben Text – war ein besonderer, aber heikler Anreiz, dem Mozart wohl nur nachgab, um ein besonderes Bravourstück für Aloysia zu schaffen.
Es war ein Musizierprinzip dieser Zeit: Die Musik musste neu, der Text durfte alt sein, dadurch wurden beide, wenn sie gut waren, nur umso beliebter. Die Strophen Metastasios haben die Komponisten also nicht etwa in Unkenntnis, sondern in genauer Kenntnis früherer Vertonungen gereizt. Nach der L’Olimpiade-Premiere in Wien 1733 mit Musik von Caldara erlebte das Stück eine zweite Fassung zur Karnevalssaison in Venedig mit Musik von Antonio Vivaldi, Anfang 1734. Die Partitur war lange verschollen und wurde erst 1927 in Turin wiederentdeckt. Alfredo Casella und Virgilio Mortari brachten sie 1939 in Siena zur Aufführung. Vivaldis Vertonung und eine weitere von Pergolesi, die für den gefeierten Komponisten der Serva padrona ein böser Reinfall war, stellten wahrscheinlich rein musikalisch die Höhepunkte der Ära Metastasio dar, nimmt man zwei spätere Fälle aus, den Temistocle von Johann Christian Bach und Mozarts