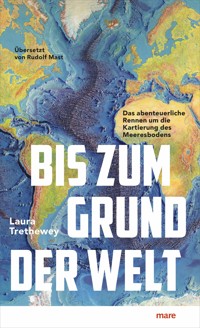
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Ozeane bedecken drei Viertel der Erde, doch noch bis Anfang 2020 waren kaum 25 Prozent ihres Grundes erforscht. Während die Menschheit zum Mars strebt, verbleibt so auf der Oberfläche unseres Planeten eine schier endlose Fläche unbekannten Terrains. Nun aber hat ein spektakuläres Rennen begonnen: Wissenschaftler, Investoren und private Abenteurer haben es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 die letzten weißen Flecken auf dem Globus zu kartieren. Mit Laura Trethewey folgen wir einer Reihe faszinierender Charaktere, die sich diesem Projekt verschrieben haben, und entdecken seine Chancen und Gefahren: Was wird uns der Grund der Meere über den Ursprung des Lebens lehren? Welche Ressourcen liegen hier verborgen und wer wird sie beanspruchen? Und wie können wir schützen, was wir aus nachtschwarzer Tiefe ans Tageslicht befördern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Laura Trethewey
BIS ZUM GRUND DER WELT
Das abenteuerliche Rennen um die Kartierung des Meeresbodens
Aus dem amerikanischen Englisch
von Rudolf Mast
Für meine Mutter, deren Liebe tiefer ist als der Marianengraben
INHALT
VORWORT
Kapitel 1 EXPEDITION IN DIE TIEFE
Kapitel 2 SCHIFF GESUCHT
Kapitel 3 AM GRUND DES ATLANTIKS
Kapitel 4 MARIE THARP UND DIE KARTE, DIE DIE WELT VERÄNDERTE
Kapitel 5 DER EINSAMSTE OZEAN DER WELT
Kapitel 6 BENENNEN UND BESITZEN
Kapitel 7 DATENSAMMLUNG FÜR EINE KARTE DER ARKTIS
Kapitel 8 ROBOTER AUF SEE
Kapitel 9 BEGRABENE GESCHICHTE
Kapitel 10 BERGBAU IN DER TIEFE
Kapitel 11 BIS ZUM GRUND UND WEITER
NACHWORT
DANK
LITERATUR
ANMERKUNGEN
VORWORT
Ein Hydrograf erzählte mir einst, wie seine Einstellung zur Vermessung des Meeresbodens von einem Schwamm ins Wanken gebracht wurde – keinem gewöhnlichen Haushaltsschwamm, sondern einem sonderbaren Tiefseeschwamm, der zu den ältesten Lebensformen auf der Erde zählt.
Der Mann arbeitet auf einem Forschungsschiff namens Nautilus und verbringt seine Tage damit, den Meeresboden zu erkunden. Heute ist etwa ein Viertel des Meeresbodens kartiert, weniger als ein Prozent ist mit ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen, kurz ROV, erkundet worden, wie sie sich auch an Bord der Nautilus finden. Ein solcher Tauchroboter ist so groß wie ein Auto und mit Sensoren, Scheinwerfern und Videokameras ausgerüstet. Letzteren verdankt Renato Kane seine erste Begegnung mit dem Schwamm, die sein Denken umkrempeln sollte.
Kane arbeitet seit mehr als zehn Jahren auf der Nautilus, und in dieser Zeit hat er viele Tauchgänge erlebt, bei denen der Tauchroboter über den Meeresgrund gestrichen ist, Sedimente aufgelesen, neue Arten entdeckt, befremdliche tierische Verhaltensformen beobachtet, schillernde hydrothermale Quellen passiert und in Großaufnahme Bilder von Lebewesen geliefert hat, die sich in Tiefseekorallen verbergen. Kane kann von Glück sagen, dass er diesen Job hat, und dessen ist er sich sehr wohl bewusst, aber nach einer gewissen Zeit wird jede Aufgabe zur Gewohnheit. Von Zeit zu Zeit
aber wird die Routine durchbrochen, weil etwas der Erkundung des Meeresbodens einen tieferen Sinn verleiht. So wie jener Schwamm, den er auf dem Grund des Pazifischen Ozeans gesehen hat.
Der grauweiße Schwamm, der an diesem Tag vor der Kamera des Tauchroboters der Nautilus erschien, war riesig, gut und gern so groß wie das ROV selbst. Und er musste Hunderte Jahre alt sein, vermutete Kane, vielleicht sogar tausend. Tiefseeschwämme wachsen extrem langsam. Der Monorhaphis chuni wird bis zu elftausend Jahre alt und treibt dornenartige Skelettnadeln aus, die bis zu zwei Meter lang werden. Was es mit dieser enorm langen Lebensdauer auf sich hat, ist noch nicht geklärt, aber weil viele Lebewesen der Tiefsee ein hohes Alter erreichen, wird vermutet, dass es mit den Lebensbedingungen auf dem Meeresgrund zu tun hat, die von Dunkelheit, Kälte und Mangel bestimmt sind. Und dieses unbegreiflich lange Leben des Schwamms sah Kane plötzlich an sich vorbeiziehen. Das Tier, das meist für eine Pflanze gehalten wird, hatte über Jahrhunderte an einem Fleck gesessen, während Kriege wüteten, Pandemien und Propheten kamen und gingen, Weltreiche entstanden und untergingen, hatte an der Stelle ausgeharrt, Tausende Meter unter der Meeresoberfläche, und sein ganzes Leben lang nichts als dunkles, kaltes, unbewegtes Wasser kennengelernt. In der Abgeschiedenheit unter der kilometerdicken Wassersäule des Ozeans verläuft das Leben eines Tiefseeschwamms, vergleicht man es mit dem eines Menschen, unvorstellbar gleichförmig. Er lebt in vollständiger Dunkelheit, Druck und Temperatur sind konstant, eine Strömung ist in diesen Tiefen kaum zu spüren – bis eines Tages eine große, hell blinkende Maschine aus der Dunkelheit auftaucht, ihn anglotzt, weiterzieht und den Schwamm zurücklässt, der im Kielwasser des Roboters leicht schwankt. In dieser kurzen Begegnung übernimmt der Mensch die Rolle des Außerirdischen, der eine andere Welt besucht, ohne die Erde zu verlassen.
Nachdem er den Schwamm passiert hatte, setzte der Tauchroboter seine Arbeit unbeirrt fort. Kane konnte das nicht. Der Gedanke an diesen einzigartigen Moment ließ ihn nicht los. Die Tiefseeforscherin Sylvia Earle beschreibt es so: »Wenn man an einer beliebigen Position einen Stein in den Ozean wirft, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit an einer Stelle landen, an der noch kein Mensch war.«1
Dieser Tauchgang, mehr noch alle Tauchgänge, die Kane über die Jahre auf der Nautilus miterlebt hatte, begannen schwer auf ihm zu lasten. Zwar werden sie alle aufgezeichnet und archiviert, aber das Schiff würde nie wieder an die entsprechenden Stellen zurückkehren. »Das, was du in diesem Moment siehst, wird nie wieder jemand sehen«, so erklärt Kane mir später.
Wir saßen im Datenraum der Nautilus, die entlang der Küste von Kalifornien Richtung Norden fuhr. Die Bullaugen an den Wänden erinnerten an Waschmaschinen im Spülgang. Brodelnde Wellen schlugen gegen das Glas und ließen erahnen, wie stürmisch das Wetter draußen war. Der Raum selbst wurde von Bildschirmen dominiert: Computermonitore vor einem halben Dutzend Rechner und Videomonitore, die eine ganze Wand bedeckten. Auf jedem von ihnen trafen in Echtzeit Daten aus der Wasserwelt draußen ein: neue Karten vom Meeresgrund, neue Erkenntnisse und Datensätze, die auszuwerten und zu verstehen die Fachleute Jahre kosten würde. Die Erkundung des Ozeans ist einer jener heute selten gewordenen Bereiche der Wissenschaft, in denen bahnbrechende Erkenntnisse meist zufällig gewonnen werden. Darin liegt die Last, aber auch die Lust daran, Meeresforschung zu betreiben: Was auch immer einen in der Tiefsee erwartet, könnte etwas Neues sein.
Und noch harrt so viel Neues der Entdeckung.
»Über die Oberfläche des Mondes wissen wir mehr als über den Grund des Ozeans.« Dieser oder ein ähnlich formulierter Satz steht in nahezu jedem Artikel, den man heute über die Tiefsee lesen kann. Als Journalistin, deren Schwerpunkt der Ozean ist und die deshalb sehr viel über Meeresthemen schreibt und liest, ist er mir so oft begegnet, dass ich das Zählen aufgegeben habe. Mitunter wird der Mond gegen den Mars oder einen anderen Himmelskörper ausgetauscht, aber meist wird die Behauptung wörtlich übernommen, ohne dass Gründe angeführt würden. Wann immer ich dem Satz begegne, frage ich mich daher, warum: Warum wissen wir so wenig über den Ozean? Und woran liegt es, dass wir andere Planeten besser kennen als unseren eigenen?
Wer sich wie ich mit dem zitierten Satz ein wenig länger befasst, wird feststellen, dass er sich weniger auf den Meeresboden selbst als vor allem auf dessen Vermessung bezieht – obwohl auch unser Wissen um die Tiefsee als Lebensraum und dessen Geschichte ausgesprochen dürftig ist, wenn man es damit vergleicht, was wir über das Leben an Land wissen. Die beste, weil umfassendste Karte, die wir vom Ozean haben, stammt aus Satellitendaten, und die Auflösung ist so gering, dass komplette unterseeische Berge fehlen. Die Topografie des Mondes, von Mars und Venus und anderen Himmelskörpern wird längst mit deutlich höherer Auflösung vermessen als der Meeresboden der Erde. Ein Ergebnis dieser Vernachlässigung ist, dass die Fläche des Meeresbodens, die es noch zu kartieren gilt, in etwa doppelt so groß ist wie die Fläche aller Kontinente zusammengenommen.
Im Jahr 2017 entstand in Zusammenarbeit der Vereinten Nationen und der privaten Nippon Foundation ein Projekt mit der Bezeichnung Seabed 2030, das sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum namensgebenden Zeitpunkt eine vollständige Karte des Meeresbodens aller Ozeane zu erstellen. Unter der Leitung eines zusammengewürfelten Haufens von Hydrografen aus aller Welt nahm sich Seabed 2030 zum Ziel, Schiffe, die, vom Kreuzfahrtschiff bis zur Luxusjacht, ohnehin auf den Weltmeeren unterwegs sind, dazu anzuhalten, relevante Daten zu sammeln und zu übermitteln. Parallel sollten neue autonome Technologien genutzt werden, um den Meeresgrund mithilfe von Drohnen zu vermessen. Hinter allem steht die Hoffnung, an einem Wendepunkt in der Geschichte, an dem die Erde aufgrund des Klimawandels eine Reihe von miteinander zusammenhängenden Krisen durchlebt, dank Seabed 2030 eine Karte erstellen zu können, die uns dabei hilft, uns selbst und den Planeten zu bewahren. Dann müssten wir auch nie wieder lesen, dass wir den Mond besser kennen als den Ozean, und uns fragen, warum das so ist – denn endlich wäre die Karte vollständig.
Von der Vorstellung elektrisiert, heftete ich mich an die Fersen von Seabed 2030 und stellte sehr bald fest, dass es gute Gründe dafür gibt, dass der Meeresgrund noch nicht kartiert ist. Der erste und naheliegendste: Der Ozean ist riesig. Er bedeckt 71 Prozent der Erdoberfläche. Und doch ist es nicht leicht, Menschen, die auf den verbleibenden 29 Prozent leben, anschaulich zu machen, wie groß 71 Prozent tatsächlich sind. Sie sind unermesslich groß – so groß, dass es unseren Verstand übersteigt. Unser Planet besteht zum allergrößten Teil aus einem ebenen blauen Meer, und damit ist nur die Oberfläche beschrieben. Im Durchschnitt ist dieser Ozean vier Kilometer tief – also ungefähr zehnmal so tief, wie das Empire State Building in New York hoch ist.2 Die fünf Ozeanbecken enthalten zusammen mehr als 1,3 Milliarden Kubikkilometer Salzwasser, die 99 Prozent des bewohnbaren Raums der Erde ausmachen. Auf diese Unterwasserwelt werden die meisten von uns nie auch nur einen Blick werfen.
Der Ozean ist aber auch, um es vorsichtig zu sagen, ein gnadenloses Arbeitsumfeld. Der Hydrograf, der den Meeresgrund vermessen will, sieht sich einer Vielzahl von Widersachern gegenüber. Zunächst einmal benötigt man ein mit Diesel betriebenes Vermessungsschiff, spezielle Fachkenntnisse und ein teures, für die Tiefsee geeignetes Echolot. Auf dem Meer muss man gegen Wind, Wasser, Wellen, Sonne und Salz ankämpfen, die der Ausrüstung zusetzen und das Personal auf eine harte Probe stellen. Derweil tut sich unter einem ein Paralleluniversum auf, in dem ewige Dunkelheit, eisige Kälte und ein Druck herrschen, der Knochen brechen lässt. In meiner Zeit an Bord der Nautilus beispielsweise war das Wetter so schlecht, dass wir gerade mal ein Gebiet von der Größe Rhode Islands kartieren konnten, bevor wir umdrehen mussten. In Regionen wie dem riesigen, weitgehend unkartierten Südlichen Ozean rund um die Antarktis bekommt man es regelmäßig mit Wellen zu tun, die so hoch sind wie Wolkenkratzer.
All das macht die Vermessung des Meeresbodens zu einem sehr, sehr teuren Unterfangen. Seabed 2030 veranschlagt die Kosten für das selbstgesteckte Ziel auf drei bis fünf Milliarden Dollar. (Zum Vergleich: Die Marsmission, die 2020 begann und mit der Landung des Rovers Perseverance auf dem Roten Planeten endete, verschlang in etwa dieselbe Summe.3) Je weiter sich Vermessungsschiffe der Küste nähern, desto komplexer wird das Kartieren – und desto komplizierter die Politik. Wer umstrittene Seegebiete kartieren will, betritt ein geopolitisches Minenfeld. Auch wenn Seabed 2030 ausschließlich wissenschaftliche Ziele verfolgt, empfinden viele Staaten das Eindringen in ihr Hoheitsgebiet als Verletzung ihrer Souveränität oder, anders formuliert, als Spionage. Zu den Hindernissen gehören auch Konflikte mit dem Naturschutz. Die Vermessung des Meeresbodens erfolgt in den meisten Fällen mit hochmodernen Fächer- oder Multibeam-Echoloten. Von der Handelsschifffahrt über Marineübungen bis hin zur Suche nach und der Erschließung von Öl- und Gasquellen – der zunehmend industrialisierte Ozean ist ein akustischer Albtraum für Wale und andere Meerestiere, die ein extrem empfindliches Gehör haben, von dem letztlich ihr Überleben abhängt. Sollen wir dem Lärm, der schon jetzt in unseren Meeren herrscht, wirklich weiteren hinzufügen?
In diese Fragen tauchte ich während einer Reise auf der Nautilus ein, die der Kartierung diente. Ich sprach mit Dutzenden Hydrografen aus aller Welt. Ich besuchte Konferenzen, Vorlesungen und internationale Treffen, auf denen neue Namen für Berge und Täler vergeben wurden, die kurz zuvor gefunden worden waren. Ich flog in ein abgelegenes arktisches Dorf, um zu beobachten, wie Inuit unkartierte Küstenlinien erfassen. Ich tauchte im Golf von Mexiko und lernte Karten des Meeresbodens kennen, die Archäologen auf die Spur von Überresten der frühen Menschheitsgeschichte führten. Ich lief in der Nähe von San Francisco durch einen Flugzeughangar voller Drohnen zur Vermessung des Meeresbodens.
Die Geschichte der Kartierung wirft eine weitere beunruhigende Frage auf. Was passiert, wenn Seabed 2030 ein Erfolg wird? Aus der Geschichte des Kolonialismus wissen wir nur zu genau, dass eine Karte kein neutrales Hilfsmittel ist. Oder wie der Journalist Stephen Hall einst schrieb: »Eine Karte ist stets die Ankündigung einer Form der Ausbeutung.« Dieser Satz folgte mir bis Jamaika, wo ich Zeugin wurde, wie die Regierungen der Welt Regeln und Bestimmungen für den Rohstoffabbau am Meeresgrund diskutierten. Die umfassende Industrialisierung des Planeten hat nun auch das letzte bislang verschonte Ökosystem der Erde in den Blick genommen – ebnen die Karten den Weg dorthin?
Einer Wahrheit bin ich mir sehr deutlich bewusst geworden, während ich neben Renato Kane auf der Nautilus saß: Wir sind heute in der Lage, den kompletten Ozean zu vermessen. Mehr noch: Die Geräte und die Technologie stehen uns schon seit Jahrzehnten zur Verfügung. Warum haben wir es nicht getan? Diese Frage führt zurück zu dem Satz, der am Anfang meiner Entdeckungsreise stand: Wir kennen die Oberfläche des Mondes besser als den Grund des Ozeans. Es ist ein Klischee, und doch klingt es in einer Zeit, in der eine neue Phase der Erforschung des Weltalls ansteht, besonders glaubhaft. Die NASA hat zig Milliarden Dollar in das Artemis-Programm gesteckt, um Astronauten auf den Mond und nach Möglichkeit auch auf den Mars zu bringen.4 Unterdessen droht eine unentdeckte Welt unter Wasser in Vergessenheit zu geraten.
Kapitel 1 EXPEDITION IN DIE TIEFE
1.
Es war die sonderbarste Stellenbeschreibung, die Cassie Bongiovanni je gelesen hatte, und in letzter Zeit hatte sie wahrlich viele gelesen. Die begabte, fünfundzwanzig Jahre alte Studentin der Hydrografie an der Universität von New Hampshire stand wenige Wochen vor ihrem Masterabschluss und sondierte auf der Suche nach ihrer ersten Anstellung den Markt. Ihr kam es vor, als führten sämtliche Kommilitonen, die mit ihr am Zentrum für Küsten- und Tiefseekartierung (CCOM) studierten, ständig Bewerbungsgespräche, wenn sie nicht schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche hatten.
»Offen gestanden bekam ich Panik«, so Cassies Erinnerung. »Das Studium ist so hoch angesehen, dass nahezu jeder, der es erfolgreich abschließt, im Handumdrehen einen Job findet. Ich wollte nicht diejenige sein, der das nicht gelingt.«
Dann traf eine E-Mail in ihrem Postfach ein, weitergeleitet vom Freund einer Freundin, der in der NOAA arbeitete, der nationalen Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA. Gesucht wurden »qualifizierte Personen«, die, wie es etwas kryptisch hieß, bereit wären, für 110 Tage an Bord eines Schiffes zu gehen und mithilfe eines Sonarsystems Vermessungen vorzunehmen. Um welches System es sich handelte, ging daraus ebenso wenig hervor wie die Region, in der die Vermessungen stattfinden, oder welchem Zweck die so entstehenden Karten dienen sollten. Aber die Mail erreichte Cassie Bongiovanni in einem Moment, in dem ihr die Angst vor der Zukunft nicht allzu viel Wahl ließ.
Das war im Herbst 2018, zu einer Zeit also, in der an Jobs in der »Meereswirtschaft« kein Mangel herrschen sollte, nachdem die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für den Wirtschaftsraum Meer eine Phase beispiellosen Wachstums und entsprechender Investitionen vorausgesagt hatte.1 Der wirtschaftliche Ertrag, den die Ozeane abwerfen, würde sich von 1,5 Billionen Dollar im Jahr 2010 auf mehr als drei Billionen Dollar im Jahr 2030 verdoppeln. Dieses Wachstum würden nicht allein die traditionellen Akteure generieren, die auf den Weltmeeren aktiv sind – die Schifffahrt, die Fischerei sowie die Förderung von Öl und Gas –, sondern auch neue Mitspieler wie Windkraft, Aquakultur, maritime Biotechnologie und Rohstoffabbau. Diese Neueinsteiger brachten viel Geld und große Träume mit. Und fast alle waren auf Fachleute wie Cassie Bongiovanni angewiesen.
Nicht nur die Wirtschaft zeigte vermehrtes Interesse am Meer. Nach Jahren schwindender öffentlicher Investitionen und niederschmetternder Berichte über den Zustand der Meere hatte für die Meeresforschung unvermittelt ein Goldenes Zeitalter begonnen. In den späten Nullerjahren und zu Beginn des neuen Jahrzehnts hatten einige prominente philanthropische Milliardäre entsprechende Forschungseinrichtungen gegründet und hochmoderne Schiffe bauen lassen. Ray Dalio, der Chef von Bridgewater Associates, des größten Hedgefonds der Welt, gründete in dieser Zeit OceanX, eine Meeresforschungseinrichtung mit angeschlossener Medienproduktion. Eric Schmidt, früher Chef von Google, und seine Frau Wendy hoben das Schmidt Ocean Institute aus der Taufe und erwarben ein Schiff, das sie Falkor nannten. Für den Namen stand der Glücksdrache aus der englischen Ausgabe von Die unendliche Geschichte Pate. Paul Allen, Mitbegründer von Microsoft, und Marc Benioff, Chef der Firma Salesforce, stifteten an mehreren Universitäten der Westküste Studiengänge für Meeresforschung. Die reichsten Menschen der Welt steckten plötzlich Unsummen in die Erforschung des Ozeans.
Auch die internationale Gemeinschaft blieb nicht untätig. Im Jahr 2017 erklärte die Vollversammlung der Vereinten Nationen den Zeitraum von 2021 bis 2030 zur Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung. Noch im selben Jahr wurde Seabed 2030 mit dem Ziel gegründet, bis zum Ende des folgenden Jahrzehnts sämtliche Weltmeere zu vermessen – ein ambitioniertes Vorhaben, das die Menschheit seit mehr als viertausend Jahren vor sich herschiebt. Nun kündigte Seabed 2030 an, es in nur dreizehn Jahren zum Abschluss zu bringen.
Als Cassie Bongiovanni ihrem Abschluss als Hydrografin an einer der wichtigsten Universitäten des Landes entgegensah, hatten also Regierungen, Ökonomen und illustre Milliardäre gleichermaßen den Ozean für sich entdeckt. In dem entstehenden Wirtschaftszweig sollte sich eine Anstellung für sie finden. Es gab ein paar Kontakte, ein paar Telefonate, sogar einige Gespräche, die recht verheißungsvoll verliefen und doch zu nichts Greifbarem führten. Mit ihrem Studium hatte sie 2016, also zwei Jahre zuvor, begonnen. Damals wurde der Anteil des kartierten Meeresbodens auf etwa fünfzehn Prozent geschätzt. Es gab also noch alle Hände voll zu tun. Nun musste sich nur jemand finden, der ihr eine Chance gab.
Die besagten fünfzehn Prozent kartierten Meeresbodens befinden sich in der Hauptsache in Küstennähe. Nationale Regierungen sind aufgrund internationaler Abkommen dazu verpflichtet, ihre Hoheitsgewässer zu vermessen. In internationalen Gewässern hingegen ist die Kartierung überaus lückenhaft. Auf den detailliertesten Karten, über die Seabed 2030 verfügt, sind die Kontinente durch dünne Vermessungslinien verbunden, die ein Schlaglicht auf winzige Flecken des Meeresbodens werfen, während der große Rest in Dunkelheit versinkt. Die Linien entsprechen in der Regel den Routen der Handelsschifffahrt, auf denen gut 95 Prozent des internationalen Warentransports abgewickelt werden, oder sie zeigen an, wo die großen Unterseekabel verlaufen, die gut neunzig Prozent der weltweiten Datenübertragung übernehmen.2 In manchen Regionen, so im Golf von Mexiko vor der Küste von Louisiana oder in der Großen Syrte vor Libyen, ist der Meeresgrund gründlich vermessen, weil unter dem urzeitlichen Schlick fossile Brennstoffe lagern. Doch über dem Großteil des internationalen Meeresbodens liegt ein Schleier der Dunkelheit. Darunter verbirgt sich das letzte große Rätsel dieser Welt.
Beim Blick auf die E-Mail und deren sonderbare Suche nach Hydrografen spürte Cassie, wie die ungewisse Zukunft auf ihr lastete. In nur wenigen Wochen würde sie ihre Masterarbeit verteidigen. Anschließend wäre sie in rascher Folge damit konfrontiert, dass ihr Studium und damit auch die studentische Krankenversicherung beendet wäre, sie aus dem Wohnheim ausziehen und vermutlich bei ihren Eltern in Dallas unterkommen müsste, was sich wie eine Niederlage anfühlte. Was hatte sie denn zu verlieren? Sie verfasste eine Antwort, hängte ihren Lebenslauf an und drückte auf »Senden«.
Sich selbst beschreibt Cassie als schüchtern, ihre Stärken sieht sie im Planen und Organisieren. Sie hat große braune Augen, hohe Wangenknochen und ein gewinnendes Lächeln. Das lange braune Haar bindet sie meist zu einem Dutt oder einem französischen Zopf. Auf den ersten Blick mag sie zurückhaltend oder gar zugeknöpft wirken. Doch sehr bald erweist sich, dass ihr Sinn für Humor, ihr Einfühlungsvermögen und ihre Intelligenz gleichermaßen ausgeprägt sind. Und sie ist durch und durch das, was man einen Millennial nennt: Sie hält sich für »total verpeilt«, reißt Witze über Pokémon GO (die ich nicht verstehe) und überraschte mich einmal mit einer Anspielung auf den Film Save the Last Dance von 2001 mit Julia Stiles (damit konnte ich etwas anfangen).
»Und warum ich?«, fragte sie in ihrer charakteristischen zurückhaltenden Art, als ich den Kontakt zu ihr aufnahm. Wird mir diese Frage gestellt, weiß ich als Journalistin, dass ich auf eine Goldader gestoßen bin. Die Cassies dieser Welt interessieren mich besonders, die Menschen, die im Hintergrund wirken, im Verborgenen, die für ausgeschlossen halten, dass sie etwas Interessantes zu erzählen haben könnten. Tatsächlich erweisen sie sich meist als privilegierter Zugang zur Wahrheit.
Nun gelten jene Forscher und Abenteurer, die sich dem Ozean verschrieben haben, nicht gerade als Ausgeburt an Bescheidenheit. Und auch das nahm mich für Cassie Bongiovanni ein: Sie gibt nicht vor, die einzige rechtmäßige Erbin von Roald Amundsen zu sein, die darauf brennt, den Südpol zu erreichen, sie hält sich auch nicht für einen zeitgenössischen Kapitän Nemo.3 Und sie zählt auch nicht zu jenem elitären Zirkel, dessen Mitglieder heute die Weltmeere erkunden, wie beispielsweise Ray Dalio und der Regisseur James Cameron, die ganze Teams hinter sich scharen, um ihrer Leidenschaft zu frönen. 2018 aber war sie im Begriff, etwas Außergewöhnliches zu tun, etwas, das in der langen und verwickelten Geschichte der Meeresforschung noch niemand getan hatte.
Wenn Cassie über die Vermessung des Meeresbodens spricht, darüber, wie es sich anfühlt, etwas zu sehen, was zuvor noch niemand gesehen hat, dann höre ich in ihrer Stimme jene Neugier, die für jede Form von Forschung unerlässlich ist.
Aufgewachsen in Dallas, weit weg von jedem Meer, dafür zwischen Förderpumpen, begann Cassie früh, sich für die Erde zu interessieren. So kam sie zu einem Bachelorabschluss in Geologie – im ölreichen Texas ein ziemlich normaler Werdegang, wie sie selbst meint. Im Sommer flüchtete die Familie aus der Stadt an die Küste. Meist ging es mit dem Auto Richtung Nordosten, um Verwandte in New Jersey zu besuchen. Dort war es auch, wo Cassie eine Eingebung hatte: Sie liebte das Meer durchaus, aber »mir war nicht bewusst, dass es außer Meeresbiologie irgendein Fachgebiet gab, das sich mit dem Ozean befasst«. Doch in der zweiten Hälfte ihres Bachelorstudiums nahm sie an einer Einführungsveranstaltung für Ozeanografie teil und erfuhr, dass sie sich auf die Geologie jenes Teils der Erde spezialisieren konnte, der unter Wasser lag. Je intensiver sie sich mit der Ozeanografie befasste und je mehr entsprechende Kurse sie belegte, desto klarer wurde ihr, dass die Vermessung des Meeresbodens eine Möglichkeit bot, ihre Liebe zum Meer und zur Erde zu kombinieren und daraus einen Beruf zu machen.
Noch am selben Tag, an dem sie ihre Bewerbung abgeschickt hatte, klingelte ihr Telefon. Ein Mann mit neuseeländischem Akzent stellte sich als Rob McCallum vor und legte mit den Worten los: »Ich würde Ihnen gern etwas über Five Deeps erzählen.«
2.
Während Cassie auf der Suche nach einem Job war, suchte Victor Vescovo nach der nächsten großen Herausforderung. Auch Victor stammt aus Dallas, und wie Cassie hat er italienische Wurzeln. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber auch schon. Victor Vescovo hatte als Investor ein Vermögen gemacht und, wenn er nicht gerade für die U. S. Navy als Nachrichtenoffizier aktiv war, sein Geld dafür verwendet, sich als moderner Abenteurer zu betätigen. Er absolvierte erfolgreich den Explorers Grand Slam, wofür er die jeweils höchsten Berge aller Kontinente besteigen sowie per Ski den Nord- und den Südpol erreichen musste. Er besitzt einen Helikopter und ein Flugzeug sowie die entsprechenden Fluglizenzen. Anders, als man erwarten könnte, sieht er aber weder aus wie der adrenalingetriebene texanische Finanzmann, noch spricht er so. Er hat taubenblaue Augen, einen blassen, fast weißen Teint und langes, aschblondes Haar, das er zu einem Pferdeschwanz bindet. Seine Stimme klingt sanft und nachdenklich, aber wenn es um Militärgeschichte oder Science-Fiction geht, kann die Begeisterung schon mal mit ihm durchgehen. Er wirkt wie jemand, der sich in seinem Leben noch nie gelangweilt hat. Nun hatte er sich in den Kopf gesetzt, der erste Mensch zu werden, der die tiefsten Stellen aller fünf Weltmeere erreicht.
Die Idee reifte allmählich. Im Laufe der Nullerjahre – Victor diente einer Firma als Vorstandsvorsitzender und drei weiteren als Aufsichtsrat – hatte er begonnen, nach einem neuen Abenteuer Ausschau zu halten, dem er sich stellen könnte.4 Für das Bergsteigen wurde er allmählich zu alt, aber der Hunger nach einer neuen Herausforderung war geblieben. Es musste nur etwas sein, wofür mehr Hirn als Muskeln nötig war. Über die Jahre hatte er aufmerksam die Rekordversuche des britischen Geschäftsmanns Richard Branson und dessen Versuch verfolgt, zu den tiefsten Stellen aller fünf Ozeane zu tauchen.
Nach einer Serie technischer Pannen sah sich Branson gegen Ende des Jahres 2014 gezwungen, die sogenannten Five Dives aufzugeben.5 Zu den gravierenden Problemen, denen er sich gegenübersah, gehörte, dass die transparente Kuppel seines eigens entworfenen Tauchboots bei einer Simulation unter dem Druck, der einige Kilometer unter der Wasseroberfläche herrscht, nachgab. Ein platt gedrücktes Tauchboot könnte den Gedanken aufkommen lassen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, zu den tiefsten Stellen der Welt zu tauchen. Victor aber interessierte vor allem, dass ein Weltrekord noch zu vergeben war.
»Das war 2014 oder 2015, und ich dachte: ›Du machst Scherze! Kein Mensch war bisher auf dem Grund unserer Ozeane?‹«, so Victor. Er empfand es geradezu als persönliche Kränkung, dass die tiefsten Regionen des Planeten noch unerforscht waren. Und tatsächlich fällt auf, dass es kaum Menschen gibt, die sich der Erkundung der Tiefsee verschrieben haben. Der berühmteste Tauchgang fand 1960 statt, als ein Zwei-Mann-Team im Pazifischen Ozean, unweit der zu den USA zählenden Insel Guam, gut elf Kilometer tief tauchte. Dort treffen zwei tektonische Platten aufeinander, die ältere, verharschte und schwere Pazifische Platte schiebt sich unter die jüngere und leichtere Philippinische Platte. Diesem geologischen Kräftemessen verdankt sich der Marianengraben, mit ihm dessen tiefste Stelle: das Challengertief. Der Marianengraben erstreckt sich über 2540 Kilometer und reicht bis jenseits der 10000 Meter Tiefe. In dem ohnehin außergewöhnlich tiefen Graben befindet sich ein kleiner Spalt, der noch einen Kilometer tiefer ist: das Challengertief, der mit 10924 Meter tiefste Punkt des Ozeans.
Das Zwei-Mann-Team, bestehend aus dem US-Marineleutnant Don Walsh und dem Schweizer Ozeanografen Jacques Piccard, bestieg ein einfaches Unterwasserfahrzeug namens Trieste, tauchte ab und verbrachte zwanzig Minuten in maximaler Tiefe. Don Walsh bekannte später in Interviews, dass er erwartet hatte, eine wahre Flut an Expeditionen in die Tiefsee auszulösen. Aber fünfzig Jahre lang stieg niemand in das Challengertief hinab.
2012 tauchte der Filmregisseur James Cameron in das Challengertief und stellte dabei einen neuen Rekord für den tiefsten Solo-Tauchgang auf. Glatt lief diese Expedition allerdings nicht. Weil die Zeit drängte, startete Cameron mitten in der Nacht. Als er Stunden später zurück an die Oberfläche kam, konnte das Begleitschiff ihn nicht finden. Die Jacht des Milliardärs Paul Allen, die zufällig in der Nähe war, wurde herbeigerufen, um bei der Suche nach dem Regisseur zu helfen. Mehrere Funktionen seines Tauchbootes, der Deepsea Challenger, hatten während des Tauchgangs versagt – glücklicherweise keine lebenswichtigen. Dennoch sollte die Deepsea Challenger keinen weiteren Tauchgang erleben.6
Das Für und Wider einer Expedition auf den Grund des Marianengrabens abwägend, fielen Victor Vescovo ein paar Dinge ein, die ihm an diesem Unterfangen zusagten. Nach den höchsten Bergen auch die tiefsten Tiefen der Erde zu erreichen, war eines davon. (Was ihm ganz nebenbei einen weiteren Weltrekord einbringen würde: als erster Mensch die höchsten und die tiefsten Punkte der Erde zu erreichen.) Er mag vielleicht nicht reden und nicht aussehen wie ein Texaner, aber er denkt wie ein Texaner. »Ich stamme aus einer Kultur, in der man sagt: ›Wenn nicht ich, wer dann?‹ Man kann nicht alles der Regierung oder sonst wem überlassen. Also sagt man sich: ›Na gut, warum nicht ich?‹«
Victors wachsendes Interesse am Tiefseetauchen fiel zeitlich zusammen mit einem grundsätzlichen Wandel in der Forschung. Im 20. Jahrhundert wurden wissenschaftliche oder militärische Vorhaben, die der Erkundung unerforschter Regionen der Welt dienten, durch nationale Regierungen gefördert. Seit einiger Zeit aber machen sich die reichsten Menschen der Welt – fast alles weiße Männer – von Regierungen unabhängig und gründen private Forschungsinstitute und Explorationsgesellschaften. Kritische Stimmen wenden ein, dass Firmen wie Elon Musks SpaceX und Jeff Bezos' Blue Origin keinen Fortschritt darstellen, sondern eher einen Sprung nach hinten. Sie türmen Hindernisse auf, die nur die Reichen und jene, die sich mit ihnen einlassen, zu überwinden hoffen dürfen. Indem die Erkundung der Welt im 21. Jahrhundert privatisiert wird, wird sie dem immer ähnlicher, was sie im 19. Jahrhundert einmal war, als die soziale Schieflage, die aus der industriellen Revolution resultierte, zahllose Gentleman-Entdecker hervorbrachte, die genügend Zeit und Geld hatten, um ihrem neuen Hobby nachzugehen: dem Aufbruch ins Unbekannte.7
Über vier Jahre steckte Vescovo mehrere Millionen in das Unterfangen, an dem Branson gescheitert war: die fünf tiefsten Punkte der Erde zu erreichen. Der Mission verlieh er den Namen Five Deeps Expedition. Er kaufte ein Forschungsschiff. Er beauftragte die Firma Triton Submarines in Florida, ein innovatives Tauchboot zu bauen, und taufte es Limiting Factor. Er stellte einen Expeditionsleiter ein, den Neuseeländer Rob McCallum, der ein Team von Fachleuten mitbrachte, darunter den Meeresbiologen Alan Jamieson und die Meeresgeologin Heather Stewart.
Stewart entdeckte in dem schönen Plan, dem Five Deeps folgen sollte, schon sehr bald einen großen Haken: Noch wusste niemand, wo sich die tiefsten Stellen der Weltmeere genau befanden.8 »Für den Pazifik ist die Sache klar«, erklärte sie, weil »fast jeder weiß, dass es der Marianengraben ist, denn das Challengertief wurde mehrfach vermessen.« Der Südliche Ozean, um das andere Ende der Skala zu nehmen, ist ein gänzlich unbeschriebenes Blatt. Nur ein winziger Teil wurde bislang mit modernen Instrumenten vermessen, und Stewart vermutete, dass vielleicht ein Prozent des Süd-Sandwich-Grabens, der tiefsten Region des Südlichen Ozeans, brauchbar kartiert war. »Wo ist denn nun der tiefste Punkt des Südlichen Ozeans? Noch kannst du es dir aussuchen«, sagte sie lachend.
Und da kam Cassie Bongiovanni ins Spiel. So jedenfalls Rob McCallum in besagtem Telefonat. Würde sie sich Five Deeps als Chefhydrografin anschließen, dann wäre es ihr Job, die tiefsten Punkte auf dem gesamten Planeten zu finden.
3.
Nach dem Telefonat mit McCallum war Cassie, um es vorsichtig auszudrücken, regelrecht euphorisch. »In dieser Nacht habe ich kein Auge zugemacht«, sagte sie. »Ich musste immer an die Möglichkeiten denken, die sich mir boten. Die ganze Nacht lang habe ich mir vorgestellt, wie mein Leben aussähe, wenn ich an all diese großartigen Orte reisen könnte, während ich einer Arbeit nachgehe, die ich liebe.«
Cassie suchte die Website von Five Deeps auf, die eine schmucke Weltkarte zierte: die Ozeane in Schwarz, die Kontinente in Blau und die tiefsten Stellen im Atlantischen Ozean, dem Südlichen Ozean, dem Indischen Ozean, dem Pazifischen Ozean und dem Arktischen Ozean markiert. Der erste Tauchgang sollte im atlantischen Puerto-Rico-Graben stattfinden, die Fahrt dorthin über Puerto Rico und Curaçao führen. Anschließend, so der Plan, würde das Schiff Kurs Süd nehmen, bis eine Inselkette vulkanischen Ursprungs im Südlichen Ozean erreicht wäre. Zwischenhalte sollten in Uruguay und Grytviken eingelegt werden, einer abgelegenen Walfangstation in Südgeorgien, wo einst Sir Ernest Shackleton haltmachte, bevor er zu seiner schicksalhaften Reise in die Antarktis aufbrach. Weiter ginge es über Kapstadt in Südafrika und von dort aus in östlicher Richtung in den Indischen Ozean, wo ein Tauchgang in den Sundagraben erfolgen sollte. Zwischenhalte wären Indonesien und Osttimor. Anschließend sollte das Schiff nach Guam fahren, jener zu den USA gehörenden Pazifikinsel in unmittelbarer Nachbarschaft zum Marianengraben. Von dort aus ginge es wieder nach Norden, durch den Panamakanal zurück in den Atlantik und weiter zum Molloytief im Arktischen Ozean, dem fünften und letzten »tiefsten Punkt«. Enden sollte die Reise auf Spitzbergen.
Verliefe alles nach Plan, würde das Team ein glorreicher Empfang in der Royal Geographical Society in London erwarten. In etwas mehr als einem Jahr würde die Weltreise Cassie nicht nur zu Inseln führen, die so abgelegen waren, dass sie fast von der Weltkarte fielen, nicht nur in bezaubernde und quirlige tropische Städte mitten im Indischen und im Pazifischen Ozean, sondern sie auch zu einer Entdeckerin von Weltrang werden lassen. Eisberge und Pinguine erwarteten sie, buddhistische Klöster und Affen, einsame, auf hohen Bergen gelegene Burgen, Strände mit Unmengen an zerbrechlichen cremefarbenen Muscheln … und der Meeresboden.
»Ich bin ausgeflippt«, so Cassie. »Ich habe meine Eltern auf die Website gelotst, um ihnen zu zeigen, was mich erwartete«, berichtete sie mit einer Stimme, die vor Aufregung ganz schrill klang. Seit jeher überließ sie die Dinge nur ungern dem Zufall, und so hatte sie insgeheim eine Liste von Orten zusammengestellt, die sie eines Tages besuchen wollte. An viele davon würde Five Deeps sie führen. Und Victor Vescovo würde sie dafür, dass sie um die Welt reiste und ihrem Traumberuf als Hydrografin nachging, auch noch bezahlen. In ihrer Begeisterung klickte sie auf den Link, der zur Crewliste führte, woraufhin die Porträts von fünf älteren weißen Männern erschienen, für jede Leitungsposition einer. Das gab ihr zu denken. Mehr noch, es setzte ihr so sehr zu, dass sich Ernüchterung einstellte. Und damit war sie nicht allein.
Bei einer Konferenz für Meeresforschung hatte eine Wissenschaftlerin vehement beklagt, wie wenig divers Five Deeps aufgestellt war, und seither wollte diese Kritik nicht wieder verstummen.9 Als sie wieder an der Uni war, fragte Cassie ihre Freunde und Kommilitonen am CCOM, wie sie über das Jobangebot dachten. Das einhellige Echo lautete: »Willst du wirklich auf ein Schiff gehen, auf dem nur Männer sind? Ist denn nicht irgendwo zumindest eine einzige Frau erwähnt?« Cassies Bedenken waren eher professioneller Natur: Würden die älteren und erfahrenen Männer auf eine junge Frau von fünfundzwanzig Jahren hören, die frisch von der Uni kam?
Es gab aber noch mehr Warnsignale. Bei ihrem Telefonat mit McCallum war ihr schon nach wenigen Sekunden klar geworden, dass er von der Art der Kartierung, für die sie eingestellt werden sollte, nicht allzu viel verstand. McCallum mag eine spannende Figur mit vielen Verdiensten und Fähigkeiten sein. Er ist ein versierter Taucher, ein erfahrener Pilot und ein mit allen Wassern gewaschener Expeditionsleiter, der, um die Rolle auszufüllen, von den Aufgaben, die in seinem Team anfallen, wenn nicht alles, so doch vieles verstehen muss. Ein Hydrograf aber ist er nicht, und das war Cassie sehr schnell klar. Den ersten Hinweis hatte die Art und Weise gegeben, in der er über das Fächerecholot sprach, das Five Deeps unlängst angeschafft hatte. »Er sprach die ganze Zeit von dem ›Sonar‹, und das sagt niemand, der was davon versteht.«
»Ist Sonar denn falsch?«, erkundigte ich mich leicht verwirrt. (Immerhin hatte ich den Ausdruck während unseres Gespräches selbst benutzt.)
»Dass es ein Sonar ist, versteht sich von selbst, weil Schall die einzige Möglichkeit ist, Tiefen zu messen«, erklärte Cassie geduldig. In der Welt der Hydrografie verwenden die Menschen eher Firmennamen und Modellnummern, um die Leistungsfähigkeit eines Sonars anzugeben. »Also habe ich McCallum gefragt: ›Wissen Sie, welches Sonar Sie verwenden?‹ Er erwiderte: ›Kongsberg.‹ Daraufhin fragte ich nach: ›Ein Zwölf-Kilohertz-Gerät also?‹ Woraufhin er zugab: ›Ich weiß es nicht, aber ich schicke Ihnen die Dokumentation.‹« Cassie war beunruhigt. Was, wenn sie den Job annahm und mitten auf einem Ozean auf einem Schiff festsaß und niemand außer ihr begriff, dass sie etwas versuchte, was noch nie zuvor ein Mensch gemacht hatte? Der Gedanke war nicht sonderlich ermutigend.
4.
Cassies bevorzugte Weise, den Menschen vor Augen zu führen, wie wenig wir über den Meeresboden wissen, besteht darin, auf ihrem Computer die Kartiersoftware zu öffnen und die Weltkarte auf das zu reduzieren, was wir über den Meeresboden wissen. »So lässt sich auf einen Blick erkennen, warum es so wichtig ist, den Meeresboden zu vermessen«, erklärte sie lachend, als sie mir eines Tages per Zoom den Effekt vorführte. »Da ist einfach nichts. Das ist der Grund. Deshalb ist es so wichtig. Weil wir nichts wissen.« Und tatsächlich war die Wirkung erstaunlich. Von einem Augenblick zum anderen verwandelte sich die Karte einer prallen dreidimensionalen Darstellung von Unterwasserbergen, Gräben und Schluchten in eine unbeschriebene leere Fläche, und das insbesondere in Regionen außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer.
Cassie hat die Erfahrung gemacht, dass die Menschen oft überrascht sind, wenn sie hören, dass die Ozeane noch nicht vermessen sind. Immerhin befinden wir uns im 21. Jahrhundert, und der Menschheit sind weitaus beeindruckendere Dinge gelungen, darunter die Landung eines Roboters auf dem Mars und die Entschlüsselung des genetischen Codes. Weltkarten erwecken den Eindruck, dass der Planet vollständig vermessen ist. Wenn ich als Kind mit dem Finger über einen sich drehenden Globus gefahren bin, konnte ich die kleinen Erhebungen fühlen, die für die Rocky Mountains in Nordamerika oder den Himalaja in Asien standen. Der Ozean aber war eine ebene blaue Fläche. Damals dachte ich mir nichts dabei, dass die reliefartigen Konturen dort endeten, wo das Meer begann. Ging ich davon aus, dass die glatte Fläche die Wasseroberfläche darstellte? Wahrscheinlich habe ich nicht einen Moment lang darüber nachgedacht. Heute empfinde ich es als Selbstverständlichkeit, dass sich das spektakuläre Auf und Ab unter Wasser fortsetzt.
Wenn Cassie gefragt wird, womit sie ihr Geld verdient, fällt ihr die Antwort nicht leicht. »Ich muss den Menschen immer erklären, dass der Ozean noch nicht vermessen ist.« Die Reaktionen sind eher ungläubig, weil schon ein kurzer Blick auf Google Maps das Gegenteil zu sagen scheint. Diese Karten stammen allerdings nicht von Kartografen, sondern von Satelliten, die um die Erde kreisen und dabei unaufhörlich Daten über die Meeresoberfläche und die Erdanziehungskraft sammeln.10
Die Untersuchung der Meeresoberfläche ist eine »zuverlässige Art von Schädellehre«, schreibt der Wissenschaftsjournalist Robert Kunzig11, weil sie Hinweise darauf liefert, wie es auf dem Grund des Meeres aussieht. Genügend Messungen vorausgesetzt, können Satelliten Senkungen und Anhebungen des Meeresspiegels präzise lokalisieren, was Rückschlüsse darauf erlaubt, dass sich nicht allzu weit entfernt eine Schlucht oder ein Berg befinden muss. Im Normalfall steigt der Wasserspiegel über einem unterseeischen Berg an, während er über einer Schlucht sinkt, und der unterschiedliche Wasserstand wiederum hat eine unterschiedliche Erdanziehungskraft zur Folge. »Die meisten Menschen reagieren ungläubig, wenn ich ihnen sage, dass der Wasserstand in den Weltmeeren nicht überall gleich ist«, so Cassie.
Wenn der Globus meiner Kindheit die Welt so gezeigt hätte, wie sie ist, wäre er nicht rund gewesen, sondern ein unförmiger Ball, auf dem als Erstes das System aus mittelozeanischen Rücken auffallen würde, ein unterseeischer Gebirgszug, der sich über den kompletten Planeten zieht. Mit 65000 Kilometer Länge prägt er die Erde wie kein anderes natürliches Gebilde. Allerdings entzieht er sich unserem Blick, weil er unter einer durchschnittlich vier Kilometer dicken Schicht aus Meerwasser liegt. Nur an wenigen Stellen reicht der mittelozeanische Rücken bis an die Wasseroberfläche, so in Island, wo er tiefe Täler in die Landschaft geschnitten und feuerspuckende Vulkane aufgeworfen hat. Die höchsten Unterwasserberge finden sich nicht im mittelozeanischen Rücken, dafür aber die tiefen Gräben, in die Victor Vescovo hinabtauchen wollte: der Marianengraben im Pazifik, der Puerto-Rico-Graben im Atlantik, der Sundagraben im Indischen Ozean, das Molloytief im Arktischen Ozean sowie der Süd-Sandwich-Graben im Südlichen Ozean.
Der tiefste dieser Gräben, der Marianengraben, misst fast elf Kilometer, womit er jeden Berg an Land bei Weitem übertrifft. Der Mount Everest, um den höchsten zu nennen, fände im Marianengraben nicht nur problemlos Platz, es blieben immer noch fast zwei Kilometer Wasser darüber. Der Boden dieses Abgrunds ist von Ablagerungen bedeckt, die so fein und schwerelos sind wie Staub. Die Senken nehmen mehr als die Hälfte der Erdoberfläche ein und sind größer als alles Grün- und Weideland der eurasischen Steppe zusammengenommen, die sich immerhin von Ungarn bis zur Ostgrenze Chinas erstreckt.12 Hier häuft sich, was poetisch Meeresschnee genannt wird, tatsächlich aber die Überreste von Abertausenden abgestorbenen marinen Organismen darstellt, die über viele Jahrtausende zu Boden gesunken sind und dort eine Sedimentschicht gebildet haben. Darin findet sich auch erodiertes Gestein, das an Land abgetragen wird, darunter eine nicht endende Flut von Auswaschungen aus dem Himalaja, die über die Flüsse Indus und Ganges in den Indischen Ozean gelangt. Zu beiden Seiten des indischen Subkontinents verlaufen so gigantische Fächer aus Sediment, die mehrere Tausend Kilometer lang und bis zu zwanzig Kilometer breit sind. Auch in seismischer Hinsicht ist der Meeresboden aktiver als das Festland. Hier gibt es brodelnde Vulkane, sprudelnde heiße Quellen, tektonische Platten, die brechen und aneinanderstoßen, sowie gewaltige Seebeben. Der größte Wasserfall der Welt ist nicht der Salto Ángel in Venezuela, der immerhin fast 1000 Meter misst, nein, der höchste Wasserfall befindet sich auf dem Meeresgrund zwischen Grönland und Island, wo kaltes, dichtes Wasser aus dem Nordmeer auf leichteres und wärmeres Wasser aus der Irmingersee trifft und 3500 Meter in die Tiefe stürzt. Alles, was mit dem Meeresboden zu tun hat, ist größer, kühner und extremer als auf jenem relativ unspektakulären Gebiet, das wir Festland nennen.
David Sandwell, Geophysiker an der Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, Kalifornien, gehört zu den Pionieren der Vermessung des Meeresbodens per Satellit. Er hätte durchaus Anlass, mit dem, was er erreicht hat, wenigstens ein bisschen anzugeben, aber dafür ist er sich der Grenzen seiner Möglichkeiten zu bewusst. »Diese Satellitenkarten haben eine Schwäche, die wir nicht beheben können«, erklärte er mir. »Die durchschnittliche Meerestiefe beträgt vier Kilometer, und mit dem Satelliten messen wir Veränderungen der Erdanziehung, die sich in der Topografie der Wasseroberfläche niederschlägt. Analog gilt, dass die Gravitation auf dem Meeresboden die dortige Topografie wiedergibt. Überträgt man aber die Werte vom Meeresboden auf die Wasseroberfläche, macht einem die Physik einen Strich durch die Rechnung, weil immerhin vier Kilometer dazwischen liegen. Denn bei vier Kilometern liegt auch die Grenze der Bildauflösung«13, so Sandwell. »Mehr geht nicht, das ist physikalisch ausgeschlossen.«
Im Laufe der letzten zwanzig Jahre haben Sandwell und sein Mitarbeiter Walter Smith versucht, die Karten zu verbessern. 2014 veröffentlichten sie eine neue Karte, auf der der gesamte weltweite Meeresboden mit einer Auflösung von sechs Kilometern dargestellt ist.14 Im Vergleich zu dem Vorläufer, der von 1997 stammte und es nur auf eine Auflösung von zwölf Kilometern brachte, war das ein riesiger Fortschritt. Diese beiden Karten sind bis heute die besten und detailliertesten, die wir vom Meeresboden haben, aber sie reichen nicht im Entferntesten an jene Karten heran, die wir etwa vom Mond, vom Mars und von der Venus haben.15 Selbst bei einer Auflösung von fünf Kilometern verschwinden ganze Berge, und die tatsächliche Größe und Lage von unterseeischen Formationen kann, so Cassie, »weit, sehr weit verfehlt« werden. Sie hat Berge entdeckt, die laut Karte ganz woanders sein sollten. Das beste Mittel, um den Meeresgrund zu vermessen, ist es, ein Schiff loszuschicken und den Grund Stück für Stück mit dem Echolot abzutasten.16
Als ich bei der Begegnung mit ihr all das unkartierte Gebiet vor mir sah, wurde mir klar, dass ich es nicht mit einer Karte zu tun hatte, zumindest keiner Karte, wie wir sie aus unseren Smartphones kennen, auf denen ein kleiner blauer Punkt jederzeit unsere exakte Position anzeigt. Die genauesten Karten, die wir vom Meeresboden haben, zeigen uns vielmehr, wie wenig wir über unseren Planeten wissen. Dort unten gibt es noch so viel zu entdecken: verwitterte und in sich zusammengefallene Vulkane, Guyots genannt, brodelnde Methanquellen, Solebecken, die unter Wasser Seen bilden und so salzig sind, dass sie für alle Lebewesen eine tödliche Gefahr darstellen, sieht man mal von ein paar Mikroorganismen ab, die wir als Gegenstück zu jenen Außerirdischen ansehen dürfen, die wir auf anderen Planeten vermuten.
Cassies Karte, die den Blick auf die Welt gewissermaßen umdreht, erzählt uns auch, wie wir den Ozean bis heute vermessen haben: heimlich, sporadisch und oft regelrecht habgierig. Den Kapitänen früherer Zeiten war es egal, wie der Meeresgrund aussah, solange er den Rümpfen ihrer Schiffe nicht zu nahe kam. Auf den Karten der Hochsee stand statt einer konkreten Tiefe lediglich »keine Angabe«. Was übersetzt hieß: »Tief genug.«17 Wesentlich anders halten wir es bis heute nicht. Grenzüberwachung, Fischfang, Tourismus, Schifffahrt – für die meisten Bereiche, die mit dem Meer zu tun haben, ist irrelevant, wie der Meeresboden aussieht: Keine Angabe. Die Ausnahmen von dieser Regel heißen Überseekabel und Tiefseebergbau. Und natürlich interessiert sich die Kriegsmarine der Großmächte dafür, wie es unter Wasser aussieht, ganz besonders in Gegenden, die strategisch wichtig sind.
Würde sich Cassie Bongiovanni Five Deeps anschließen, würde sie die entlegensten Flecken der Erde vermessen. Die meisten Absolventen des CCOM landen auf Stellen bei der Regierung, der Navy oder der Industrie, wo sie Karten von wichtigen Häfen und Schifffahrtsstraßen erstellen. Five Deeps würde Cassie zu den weißen Flecken auf den Seekarten führen. Die Expedition könnte das größte Abenteuer ihres ganzen Lebens werden – oder ein riesiger Reinfall.
Neben einer gut gemachten Website konnte Five Deeps nur wenig vorweisen. Victor Vescovo war in der Szene der Meeresforscher nahezu unbekannt. Die wenigen bekannten Namen, die zu dem Projekt gehörten, standen für Glaubwürdigkeit, aber als Team war Five Deeps noch nicht in Erscheinung getreten. Und schon jetzt stand die Expedition kurz vor dem Scheitern. Schuld waren rechtliche Auseinandersetzungen, Machtspielchen, Einstellungen und Entlassungen, Mehrkosten von mehreren Millionen Dollar, ein Schiff, das von verärgerten Arbeitern demoliert worden war, und ein Vorfall, bei dem es wegen eines durch die Luft fliegenden metallenen Hakens um ein Haar einen Toten gegeben hätte.18
Im Sommer 2018, Monate vor Rob McCallums Telefonat mit Cassie Bongiovanni, sollte die Expedition in den Arktischen Ozean ohne einen Hydrografen an Bord des neuen Schiffes namens Pressure Drop aufbrechen. Die Wissenschaftler, aber auch McCallum und Patrick Lahey, der Chef von Triton, drängten Victor, eine Fachkraft für Vermessung zu verpflichten und zusätzlich ein Fächerecholot anzuschaffen. Das wäre teuer geworden. Das Schiff war gerade erst überholt worden, die Kosten dafür waren von geschätzten 2,5 Millionen Dollar auf mehr als zwölf Millionen Dollar geradezu explodiert. Im Laufe der Arbeiten hatte ein Angestellter der Werft behauptet, er sei durch ein offenes Luk gefallen, und ein Schmerzensgeld in sechsstelliger Höhe gefordert. Nun verlangte sein Team von Victor, eine Million Dollar oder mehr in ein Fächerecholot zu investieren und zusätzlich einen Hydrografen anzustellen. Victor war ein reicher Mann, keine Frage, aber er war kein Jeff Bezos, der auf unbegrenzte finanzielle Reserven zurückgreifen kann, und auch kein James Cameron, der einige der profitabelsten Filme der Geschichte verantwortet hat, nur um, wie er selbst behauptete, Geld für das Tiefseetauchen zusammenzubekommen.19
»Ich habe Victor gesagt: ›Du willst doch nicht das viele Geld in das Projekt stecken, rund um die Welt fahren und irgendwo tauchen, nur damit am Ende jemand kommt, der die richtige Ausrüstung hat, und sagt, tut mir leid, du hast die falschen Stellen erwischt‹«, berichtete Heather Stewart. Stewart war der Überzeugung, dass nur ein modernes Fächerecholot die Zweifel an Victors Weltrekord vertreiben könnte. Ein solches Gerät verwenden alle, die in der Erkundung der Weltmeere unterwegs sind, vom Militär über Regierungen bis hin zur Wissenschaft.
Schließlich gelang es Stewart und ihren Mitstreitern, Victor zu überzeugen. »Er setzt sich Ziele, und er hasst es, wenn ihm jemand zuvorkommt«, so Stewarts Erklärung. Sie riet ihm, ein EM 122 anzuschaffen, ein Gerät des norwegischen Herstellers Kongsberg Maritime. »Es hat sich vielfach bewährt und bietet die Garantie, dass es tut, was du von ihm erwartest«, lautete ihr Argument. Kurz darauf erhielt sie eine E-Mail mit der Nachricht, dass Five Deeps ein EM 124 erworben hatte. Das kam ihr komisch vor. »Es gibt kein Modell mit der Bezeichnung EM 124«, dachte sie. Sie wandte sich an ihre norwegischen Kontakte und erfuhr, dass es das EM 124 zwar gab, es aber noch nicht käuflich zu erwerben war. Und auf einem Schiff war es noch nie eingesetzt worden. Bei Stewart klingelten die Alarmglocken. »Mir fiel sofort die Regel ein, laut der man nie der Erste sein soll, der ein neues Gerät kauft. Was hatte sich Victor nur dabei gedacht?« Und siehe da: Das Gerät, das sie schließlich erhielten, trug die Seriennummer 0001. Das mag beeindruckend klingen, war tatsächlich aber ein wahrer Albtraum, »weil du sämtliche Kinderkrankheiten selbst herausfinden musst«, so Cassie, die es mit dem Kauf eines neuen iPhones mit dem neuesten Betriebssystem verglich, das zum allerersten Mal installiert wurde.
Als das Gerät ankam, hatte Five Deeps das enge Zeitfenster für die Fahrt in den Arktischen Ozean bereits verpasst. Um alle fünf Tauchgänge in einem Kalenderjahr unterzubringen, musste sich die Expedition an den kurzen Phasen mit geeignetem Wetter an den beiden Polen orientieren: dem kurzen Sommer im Südlichen Ozean in den Monaten Januar und Februar sowie dem nicht minder kurzen Sommer im Arktischen Ozean in den Monaten Juli und August. Die Verspätung, die man sich nun eingehandelt hatte, war allerdings nicht dem Fächerecholot anzulasten. Schuld war das Tauchboot des Herstellers Triton Submarines. Die kleine und etwas chaotische Firma aus Florida hatte sich einen Namen gemacht, weil sie für Kunden wie Ray Dalio und dessen Projekt OceanX Tauchboote gebaut hatte, aus denen unter anderem die spektakulären Aufnahmen für die BBC-Produktion Unser blauer Planet stammten.20
Zum Sommeranfang 2018 machte sich Alan Jamieson, der leitende Wissenschaftler von Five Deeps, auf den Weg nach Vero Beach, wo die Firma Triton ihren Sitz hatte, um sich davon zu überzeugen, wie weit die Arbeiten gediehen waren. »Ich konnte es kaum glauben, weil ich in der Erwartung angereist war, mir das Tauchboot ansehen zu können, aber alles, was ich vorfand, war eine Kugel aus Titan«, berichtete er lachend. Ursprünglich hatte er zwei Wochen bleiben wollen, aber letztlich verbrachte er fast den ganzen Sommer in Florida und wurde Zeuge, wie die Belegschaft von Triton in der schwülen Hitze der unklimatisierten Werkhalle eine Überstunde an die andere reihte. Patrick Lahey, ein stets gut gelaunter und ewig optimistischer Kanadier, überwachte die Arbeiten persönlich und hielt die Hoffnung am Leben, dass Five Deeps rechtzeitig würde aufbrechen können, um das kleine Zeitfenster am Ende des arktischen Sommers zu nutzen. Ob es klappte, hing von einer Reihe von Tests auf den Bahamas ab, bei denen nichts schiefgehen durfte.
Bei einem dieser Tests drückte Victor auf den Knopf, mit dem der Manipulator, der flexible Greifarm, eingeschaltet wurde, woraufhin eine Rauchfahne durch die Kabine wehte. »Riechst du das?«, fragte er Lahey. »Ja«, erwiderte Lahey. Dann griffen beide reflexartig nach ihren Lungenautomaten, die sie im Notfall zwei Minuten lang mit Atemluft versorgen sollten. Zusätzlich war ein von der Umgebungsluft unabhängiges Atemschutzgerät installiert, wie es auch Bergleute benutzen, um im Falle eines Grubenunglücks die Überlebenschancen zu erhöhen. Gerade unter Wasser ist der Ausbruch eines Feuers ein wahrer Albtraum, weil Sauerstoff ohnehin ein knappes Gut ist. Die Besatzung des Tauchbootes braucht ihn, um atmen zu können, aber der Sauerstoff hält auch das Feuer am Leben. In diesem Falle verzog sich der Rauch nach kurzer Zeit von allein, der vermutete Notfall entpuppte sich als Panne, ausgelöst durch einen plötzlichen Anstieg der Spannung in dem Moment, in dem Victor den Greifarm aktivieren wollte. Der Tauchgang musste trotzdem vorzeitig beendet werden. Vier Jahre zuvor hatte Richard Branson seinen Rekordversuch abbrechen müssen, weil der Druckkörper seines Tauchbootes nachgegeben hatte. Tritons Konstruktion aus Titan war stabiler, aber dafür drohten die Mehrkosten und die technischen Pannen Five Deeps einen Strich durch die Rechnung zu machen.21
»Die Leute von Triton brannten darauf, das verflixte Ding in Ordnung zu bringen, während die Leute von Five Deeps sich redlich mühten, den Überblick nicht zu verlieren. Victor bewegte vor allem die Frage, warum das Tauchboot noch nicht einsatzfähig war, ohne ein Gespür dafür aufzubringen, dass wir ihm ein technisches Wunderwerk bauten«, so Jamiesons Erinnerung. Die Pannen betrafen ausschließlich nicht lebensnotwendige Systeme wie etwa einen Fehlalarm auf der Schalttafel oder den unvermittelten Anstieg der Netzspannung, aber noch waren die Kinderkrankheiten gravierend genug, um einen Tauchgang auf den Grund des Meeres zu verhindern.
Gegen Ende des Sommers mussten alle an dem Projekt Beteiligten einsehen, dass Five Deeps die Arktis nicht rechtzeitig erreichen würde. Daraufhin änderte McCallum die Planung und setzte den atlantischen Puerto-Rico-Graben an die erste Stelle, der Südliche Ozean rückte auf Platz zwei, der Arktische Ozean landete am Ende der Reise, das im Spätsommer 2019 erreicht sein sollte. Die Verspätung betrug inzwischen vier Monate und hatte Mehrkosten für Gehälter und anderes in Höhe von zwei Millionen Dollar verursacht. Aber ohne funktionierendes Tauchboot würde es weder Five Deeps noch wissenschaftliche oder kartografische Programme geben. Im Herbst sollte auf der niederländischen Karibikinsel Curaçao das EM-124-Fächerecholot auf der Pressure Drop installiert, nach einer letzten Testreihe sollte im Puerto-Rico-Graben der Tauchgang zur tiefsten Stelle des Atlantiks gewagt werden. Wohl und Wehe der Expedition hingen davon ab, dass es einem nicht erprobten Tauchboot, einer bunt zusammengewürfelten Crew und einem noch nie benutzten Echolot gelang, noch im Jahr 2018 einen ersten Erfolg zu landen. Alles andere hätte Victors Geduld, aber auch seinen Geldbeutel überstrapaziert.
Kapitel 2 SCHIFF GESUCHT
1.
Meine Gespräche mit Cassie Bongiovanni kreisten immer wieder um zwei zentrale Fragen, die mit der Kartierung des Meeresgrundes zusammenhängen: Wie viel bleibt uns noch zu vermessen? Und warum ist es so kompliziert, die tiefsten Stellen ausfindig zu machen?
Eine kurze Suche im Internet ergibt, dass die Fläche aller Ozeane des Planeten zusammengenommen 362 Millionen Quadratkilometer beziehungsweise 71 Prozent der Erdoberfläche umfasst.1 Aber was bedeuten diese Zahlen, wenn man sie auf ein menschliches Maß bringt? Nichts auf der Erde ist auch nur annähernd so groß wie der Meeresboden, weshalb sich jeder Vergleich mit etwas Irdischem, sei es die Höhe des Eiffelturms, sei es die Länge der Halbinsel Manhattan, verbietet. So nimmt es nicht wunder, dass wir zu den Sternen oder dem Weltraum greifen, wenn wir nach einer Vergleichsgröße suchen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir zu dem Schluss kommen: »Wir wissen mehr über die Oberfläche des Mondes als über den Meeresgrund auf der Erde.«
Alan Jamieson ist dieser Satz aus vollem Herzen zuwider. Einer der wichtigsten Gründe für seine Aversion ist der Umstand, dass es nicht sonderlich überraschend ist, wenn wir mehr über einen kleinen, trockenen, unbelebten Mond wissen als über unseren großen, von Wasser bedeckten Planeten, der voller Leben steckt. Im Vergleich zur Erde ist der Mond winzig, seine Größe entspricht 7,5 Prozent der Größe der Erde. Seine Oberfläche ist kleiner als die des Nordatlantiks, sein Durchmesser kleiner, als Australien breit ist.2 Seabed 2030 kündigte im Jahr 2019 an, dass die zur Veröffentlichung anstehende Meeresbodenkarte fünfzehn Prozent der Gesamtfläche in der angestrebten Auflösung abdecken würde.3 Das entspricht einer Fläche, die anderthalb mal so groß ist wie der Mond. »Das ist ziemlich viel. Warum sollten wir uns dafür kasteien?«, polterte Jamieson im Deep-Sea Podcast. Als ein Journalist den Vergleich mit dem Mond in einem Artikel Jamieson zuschrieb, schickte der ihm eine E-Mail und stellte klar, dass er dergleichen nie gesagt habe und auch nie sagen würde. Der Journalist soll ihm geantwortet haben: »Die Menschen sagen es, also schreiben wir es, und wir schreiben es, weil die Menschen es hören wollen.« Diese Antwort brachte Jamieson so sehr auf die Palme, dass er sich auf die Fährte des Zitats begab und schließlich in einem akademischen Aufsatz aus den Fünfzigerjahren fündig wurde, als die Menschheit weder auf dem Mond noch auf dem Grund des Ozeans gewesen war.4
Um zu verstehen, vor welch gewaltiger Aufgabe Seabed 2030 steht, sollte man sich vor Augen führen, dass im anstehenden Jahrzehnt eine Fläche vermessen werden soll, die achtmal größer ist als der Mond. Und selbst dieser Vergleich vermag die Herkulesaufgabe nicht recht auszudrücken. Der weitaus größte Teil der Erdoberfläche ist von einer im Durchschnitt vier Kilometer dicken milchigen Schicht aus Salzwasser bedeckt. Wasser absorbiert, reflektiert und bricht Licht und unterbindet so alle Versuche, den Meeresboden mit Lasern oder Radar zu vermessen, wie wir es bei Mars und Venus und jedem anderen Planeten handhaben, der nicht von Wasser bedeckt ist. Es mag naheliegend erscheinen, den Ozean und den Weltraum zu vergleichen. Aber sobald es um die Vermessung des Meeresbodens geht, ist der Vergleich mit dem Mond eine arge Untertreibung der Schwierigkeiten, vor denen wir stehen.
Wie viel Ozean muss denn nun noch vermessen werden? Um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen, habe ich Tim Kearns kontaktiert, einen wortgewaltigen kanadischen Hydrografen, der Map the Gaps betreibt, eine gemeinnützige Organisation, die sich vorgenommen hat, die Karte des Meeresbodens zu vervollständigen. Kearns kam ohne Umschweife auf die Suche nach dem vermissten Flugzeug der Malaysia Airlines zu sprechen, zu deren Ergebnissen eine detaillierte Karte eines fast 300000 Quadratkilometer großen Gebietes im südöstlichen Indischen Ozean zählt, das bis dahin nahezu gänzlich unkartiert war.5
»Als ich die Datensätze gesehen habe, dachte ich, ich spinne, so schön war das, was sich mir da zeigte. Auf den Karten, die entstanden, sind Berge zu erkennen, unterseeische Rutschungen und tiefe Spalten, aber auch zwei Schiffswracks aus dem 19. Jahrhundert. Die Hydrografen profitierten davon, dass sie sehr lange vor Ort waren und sehr viele Daten sammeln konnten, aber würde man die auf eine Weltkarte übertragen, wäre es so, als legten Sie eine Streichholzschachtel auf den Fußboden Ihrer Küche. Eine Winzigkeit! Ich will den Erfolg nicht kleinreden, aber ich habe mich bei dem Gedanken ertappt: Verdammte Hacke, der Ozean ist wahnsinnig groß.«
Auch wenn die Menschen seit Tausenden von Jahren versuchen, Karten des Ozeans zu erstellen, sind es immer wieder Tragödien wie das Verschwinden des Flugs Malaysia Airlines 370, die dem Unterfangen neuen Schub verleihen. Das Verschwinden von Amelia Earhart, der Untergang der Titanic, der Tsunami des Jahres 2004, der eine Viertelmillion Menschen das Leben kostete – diese und weitere grausige Ereignisse lieferten den Anlass, sich verstärkt mit dem Meeresboden zu befassen. Dazu beitragen könnte auch eine genaue Prüfung unseres Gewissens hinsichtlich der Frage, warum wir so viel Geld und Energie investieren, um fremde Planeten zu erforschen, wenn wir doch unseren eigenen kaum kennen. Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA, untersucht und vermisst seit mehr als 200 Jahren die Küsten der USA, aber eine Abteilung für die Hohe See hat sie erst seit 2001. Das Budget, das sie für die Kartierung des Meeresbodens zur Verfügung hat, beträgt etwa ein Fünftel der Summe, die für die Erkundung des Weltraums bereitsteht. Die NASA bekommt jedes Jahr mehr Geld von der US-Regierung, die den Etat für die Ozeanforschung gleichzeitig deckelt oder gar senkt. Im Jahr 2021 belief sich das Budget der NOAA auf insgesamt 5,4 Milliarden Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 1,4 Prozent entsprach. Das Budget der NASA lag im selben Jahr bei 25,2 Milliarden Dollar, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von zwölf Prozent. So kommt es, dass wir erst im Angesicht von Katastrophen ein Gefühl dafür bekommen, wie klein und verwundbar wir auf unserem Heimatplaneten sind, über den wir noch so wenig wissen. Doch die Geschichte lehrt uns, dass unser Interesse an der Tiefsee eher ab- als zunimmt und wir uns lieber anderen Themenfeldern widmen.
Bleibt die zweite Frage, um die meine Gespräche mit Cassie immer wieder kreisten: Warum fällt es den Hydrografen so schwer, etwas so Konkretes und räumlich Begrenztes wie den Meeresboden zu vermessen? Selbst mit den modernsten Geräten und den besten Fachleuten bleibt die Tiefenmessung fehlerhaft, die Abweichungen können bis zu fünfzehn Meter in diese oder jene Richtung betragen.
»Das ist besonders frustrierend«, sagte Cassie mit einem Seufzer, wann immer ich ihr diese Frage stellte. »Ich habe es so oft zu erklären versucht, dass mir die Worte ausgegangen sind. Die Unsicherheit ist in der Technik begründet, die uns zur Verfügung steht. Ich kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob ein bestimmter Punkt auf dem Meeresboden auf demselben Niveau liegt wie ein anderer Punkt wenige Meter weiter. Es geht einfach nicht. Wir bekommen die erforderliche Auflösung nicht hin, zumindest nicht mit der heutigen Technik. Ausgeschlossen.«
»Ach so«, sagte ich dann, »ich verstehe.« Um nach wenigen Augenblicken die Frage hinterherzuschieben: »Aber warum ist es ausgeschlossen?« Woraufhin Cassie in ihrer Engelsgeduld es erneut und mit einer anderen Erklärung versuchte. »Stell dir vor, du stehst am Fuße des Mount Everest und versuchst, mit einem Laserpointer einen bestimmten Punkt auf dem Gipfel anzustrahlen, und zwar auf den Zentimeter genau. Das entspricht ziemlich genau dem, was wir schaffen sollen.« Dass das kaum zu bewerkstelligen war, leuchtete mir ein.
Doch um zu verstehen, wie groß der Ozean tatsächlich ist und was es bedeutet, den Meeresboden zu vermessen, musste ich, wie mir bewusst wurde, selbst aufs Meer hinausfahren. Richtig ist, dass der Ozean mit Schall vermessen wird, weshalb man den Meeresboden also eher hören als sehen kann. Richtig ist aber auch, dass ich ein Mensch bin und als solcher die Dinge sehen muss, wenn ich sie glauben soll.
2.
Viele der Schiffe, die heute für die Vermessung des Meeresbodens unterwegs sind, werden von der Navy oder der Industrie betrieben. Dort würde niemand Interesse daran haben, eine neugierige Journalistin an Bord zu lassen, die lästige Fragen dazu stellen würde, was sie warum auf dem Meeresboden kartieren. Blieb eine Handvoll von Forschungsschiffen, die von der US-Regierung, Universitäten oder einigen wenigen wohltätigen oder gemeinnützigen Organisationen betrieben werden. Die im Wortsinn naheliegendste Möglichkeit befand sich, fünfzehn Minuten Autofahrt von meiner Wohnung entfernt, im Hafen von San Diego, wo mehrere Forschungsschiffe der Scripps Institution of Oceanography liegen. Auch die Flotte der NOAA, der Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) in Massachusetts sowie das Forschungsschiff Falkor und weitere Schiffe des Schmidt Ocean Institute sind hier zu Hause.





























