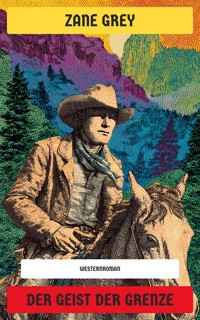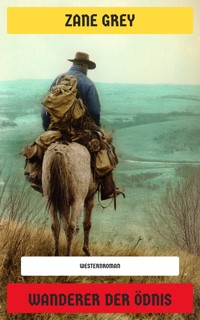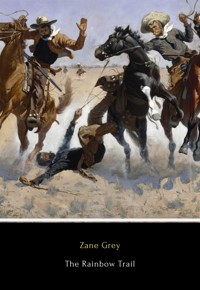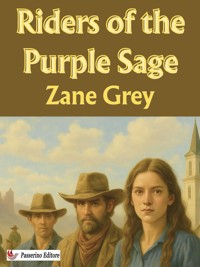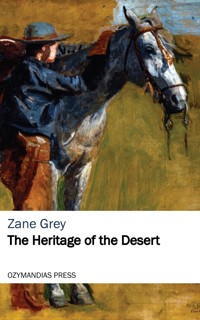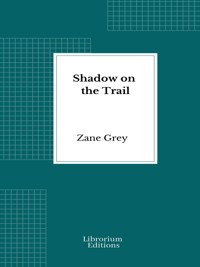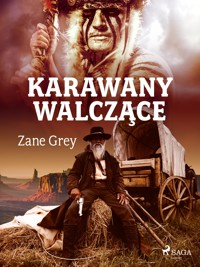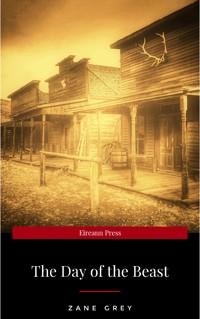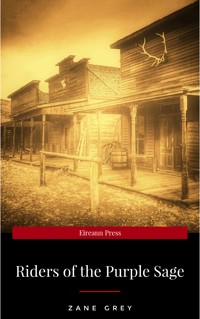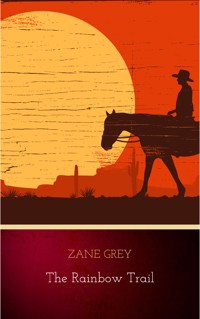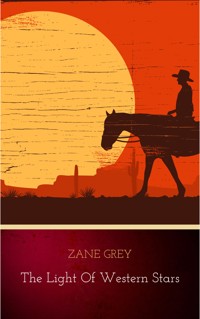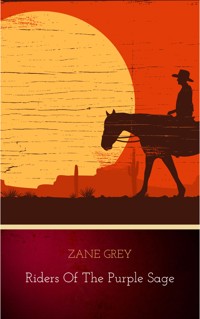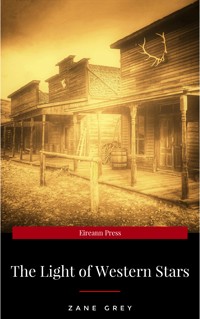1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Bis zum letzten Mann" von Zane Grey ist ein fesselnder Westernroman, der in der wilden, gesetzlosen Landschaft Arizonas spielt. Die Geschichte basiert lose auf wahren Begebenheiten und erzählt von einem erbitterten Familienkonflikt, der in einer Spirale aus Hass, Loyalität und Rache mündet. Im Mittelpunkt steht Jean Isbel, Sohn eines alten Ranchers, der nach Jahren in den Bergen in seine Heimat zurückkehrt. Sein Vater, Gaston Isbel, ist tief in einen blutigen Streit mit der rivalisierenden Familie Jorth verwickelt. Was zunächst als Fehde um Land und Vieh beginnt, entwickelt sich zu einem gnadenlosen Kampf um Ehre und Überleben. Jean, der eigentlich Frieden sucht, wird zunehmend in den Strudel der Gewalt hineingezogen und muss sich zwischen Pflicht, Moral und seinen eigenen Gefühlen entscheiden. Besonders spannend wird die Handlung, als Jean Ellen Jorth, die Tochter des gegnerischen Clanführers, kennenlernt. Zwischen den beiden entsteht eine zarte, verbotene Liebe – ein Hoffnungsschimmer inmitten von Hass und Blutvergießen. Doch ihr Schicksal steht unter einem dunklen Stern, denn der Konflikt zwischen den Familien eskaliert unaufhaltsam. Der Roman basiert lose auf den wahren Ereignissen des Pleasant-Valley-Krieges, einer berüchtigten Fehde zwischen Viehzüchtern und Schafhirten in Arizona. Im Vorwort erklärt Zane Grey, wie ihn diese Geschichte fand: Auf seinen Reisen durch die Weiten Arizonas hörte er von diesem Konflikt, dessen blutige Spuren in der Landschaft noch sichtbar waren. Grey beschreibt, wie er über Jahre hinweg immer wieder in das Tonto Basin zurückkehrte, mit alten Pionieren sprach und schließlich die Erzählungen zusammentrug, die die Grundlage seines Romans bildeten. Zane Grey gelingt es meisterhaft, das raue Leben des Wilden Westens einzufangen – mit staubigen Ebenen, rauen Männern und einer Atmosphäre, die von Gefahr und Leidenschaft durchdrungen ist. Die Spannung wächst mit jeder Seite, während Grey die Themen von Ehre, Rache, Liebe und Freiheit miteinander verwebt. "Bis zum letzten Mann" ist eine intensive, dramatische Erzählung über Menschen, die bis zum Äußersten gehen – und zeigt, dass in der Welt der Cowboys der Kampf um Gerechtigkeit oft mit dem eigenen Leben bezahlt wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bis zum letzten Mann
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Es war klar, dass ich bei meinen Versuchen, eine romantische Geschichte des großen Westens zu schreiben, irgendwann auf die Geschichte einer Fehde stoßen würde. Lange habe ich mich von diesem Thema ferngehalten. Aber jetzt bin ich doch hier angelangt und muss mich damit auseinandersetzen, weil ich unbedingt die spannenden Ereignisse der Pionierzeit aufschreiben will.
Selbst heute ist es nicht möglich, in die entlegenen Winkel des Westens zu reisen, ohne das Leben von Menschen zu sehen, die noch immer von einer von Kämpfen geprägten Vergangenheit beeinflusst sind. Wie kann man die Wahrheit über die Pionierzeit des Westens erzählen, wenn man die Kämpfe, die Auseinandersetzungen und das Blutvergießen auslässt? Das ist unmöglich. Wie kann ein Roman so bewegend und spannend sein wie jene Zeiten, wenn er nicht voller Sensationen ist? Ich habe mich lange damit beschäftigt, Geschichten so zu gestalten, dass sie der Zeit entsprechen, die sie beschreiben. Ich liebe den Westen wegen seiner Weite, seiner Gegensätze, seiner Schönheit, seiner Farben und seines Lebens, wegen seiner Wildheit und Gewalt und wegen der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie er große Männer und Frauen hervorgebracht hat, die unbekannt und unbesungen gestorben sind.
In diesem materialistischen Zeitalter, diesem harten, praktischen, schnellen, gierigen Zeitalter des Realismus, scheint es keinen Platz für Schriftsteller von Liebesromanen zu geben, keinen Platz für Romantik an sich. Viele Jahre lang waren alle Ereignisse, die zum großen Krieg führten, realistisch, und der Krieg selbst war schrecklich realistisch, ebenso wie seine Folgen. Romantik ist nur ein anderer Name für Idealismus, und ich behaupte, dass ein Leben ohne Ideale nicht lebenswert ist. Nie zuvor in der Geschichte der Welt wurden Ideale so dringend gebraucht wie heute. Walter Scott schrieb Romane, ebenso wie Victor Hugo, Kipling, Hawthorne und Stevenson. Vor allem Stevenson ging hart gegen die Realisten vor. Die Menschen leben für den Traum in ihren Herzen. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der nicht einen geheimen Traum hat, eine Hoffnung, wie vage sie auch sein mag, eine geschichtsträchtige Mauer, die er in der Dämmerung betrachtet, ein bemaltes Fenster, das zur Seele führt. Wie seltsam ist es doch, dass die Realisten Ideale und Träume haben! Wenn man sie liest, könnte man meinen, ihr Leben habe nichts Bedeutendes. Aber sie lieben, sie hoffen, sie träumen, sie opfern sich auf, sie kämpfen mit diesem Traum in ihren Herzen genauso wie andere auch. Wir alle sind Träumer, wenn nicht in der trägen Verschwendung von Zeit, dann in der Bedeutung des Lebens, die uns weiterarbeiten lässt.
Wordsworth schrieb: „Die Welt ist zu viel mit uns.“ Und wenn ich das Geheimnis meiner Ambitionen als Romanautor in wenigen Worten zusammenfassen könnte, wäre es in diesem Zitat enthalten. Meine Inspiration zum Schreiben kam schon immer aus der Natur. Charaktere und Handlungen sind dem Schauplatz untergeordnet. In allem, was ich gemacht habe, habe ich versucht, den Menschen zu zeigen, wie sehr die Welt sie einnimmt. Durch das Sammeln und Ausgeben ihrer Güter verschwenden sie ihre Kräfte, ohne jemals einen Hauch des freien und wunderbaren Lebens in der freien Natur zu spüren!
Damit kehre ich zum Hauptanliegen dieses Vorworts zurück, in dem ich zu erklären versuche, warum und auf welche Weise ich dazu kam, die Geschichte einer Fehde niederzuschreiben, die in Arizona unter dem Namen Pleasant-Valley-Krieg berüchtigt ist.
Vor einigen Jahren erzählte mir Mr. Harry Adams, ein Viehzüchter aus dem Vermajo Park in New Mexico, er sei im Tonto Basin in Arizona gewesen und meinte, ich könnte dort interessantes Material über den sogenannten Pleasant-Valley-Krieg finden. Seine Darstellung des Konflikts zwischen Viehzüchtern und Schafhirten bestärkte mich jedenfalls darin, mir die Gegend einmal anzusehen. Mein alter Führer, Al Doyle aus Flagstaff, hatte mich bereits durch die halbe Gegend Arizonas geleitet, aber nie hinab in dieses wunderbare, wilde und zerklüftete Becken zwischen der Mogollon-Mesa und den Mazatzal-Bergen. Doyle hatte lange an der Grenze zur Wildnis gelebt, und seine Version des Pleasant-Valley-Krieges wich deutlich von derjenigen Mr. Adams’ ab. Ich befragte noch andere alteingesessene Männer dazu, und ihre Bemerkungen weckten meine Neugier nur umso mehr.
Als Doyle und ich einmal dort unten angekommen waren, fanden wir das wildeste, schroffste, raueste und zugleich bemerkenswerteste Land, das je einer von uns betreten hatte; und die wenigen Bewohner waren wie das Land selbst. Offiziell war ich gekommen, um Bären, Löwen und Truthähne zu jagen, doch in Wahrheit war ich auf der Suche nach der Geschichte jenes Pleasant-Valley-Krieges. Ich nahm die Dienste eines Bärenjägers in Anspruch, der drei kräftige Söhne hatte – ebenso wortkarg, seltsam und unnahbar wie er selbst. Kein Rad, kein Wagen hatte je auch nur in die Nähe ihrer Hütte Spuren hinterlassen. Ich verbrachte zwei wundervolle Monate mit der Jagd und dem Genießen der Schönheit und Erhabenheit jenes Rim-Rock-Landes, doch ich kehrte zurück, ohne auch nur das Geringste über den Pleasant-Valley-Krieg erfahren zu haben. Diese Texaner und ihre wenigen Nachbarn, ebenfalls aus Texas stammend, sprachen nicht. Doch alles, was ich sah und empfand, befeuerte nur umso mehr meine Sehnsucht. Diese Reise fand im Herbst des Jahres 1918 statt.
Im folgenden Jahr kehrte ich zurück – mit den besten Pferden, der besten Ausrüstung und den tüchtigsten Männern, die die Doyles aufbieten konnten. Und diesmal stellte ich keine Fragen. Stattdessen ritt ich Pferde – manche davon waren zu wild für mich – und trug ein Gewehr über Hunderte von Meilen, legte an manchen Tagen dreißig bis vierzig Meilen im Sattel zurück und kletterte in die tiefen Canyons hinab und wieder hinauf, wobei ich verzweifelt versuchte, mit einem dieser langbeinigen Texaner Schritt zu halten. Ich lernte das Leben dieser Hinterwäldler kennen, doch die Geschichte des Pleasant-Valley-Krieges blieb mir weiterhin verschlossen. Immerhin aber hatte ich mir die Freundschaft dieses harten Volkes erworben.
Im Jahr 1920 kehrte ich mit einer noch größeren Ausrüstung zurück, bereit, so lange zu bleiben, wie es mir beliebte. Und diesmal kamen, ohne dass ich darum bat, verschiedene Einheimische aus dem Tonto-Gebiet zu mir, um mir vom Pleasant-Valley-Krieg zu erzählen. Kein einziger von ihnen stimmte in irgendeinem Punkt mit den anderen überein – außer in einem: dass nur einer der aktiven Teilnehmer die Kämpfe überlebte. Daher rührt mein Titel: BIS ZUM LETZTEN MANN. So wurde ich von einer Flut an Material überrollt, aus der ich mich nur mühsam zu einer eigenen Schlussfolgerung durcharbeiten konnte. Manche der Geschichten, die man mir erzählte, sind für einen Romanautor von geradezu verführerischer Anziehungskraft. Doch so sehr ich selbst an sie glaube, kann ich es nicht wagen, ihre Unwahrscheinlichkeit jenen zuzumuten, die keine Vorstellung von der Wildheit wilder Männer in einer wilden Zeit haben. Es hat diesen schrecklichen und blutigen Zwist tatsächlich gegeben – vielleicht den tödlichsten und zugleich am wenigsten bekannten in der gesamten Geschichte des Westens. Ich habe das Gelände gesehen, die Hütten, die Gräber – alles so düster und eindringlich, dass es nur erahnen lässt, was sich dort zugetragen haben muss.
Ich habe niemals die wahre Ursache des Pleasant-Valley-Krieges erfahren – oder, wenn ich sie doch gehört habe, so hatte ich keine Möglichkeit, sie als solche zu erkennen. Alle angegebenen Gründe erschienen plausibel und überzeugend. Merkwürdigerweise herrscht im gesamten Tonto-Becken noch immer Verschwiegenheit und Zurückhaltung, was die Tatsachen dieses Streits betrifft. Viele Nachkommen der Getöteten leben noch heute dort. Doch niemand spricht gern darüber. Gewiss haben sich viele der mir erzählten Begebenheiten tatsächlich zugetragen – etwa jene schreckliche Geschichte von den beiden Frauen, die angesichts unerbittlicher Feinde die Leichen ihrer toten Ehemänner davor bewahrten, von wilden Schweinen gefressen zu werden. Es genügt zu sagen, dass diese Erzählung meiner Vorstellung vom Krieg entspricht. Ich stütze sie auf jenes Umfeld, das ich kennen- und liebengelernt habe, auf die seltsamen Leidenschaften ursprünglicher Menschen und auf meine instinktive Reaktion auf die Tatsachen und Gerüchte, die ich gesammelt habe.
ZANE GREY. AVALON, KALIFORNIEN, April 1921
KAPITEL I
Am Ende einer trockenen, bergauf führenden Fahrt durch karges Land packte Jean Isbel seine Sachen aus, um am Rande der Zedern zu campen, wo eine kleine felsige Schlucht mit Weiden und Pappeln Wasser und Gras versprach.
Seine Tiere waren müde, vor allem das Packesel, das eine schwere Last getragen hatte; und mit einem langsamen Seufzer der Erleichterung knieten sie nieder und wälzten sich im Staub. Auch Jean verspürte eine gewisse Erleichterung, als er seine Chaps ablegte. Er war die heißen, staubigen, gleißenden Tage in der kargen Landschaft nicht gewohnt. Er streckte seinen langen Körper neben einem kleinen Bach mit klarem Wasser aus, das über die roten Steine plätscherte, und trank gierig. Das Wasser war kühl, hatte aber einen beißenden Geschmack – einen alkalischen Beigeschmack, den er nicht mochte. Seit er Oregon verlassen hatte, hatte er kein klares, süßes, kaltes Wasser mehr getrunken, und er vermisste es genauso wie die stattlichen, schattigen Wälder, die er so geliebt hatte. Dieses wilde, endlose Land Arizona schien seinen Hass zu verdienen.
Als er seine Aufgaben in aller Ruhe erledigt hatte, war es bereits dämmerig geworden und die Kojoten hatten angefangen zu heulen. Jean lauschte den Heulern und dem Rauschen des kühlen Windes in den Zedern mit einem Gefühl der Zufriedenheit, dass ihm diese einsamen Geräusche vertraut waren. Dieses Zedernholz brannte zu einem schönen Feuer und der Geruch seines Rauchs war auf neue Weise angenehm.
„Vielleicht werde ich Arizona noch mögen lernen“, sinnierte er halb laut. „Aber ich sehne mich nach Wasserfällen und dunkelgrünen Wäldern. Das muss der Indianer in mir sein ... Jedenfalls braucht mich mein Vater dringend, und ich schätze, ich werde hier bleiben.“
Jean warf ein paar Zedernzweige ins Feuer und öffnete im Schein des Feuers den Brief seines Vaters, in der Hoffnung, durch wiederholtes Lesen mehr von seiner seltsamen Bedeutung zu erfassen. Der Brief hatte zwei Monate gebraucht, um ihn zu erreichen, war mit Reisenden, mit der Postkutsche und dem Zug, dann mit dem Boot und schließlich wieder mit der Postkutsche gekommen. Er war mit Bleistift auf ein Blatt geschrieben, das aus einem alten Hauptbuch herausgerissen worden war, und wäre selbst bei besserer Lesbarkeit schwer zu entziffern gewesen.
„Dads Handschrift war schon immer schlecht, aber ich habe sie noch nie so zittrig gesehen“, sagte Jean und dachte laut nach.
GRASS VALLY, ARIZONA. Sohn Jean, komm nach Hause. Hier ist dein Zuhause, und hier wirst du gebraucht. Als wir Oregon verließen, dachten wir alle, du würdest nicht lange hinter uns zurückbleiben. Aber jetzt sind schon Jahre vergangen. Ich werde alt, mein Sohn, und du warst immer mein zuverlässigster Junge. Nicht, dass du jemals so verdammt zuverlässig gewesen wärst. Nur schien deine Wildheit eher in den Wald zu passen. Du kommst nach deiner Mutter, und deine Brüder Bill und Guy kommen nach mir. Das ist die rote und weiße Wahrheit. Du bist zum Teil Indianer, Jean, und diesen Indianer werde ich wohl dringend brauchen. Ich bin reich an Rindern und Pferden. Und meine Weide hier ist die beste, die ich je gesehen habe. In letzter Zeit haben wir Vieh verloren. Aber das ist noch nicht alles und auch nicht so schlimm. Schafhirten sind nach Tonto gezogen und weiden auf Grass Valley. Viehzüchter und Schafhirten können in diesem Land niemals zusammenleben. Uns stehen schwere Zeiten bevor. Ich habe wohl noch mehr Gründe, mir Sorgen zu machen und dich zu brauchen, aber du musst warten, bis ich dir das persönlich sage. Was auch immer du gerade tust, lass es sein und mach dich auf den Weg nach Grass Valley, damit du im Frühjahr hier bist. Ich bitte dich, dir die Mühe zu machen, ein paar Gewehre und viele Patronen einzupacken. Und versteck sie in deiner Ausrüstung. Wenn du auf dem Weg nach Tonto jemanden triffst, hör mehr zu, als dass du redest. Und zuletzt, mein Sohn, lass dich durch nichts in Oregon aufhalten. Ich nehme an, du hast eine Freundin, und wenn ja, bring sie mit. Mit lieben Grüßen von deinem Vater, GASTON ISBEL.
Jean dachte über diesen Brief nach. Nach den Erinnerungen an seinen Vater, der immer selbstständig gewesen war, war das eine Überraschung und irgendwie ein Schock gewesen. Wochen des Reisens und Nachdenkens hatten ihm nicht geholfen, die Bedeutung zwischen den Zeilen zu verstehen.
„Ja, Papa wird alt“, dachte Jean und spürte, wie eine Wärme und eine Traurigkeit in ihm aufstiegen. „Er muss weit über sechzig sein. Aber er hat nie alt ausgesehen ... Jetzt ist er also reich und verliert Vieh und wird von seinem Land vertrieben. Papa konnte viel ertragen, aber nicht viel von Schafzüchtern.“
Die Sanftheit, die in Jean aufkam, verschmolz mit einer kalten, nachdenklichen Ernsthaftigkeit, die jedes Mal einsetzte, wenn er den Brief seines Vaters las. Ein dunkler, voller Strom schien durch seine Adern zu fließen, und manchmal spürte er, wie er anschwoll und sich erhitzte. Das beunruhigte ihn und machte ihm bewusst, dass es ein tieferes, stärkeres Ich gab, das im Gegensatz zu seiner sorglosen, freien und verträumten Natur stand. Nichts band ihn an Oregon, außer seiner Liebe zu den großen, stillen Wäldern und den tosenden Flüssen; und diese Liebe kam von seiner weicheren Seite. Es hatte ihn viel Überwindung gekostet, wegzugehen. Und während der gesamten Reise mit dem Schiff entlang der Küste nach San Diego, mit der Postkutsche über die Sierra Madres und schließlich auf dem letzten Stück über Land zu Pferd hatte er gespürt, wie sein ruhiges und glückliches Selbst in den Hintergrund trat und dieses unbekannte, düstere Selbst mit seinen bedrohlichen Möglichkeiten die Oberhand gewann. Doch trotz eines unbestimmten Bedauerns und seiner Verbundenheit mit Oregon musste er, als er in seinen Decken lag, zugeben, dass er ein großes Interesse an seiner abenteuerlichen Zukunft hatte und diese karge, wilde Landschaft Arizonas sehr genoss. Es schien ein anderer Himmel zu sein, der sich als dunkle, sternenübersäte Kuppel über ihm ausbreitete – näher, weiter, blauer. Der starke Duft von Salbei und Zeder schwebte mit dem Rauch des Lagerfeuers über ihm, und alles schien seine Gedanken schläfrig zu beruhigen.
Im Morgengrauen rollte er sich aus seinen Decken, zog seine Stiefel an und begann den Tag mit Begeisterung für die Arbeit, die ihn seiner Berufung näher bringen musste. Der weiße, knisternde Frost und die kalte, beißende Luft waren die gleichen starken Ansporn zum Handeln, die er aus den Hochländern von Oregon kannte, doch sie waren nicht ganz dieselben. Er verspürte eine Erregung, die der Wirkung eines starken, süßen Weins ähnelte. Seinem Pferd und seinem Maultier war es in der Nacht gut gegangen, da sie sich im kleinen Canyon mit Gras und Wasser erholt hatten. Jean stieg auf und ritt mit Freude in die Zedernwälder hinein, endlich die endlosen Meilen kargen Landes hinter sich gelassen zu haben.
Der Pfad, dem er folgte, schien nur selten begangen zu werden. Nach den dürftigen Auskünften, die er in der letzten Siedlung erhalten hatte, führte er direkt zu dem, was man den Rand nannte, und von dort aus konnte man das Gras-Tal unten im Becken sehen. Der Anstieg des Geländes war so allmählich, dass man ihn nur auf langen, offenen Strecken erkennen konnte. Doch die Beschaffenheit der Vegetation zeigte Jean, dass er stetig an Höhe gewann. Spärliche, niedrige, knorrige Zedern wichen zahlreicheren, dunkleren, grüneren und buschigeren Exemplaren, und diese wiederum wurden von hohen, voll belaubten Bäumen mit grünen Beeren abgelöst. Salbei und Gras wuchsen auf den offenen Ebenen üppiger. Dann kamen die Pinyon-Kiefern, und bald darauf mischten sich unter sie die schachbrettartig gemusterten Wacholderbäume. Jean begrüßte die erste Kiefer mit einem herzhaften Schlag auf ihre braune, raue Rinde. Es war eine kleine, kümmerlich wachsende Zwergkiefer, die ums Überleben kämpfte. Die nächste war schon größer, und danach folgten mehrere weitere, und jenseits davon ragten Kiefern überall über die niedrigeren Bäume hinaus. Der Duft von Kiefernnadeln mischte sich mit den anderen trockenen Gerüchen, die den Wind für Jean angenehm machten. Eine Stunde nach Erreichen der ersten Kiefern hatte er die Zedern und Pinyons hinter sich gelassen und war in einen sich langsam verdichtenden und vertiefenden Wald eingedrungen. Unterholz war spärlich, außer in Schluchten, und auf den offenen Stellen wuchs gebleichtes Gras. Jeans Blick schweifte umher, auf der Suche nach Eichhörnchen, Vögeln, Hirschen oder irgendeinem sich bewegenden Wesen. Es schien ein trockener, unbewohnter Wald zu sein. Gegen Mittag hielt Jean an einem Tümpel mit Oberflächenwasser, offenbar geschmolzenem Schnee, und ließ seine Tiere trinken. Im Schlamm entdeckte er einige alte Hirschspuren und mehrere riesige Vogelspuren, die ihm unbekannt waren und die er für die Fährten wilder Truthähne hielt.
An diesem Teich teilte sich der Weg. Jean hatte keine Ahnung, welchen Weg er nehmen sollte. „Ist wohl egal“, murmelte er, als er wieder aufsteigen wollte. Sein Pferd stand mit gespitzten Ohren da und schaute den Weg zurück. Dann hörte Jean das Klappern von trabenden Hufen und entdeckte einen Reiter.
Jean tat so, als würde er seinen Sattelgurt festziehen, während er über sein Pferd hinweg den herannahenden Reiter beobachtete. Alle Männer in dieser Gegend waren für Jean Isbel von großem Interesse. Dieser Mann ritt in einiger Entfernung und sah aus wie alle Arizonier, die Jean bisher gesehen hatte. Er saß souverän im Sattel und war groß und schlank. Er trug einen riesigen schwarzen Sombrero und einen verschmutzten roten Schal. Seine Weste war offen und er trug keinen Mantel.
Der Reiter kam im Trab näher und hielt einige Schritte vor Jean an.
„Hallo, Fremder!“, sagte er barsch.
„Hallo auch!“, antwortete Jean. Er spürte instinktiv, dass diese Begegnung mit dem Mann von Bedeutung war. Noch nie hatte jemand Jean und seine Ausrüstung so scharf mustert. Er hatte ein staubfarbenes, sonnenverbranntes Gesicht, lang, schlank und hart, einen riesigen sandfarbenen Schnurrbart, der seinen Mund verdeckte, und Augen von durchdringender Intensität. Dieser Mann hatte noch nicht viel harte Erfahrung im Westen gesammelt, doch gemessen an seinem Alter war er noch nicht alt. Als er vom Pferd stieg, sah Jean, dass er selbst für einen Arizonier groß war.
„Ich habe deine Spuren gesehen“, sagte er, während er seinem Pferd das Zaumzeug abnahm, damit es trinken konnte. „Wohin willst du?“
„Ich glaube, ich habe mich verlaufen“, antwortete Jean. „Das ist Neuland für mich.“
„Klar. Das habe ich an deinen Spuren und deinem letzten Lager gesehen. Nun, wohin wolltest du, bevor du dich verfahren hast?“
Die Frage war bewusst kühl, mit einem trockenen, scharfen Unterton. Jean spürte, dass sie weder freundlich noch nett gemeint war.
„Grass Valley. Mein Name ist Isbel“, antwortete er knapp.
Der Reiter versorgte sein Pferd, das getrunken hatte, und legte ihm das Zaumzeug wieder an; dann schien er mit einem langen Schwung seines Beines in den Sattel zu steigen.
„Ich wusste, dass du Jean Isbel bist“, sagte er. „Jeder in Tonto hat gehört, dass der alte Gass Isbel nach seinem Jungen geschickt hat.“
„Warum hast du dann gefragt?“, fragte Jean unverblümt.
„Ich wollte wohl sehen, was du dazu sagst.“
„Ach so? Na gut. Aber mir ist es ziemlich egal, was du sagst.“
Ihre Blicke trafen sich unverwandt, und jeder musterte den anderen in einem unsichtbaren Kampf der Willenskräfte.
„Klar, das ist normal“, antwortete der Reiter. Er sprach langsam und bewegte seine langen, braunen Hände, während er eine Zigarette aus seiner Weste holte, im Takt seiner Worte. „Aber da du zu den Isbels gehörst, werde ich meine Meinung sagen, ob du willst oder nicht. Mein Name ist Colter und ich bin einer der Schafzüchter, mit denen Gass Isbel Streit hat.“
„Colter. Freut mich, dich kennenzulernen“, antwortete Jean. „Und ich denke, wer meinen Vater verärgert hat, wird auch mich verärgern.“
„Klar. Wenn das nicht so wäre, wärst du kein Isbel“, erwiderte Colter mit einem grimmigen Lachen. „Man sieht sofort, dass du noch keinen der Jungs aus Tonto Basin getroffen hast. Nun, ich sag dir, dein alter Herr hat im Laden von Greaves wie eine Frau gequatscht. Er hat mit dir geprahlt und damit, wie gut du kämpfen und schießen kannst und wie gut du Pferde oder Menschen aufspüren kannst! Er hat damit geprahlt, dass du jeden Schafhirten zurück auf den Rim jagen würdest ... Ich erzähle dir das, weil wir wollen, dass du unsere Position richtig verstehst. Wir werden in Grass Valley Schafe züchten.“
„Aha! Und wer sind ‚wir‘?“, fragte Jean knapp.
„Was? ... Wir – ich meine die Schafhirten, die diesen Rim von Black Butte bis zum Apache-Land hüten.“
„Colter, ich bin fremd in Arizona“, sagte Jean langsam. „Ich weiß wenig über Rancher oder Schafhirten. Es stimmt, mein Vater hat mich hergeschickt. Es stimmt auch, dass er geprahlt hat, denn er neigte dazu, zu prahlen und zu protzen. Und er ist jetzt alt. Ich kann nichts dafür, wenn er mit mir geprahlt hat. Aber wenn er das getan hat und wenn er mit seiner Haltung gegenüber euch Schafzüchtern Recht hat, werde ich mein Bestes tun, um seinem Prahlen gerecht zu werden.“
„Ich verstehe, was du meinst. Wir verstehen uns, und das ist eine große Hilfe. Sag deinem alten Herrn, was ich meine“, antwortete Colter, als er sein Pferd nach links wendete. „Der Weg nach Süden gehört dir. Wenn du zum Rim kommst, siehst du unten im Becken eine kahle Stelle. Das ist Grass Valley.“
Er ritt davon und verschwand im Wald. Jean lehnte sich an sein Pferd und dachte nach. Es schien schwierig, diesem Colter gerecht zu werden, nicht wegen seiner Behauptungen, sondern wegen einer subtilen Feindseligkeit, die von ihm ausging. Colter hatte ein hartes Gesicht, eine verschleierte Absicht und eine Ausdrucksweise, die Jean mit unehrlichen Menschen in Verbindung brachte. Selbst wenn Jean keine Vorurteile gehabt hätte, wenn er nichts von den Problemen seines Vaters mit diesen Schafzüchtern gewusst hätte und wenn Colter ihn nur getroffen hätte, um Blicke und Grüße auszutauschen, hätte Jean dennoch nie einen positiven Eindruck von ihm gewonnen. Colter ging ihm auf die Nerven und weckte eine selten empfundene Feindseligkeit in ihm.
„Heigho!“, seufzte der junge Mann, „Auf Wiedersehen, Jagen und Fischen! Dad hat mir einen Männerjob gegeben.“
Damit stieg er auf sein Pferd und trieb das Packesel auf den rechten Weg. Im Schritt und Trab reitete er den ganzen Nachmittag lang und gelangte gegen Sonnenuntergang in einen dichten Kiefernwald. Mehr als eine Schneewehe zeigte sich weiß zwischen dem Grün, geschützt an den Nordhängen schattiger Schluchten. Und als er diese Zone mit üppigerem, tieferem Waldland betrat, legte Jean seine düsteren Vorahnungen ab. Diese stattlichen Kiefern waren nicht die riesigen Tannen von Oregon, aber jeder Waldliebhaber konnte unter ihnen glücklich sein. Er kletterte noch höher, bis sich der Wald vor und um ihn herum wie ein ebener Park ausbreitete, mit dichten Schluchten hier und da auf jeder Seite. Und bald führte diese trügerische Ebene zu einer höheren Terrasse, auf der die Kiefern emporragten und von wunderschönen Bäumen begleitet wurden, die er für Fichten hielt. Mit ihrer dicken Rinde und ihren regelmäßig ausladenden Ästen ragten diese Nadelbäume in symmetrischer Form empor und durchbohrten den Himmel mit silbernen Federn. Anmutiges graugrünes Moos wiegte sich wie Schleier von den Ästen. Die Luft war nicht mehr so trocken und es war kälter, mit einem Hauch von Schnee in der Luft. Jean schlug sein Lager an der ersten geeigneten Stelle auf und rollte vorsichtshalber sein Bett in einiger Entfernung vom Feuer aus. Unter den leise rauschenden Kiefern fühlte er sich wohl, nachdem er das Gefühl der unermesslichen Weite, die ihn umgab, verloren hatte.
Das Gackern der Wildtruthähne weckte Jean: „Chuga-lug, chug-a-lug, chug-a-lug-chug.“ Es gab keinen großen Unterschied zwischen dem Gackern eines wilden Truthahns und dem eines zahmen. Jean stand auf, nahm sein Gewehr und ging in die graue Dunkelheit der Morgendämmerung hinaus, um die Truthähne zu suchen. Aber es war zu dunkel, und als endlich das Tageslicht kam, schienen sie verschwunden zu sein. Das Maultier hatte sich verirrt, und da Jean es suchen, Frühstück kochen und packen musste, kam er nicht sehr früh los. Auf dieser letzten Etappe seiner langen Reise hatte er das Tempo gedrosselt. Er war es leid, sich zu beeilen; der Wechsel von Wochen in der gleißenden Sonne und dem staubigen Wind zu diesem schönen, dunkelgrünen und braunen Wald war sehr willkommen; er wollte auf dem schattigen Pfad verweilen. An diesem Tag wollte er sicher sein, den Rand zu erreichen. Nach und nach verlor er den Pfad. Er war einfach durch mangelnde Nutzung abgenutzt. Hin und wieder kreuzte Jean einen alten Pfad, und je tiefer er in den Wald vordrang, desto mehr Spuren von Truthähnen, Rehen und Bären fand er an feuchten oder staubigen Stellen. Die Menge an Bärenspuren überraschte ihn. Bald wurde seine empfindliche Nase von einem Schafgeruch angeregt, und schon bald ritt er auf einen breiten Schafpfad. Anhand der Spuren schätzte Jean, dass die Schafe am Vortag dort vorbeigekommen waren.
Eine unbegründete Abneigung schien in ihm zu entstehen. Natürlich war er darauf vorbereitet, Schafe nicht zu mögen, und deshalb war er unvernünftig. Aber andererseits hatte diese Schafherde eine breite kahle Spur hinterlassen, ohne Unkraut, ohne Gras, ohne Blumen. Wo Schafe weideten, zerstörten sie alles. Das war es, was Jean gegen sie hatte.
Eine Stunde später ritt er auf den Kamm eines langen, parkähnlichen Hangs, wo überall neues grünes Gras spross und Blumen blühten. Die Kiefern standen weit auseinander; knorrige Eichen ragten rau und grau vor der grünen Wand des Waldes empor. Ein weißer Schneestreifen glitzerte wie ein fließender Bach tief unten im Wald.
Jean hörte das musikalische Läuten von Glocken und das Blöken der Schafe und das leise, süße Blöken der Lämmer. Als er auf diese Geräusche zu ritt, kam ein Hund aus einem Eichenwäldchen gelaufen und bellte ihn an. Als Nächstes roch Jean ein Lagerfeuer und bald sah er eine sich kräuselnde blaue Rauchsäule und dann ein kleines spitzes Zelt. Hinter der Eichenlichtung traf Jean auf einen mexikanischen Jungen, der eine Karabinerflinte trug. Der Junge hatte ein dunkles, freundliches Gesicht und antwortete auf Jeans Begrüßung mit „BUENAS DIAS”. Jean verstand nur wenig Spanisch, und aus seinen einfachen Fragen schloss er lediglich, dass der Junge nicht allein war – und dass es “Lammzeit” war.
Letzteres wurde lautstark deutlich. Der Wald schien voller schriller, unaufhörlicher Blöken und klagender Laute zu sein. Rund um das Lager, am Hang, in den Lichtungen und überall waren Schafe. Einige grasten, viele lagen, die meisten waren Mutterschafe, die weiße, flauschige Lämmer säugten, die noch unsicher auf ihren Beinen standen. Überall sah Jean kleine, gerade geborene Lämmer. Ihr schrilles Blöken übertönte das schwerere Mäh-Mäh ihrer Mütter.
Jean stieg ab und führte sein Pferd zum Lager hinunter, wo er hoffte, einen anderen, älteren Mexikaner zu treffen, von dem er vielleicht Informationen bekommen könnte. Der Junge ging mit ihm. Hier unten war das klagende Geschrei der Schafe nicht so laut.
„Hallo!“, rief Jean fröhlich, als er sich dem Zelt näherte. Es kam keine Antwort. Er ließ die Zügel fallen und ging ziemlich langsam weiter, um nach jemandem Ausschau zu halten. Dann erschreckte ihn eine Stimme von der Seite.
„Guten Morgen, Fremder.“
Ein Mädchen trat aus dem Schatten einer Kiefer hervor. Sie trug ein Gewehr. Ihr Gesicht war von einer satten Bräune, aber sie war keine Mexikanerin. Diese Tatsache und die plötzliche Gewissheit, dass sie ihn beobachtet hatte, verunsicherten Jean ein wenig.
„Entschuldigung, Miss“, stammelte er. „Ich hätte nicht erwartet, ein Mädchen zu sehen ... Ich habe mich irgendwie verlaufen – ich suche den Rim – und dachte, ich würde einen Schafhirten finden, der mir den Weg zeigen könnte. Ich verstehe die Sprache dieses Jungen nicht.“
Während er sprach, schien sich eine gewisse Anspannung in ihrem Gesicht zu lösen. Auch ein leichter Anflug von Feindseligkeit verschwand. Jean war sich nicht einmal sicher, ob er es richtig wahrgenommen hatte, aber da war etwas gewesen, das nun verschwunden war.
„Klar, ich zeig's dir gern“, sagte sie.
„Danke, Miss. Jetzt kann ich wohl aufatmen“, antwortete er.
„Es ist eine lange Fahrt von San Diego. Heiß und staubig! Ich bin ziemlich müde. Und vielleicht ist dieser Wald nicht gut für meine schmerzenden Augen!“
„San Diego! Du kommst von der Küste?“
„Ja.“
Jean hatte seinen Sombrero abgenommen, als er sie sah, und hielt ihn immer noch in der Hand, vielleicht aus Respekt. Das schien ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
„Setz deinen Hut auf, Fremder ... Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann mir jemals ein Mann seinen Kopf entblößt hat.“ Sie lachte leise, wobei sich Überraschung und Offenheit mit einem Hauch von Bitterkeit vermischten.
Jean setzte sich mit dem Rücken an eine Kiefer, legte den Sombrero neben sich und sah sie direkt an, mit einer seltsamen Neugier, als wolle er seinen ersten flüchtigen Eindruck durch genaues Beobachten bestätigen. Wenn seine Begegnung mit Colter schon instinktiv gewesen war, so war diese hier noch mehr. Das Mädchen saß halb, halb lehnte sie an einem Baumstamm, mit dem glänzenden kleinen Karabiner auf den Knien. Sie sah ihn ruhig und neugierig an, und Jean hatte noch nie einen solchen Blick gesehen. Ihre Augen waren ziemlich groß und oval, klar und ruhig, mit einem Hauch von Nachdenklichkeit in ihrer bernsteinfarbenen Tiefe. Sie schienen Jean zu durchdringen, und er senkte als Erster den Blick. Dann sah er ihren zerlumpten, selbstgewebten Rock und ein paar Zentimeter braune, nackte Knöchel, kräftig und rund, und grobe, abgetragene Mokassins, die die Form ihrer Füße nicht verbergen konnten. Plötzlich zog sie ihre strumpfosenlosen Knöchel und schlecht beschuhten kleinen Füße zurück. Als Jean seinen Blick wieder hob, sah er, dass sie ihr Gesicht halb abgewandt hatte und ein roter Fleck auf ihrer goldbraunen Wange zu sehen war. Diese Spur von Verlegenheit entfernte sie irgendwie aus dieser starken, rauen, wilden Waldlandschaft. Es veränderte ihre Haltung. Es lenkte von dem neugierigen, unverschämten, fast kühnen Blick ab, den er in ihren Augen gesehen hatte.
„Ich schätze, du kommst aus Texas“, sagte Jean nach einer Weile.
„Klar“, sagte sie mit gedehnter Stimme. Sie hatte einen gemächlichen Südstaatenakzent, der angenehm zu hören war. „Wie kommst du darauf?“
„Man erkennt einen Texaner sofort. Wo ich herkomme, gab es viele Pioniere und Viehzüchter aus dem alten Lone-Star-Staat. Ich habe für einige gearbeitet. Und, wenn ich so darüber nachdenke – ich höre einer texanischen Dame lieber zu als irgendjemand anderem.“
„Kanntest du viele Mädchen aus Texas?“, fragte sie und drehte sich wieder zu ihm um.
„Ich glaube schon – ziemlich viele.“
„Hast du dich mit ihnen getroffen?“
„Mit ihnen ausgegangen? Du meinst wohl, mit ihnen zusammen gewesen sein. Ja, ich glaube schon – ein bisschen“, lachte Jean. „Manchmal sonntags oder zu einem Tanz, der nur alle Jubeljahre einmal stattfand, und gelegentlich zu einem Ausritt.“
„Das zählt doch“, sagte das Mädchen sehnsüchtig.
„Wofür?“, fragte Jean.
„Dass du ein Gentleman bist“, antwortete sie mit Nachdruck. „Oh, ich habe es nicht vergessen. Ich hatte Freunde, als wir in Texas lebten ... Vor drei Jahren. Es kommt mir viel länger vor. Drei elende Jahre in diesem verdammten Land!“
Dann biss sie sich auf die Lippe, offensichtlich um weitere unbedachte Äußerungen gegenüber einem völlig Fremden zu unterdrücken. Und genau dieses Lippenbeißen lenkte Jeans Aufmerksamkeit auf ihren Mund. Er hatte eine schöne Form, Fülle und Farbe, die eine gewisse Traurigkeit und Bitterkeit nicht verbergen konnten. Dann veränderte sich das ganze strahlende braune Gesicht für Jean. Er sah, dass es jung war, voller Leidenschaft und Zurückhaltung, und eine Kraft besaß, die ihn immer mehr beeindruckte. Dies, zusammen mit ihrer Scham und ihrem Pathos und der Tatsache, dass sie sich nach Respekt sehnte, weckte Jeans Interesse.
„Nun, ich glaube, du schmeichelst mir“, sagte er, in der Hoffnung, sie wieder zu beruhigen. „Ich bin nur ein rauer Jäger und Fischer, Holzfäller und Pferdeführer. Ich habe nie die nötige Schulbildung erhalten – und auch nicht annähernd genug Gesellschaft von netten Mädchen wie dir.“
„Bin ich nett?“, fragte sie schnell.
„Aber sicher“, antwortete er lächelnd.
„In diesen Lumpen?“, fragte sie mit einem plötzlichen Ausbruch von Leidenschaft, der ihn begeisterte. „Schau dir die Löcher an.“ Sie zeigte ihm die Risse und abgenutzten Stellen an den Ärmeln ihrer Bluse aus Hirschleder, durch die ein runder, brauner Arm schimmerte. „Ich nähe, wenn ich etwas zum Nähen habe ... Schau dir meinen Rock an – ein schmutziger Lappen. Und ich habe nur noch einen anderen ... Schau!“ Wieder färbten sich ihre Wangen rot, was ihr sehr gut stand und ihre Handlung Lügen strafte. Aber ihre Scham konnte ihre Heftigkeit jetzt nicht mehr bremsen. Eine aufgestaute Verbitterung schien sich wie eine Flut entladen zu haben. Sie hob den zerlumpten Rock fast bis zu den Knien. „Keine Strümpfe! Keine Schuhe! ... Wie kann ein Mädchen nett sein, wenn es keine sauberen, anständigen Frauenkleider zum Anziehen hat?“
„Wie – wie kann ein Mädchen ...“, begann Jean. „Hören Sie, Miss, ich bitte Sie um Verzeihung, dass ich Sie irgendwie dazu gebracht habe, sich ein wenig zu vergessen. Ich glaube, ich verstehe Sie. Sie treffen nicht viele Fremde, und ich habe Sie irgendwie falsch behandelt – Sie zu sehr unter Druck gesetzt – und zu viel geredet. Wer und was Sie sind, geht mich nichts an. Aber wir sind uns begegnet ... Und ich glaube, etwas ist passiert – vielleicht mehr für mich als für dich ... Jetzt lass mich dir mal was über Kleidung und Frauen sagen. Ich glaube, die meisten Frauen lieben schöne Sachen zum Anziehen und denken, weil Kleidung sie hübsch aussehen lässt, dass sie dadurch netter oder besser sind. Aber das stimmt nicht. Du liegst falsch. Vielleicht wäre es für ein Mädchen wie dich zu viel verlangt, ohne Kleidung glücklich zu sein. Aber du kannst es sein – du bist genauso hübsch und – und schön – und, soweit du weißt, für manche Männer sogar viel attraktiver.
„Fremder, du musst mein Temperament und mein Verhalten entschuldigen“, antwortete das Mädchen gelassen. „Das war, gelinde gesagt, nicht nett. Und ich möchte nicht, dass jemand eine bessere Meinung von mir hat, als ich verdiene. Meine Mutter ist in Texas gestorben, und ich lebe hier draußen in dieser wilden Gegend – ein Mädchen allein unter rauen Männern. Durch die Begegnung mit dir heute wird mir klar, wie hart ihr Leben ist – und was es mit mir gemacht hat.“
Jean unterdrückte seine Neugier und versuchte, das wachsende Gefühl, dass er Mitleid mit ihr hatte und sie mochte, aus seinen Gedanken zu verdrängen.
„Bist du Schafhirtin?“, fragte er.
„Klar, ab und zu. Mein Vater lebt hier hinten in einer Schlucht. Er ist Schafzüchter. In letzter Zeit wurde auf Hirten geschossen. Momentan sind wir unterbesetzt, und ich muss einspringen. Aber ich mag das Hüten und ich liebe die Wälder, den Rim Rock und das ganze Tonto. Wenn es nur das gäbe, wäre ich sicher glücklich.“
„Auf Hirten geschossen!“, rief Jean nachdenklich aus. „Von wem? Und warum?“
„Es gibt Ärger zwischen den Viehzüchtern unten im Becken und den Schafhirten oben am Rim. Mein Vater sagt, dass es sicher Ärger geben wird. Ich sage ihm, dass ich hoffe, dass die Viehzüchter ihn zurück nach Texas jagen.“
„Dann – bist du auf der Seite der Rancher?“, fragte Jean und versuchte, beiläufiges Interesse vorzutäuschen.
„Nein. Ich werde immer auf der Seite meines Vaters stehen“, antwortete sie mit Nachdruck. „Aber ich muss zugeben, dass ich denke, dass die Viehzüchter in dieser Auseinandersetzung im Recht sind.“
„Wie das?“
„Weil es überall Gras gibt. Ich sehe keinen Sinn darin, dass ein Schafzüchter sich die Mühe macht, einen Viehzüchter zu umzingeln und ihm seine Schafe wegzunehmen. Das hat den Streit ausgelöst. Gott allein weiß, wie das enden wird. Denn die meisten von ihnen hier kommen aus Texas.“
„Das habe ich auch gehört“, antwortete Jean. „Und ich habe gehört, dass fast alle diese Texaner aus Texas vertrieben wurden. Ist da etwas Wahres dran?“
„Ich denke schon“, antwortete sie ernst. „Aber, Fremder, es könnte unklug sein, das irgendwo zu sagen. Mein Vater zum Beispiel wurde nicht aus Texas vertrieben. Ich verstehe wirklich nicht, warum er hierher gekommen ist. Er hat Vieh angesammelt, aber er ist nicht reich und auch nicht so wohlhabend wie zu Hause.“
„Wirst du für immer hier bleiben?“, fragte Jean plötzlich.
„Wenn ich das tue, dann erst in meinem Grab“, antwortete sie düster. „Aber was bringt es, darüber nachzudenken? Die Menschen bleiben an Orten, bis sie weiterziehen. Man kann nie wissen ... Nun, Fremder, dieses Gespräch hält dich auf.“
Sie schien jetzt launisch zu sein, und ein Anflug von Distanziertheit schlich sich in ihre Stimme. Jean stand sofort auf und ging zu seinem Pferd. Wenn dieses Mädchen nicht weiter reden wollte, hatte er sicherlich keine Lust, sie zu belästigen. Sein Maultier hatte sich unter die blökenden Schafe verirrt. Jean trieb es zurück und führte dann sein Pferd zu dem Mädchen. Sie wirkte größer und war, obwohl sie nicht kräftig gebaut war, lebhaft und geschmeidig, mit etwas an sich, das zu diesem Ort passte. Jean widerstrebte es, sich von ihr zu verabschieden.
„Wo ist der Rim?“, fragte er und wandte sich seinen Sattelgurten zu.
„Nach Süden“, antwortete sie und zeigte in die Richtung. „Es ist nur etwa eine Meile entfernt. Ich begleite dich hinunter ... Du bist wohl auf dem Weg nach Grass Valley?“
„Ja, ich habe dort Verwandte“, antwortete er. Er fürchtete ihre nächste Frage, von der er vermutete, dass sie seinen Namen betreffen würde. Aber sie fragte nicht. Sie nahm ihr Gewehr und wandte sich ab. Jean ging mit großen Schritten zu ihr hinüber. „Wenn du gehst, werde ich wohl nicht reiten.“
So fand er sich neben einem Mädchen wieder, das den freien Gang einer Bergbewohnerin hatte. Ihr nackter, brauner Kopf reichte ihm fast bis zur Schulter. Es war ein kleiner, hübscher Kopf, anmutig, aufrecht gehalten, und das dichte Haar darauf war glänzend und weichbraun. Sie trug es in einem Zopf, ziemlich unordentlich und verfilzt, wie er fand, und es war mit einer Schnur aus Hirschleder zusammengebunden. Insgesamt zeugte ihre Kleidung von Armut.
Jean ließ das Gespräch ein wenig versiegen. Er wollte überlegen, was er als Nächstes sagen sollte, und dann empfand er ein eher vages Vergnügen daran, neben ihr herzulaufen. Ihr Profil war gerade geschnitten und von exquisiter Linie. Von dieser Seitenansicht aus war die weiche Rundung ihrer Lippen nicht zu sehen.
Sie versuchte mehrmals, ein Gespräch anzufangen, aber Jean ignorierte sie jedes Mal, was sie offensichtlich zunehmend verunsicherte. Schließlich hatte Jean sich entschieden, was er sagen wollte, und begann plötzlich: „Ich mag dieses Abenteuer. Und du?“
„Abenteuer! Mich im Wald zu treffen?“ Und sie lachte das Lachen der Jugend. „Du musst wohl dringend ein Abenteuer brauchen, Fremder.“
„Gefällt es dir?“, beharrte er und suchte mit seinen Augen das halb abgewandte Gesicht.
„Es könnte mir gefallen“, antwortete sie offen, „wenn – wenn mein Temperament mich nicht zum Narren gemacht hätte. Ich treffe nie jemanden, mit dem ich mich gerne unterhalte. Warum sollte es nicht schön sein, jemandem zu begegnen, den man noch nicht kennt – jemandem, der in dieser wilden Gegend fremd ist?“
„Wir sind, wie wir sind“, sagte Jean einfach. „Ich finde nicht, dass du dich lächerlich gemacht hast. Wenn ich das denken würde, würde ich dich dann wiedersehen wollen?“
„Willst du das?“ Das braune Gesicht blitzte ihn überrascht an, mit einem Ausdruck, den er für Freude hielt. Und weil er ruhig und freundlich wirken wollte, nicht zu eifrig, musste er sich die Begeisterung verkneifen, die er beim Anblick dieser sich verändernden Augen empfand.
„Natürlich will ich das. Ich bin wohl etwas zu dreist, nachdem wir uns gerade erst kennengelernt haben. Aber ich habe vielleicht keine weitere Gelegenheit, dir das zu sagen, also nimm es mir bitte nicht übel.“
Nachdem er diese Erklärung abgegeben hatte, verspürte Jean Erleichterung und eine gewisse Freude. Er hatte befürchtet, dass er vielleicht nicht den Mut haben würde, es zu sagen. Sie ging weiter wie zuvor, nur mit leicht gesenktem Kopf und niedergeschlagenen Augen. Auf ihren Wangen war nichts zu sehen außer der goldbraunen Bräune und dem blauen Geflecht der Adern. Da bemerkte er ein leichtes Zittern in ihrem Hals, und ihm wurde bewusst, wie anmutig seine Kontur war, wie voll und pulsierend er war und wie edel er sich in die Rundung ihrer Schulter einfügte. Hier, in ihrem zitternden Hals, lag ihre Schwäche, der Beweis ihres Geschlechts, die Weiblichkeit, die im Widerspruch zu ihrem bergsteigerhaften Gang und dem Griff ihrer starken braunen Hände um ein Gewehr stand. Das hatte eine Wirkung auf Jean, die für ihn völlig unerklärlich war, sowohl in der seltsamen Wärme, die ihn überkam, als auch in den Worten, die er nicht zurückhalten konnte.
„Mädchen, wir sind Fremde, aber was macht das schon? Wir sind uns begegnet, und ich sage dir, das bedeutet mir etwas. Ich kenne Mädchen seit Monaten und habe noch nie so empfunden. Ich weiß nicht, wer du bist, und es ist mir egal. Du hast mir viel verraten. Du bist nicht glücklich. Du bist einsam. Und wenn ich dich nicht um meinetwillen wiedersehen wollte, würde ich es um deinetwillen tun. Einige Dinge, die du gesagt hast, werde ich nicht so schnell vergessen. Ich habe eine Schwester, und ich weiß, dass du keinen Bruder hast. Und ich denke ...“
In diesem Moment ergriff Jean in seiner Ernsthaftigkeit und ganz ohne nachzudenken ihre Hand. Die Berührung unterbrach seinen Redefluss und ließ ihn plötzlich über seine Kühnheit entsetzt sein. Aber das Mädchen machte keine Anstalten, ihre Hand zurückzuziehen. Also holte Jean tief Luft und versuchte, seine Verwirrung zu überwinden, und hielt tapfer durch. Er glaubte, einen schwachen, warmen Druck zu spüren, der seinen Griff erwiderte. Sie war jung, sie hatte keine Freunde, sie war ein Mensch. Durch diese Hand in seiner spürte Jean mehr denn je ihre Einsamkeit. Doch gerade als er wieder etwas sagen wollte, zog sie ihre Hand zurück.
„Da ist der Rand“, sagte sie in ihrem urigen Südstaatenakzent. „Und da ist dein Tonto-Becken.“
Jean hatte sich nur auf das Mädchen konzentriert. Er war neben ihr hergelaufen, ohne auf das zu achten, was vor ihm lag. Als sie das sagte, schaute er erwartungsvoll auf und war sprachlos.
Er spürte eine schiere Kraft, ein Herabziehen in einen riesigen Abgrund unter ihm. Als er in die Ferne blickte, sah er ein schwarzes Becken aus bewaldetem Land, das dunkelste und wildeste, das er je gesehen hatte, hundert Meilen blaue Weite bis zu einer weitläufigen Bergkette, die sich violett gegen den Himmel abzeichnete. Es schien eine gewaltige Schlucht zu sein, die auf drei Seiten von kühnen, wellenförmigen Bergketten umgeben war und auf seiner Seite von einer Wand, die so hoch war, dass er sich in die Höhe des Himmels erhoben fühlte.
„Im Südosten siehst du die Sierra Anchas“, sagte das Mädchen und deutete mit dem Finger. „Die Kerbe in der Bergkette dort ist der Pass, durch den die Schafe nach Phoenix und Maricopa getrieben werden. Diese großen, schroffen Berge im Süden sind die Mazatzals. Und dort im Westen liegt die Four-Peaks-Kette. Und du stehst hier auf dem Rim.“
Jean konnte zunächst nicht erkennen, was der Rim war, aber als er seinen Blick nach Westen wandte, begriff er dieses bemerkenswerte Naturphänomen. Meilenweit schien sich eine kolossale rote und gelbe Mauer, ein Wall, eine bergige Klippe, im Zickzack nach Westen zu erstrecken. Die Felsvorsprünge, die sich über die Leere erstreckten, waren großartig und kühner. Sie verliefen in Richtung der untergehenden Sonne. Die langen Linien, die von ihnen wegslanteten, waren beeindruckend und verliefen dunkel gefleckt, bis sie in den schwarzen Wald übergingen. Jean hatte noch nie eine so wilde und raue Manifestation der Tiefen und Umwälzungen der Natur gesehen. Er war sprachlos.
„Fremder, schau nach unten“, sagte das Mädchen.
Jeans Blick war geschult, Höhen, Tiefen und Entfernungen einzuschätzen. Die Wand, auf der er stand, fiel so steil ab, dass ihm beim Hinsehen schwindelig wurde, und dann gingen die zerklüfteten, zerbrochenen Klippen in rot schimmernde, von Zedern bewachsene Hänge über, die sich immer weiter hinunter in mit Wäldern bewachsene Schluchten erstreckten, aus denen das Rauschen von reißenden Gewässern emporstieg. Hang um Hang, Kamm um Kamm, Schlucht um Schlucht – so versank die gewaltige Mulde in ihren schwarzen, trügerischen Tiefen, eine Wildnis, die unmöglich zu durchqueren schien.
„Wunderbar!“, rief Jean aus.
„Das ist es wirklich!“, flüsterte das Mädchen. „Das ist Arizona. Ich glaube, ich liebe DIESES Land. Die Höhen und Tiefen – die Erhabenheit seiner Wildnis!“
„Und du willst hier weg?“
„Ja und nein. Ich leugne nicht, dass ich hier Frieden finde. Aber ich sehe das Becken nicht oft, und außerdem lebt man nicht von grandiosen Landschaften.“
„Kind, selbst wenn es nur ab und zu ist – dieser Anblick würde jedes Leid heilen, wenn du ihn nur sehen würdest. Ich bin froh, dass ich gekommen bin. Ich bin froh, dass du ihn mir als Erstes gezeigt hast.“
Auch sie schien unter dem Bann der Weite, Einsamkeit, Schönheit und Erhabenheit zu stehen, die das Herz einfach berühren mussten.
Jean nahm wieder ihre Hand. „Mädchen, sag, dass du mich hier treffen wirst“, sagte er, und seine Stimme hallte tief in seinen Ohren wider.
„Natürlich werde ich das“, antwortete sie leise und wandte sich ihm zu. In diesem Moment schien Jean ihr Gesicht zum ersten Mal zu sehen. Sie war so schön, wie er noch nie zuvor Schönheit gesehen hatte. Vor dieser Kulisse erweckte sie sie zum Leben – wildes, süßes, junges Leben –, dessen ergreifende Bedeutung ihn verfolgte und ihm doch entging. Aber sie gehörte hierher. Ihre Augen suchten erneut seine, als suchten sie einen verlorenen Teil von ihr selbst, einen Teil, den sie noch nicht erkannt hatte, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Neugierig, sehnsüchtig, hoffnungsvoll, froh – es waren Augen, die überrascht schienen, einen Teil ihrer Seele zu offenbaren.
Dann öffneten sich ihre roten Lippen. Ihre zitternde Bewegung zog Jean wie ein Magnet an. Eine unsichtbare, mächtige Kraft zog ihn zu ihr hinunter, um sie zu küssen. Was auch immer der Zauber gewesen war, diese unhöfliche, unbewusste Handlung brach ihn.
Er zuckte zurück, als würde er einen Schlag erwarten. „Mädchen – ich – ich“, keuchte er erstaunt und plötzlich von Reue erfüllt, „ich habe dich geküsst – aber ich schwöre, es war nicht absichtlich – ich hätte nie gedacht ...“
Die Wut, die Jean erwartet hatte, blieb aus. Er stand da, schwer atmend, mit ausgestreckter Hand in unbewusstem Flehen. Durch dieselbe Magie vielleicht, die sie einen Moment zuvor verwandelt hatte, war sie nun wieder von ihrem älteren Charakter erfüllt.
„Ich glaube, ich habe Sie etwas voreilig als Gentleman bezeichnet“, sagte sie mit einer gewissen trockenen Bitterkeit. „Aber, Fremder, Sie sind sehr direkt.“
„Du bist doch nicht beleidigt?“, fragte Jean hastig.
„Oh, ich wurde schon öfter geküsst. Männer sind alle gleich.“
„Das sind sie nicht“, antwortete er hitzig, mit einem leichten Anflug von Desillusionierung, einem Nachlassen der Verzauberung. „Stell mich nicht auf eine Stufe mit anderen Männern, die dich geküsst haben. Ich war nicht ich selbst, als ich es tat, und ich wäre auf die Knie gegangen, um dich um Vergebung zu bitten ... Aber jetzt würde ich das nicht tun – und ich würde dich auch nicht noch einmal küssen, selbst wenn du es wolltest.“
Jean las in ihrem seltsamen Blick etwas, das ihm wie ein vager Zweifel erschien, als würde sie ihn hinterfragen.
„Miss, ich nehme das zurück“, fügte Jean kurz hinzu. „Es tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Es war gemein von mir, dich zu küssen. Ein Mädchen, allein im Wald, das sich so sehr bemüht hat, nett zu mir zu sein! Ich weiß nicht, warum ich meine Manieren vergessen habe. Und ich bitte dich um Verzeihung.“
Sie schaute weg und zeigte dann weit weg hinunter ins Becken.
„Da ist Grass Valley. Der lange graue Fleck im Schwarzen. Es ist etwa fünfzehn Meilen entfernt. Reite den Rand entlang, bis du einen Weg überquerst. Du kannst ihn nicht verfehlen. Dann geh hinunter.“
„Ich bin dir sehr dankbar“, antwortete Jean und akzeptierte widerwillig, was er als seine Entlassung ansah. Er wendete sein Pferd, setzte den Fuß in den Steigbügel und blickte dann zögernd über den Sattel hinweg zu dem Mädchen. Ihre Abwesenheit, während sie in die violetten Tiefen starrte, deutete auf Einsamkeit und Wehmut hin. Sie dachte nicht an die Landschaft, die sich so wundersam vor ihr ausbreitete. Jean kam der Gedanke, dass sie vielleicht über eine subtile Veränderung in seinen Gefühlen und seiner Haltung nachdachte, etwas, das ihm bewusst war, das er aber nicht definieren konnte.
„Ich nehme an, das ist ein Abschied“, sagte er zögernd.
„ADIOS, SENOR“, antwortete sie und wandte sich wieder ihm zu. Sie hob die kleine Karabinerpistole an ihre Ellenbeuge und schien, halb umdrehend, bereit zu sein, zu gehen.
„Adios bedeutet Auf Wiedersehen?“, fragte er.
„Ja, auf Wiedersehen bis morgen oder auf Wiedersehen für immer. Versteh es, wie du willst.“
„Dann treffen wir uns übermorgen hier wieder?“ Wie eifrig er sprach, aus einem Impuls heraus, ohne über das Ungreifbare nachzudenken, das ihn verändert hatte!
„Habe ich gesagt, dass ich nicht komme?“
„Nein. Aber ich dachte, du hättest nach ... keine Lust mehr“, antwortete er und brach verwirrt ab.
„Klar, ich freue mich, dich zu sehen. Übermorgen gegen Nachmittag. Genau hier. Bring mir alle Neuigkeiten aus Grass Valley mit.“
„Okay. Danke. Das wird ... gut“, antwortete Jean, und während er sprach, verspürte er eine beschwingte Aufregung, eine angenehme Leichtigkeit der Begeisterung, wie sie immer in ihm aufkam, wenn er ein Abenteuer erwartete. Bevor dieses Gefühl verflog, wunderte er sich darüber und fühlte sich unsicher. Er musste nachdenken.
„Stranger Shore, ich kann mich nicht erinnern, dass du mir gesagt hast, wer du bist“, sagte sie.
„Nein, ich glaube, das habe ich nicht“, erwiderte er. „Was macht das schon für einen Unterschied? Ich habe gesagt, dass es mir egal ist, wer oder was du bist. Kannst du nicht dasselbe über mich denken?“
„Klar – das habe ich auch so empfunden“, antwortete sie etwas verwirrt, während sie ihn mit ihrem braunen Blick unverwandt ansah. „Aber jetzt bringst du mich zum Nachdenken.“
„Lass uns treffen, ohne mehr voneinander zu wissen als jetzt.“
„Klar. Das würde mir gefallen. In diesem großen, wilden Arizona fühlt sich ein Mädchen – und ich denke, auch ein Mann – so unbedeutend. Was bedeutet schon ein Name? Trotzdem müssen Menschen und Dinge unterschieden werden. Ich werde dich “Fremder„ nennen und damit zufrieden sein – wenn du sagst, dass es für dich fair ist, nicht zu sagen, wer du bist.“
„Fair! Nein, das ist es nicht“, erklärte Jean und musste gestehen. „Mein Name ist Jean – Jean Isbel.“
„ISBEL!“, rief sie mit einem heftigen Ruck aus. „Du kannst doch unmöglich der Sohn des alten Gass Isbel sein ... Ich habe seine beiden Söhne gesehen.“
„Er hat drei“, antwortete Jean erleichtert, jetzt, wo das Geheimnis gelüftet war. „Ich bin der Jüngste. Ich bin vierundzwanzig. Ich war bis jetzt noch nie außerhalb von Oregon. Auf dem Weg ...“
Die braune Farbe wich langsam aus ihrem Gesicht, sodass sie ganz blass wurde und ihre Augen zu leuchten begannen. Ihre Geschmeidigkeit schien sich zu versteifen.
„Ich heiße Ellen Jorth“, platzte sie leidenschaftlich heraus. „Sagt dir das irgendwas?“
„Ich habe diesen Namen noch nie in meinem Leben gehört“, protestierte Jean. „Ich dachte natürlich, Sie gehören zu den Schafzüchtern, die mit meinem Vater zerstritten sind. Deshalb musste ich Ihnen sagen, dass ich Jean Isbel bin ... Ellen Jorth. Das ist seltsam und schön ... Ich denke, ich kann Ihnen genauso eine gute Freundin sein ...“
„Niemand namens Isbel kann jemals mein Freund sein“, sagte sie mit bitterer Kälte. Ihre Gelassenheit und ihre sanfte Sehnsucht waren wie weggeblasen, und sie stand einen Moment lang vor ihm wie ein völlig anderes Mädchen, eine feindselige Gegnerin. Dann drehte sie sich um und ging mit schnellen Schritten in den Wald hinein.
Jean sah ihr erstaunt und bestürzt nach, wie sie sich mit ihren geschmeidigen, freien Schritten schnell entfernte, und wollte ihr folgen, wollte sie rufen; aber die Verbitterung, die ihre plötzlich bekundete Feindseligkeit in ihm hervorrief, hielt ihn stumm an seinem Platz fest. Er sah ihr nach, wie sie verschwand, und als die braun-grüne Wand des Waldes die schlanke graue Gestalt verschluckte, kämpfte er gegen den drängenden Wunsch, ihr zu folgen, und kämpfte vergeblich.
KAPITEL II
Aber Ellen Jorths Mokassinfüße hinterließen keine erkennbaren Spuren auf dem federnden Nadelteppich, der den Boden bedeckte, und Jean konnte keine Spur von ihr finden.
Ein wenig vergebliches Hin- und Herlaufen kühlte seinen Impuls ab und rief seinen Stolz zu Hilfe. Er kehrte zu seinem Pferd zurück, stieg auf, ritt hinter dem Packesel her, um ihn in Gang zu bringen, und spürte bald die Erleichterung, eine Entscheidung getroffen und gehandelt zu haben. An einigen Stellen wuchsen dichte Büschel kleiner Kiefern am Rand, sodass er um sie herumreiten musste; dabei verlor er das violette Becken aus den Augen. Jedes Mal, wenn er zu einer Lichtung zurückkam, von der aus er die wilde Rauheit, die Farben und die Weiten sehen konnte, wuchs seine Wertschätzung für ihre Natur. Arizona von Yuma bis zum Little Colorado war für ihn eine endlose, vom Wind verwehte, von der Sonne versengte Öde gewesen. Dieses schwarz bewaldete, von Felsen umgebene Land mit seinen unberührten Pfaden war eine Welt, die ihn an sich schon zufriedenstellte. Ein Instinkt in Jean verlangte nach einem einsamen, wilden Land, in dessen Festungen er nach Belieben umherstreifen und das andere, seltsame Selbst sein konnte, das er sich immer gewünscht hatte, aber nie gewesen war.
Immer wieder drängte sich ihm das strahlende Gesicht von Ellen Jorth in sein Bewusstsein, die Art, wie sie ihn angesehen hatte, die Dinge, die sie gesagt hatte. „Ich war wohl ein Dummkopf“, sagte er zu sich selbst mit einem starken Gefühl der Demütigung. „Sie hat nie erkannt, wie ernst es mir war.“ Und Jean begann sich mit einer Lebhaftigkeit an die Umstände zu erinnern, die ihn beunruhigte und verwirrte.
Der Zufall, einem solchen Mädchen an diesem einsamen Ort zu begegnen, mochte ungewöhnlich sein – aber es war passiert. Die Überraschung hatte ihn benommen gemacht. Der Charme ihres Aussehens, die Anziehungskraft ihres Wesens mussten ihn von Anfang an angezogen haben, aber er hatte es nicht erkannt. Erst als sie sagte: „Oh, ich bin schon einmal geküsst worden“, wurden seine Gefühle in ihrem unbedachten Verlauf gebremst. Und diese Worte hatten einen Unterschied gemacht, den er nun zu analysieren versuchte. Eine Seite seiner Persönlichkeit, eine Stimme, eine Idee hatte begonnen, sie zu verteidigen, noch bevor er sich bewusst wurde, dass er sie vor sein Urteil gestellt hatte. Diese Verteidigung schien nun in ihm lautstark zu sein, und er zwang sich, ihr zuzuhören. In seinem verletzten Stolz wollte er seine erstaunliche Hingabe an einen süßen und sentimentalen Impuls rechtfertigen.
Jetzt wurde ihm klar, dass er auf den ersten Blick in ihrem Blick, ihrer Haltung, ihrer Stimme die Eigenschaft hätte erkennen müssen, die er als „vollblütig“ bezeichnete. Ihre zerlumpte und fleckige Kleidung bewies nicht, dass sie von gewöhnlicher Herkunft war. Jean kannte eine Reihe von feinen und gesunden Mädchen aus guter Familie, und er erinnerte sich an seine Schwester. Diese Ellen Jorth war eine solche Frau, unabhängig von ihrer gegenwärtigen Umgebung. Jean verteidigte sie loyal, selbst nachdem er seinen egoistischen Stolz befriedigt hatte.
In diesem Moment – im Kampf mit einem unfassbaren und heimlichen Zauber, unwirklich und fantasievoll wie der Traum von einer verbotenen Verzauberung – kam Jean zu dem Teil des kleinen Walddramas, in dem er Ellen Jorth geküsst hatte und nicht zurechtgewiesen worden war. Warum hatte sie seine Handlung nicht übel genommen? Die Illusion, die er träumerisch und edel aufgebaut hatte, war zerstreut. „Oh, ich wurde schon einmal geküsst!“ Der Schock, den er nun empfand, übertraf seine anfängliche Bestürzung. Sie hatte halb bitter gesprochen und war voller Verachtung für sich selbst, für ihn oder für alle Männer. Denn sie hatte gesagt, alle Männer seien gleich. Jean ärgerte sich über diese Beleidigung, die jeder anständige Mann hasste. Natürlich würde jeder glückliche und gesunde junge Mann solche roten, süßen Lippen küssen wollen. Aber wenn diese Lippen für andere bestimmt gewesen wären – niemals für ihn! Jean dachte darüber nach, dass er seit seinen Kinderspielen kein Mädchen mehr geküsst hatte – bis diese braunhäutige Ellen Jorth in sein Leben trat. Er wunderte sich darüber. Außerdem wunderte er sich über die Bedeutung, die er dem beimessete. War es nicht letztlich nur ein Zufall? Warum sollte er sich daran erinnern? Warum sollte er darüber nachdenken? Was war das für ein schwaches, tiefes, wachsendes Kribbeln, das einige seiner Gedanken begleitete?