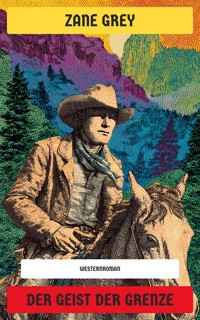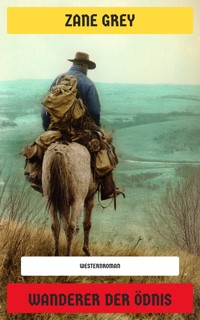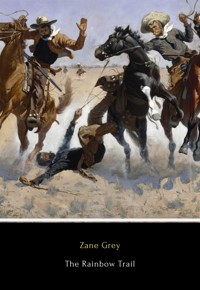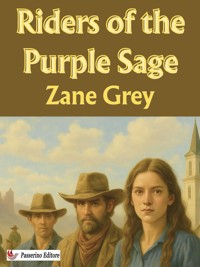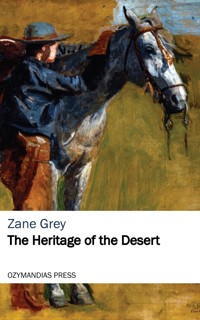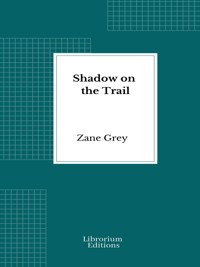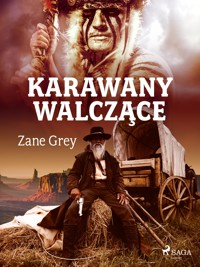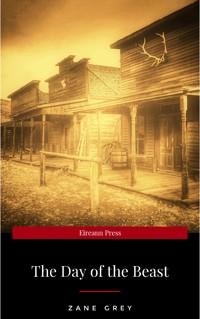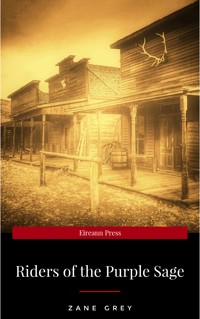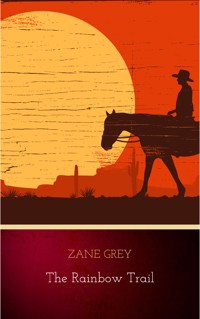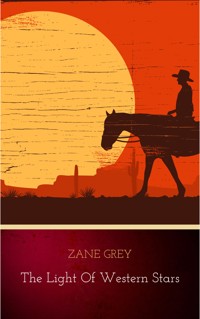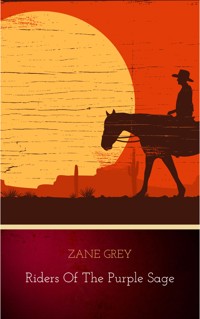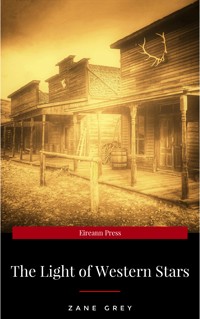0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Der einsame Ranger" von Zane Grey ist ein mitreißender Westernroman über den inneren Kampf eines Mannes, der gezwungen ist, zum Geächteten zu werden – und sich doch nach Recht und Frieden sehnt. Im Mittelpunkt steht Buck Duane, der letzte Spross einer Familie von Revolverhelden. In ihm lodert ein gefährliches Erbe – der instinktive Drang zum Kampf, den er vergeblich zu unterdrücken versucht. Als in seiner Heimatstadt ein trunkener Cowboy namens Cal Bain Streit sucht, warnt ihn sein Onkel, sich fernzuhalten. Doch Buck kann der Herausforderung nicht ausweichen: In Texas gilt es als Feigheit, sich zurückzuziehen. Als Bain zur Waffe greift, tötet Duane ihn in Notwehr – und wird dadurch selbst zum Gesetzlosen. Von diesem Moment an beginnt für Buck eine rastlose Flucht durch die unendlichen Weiten des texanischen Grenzlands. Er wird zum einsamen Wanderer, ständig zwischen Leben und Tod, zwischen Schuld und Gerechtigkeit. In der rauen Wildnis begegnet er gefährlichen Banditen, aber auch Menschen, die ihm Hoffnung geben – darunter mutige Frauen, die in ihm mehr sehen als nur den gefürchteten Revolvermann. Doch der Schatten seiner Tat bleibt. Zane Grey zeichnet in eindringlichen Bildern die seelische Zerrissenheit eines Mannes, der nicht böse ist, aber vom Gesetz dazu gemacht wurde. Die glühende Sonne, der Staub der Prärie und das stetige Drohen der Gewalt bilden die Kulisse einer Geschichte, die von innerer Stärke, Ehre und Erlösung handelt. "Der einsame Ranger" ist mehr als nur ein klassischer Western – es ist ein spannendes Psychogramm eines Mannes, der gezwungen ist, gegen seine eigene Natur anzukämpfen, und der in der Wildnis nicht nur Feinde, sondern auch sich selbst findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der einsame Ranger
Inhaltsverzeichnis
An HAUPTMANN JOHN HUGHES und seine Texas Rangers
Es mag euch komisch vorkommen, dass ich von allen Geschichten, die ich am Rio Grande gehört habe, als erste die von Buck Duane – einem Gesetzlosen und Revolverhelden – ausgewählt habe.
Aber Ranger Coffees Geschichte über den letzten der Duanes hat mich wirklich nicht losgelassen, und ich habe meiner Fantasie freien Lauf gelassen und sie auf meine eigene Art nacherzählt. Sie handelt vom alten Gesetz – den alten Tagen an der Grenze – und deshalb passt sie am besten an den Anfang. Vielleicht werde ich bald das Vergnügen haben, über die Grenze von heute zu schreiben, die in Joe Sitters lakonischer Rede „Shore ist fast so schlimm und wild wie eh und je!“
Im Norden und Osten herrscht die weit verbreitete Meinung, dass die Grenze des Westens längst Vergangenheit ist und nur noch in Geschichten in Erinnerung bleibt. Wenn ich daran denke, erinnere ich mich an Ranger Sitter, als er diese Bemerkung machte, während er grimmig eine noch nicht verheilte Schusswunde streichelte. Und ich erinnere mich an den Riesen Vaughn, diesen typischen Sohn des robusten Texas, der mit bandagiertem Kopf still dasaß und mit seinem nachdenklichen Blick dem Gesetzlosen, der ihm aufgelauert hatte, Unheil prophezeite. Nur wenige Monate sind seitdem vergangen – seit meinem unvergesslichen Aufenthalt bei Ihnen – und doch haben Russell und Moore in dieser kurzen Zeit wie Rangers die Grenze überschritten.
Meine Herren,—ich habe die Ehre, Ihnen dieses Buch zu widmen, in der Hoffnung, dass es mir vergönnt sein möge, der Welt die Wahrheit über eine seltsame, einzigartige und oft missverstandene Gemeinschaft von Männern zu berichten—die Texas Rangers—die den großen Staat des Einsamen Sterns bewohnbar machten, die niemals friedliche Ruhe und Schlaf kannten, die im Begriff sind zu verschwinden, die gewiss nicht vergessen werden und eines Tages zu ihrem Recht gelangen werden.
ZANE GREY
BUCH I. DER GESETZLOSE
KAPITEL I
Es war also in ihm – ein angeborener Kampfinstinkt, ein drängender Drang zu töten. Er war der Letzte der Duane, dieser alten Kämpferfamilie aus Texas. Aber weder die Erinnerung an seinen toten Vater noch die flehentlichen Bitten seiner sanftmütigen Mutter noch die Warnung seines Onkels, der jetzt vor ihm stand, hatten Buck Duane so sehr bewusst gemacht, welche dunkle Leidenschaft in seinem Blut schlummerte. Es war das Wiederauftreten einer seltsamen Emotion, die in den letzten drei Jahren in ihm aufgekommen war und nun hundertfach an Stärke zugenommen hatte.
„Ja, Cal Bain ist in der Stadt, voll mit schlechtem Whisky und auf der Jagd nach dir“, wiederholte der ältere Mann ernst.
„Das ist schon das zweite Mal“, murmelte Duane, als würde er mit sich selbst reden.
„Junge, du kannst einer Begegnung nicht ausweichen. Verlasse die Stadt, bis Cal wieder nüchtern ist. Wenn er nicht trinkt, hat er nichts gegen dich.“
„Aber was will er von mir?“, fragte Duane. „Mich wieder beleidigen? Das lasse ich mir kein zweites Mal gefallen.“
„Er hat ein Fieber, das derzeit in Texas grassiert, mein Junge. Er will eine Schießerei. Wenn er dich trifft, wird er versuchen, dich umzubringen.“
Da regte sich wieder etwas in Duane, dieser brodelnde Blutstrom, wie ein Feuerwind, der sein Innerstes erschütterte und dann nachließ und ihn seltsam kalt zurückließ.
„Mich töten! Wozu?“, fragte er.
„Gott weiß, dass es keinen Grund gibt. Aber was hat das mit den meisten Schießereien heutzutage zu tun? Haben sich nicht fünf Cowboys bei Everall gegenseitig umgebracht, nur weil sie sich wegen einer Peitsche gestritten haben? Und Cal hat keinen Grund, dich zu mögen. Seine Freundin war in dich verliebt.“
„Ich habe aufgehört, als ich herausfand, dass sie seine Freundin war.“
„Ich glaube, sie hat nicht aufgehört. Aber vergiss sie und die Gründe. Cal ist hier, gerade betrunken genug, um unausstehlich zu sein. Er will unbedingt jemanden umbringen. Er ist einer dieser angeberischen Revolverhelden. Er möchte, dass man ihn für böse hält. Es gibt viele wilde Cowboys, die nach Ruhm streben. Sie reden davon, wie schnell sie mit dem Revolver sind. Sie ahmen Bland, King Fisher, Hardin und all die großen Gesetzlosen nach. Sie drohen damit, sich den Banden am Rio Grande anzuschließen. Sie lachen über die Sheriffs und prahlen damit, wie sie es den Rangers zeigen würden. Cal ist sicher keine große Gefahr für dich, wenn du ihm nur aus dem Weg gehst.“
„Du meinst, ich soll weglaufen?“, fragte Duane verächtlich.
„Ich würde es nicht so sagen. Geh ihm einfach aus dem Weg. Buck, ich hab keine Angst, dass Cal dich erwischen würde, wenn du ihn in der Stadt triffst. Du hast die Augen deines Vaters und sein Geschick mit der Waffe. Was ich am meisten fürchte, ist, dass du Bain umbringst.“
Duane schwieg, ließ die ernsten Worte seines Onkels auf sich wirken und versuchte, ihre Bedeutung zu begreifen.
„Wenn Texas sich jemals von diesem blöden Krieg erholt und diese Gesetzlosen erledigt, dann hat ein junger Mann eine Chance“, fuhr der Onkel fort. „Du bist jetzt dreiundzwanzig und ein beeindruckender Kerl, abgesehen von deinem Temperament. Du hast eine Chance im Leben. Aber wenn du dich auf Schießereien einlässt, wenn du einen Mann tötest, bist du ruiniert. Dann wirst du einen weiteren töten. Es wird die gleiche alte Geschichte sein. Und die Rangers würden dich zum Gesetzlosen machen. Die Rangers stehen für Recht und Ordnung in Texas. Diese Sache mit der Chancengleichheit funktioniert bei ihnen nicht. Wenn du dich der Verhaftung widersetzt, töten sie dich. Wenn du dich der Verhaftung fügst, kommst du ins Gefängnis und wirst vielleicht gehängt.“
„Ich würde niemals gehängt werden“, murmelte Duane düster.
„Ich glaube auch nicht“, antwortete der alte Mann. „Du wärst wie dein Vater. Er war immer bereit zu ziehen – zu bereit. In Zeiten wie diesen, in denen die Texas Rangers das Gesetz durchsetzen, wäre dein Vater zum Fluss getrieben worden. Und, mein Sohn, ich fürchte, du bist ganz der Vater. Kannst du dich nicht zurückhalten, deine Wut zügeln, vor Ärger davonlaufen? Denn am Ende wirst du nur das Nachsehen haben. Dein Vater wurde bei einer Schlägerei auf offener Straße getötet. Und man erzählte sich, dass er noch zweimal geschossen habe, nachdem eine Kugel sein Herz durchschlagen hatte. Denk daran, wie schrecklich ein Mensch sein muss, um so etwas zu tun. Wenn du solches Blut in dir hast, gib ihm niemals eine Chance.“
„Was du sagst, ist alles schön und gut, Onkel“, erwiderte Duane, „aber der einzige Ausweg für mich ist die Flucht, und das werde ich nicht tun. Cal Bain und seine Bande haben mich bereits als Feigling hingestellt. Er sagt, ich hätte Angst, mich ihm zu stellen. Das kann ein Mann in diesem Land einfach nicht ertragen. Außerdem würde Cal mich eines Tages in den Rücken schießen, wenn ich mich ihm nicht stelle.“
„Na gut, was willst du dann machen?“, fragte der ältere Mann.
„Ich hab mich noch nicht entschieden.“
„Nein, aber du kommst der Entscheidung sehr schnell näher. Dieser verdammte Zauber wirkt auf dich. Du bist heute anders. Ich erinnere mich, wie launisch du früher warst, wie du die Beherrschung verloren hast und wilde Reden gehalten hast. Damals hatte ich keine große Angst vor dir. Aber jetzt wirst du kühl und ruhig, du denkst tiefgründig, und mir gefällt der Ausdruck in deinen Augen nicht. Er erinnert mich an deinen Vater.“
„Ich frage mich, was Dad heute zu mir sagen würde, wenn er noch am Leben und hier wäre“, sagte Duane.
„Was denkst du? Was könntest du von einem Mann erwarten, der zwanzig Jahre lang nie einen Handschuh an seiner rechten Hand getragen hat?“
„Nun, viel hätte er wohl kaum gesagt. Vater sprach nie viel. Aber er hätte eine Menge getan. Und ich schätze, ich werde in die Stadt hinuntergehen und Cal Bain Gelegenheit geben, mich zu finden.“
Dann folgte eine lange Stille, während der Duane mit gesenkten Augen dasaß und der Onkel in traurigen Gedanken über die Zukunft versunken schien. Schließlich wandte er sich Duane mit einem Ausdruck zu, der Resignation verriet, aber auch eine Lebhaftigkeit, die zeigte, dass sie vom selben Blut waren.
„Du hast ein schnelles Pferd – das schnellste, das ich in dieser Gegend kenne. Nachdem du Bain getroffen hast, komm schnell nach Hause zurück. Ich werde eine Satteltasche für dich packen und das Pferd bereitstellen.“
Damit drehte er sich auf dem Absatz um und ging ins Haus, während Duane über die seltsamen Worte seines Onkels nachdachte. Buck fragte sich, ob er die Meinung seines Onkels über das Ergebnis eines Treffens zwischen ihm und Bain teilte. Seine Gedanken waren unklar. Aber in dem Moment, als er sich endgültig entschied, Bain zu treffen, überkam ihn eine solche Welle der Leidenschaft, dass er sich fühlte, als würde er von Schüttelfrost geschüttelt. Doch das war alles innerlich, in seiner Brust, denn seine Hand war wie ein Fels und soweit er sehen konnte, zitterte kein Muskel an ihm. Er hatte keine Angst vor Bain oder irgendeinem anderen Mann, aber eine vage Angst vor sich selbst, vor dieser seltsamen Kraft in ihm, ließ ihn nachdenken und den Kopf schütteln. Es war, als hätte er in dieser Angelegenheit nicht das letzte Wort. Es schien, als hätte er sich nur ungern gehen lassen, und eine Stimme, ein Geist aus der Ferne, etwas, für das er nicht verantwortlich war, hatte ihn dazu gezwungen. Diese Stunde in Duanes Leben war wie Jahre des tatsächlichen Lebens, und in ihr wurde er zu einem nachdenklichen Mann.
Er ging ins Haus und schnallte seinen Gürtel und seine Waffe um. Die Waffe war eine Colt .45, sechs Schuss, schwer, mit einem Griff aus Elfenbein. Er hatte sie fünf Jahre lang immer wieder mitgenommen. Davor hatte sie sein Vater benutzt. In die Wölbung des Elfenbeingriffs waren mehrere Kerben gefeilt. Diese Waffe war diejenige, mit der sein Vater zweimal geschossen hatte, nachdem er durch das Herz getroffen worden war, und seine Hand hatte sich im Todesgriff so fest um sie geschlossen, dass seine Finger aufgezwungen werden mussten. Seit sie in Duanes Besitz gekommen war, hatte er sie nie auf einen Menschen gerichtet. Aber der kalte, glänzende Lack der Waffe zeigte, wie sie benutzt worden war. Duane konnte sie mit unvorstellbarer Schnelligkeit ziehen und aus sechs Metern Entfernung eine Karte spalten, die mit der Spitze zu ihm zeigte.
Duane wollte seiner Mutter nicht begegnen. Zum Glück, wie er dachte, war sie nicht zu Hause. Er ging hinaus und den Weg zum Tor hinunter. Die Luft war erfüllt vom Duft der Blüten und dem Gesang der Vögel. Draußen auf der Straße stand eine Nachbarin und unterhielt sich mit einem Bauern in einem Wagen; sie sprachen ihn an, und er hörte sie, antwortete aber nicht. Dann machte er sich auf den Weg die Straße hinunter in Richtung Stadt.
Wellston war eine kleine Stadt, aber wichtig in diesem unruhigen Teil des großen Staates, weil sie das Handelszentrum eines mehrere hundert Meilen großen Gebiets war. An der Hauptstraße standen vielleicht fünfzig Gebäude, einige aus Ziegeln, einige aus Holz, die meisten aus Lehmziegeln, und ein Drittel davon, die mit Abstand wohlhabendsten, waren Saloons. Von der Straße bog Duane in diese Straße ein. Es war eine breite Durchgangsstraße, gesäumt von Anbindevorrichtungen, gesattelten Pferden und Fahrzeugen verschiedener Art. Duanes Blick wanderte die Straße entlang und nahm alles auf einen Blick wahr, insbesondere Personen, die gemächlich auf und ab gingen. Kein Cowboy war zu sehen. Duane verlangsamte seine Schritte, und als er Sol Whites Lokal erreichte, das der erste Saloon war, ging er langsam. Mehrere Leute sprachen ihn an und drehten sich um, nachdem sie an ihm vorbeigegangen waren. Er blieb an der Tür von Whites Saloon stehen, schaute sich kurz um und ging dann rein.
Der Saloon war groß und kühl, voller Männer, Lärm und Rauch. Der Lärm verstummte, als er eintrat, und die darauf folgende Stille wurde nur durch das Klirren mexikanischer Silberdollar an einem Monte-Tisch unterbrochen. Sol White, der hinter der Bar stand, richtete sich auf, als er Duane sah, und beugte sich dann, ohne ein Wort zu sagen, vor, um ein Glas zu spülen. Alle Augen außer denen der mexikanischen Spieler waren auf Duane gerichtet, und diese Blicke waren scharf, spekulativ, fragend. Diese Männer wussten, dass Bain Ärger suchte; wahrscheinlich hatten sie seine Prahlereien gehört. Aber was hatte Duane vor? Mehrere der anwesenden Cowboys und Rancher tauschten Blicke aus. Duane wurde von Männern, die alle Waffen trugen, mit dem unfehlbaren Instinkt der Texaner gemessen. Der Junge war der Sohn seines Vaters. Daraufhin begrüßten sie ihn und kehrten zu ihren Drinks und Karten zurück. Sol White stand mit seinen großen roten Händen auf der Bar; er war ein großer, knochiger Texaner mit einem langen, zu scharfen Spitzen gewachsten Schnurrbart.
„Howdy, Buck“, begrüßte er Duane. Er sprach unbekümmert und wandte seinen dunklen Blick für einen Moment ab.
„Hey, Sol“, antwortete Duane langsam. „Sag mal, Sol, ich hab gehört, dass ein Typ in der Stadt ist, der mich dringend sucht.“
„Vermutlich, Buck“, antwortete White. „Er kam vor etwa einer Stunde hierher. Er war ziemlich wütend und schrie nach Blut. Er erzählte mir vertraulich, dass eine bestimmte Person dir einen weißen Seidenschal geschenkt habe, und er war fest entschlossen, ihn mit roten Flecken nach Hause zu tragen.“
„War jemand bei ihm?“, fragte Duane.
„Burt und Sam Outcalt und ein kleiner Cowboy, den ich noch nie gesehen habe. Sie alle haben ihn überredet, die Stadt zu verlassen. Aber er hat in den Kristallkugel geschaut, Buck, und er ist hier, um zu bleiben.“
„Warum sperrt Sheriff Oaks ihn nicht ein, wenn er so schlimm ist?“
„Oaks ist mit den Rangers weggegangen. Es gab einen weiteren Überfall auf Fleshers Ranch. Wahrscheinlich die King-Fisher-Bande. Und so ist die Stadt völlig ungeschützt.“
Duane ging nach draußen und schaute die Straße hinunter. Er lief den ganzen langen Block entlang und traf viele Leute – Bauern, Rancher, Angestellte, Händler, Mexikaner, Cowboys und Frauen. Es war schon komisch, dass die Straße fast leer war, als er umkehrte, um zurückzugehen. Er war noch keine hundert Meter zurück, da war die Straße schon komplett menschenleer. Ein paar Köpfe ragten aus Türen und um Ecken hervor. Auf der Hauptstraße von Wellston kam es alle paar Tage zu solchen Situationen. Wenn es für Texaner ein Instinkt war, zu kämpfen, dann war es für sie auch ein Instinkt, die Anzeichen einer bevorstehenden Schießerei mit bemerkenswerter Schnelligkeit zu erkennen. Gerüchte konnten sich nicht so schnell verbreiten. In weniger als zehn Minuten wussten alle, die auf der Straße oder in den Geschäften gewesen waren, dass Buck Duane herausgekommen war, um seinem Feind entgegenzutreten.
Duane ging weiter. Als er fünfzig Schritte vor einem Saloon angekommen war, bog er in die Mitte der Straße aus, blieb dort einen Moment stehen, ging dann weiter und kehrte zum Bürgersteig zurück. Auf diese Weise ging er die ganze Länge des Blocks entlang. Sol White stand in der Tür seines Saloons.
„Buck, ich gebe dir einen Tipp“, sagte er schnell und mit leiser Stimme. „Cal Bain ist bei Everall. Wenn er dich wirklich so sehr jagt, wie er prahlt, wird er dort auftauchen.“
Duane überquerte die Straße und ging los. Trotz Whites Aussage war Duane vorsichtig und ging langsam an jeder Tür vorbei. Es passierte nichts, und er durchquerte fast den gesamten Block, ohne eine Person zu sehen. Everalls Lokal befand sich an der Ecke.
Duane wusste, dass er kaltblütig und ruhig war. Er spürte eine seltsame Wut, die ihn dazu brachte, vorwärts springen zu wollen. Er schien sich nach dieser Begegnung mehr zu sehnen als nach allem, was er jemals gewollt hatte. Aber so lebhaft seine Empfindungen auch waren, er fühlte sich wie in einem Traum.
Bevor er Everalls Wohnung erreichte, hörte er laute Stimmen, von denen eine besonders laut war. Dann schwang die niedrige Tür nach außen, als würde sie von einer kräftigen Hand aufgestoßen. Ein o-beiniger Cowboy in wollenen Chaps stürmte auf den Bürgersteig. Als er Duane sah, schien er in die Luft zu springen und stieß einen wilden Schrei aus.
Duane blieb am äußeren Rand des Bürgersteigs stehen, vielleicht ein Dutzend Meter von Everalls Tür entfernt.
Wenn Bain betrunken war, zeigte er es nicht in seinen Bewegungen. Er stolzierte vorwärts und schloss schnell die Lücke. Rot, verschwitzt, zerzaust und ohne Hut, mit verzerrtem Gesicht, das die bösartigsten Absichten ausdrückte, war er eine wilde und unheimliche Gestalt. Er hatte bereits einen Mann getötet, und das zeigte sich in seinem Verhalten. Seine Hände waren vor ihm ausgestreckt, die rechte etwas tiefer als die linke. Bei jedem Schritt brüllte er seine Wut in Form von Flüchen heraus. Allmählich wurde er langsamer und blieb dann stehen. Gut fünfundzwanzig Schritte trennten die beiden Männer.
„Willst du nicht ziehen, du ...!“, schrie er wütend.
„Ich warte auf dich, Cal“, antwortete Duane.
Bains rechte Hand versteifte sich – bewegte sich. Duane warf seine Waffe wie ein Junge einen Ball unterhand wirft – eine Technik, die ihm sein Vater beigebracht hatte. Er drückte zweimal ab, seine Schüsse waren fast wie einer. Bains großer Colt donnerte, während er nach unten zeigte und er zu Boden fiel. Seine Kugel spritzte Staub und Kies an Duanes Füßen auf. Er fiel locker, ohne sich zu verrenken.
In einem Augenblick wurde Duane klar, was wirklich los war. Er ging vorwärts und hielt seine Waffe bereit, um auf die kleinste Bewegung von Bain zu reagieren. Aber Bain lag auf dem Rücken, und nur seine Brust und seine Augen bewegten sich. Wie seltsam war das Rot aus seinem Gesicht gewichen – und auch die Verzerrung! Der Teufel, der sich in Bain gezeigt hatte, war verschwunden. Er war nüchtern und bei Bewusstsein. Er versuchte zu sprechen, schaffte es aber nicht. Seine Augen drückten etwas erbärmlich Menschliches aus. Sie veränderten sich – rollten – wurden leer.
Duane holte tief Luft und steckte seine Waffe weg. Er fühlte sich ruhig und gelassen und war froh, dass der Kampf vorbei war. Ein heftiger Ausdruck entfuhr ihm. „Der Idiot!“
Als er aufblickte, waren Männer um ihn herum.
„Volltreffer“, sagte einer.
Ein anderer, ein Cowboy, der offensichtlich gerade den Spieltisch verlassen hatte, beugte sich vor und öffnete Bains Hemd. Er hatte das Pik-Ass in der Hand. Er legte es auf Bains Brust, und die schwarze Figur auf der Karte bedeckte die beiden Einschusslöcher direkt über Bains Herz.
Duane drehte sich um und eilte davon. Er hörte einen anderen Mann sagen:
„Ich denke, Cal hat bekommen, was er verdient hat. Buck Duane hat zum ersten Mal geschossen. Wie der Vater, so der Sohn!“
KAPITEL II
Ein Gedanke ging Duane immer wieder durch den Kopf, nämlich dass er sich die Sorge hätte sparen können, indem er sich vorstellte, wie schrecklich es wäre, einen Mann zu töten. Jetzt hatte er dieses Gefühl nicht mehr. Er hatte die Gemeinde von einem betrunkenen, prahlerischen, streitsüchtigen Cowboy befreit.
Als er zum Tor seines Hauses kam und dort seinen Onkel mit einem mächtigen Pferd sah, gesattelt, mit Feldflasche, Lasso und Satteltaschen, durchfuhr ihn ein leichter Schock. Er hatte es vergessen – die Konsequenz seiner Tat. Aber der Anblick des Pferdes und der Blick seines Onkels erinnerten ihn daran, dass er nun ein Flüchtling werden musste. Eine unvernünftige Wut überkam ihn.
„Dieser verdammte Idiot!“, rief er wütend. „Die Begegnung mit Bain war keine große Sache, Onkel Jim. Er hat mir nur die Stiefel abgestaubt, das ist alles. Und dafür muss ich jetzt untertauchen.“
„Sohn, hast du ihn getötet?“, fragte der Onkel mit heiserer Stimme.
„Ja. Ich stand über ihm und sah zu, wie er starb. Ich habe getan, was mir angetan worden wäre.“
„Ich wusste es. Ich habe es schon vor langer Zeit kommen sehen. Aber jetzt können wir nicht mehr über verschüttetes Blut weinen. Du musst die Stadt und diese Gegend verlassen.“
„Mutter!“, rief Duane.
„Sie ist nicht zu Hause. Du kannst nicht warten. Ich werde es ihr sagen – das, was sie immer befürchtet hat.“
Plötzlich setzte sich Duane hin und bedeckte sein Gesicht mit den Händen.
„Mein Gott! Onkel, was habe ich getan?“ Seine breiten Schultern zitterten.
„Hör zu, mein Sohn, und merk dir, was ich sage“, antwortete der ältere Mann ernst. „Vergiss das nie. Du bist nicht schuld. Ich bin froh, dass du es so siehst, denn vielleicht wirst du nie hart und gefühllos werden. Du bist nicht schuld. Das hier ist Texas. Du bist der Sohn deines Vaters. Es sind wilde Zeiten. Das Gesetz, wie es die Ranger jetzt durchsetzen, kann das Leben nicht von einer Minute auf die andere ändern. Selbst deine Mutter, die eine gute, aufrichtige Frau ist, hat ihren Teil dazu beigetragen, dich zu dem zu machen, was du jetzt bist. Denn sie war eine der Pioniere – der kämpferischen Pioniere dieses Staates. In diesen wilden Zeiten, bevor du geboren wurdest, entwickelte sich in ihr der Instinkt zu kämpfen, um ihr Leben und ihre Kinder zu retten, und dieser Instinkt ist auch in dir zum Vorschein gekommen. Es wird viele Jahre dauern, bis er bei den in Texas geborenen Jungen ausstirbt.“
„Ich bin ein Mörder“, sagte Duane und zitterte.
„Nein, mein Sohn, das bist du nicht. Und das wirst du auch nie sein. Aber du musst ein Gesetzloser sein, bis die Zeit sicher genug ist, dass du nach Hause zurückkehren kannst.“
„Ein Gesetzloser?“
„Ich habe es gesagt. Wenn wir Geld und Einfluss hätten, würden wir einen Prozess riskieren. Aber wir haben weder das eine noch das andere. Und ich glaube, dass das Schafott oder das Gefängnis kein Ort für Buckley Duane sind. Mach dich auf den Weg in die Wildnis, und wo immer du hingehst und was immer du tust – sei ein Mann. Lebe ehrlich, wenn das möglich ist. Wenn nicht, sei so ehrlich, wie du kannst. Wenn du mit Gesetzlosen zusammen sein musst, versuch, nicht schlecht zu werden. Es gibt Gesetzlose, die nicht nur schlecht sind – viele, die durch so eine Sache wie die, die du erlebt hast, in die Wildnis getrieben wurden. Wenn du unter diese Leute kommst, vermeide Streit. Trink nicht, spiel nicht. Ich muss dir nicht sagen, was du tun sollst, wenn es zu einer Schießerei kommt, was wahrscheinlich ist. Du kannst nicht nach Hause kommen. Wenn diese Sache vergessen ist, falls das jemals passiert, werde ich eine Nachricht in das unbesiedelte Land schicken. Sie wird dich eines Tages erreichen. Das ist alles. Denk daran, sei ein Mann. Auf Wiedersehen.“
Duane, mit trüben Augen und einem Kloß im Hals, drückte die Hand seines Onkels und verabschiedete sich wortlos von ihm. Dann sprang er auf den Rücken des Schwarzen und ritt aus der Stadt.
So schnell, wie es die Rücksicht auf sein Pferd zuließ, legte Duane eine Strecke von fünfzehn oder achtzehn Meilen zurück. Dann wurde er langsamer, denn das Reiten erforderte nicht mehr seine ganze Aufmerksamkeit. Er kam an mehreren Ranches vorbei und wurde von Männern gesehen. Das gefiel ihm nicht, und so nahm er einen alten Pfad querfeldein. Es war eine flache Gegend mit spärlichem Bewuchs aus Mesquite-Bäumen und Feigenkakteen. Gelegentlich erhaschte er einen Blick auf niedrige Hügel in der Ferne. Er hatte oft in dieser Gegend gejagt und wusste, wo er Gras und Wasser finden konnte. Als er diese Anhöhe erreichte, hielt er jedoch nicht am ersten geeigneten Lagerplatz an, sondern ritt weiter und weiter. Einmal kam er auf den Rand eines Hügels und sah unter sich eine weitläufige Landschaft. Sie hatte die graue Gleichförmigkeit, die alles kennzeichnete, was er durchquert hatte. Er schien weite Räume sehen zu wollen – einen Blick auf die große Wildnis zu erhaschen, die irgendwo im Südwesten lag. Es war Sonnenuntergang, als er beschloss, an einem geeigneten Ort, den er gefunden hatte, zu campen. Er führte das Pferd zum Wasser und begann dann, das flache Tal nach einem geeigneten Platz zum Lagern abzusuchen. Er kam an alten Lagerplätzen vorbei, an die er sich gut erinnerte. Diese gefielen ihm diesmal jedoch nicht, und die Bedeutung dieser Veränderung in ihm wurde ihm in diesem Moment nicht bewusst. Schließlich fand er einen abgelegenen Platz unter dichten Mesquitebäumen und Eichen, in geraumer Entfernung vom alten Pfad. Er nahm Sattel und Packzeug vom Pferd. Er suchte in seinen Sachen nach einer Fessel und als er feststellte, dass sein Onkel keine eingepackt hatte, fiel ihm plötzlich ein, dass er selten eine Fessel benutzte, schon gar nicht bei diesem Pferd. Er schnitt ein paar Meter vom Ende seines Lassos ab und benutzte das. Das Pferd, das solche Einschränkungen seiner Bewegungsfreiheit nicht gewohnt war, musste auf die Wiese getrieben werden.
Duane machte ein kleines Feuer, bereitete sein Abendessen zu und aß. Nachdem er damit fertig war und die Arbeit des Tages beendet hatte, setzte er sich hin und stopfte seine Pfeife. Die Dämmerung war der Abenddämmerung gewichen. Ein paar blasse Sterne waren gerade zu leuchten begonnen. Über dem leisen, anhaltenden Summen der Insekten erklang das Abendlied der Rotkehlchen. Bald verstummten die Vögel, und die Stille wurde noch deutlicher spürbar. Als die Nacht hereinbrach und der Ort dadurch noch isolierter und einsamer wirkte, verspürte Duane ein Gefühl der Erleichterung.
Plötzlich wurde ihm klar, dass er nervös, wachsam und schlaflos war. Diese Tatsache überraschte ihn, und er begann, zurückzudenken und seine letzten Handlungen und deren Motive zu hinterfragen. Die Veränderung, die ein einziger Tag bewirkt hatte, verblüffte ihn. Er, der immer frei, unbeschwert und glücklich gewesen war, besonders wenn er allein in der Natur unterwegs war, war innerhalb weniger Stunden gefesselt, ernst und in Gedanken versunken geworden. Die Stille, die ihm einst so angenehm gewesen war, bedeutete ihm jetzt nichts mehr, außer dass er dadurch die Geräusche seiner Verfolger besser hören konnte. Die Einsamkeit, die Nacht, die Wildnis, die ihm immer schön erschienen waren, vermittelten ihm jetzt nur noch ein Gefühl der Sicherheit für den Moment. Er beobachtete, er lauschte, er dachte nach. Er fühlte sich müde, hatte aber keine Lust, sich auszuruhen. Er wollte bei Tagesanbruch aufbrechen und sich in Richtung Südwesten aufmachen. Hatte er ein Ziel? Es war so vage wie sein Wissen über diese große Einöde aus Mesquite-Bäumen und Felsen, die an den Rio Grande grenzte. Irgendwo da draußen gab es einen Zufluchtsort. Denn er war ein Flüchtling vor dem Gesetz, ein Gesetzloser.
Ein Gesetzloser zu sein bedeutete damals ewige Wachsamkeit. Kein Zuhause, keine Ruhe, kein Schlaf, keine Zufriedenheit, kein lebenswertes Leben! Er musste entweder ein einsamer Wolf sein oder sich unter Menschen bewegen, die ihm zuwider waren. Selbst wenn er ehrlich arbeitete, musste er seine Identität verbergen und das Risiko eingehen, entdeckt zu werden. Wenn er nicht auf einer abgelegenen Ranch arbeitete, wie sollte er dann leben? Der Gedanke an Diebstahl war ihm zuwider. Die Zukunft schien grau und düster genug. Und er war dreiundzwanzig Jahre alt.
Warum wurde ihm dieses harte Leben auferlegt?
Die bittere Frage schien eine seltsame Kälte auszulösen, die sich in seinen Adern ausbreitete. Was war los mit ihm? Er schürte die wenigen Mesquite-Holzscheite zu einem letzten flackernden Feuer. Ihm war kalt, und aus irgendeinem Grund wollte er etwas Licht. Der schwarze Kreis der Dunkelheit lastete schwer auf ihm, umschloss ihn. Plötzlich setzte er sich kerzengerade auf und erstarrte in dieser Position. Er hatte einen Schritt gehört. Er war hinter ihm – nein – an der Seite. Jemand war da. Er griff nach seiner Waffe, und die Berührung des kalten Stahls war ein weiterer eisiger Schock. Dann wartete er. Aber alles war still – still, wie es nur ein Wildnis-Arroyo sein kann, mit seinem leisen Murmeln des Windes in den Mesquite-Bäumen. Hatte er einen Schritt gehört? Er begann wieder zu atmen.
Aber was war mit dem Licht seines Lagerfeuers los? Es hatte einen seltsamen grünen Schimmer angenommen und schien in die äußeren Schatten zu verschwinden. Duane hörte keine Schritte, sah keine Bewegung; dennoch war noch jemand bei dieser Lagerfeuerwache anwesend. Duane sah ihn. Er lag dort inmitten des grünen Scheins, ausgestreckt, regungslos, sterbend. Cal Bain! Seine Gesichtszüge waren wunderbar deutlich, klarer als jede Kamee, schärfer umrissen als auf jedem Bild. Es war ein hartes Gesicht, das an der Schwelle zur Ewigkeit weich wurde. Die rote Bräune der Sonne, die groben Zeichen der Trunkenheit, die für Bain so charakteristische Wildheit und der Hass waren nicht mehr da. Dieses Gesicht zeigte einen anderen Bain, zeigte alles Menschliche in ihm, das verblasste, so schnell, wie es weiß wurde. Die Lippen wollten sprechen, hatten aber nicht die Kraft dazu. Die Augen spiegelten die Qual der Gedanken wider. Sie verrieten, was für diesen Mann möglich gewesen wäre, wenn er gelebt hätte – dass er seinen Fehler zu spät erkannt hatte. Dann rollten sie sich zurück, wurden leer und schlossen sich im Tod.
Dieser eindringliche Besuch ließ Duane in kaltem Schweiß dasitzen, von Reue geplagt, der sich in sein Innerstes fraß, und er erkannte den Fluch, der auf ihm lastete. Er ahnte, dass er dieses Phantom niemals loswerden würde. Er erinnerte sich daran, wie sein Vater ewig von den Furien der Schuld verfolgt worden war, wie er weder bei der Arbeit noch im Schlaf jemals die Männer vergessen konnte, die er getötet hatte.
Es war schon spät, als Duane endlich einschlafen konnte, und dann quälten ihn Träume. Am Morgen machte er sich so früh auf den Weg, dass er in der grauen Dämmerung Schwierigkeiten hatte, sein Pferd zu finden. Der Tag brach gerade an, als er sich wieder auf den alten Pfad begab.
Er ritt den ganzen Vormittag zügig und hielt an einem schattigen Ort an, um sich auszuruhen und sein Pferd weiden zu lassen. Am Nachmittag setzte er seinen Weg in gemächlichem Trab fort. Die Landschaft wurde wilder. Kahle, zerklüftete Berge durchbrachen die Ebene des eintönigen Horizonts. Gegen drei Uhr nachmittags kam er an einen kleinen Fluss, der die Grenze seines Jagdgebiets markierte.
Seine Entscheidung, eine Weile flussaufwärts zu reiten, beruhte auf zwei Tatsachen: Der Fluss war hoch und hatte auf beiden Seiten Treibsandbänke, und er zögerte, in diese Region zu reiten, wo allein seine Anwesenheit bedeutete, dass er ein gezeichneter Mann war. Die Auen, durch die sich der Fluss nach Südwesten schlängelte, waren einladender als die Ödnis, die er durchquert hatte. Den Rest des Tages ritt er gemächlich flussaufwärts. Bei Sonnenuntergang drang er in das Dickicht aus Weiden und Pappeln ein, um dort die Nacht zu verbringen. Er dachte, dass er sich in dieser einsamen Umgebung wohl und zufrieden fühlen würde. Aber das war nicht der Fall. Jedes Gefühl, jede Vorstellung, die er in der vergangenen Nacht erlebt hatte, kehrte etwas lebhafter zurück und wurde durch neue Gefühle und Vorstellungen gleicher Intensität und Farbe noch verstärkt.
Auf diese Art reiste und zeltete er noch drei weitere Tage, während denen er mehrere Pfade und eine Straße kreuzte, auf der kürzlich Vieh – wahrscheinlich gestohlenes Vieh – vorbeigekommen war. So ging ihm mit der Zeit seine Vorräte aus, bis auf Salz, Pfeffer, Kaffee und Zucker, von denen er eine Menge dabei hatte. In den Büschen gab es Rehe, aber da er nicht nah genug herankommen konnte, um sie mit seinem Revolver zu erlegen, musste er sich mit einem Kaninchen begnügen. Er wusste, dass er sich mit der kargen Kost zufrieden geben musste, die ihm sicherlich bevorstand.
Irgendwo flussaufwärts gab es ein Dorf namens Huntsville. Es lag etwa hundert Meilen von Wellston entfernt und war im gesamten Südwesten von Texas bekannt. Er war noch nie dort gewesen. Tatsächlich war dieser Ruf so groß, dass ehrliche Reisende einen großen Bogen um die Stadt machten. Duane hatte für seine Verhältnisse ziemlich viel Geld dabei und beschloss, Huntsville zu besuchen, wenn er es finden konnte, und sich dort mit Proviant einzudecken.
Am nächsten Tag, gegen Abend, stieß er auf eine Straße, von der er glaubte, dass sie zum Dorf führen könnte. Im Sand waren viele frische Pferdespuren zu sehen, die ihn nachdenklich machten. Trotzdem folgte er der Straße und ging vorsichtig weiter. Er war noch nicht weit gekommen, als er das Geräusch schneller Hufschläge hörte. Sie kamen von hinten. In der zunehmenden Dämmerung konnte er nicht weit zurück auf die Straße sehen. Stimmen warnten ihn jedoch, dass diese Reiter, wer auch immer sie waren, näher gekommen waren, als ihm lieb war. Weiter die Straße entlang zu gehen, kam nicht in Frage, also bog er ein Stück in die Mesquite-Bäume ein und hielt an, in der Hoffnung, nicht gesehen oder gehört zu werden. Da er nun ein Flüchtling war, schien jeder Mann sein Feind und Verfolger zu sein.
Die Reiter kamen schnell näher. Bald waren sie auf gleicher Höhe mit Duane, so nah, dass er das Knarren der Sättel und das Klirren der Sporen hören konnte.
„Er hat sicher den Fluss weiter unten überquert“, meinte einer der Männer.
„Ich glaube, du hast recht, Bill. Er ist uns entwischt“, antwortete ein anderer.
Ranger oder eine Gruppe von Ranchern auf der Jagd nach einem Flüchtigen! Diese Erkenntnis versetzte Duane in eine seltsame Erregung. Sicherlich konnten sie nicht auf der Suche nach ihm sein. Aber das Gefühl, das ihm ihre Nähe gab, war genau dasselbe, als wäre er dieser gesuchte Mann. Er hielt den Atem an, biss die Zähne zusammen und drückte beruhigend seine Hand auf sein Pferd. Plötzlich bemerkte er, dass die Reiter angehalten hatten. Sie flüsterten. Er konnte gerade noch eine dunkle Gruppe erkennen, die sich dicht gedrängt hatte. Was hatte sie dazu gebracht, so verdächtig anzuhalten?
„Du irrst dich, Bill“, sagte ein Mann mit leiser, aber deutlicher Stimme.
„Die Vorstellung, ein Pferd keuchen zu hören. Du bist schlimmer als ein Ranger. Und du bist wild entschlossen, diesen Viehdieb zu töten. Ich sage, lass uns nach Hause gehen und etwas essen.“
„Na gut, ich werde mir nur den Sand ansehen“, antwortete der Mann namens Bill.
Duane hörte das Klirren von Sporen an Stahlsteigbügeln und das Stampfen von Stiefeln auf dem Boden. Es folgte eine kurze Stille, die von einem scharf geatmeten Ausruf unterbrochen wurde.
Duane wartete nicht länger. Sie hatten seine Spur gefunden. Er trieb sein Pferd direkt ins Gebüsch. Beim zweiten krachenden Sprung kamen Schreie von der Straße und dann Schüsse. Duane hörte das Zischen einer Kugel dicht an seinem Ohr, und als sie einen Ast traf, machte sie ein seltsames singendes Geräusch. Diese Schüsse und die Nähe dieses Bleigeschosses weckten in Duane einen schnellen, heißen Groll, der sich zu einer fast unkontrollierbaren Leidenschaft steigerte. Er musste entkommen, doch es schien ihm egal zu sein, ob er es tat oder nicht. Etwas Unheimliches drängte ihn, anzuhalten und das Feuer dieser Männer zu erwidern. Nachdem er ein paar hundert Meter geritten war, richtete er sich vom Sattelknauf auf, wo er sich gebückt hatte, um den stechenden Ästen auszuweichen, und versuchte, sein Pferd zu lenken. In den dunklen Schatten unter Mesquite- und Pappeln fiel es ihm schwer, einen freien Weg zu finden; dennoch gelang es ihm so gut und so geräuschlos, dass er sich allmählich von seinen Verfolgern entfernte. Das Geräusch ihrer Pferde, die durch das Dickicht brachen, verstummte. Duane zügelte sein Pferd und lauschte. Er hatte sie abgehängt. Wahrscheinlich würden sie bis zum Tagesanbruch ihr Lager aufschlagen und dann seinen Spuren folgen. Er machte sich wieder auf den Weg, führte sein Pferd im Schritt und spähte aufmerksam auf den Boden, um die erste Spur, die er kreuzte, zu nutzen. Es schien lange zu dauern, bis er eine fand. Er folgte ihr bis spät in die Nacht, als er wieder auf das Weidengebüsch und damit in die Nähe des Flusses stieß, sein Pferd anband und sich hinlegte, um sich auszuruhen. Aber er schlief nicht. Seine Gedanken kreisten bitter um das Schicksal, das ihn ereilt hatte. Er versuchte, an andere Dinge zu denken, aber vergeblich.
Jeden Moment erwartete er die Kälte, das Gefühl der Einsamkeit, das doch ein Vorzeichen für einen seltsamen Besuch war, die seltsamen Lichter und Schatten der Nacht – all diese Dinge, die die Ankunft von Cal Bain ankündigten. Hartnäckig kämpfte Duane gegen das heimtückische Phantom. Er redete sich immer wieder ein, dass es nur Einbildung sei, dass es mit der Zeit verschwinden würde. Dennoch glaubte er in seinem Herzen nicht an das, was er sich erhoffte. Aber er wollte nicht aufgeben; er wollte den Geist seines Opfers nicht als Realität akzeptieren.
Die graue Morgendämmerung fand ihn wieder im Sattel, auf dem Weg zum Fluss. Nach einer halben Stunde Reiten erreichte er das dichte Buschwerk und die Weidengebüsche. Er schlängelte sich hindurch und kam schließlich zur Furt. Der Grund war mit Kies bedeckt und daher leicht zu überqueren. Auf der anderen Seite angekommen, zügelte er sein Pferd und blickte düster zurück. Diese Geste zeigte, dass er seine Situation akzeptierte: Er hatte freiwillig Zuflucht bei den Gesetzlosen gesucht; er war nun ein Ausgestoßener. Ein bitterer und leidenschaftlicher Fluch kam über seine Lippen, als er sein Pferd in das Gestrüpp auf dem fremden Ufer trieb.
Er ritt vielleicht zwanzig Meilen, ohne sein Pferd zu schonen oder sich darum zu kümmern, ob er eine deutliche Spur hinterließ oder nicht.
„Sollen sie mich doch jagen!“, murmelte er.
Als die Hitze des Tages drückend wurde und Hunger und Durst sich bemerkbar machten, begann Duane sich nach einem Ort umzusehen, an dem er eine Mittagspause einlegen konnte. Der Weg führte zu einer Straße, die durch die Spuren von Rindern festgestampft und glatt war. Er zweifelte nicht daran, dass er auf eine der Straßen gestoßen war, die von Grenzräubern benutzt wurden. Er bog ein und war kaum eine Meile gefahren, als er hinter einer Kurve plötzlich auf einen einzelnen Reiter traf, der auf ihn zu ritt. Beide Reiter wendeten ihre Pferde scharf und waren bereit, loszurennen und zurückzuschießen. Nicht mehr als hundert Schritte trennten sie. Sie standen einen Moment lang da und beobachteten sich gegenseitig.
„Guten Morgen, Fremder“, rief der Mann und nahm die Hand von seiner Hüfte.
„Hallo“, antwortete Duane knapp.
Sie ritten aufeinander zu, verkürzten den Abstand um die Hälfte und hielten dann wieder an.
„Ich sehe, dass du kein Ranger bist“, rief der Reiter, „und ich bin es auch nicht.“
Er lachte laut, als hätte er einen Witz gemacht.
„Woher weißt du, dass ich kein Ranger bin?“, fragte Duane neugierig. Irgendwie hatte er sofort erkannt, dass der Reiter kein Offizier war und auch kein Rancher, der gestohlenes Vieh verfolgte.
„Na ja“, sagte der Mann und trieb sein Pferd im Schritt vorwärts, „ein Ranger würde sich niemals bereit machen, vor einem einzigen Mann in die andere Richtung zu rennen.“
Er lachte erneut. Er war klein und drahtig, schlurfte in seiner Kleidung, war bis an die Zähne bewaffnet und saß auf einem schönen braunen Pferd. Er hatte schnelle, tanzende braune Augen, die gleichzeitig offen und kühn waren, und ein grobes, gebräuntes Gesicht. Offensichtlich war er ein gutmütiger Raufbold.
Duane erkannte die Wahrheit dieser Aussage und dachte darüber nach, wie schlau der Typ ihn als einen gejagten Mann eingeschätzt hatte.
„Ich heiße Luke Stevens und komme vom Fluss. Wer bist du?“, fragte der Fremde.
Duane schwieg.
„Ich nehme an, du bist Buck Duane“, fuhr Stevens fort. „Ich habe gehört, dass du ein verdammt guter Schütze bist.“
Diesmal lachte Duane, nicht über das zweifelhafte Kompliment, sondern über die Vorstellung, dass der erste Gesetzlose, dem er begegnete, ihn kennen sollte. Das war ein Beweis dafür, wie schnell sich Gerüchte über Schießereien an der texanischen Grenze verbreiteten.
„Also, Buck“, sagte Stevens freundlich, „ich will deine Zeit und deine Gesellschaft nicht in Anspruch nehmen. Ich sehe, dass du zum Fluss willst. Aber hast du vielleicht Zeit für eine kleine Mahlzeit?“
„Ich hab kein Essen mehr und bin selbst ziemlich hungrig“, gab Duane zu.
„Du hast dein Pferd ziemlich strapaziert, wie ich sehe. Nun, ich denke, du solltest dich besser eindecken, bevor du diese Gegend erreichst.“
Er machte eine ausladende Geste mit dem rechten Arm und deutete nach Südwesten, wobei seine Bewegung den Eindruck einer weiten und kargen Region vermittelte.
„Vorräte einkaufen?“, fragte Duane nachdenklich.
„Klar. Ein Kerl muss einfach was essen. Ich komme ohne Whisky klar, aber nicht ohne Essen. Das macht es so schwierig, in diesen Gegenden zu reisen und deinem Schatten auszuweichen. Ich bin gerade auf dem Weg nach Mercer. Das ist eine kleine Stadt flussaufwärts. Ich werde mir etwas zu essen besorgen.“
Stevens' Tonfall war einladend. Offensichtlich würde er Duanes Gesellschaft begrüßen, aber er sagte es nicht offen. Duane schwieg jedoch, und dann fuhr Stevens fort.
„Fremder, in dieser Gegend sind zwei eine Menschenmenge. Das ist sicherer. Ich war nie ein großer Fan davon, mich alleine durchzuschlagen, obwohl ich es aus Notwendigkeit getan habe. Man muss ein verdammt guter Mann sein, um längere Zeit alleine zu reisen. Ich war schon so krank, dass ich mich danach sehnte, dass ein Ranger vorbeikommt und mich erschießt. Gib mir lieber einen Partner. Vielleicht bist du nicht so ein Typ, und ich will mich nicht aufspielen und fragen. Aber ich sage einfach, dass ich mich selbst für ausreichend halte.“
„Du meinst, du möchtest, dass ich mit dir komme?“, fragte Duane.
Stevens grinste. „Nun, ich würde lächeln. Ich wäre besonders stolz darauf, von einem Mann mit deinem Ruf begleitet zu werden.“
„Hör mal, mein Lieber, das ist alles Quatsch“, sagte Duane etwas hastig.
„Ich finde, Bescheidenheit steht einem jungen Mann gut zu Gesicht“, antwortete Stevens. „Ich hasse Prahlerei. Und ich kann mit diesen angeberischen Cowboys nichts anfangen, die immer nach Ärger suchen und mit Waffen prahlen. Buck, ich weiß nicht viel über dich. Aber jeder Mann, der an der texanischen Grenze gelebt hat, erinnert sich gut an deinen Vater. Das wurde wohl von dir erwartet, und ein Großteil deines Rufs war bereits begründet, bevor du zur Waffe gegriffen hast. Ich habe nur gehört, dass du blitzschnell ziehst, und wenn du mit der Waffe loslegst, würde die Figur auf dem Pik-Ass deine Kugellöcher verdecken. Das ist das Gerücht, das an der Grenze die Runde macht. Es ist die Art von Ruf, die einem Mann in diesem Land mit Sicherheit weit und schnell voraus eilt. Und auch der sicherste, darauf würde ich wetten. Das ist das Land des Schnellziehens. Ich sehe jetzt, dass du nur ein Junge bist, wenn auch ein kräftiger und stämmiger. Nun, Buck, ich bin kein junger Hüpfer mehr und bin schon lange unterwegs. Vielleicht schadet dir ein bisschen Gesellschaft meinerseits nicht. Du musst das Land kennenlernen.
Dieser Gesetzlose hatte etwas Aufrichtiges und Sympathisches an sich.
„Ich wage zu behaupten, dass du Recht hast“, antwortete Duane leise. „Und ich werde mit dir nach Mercer gehen.“
Im nächsten Moment ritt er mit Stevens die Straße entlang. Duane war nie ein großer Redner gewesen, und jetzt fiel ihm das Sprechen schwer. Aber seinem Begleiter schien das nichts auszumachen. Er war ein scherzhafter, redseliger Kerl, der wahrscheinlich froh war, jetzt seine eigene Stimme zu hören. Duane hörte zu und dachte manchmal mit einem Stich im Herzen an den Namen und das Erbe, das sein Vater ihm hinterlassen hatte.
KAPITEL III
Spät an diesem Tag, ein paar Stunden vor Sonnenuntergang, sattelten Duane und Stevens ihre Pferde, nachdem sie sie im Schatten einiger Mesquitebäume in der Nähe der Stadt Mercer ausgeruht hatten, und machten sich bereit, weiterzureiten.
„Buck, da wir nach Futter suchen und keinen Ärger wollen, solltest du besser hierbleiben“, meinte Stevens, als er aufstieg. „Weißt du, Städte, Sheriffs und Ranger suchen immer nach neuen Typen, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Die meisten alten Hasen vergessen sie irgendwie, außer denen, die wirklich übel sind. Nun, niemand in Mercer wird mich bemerken. Ich schätze, seit meiner Zeit sind tausend Männer in die Flussregion geflohen, um Gesetzlose zu werden. Warte einfach hier und sei bereit, schnell zu reiten. Vielleicht wird meine Sünde trotz meiner guten Absichten wieder zum Vorschein kommen. In diesem Fall wird es ...“
Seine Pause war vielsagend. Er grinste, und seine braunen Augen funkelten vor wildem Humor.
„Stevens, hast du Geld?“, fragte Duane.
„Geld!“, rief Luke verblüfft. „Ich hab seit Ewigkeiten keinen Cent mehr.“
„Ich besorge das Geld für Essen“, erwiderte Duane. „Und für Whisky auch, vorausgesetzt, du kommst schnell zurück – ohne Ärger zu machen.“
„Du bist echt ein guter Kumpel“, sagte Stevens voller Bewunderung, als er das Geld nahm. „Ich gebe dir mein Wort, Buck, und ich bin hier, um zu sagen, dass ich es noch nie gebrochen habe. Halt dich bedeckt und warte auf mich.“
Damit spornte er sein Pferd an und ritt aus den Mesquitebäumen heraus in Richtung Stadt. Aus dieser Entfernung, etwa einer Viertelmeile, sah Mercer wie eine Ansammlung niedriger Lehmhäuser aus, die in einem Hain aus Pappeln standen. Auf den Luzerneweiden standen hier und da Pferde und Rinder. Duane sah einen Schafhirten, der eine kleine Herde hütete.
Bald darauf ritt Stevens aus dem Blickfeld in die Stadt hinein. Duane wartete und hoffte, dass der Gesetzlose sein Versprechen halten würde. Wahrscheinlich war noch keine Viertelstunde vergangen, als Duane die deutlichen Schüsse eines Winchester-Gewehrs, das Klappern schneller Hufschläge und Schreie hörte, die unverkennbar Gefahr für einen Mann wie Stevens bedeuteten. Duane stieg auf sein Pferd und ritt zum Rand der Mesquite-Bäume.
Er sah eine Staubwolke auf der Straße und ein braunes Pferd, das schnell rannte. Stevens war offenbar von keinem der Schüsse getroffen worden, denn er saß fest im Sattel und seine Reitkunst beeindruckte Duane selbst in diesem Moment. Er trug ein großes Gepäckstück über dem Sattelknauf und schaute immer wieder zurück. Die Schüsse hatten aufgehört, aber die Schreie wurden lauter. Duane sah mehrere Männer rennen und mit den Armen wedeln. Dann spornte er sein Pferd an und nahm einen schnellen Galopp auf, damit Stevens ihn nicht überholen konnte. Bald holte der Gesetzlose ihn ein. Stevens grinste, aber in seinen tanzenden Augen lag jetzt kein Spaß mehr. Es war ein Teufel, der in ihnen tanzte. Sein Gesicht schien einen Hauch blasser zu sein.
„Ich kam gerade aus dem Laden“, schrie Stevens. „Da bin ich einem Rancher begegnet, der mich kannte. Er hat mit seinem Gewehr geschossen. Ich glaube, die werden uns verfolgen.“
Sie legten mehrere Meilen zurück, bevor es Anzeichen einer Verfolgung gab, und als Reiter aus den Pappeln auftauchten, entfernten sich Duane und sein Begleiter stetig weiter.
„Keine Pferde in dieser Gruppe, um die wir uns Sorgen machen müssten“, rief Stevens.
Duane war derselben Meinung und schaute nicht mehr zurück. Er ritt etwas voraus und hörte ständig das schnelle Stampfen der Hufe hinter sich, da Stevens dicht hinter ihm blieb. Bei Sonnenuntergang erreichten sie die Weiden und den Fluss. Duanes Pferd war außer Atem und schweißgebadet. Erst nachdem sie den Fluss überquert hatten, hielt Duane an, um sein Tier ausruhen zu lassen. Stevens ritt das niedrige, sandige Ufer hinauf. Er taumelte im Sattel. Mit einem überraschten Ausruf sprang Duane vom Pferd und rannte zu dem Gesetzlosen.
Stevens war blass, und sein Gesicht war schweißgebadet. Die ganze Vorderseite seines Hemdes war blutgetränkt.
„Du bist angeschossen!“, rief Duane.
„Na, wer zum Teufel hat gesagt, dass ich das nicht bin? Könntest du mich vielleicht mitnehmen – auf diesem Rucksack hier?“
Duane hob das schwere Gepäck herunter und half Stevens dann beim Absteigen. Der Gesetzlose hatte blutigen Schaum auf den Lippen und spuckte Blut.
„Oh, warum hast du das nicht gesagt!“, rief Duane. „Ich hätte nie gedacht, dass dir etwas fehlt. Du sahst völlig unversehrt aus.“
„Nun, Luke Stevens mag zwar so geschwätzig wie eine alte Frau sein, aber manchmal sagt er einfach nichts. Es hätte nichts gebracht.“
Duane bat ihn, sich hinzusetzen, zog ihm das Hemd aus und wusch ihm das Blut von Brust und Rücken. Stevens war ziemlich tief in die Brust geschossen worden, und die Kugel hatte ihn komplett durchschlagen. Dass er sich und das schwere Gepäck im Sattel halten konnte, war eine fast unglaubliche Leistung. Duane konnte sich nicht vorstellen, wie das möglich gewesen war, und er hatte keine Hoffnung für den Gesetzlosen. Aber er versorgte die Wunden und verband sie fest.
„Der Typ hieß Brown“, sagte Stevens. „Ich und er hatten Streit wegen einem Pferd, das ich ihm in Huntsville geklaut hatte. Wir hatten damals eine Schießerei. Als ich dann in Mercer auf meinem Pferd saß, sah ich diesen Brown, und ich sah ihn, bevor er mich sah. Ich hätte ihn auch töten können. Aber ich wollte mein Versprechen dir gegenüber nicht brechen. Ich hatte irgendwie gehofft, er würde mich nicht entdecken. Aber das tat er – und schoss mich hier als Erstes an. Was hältst du von diesem Loch?“
„Es sieht ziemlich schlimm aus“, antwortete Duane, und er konnte dem fröhlichen Gesetzlosen nicht in die Augen sehen.
„Das kann ich mir vorstellen. Nun, ich habe schon einige schwere Verletzungen überlebt. Vielleicht schaffe ich auch diese. Jetzt, Buck, bring mich irgendwo in die Büsche, lass mir etwas zu essen und Wasser da und dann verschwinde.“
„Dich hier allein lassen?“, fragte Duane scharf.
„Klar. Weißt du, ich kann nicht mit dir mithalten. Brown und seine Freunde werden uns ein Stück über den Fluss folgen. In diesem Spiel muss man an sich selbst denken.“
„Was würdest du an meiner Stelle tun?“, fragte Duane neugierig.
„Na ja, ich würde mich wohl verziehen und meine Haut retten“, antwortete Stevens.
Duane hatte Zweifel an der Aussage des Gesetzlosen. Er entschied sich, ohne weitere Worte zu handeln. Zuerst tränkte er die Pferde, füllte die Feldflaschen und den Wassersack und band dann das Gepäck auf sein eigenes Pferd. Dann hob er Stevens auf sein Pferd, hielt ihn im Sattel fest und bog in das Gebüsch ein, wobei er darauf achtete, festen oder grasbewachsenen Boden zu wählen, der kaum Spuren hinterließ. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit stieß er auf einen Pfad, von dem Stevens meinte, er sei gut geeignet, um in die Wildnis zu gelangen.
„Ich denke, wir sollten besser im Dunkeln weiterreiten – bis ich umfalle“, schloss Stevens mit einem Lachen.
Die ganze Nacht lang ging Duane, düster und nachdenklich, aufmerksam auf den verwundeten Gesetzlosen achtend, den Pfad entlang und hielt nicht an, bis es dämmerte. Dann war er müde und sehr hungrig. Stevens schien in schlechter Verfassung zu sein, obwohl er immer noch lebhaft und fröhlich war. Duane schlug ein Lager auf. Der Gesetzlose lehnte Essen ab, verlangte aber nach Whisky und Wasser. Dann streckte er sich aus.
„Buck, würdest du mir bitte meine Stiefel ausziehen?“, fragte er mit einem schwachen Lächeln auf seinem blassen Gesicht.
Duane zog sie ihm aus und fragte sich, ob der Gesetzlose vielleicht nicht mit seinen Stiefeln an den Füßen sterben wollte. Stevens schien seine Gedanken zu lesen.
„Buck, mein alter Vater hat immer gesagt, ich sei geboren, um gehängt zu werden. Aber das war ich nicht – und mit deinen Stiefeln an den Füßen zu sterben, ist die zweitschlimmste Art zu krepieren.“
„Du hast eine Chance, das zu überstehen“, sagte Duane.
„Klar. Aber ich will mit den Stiefeln Recht behalten – und sag mal, Kumpel, wenn ich doch sterbe, denk einfach daran, dass ich deine Freundlichkeit zu schätzen wusste.“
Dann schloss er die Augen und schien einzuschlafen.
Duane konnte kein Wasser für die Pferde finden, aber es gab reichlich taufeuchtes Gras, auf dem er sie anbinden konnte. Nachdem das erledigt war, bereitete er sich eine dringend benötigte Mahlzeit zu. Die Sonne wurde langsam warm, als er sich hinlegte, um zu schlafen, und als er aufwachte, ging sie gerade im Westen unter. Stevens lebte noch, denn er atmete schwer. Die Pferde waren in Sichtweite. Alles war still, bis auf das Summen der Insekten im Gebüsch. Duane lauschte eine Weile, stand dann auf und ging zu den Pferden.
Als er mit ihnen zurückkam, fand er Stevens wach vor, mit strahlenden Augen, fröhlich wie immer und offenbar stärker.
„Wal, Buck, ich bin noch bei dir und bereit für eine weitere Nachtfahrt“, sagte er. „Ich glaube, alles, was ich jetzt brauche, ist ein großer Schluck aus dieser Flasche. Hilfst du mir? Da! Das war großartig. Heute Abend schlucke ich kein Blut mehr. Vielleicht habe ich alles ausgeblutet, was in mir war.“
Während Duane sich hastig etwas zu essen besorgte, die kleine Ausrüstung zusammenpackte und die Pferde sattelte, redete Stevens weiter. Er schien es eilig zu haben, Duane alles über die Gegend zu erzählen. Eine weitere Nachtfahrt würde sie außer Reichweite ihrer Verfolger bringen, in Schlagdistanz zum Rio Grande und den Verstecken der Gesetzlosen.
Als es Zeit war, auf die Pferde zu steigen, sagte Stevens: „Ich nehme an, du kannst mir noch einmal meine Stiefel anziehen.“ Trotz des Lachens, das diese Worte begleitete, bemerkte Duane eine subtile Veränderung in der Stimmung des Gesetzlosen.
In dieser Nacht wurde die Reise dadurch erleichtert, dass der Weg breit genug für zwei Pferde nebeneinander war, sodass Duane reiten und gleichzeitig Stevens im Sattel halten konnte.
Die größte Schwierigkeit bestand darin, die Pferde im Schritt zu halten. Sie waren an den Trab gewöhnt, und diese Gangart war für Stevens nicht geeignet. Das Rot verschwand aus dem Westen; eine blasse Nachglühphase hielt eine Weile an; dann setzte die Dunkelheit ein; schließlich verdunkelte sich die weite blaue Fläche und die Sterne leuchteten heller. Nach einer Weile hörte Stevens auf zu reden und sackte im Sattel zusammen. Duane trieb die Pferde jedoch weiter voran, und die langsamen Stunden vergingen. Duane dachte, die stille Nacht würde niemals enden und es gäbe kein Ende der melancholischen, düsteren Ebene. Aber schließlich verdeckte ein Grauschleier die Sterne und hüllte die Ebene mit Mesquite-Bäumen und Kakteen ein.
Die Morgendämmerung überraschte die Flüchtlinge an einem grünen Lagerplatz am Ufer eines kleinen felsigen Baches. Stevens fiel wie ein totes Gewicht in Duanes Arme, und ein Blick auf das hageres Gesicht zeigte Duane, dass der Gesetzlose seine letzte Reise angetreten hatte. Er wusste es auch. Dennoch herrschte Fröhlichkeit vor.
„Buck, meine Füße sind furchtbar müde vom Tragen dieser schweren Stiefel“, sagte er und schien ungemein erleichtert, als Duane sie ihm auszog.
Diese Sache mit den Stiefeln des Gesetzlosen war seltsam, fand Duane. Er machte es Stevens so bequem wie möglich und kümmerte sich dann um seine eigenen Bedürfnisse. Und der Gesetzlose knüpfte an das Gespräch an, das er am Abend zuvor unterbrochen hatte.