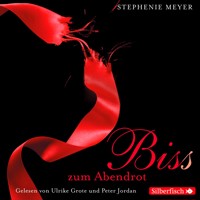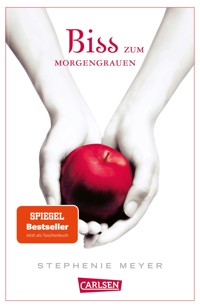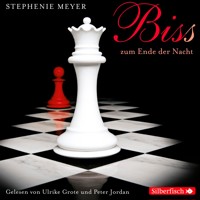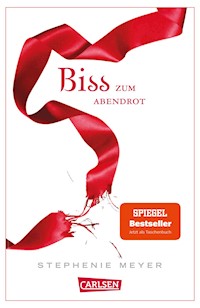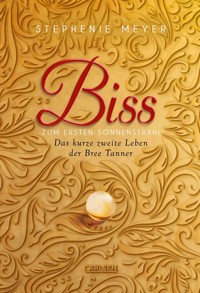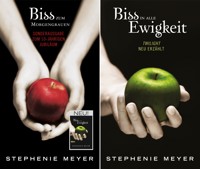
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jede Geschichte hat zwei Seiten … Beaufort Swans Leben ändert sich von Grund auf, als er der geheimnisvollen Edythe Cullen begegnet. Gerade erst ist er in die düstere Kleinstadt Forks gezogen, und er hätte nie gedacht, hier jemanden wie sie zu treffen. Edythes goldene Augen, ihre Haut wie Elfenbein und ihre übernatürlichen Fähigkeiten faszinieren ihn und ziehen ihn unwiderstehlich an. Beaufort sucht ihre Nähe. Erst nach und nach begreift er, in welche Gefahr er sich damit begibt. Doch da ist es fast schon zu spät … Zum 10-jährigen Jubiläum von Biss zum Morgengrauen hat Stephenie Meyer mit Biss in alle Ewigkeit eine ebenso gewagte wie fesselnde Neuerzählung der heiß geliebten Kultgeschichte vorgelegt. Diese Doppelausgabe enthält Biss in alle Ewigkeit, ein Vorwort und ein Nachwort der Autorin sowie den vollständigen ersten Band der Twilight-Serie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1332
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
An all meine wunderbaren Freunde und Leser:
Feiert mit mir das zehnjährige Jubiläum von Biss zum Morgengrauen! Schwer zu glauben, wie lange es schon her ist, dass das alles angefangen hat. Aber da auch meine kleinen Jungs mittlerweile ausgewachsene Teenager sind, werde ich mich der Wahrheit wohl stellen müssen.
Vielen Dank, dass Ihr mir zehn Jahre voller Abenteuer geschenkt habt, die alles übertrafen, was ich je von meinem Leben erwartet habe. Ich bin eigentlich ein sehr prosaischer Mensch, aber was ich mit meinen Fans erlebt habe, lässt mich – zumindest ein kleines bisschen – an Magie glauben.
Zur Feier dieses wichtigen Ereignisses habe ich neues Bonusmaterial geschrieben, damit Ihr die Welt von Biss zum Morgengrauen noch mehr genießen könnt. (Und weil es von Stephenie Meyer stammt, ist es sogar länger als das Original).
Ihr findet Biss zumMorgengrauen oder Biss in alle Ewigkeit, wenn Ihr auf die entsprechenden Links klickt.
Ich war sehr gerne wieder in Forks und ich hoffe, Euch wird es genauso gehen.
Ihr seid großartig und ich liebe Euch.
Vielen Dank!Stephenie
Vorwort
Hallo, liebe Leserinnen und Leser!
Zehn Jahre Biss zum Morgengrauen – ein Grund zum Feiern! Begleitet mich zum Jubiläum noch einmal nach Forks.
Doch eins nach dem anderen:
ES TUT MIR WIRKLICH LEID.
Ich weiß, es wird viel Heulen und Zähneklappern geben, weil dieses neue Bonusmaterial A) nicht völlig neu und B) erst recht nicht Edward auf den ersten Blick ist. (Falls Ihr denkt, ich könne mir nicht vorstellen, wie Ihr leidet, darf ich Euch versichern, dass meine Mutter mir das schon mit aller Deutlichkeit klargemacht hat.) Ich werde Euch erklären, wie es dazu kam, und hoffentlich wird es dann für Euch wenn schon nicht besser, so doch zumindest nachvollziehbar.
Vor einer Weile kam meine Agentin auf mich zu und fragte, ob ich irgendetwas für die Neuausgabe zum zehnten Jubiläum von Biss zum Morgengrauen schreiben könne. Der Verlag dachte an etwas wie ein Vorwort, eine Art »Zum zehnten Jubiläum«-Brief oder so. Das fand ich … ehrlich gesagt, wirklich langweilig. Was hätte ich da schon Amüsantes und Aufregendes sagen können? Nichts. Also dachte ich über andere Möglichkeiten nach, und wenn es Euch dann besser geht – Edward auf den ersten Blick kam mir durchaus in den Sinn. Das Problem war die Zeit, beziehungsweise der Mangel an selbiger. Sie hätte auf keinen Fall gereicht, um einen Roman zu schreiben, nicht mal einen halben.
Als ich nach so langer Zeit wieder über Biss zum Morgengrauen nachdachte und das Jubiläumsproblem mit Freunden diskutierte, fiel mir etwas ein, das ich bei Signierstunden und Interviews schon einmal erwähnt hatte. Wie Ihr wisst, musste Bella ständig eine Menge Kritik einstecken, weil sie so oft gerettet wurde, und die Leser haben sich darüber beschwert, dass sie die typische Jungfer in Nöten sei. Meine Antwort darauf lautete immer, Bella sei ein Mensch in Nöten, ein normaler Mensch, der von allen Seiten von Leuten umgeben ist, die im Grunde entweder Superhelden oder Superschurken sind. Außerdem wurde ihr vorgehalten, sie habe nichts als ihre Liebe im Kopf, als wäre das irgendwie typisch für Mädchen. Ich habe aber immer wieder darauf hingewiesen, dass es nicht anders gewesen wäre, wenn die menschliche Figur ein Mann und der Vampir weiblich gewesen wäre – die Geschichte wäre trotzdem die gleiche. Wenn man Geschlecht und Art mal beiseitelässt, war Biss zum Morgengrauen immer eine Geschichte über den Zauber, das unwiderstehliche Verlangen und die Euphorie der ersten Liebe.
Ich dachte mir also: Okay, warum stelle ich diese Theorie nicht einfach mal auf die Probe? Das macht bestimmt Spaß. Wie üblich fing ich in dem Glauben an, dass es ein oder zwei Kapitel werden würden. (Es ist lustig/traurig, dass ich mich anscheinend immer noch nicht besonders gut kenne.) Ihr erinnert Euch, dass ich erwähnte, wie knapp die Zeit war? Zum Glück hat dieses Projekt nicht nur Spaß gemacht, sondern ging mir auch leicht von der Hand. Wie sich herausstellte, macht es gar keinen großen Unterschied, ob ein menschliches Mädchen in einen männlichen Vampir verliebt ist oder ein menschlicher Junge in einen weiblichen Vampir. Und so kam es zu Beau und Edythe.
Einige Anmerkungen zur Umkehrung:
1. Ich habe bei allen Biss-Figuren grundsätzlich eine Geschlechtsumwandlung vorgenommen, doch es gibt zwei Ausnahmen:
•Die wichtigste Ausnahme sind Charlie und Renée, die Charlie und Renée geblieben sind. Dafür gibt es einen Grund: Beau kam 1987 zur Welt. Damals kam es nur selten vor, dass einem Vater das alleinige Sorgerecht für ein Kind zugesprochen wurde – vor allem, wenn es sich bei dem Kind um einen Säugling handelte. Höchstwahrscheinlich hätte nachgewiesen werden müssen, dass die Mutter in irgendeiner Weise ungeeignet war. Damals (und selbst heute) hätte wohl kaum ein Richter ein Kind zu einem unsteten, arbeitslosen Vater gegeben, wenn die Mutter eine geregelte Arbeit und ein intaktes soziales Umfeld hätte vorweisen können. Charlie hätte natürlich einen Prozess gegen Renée anstrengen und ihr Bella vielleicht wegnehmen können. Trotzdem kommt in Biss zum Morgengrauen die unwahrscheinlichere Konstellation vor. Bella – und in diesem Fall nun Beau – konnte nur deshalb bei Renée aufwachsen, weil vor einigen Jahrzehnten die Rechte der Mutter über die des Vaters gestellt wurden und weil Charlie außerdem nicht zu den rachsüchtigen Männern gehört.
•Die zweite Ausnahme ist relativ bedeutungslos – bloß ein paar Hintergrundfiguren, die nur zwei Mal erwähnt werden. Der Grund für diese Ausnahme ist mein unangebrachter Sinn für Gerechtigkeit bei Romanfiguren. Am Rande des Biss-Universums gab es zwei Figuren, die wirklich ständig Pech hatten. Statt einer Geschlechtsumwandlung habe ich mir etwas Besonderes für sie ausgedacht. Es ist nicht entscheidend für die Geschichte und hat nur damit zu tun, dass ich schräg bin und meine Neurosen auslebe.
2. Da ich noch viele weitere Änderungen im Text vorgenommen habe, die nötig wurden, weil Beau ein Junge ist, dachte ich mir, ich schlüssele sie mal für Euch auf. Es sind natürlich nur grobe Schätzungen. Ich habe nicht alle Wörter gezählt, die ich geändert habe, und es ist auch nicht mathematisch exakt.
•5% der Änderungen habe ich vorgenommen, weil Beau ein Junge ist.
•5% der Änderungen haben damit zu tun, dass sich Beaus Charakter etwas anders entwickelt hat als der von Bella. Beau ist vor allem zwanghafter und in seiner Wortwahl und seinen Gedanken viel weniger blumig. Außerdem ist er nicht so wütend – im Gegensatz zu Bella schleppt er keine Komplexe mit sich herum.
•70% der Änderungen habe ich gemacht, weil ich den Text nach zehn Jahren noch einmal überarbeiten durfte. Ich konnte fast jedes Wort korrigieren, das mich seit Druck des Buches gestört hat, und das war großartig.
•10% waren Dinge, bei denen ich mir gewünscht hätte, ich hätte sie schon beim ersten Mal geschrieben, nur leider sind sie mir damals nicht eingefallen. Das klingt vielleicht wie der vorherige Punkt, ist es aber nicht ganz. Hier geht es nicht um ein Wort, das unbeholfen oder komisch klingt. Es geht vielmehr um eine Idee, die ich gern früher ausprobiert hätte, oder um Unterhaltungen, die es hätte geben sollen, die aber nicht stattfanden.
•5% waren mythologische Unstimmigkeiten – genauer gesagt, Fehler –, meistens im Zusammenhang mit Visionen. Mit jedem Folgeband von Biss zum Morgengrauen – und sogar bei Edward auf den ersten Blick, wo ich mit Edward in Alice’ Kopf blicken konnte – habe ich Alice’ Visionen zunehmend verfeinert. In Biss zum Morgengrauen ist das mystischer, und aus meiner jetzigen Perspektive hätte Alice manchmal daran beteiligt sein sollen, doch sie war es nicht. Schade!
•Damit bleibt ein 5%-Sammelsurium von vielen verschiedenen Änderungen übrig, die ich alle aus unterschiedlichen, aber zweifellos selbstsüchtigen Gründen vorgenommen habe.
Ich hoffe, Ihr habt Spaß an Beaus und Edythes Geschichte, auch wenn Ihr nicht darauf gewartet habt. Ich hatte jedenfalls die schönste Zeit überhaupt, während ich mir diese neue Version ausgedacht habe. Beau und Edythe wuchsen mir auf eine Art ans Herz, die ich nicht vorhergesehen habe, und ihre Geschichte lässt die fiktionale Welt von Forks wieder neu und glücklich vor meinen Augen aufleben. Ich hoffe, Euch geht es ebenso. Wenn Ihr nur ein Zehntel so viel Vergnügen daran habt wie ich, dann war es die Sache wert.
Danke fürs Lesen. Danke, dass Ihr Teil dieser Welt seid, und danke für all die unglaubliche Freude, die Ihr mir in den letzten zehn Jahren geschenkt habt – das alles hätte ich mir nie träumen lassen.
Alles LiebeStephenie
Das seltsame Geschick ist auch ein erhabenes.Jules Verne, Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer
Prolog
Ich hatte nie lange darüber nachgedacht, wie ich sterben würde – auch wenn ich in den vergangenen Monaten allen Grund dazu gehabt hätte. Und wenn, dann hätte ich es mir so niemals vorgestellt.
Mein Blick war auf die dunklen Augen der Jägerin gerichtet, die am anderen Ende des lang gezogenen Raumes stand und mich freundlich betrachtete.
Zumindest war es eine gute Art zu sterben – an Stelle eines anderen, eines geliebten Menschen. Es war sogar edel. Das musste etwas wert sein.
Wäre ich nicht nach Forks gegangen, würde ich jetzt nicht dem Tod ins Auge blicken, so viel stand fest. Doch trotz meiner Angst konnte ich mich nicht dazu durchringen, meine Entscheidung zu bereuen. Wenn einem das Leben einen Traum beschert, der jede Erwartung so sehr übersteigt, dann ist es sinnlos zu trauern, wenn er zu Ende geht.
Die Jägerin lächelte und kam ohne Eile auf mich zu, um mich zu töten.
Auf den ersten Blick
17. Januar 2005
Meine Mutter fuhr mich mit heruntergelassenen Fenstern zum Flughafen. Überall sonst mochte Januar sein, in Phoenix jedoch war es warm, vierundzwanzig Grad, bei strahlend blauem Himmel. Ich trug mein Lieblingsshirt – das von Monty Python mit den Schwalben und der Kokosnuss. Mom hatte es mir vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt und es war mittlerweile etwas zu kurz, aber das war egal. T-Shirts würden sich für mich sowieso bald erledigt haben.
Auf der Halbinsel Olympic im Nordwesten von Washington liegt unter einem fast ständig bewölkten Himmel eine Kleinstadt namens Forks. Diese unbedeutende Stadt bekommt mehr Regen ab als jeder andere Ort in den Vereinigten Staaten von Amerika. Vor dieser Stadt und ihrer erdrückenden Düsternis war meine Mutter mit mir geflohen, als ich nur wenige Monate alt war. In dieser Stadt hatte ich bis zu meinem vierzehnten Geburtstag jeden Sommer einen Monat meiner Ferien verbringen müssen. Dann hatte ich schließlich Bedingungen gestellt und die letzten drei Sommer machte mein Vater, Charlie, mit mir stattdessen zwei Wochen Urlaub in Kalifornien.
Und trotzdem ging ich nun für den Rest meiner Highschoolzeit nach Forks ins Exil. Anderthalb Jahre. Achtzehn Monate. Ich hatte das Gefühl, eine Gefängnisstrafe anzutreten. Achtzehn Monate, ganz schön hart. Als ich die Autotür hinter mir zuschlug, klang es wie niederrasselnde Eisenstäbe.
Okay, das war ein bisschen theatralisch. Meine Mutter hatte schon immer gesagt, ich hätte eine lebhafte Fantasie. Und natürlich war das alles meine eigene Entscheidung. Selbst auferlegtes Exil.
Das machte die Sache aber auch nicht einfacher.
Ich liebte Phoenix. Ich liebte die Sonne und die trockene Hitze und die große ausufernde Stadt. Und ich lebte gern bei meiner Mutter, die mich brauchte.
»Du musst das nicht tun«, wiederholte meine Mutter – zum soundsovielten Mal –, als wir an die Sicherheitskontrolle kamen.
Sie behauptet, wir sähen einander so ähnlich, dass ich sie als Rasierspiegel benutzen könnte. Das stimmt nicht ganz, aber mit meinem Vater habe ich wirklich überhaupt keine Ähnlichkeit. Im Gegensatz zu mir hat meine Mutter ein spitzes Kinn und volle Lippen, aber wir haben genau die gleichen Augen. Sie wirken kindlich bei ihr – so groß und blassblau –, weshalb sie eher wie meine Schwester und nicht wie meine Mutter aussieht. Das bekommen wir jedenfalls ständig zu hören und obwohl sie so tut, als ob sie es nicht mögen würde, steht sie total drauf. Mich lässt das Blassblau nicht jung wirken, sondern eher … unfertig.
Als ich in diese großen besorgten Augen blickte, die meinen so ähnlich sind, geriet ich in Panik. Ich hatte mich mein ganzes Leben lang um meine Mutter gekümmert. Bestimmt hatte es irgendwann mal eine Zeit gegeben (wahrscheinlich als ich noch in den Windeln lag), in der ich nicht für Rechnungen und Papierkram und Kochen und einen kühlen Kopf zuständig war, aber daran konnte ich mich nicht mehr erinnern.
War es gut, meine Mutter sich selbst zu überlassen? In den Monaten, in denen ich mit dieser Entscheidung gerungen hatte, kam es mir wie der richtige Schritt vor. Aber jetzt fühlte es sich in jeder Hinsicht falsch an.
Klar, sie hatte nun Phil, die Rechnungen würden also bestimmt pünktlich bezahlt werden, der Kühlschrank wäre gefüllt und das Auto vollgetankt, und wenn sie sich verlief, gab es jemanden, den sie anrufen konnte … Sie brauchte mich nicht mehr so dringend.
»Ich will aber gehen«, log ich. Ich war immer ein mieser Lügner gewesen, aber diesen Satz hatte ich in letzter Zeit so oft wiederholt, dass er mittlerweile fast glaubhaft klang.
»Grüß Charlie von mir.«
»Mach ich.«
»Bis bald«, versprach sie. »Du kannst jederzeit wieder nach Hause kommen – und wenn du mich brauchst, setze ich mich sofort in den Flieger.«
Aber ich wusste, was ihr das abverlangen würde.
»Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen«, beteuerte ich. »Das wird super. Ich hab dich lieb, Mom.«
Sie drückte mich fest an sich, ich ging durch die Metalldetektoren und dann war sie weg.
Der Flug von Phoenix nach Seattle dauert drei Stunden, danach geht es noch mal eine Stunde in einem kleinen Flugzeug hoch nach Port Angeles und dann mit dem Auto eine Stunde runter nach Forks. Das Fliegen hat mir nie etwas ausgemacht, doch die Fahrt mit Charlie beunruhigte mich ein wenig.
Charlie hatte die ganze Sache ziemlich gut aufgenommen. Er schien sich wirklich zu freuen, dass ich zum ersten Mal für längere Zeit bei ihm wohnen würde. Er hatte mich schon in der Schule angemeldet und wollte mir auch helfen, ein Auto zu finden.
Aber es würde verkrampft mit ihm sein. Man konnte keinen von uns beiden als extrovertiert bezeichnen – vermutlich eine Grundvoraussetzung, um mit meiner Mutter zusammenzuleben. Doch davon mal abgesehen – worüber sollten wir reden? Ich hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich Forks nicht mochte.
Bei der Landung in Port Angeles regnete es. Es war kein böses Omen, es war einfach wie immer. Die Sonne hatte ich innerlich schon abgehakt.
Charlie kam mich mit dem Streifenwagen abholen. Auch damit hatte ich gerechnet. Für die braven Bürger von Forks ist Charlie nämlich Chief Swan, der Polizeichef der Stadt. Und das war der Hauptgrund, warum ich unbedingt ein eigenes Auto haben wollte, obwohl ich knapp bei Kasse war: Ich hatte keine Lust, in einem Wagen mit roten und blauen Lichtern auf dem Dach durch die Stadt kutschiert zu werden. Nichts hält den Verkehr so sehr auf wie ein Polizist.
Ich stolperte aus dem Flugzeug und in Charlies unbeholfen entgegengestreckten Arm.
»Schön, dich zu sehen, Beau«, sagte er lächelnd, während er mich reflexartig auffing. »Du hast dich kaum verändert. Wie geht’s Renée?«
»Mom geht’s gut. Ich freu mich auch, dich zu sehen, Dad.« Er wollte nicht, dass ich ihn Charlie nannte.
»Ist es für dich wirklich in Ordnung, sie allein zu lassen?«
Wir wussten beide, dass es bei dieser Frage nicht darum ging, ob ich mich persönlich gut dabei fühlte. Es ging darum, ob ich mich vor meiner Verantwortung ihr gegenüber drückte. Genau aus diesem Grund hatte Charlie mit meiner Mutter nie um das Sorgerecht gestritten; er wusste, dass sie mich brauchte.
»Ja. Sonst wäre ich nicht hier.«
»Na gut.«
Ich hatte nur zwei große Reisetaschen dabei. Die meisten meiner Arizona-Klamotten waren nicht wasserfest und für das Klima in Washington State nicht geeignet. Obwohl Mom und ich unser Geld zusammengelegt hatten, um meine Wintergarderobe aufzustocken, war sie nach wie vor dürftig. Ich konnte die beiden Taschen problemlos tragen, doch Charlie bestand darauf, mir eine abzunehmen.
Ich geriet etwas aus dem Gleichgewicht – nicht dass mein Gleichgewichtssinn jemals besonders ausgeprägt gewesen wäre, vor allem seit meinem letzten Wachstumsschub – und stolperte über die Türschwelle. Die Tasche machte einen Schlenker und traf einen Typen, der ins Flughafengebäude hineinwollte.
»Oh, sorry.«
Er war nicht viel älter als ich, allerdings wesentlich kleiner, aber das hielt ihn nicht davon ab, sich mit hochgerecktem Kinn vor mir aufzubauen. Sein Hals war auf beiden Seiten tätowiert. Die kleine Frau mit den rabenschwarz gefärbten Haaren neben ihm starrte mich drohend an.
»Sorry?«, wiederholte sie, als wäre meine Entschuldigung eine Beleidigung gewesen.
»Ja, wieso?«
Und dann bemerkte sie Charlie in seiner Uniform. Er brauchte nicht mal was zu sagen. Ein Blick von ihm auf den Tätowierten genügte, und schon trat der Typ einen Schritt zurück und sah plötzlich wesentlich jünger aus. Als Charlie die Frau musterte, verzog sie den roten, mit Lipgloss geschminkten Mund zu einer Schnute. Ohne einen weiteren Kommentar drückten sich die beiden an mir vorbei und gingen in das kleine Flughafengebäude.
Charlie und ich zuckten gleichzeitig die Achseln. Es war lustig, dass wir, obwohl wir uns so selten sahen, manchmal die gleichen Angewohnheiten hatten. Vielleicht hatte es was mit den Genen zu tun.
»Ich hab ein gutes Auto für dich gefunden, ganz billig«, verkündete Charlie, als wir angeschnallt im Streifenwagen saßen und losfuhren.
»Was denn für eins?«, fragte ich misstrauisch, weil er »ein gutes Auto für dich« gesagt hatte statt einfach »ein gutes Auto«.
»Es ist ein Pick-up – ein Chevy.«
»Und wo hast du den her?«
»Erinnerst du dich noch an Bonnie Black aus La Push?« La Push ist das winzige Indianerreservat hier an der Küste.
»Nein.«
»Ihr Mann und sie waren im Sommer oft mit uns angeln«, versuchte Charlie mir auf die Sprünge zu helfen.
Das erklärte, warum ich mich nicht an sie erinnerte. Im Verdrängen von unangenehmen Erinnerungen bin ich Weltmeister.
»Sie sitzt mittlerweile im Rollstuhl«, fuhr Charlie fort, als ich nicht reagierte. »Da sie sowieso nicht mehr Auto fahren kann, hat sie mir ein gutes Angebot gemacht.«
»Welches Baujahr?« Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatte er gehofft, dass ich genau diese Frage nicht stellen würde.
»Bonnie hat alles Mögliche am Motor ausgetauscht – er ist so gut wie neu.«
Glaubte er wirklich, ich würde so schnell aufgeben?
»Wann hat sie ihn denn gekauft?«
»Ich glaube, 1984.«
»Als Neuwagen?«
»Das nicht. Neu war er Anfang der Sechziger, würde ich mal sagen – oder frühestens in den späten Fünfzigern«, räumte er verlegen ein.
»Aber Dad, ich hab keine Ahnung von Autos. Wenn irgendwas kaputtgeht, krieg ich das nie wieder hin, und eine Werkstatt kann ich nicht bezahlen …«
»Ehrlich, Beau, das Ding läuft wie geschmiert. So was wird heute gar nicht mehr gebaut.«
Das Ding, dachte ich … Das klang nicht schlecht, zumindest als Spitzname.
»Was verstehst du denn unter billig?« Um zu dem Punkt zu kommen, bei dem ich keine Kompromisse machen konnte.
»Na ja, ich hab ihn eigentlich schon für dich gekauft. Als Begrüßungsgeschenk.« Charlie warf mir einen hoffnungsvollen Seitenblick zu.
Wow. Umsonst.
»Dad, das hättest du wirklich nicht tun müssen. Ich wollte mir doch selber ein Auto kaufen.«
»Hab ich gern gemacht. Ich will, dass es dir hier gut geht.« Er wandte den Blick nicht von der Straße, als er das sagte. Charlie war es nie leichtgefallen, seine Gefühle in Worte zu fassen. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen uns. Als ich ihm antwortete, schaute ich ebenfalls geradeaus.
»Das ist super, Dad. Danke, ich freu mich wirklich.« Dass es mir in Forks nie richtig gut gehen würde, brauchte ich nicht hinzuzufügen. Es half schließlich niemandem weiter, wenn er meinen Frust mit mir teilte. Und einem geschenkten Pick-up schaute man nicht ins Maul – oder unter die Motorhaube.
»Ach was, keine Ursache«, murmelte er verlegen, weil ich mich bedankte.
Wir wechselten noch ein paar Sätze über das ewige Regenwetter, dann gingen uns die Themen aus. Wir blickten nach draußen.
Vermutlich war es wirklich schön hier. Alles war grün: die moosbewachsenen Stämme und Äste der Bäume, der mit Farnen bedeckte Boden. Selbst das durch die Blätter schimmernde Licht war grünlich.
Es war zu grün. Ein fremder Planet.
Dann waren wir endlich bei Charlie. Er wohnte noch immer in dem kleinen Haus mit den drei Zimmern plus Küche, das meine Mutter und er zu Beginn ihrer Ehe gekauft hatten. Mehr als einen Beginn hatte es in dieser Ehe nicht gegeben. Und dort, auf der Straße vor dem Haus, an dem sich nie etwas änderte, stand mein neuer – na ja, zumindest für mich neuer – Pick-up. Sein roter Lack war stumpf, er hatte große, geschwungene Kotflügel und ein abgerundetes Fahrerhaus.
Ich fand ihn genial. Da Autos eigentlich noch nie mein Ding gewesen waren, überraschte mich meine Reaktion. Ich wusste zwar nicht, ob er überhaupt fuhr, aber ich fand, dass er zu mir passte. Außerdem war er eines dieser robusten eisernen Ungeheuer, die nie kaputtgehen und bei Unfällen keinen Kratzer kriegen, während der ausländische Wagen, den sie gerade plattgemacht haben, in Einzelteilen um sie herumliegt.
»Wow, Dad, der ist ja der Hammer! Danke!« Diesmal echte Begeisterung. Ich hatte nicht nur einen richtig coolen Pick-up, sondern musste nun auch morgens nicht mehr zwei Stunden durch den Regen zur Schule laufen oder mich vom Streifenwagen des Polizeichefs mitnehmen lassen. Mein ultimativer Albtraum.
»Freut mich, dass er dir gefällt«, brummte Charlie, er war schon wieder verlegen.
Wir mussten nur einmal laufen, um meine ganzen Sachen nach oben zu schaffen. Ich bekam das Zimmer zur Straßenseite, in dem ich schon immer gewohnt hatte. Der Dielenboden, die hellblauen Wände, die schräge Decke, die ausgeblichenen blau-weiß karierten Vorhänge an den Fenstern – alles war ein Teil meiner Kindheit. Charlie hatte seit meiner Geburt nur zwei Veränderungen vorgenommen: Er hatte die Babywiege gegen ein Bett ausgetauscht und, als ich etwas älter war, einen Schreibtisch hineingestellt, auf dem nun ein gebrauchter Computer stand. Auf dem Boden war ein Modemkabel festgetackert, das zur nächsten Telefonbuchse führte. Das war eine der Bedingungen meiner Mutter gewesen, damit wir in Kontakt bleiben konnten. Selbst der alte Schaukelstuhl aus meiner Babyzeit stand noch in der Ecke.
Es gab nur ein kleines Badezimmer im Haus, oben neben der Treppe, das würde ich mir mit Charlie teilen müssen. Aber bisher hatte ich eines mit meiner Mutter zusammen, und das war eindeutig schlimmer. Sie hatte viel mehr Krimskrams und wehrte sich hartnäckig gegen all meine Aufräumversuche.
Eine von Charlies besten Eigenschaften ist, dass er einen in Ruhe lassen kann. Er zog sich zurück, damit ich ankommen und auspacken konnte, was meiner Mutter nie in den Sinn gekommen wäre. Es tat gut, allein zu sein, nicht lächeln und ein zufriedenes Gesicht machen zu müssen, sondern einfach trübsinnig in den strömenden Regen hinauszuschauen und düstere Gedanken zu wälzen.
Die Forks High School hatte gerade mal 357 Schüler – mit mir nun 358 –, zu Hause waren wir allein in meinem Jahrgang mehr als siebenhundert gewesen. Alle hier waren zusammen aufgewachsen, schon ihre Großeltern kannten sich aus dem Sandkasten. Ich würde der Neue aus der Großstadt sein, etwas zum Anstarren und Tuscheln.
Wäre ich einer der coolen Jungs gewesen, hätte ich das zu meinem Vorteil nutzen können. Und wäre lässig wie der Supermacho hereinspaziert. Aber man sah mir auf den ersten Blick an, dass ich keiner dieser Typen war – weder der Footballstar noch der Klassensprecher und auch nicht der Draufgänger mit dem Motorrad. Ich war der Typ, der aussah, als könnte er ganz gut Basketball spielen, was sich allerdings gleich erledigt hatte, wenn ich den ersten Schritt machte. Ich war der Typ, den man in den Spind schubste, bis ich in der Zehnten plötzlich zwanzig Zentimeter in die Höhe geschossen war. Ich war der Typ, der zu ruhig und zu käsig war und der keine Ahnung hatte von Videospielen, Autos oder Baseballergebnissen oder irgendetwas anderem, wofür ich mich eigentlich hätte interessieren müssen.
Im Gegensatz zu anderen Jungs hatte ich kaum Freizeit, um irgendwelchen Hobbys nachzugehen. Ich musste mich darum kümmern, dass das Konto gedeckt war, verstopfte Abflüsse reinigen und den Wocheneinkauf erledigen.
Zumindest war das bisher so gewesen.
Mit Leuten meines Alters kam ich deshalb nicht besonders gut klar. Und vielleicht kam ich ja in Wahrheit mit Leuten generell nicht gut klar, fertig. Selbst meine Mutter, der ich näherstand als irgendwem sonst auf der Welt, begriff nicht wirklich, wie ich tickte. Manchmal fragte ich mich, ob ich dieselben Dinge sah wie der Rest der Menschheit. Vielleicht sah ich das, was alle anderen als rot wahrnahmen, ja grün. Vielleicht roch ich Essig, wenn sie Kokosnuss rochen. Vielleicht hatte mein Gehirn irgendeinen Defekt.
Aber die Ursache war egal – entscheidend war die Wirkung. Und der nächste Tag würde erst der Anfang sein.
Ich schlief nicht gut in dieser Nacht, selbst nachdem ich aufgehört hatte zu grübeln. Das andauernde Rauschen des Regens und des Windes auf dem Dach wollte einfach nicht zum Hintergrundgeräusch werden. Ich zog mir die alte Steppdecke über den Kopf und später noch das Kissen, trotzdem schlief ich erst nach Mitternacht ein, als der Regen endlich nachließ und nur noch leise tröpfelte.
Als ich am Morgen aus dem Fenster schaute, sah ich nur dichten Nebel und plötzlich erschien mir das Zimmer erdrückend eng. Hier konnte man nie den Himmel sehen, es fühlte sich an wie die Gefängniszelle, die ich mir am Flughafen vorgestellt hatte.
Das Frühstück mit Charlie verlief ruhig. Er wünschte mir viel Glück in der Schule. Ich bedankte mich, doch ich wusste, dass seine Hoffnung reine Zeitverschwendung war. Das Glück ging mir tendenziell aus dem Weg. Charlie fuhr los zum Polizeirevier, das ihm Frau und Familie ersetzte; ich hatte noch ein bisschen Zeit. Nachdem er weg war, saß ich auf einem der drei bunt zusammengewürfelten Stühle an dem alten, quadratischen Eichentisch und betrachtete die vertraute kleine Küche: die dunkel getäfelten Wände, die leuchtend gelben Schränke, das weiße Linoleum. Alles war unverändert. Die Schränke hatte meine Mutter vor achtzehn Jahren gestrichen, um etwas Sonne ins Haus zu bringen. Nebenan, in dem winzigen Wohnzimmer, hingen ein paar Bilder über dem kleinen Kamin. Ein Hochzeitsfoto von Charlie und meiner Mutter, aufgenommen in Las Vegas, daneben eins von uns dreien im Krankenhaus, nach meiner Geburt, wohl von einer hilfsbereiten Schwester aufgenommen, und schließlich, in einer Reihe, meine Schulfotos bis zu diesem Jahr. Die waren mir peinlich – die üblen Haarschnitte, die Jahre mit Zahnspange, die Akne, die schließlich verschwunden war. Ich musste Charlie davon überzeugen, sie irgendwo anders aufzuhängen, zumindest solange ich hier wohnte.
In diesem Haus war nicht zu übersehen, dass Charlie die Trennung von meiner Mutter nie verwunden hatte. Das deprimierte mich irgendwie.
Ich wollte nicht zu früh in der Schule sein, aber hier drinnen hielt ich es nicht länger aus. Ich zog meine Jacke an – aus festem undurchlässigem Polyester, wie ein Schutzanzug – und ging hinaus in den Regen.
Da es nach wie vor nur nieselte, wurde ich nicht sofort klatschnass, als ich den Hausschlüssel aus seinem üblichen Versteck unter dem Dachvorsprung neben der Tür nahm und abschloss. Das platschende Geräusch meiner neuen wasserfesten Stiefel klang komisch, ich vermisste das vertraute Knirschen von Kies.
Im Wagen war es gemütlich und trocken. Obwohl Bonnie oder Charlie ihn sauber gemacht zu haben schien, rochen die hellbraunen Sitzpolster immer noch leicht nach Tabak, Benzin und Pfefferminz. Zu meiner Erleichterung sprang der Motor gleich an, heulte allerdings mit ohrenbetäubender Lautstärke auf und behielt den Lärmpegel auch im Leerlauf bei. Aber irgendeine Macke musste ein Auto in diesem Alter ja haben. Dafür funktionierte erstaunlicherweise das vorsintflutliche Radio.
Die Schule zu finden, war nicht weiter schwierig, sie lag, wie fast alles in dieser Stadt, direkt neben der Hauptstraße. Zunächst nahm ich sie überhaupt nicht als solche wahr, erst das Schild, das sie als Forks High School auswies, gab mir den Hinweis. Es war eine Ansammlung gleich aussehender Häuser aus rotbraunen Ziegeln. Auf dem Gelände standen so viele Bäume und Büsche, dass ich zuerst gar nicht bemerkte, wie groß es war. Wo war bloß das vertraute Anstaltsgefühl?, dachte ich. Wo waren der Maschendrahtzaun und die Metalldetektoren?
Ich parkte gleich vor dem ersten Gebäude, über der Tür war ein kleines Schild mit der Aufschrift »Verwaltung« angebracht. Da niemand sonst dort parkte, war es bestimmt verboten, aber bevor ich wie ein Idiot Runde um Runde im Regen drehte, wollte ich mich lieber im Büro erkundigen.
Drinnen war es hell erleuchtet und wärmer, als ich gehofft hatte. Das Sekretariat war klein; es gab einen winzigen Wartebereich mit gepolsterten Klappstühlen, auf dem Boden lag orange gesprenkelte Auslegeware, an den Wänden hingen jede Menge Mitteilungen und Auszeichnungen und eine große laut tickende Uhr. Und als ob es draußen nicht schon genug Grün gäbe, standen überall große Plastiktöpfe mit Zimmerpflanzen herum. Mitten durch den Raum ging ein langer Tresen, der mit Formularablagen zugestellt war, an seiner Vorderseite klebten lauter bunte Infozettel. Dahinter standen drei Schreibtische und an einem davon saß ein dicklicher kahlköpfiger Mann mit Brille. Als ich sah, dass er nur ein T-Shirt trug, kam ich mir sofort viel zu warm angezogen vor.
Der Glatzkopf blickte auf. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Mein Name ist Beau Swan«, sagte ich und er schien sofort Bescheid zu wissen. Man hatte mich erwartet, ich war schon ein Gesprächsthema. Der Sohn des Polizeichefs, der Junge mit der labilen Mutter, endlich zu Hause.
»Ja, richtig«, sagte er und kramte in einem schiefen Stapel Unterlagen herum, bis er fand, wonach er suchte. »Hier ist Ihr Stundenplan, Beaufort, und eine Übersichtskarte des Schulgeländes.« Er kam mit mehreren Blättern zum Tresen.
»Ähm, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre mir Beau lieber.«
»Natürlich, kein Problem, Beau.«
Er ging mit mir meinen Stundenplan durch, zeichnete auf der Karte die kürzesten Wege zwischen den Kursräumen ein und gab mir einen Zettel, den ich von allen Lehrern unterschreiben lassen und nach dem Unterricht wieder bei ihm abgeben sollte. Dann lächelte er mich an und sagte wie Charlie, dass er hoffe, ich würde mich in Forks wohlfühlen. Ich erwiderte sein Lächeln so überzeugend wie möglich.
Als ich zu meinem Pick-up zurückging, trafen allmählich auch die anderen Schüler ein. Ich folgte der Autoschlange um das Schulgelände herum. Die meisten Wagen waren etwas älter, so wie mein Pick-up, nichts Protziges. Zu Hause hatte ich in einem der wenigen einkommensschwachen Viertel des Paradise Valley District gewohnt. Ein fabrikneuer Mercedes oder Porsche auf dem Schülerparkplatz war dort ganz normal. Hier war das schickste Auto ein funkelnagelneuer silberner Volvo, der richtig herausstach. Um nicht gleich alle Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, stellte ich trotzdem den röhrenden Motor ab, sobald ich eingeparkt hatte.
Ich schaute mir noch einmal die Karte an und versuchte sie mir einzuprägen. Hoffentlich musste ich nicht den ganzen Tag mit diesem Stück Papier vor dem Gesicht herumlaufen. Ich stopfte alles in meinen Rucksack, warf mir den Trageriemen über die Schulter und holte tief Luft. Wird schon nicht so schlimm werden, redete ich mir ein. Im Ernst, hier ging es schließlich nicht um Leben und Tod, sondern bloß um eine High School. Es würde mich schon keiner beißen. Dann atmete ich noch einmal durch und stieg aus.
Ich zog mir die Kapuze über und lief mit den anderen Schülern zum Gehweg hinunter. Erleichtert stellte ich fest, dass ich in meiner schlichten schwarzen Jacke nicht auffiel, doch an meiner Größe war nichts zu ändern. Ich zog die Schultern hoch und senkte den Kopf.
Einmal an der Cafeteria vorbei, war Haus drei nicht zu verfehlen. An der östlichen Ecke des Gebäudes prangte ein weißes Quadrat mit einer großen schwarzen 3 darauf. Ich folgte zwei Unisex-Regenjacken ins Gebäude hinein.
Das Klassenzimmer war klein. Die beiden vor mir hängten ihre Jacken an eine lange Reihe von Kleiderhaken neben der Tür. Ich hängte meine daneben. Es waren zwei Mädchen, das eine hatte porzellanfarbene Haut und blonde Haare, das andere war ebenfalls blass mit hellbraunem Haar. Meine Hautfarbe würde hier wenigstens nicht besonders auffallen.
Ich ging mit meinem Laufzettel zur Lehrerin, einer schmalen Frau mit dünnem Haar, deren Namensschild auf dem Tisch sie als Ms Mason auswies. Als sie meinen Namen sah, gaffte sie mich an, was mir nicht gerade Mut machte. Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf stieg, was garantiert hässliche Flecke auf meinen Wangen und auf der Nase hervorrief. Aber wenigstens schickte sie mich gleich zu einem freien Platz in der letzten Reihe, ohne mich der Klasse vorzustellen. Ich klemmte mich so unauffällig wie möglich hinter den kleinen Tisch.
Der Platz ganz hinten machte es meinen neuen Mitschülern schwer, mich anzustarren, hielt sie aber nicht davon ab. Ich hob den Blick nicht von der Leseliste, die mir die Lehrerin in die Hand gedrückt hatte. Das Übliche: Brontë, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Das hatte ich alles schon gelesen. Was beruhigend war … und langweilig. Ich überlegte, ob Mom bereit wäre, mir den Ordner mit meinen alten Aufsätzen zu schicken – oder hielt sie das für Schummelei? In Gedanken spielte ich verschiedene Diskussionen mit ihr durch, während die Lehrerin vorne ihren Monolog fortsetzte.
Als es klingelte, lehnte sich ein blasses, mageres Mädchen mit Pickeln über den Gang zu mir herüber. Ihre schwarzen Haare glänzten wie ein Ölfleck.
»Du bist bestimmt Beaufort Swan, oder?«, sagte sie. Sie schien eines dieser übertrieben hilfsbereiten Schachklub-Mädchen zu sein.
»Beau«, korrigierte ich sie. Alle im Umkreis von drei Tischen drehten sich in meine Richtung.
»Was hast du in der nächsten Stunde?«, fragte sie.
Ich musste in meinem Rucksack nachsehen. »Gemeinschaftskunde, bei Jefferson, in Haus sechs.«
Egal, wohin ich sah, überall begegnete ich neugierigen Blicken.
»Ich muss zu Haus vier, ich könnte dir den Weg zeigen.« Eindeutig übertrieben hilfsbereit. »Ich bin Erica«, fügte sie hinzu.
Ich lächelte gezwungen. »Danke.«
Wir holten unsere Jacken und gingen hinaus in den Regen, der stärker geworden war. Ein paar Leute schienen extra dicht hinter uns herzulaufen, als ob sie mithören wollten. Hoffentlich fing ich nicht an, paranoid zu werden.
»Bestimmt ein ziemlicher Unterschied zu Phoenix, oder?«, fragte sie.
»Stimmt.«
»Dort regnet es selten, was?«
»Drei- oder viermal im Jahr.«
»Wow, wie das wohl ist?«, überlegte sie.
»Sonnig«, sagte ich.
»Du bist aber nicht besonders braun.«
»Meine Mutter ist zur Hälfte Albino.«
Während sie mich besorgt musterte, musste ich mir ein Stöhnen verkneifen. Viele Wolken und ein Sinn für Humor waren wohl unvereinbare Gegensätze. Ein paar Monate hier, dann würde ich vergessen haben, was Sarkasmus ist.
Wir gingen wieder an der Cafeteria vorbei, zu den Gebäuden im südlichen Teil des Schulgeländes, neben der Sporthalle. Trotz der gut sichtbaren Nummer am Haus brachte Erica mich bis zur Tür.
»Viel Glück«, sagte sie, als ich nach der Klinke griff. »Vielleicht haben wir ja noch andere Kurse zusammen.« Es klang hoffnungsvoll.
Ich lächelte – was sie hoffentlich nicht als Ermutigung auffasste – und ging hinein.
Der Rest des Vormittags verlief ungefähr auf die gleiche Weise. Ms Varner, meine Mathelehrerin, die ich wegen ihres Faches sowieso schon unsympathisch gefunden hätte, war die Einzige, die mich dazu zwang, mich vor die Klasse zu stellen und meinen Namen zu sagen. Ich stammelte, bekam rote Flecke und stolperte auf dem Weg zu meinem Platz über meine eigenen Füße.
Nach der zweiten Stunde erkannte ich in jedem neuen Raum ein paar Gesichter wieder. Es gab immer jemanden, der mutiger war als die anderen, sich vorstellte und mich fragte, wie es mir in Forks gefiel. Ich versuchte diplomatisch zu sein, aber die meiste Zeit log ich einfach das Blaue vom Himmel herunter. Wenigstens brauchte ich die Übersichtskarte nicht.
Jeder neue Lehrer nannte mich erst einmal Beaufort und obwohl ich sie sofort verbesserte, machte es mich irgendwie fertig. Ich hatte Jahre gebraucht, um den Beaufort loszuwerden – schönen Dank auch, Opa, dass du ein paar Monate vor meiner Geburt sterben musstest und sich meine Mutter verpflichtet fühlte, mir deinen Namen zu geben. Zu Hause erinnerte sich mittlerweile keiner mehr daran, dass Beau nur die Kurzform war. Aber hier ging alles wieder von vorne los.
Ein Junge saß sowohl in Mathe als auch in Spanisch neben mir und nahm mich in der Mittagspause zur Cafeteria mit. Er war klein, reichte mir nicht einmal bis zur Schulter, aber seine wilden dunklen Locken machten unseren Größenunterschied fast wieder wett. Da ich mich nicht an seinen Namen erinnern konnte, lächelte ich bloß und nickte, während er über Lehrer und Fächer quatschte. Ich versuchte gar nicht erst, mir irgendwas davon zu merken.
Wir setzten uns ans Ende eines voll besetzten Tisches zu ein paar Freunden von ihm, die er mir vorstellte – gute Manieren hatten sie in Forks, das musste man ihnen lassen. Allerdings vergaß ich auch ihre Namen auf der Stelle. Sie schienen es cool zu finden, dass er mich mitgebracht hatte. Als Erica, das Mädchen aus dem Englischkurs, mir quer durch den Raum zuwinkte, lachten alle. Offenbar war ich schon die Witzfigur. Ich stellte sogar für meine Verhältnisse gerade einen neuen Rekord auf. Allerdings wirkte keiner von ihnen bösartig.
Als ich dort saß und versuchte, mich mit sieben neugierigen Fremden zu unterhalten, sah ich sie zum ersten Mal.
Sie saßen an einem Tisch am anderen Ende der Cafeteria, so weit entfernt von uns, wie es in dem langen Raum möglich war. Sie waren zu fünft. Sie redeten nicht und sie aßen nicht, obwohl vor jedem von ihnen ein Tablett mit Essen stand. Im Gegensatz zu den meisten anderen im Raum glotzten sie mich aber nicht an, so dass ich sie anstarren konnte, ohne Angst haben zu müssen, ertappt zu werden. Doch das alles war nicht der Grund, warum sie meine Aufmerksamkeit erregten.
Sie hatten keinerlei Ähnlichkeit miteinander.
Es waren drei Mädchen darunter. Eines davon war selbst im Sitzen sehr groß, vielleicht so groß wie ich – ihre Beine wirkten einfach endlos lang. Vom Aussehen her hätte sie Mannschaftskapitänin eines Volleyballteams sein können, und ihre Schmetterbälle wollte man ganz sicher nicht abkriegen. Ihre dunklen Locken waren zu einem unordentlichen Pferdeschwanz zusammengebunden.
Die Zweite hatte schulterlanges honigfarbenes Haar; sie war nicht ganz so groß wie die Brünette, aber wahrscheinlich immer noch größer als die meisten Jungs an meinem Tisch. Sie wirkte irgendwie angespannt, gereizt. Komischerweise erinnerte sie mich aus irgendeinem Grund an die Schauspielerin in dem Actionfilm, den ich mir vor einigen Wochen angesehen hatte. Sie hatte ein Dutzend Typen mit der Machete niedergemäht. Ich konnte mich erinnern, dass ich es für unglaubwürdig gehalten hatte – es konnte einfach nicht sein, dass sie es mit so vielen fiesen Kerlen aufnahm und dann auch noch gewann. Hätte dieses Mädchen die Rolle gespielt, hätte ich es ihr möglicherweise abgenommen.
Das dritte Mädchen war kleiner, seine Haarfarbe changierte zwischen Rot und Braun, aber im Grunde war sie weder das eine noch das andere; sie hatte etwas eigenartig Metallisches und erinnerte an Bronze. Das Mädchen schien jünger zu sein als die beiden anderen, die locker als Studentinnen durchgegangen wären.
Die beiden Jungen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Der größere – der eindeutig größer war als ich, vermutlich eins fünfundneunzig oder sogar noch mehr – war offenbar der Spitzensportler der Schule. Und der Beliebteste. Der Typ, der im Kraftraum immer alle Geräte für sich beanspruchte. Seine glatten goldblonden Haare waren am Hinterkopf zu einem Dutt zusammendreht, der aber gar nichts Weibisches hatte – im Gegenteil, er ließ ihn noch viel männlicher wirken. Der Typ war eindeutig zu cool für diese Schule, und überhaupt für jede Schule.
Der Kleinere war drahtig, seine dunklen Haare waren so kurz abrasiert, dass sie nur wie ein Schatten auf seiner Kopfhaut wirkten.
Aber trotz aller Unterschiede glichen sie einander wie ein Ei dem anderen. Sie waren allesamt kalkweiß – die blassesten Schüler dieser sonnenlosen Stadt. Sogar noch blasser als ich, der Albino. Trotz ihrer verschiedenen Haarfarben hatten sie alle ganz dunkle Augen – von meinem Platz aus schienen sie schwarz. Und unter ihren Augen lagen tiefe Schatten – violett, wie Blutergüsse. Vielleicht hatten die fünf gerade eine Nacht durchgemacht oder kurierten einen Nasenbruch aus. Allerdings war ihre Nase, wie alles andere in ihrem Gesicht, absolut gerade und ebenmäßig.
Aber das war nicht der Grund dafür, dass ich den Blick nicht abwenden konnte.
Ich starrte sie an, weil ihre Gesichter, so verschieden und doch gleich sie sein mochten, unglaublich, überirdisch schön waren. Sowohl die Mädchen als auch die Jungen – wunderschön. Solche Gesichter gab es in der Realität nicht, nur auf den geschönten Bildern von Modemagazinen oder Werbetafeln. Oder in einem Museum, auf den Gemälden alter Meister, als Engelsgesichter. Sie waren irgendwie unwirklich.
Ich fand das kleinere Mädchen mit den bronzefarbenen Haaren am schönsten, aber die weibliche Hälfte der Schülerschaft würde vermutlich den blonden Filmstar wählen. Doch das wäre ein Irrtum. Ja, sie sahen alle umwerfend aus, aber das Mädchen war irgendwie mehr als nur schön. Sie war absolut vollkommen. Es war eine verwirrende, verstörende Vollkommenheit, die mir auf den Magen schlug.
Sie vermieden jeden Blickkontakt, sowohl untereinander als auch mit den anderen Schülern. Soweit ich es beurteilen konnte, starrten sie einfach ins Leere. Sie erinnerten mich an Models, die betont künstlerisch für Werbeaufnahmen posierten – ihrer eigenen Schönheit überdrüssig. Ich beobachtete, wie der drahtige Kahlrasierte mit seinem Tablett aufstand – die Colaflasche war ungeöffnet und der Apfel unberührt – und davonging, sein schneller, anmutiger Gang gehörte eher auf einen Laufsteg. Während ich ihm noch mit den Augen folgte und überlegte, ob es in dieser Stadt wohl eine Tanzgruppe gab, stellte er das Tablett ab und glitt mit unglaublicher Geschwindigkeit zur Hintertür hinaus. Mein Blick schnellte zu den anderen zurück, die sich nicht von der Stelle gerührt hatten.
»Wer sind denn die da drüben?«, fragte ich den Jungen aus meinem Spanischkurs, dessen Name mir nicht mehr einfallen wollte.
Als er aufblickte, um zu sehen, wen ich meinte – obwohl mein Tonfall das vermutlich erahnen ließ –, sah plötzlich die Vollkommene zu uns herüber. Sie musterte kurz meinen Nachbarn, dann wanderten ihre dunklen Augen weiter zu mir. Schräg stehende Mandelaugen, dichte Wimpern.
Sie wandte schnell den Blick ab, viel schneller als ich, obwohl ich, als ich merkte, dass sie zu uns herübersah, sofort aufgehört hatte sie anzustarren. Ich spürte, wie sich wieder rote Flecke auf meinen Wangen bildeten. In ihrem kurzen Blick lag keinerlei Interesse – es war, als ob mein Nachbar ihren Namen gerufen und sie nur unwillkürlich aufgeschaut hätte, auch wenn sie nicht im Traum daran dachte, ihm zu antworten.
Der Junge neben mir lachte verlegen auf und starrte wie ich auf die Tischplatte.
Seine Antwort war ein gedämpftes Murmeln. »Das sind die Cullens und die Hales. Edith und Eleanor Cullen, Jessamine und Royal Hale. Der Junge, der eben gegangen ist, war Archie Cullen. Sie leben alle bei Dr. Cullen und ihrem Mann.«
Ich warf einen Seitenblick auf das vollkommene Mädchen, das nun sein Tablett betrachtete und mit schlanken blassen Fingern einen Bagel in Stücke zupfte. Obwohl sie kaum die Lippen öffnete, bewegte sich ihr Mund sehr schnell. Die drei anderen sahen sie nicht an, aber ich hatte dennoch den Eindruck, dass sie leise auf sie einredete.
Seltsame Namen. Altmodisch. Namen von Großeltern – so wie meiner. Aber vielleicht standen die hier auf so was? Kleinstadtnamen? Mir fiel endlich wieder ein, dass mein Tischnachbar Jeremy hieß. Ein ganz normaler Name. In meinem Geschichtskurs zu Hause hatte es zwei Jeremys gegeben.
»Sie sehen alle … ziemlich gut aus.« Was für eine Untertreibung.
»Ja!«, stimmte Jeremy zu und lachte. »Sie sind aber schon vergeben – also Royal und Eleanor, Archie und Jessamine. Sie sind Pärchen. Und sie wohnen zusammen.« Er kicherte und wackelte vielsagend mit den Augenbrauen.
Keine Ahnung, warum, aber seine Reaktion weckte den Wunsch in mir, sie zu verteidigen. Vielleicht nur, weil er es so geringschätzig gesagt hatte. Aber was hätte ich schon vorbringen können? Ich kannte sie ja überhaupt nicht.
»Welche sind die Cullens?«, fragte ich, um den Ton, aber nicht das Thema zu wechseln. »Sie sehen nicht aus, als wären sie miteinander verwandt … na ja, also, irgendwie …«
»Nein, das sind sie auch nicht. Dr. Cullen ist noch sehr jung. Anfang dreißig. Die beiden Cullens sind adoptiert. Die Hales – die zwei Blonden – sind tatsächlich Geschwister, Zwillinge, glaub ich, und so was wie Pflegekinder.«
»Für Pflegekinder sehen sie aber ganz schön erwachsen aus.«
»Mittlerweile schon. Royal und Jessamine sind beide achtzehn, aber sie leben schon seit ihrer Kindheit bei Mr Cullen. Ich glaube, er ist ihr Onkel.«
»Ganz schön großherzig – so viele Kinder aufzunehmen, obwohl sie selber noch so jung sind.«
»Ja, vermutlich«, stimmte Jeremy widerstrebend zu, er schien Dr. Cullen und ihren Mann aus irgendeinem Grund nicht zu mögen. Den Seitenblicken auf ihre adoptierten Kinder nach zu urteilen, war da Eifersucht im Spiel. »Aber Dr. Cullen kann, glaube ich, selber keine Kinder bekommen«, fügte er hinzu, als wäre ihre Großherzigkeit deshalb weniger wert.
Während ich mit ihm redete, wanderte mein Blick immer wieder zu der sonderbaren Familie. Sie starrten nach wie vor die Wand an, ohne ihr Essen anzurühren.
»Haben sie schon immer in Forks gewohnt?«, fragte ich. Warum waren sie mir noch nie aufgefallen, wenn ich im Sommer hier war?
»Nein. Sie sind erst vor zwei Jahren hergezogen, davor haben sie irgendwo in Alaska gelebt.«
Ich spürte Mitleid in mir aufsteigen. Und Erleichterung. Mitleid, weil sie trotz ihrer Schönheit Außenseiter waren und nicht akzeptiert wurden. Erleichterung, dass ich nicht der einzige Neue hier war und ganz sicher nicht der interessanteste, egal, welchen Maßstab man anlegte.
Während ich sie musterte, schaute das vollkommene Mädchen, eine der Cullens, plötzlich auf und begegnete meinem Blick, diesmal mit offensichtlicher Neugierde. Ich sah sofort weg, meinte jedoch, in ihren Augen eine Art unbefriedigte Erwartung wahrgenommen zu haben.
»Wer ist das Mädchen mit den rotbraunen Haaren?«, fragte ich. Ich tat, als würde ich mich in der Cafeteria umschauen, und sah beiläufig in ihre Richtung; sie starrte mich immer noch an, allerdings nicht so penetrant wie die anderen Schüler an diesem Tag. In ihrem Blick lag eine Enttäuschung, die ich nicht verstand. Ich sah wieder auf den Tisch.
»Das ist Edith. Sie ist ziemlich heiß, aber mach dir keine Hoffnungen. Sie verabredet sich mit niemandem. Anscheinend ist ihr keiner der Jungs hier gut genug«, sagte Jeremy missmutig und schnaubte. Wie oft sie ihm wohl eine Abfuhr erteilt hatte?
Ich presste die Lippen aufeinander, um mein Lächeln zu verbergen. Dann wagte ich einen weiteren Blick. Edith. Ihr Gesicht war abgewandt, aber da war dieses Grübchen in ihrer Wange – sie schien ebenfalls zu lächeln.
Ein paar Minuten später standen die vier gemeinsam vom Tisch auf. Sie wirkten alle auffallend anmutig, auch der goldene Filmstar. Es war seltsam, sie gemeinsam in Bewegung zu sehen. Edith blickte nicht noch einmal zu mir herüber.
Ich blieb länger bei Jeremy und seinen Freunden sitzen, als ich es allein getan hätte. Ich wollte am ersten Tag auf keinen Fall zu spät zum Unterricht kommen. Einer der Jungs, die ich gerade kennengelernt hatte, der mich höflich daran erinnerte, dass er Allen hieß, hatte in der nächsten Stunde mit mir Biologie II. Wir liefen schweigend zusammen zum Klassenzimmer. Wahrscheinlich war er genauso schüchtern wie ich.
Als wir den Raum betraten, setzte Allen sich sofort an einen der schwarz beschichteten Labortische, die genauso aussahen wie die bei mir zu Hause. Er hatte bereits einen Tischnachbarn. Tatsächlich waren alle Tische besetzt, bis auf einen. Neben dem Mittelgang erkannte ich Edith Cullen mit ihrem ungewöhnlich metallisch schimmerndem Haar, und der einzig freie Platz war neben ihr.
Mein Herz begann schneller zu schlagen.
Während ich den Gang zur Lehrerin vorlief, um mich vorzustellen und meinen Laufzettel unterschreiben zu lassen, versuchte ich sie unauffällig zu beobachten. Als ich an ihr vorbeiging, erstarrte sie plötzlich auf ihrem Stuhl. Ruckartig hob sie überraschend schnell den Kopf und stierte mich mit einem seltsamen Gesichtsausdruck an – er war mehr als wütend, er war zornig, feindselig. Bestürzt schaute ich weg und bekam schon wieder rote Flecke. Ich stolperte über ein auf dem Boden liegendes Buch und musste mich an einer Tischkante festhalten. Das Mädchen, das dort saß, kicherte.
Ich hatte Recht gehabt mit den Augen. Sie waren schwarz – rabenschwarz.
Mrs Banner unterschrieb meinen Zettel und reichte mir ein Buch, ohne sich mit irgendeinem Vorstellungsquatsch und der Erwähnung meines vollen Namens aufzuhalten. Wir würden bestimmt gut miteinander klarkommen. Es blieb ihr natürlich nichts anderes übrig, als mich zu dem einzigen freien Platz in der Mitte des Raumes zu schicken. Verlegen, verwirrt und mit gesenktem Kopf ging ich auf Edith zu und fragte mich, womit ich den feindseligen, finsteren Blick verdient haben könnte, den sie mir zugeworfen hatte.
Ich sah auch nicht auf, als ich mein Buch auf den Tisch legte und mich hinsetzte, doch aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass sie ihre Haltung änderte. Sie lehnte sich weit weg von mir, saß auf der äußersten Kante ihres Stuhls und drehte das Gesicht weg, als würde sie etwas Ekliges riechen. Ich schnupperte unauffällig. Mein Shirt roch nach Waschmittel. Wie konnte das jemand unangenehm finden? Ich rutschte mit meinem Stuhl nach rechts, um ihr möglichst viel Platz zu lassen, und versuchte, mich auf den Unterricht zu konzentrieren.
Es ging um den Aufbau von Zellen, das hatten wir schon in Phoenix durchgenommen. Ich schrieb trotzdem ordentlich mit und hob kein einziges Mal den Kopf.
Dennoch musste ich immer wieder zu dem seltsamen Mädchen neben mir hinüberspähen. Sie änderte ihre steife Haltung auf der Stuhlkante während der gesamten Stunde nicht und hielt so viel Abstand wie möglich von mir, ihr Gesicht hinter den Haaren versteckt. Ihre Hand lag zur Faust geballt auf dem linken Oberschenkel, unter der blassen Haut zeichneten sich die Sehnen ab. Auch das veränderte sich die ganze Stunde nicht. Sie trug ein weißes Shirt mit Knöpfen, das sie bis zu den Ellenbogen hochgeschoben hatte, und ihr bleicher Unterarm war erstaunlich muskulös. Mir fiel unweigerlich auf, wie makellos ihre Haut war. Keine einzige Sommersprosse, keine einzige Narbe.
Die Stunde schien sich länger hinzuziehen als jede andere an diesem Tag. Lag es daran, dass es die vorletzte war oder weil ich darauf wartete, dass sich die angespannte Faust öffnen würde? Doch sie blieb geballt und Edith saß auch weiterhin so reglos da, als würde sie nicht einmal atmen. Was war ihr Problem? Benahm sie sich immer so? Vielleicht war mein Urteil über Jeremys abfällige Kommentare heute beim Mittagessen voreilig gewesen. Vielleicht war es gar keine verletzte Eitelkeit bei ihm.
Mit mir konnte das alles jedenfalls nichts zu tun haben. Sie kannte mich doch überhaupt nicht.
Als Mrs Banner am Ende der Stunde einige Tests zurückgab, drückte sie mir einen in die Hand, den ich dem Mädchen weiterreichen sollte. Ich schaute automatisch auf die obere Ecke – hundert Prozent … Und ich hatte ihren Namen in Gedanken falsch buchstabiert. Sie schrieb sich Edythe, nicht Edith. Diese Schreibweise hatte ich noch nie gesehen, aber sie passte besser zu ihr.
Als ich ihr den Test zuschob, wagte ich einen Blick in ihre Richtung, was ich jedoch sofort bereute. Wieder funkelte sie mich wütend an, und in ihren schwarzen Mandelaugen lag tiefe Abscheu. Der Hass, den sie ausstrahlte, ließ mich zurückweichen, und der Spruch Wenn Blicke töten könnten schoss mir plötzlich durch den Kopf.
Da schrillte die Klingel, ich fuhr erschrocken zusammen und Edythe Cullen sprang von ihrem Platz auf. Sie bewegte sich wie eine Tänzerin, die makellosen Linien ihres schlanken Körpers in vollkommener Harmonie. Sie drehte mir den Rücken zu und war aus der Tür, noch bevor sonst irgendjemand aufgestanden war.
Ich saß wie angewurzelt auf meinem Stuhl und starrte ihr verblüfft hinterher. Was für ein Biest. Ich packte langsam meine Sachen zusammen und versuchte, meine Verwirrung und die Schuldgefühle zu verdrängen. Wofür sollte ich mich schuldig fühlen? Ich hatte ihr nichts getan. Wie auch? Wir hatten kein einziges Wort miteinander gewechselt.
»Du bist bestimmt Beaufort Swan, oder?«, hörte ich eine weibliche Stimme fragen.
Als ich aufblickte, stand ein hübsches, kindlich aussehendes Mädchen vor mir; ihre Haare waren sorgfältig zu einem hellblonden Vorhang geglättet und sie lächelte mich freundlich an. Sie war offenbar nicht der Meinung, dass ich schlecht roch.
»Beau«, korrigierte ich sie lächelnd.
»Ich bin McKayla.«
»Hi, McKayla.«
»Weißt du, wie du zu deinem nächsten Kurs kommst?«
»Ich muss zur Sporthalle, ich glaube, die finde ich.«
»Sport habe ich jetzt auch.« Sie schien ganz begeistert darüber zu sein, obwohl das bei einer so kleinen Schule kein großer Zufall war.
Wir gingen also gemeinsam; sie quasselte ununterbrochen und übernahm den Großteil der Unterhaltung, was die Sache für mich einfach machte. Sie hatte, bis sie zehn war, in Kalifornien gelebt und konnte deshalb nachempfinden, dass mir die Sonne fehlte. Wie sich herausstellte, waren wir auch im selben Englischkurs gewesen. So nett wie sie war noch keiner an diesem Tag zu mir gewesen.
Als wir die Sporthalle betraten, fragte sie: »Sag mal, hast du Edythe Cullen mit einem Bleistift gepikt oder was? So wie heute habe ich sie ja noch nie erlebt.«
Ich zuckte zusammen. Es war also nicht nur mir aufgefallen. Und anscheinend benahm sich Edythe Cullen normalerweise nicht so. Ich beschloss, mich dumm zu stellen.
»Meinst du das Mädchen, das in Bio neben mir saß?«
»Ja, genau«, sagte McKayla. »Sie sah aus, als hätte sie irgendwelche Schmerzen.«
»Keine Ahnung«, erwiderte ich. »Wir haben nicht miteinander geredet.«
»Sie ist seltsam.« Statt in Richtung Mädchenumkleide weiterzugehen, blieb McKayla neben mir stehen. »Wenn ich das Glück gehabt hätte, neben dir zu sitzen, dann hätte ich mit dir gesprochen.«
Ich lächelte sie an und ging in den Umkleideraum der Jungen. Sie war nett und schien mich sympathisch zu finden, aber die merkwürdige letzte Stunde konnte ich trotzdem nicht vergessen.
Coach Clapp, die Sportlehrerin, suchte mir ein Trikot heraus, bestand aber nicht darauf, dass ich mich gleich umzog und mitmachte. In Phoenix musste man Sport nur zwei Jahre belegen, hier war es die ganzen vier Jahre lang Pflicht – meine persönliche Spezialversion von Hölle.
Ich schaute den vier gleichzeitig stattfindenden Volleyballspielen zu. Wenn ich daran dachte, wie viele Verletzungen ich mir und anderen schon beim Volleyball zugefügt hatte, wurde mir ganz anders.
Schließlich war auch Sport vorbei. Ich ging langsam zum Sekretariat, um meinen Laufzettel abzugeben. Der Regen hatte nachgelassen, aber es wehte ein starker Wind und es war kälter geworden. Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke hoch und schob die freie Hand in eine Hosentasche.
Als ich das warme Sekretariat betrat, hätte ich fast wieder kehrtgemacht.
Vor mir am Tresen stand Edythe Cullen, ihre wirren bronzefarbenen Haare waren unverkennbar. Sie schien nicht zu bemerken, dass ich hereingekommen war. Ich drückte mich an die hintere Wand und wartete, bis der kahlköpfige Sekretär frei würde.
Obwohl Edythe nur mit leiser Samtstimme mit ihm diskutierte, bekam ich schnell mit, worum es ging: Sie wollte ihren Biokurs auf eine andere Stunde verlegen – egal, welche.
Es konnte nicht meinetwegen sein. Es musste etwas anderes sein, etwas, das passiert war, bevor ich den Bioraum betreten hatte. Ihr Gesichtsausdruck vorhin hatte sicher nichts mit mir zu tun. Es war unmöglich, dass jemand, der mich nicht kannte, eine derart plötzliche und starke Aversion gegen mich empfand. Für eine so heftige Reaktion war ich viel zu unbedeutend.
Wieder ging die Tür auf und ein kalter Windstoß fegte durch den Raum, er ließ die Papiere auf dem Tresen rascheln und fuhr mir durch die Haare. Ein Mädchen kam herein, ging zum Tresen, legte einen Zettel in einen Ablagekorb und verschwand wieder nach draußen. Edythe Cullen erstarrte, dann drehte sie sich langsam zu mir um und funkelte mich an. Ihr Gesicht war unglaublich schön, ohne den geringsten Makel, durch den sie wohl menschlich gewirkt hätte, doch ihr Blick war stechend und hasserfüllt. Für einen kurzen Moment durchfuhr mich ein seltsamer Schauer, ich hatte richtig Angst, die Härchen auf meinen Armen stellten sich auf. Als würde sie gleich eine Pistole ziehen und mich erschießen. Der Blick währte nur eine Sekunde, aber er war noch kälter als der eisige Wind. Danach wandte sie sich wieder dem Sekretär zu.
»Kein Problem«, sagte sie hastig und mit seidenweicher Stimme. »Ich verstehe, dass es nicht geht. Trotzdem vielen Dank für Ihre Mühe.« Sie machte auf dem Absatz kehrt und stolzierte, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, durch die Tür.
Ich stapfte wie ferngesteuert zum Tresen, mein Gesicht zur Abwechslung mal weiß statt rot, und reichte dem Sekretär meinen unterschriebenen Laufzettel.
»Hallo, Beau, wie war Ihr erster Tag?«, fragte er.
»Gut«, log ich, meine Stimme war rau. Ich hatte ihn wohl nicht überzeugt.
Mein Pick-up war eines der letzten Autos auf dem Parkplatz. Er erschien mir wie eine Zuflucht, ein Ort, der sich in dieser nassen grünen Hölle noch am ehesten wie ein Zuhause anfühlte. Eine Zeit lang saß ich einfach da und starrte mit leerem Blick durch die Windschutzscheibe. Doch bald war es so kalt, dass ich die Heizung brauchte.
Ich drehte den Zündschlüssel und der Motor röhrte los. Auf der Rückfahrt zu Charlies Haus versuchte ich an nichts zu denken.
Wie ein offenes Buch
Der nächste Tag war besser … und schlimmer.
Besser, weil es ausnahmsweise mal nicht regnete, obwohl die Wolken dicht und schwarz am Himmel hingen. Und auch einfacher, weil ich wusste, was mich erwartete. McKayla setzte sich in Englisch zu mir und begleitete mich unter den feindseligen Blicken von Schachklub-Erica zu meinem nächsten Kurs; das war doch mal nett für mein Ego. Außerdem wurde ich nicht mehr so angestarrt wie am Vortag. Beim Mittagessen saß ich mit einer großen Gruppe zusammen, darunter McKayla, Erica, Jeremy, Allen und noch ein paar andere, deren Gesichter und Namen ich mir mittlerweile merken konnte. Ich hatte das Gefühl, allmählich schwimmen zu lernen, statt nur hilflos mit den Armen herumzurudern.
Der Tag war schlimmer, weil ich müde war; bei dem Regen, der ständig aufs Haus trommelte, bekam ich einfach kein Auge zu. Er war schlimmer, weil mich Ms Varner in Mathe aufrief, obwohl ich mich nicht gemeldet hatte, und weil ich die falsche Antwort gab. Und er war schlimmer, weil ich Volleyball spielen musste und beim einzigen Mal, als ich mich nicht wegduckte, zwei anderen aus der Mannschaft einen verpatzten Ball an den Kopf schoss. Und der Tag war schlimmer, weil Edythe Cullen nicht in der Schule war.
Den ganzen Vormittag versuchte ich, nicht an die Mittagspause und ihre hasserfüllten Blicke zu denken. Ein Teil von mir wollte sie zur Rede stellen und eine Erklärung für ihre schlechte Laune verlangen. Als ich schlaflos im Bett lag, hatte ich mir sogar schon zurechtgelegt, was ich sagen würde. Doch ich wusste ganz genau, dass ich mich nicht trauen würde. Vielleicht, wenn sie nicht so umwerfend schön gewesen wäre.
Aber als ich mit Jeremy in die Cafeteria kam und mich vergeblich bemühte, nicht den ganzen Saal mit den Augen nach ihr abzusuchen, entdeckte ich ihre vier adoptierten Geschwister am gleichen Tisch wie am Vortag, und sie saß nicht bei ihnen.
McKayla fing uns ab und lotste uns zu ihrem Tisch. Jeremy schien ihre Aufmerksamkeit zu gefallen, und seine Freunde kamen nach kurzer Zeit auch zu uns herüber. Ich versuchte, den Gesprächen um mich herum zu folgen, aber ich war immer noch unruhig, weil ich darauf wartete, dass Edythe auftauchen würde. Ich hoffte, dass sie mich dann einfach ignorieren und damit beweisen würde, dass ich nur aus einer Mücke einen Elefanten machte.
Aber sie kam nicht und ich wurde immer angespannter.
Als sie am Ende der Mittagspause nach wie vor nicht aufgetaucht war, ging ich etwas zuversichtlicher in die Biologiestunde. Auf dem Weg zum Klassenzimmer wich McKayla nicht von meiner Seite, sie verhielt sich immer merkwürdiger und tat irgendwie, als sei ich ihr Eigentum. An der Tür zögerte ich kurz, aber auch hier war Edythe Cullen nicht. Erleichtert setzte ich mich auf meinen Platz. McKayla folgte mir und erzählte von einem geplanten Ausflug zum Strand. Sie blieb an meinem Tisch stehen, bis es klingelte, dann lächelte sie mich schmachtend an und setzte sich neben einen Jungen mit Zahnspange und einer Art Topffrisur.
Ich wollte nicht eingebildet sein, aber ich war ziemlich sicher, dass sie auf mich stand, und das war ein komisches Gefühl. Zu Hause hatten mich die Mädchen kaum beachtet. Ich fragte mich, ob ich McKaylas Zuneigung wirklich wollte. Sie war ja ganz hübsch, aber ihre Aufmerksamkeit war mir etwas unangenehm. Nur warum? Weil sie mich auserwählt hatte statt umgekehrt? Das war ein dummer Grund. Ziemlich machomäßig, von wegen, die Initiative müsste von mir ausgehen. Aber lange nicht so dumm wie die andere Möglichkeit, die ich in Erwägung gezogen hatte – ich hoffte inständig, dass es nichts damit zu tun hatte, dass ich Edythe Cullen gestern so lange angestarrt hatte. Doch vermutlich war es leider genau das. Und das wäre wirklich die größte Dummheit überhaupt. Wenn ich das Aussehen eines Mädchens an einem Gesicht wie dem von Edythe maß, dann war ich verloren. Das waren Hirngespinste, nicht die Realität.