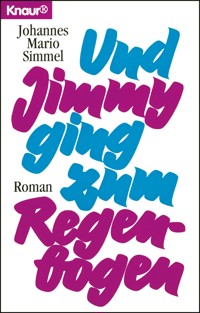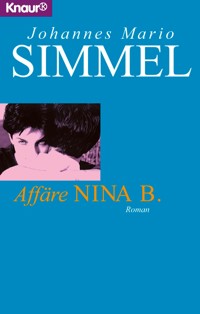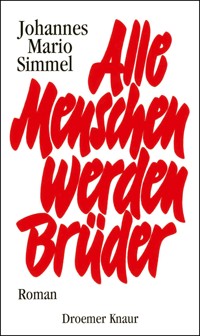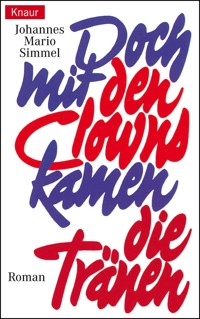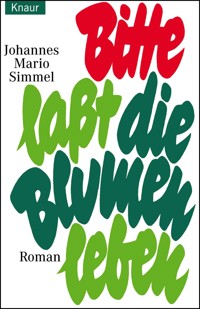
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ergreifende Geschichte über die Liebe, das Leben und die Suche nach Glück in einer Welt voller Rätsel und Geheimnisse. In Bitte lasst die Blumen leben erzählt Johannes Mario Simmel die packende Geschichte eines fast fünfzigjährigen "Aussteigers", der sich in eine junge Buchhändlerin verliebt. Es ist die ergreifende Geschichte einer großen Liebe, aber auch die eines Mannes, der zweimal leben wollte. Doch als ein rätselhafter Kriminalfall die beiden überschattet, müssen sie um ihr Glück und ihre Zukunft kämpfen. Simmel schafft es meisterhaft, die Themen Liebe, Glück, Menschlichkeit und die Suche nach dem Sinn des Lebens mit Elementen eines spannenden Kriminalromans zu verweben. Ein Buch, das den Leser von der ersten bis zur letzten Seite fesselt und noch lange nachhallt. Ein Meisterwerk der deutschen Belletristik, das die Herzen der Leser im Sturm erobern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 952
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Bitte, laßt die Blumen leben
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Bitte lasst die Blumen leben!ist die ergreifende Geschichte der großen Liebe zwischen einem fast fünfzigjährigen »Aussteiger« und einer jungen Buchhändlerin. Es ist die packende Geschichte eines Mannes, der zweimal leben wollte. Es ist die Geschichte eines rätselhaften Kriminalfalls.
Inhaltsübersicht
Zitat
Dieser Roman beruht auf [...]
Erstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Zweites Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Drittes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
Die Welt zerbricht jeden, und nachher sind viele an den gebrochenen Stellen stark. Aber die, die nicht zerbrechen wollen, die tötet sie. Sie tötet die sehr Guten und die sehr Feinen und die sehr Mutigen; ohne Unterschied. Wenn du nicht zu diesen gehörst, kannst du sicher sein, daß sie dich auch töten wird, aber sie wird keine besondere Eile haben.
Aus »In einem andern Land«
von Ernest Hemingway
Dieser Roman beruht auf einer wahren Begebenheit. Um Unschuldige zu schützen, wurden die Ereignisse – ausgenommen solche der Zeitgeschichte – leicht abgewandelt sowie Personen und Orte der Handlung verschlüsselt.
Das Geschehen trug sich 1981 und 1982 zu, in einer Zeit, in der die Menschen so viel von Krieg und Frieden redeten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Angst zu bekennen wurde Ehrensache, »Friedenshetzer« ein Ehrentitel und die politische Weltlage gefährlicher mit jedem neuen Tag.
Es war in jener Atmosphäre von Furcht, Unsicherheit und Auflehnung, daß ein totaler »Aussteiger« und eine junge Frau zueinander fanden – zur Liebe ihres Lebens.
J. M. S.
Erstes Buch
1
Du mußt sofort nach Wien kommen«, sagte Daniel.
»Was ist geschehen?« fragte ich.
»Nicht am Telefon«, sagte er. »Ich muß dich unter allen Umständen sprechen. So schnell wie möglich. Ich habe mich schon erkundigt. Es geht noch eine Maschine von Paris nach Wien heute abend. EURO-AIR. Um Viertel vor elf. Jetzt ist es halb acht. Du hast Zeit genug. Sobald du in Wien gelandet bist, komm in meine Kanzlei. Ich arbeite die Nacht durch.«
»Und wenn die Maschine ausgebucht ist?« fragte ich. »Wenn ich keinen Platz mehr kriege?«
»Dann nimm ein kleines Charterflugzeug! So eines gibt es immer. Ich sage dir, es ist unbedingt nötig, daß ich dich so schnell wie möglich spreche, unbedingt, verstehst du, Charles?«
»Ja, ich verstehe«, sagte ich und öffnete schon die Knöpfe meines Smokinghemdes. Durch die hohen, offenen Fenster des Arbeitszimmers drang süß und schwer der Duft blühender Sträucher aus dem Jardin du Ranelagh, dem Park gegenüber. Wir wohnten in einem kleinen Palais an der Allee Pilatre de Rozier im 16. Arrondissement. Mein Arbeitszimmer lag im ersten Stock. Die Sonne stand tief im Westen und tauchte alles in gleißendes, goldenes Licht. Der Tag war sehr heiß gewesen. Aus dem Park kam frische Luft.
Daniel, das war der Wiener Rechtsanwalt Dr. Daniel Mann. Nach so vielen Jahren der Zusammenarbeit vertraute ich ihm blind – wie er mir. Etwas sehr Schwerwiegendes war geschehen, wenn er so sprach. Es mußte einen gemeinsamen Klienten betreffen. Wir hatten einige sehr wichtige.
»Ich würde ja zum Flughafen fahren und dich abholen«, sagte er. »Aber ich kann hier nicht weg. Zuviel Arbeit. Und dann muß ich auf zwei Anrufe warten.«
»Schon gut«, sagte ich. »Ich komme. Mit Linie oder Charter. Ich rufe dich aus Orly noch an.«
»Danke«, sagte er. »Nimm ein Taxi zu mir in die Stadt.« Er hatte seine Kanzlei in einem alten Haus am Graben im 1. Bezirk. Ich war zweimal dort gewesen. »Das Tor wird verschlossen sein. Läute dreimal lang – kurz – lang.«
»Ja, Daniel«, sagte ich.
»Kommt dir sehr ungelegen, was?«
»Na ja, wir waren eingeladen. Beim englischen Botschafter.«
»Das tut mir leid, Charles, aber du mußt nach Wien.«
»Alles klar«, sagte ich. »Du hörst bald von mir. Ciao, Daniel.«
Ich legte den Hörer auf. Schräg fielen die Strahlen der sinkenden Sonne in den Raum. Fern brandete lärmend der Verkehr. In unserer Straße war es still. Dann rief ich den EURO-AIR-Schalter in Orly an. Sie hatten noch Platz in der Maschine, die um 22 Uhr 45 flog.
»Aber es ist ein Platz in der zweiten Klasse. Die erste ist ausgebucht, Maître«, sagte eine Mädchenstimme. Notare und Anwälte werden in Frankreich Maître genannt.
»Das macht nichts, Mademoiselle.«
»Und seien Sie bitte eine Stunde vor Abflug hier, Maître.«
»Ich bin pünktlich«, sagte ich und hängte wieder ein. Dann nahm ich mein weißes Smokingjackett, das über einem Stuhl hing, und ging in das Ankleidezimmer. Es lag am anderen Ende der Etage bei den Schlaf- und Badezimmern. Spiegel verdeckten alle Wände des fensterlosen achteckigen Raums. Hinter den Spiegeln befanden sich große Schränke und die Türen zu zwei Badezimmern sowie zum Flur. Neben dem Badezimmer meiner Frau gab es noch einen Schminkraum. Die Tür stand offen. Yvonne saß vor dem mit Lichtröhren gesäumten Spiegel. Ihr Schminktisch quoll über vor Tuben, Tiegeln, Dosen, Fläschchen und Kämmen wie die vielen Wandregale aus Glas.
Yvonne trug einen dünnen Kittel. Sie bereitete sich seit Stunden auf die Einladung vor. Zuerst war zusammen mit einer Maniküre ein Friseur dagewesen. Die beiden kamen immer ins Haus. Yvonne haßte es, zum Friseur zu gehen. Auch ein Masseur kam jeden zweiten Tag.
Meine Frau klebte gerade lange künstliche Wimpern ans rechte Augenlid, was ihre ganze Aufmerksamkeit erforderte. Sie sah und hörte mich kommen, aber sie konnte nicht sprechen. Ich sagte: »Tut mir leid, ich muß sofort nach Wien. Daniel hat angerufen. Es ist äußerst dringend.«
Fünf Sekunden Stille.
Dann hatte sie sich gefaßt. Ihre Stimme klang schrill: »Das ist doch nicht dein Ernst!«
»Doch«, sagte ich. »Tut mir leid. Ich muß nach Wien. Sofort.«
Am rechten Lid klebten jetzt die langen künstlichen Wimpern, das linke wirkte dagegen nackt. Es sah komisch aus.
»Und unsere Einladung?«
Ich zog das Smokinghemd aus und öffnete die Hose.
»Ich werde anrufen und dem Botschafter alles erklären. Du mußt allein hingehen, Yvonne.«
»Ich gehe nicht allein hin, und das weißt du!«
»Du kennst doch alle Leute, die dort sein werden.«
»Aber du wirst nicht dort sein!«
»Herrgott, ich muß nach Wien. Yvonne, bitte! Es ist sehr wichtig, sonst hätte Daniel nicht angerufen.«
»Ich gehe nicht allein. Wie sieht das aus? Alle Weiber kommen mit ihren Männern, und ich komme allein. Du glaubst doch selbst nicht, daß ich allein hingehe.«
Nein, das glaubte ich selbst nicht. Trotz aller zur Schau getragenen Souveränität war Yvonne in Gesellschaft immer unsicher geblieben. Sie liebte Parties, Galas und offizielle Einladungen zu Cocktails oder Abendessen über alles, große Gesellschaften, das war ihr Leben – aber nur an meiner Seite. Nur wenn ich bei ihr war. Nicht unbedingt in ihrer unmittelbaren Nähe. Bloß anwesend. Dann brillierte sie. Dann war sie in ihrem Element. Aber ich mußte dabei sein. Sie hatte Angst, wenn ich sie nicht begleitete, das wußte ich. Wie seltsam war das doch für eine Frau, der die Society (und sie konnte nicht versnobt genug sein), der die Öffentlichkeit, der Kameras und Blitzlichter, Klatschspalten und Berühmtheiten alles bedeuteten. So sehr sie mich mit den Jahren auch verabscheute – dafür, für ihr wirkliches Leben, brauchte sie mich noch immer und mehr denn je.
Ich stand nun in Unterhose und Socken da, wählte neue Wäsche und einen leichten, blauen Anzug. Ich wußte, was jetzt kommen würde. Bei aller Abneigung tat sie mir leid.
»Du Lump«, sagte meine Frau Yvonne.
Ich machte, daß ich in meinen blauen Anzug kam.
»Du mußt gar nicht nach Wien. Du willst nur zu irgendeiner Hure. Zu einer von deinen Huren. Hast du dir schon lange überlegt. Weil ich mich so auf heute abend gefreut habe. Mußtest du mir natürlich kaputtmachen, die Freude. Machst mir jede Freude kaputt, Lump, mieser!«
Ich antwortete nicht.
Gerade noch rechtzeitig sah ich, wie sie einen schweren Cremetiegel vom Schminktisch hob und nach mir schleuderte. Ich bückte mich blitzschnell. Das Cremegeschoß traf den großen Wandspiegel hinter mir und zertrümmerte ihn in Kopfhöhe. Hätte ich mich nicht gebückt, der Tiegel wäre gegen meine Schläfe geprallt. Yvonne warf oft Gegenstände nach mir, wenn sie sehr wütend war. Ich mußte achtgeben. Ich gab acht, obwohl ich nach all diesen Jahren dem Ende sehr nahe war. Hätte sie mich getroffen, wäre das Elend vielleicht vorbei gewesen.
»Sag etwas!« schrie sie. Die künstlichen Wimpern auf dem rechten Lid waren verrutscht, zum Teil hingen sie frei in der Luft. Yvonne weinte. Tusche, Lidschatten und Schminke flossen in das dicke Make-up auf den Wangen, die Farben mischten sich, Yvonne sah aus wie ein Clown. Ich war zehn Jahre älter als sie, aber sie wirkte nach einem gelungenen Lifting um vieles jünger. Und sie war eine Schönheit – allerdings nicht im Augenblick. Sie hatte immer noch den schlanken Körper, der mich einst so erregt hatte, die langen Beine, die festen Brüste, die weiße Haut. Ihr Haar war bläulichschwarz und glänzte wie ihre bläulichschwarzen Augen, große schräggeschnittene Augen. Ebenmäßig war das Gesicht mit den hohen Backenknochen. Gar mancher Mann drehte sich nach ihr um auf der Straße, gar mancher Mann betrachtete sie gierig, o ja. Nur ich nicht mehr, nein, nicht mehr ich.
»Den halben Tag bereite ich mich vor auf diesen Abend – und dann kommst du und sagst, du mußt nach Wien! Absichtlich, absichtlich tust du das!« Jetzt weinte sie heftig. Die Farben auf ihrem Gesicht vermischten sich immer mehr. Sie sah tragisch und lächerlich aus.
Ich öffnete eine andere Spiegeltür, nahm einen Koffer heraus und suchte ein paar Sachen zusammen, die ich nach Wien mitnehmen wollte.
»Hast die Sprache verloren?« schrie Yvonne. »Kannst nicht mehr reden mit mir, wie?« Ihr Kittel rutschte von den Schultern. Nackt, nur mit einem kleinen lachsfarbenen Höschen und hochhackigen Pantoffeln bekleidet, stand sie im Ankleideraum. Keuchend ging ihr Atem. Die Brüste hoben und senkten sich hastig.
»Antworte mir!«
»Was soll ich antworten?«
»Daß du es absichtlich getan hast! Wieder einmal! Um mich zu quälen. Um mich zum Weinen zu bringen.«
Ich antwortete nicht. Ich legte Hemden in den Koffer, Socken, Unterwäsche, einen Anzug. Wie gut kannte ich das alles, wie lange schon. Sollte sie doch weinen, schreien, mich verfluchen. Sollte sie doch.
Außer sich ging sie zu ihrem Schminktisch.
»Du … du …! Wie ich dich hasse! Wie ich dich hasse! Nun hast du es wieder einmal erreicht! Aber Gott ist gerecht! Gott ist gerecht! Er läßt so etwas nicht zu! Nicht immer weiter!« Sie knickte auf einem Pantoffel um, schleuderte ihn vom Fuß und schrie: »Das alles wird sich an dir rächen! Rächen, ja! Verreck doch schon, du Hund! Verreck! Verreck! Und bald! Es wird mich freuen, wenn du bald verreckst!« Sie schleuderte auch den zweiten Pantoffel fort und rannte aus dem Schminkraum durch das Bad ins Schlafzimmer. Die Tür fiel hinter ihr zu.
Ich bin meiner Frau Yvonne nie wieder begegnet.
2
Soll ich Sie zum Flughafen fahren, Maître?« fragte Emile.
Wir standen auf dem Kiesweg des Gartens vor unserem weißen Palais. Mein Wagen parkte da. Emile Rachet, der Concierge, hatte den Koffer heruntergetragen. Der Hausmeister war ein fleißiger und geschickter Mann, der einfach alles konnte. Er war Elektriker, Klempner, Maler, Maurer und Gärtner. Die Arbeit, die er nicht schaffte, gab es nicht. Seit achtzehn Jahren lebte er in der Mansardenwohnung über dem Garagenhaus hinten im Garten – seit ich in der Allee Pilatre de Rozier lebte.
»Nein«, sagte ich müde, denn der Streit mit meiner Frau war mir nähergegangen, als ich wahrhaben wollte. »Ich habe doch ein Taxi gerufen, Emile. Vielen Dank.«
Ich hatte mich auch telefonisch beim britischen Botschafter entschuldigt: Ich müsse dringend nach Wien, Yvonne fühle sich nicht wohl, die Hitze. Er war von besonderer Liebenswürdigkeit gewesen und hatte meiner Frau schnelle Besserung und mir einen guten Flug gewünscht.
»Dauert immer eine Weile um die Zeit, bis ein Taxi hierher durchkommt«, sagte Emile. Er war so groß wie ich und etwa gleich alt. Zum weißen Hemd, einer weißen Hose und einer blauen Schürze trug er einen breitkrempigen Strohhut.
»Ja, viel Abendverkehr«, sagte ich und sah hinüber zu dem Park mit seinen vielen Sträuchern und Blumen. Rot, blau, gelb und lila leuchteten sie auf im Licht der untergehenden Sonne. Das grüne Laub der Bäume glänzte. Es war noch immer sehr warm.
Emile sah mich an. »Es tut mir so leid.«
»Was?«
»Ach, Monsieur.« Er seufzte. »Madame hat eine laute Stimme. Die Köchin hat sie gehört. Und das Mädchen und der Diener auch. Sie haben es mir erzählt.«
»Schon gut«, sagte ich. »Schon gut, Emile.«
»Nichts ist gut«, sagte er leise.
Ein einfacher Mensch war Emile Rachet. Er liebte den großen Garten und seine kleine Freiheit, so zu arbeiten, wie er es für richtig hielt – eine Freiheit, die ich ihm gern einräumte. Wenn Yvonne ihn anschrie, war seine Antwort stets: »Ich bin ein Angestellter Ihres Mannes, Madame, ich bin nicht Ihr Angestellter.« Sie ließ ihn deshalb auch meistens in Ruhe.
Von mir hatte er die Erlaubnis bekommen, ein kleines Stück Land in einer entlegenen Ecke des Gartens zu bebauen. Emile, der den Rasen, die Hecken, die Bäume und Blumen pflegte, pflanzte auf seinem Flecken Land Bohnen, Tomaten, Salate und anderes Gemüse für unsere Küche und seinen eigenen Bedarf. Von allem, was er liebte, liebte er dieses Stückchen Erde am meisten. Er war ledig und hatte etwas von einem Sonderling an sich, von einem liebenswerten Sonderling.
Emile schien zu leiden, weil ich so blaß und schweigsam war, und angestrengt nachzudenken, wie er mich fröhlicher machen konnte. Nun räusperte er sich aufgeregt. Offensichtlich war ihm eine Idee gekommen.
»Wie lange bleiben Sie in Wien, Monsieur?«
»Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich morgen abend wieder da. Warum?« Ich mußte an einen Satz denken, den der Philosoph Ernst Bloch geschrieben hat: ›Wenigstens einen kleinen Ausblick auf etwas Beruhigendes, Erfreuliches braucht der Mensch.‹ Das muß er einfach haben, sonst kann er nicht leben.
»Ich habe schon herrliche Tomaten und ganz besonders schönen Salat, Monsieur«, verkündete Emile. »Auch Radieschen und Gurken. Wenn Monsieur zurückkommt, gibt es Salat Nicoise. In Ordnung?«
»Fein«, sagte ich. Ausblick durch eine ›mindestens halb geöffnete Tür‹, schrieb Bloch, aber um mich waren alle Türen geschlossen seit langer, langer Zeit.
»Ich rede mit der Köchin. Sie hat, was man noch dazu braucht«, sagte Emile. »Thunfisch, Eier, Sardellen, Oliven.« Er lachte in der Hoffnung, mir eine Freude bereiten zu können. »Monsieur bekommt einen feinen, schönen Salat Nicoise!«
Ich tat ihm den Gefallen und lachte auch.
»Vergeßt den Knoblauch nicht!« sagte ich. An Blochs ›Prinzip Hoffnung‹ kam niemand vorbei. Und ich hatte keine, hatte keine Hoffnung mehr. Schon lange nicht mehr.
Emile lachte wieder, er schien jetzt glücklich.
»Knoblauch, ja«, sagte Emile. »Und Senf und frische Kräuter.«
»Und die Eier in Viertel geschnitten«, sagte ich. ›Hoffnungslosigkeit‹, schrieb Bloch, ›ist das Unhaltbarste, das ganz und gar den menschlichen Bedürfnissen Unerträgliche.‹
»Wie immer in Viertel«, sagte Emile lachend. Dann erschrak er. »Sie weinen, Monsieur!«
»Unsinn«, sagte ich. »Mir ist nur eine Mücke ins Auge gekommen.« Ich wischte beide Augen mit einem Taschentuch trocken. »Verflucht nochmal, diese Scheißmücken.«
»Diese Mücken, ja«, sagte Emile verloren.
Vor dem Parktor hielt ein Taxi, der Fahrer stieg aus. Emile nahm den Koffer und trug ihn zum Wagen. Ich gab ihm die Hand. Er schüttelte sie fest, während er seinen Strohhut abnahm.
»Sie sind sehr unglücklich, Monsieur«, sagte Emile, als ich in den heißen Fond stieg, leise.
»Hören Sie auf!« sagte ich. »Viele Radieschen in den Salat, fein geschnitten.«
»Fein geschnitten. Ach, Monsieur«, sagte er gramvoll und schloß den Schlag.
Hoffnungslosigkeit war das Unhaltbarste, das ganz und gar den menschlichen Bedürfnissen Unerträgliche …
Der Fahrer kroch hinter das Steuer. »Wohin, ’sieur?«
»Orly«, sagte ich. »Flughafen.«
Er fuhr an. Ich wurde in den Sitz zurückgedrückt und blickte mich um. Emile stand auf der Straße, den Strohhut an die Brust gepreßt. Der Duft der blühenden Sträucher und Blumen drang in den Wagen, schwer und süß.
Ich habe Emile nie wiedergesehen.
3
Also brachte die blonde Stewardeß den Whisky, den ich bestellt hatte, und ich nahm das Glas und sagte: »Danke, Monique.« Ich flog oft in EURO-AIR-Maschinen und kannte die Vornamen vieler Stewardessen. Mit einigen hatte ich etwas gehabt, mit der hübschen Monique zum Beispiel, die nicht ahnte, daß sie in einer knappen Stunde sterben mußte.
»Gern geschehen, Maître«, sagte Monique und lächelte mir zu. Damals, in jener Nacht, hieß ich noch Charles Duhamel. Herzkrank, Angina pectoris, unter Langzeitbehandlung mit Nitropräparaten. Vor dem Abflug hatte ich zur Sicherheit die Kapsel eines schnell wirkenden Nitromittels geschluckt, denn ich wollte keinesfalls in zehntausend Metern Höhe einen Anfall bekommen. Vor jedem Start nahm ich solch eine Kapsel. Noch nie hatte ich beim Fliegen einen Anfall bekommen.
Ich bin ein häßlicher Mensch.
Meine Nase ist viel zu groß und zudem schief, der Mund zu fleischig, das Kinn tritt zurück, die Stirn ist zu hoch. Ich bin sehr groß und stand, ging und saß darum stets leicht gebückt, so daß leicht der Eindruck entstehen konnte, ich hätte einen Buckel. Gleich Shakespeares König Richard III. war ich ›zu Possenspielen nicht gemacht, noch um zu buhlen vor verliebten Spiegeln‹. Ich wußte, wie ich aussah – häßlich eben, wie verwachsen, mit einem kurzgestutzten Vollbart und langem, nach hinten gekämmtem braunem Haar, das meine Ohren, die leicht abstanden, verdecken sollte. ›Entstellt‹ kam ich mir vor wie König Richard, ›verwahrlost, vor der Zeit gesandt in diese Welt des Atmens‹. Tatsächlich war ich eine Frühgeburt, ein Siebenmonatskind, und dennoch so hochaufgeschossen.
Allerdings hatte ich niemals die geringste Schwierigkeit gehabt, Frauen zu bekommen, die ich gerade haben wollte. Ich war ein Mann, auf den sie alle, alle flogen. Sie mußten etwas spüren, die Frauen. Mit Monique war es einmal in einer Kabine der Herrentoilette des Flughafens Orly geschehen. Ich hatte zuvor am EURO-AIR-Schalter nur leise zu ihr gesagt: »Ich will dich haben.« Das hatte genügt. Hinterher war zuerst sie, dann ich aus der Kabine getreten. Wir hatten bis dahin kein Wort miteinander gesprochen. Wenn Monique mich seither sah, schien sie erfreut und blieb vollkommen natürlich.
Ähnliches geschah häufig. Diese Art, eine Frau zu nehmen, regte mich sehr auf. Sie regte auch die Frauen sehr auf. Unglaublich, aber wahr: Niemals hatte ich eine Ohrfeige bekommen, nur zweimal war die Frau stumm fortgegangen. Aber all die anderen … Ich hatte es getan mit ihnen nachts in den Korridoren von Eisenbahnwaggons, während der Zug durch die Dunkelheit donnerte, in Hausfluren, in Autos, in Wäschekammern und Badezimmern fremder Wohnungen, wo ich zu Gast geladen war, im Kino, auf dem Vorderdeck einer Jacht, einmal sogar in einem mit Menschen vollgestopften Wagen der Metro. Besonders erregte es mich – und die Frauen –, wenn jemand kommen konnte, und entdecken, was wir taten. Ich gestehe, daß mir diese Abenteuer seit Jahren die angenehmsten waren.
Während ich die letzten Zeilen noch einmal lese, erschrecke ich, denn es ist die reine Wahrheit, die ich da niedergeschrieben habe. So stand es damals um mich. Das war alles, was ich an Beziehungen zu Frauen, was ich an Liebe hatte. Und dabei fühlte ich mich noch wohl. Nein, das stimmt nicht. Ich fühlte mich nicht wohl dabei. Ich fühlte mich nie wohl. Oft dachte ich an Selbstmord. Aber dazu war ich zu feige.
4
Du hast gewiß schon von dem Mann gehört, mein Herz, der nur schnell mal um die Ecke ging, weil er Zigaretten kaufen wollte. Er ging – und kam niemals wieder.
Solche Männer – und Frauen – gibt es in Amerika jährlich zu Zehntausenden, und auch in Europa sind es viele Tausende. Diese Menschen steigen aus. Sie haben ihr altes Leben satt. Sie sehnen sich nach einem neuen, das sie augenblicklich beginnen können, in der nächsten Minute, sobald sie um die Ecke sind. Es gibt Statistiken über diese Aussteiger. Einer Auskunft des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden zufolge verschwanden in der Bundesrepublik 1980 genau 3509 Männer und 1735 Frauen. Das sind 14 Menschen pro Tag. 51 Prozent wurden innerhalb von drei Tagen wiederentdeckt. Die restlichen jedoch – immerhin 2570 Männer und Frauen – tauchten nie wieder auf, und so muß man annehmen, daß es ihnen wirklich gelungen ist, ein neues Leben zu beginnen.
Für mich war dieses Aussteigen aus meiner herkömmlichen Existenz zur fixen Idee geworden. Ich konnte nicht anders, ich mußte ständig an sie denken, an die Um-die-Ecke-Geher, an die Zigarettenholer. Auch in jener schönen Sommernacht, auf dem Flug von Paris nach Wien in einer Boeing 727 der EURO-AIR, dachte ich an sie, das Whiskyglas in der Hand, hinter dem Fenster zu meiner Linken einen Himmel voller Sterne. Mein Leben war mir ebenso unerträglich geworden wie mein Beruf.
Mein Beruf!
Welch hohe Ideale hatte ich in meiner Jugend! Wie anständig, wie klug, wie gebildet träumte ich da zu sein als Anwalt des Rechts und aller um ihr Recht Kämpfenden. Mit meiner ganzen Intelligenz, mit meiner ganzen Kraft wollte ich der Gerechtigkeit dienen. Ich erinnerte mich noch gut an diesen Traum eines jungen Mannes, leider, denn eben das machte alles so unerträglich.
Was war geschehen?
In Armut, unvorstellbarer Armut hatte ich studiert, hatte in Hotelküchen Geschirr, hatte verdreckte Monteuranzüge, hatte sogar Leichen gewaschen, war Taxi gefahren, auf den Bau gegangen, hatte in den gigantischen ›Hallen‹, dem Bauch von Paris, geschuftet nach Mitternacht. In einem winzigen Zimmer hatte ich gelebt, niemals genug zu essen gehabt.
Ganz erfüllt von meinen Idealen, war ich dann endlich als Verteidiger vor Gericht gestanden. Gute Leute, kleine Leute hatte ich verteidigt. Leute, die zu Unrecht angeklagt waren. Ergebnis? Elend war meine Kanzlei, elend war es mir selbst gegangen. Und dann, mehr durch einen Zufall, ein Versehen, einen Irrtum fast, hatte ein ganz großer Lump, ein Betrüger, der Schuld am Zusammenbruch vieler Existenzen trug, meine Rechtshilfe in Anspruch genommen.
Ja, und?
Freibekommen hatte ich den Kerl. Es war die Sensation von Paris. Von einem Tag zum andern hatte ich einen vollkommen neuen Mandantenkreis. Und war glücklich darüber, sehr glücklich.
Und aus diesem Grund hatte ich von da an mit meiner ganzen Kraft, meiner ganzen Intelligenz dem Geld, dem Ruhm nachgejagt, skrupellos, in meinen Sensationsprozessen vor keinem Bluff, vor keinem Trick, keinem gerissenen Manöver zurückschreckend, wenn es da – und wieder König Richard – ›um Meineid, Meineid in allerhöchstem Grad, um Mord, um grausen Mord in fürchterlichstem Grad, jedwede Sünd’ in jedem Grad geübt‹ gegangen war. In mir fanden sie ihren großen Beschützer, all die Übeltäter, auch die ärgsten. Glücklich pries sich jeglicher Mörder, wenn ich ihn vertrat. Ja, so wurde man Staranwalt, bewundert und verachtet, ganz egal, begehrt! Man verdiente ein Vermögen, hatte ein kleines Palais im vornehmsten Bezirk von Paris, einen Rolls-Royce, ein Chalet auf dem Land, ein Boot unten im Süden, hatte Bekannte zu Dutzenden: reiche, schöne, berühmte.
Hatte man Freunde?
Nein.
Man hatte einmal viele gehabt und gute, aber das war lange her. Eifersüchtig war meine Frau Yvonne gewesen auf meine Freunde, und gefürchtet hatte sie alle, zu Recht und mit richtigem Instinkt. Denn meine Freunde fragten mich damals vor vielen Jahren, wie um des Himmels willen ich denn dazu gekommen sei, eine solche Frau zu heiraten: schön, böse, dumm. Und meine Freunde erboten sich dann später auch, mir behilflich zu sein bei dem Versuch, Yvonne zu verlassen. Das ging aber nicht. Das konnte ich nicht. Und während die Zeit verstrich, ekelte meine Frau die Freunde aus dem Haus, und ich schwieg dazu aus Angst vor ihren Szenen – antike Tragödien waren das. Und ich war voller Angst und Feigheit, Feigheit, Angst.
Einen einzigen gab es, der trotzte Yvonnes Beleidigungen, all ihren Gemeinheiten: Studienkollege, Patentanwalt und damit Berufskollege, der gute Jean Balmoral. Auf der Universität hatten wir einander kennengelernt, danach waren wir zusammen am Institut d’études judiciaires gewesen, ein ganzes Jahr lang. Damals bereits hing er an mir, verließ mich nie, war mir ergeben. Nun ja, er konnte auch ergeben sein und dankbar, hatte ich ihm doch fast seine ganze Doktorarbeit geschrieben. Der gute Jean Balmoral. Mein so inniger Freund. Mein einziger.
Und ich? Warum verließ ich sie nicht, meine schöne, böse, dumme Frau?
Ich sagte schon: Das ging nicht. Das konnte ich nicht. Als ich Yvonne vor nunmehr einundzwanzig Jahren zur Frau nahm, da war ich unbekannt und arm, ihr Vater aber reich, und sie brachte Geld, viel Geld mit in die Ehe. Also Gütergemeinschaft. Gütergemeinschaft nach dem vor der Heirat geschlossenen Ehekontrakt.
Wenn ich mich von Yvonne scheiden lassen wollte, hätte mir das finanziell den Ruin gebracht. Natürlich stimmte das nicht. Aber ich redete es mir ein, denn ich liebte den Wohlstand. Und feige war ich, sehr feige.
Gewiß, alle Männer sind feige, wenn es um Aussprache, Trennung, Scheidung geht. Wie anders sind da stets Frauen, was wagen sie! Alles. Was wagen Männer? Nichts.
Du wirst fragen, mein Herz, warum ich eine solche Frau heiratete?
Nun, ich war verliebt, nicht wahr. Ich bemerkte nicht, daß sie böse war und dumm, ich sah nur, daß sie schön war, so schön. Und jung waren wir, ich achtundzwanzig, sie erst achtzehn Jahre alt. Meine Freunde bemerkten es wohl. Hörte ich auf einen einzigen von allen, die mich warnten? Auf keinen hörte ich. Völlig vergeblich blieb jedwede Warnung. Denn da war noch etwas: Wir hatten uns – so heißt das wohl – unter der Haut. Wild aufeinander waren wir wie Tiere – sieben Jahre lang. Dann war dieser Rausch zu Ende. Dann bemerkte ich, daß Yvonne dumm war, dumm und böse. Nun war es zu spät. Denn da hatte meine Karriere längst begonnen, und ich war längst bekannt.
Ich trank einen großen Schluck Whisky und sah mir in der spiegelnden Fensterscheibe dabei zu. Einen Geliebten hatte meine Frau. Paul Perrier hieß der junge, schöne Mann mit der Pfirsichhaut und den langen seidigen Wimpern über den dunklen Augen. Ganz offiziell war er Yvonnes Geliebter. In Paris kannst Du so etwas machen, mein Herz, und ich war ja auch mehr als fleißig mit meinen Damen. Um das Leben überhaupt noch aushalten zu können, redete ich mir ein, daß ich ein Karma zu tragen hätte. Die Lehre vom Karma, diesem wichtigen religiösen Begriff im Hinduismus und Buddhismus, besagt, daß das Schicksal eines jeden Menschen nach dem Tode davon abhängt, wie er gelebt hat. Seinen Taten gemäß wird der Tote im Himmel, in der Hölle oder auf der Erde in Gestalt eines Menschen, eines Tiers oder einer Pflanze wiedergeboren. Das Karma ist sozusagen die Vergeltung für gute oder böse Taten. Ich mußte demnach in einem früheren Leben etwas sehr Böses getan haben, und das Karma, die Vergeltung dafür, war Yvonne. Sie blieb meine Lebensschuld, von der ich niemals frei sein würde.
Wer von uns allen hat noch nie gedacht: Jetzt gehe ich um die Ecke Zigaretten holen, jetzt steige ich aus aus all dem Dreck, aus all der Lüge, Feigheit und Gemeinheit und fange ein neues, ein ganz anderes Leben an? Wer hat dergleichen noch nie gedacht? Ach, es war das Spiel, das alle spielten in Gedanken, nur sprach keiner davon. Ich leerte mein Glas und überlegte: Wie lange habe ich mit neunundvierzig noch zu leben? Ein Jahr? Zehn Jahre? Zwanzig? Oder nur eine Minute? Wenn ich, so dachte ich, jetzt und hier sterben würde – was wäre dann wohl über mein Leben zu sagen? Nur dies: Ganz ohne Wert war es, ganz ohne Sinn.
5
Noch einen Whisky, Monique, bitte.«
»Sofort, Maître.« Sie eilte davon.
Diesmal saß ich also in der zweiten Klasse, obwohl ich sonst stets erster flog. Die Maschine war aus London gekommen und in Paris nur zwischengelandet. Die erste Klasse war voll besetzt mit den Mitgliedern einer israelischen Regierungskommission. Londoner Beratungen über das Palästinenserproblem sollten in Wien mit Bundeskanzler Kreisky fortgesetzt werden. Er hatte sich erbötig gemacht, als Verbindungsmann zu Yassir Arafat zu fungieren. Monique hatte es mir erzählt, nach dem Start. Zuvor hatte ich noch mit Daniel Mann in Wien telefoniert.
»Alles okay, mein Alter. Ich fliege mit der EURO-AIR. Wir werden um null Uhr fünfunddreißig in Wien landen.«
»Großartig, dann bist du gegen halb zwei Uhr bei mir.«
»Ja«, hatte ich gesagt. »Also dann bis halb zwei, Daniel.«
Eng war es in der zweiten Klasse. Meine langen Beine, die ich nicht ausstrecken konnte, schmerzten. Der Mann neben mir hatte mich schon lange Zeit beobachtet. Jetzt faßte er sich ein Herz.
»Excusez-moi, Monsieur, leider je parle français très mal …«
»Sprechen Sie Deutsch?« sagte ich.
»Sie verstehen auch Deutsch?«
»Ja.«
»Phantastisch …« Er schnüffelte ergriffen. Sehr erkältet war er.
»Sie sind doch der berühmte Anwalt Duhamel, nicht wahr?«
»Na, berühmt …«
»Doch, doch. Ich habe Ihr Gesicht gesehen – in deutschen Zeitungen, vor drei Wochen, als Sie diesen Mann freibekamen … Kro … Kur …«
»Krupinski.«
»Krupinski, ja! Phantastisch!« Er strahlte mich an wie ein Kind den Weihnachtsbaum. »Wenn Sie seinen Fall nicht übernommen hätten, wäre er zur Höchststrafe verurteilt worden, wie?«
»Es ist sehr wahrscheinlich.«
»Die Guillotine, nicht wahr?« Er nieste.
»Nein, das nicht. Jetzt, mit Mitterrand und den Sozialisten am Ruder, wird man die Todesstrafe abschaffen, Herr …«
»Bosnick, Herr Doktor. Harald Bosnick. Mit ck. Hoch- und Tiefbau.«
»Sehr angenehm.«
»Also, dann nicht Guillotine, aber zweimal lebenslänglich, was?« fragte Herr Bosnick mit ck und benützte heftig schniefend ein Taschentuch. »Lebenslang unschuldig hinter Gittern – furchtbar, auch nur daran zu denken!«
»Ja«, sagte ich, »nicht wahr?«
Oh, war mir elend. Wie hatte ich von alledem genug. Stanislav Krupinski, Metallarbeiter. Natürlich war er schuldig, dieses stumpfe Tier von einem Menschen. Hatte die beiden alten Leutchen bestialisch abgeschlachtet mit dem Beil. Fünfzig Franc waren seine Beute gewesen. Ja, aber es kam zu einem reinen Indizienprozeß. Nicht ein einziger Zeuge. Und ich hatte ein Indiz nach dem anderen zerlegt, wertlos gemacht. Beklagenswerter Staatsanwalt: meinen grandiosen Posen, meiner geschickten psychologischen Behandlung der Geschworenen war er nicht gewachsen gewesen. Zwei von ihnen weinten, als der Richter den Freispruch verkündete – »wegen erwiesener Unschuld«.
Nicht wegen Mangels an Beweisen, nein wegen erwiesener Unschuld. Das sollte mir erst einer nachmachen. Früher, lang war’s her, empfand ich in solchen Augenblicken Gefühle des Glücks, der Freude, des Triumphs. Lang war’s vorbei. Nicht einmal Genugtuung hatte ich empfunden. Routine, reine Routine, sonst nichts.
»Würden Sie … könnten Sie … dürfte ich Sie wohl um ein Autogramm bitten, Herr Doktor?« Er hielt mir einen Block und einen goldenen Kugelschreiber hin. Ich schrieb meinen Namen quer über die aufgeschlagene Seite. Es war das letzte Mal für sehr lange Zeit, daß ich meinen Namen schrieb.
Herr Bosnick schnaubte donnernd in das Taschentuch.
»Danke! Wenn ich das meiner Frau erzähle … Phantastisch!«
»Ihr Whisky, Maître.«
»Danke, Monique.« Ich sah sie an. Sie schloß kurz die Augen, und das hieß: Wenn du willst, ich bin bereit. Ich nahm mir vor, im Wiener Flughafen die erstbeste Gelegenheit wahrzunehmen. Vielleicht vertrieb das vorübergehend meine Trübsal.
Ich trank einen großen Schluck, dann konnte ich mich nicht länger dem hingerissenen Herrn Bosnick entziehen.
»Sie sprechen phantastisch Deutsch, Herr Doktor. Also wirklich, ohne jeden Akzent.«
»Meine Eltern stammen aus dem Elsaß. Ich wurde in Straßburg geboren und verbrachte dort meine Jugend.«
»Ich verstehe«, sagte er.
Er verstand natürlich nichts. Er konnte nichts verstehen. Er wußte nichts von mir. Mein Vater starb, als ich drei Jahre alt war. Ich habe keine Erinnerung an ihn. Meine Mutter war eine sehr schöne Frau. Das Haus, in dem wir lebten, gehörte ihr. Sie führte darin eine Papierwarenhandlung. Der Krieg kam, das Jahr 1940, die deutsche Besatzung. Ich war acht Jahre alt. Die Nazis hatten ihre schlimmsten Fanatiker nach Elsaß-Lothringen geschickt, um dieses Land, das im Lauf der Geschichte immer wieder die Nationalität wechselte, so gründlich wie möglich zu »germanisieren«. Ein Land unter Terror also. Ein Land in Angst. Es mußte Deutsch gesprochen werden. Alle französischen Vornamen wurden eingedeutscht. Ich hieß nun Karl. In der Schule mußten wir jeden Morgen für Adolf Hitler beten.
Ein Deutscher wurde bei uns einquartiert. Mutter war zuerst starr vor Schreck. Jeder wußte, was für Deutsche nach Elsaß-Lothringen kamen. Aber der Deutsche, der nun bei uns wohnte, war ein guter Mensch. Es war gefährlich für ihn, gut zu sein. Mutter ertappte ihn einmal, als er Radio London hörte. Dieser Deutsche – ich nannte ihn nur bei seinem Vornamen: Heinz – hatte zunächst große Angst, Mutter könne ihn verraten. Aus der Angst wurde Vertrauen, aus Vertrauen Liebe. Die verbotene Liebe zwischen einer Französin und einem Deutschen.
Ich hatte plötzlich wieder einen Vater. Ja, Heinz war wie ein richtiger Vater zu mir. Auch wir liebten einander. Ich bewunderte ihn über alle Maßen. Er war so gescheit. Er hatte so viel Humor. Und er schenkte mir ein wunderbares Buch: die Märchen der Gebrüder Grimm, voll herrlich bunter Abbildungen. Mit heißem Kopf las ich darin. Schon bald hatte ich ein Lieblingsmärchen. Ich kann es noch heute, nach so vielen Jahren, fast auswendig …
›In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien …‹
So begann das Märchen »Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich«.
Heinz schenkte mir noch viele andere Bücher. Er war es, der meine Liebe zu Büchern weckte, der einen Büchernarren aus mir machte. Er war es auch, der dafür sorgte, daß ich ohne jeden Akzent Deutsch sprach. Durch ihn lernte ich: In Deutschland gab es gute und schlechte Menschen – wie in jedem anderen Land der Welt auch.
Sobald der Krieg zu Ende sei, sagten Mutter und Heinz, wollten sie heiraten und nach Bremen übersiedeln. Da stammte Heinz her. Ich freute mich schon sehr auf dieses geheimnisvolle Land Deutschland. Aber 1943 verließ uns Heinz, er kam an die Ostfront. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Ein Jahr später wurde unser Haus bei einem amerikanischen Luftangriff zerstört und meine Mutter getötet. Mich steckten sie in ein Heim.
»Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. Wir überfliegen soeben den Rhein …«
6
Damit Du, mein Herz, Dir auch wirklich eine Vorstellung davon machen kannst, wie weit es schon mit mir gekommen war, muß ich noch von meiner monströsen Müdigkeit erzählen. In den ersten Jahren unserer Ehe kam ich fast überhaupt nicht zum Schlafen. Yvonne und ich lagen im gleichen Bett und hatten die Nacht durch miteinander zu tun. Sehr oft ging das bis zum Morgengrauen. Damals schienen mir drei, vier Stunden Schlaf mehr als genug zu sein, ich war danach durchaus in der Lage, jede geistige Belastung spielend zu bewältigen. Es folgte eine lange Periode, in der ich abends wegen der Ereignisse und Erlebnisse in Kanzlei und Gerichtsaal so überdreht heimkam, daß ich nur mit schwersten Mitteln – und auch dann schlecht – schlafen konnte. Im dritten Abschnitt befand ich mich, als ich nach Wien flog, seit einem Jahr.
Ich schlief und schlief und schlief. Sonn- und feiertags kam ich überhaupt nicht aus dem Bett. Da schlief ich ohne jedes Mittel vierzehn, sechzehn, achtzehn Stunden durch: tief, fest und mit schönen Träumen. Ich hatte seit langem ein eigenes Schlafzimmer. Yvonne, die meinem Beruf Desinteresse und tiefe Verachtung entgegenbrachte, wurde erst nervös, als ich die letzte Phase dieses Stadiums erreichte – Schlafsucht. Ich glaube, hier das rechte Wort gefunden zu haben. Ich war süchtig nach Schlaf wie der Alkoholiker nach der Flasche, der Morphinist nach der Spritze. Ich war stets ein Nachtmensch gewesen. Nun legte ich mich schon um neun Uhr zu Bett, wenn es sich irgendwie machen ließ. Die wichtigsten Akten für den nächsten Tag waren dann nur schlampig gelesen, und ich hatte mich nur ungenügend für das Gericht vorbereitet. Ich schlief sofort ein und – das war das Unangenehme – fand am Morgen nicht aus den Federn. Ich wußte, daß ich aufstehen mußte, ich wußte, daß ich Termine und Verabredungen hatte, allein ich blieb im Bett und schlief – manchmal bis in den hohen Mittag hinein. Damals ließ ich wichtige Verhandlungen bei Gericht platzen, und ich zog mir den Zorn der sonst wohlgesinnten Richter zu. So ging das nicht weiter. Ich beauftragte schließlich einen jungen Mann, der bei mir seine Assessorenzeit absolvierte, an jedem Arbeitstag um sieben Uhr früh zu erscheinen, um mich, und wenn es dazu Prügel brauchte, aus dem Bett zu holen. Unser Personal war bis auf den Concierge von Yvonne ausgesucht und mir deshalb viel zu suspekt.
Also erschien an jedem Arbeitstag der junge Assessor – er hatte von mir Hausschlüssel erhalten – in meinem Schlafzimmer, und es bedurfte aller Überredungskünste und danach oft all seiner physischen Kraft, mich aus dem Bett zu zerren und dafür zu sorgen, daß ich nicht in die Kissen zurück flüchtete. Mit bleiernen Gliedern und einem Brummschädel, als hätte ich die Nacht durchgelumpt, ging ich dann ins Badezimmer, duschte eiskalt, bis ich halbwegs bei mir war, trank Unmengen starken schwarzen Kaffee und brachte mich so in eine Verfassung, in der ich klar denken und arbeiten konnte. Ich tat, was ich nie getan hatte: Ich schlief nachmittags im Büro – und mußte von dem gleichen jungen Mann, dem das alles entsetzlich peinlich war, wiederum mit Gewalt vom Sofa geholt und an den Schreibtisch geschleppt werden, weil bereits Klienten warteten. In meinen wachen Stunden indessen, wenn ich Plädoyers hielt, wenn ich schwierige Schriftsätze verfaßte, hatte ich nur eine Sehnsucht: zu schlafen. Zu schlafen und nie mehr aufzuwachen. Ich magerte stark ab in jener Zeit und sah elend aus. Ich ging zu einem bekannten Arzt. Der untersuchte mich, warf einen Blick auf meine ständig leicht zitternden Hände und sagte: »Körperlich sind Sie völlig gesund. Psychisch … hm.«
»Was heißt ›hm‹?«
»Psychisch sieht es bei Ihnen so aus: Sie schlafen endlos, weil Sie sich mit allen Kräften gegen das Wachsein und das ordentliche, pünktliche Arbeiten wehren. Sie arbeiten ja nicht für sich allein. Sie arbeiten auch für Ihre Frau. Sie hat einen Freund, nicht wahr?«
»Ja«, sagte ich.
»Nun, dann arbeiten Sie auch für ihn. Für Ihre Frau und ihn. Eben das aber wollen Sie nicht mehr tun. Man nennt das eine Flucht ins Bett. Der Zustand wird sich verschlimmern. Sie werden von den verschiedensten harmlosen Krankheiten heimgesucht werden, die Sie zumindest ans Bett fesseln … Dann werden Sie in die Krankheit flüchten. Die psychosomatischen Beschwerden, die Sie empfinden, können oder werden sich bald zu richtigen schweren Krankheiten auswachsen. Wenn es so weit kommt, wird Ihnen kein Arzt und auch der beste Psychiater nicht mehr helfen können. Sie müssen sich sofort von Ihrer Frau trennen.«
»Das kann ich nicht.«
»Dann«, sagte er, »werden Sie elend zugrunde gehen.«
An diesen Ausspruch dachte ich, als ich fühlte, wie die Maschine zu sinken begann, und Monique reden hörte. Sie sprach über ein Mikrophon, ihre Stimme ertönte aus den Bordlautsprechern.
»Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden wir in Wien-Schwechat landen. Wir bitten Sie, die Sicherheitsgurte anzulegen und das Rauchen einzustellen.« Sie wiederholte die Sätze noch in Deutsch und Englisch, und vor mir, an der Kabinendecke, flammte eine Leuchtschrift auf, die zweisprachig um das gleiche bat.
Ich nahm den Gurt und legte ihn mir über den Bauch. Es sah so aus, als wäre ich angegurtet. In Wahrheit gurtete ich mich nie an, im Flugzeug nicht und nicht im Auto. Ich konnte es einfach nicht. Ich hatte eine panische Furcht vor dem Gefühl des Angeschnalltseins. Als wir das nächtliche Wien überflogen, sah ich viele funkelnde Lichter. Die Maschine ging in eine gewaltige Kurve. Bald waren wir schon so weit gesunken, daß ich die Landebahnbefeuerung des Flughafens erkennen konnte. Noch tiefer sank die Maschine. Ich bemerkte einen sanften Ruck, als die ausgefahrenen Räder erste Bodenberührung hatten. Danach ging alles ungeheuer schnell. Ich erinnere mich noch deutlich daran, direkt vor mir einen Blitz durch die Maschine zucken gesehen zu haben, einen Blitz von nie erlebter, blindmachender Helligkeit. Dann gab es einen furchtbaren, in den Ohren schmerzenden Knall. Eine Druckwelle riß mich hoch. Und damit war Schluß. Ich verlor das Bewußtsein.
7
Ich war in einem andern Land.
Da floß ein großer Strom, an dessen Ufer ich saß. Die Luft war mild, der Himmel unendlich weit und hoch. Das Wasser unter mir rauschte leise, und aus diesem Rauschen entstand eine wunderbare Melodie, die schönste, die ich jemals gehört hatte, weich und wehmütig und doch voller Hoffnung. Und alles war Wohlklang und Harmonie, und alle meine Sorgen waren verschwunden wie meine Ängste und meine Schmerzen.
Nun flog ich über eine große Stadt hinweg auf gewaltige Weinberge zu, und über diesen sah ich das schöne, lächelnde Gesicht einer jungen Frau mit braunem Haar und riesigen braunen Augen, und das Gesicht kam näher und näher, und zuletzt war es, als ginge ich ein in dieses Gesicht, umgeben von lauter Sicherheit.
Und da waren Wälder mit uralten und sehr hohen Bäumen, und ich ging durch einen lichterfüllten Dom, den sie bildeten, und an meiner Seite ging jene Frau, und ich fühlte mit großer Rührung, daß wir zusammengehörten, so sehr, wie Mann und Frau nur zusammengehören können. Und plötzlich war da ein endlos weiter, weißer Strand, Palmen neigten sich im Sommerwind, blau war das Meer, und seine Wellen glänzten schaumgekrönt. Das Licht war anders in diesem Land, wie niemand es beschreiben könnte, ein unirdisches Licht war es, von sehr großer Kraft. Und ich sah einen Totenschädel und eine abgelaufene Sanduhr, eine niedergebrannte Kerze und ein zerfallenes Buch und andere Zeichen der Vergänglichkeit, und plötzlich ahnte ich, dies war das Land der Toten. Und ich sah viele Kinder miteinander spielen und einen alten Mann, dessen Gesicht war von der Sonne gegerbt. Er saß an einem kleinen Tisch und spielte auf einer Zither und sang dazu ein altes, schönes Lied.
Und ich sah ein sehr kleines Dorf inmitten endloser Wiesen, und überall auf diesen Wiesen sprangen Quellen wie Springbrunnen aus der Erde, und jene Frau und ich schwebten über die Wiesen und Quellen dahin, als wären wir verzaubert und vereint für alle Zeit. Und immer weiter erklang die wunderbare Melodie, deren Echo wieder und wieder erschallte, denn dieses Land der Toten war so groß wie das Weltall, unendlich groß.
Und weiter flog ich mit jener Frau über Täler und Wälder, über Ströme und Berge. Und da war ein kleines Mädchen, es hinkte und lachte und winkte uns zu, und an seiner Seite sah ich einen alten Mann mit weißem Haar, und ich war so glücklich, wie ich es niemals im Leben gewesen war.
Dann plötzlich sah ich einen Bach, und in ihm schwamm ein Toter, und ich wußte, daß ich ihn getötet hatte, aber es machte mir nichts aus, und eine Madonna blickte mich lächelnd an, mich, den Mörder, und jene junge Frau an meiner Seite.
Wir flogen nun in den strahlenden Himmel empor, höher und höher, fliegend drehten wir uns im Tanz, bis dann jäh aus schimmernder Helligkeit Dunkelheit wurde und ich zu stürzen begann, zu stürzen, hinabzustürzen, hinab, und aus der herrlichen Melodie wurde ein grauenvolles Heulen, und zuletzt lag ich in großer Finsternis und Einsamkeit, und es dauerte lange Zeit, bis ich erkannte, daß dies das Heulen von Sirenen war.
Jenes wunderbare Land der Toten hatte mich ausgespien, und ich war wieder in dem jämmerlichen Land der Lebenden mit all seiner Kälte und all seinem Jammer. Das Heulen der Sirenen wurde leiser, zuletzt war da nur noch eine einzige Sirene – und ich, irgendwo, nirgendwo, weiß nicht wo. Und ich dachte, daß es nicht der Tod war, der alles beschloß. Nein, das Leben war es, das allem ein Ende bereitete, dem größten Glück und der größten Liebe. Und ich war sehr traurig.
Eine Sirene heulte noch immer.
8
Eine Sirene heulte.
Dann waren es zwei.
Dann waren es drei.
Dann konnte ich sie nicht mehr zählen. In meinen Ohren knackte und rauschte es.
Vorsichtig bewegte ich einen Arm, ein Bein, den Kopf. Ich lag, fand ich, auf etwas Knorrigem, Stacheligem. Ich rollte zur Seite und fiel in nachtfeuchtes Gras, mit dem Gesicht nach unten. Jetzt hörte ich neben dem Sirenengeheul auch gellende Schreie, wie sie Menschen in größtem Schmerz, in größter Qual ausstoßen. Danach vernahm ich viele Stimmen durcheinander und Motorenlärm. Und schließlich drang das prasselnde Geräusch von Flammen an mein Ohr. Ganz langsam wälzte ich mich auf den Rücken.
Über mir wölbte sich der Sommernachthimmel mit seinen unendlich fernen, unendlich gleichgültigen Sternen. Behutsam setzte ich mich auf. Ich war, so schien es, unverletzt. Nur Kopfschmerz quälte mich. Ich sah, worauf ich gelegen hatte: auf einer niedrig gestutzten Hecke, wie sie neben den Startbahnen angelegt waren. Zögernd zwang ich den Blick auf etwas Helles, orangefarben Flammendes und sah in einiger Entfernung das lodernd brennende Wrack der auseinandergebrochenen Maschine, in der ich gesessen hatte. Sie war offensichtlich an der Sollbruchstelle geborsten, und ich mußte an dieser Sollbruchstelle gesessen haben. Und so bist du herausgeschleudert worden, weil du dich nicht angegurtet hast, dachte ich. Über diesen Gedanken grübelte ich lange. Ich vermochte nur mit größter Mühe zu denken. Trottel, dachte ich schließlich, weil du dich nicht angegurtet hast, konntest du überhaupt aus der Maschine herausgeschleudert werden. Deine Angst vor dem Angeschnalltsein hat dir das Leben gerettet.
Die Schreie waren entsetzlich.
Das mußten verletzte Passagiere sein, überlegte ich. Männer in weißen Kitteln liefen hin und her, knieten vor zuckenden Leibern. Von der vorderen Hälfte der Maschine war nur noch das glühende Oberteil erhalten, alles andere fehlte. Trümmer lagen weit verstreut umher, brennende Trümmer. Immer wieder gellten die Schreie. Ambulanzen rollten heran, Wagen der Flughafenfeuerwehr. Auf eine Hand gestützt, stand ich auf. Ich fühlte mich sehr schwindlig. Und mein Kopf schmerzte weiter. Was war geschehen? Waren wir abgestürzt? Ich hatte doch schon die Landebahnbefeuerung gesehen, den ersten Bodenkontakt der Räder verspürt. Was war geschehen? Ich wollte auf das brennende Wrack zugehen und merkte, daß ich nur stolpern konnte. Die Beine versagten mir. Ich blieb stehen. Nein, nicht dorthin, dachte ich. Was, wenn das Wrack explodiert? Ich wankte in die Gegenrichtung. Dann fiel ich um und fluchte. Im nächsten Moment zuckte ein stechender Schmerz durch meine linke Brusthälfte. Ich hörte vor Schreck auf zu atmen. Wenn ich jetzt einen Anfall bekam … jetzt einen Anfall …
Reglos lag ich auf der Erde und wartete. Der Anfall kam nicht. Ich stand auf und taumelte weiter.
Eine Straße in der Ferne.
Mit aufgeblendeten Scheinwerfern und heulenden Sirenen kamen Mannschaftswagen der Polizei, Feuerwehr und neue Sanitätsfahrzeuge heran. Blaulichter kreisten. Immer wieder schrien Menschen wie Tiere, die geschlachtet werden. Das Flughafengebäude war von einem hohen Stacheldrahtzaun umgeben. Ich sah, daß er an mehreren Stellen geöffnet worden war, damit die Rettungsfahrzeuge direkt auf das Flugfeld gelangen konnten.
Schon fuhr der erste Mannschaftswagen an mir vorbei. Ich stolperte erschrocken zurück. Viele andere Wagen folgten, rote, weiße. Sie schlingerten über die Landebahn. Wie in ihrem Sog drehte ich mich um. Im Schein des Feuers war alles nur als Silhouette wahrzunehmen: die Wagen, die Menschen, das Flugzeugwrack. Ich näherte mich langsam. Grell hupend überholte mich ein neuer Konvoi. Das waren Privatautos und ein großer Kastenwagen. Ich sah ein Signet und las ÖSTERREICHISCHES FERNSEHEN.
Die Wagen hielten. Männer mit Kameras sprangen heraus, rannten nach vorne, fotografierten, filmten. Starke Scheinwerfer auf dem Dach des Kastenwagens flammten auf, irrten über das Gelände. Ich sah zwei Männer neben den Scheinwerfern, Handkameras an die Schulter gepreßt. Der Kastenwagen fuhr an. Die Männer filmten weiter. Von den Mannschaftswagen waren inzwischen Scharen von Polizisten gesprungen, die auseinanderschwirrten und den Platz um die Unglücksstelle in einem weiten Kreis absperrten. Ich hörte Kommandorufe und immer wieder die Schreie. Zehn mühsame Schritte hatte ich vielleicht gemacht, da ereigneten sich zwei Explosionen von ungeheurer Wucht. Ich warf mich hin und zog den schmerzenden Kopf ein. Die Erde bebte wie bei Bombeneinschlägen. Um mich her regnete es Erdklumpen, einige trafen meinen Rücken. Vorsichtig hob ich den Kopf. Die Treibstofftanks der Maschine waren explodiert. Riesige Flammen schossen in den Nachthimmel empor.
Ich sah die Umrisse von ein paar Männern mit Kameras vor dem Flammenmeer. Sie wagten sich ganz dicht heran. Auch der Wagen des Fernsehens fuhr direkt auf die Feuerwand zu. Ich torkelte weiter. Grell beleuchtet war die Unglücksstätte jetzt. Ich sah weißglühende Metallteile, ich sah Ärzte in weißen Kitteln und Sanitäter in grauen Uniformen vor Verwundeten knien, und ich sah zerfetzte Teile von Menschenleibern brennen, in weitem Umkreis verstreut. Noch nie hatte ich etwas so Grauenhaftes gesehen. Nun, da ich näher kam, erblickte ich die Gesichter der Polizisten, die sich an den Händen hielten und ein Riesenstück des Flughafengeländes absperrten, innerhalb dessen das Inferno tobte. Menschen drängten sie zurück. Die Polizistenreihe wogte hin und her. Das müssen Angehörige sein, dachte ich benommen, Leute, die auf uns gewartet haben. Hinter der Absperrung standen Ambulanzen. Männer kamen mit einer Bahre angerannt. Ein blutiges Stück Fleisch, ein Mensch einmal, lag darauf. Zwei Sanitäter trugen die Bahre, ein dritter lief nebenher. Er hielt eine Infusionsflasche in die Höhe. Ein Kunststoffschlauch verband den Tropf und eine Vene des Schwerverletzten. Die Flasche leuchtete rot. Schnell in die Ambulanz mit der Bahre. Die Männer sprangen nach. Türen flogen zu. Das Blaulicht begann sich zuckend zu drehen, der Wagen fuhr los durch eine Gasse, welche die Polizisten freiprügeln mußten. Da rannten schon Männer mit einer Bahre zum nächsten Fahrzeug. Die Polizisten trugen Helme. Ich taumelte weiter auf die Menschen vor der Absperrung zu. Diese Menschen – Männer und Frauen – versuchten immer wieder, den Polizeikordon zu durchbrechen und zu den Verwundeten zu kommen. Es gelang ihnen nicht.
Eine Megaphonstimme dröhnte: »Hier ist die Polizei! Bitte, gehen Sie zurück! Behindern Sie nicht die Rettungsarbeiten! Wer hier noch lebt, ist schwer verletzt und muß sofort operiert werden! Zurück! Gehen Sie zurück!«
Das wirkte. Langsam wichen die Menschen. Jetzt hatte ich sie erreicht. Viele weinten fassungslos.
»Mein Mann war in der Maschine …«
»Mein Mann auch …«
»Und meine Mutter …«
»Was ist passiert, Herr Inspektor? Was ist passiert?«
Ein hochgewachsener Polizist antwortete keuchend: »Terroranschlag. Zeitbombe an Bord. Hat bei Bodenkontakt gezündet.«
»Wie viele überlebende?«
»Etwa ein Dutzend. Schwer verletzt. Alle anderen sind tot.«
»Tot!« kreischte eine Frau auf.
Ich entfernte mich von der Unglücksstelle, zog mich zurück ins Dunkel. In meinem schmerzenden Schädel dröhnte es weiter: Tot! Tot! Tot!
Ich sollte auch tot sein oder schwer verletzt. Aber ich lebte und war unverletzt, weil ich mich nicht angeschnallt hatte. Das mußte doch einen Sinn haben. Mit aller Kraft zwang ich mich zu denken.
Weg!
Ich wollte hier weg, nur weg von hier.
Weg? Weg wohin?
Hinausgeschleudert worden bist du aus deinem alten Leben, dachte ich mühsam, höchst mühsam. Mein Kopf schmerzte jetzt stärker. Hinausgeschleudert aus deinem alten Leben. Ein neues Leben kannst du beginnen. Ohne Yvonne. Ohne Lumperei. Ein ganz neues Leben. Kannst du das? Geht das?
Da formte sich eine Idee, nahm langsam, schwerfällig Gestalt an, mein Gehirn funktionierte noch nicht ordentlich. Übermächtig war nur der Wunsch, hier wegzukommen, weg, weg, weg. Vorsichtig schlurfte ich zu einem der geöffneten Tore im hohen Stacheldrahtzaun. Weg! Nur weg! Meine Knie zitterten. Ich schwankte. Rechter Fuß. Linker Fuß. Rechter Fuß. Weg! Nicht umschauen. Nur weg hier, weg.
Eisenbeiß.
Um diesen Namen schloß sich jählings mein umnebeltes Bewußtsein.
Mein alter Bekannter Eisenbeiß.
Nur er konnte mir jetzt helfen.
Helfen wobei?
Ich stolperte dahin, den Anzug verdreckt. Blut im Gesicht, warm und klebrig.
Wobei helfen?
Bei meinem Weg in ein neues Leben?
9
Beinahe menschenleer war die riesige Flughafenhalle. Wer hier gewartet hatte, stand jetzt draußen an der Landebahn. Meine Schritte schienen zu dröhnen. Ich hatte Angst, jemandem aufzufallen. Niemand durfte mich sehen jetzt, wenn ich doch untertauchen, ein neues Leben beginnen wollte. Wahnsinn von mir, in die Halle zu gehen. Aber ich mußte es tun. Ich war unendlich benommen. Eine Idee hielt mich gefangen, eine Idee …
In der Halle gab es Telefonautomaten und Telefonbücher. Urplötzlich, von einem Augenblick zum anderen, war dieser Mann mir eingefallen. Ich brauchte ihn jetzt. Ob er noch lebte? Was, wenn er tot war? Tot – es genügte schon, wenn er nicht im Telefonbuch stand oder in eine andere Stadt verzogen war.
Meine Hände zitterten wie die eines alten Süffels, als ich die Seiten eines Telefonbuchs auf der Suche nach seinem Namen durchblätterte.
Eisenaber … Eisenach … Eisenau … Eisenbeiß!
Emanuel Eisenbeiß.
Ich griff in die Jackentasche, um Münzen für den Apparat zu suchen. Es waren nur Francstücke darin. Ein Franc. Zwei Franc. Fünf Franc. Zehn Franc. Schnell griff ich in die anderen Taschen. Sinnlos, warum sollte ich auch österreichisches Geld bei mir haben. Ich fluchte, warf die französischen Münzen in den Apparat. Sie fielen alle wieder heraus.
Aber ich mußte doch telefonieren!
Und hier, wo das Unglück geschehen war, durfte ich niemanden darum bitten, mir französisches Geld zu wechseln, wenn ich verschwinden, wenn ich hinüber wollte in das neue Leben. Wütend riß ich die Seite aus dem Buch und steckte sie ein. Als ich mich umdrehte, um die Zelle zu verlassen, stand ein Polizist vor ihr. Ich mußte die Türe öffnen. Ich mußte an ihm vorbei. Er trat nicht zur Seite.
»Na!« sagte er.
»Bitte?« Aus. Aus. Alles schon aus. Ein kurzer Traum.
»Na, was ist?«
Ich starrte ihn an.
»Geht der Apparat? Nach der Explosion sind alle Leitungen ausgefallen. Herrgott! Reden Sie schon!« brüllte er. »Geht der Apparat?«
»Nein.«
»Wen wollten Sie denn anrufen?«
»Meine Frau. Unser Sohn war in der Maschine.« Wer sprach da? Ich. Ich sprach da? Ich?
»Haben Sie einen Ausweis?«
Schluß. Aus. Alles aus.
»Ja … ja, natürlich.«
Schade um die schöne Idee.
»Den werden Sie brauchen, wenn Sie in die Stadt zurückfahren.«
»Wieso?«
Sein Sprechfunkgerät begann zu quaken. Er hob es ans Ohr. Ich hörte: »Sonne … Hier ist Sonne … Alle Mann wieder zum Einsatz. Wir haben eine Leitung gefunden. Ende!«
Er rannte weg. Über die Schulter rief er zurück: »Die Ausgänge zur Stadt werden kontrolliert! Straßensperren! Es läuft doch schon die Fahndung wegen einer neuen Bombendrohung.«
Ich klopfte meinen Anzug sauber, tupfte vorsichtig mein Gesicht ab und machte, daß ich aus der totenstillen Halle kam. Weg. Weg von hier! Den Stacheldrahtzaun entlang stolperte ich bis zu einem offenen Tor. Mit aufgeblendeten Scheinwerfern und jaulender Sirene kam eine Ambulanz auf mich zu. Ich breitete die Arme weit aus und blieb mitten in der Durchfahrt stehen. Der Wagen bremste. Ich rannte zur rechten Tür und riß sie auf. Der junge Sanitäter am Steuer sah mich entgeistert an.
»Was ist los mit Ihnen? Sind Sie verrückt geworden?« Er versuchte die Tür zuzuziehen. Ich klammerte mich an den Griff. Ich sah zwei Ärzte in weißen Kitteln im hinteren Teil des Wagens, der durch eine halbgeöffnete Milchglasscheibe von den Vordersitzen getrennt war. Da lag ein Mann, über und über mit Blut besudelt, den rechten Fuß hochgelagert. Alles ging sehr schnell. Ich sah, daß man dem Mann die Hosen ausgezogen hatte. Das rechte Bein war am Oberschenkel mit einem Gummischlauch abgebunden und zuckte hin und her. Es war nur noch eine blutige Masse aus Sehnen und Muskeln, aber es zuckte wild. Das Gesicht des Mannes war bläulichweiß. Er hing an einer Blutkonserve. Der eine Arzt hielt ein Mikrophon vor den Mund. »… Walter Sessler, Rechte Wienzeile fünfzehn … Jahrgang vierundfünfzig …« Er brach ab und sah mich wütend an. »Machen Sie die Tür zu!«
»Lassen Sie mich mitfahren!«
»Ausgeschlossen. Raus. Fahr weiter, Hans!«
Der Sanitäter trat aufs Gaspedal. Der Wagen schob sich durch das Tor. Er mußte auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Das war mein Glück. Der Fahrer konnte noch nicht richtig Gas geben, er mußte erst sehen, ob die Straße frei war.
»Ich flehe Sie an … der Arzt hat doch gesagt, ich darf mit Ihnen fahren.«
»Wer sind Sie überhaupt?«
»Der Bruder.«
»Wie heißen Sie?«
Ein neues Leben …
»Sessler!« schrie ich. »Das ist mein Bruder.«
»Rein mit Ihnen«, schrie der Arzt.
»Danke«, stammelte ich, »danke …« Ich ließ mich auf den Beifahrersitz fallen und schlug die Tür zu. Die Ambulanz fuhr auf einer breiten Straße stadteinwärts. Sehr schnell kletterte die Nadel des Tachometers hinauf. Achtzig … hundert … hundertzwanzig … Die Sirene heulte.
Der Arzt sprach weiter ins Mikrophon: »Rechter Oberschenkel … Amputation nötig … wohin, Zentrale … wohin, Zentrale?«
Ein neues Leben …
»O Gott, amputieren«, stöhnte ich. »Gütiger Vater im Himmel, Heilige Mutter Maria … amputieren … Lieber Gott, bitte hilf …« Ich mußte verzweifelt sein, sonst schöpften sie Verdacht und warfen mich hinaus. Es war schließlich mein Bruder. Aus dem Lautsprecher des Funkgeräts ertönte eine Männerstimme: »Zentrale hier … Wagen zweiundzwanzig … Wagen zweiundzwanzig … Allgemeines Krankenhaus ist voll … Franz Joseph auch … Fahren Sie Rudolfspital … wiederhole … Fahren Sie Rudolfspital … Haben Sie verstanden, over?«
»Verstanden, Zentrale. Wir fahren Rudolfspital. Ende.«
Ich starrte noch immer nach hinten.
»Mein Bruder«, sagte ich, »mein Bruder …«
Der Arzt schob das Milchglasfenster zu.
Ein neues Leben …
Ich sah nach vorne. Der gelbe Mittelstreifen der Straße flog uns entgegen. Hundertdreißig Stundenkilometer fuhren wir jetzt. Nach ein paar Minuten tauchten rote Lichter auf. Der Fahrer nahm den Fuß vom Gas und bremste. Da war schon die erste Sperre. Am Straßenrand brannten Kerosinfackeln. Ich sah ein halbes Dutzend Polizisten, alle mit Maschinenpistolen im Anschlag. Hinter ihnen standen rechts und links Einsatzfahrzeuge. Sie waren so geparkt, daß man nur ganz langsam in einer Schlangenlinie durchfahren konnte.
»In Ordnung!« rief einer der Polizisten, die auch hier Helme trugen. »Weiter!«
Der Fahrer passierte die Slalomstrecke und trat danach sofort wieder das Gaspedal durch. Beim Zentralfriedhof stießen wir auf die zweite Sperre. Auch hier wurden wir weitergewinkt. Der Fahrer sprach kein Wort. Er starrte auf die Straße. Das Fenster an seiner Seite war hinuntergekurbelt. Warmer Wind drang bis zu mir. Der Tag ist nicht nur in Paris irrsinnig heiß gewesen, dachte ich. Nie wärst du durch die Absperrungen gekommen, ohne deinen Paß vorzuzeigen, nie.
Die Ambulanz bog mit kreischenden Reifen rechts in eine Seitenstraße ein. Nun verlor ich jede Orientierung. Rechts. Links. Links. Rechts. Da tauchte ein gewaltiges Gebäude auf. Neben dem Haupteingang las ich auf einem großen Emailschild:
KRANKENANSTALT RUDOLFSTIFTUNG
DER STADT WIEN
Wir kurvten in einen seitlichen Hof. Vor einem erleuchteten Eingang erblickte ich wartende Männer in Weiß. Die Ambulanz hielt. Die hintere Tür flog auf. Die Bahre mit dem Verletzten wurde auf ein Gestell mit Gummirädern gehoben. Sofort war sie verschwunden und die zwei Ärzte mit ihr.
Der Sanitäter stellte den Motor ab und sagte: »Ihr Bruder ist schon im OP. Die Zentrale hat die Chirurgen hier über Funk verständigt.« Er stieg aus. Auch ich verließ den Wagen und folgte ihm in einen hell beleuchteten Gang.
»Sie können da nicht mit«, sagte er, vor einem Lift. »Sie müssen warten.«
»Warten … Was heißt warten? Wie lange?«
»Kann Stunden dauern.«
Wie kam ich nur an ein paar Schillinge? Ich konnte doch auch hier niemanden bitten, mir französisches Geld zu wechseln. Und ich mußte Eisenbeiß anrufen!
»Wo soll ich warten?«
»Auf der Bank da hinten in dem Gang zur Kapelle.«