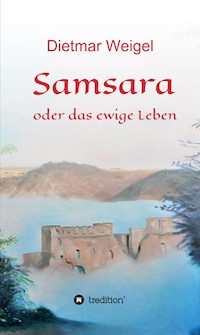Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zum diesem Buch: Die vorliegenden Erzählungen sind durch Reisen inspiriert. Landschaftliche, kulturelle und mythologische Motive fließen in die Geschichten mit ein und bilden den Hintergrund für das fiktionale Geschehen. Schauplätze sind meist Afrika und Asien. Die Charaktere begegnen in der Fremde ihren eigenen meist ungelösten Lebensfragen. Sinnliche, tiefenpsychologische und metaphysische Elemente verschmelzen zu einer erzählerischen Dichte. Es entstehen spannungsreiche, abenteuerliche - oft auch bizarre Handlungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor
Dr. phil. Dietmar Weigel lebt in Rheinland-Pfalz und ist als Erziehungswissenschaftler, Lehrer und Schulleiter berufstätig. Er war auf vielen Reisen in Europa, Afrika und Asien unterwegs.
Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Schriftstellerei. Er hat in verschiedenen Autorengruppen mitgewirkt und viele Lesungen in Kulturinitiativen, Cafés und Weingütern gehalten. Seine Werke wurden in Literaturzeitschriften veröffentlicht.
Im hier vorliegenden Band sind seine wichtigsten Erzählungen erstmals vereint. Ein Roman ist in Vorbereitung.
Inhalt
Blaue Dschungelkatzen
Stromgedanken
Die Viper
Die Blüte der Amaryllis
Der Brief
Hoch am Wind
Griechische Performance
Perlen im Sand
Aschermittwoch
Wir haben Geister gespielt
Krabats Flug
Stierspringer
Die Tränen der Pallas Athene
Le Piano Rouge
Morgenland nachts
Traumgesichter
Die Khmer-Königin
Kein himmlisches Kind, Teil 1
Kein himmlisches Kind, Teil 2
Der neue Mensch
Hummelflug
Nix wie weg
So wild bist du nicht
Totensonntag
Blaue Dschungelkatzen
In den Hütten war es still. Nicht einmal das Geplärre der Kinder war zu vernehmen. Die Mittagssonne brannte heiß und härtete die Erde der wenigen kleinen Felder rings umher. Es wuchs nicht viel in diesem Jahr. Ein bisschen Mais, ein paar Bohnen und hin und wieder konnten sich noch ein paar Bananenstauden halten. Platz gab es genug. Es lebten nicht sehr viele Menschen hier in dieser Gegend von Afrika. Die Küste und das Gebiet der Plantagen waren weit entfernt. Hier gab es nur die Steppe. Die krüppeligen Sträucher und dornigen Bäume spendeten kaum Schatten. Die Erde war steinig und ließ sich nur mühsam pflügen.
Jackson lag auf der staubigen Decke auf dem Boden seiner Lehmhütte. Er hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt und betrachtete gedankenverloren den hurtigen Lauf eines Gekkos auf der Fensterbank. Nebenan auf dem einzigen Bett lag Serena. Sie hatte den Kleinen an der Brust. Beide waren eingeschlafen.
Serena war Jacksons erste und bisher einzige Frau. Jackson hatte sie und ihr Kind aus den Bergen geholt, wo dieser fremde Stamm lebte. Serena und das Kind waren von der Sippe verstoßen worden. Warum - das hatte Jackson nicht genau verstanden, irgendeine Familienfehde wahrscheinlich. Über die Leute aus den Bergen wusste man nichts Genaues.
Jackson erhob sich und ging zu den Beiden hinüber, ganz leise, um sie nicht zu wecken. Er scheuchte die Fliegen aus ihren Gesichtern und küsste zuerst seine Frau und dann den Kleinen. Der quengelte ein bisschen im Schlaf und seine winzigen Finger umschlossen Jacksons Daumen. Jackson löste sich sacht von ihnen und ging hinaus in die Sonne.
Er besah sich seine Felder und seine Hütte. Viel besaß er nicht. Wir sind arm, dachte er, schrecklich arm. Er wusste um seine Armut, denn er hatte das Land und die Städte an der Küste gesehen. Und er hatte auch schon mit den Weißen gesprochen, die mit ihren großen Autos über die Schotterpiste brausten, bis zum See hinunter, dort, wo das große Schutzgebiet der wilden Tiere begann. Als er an den Nationalpark dachte, fiel ihm wieder die Nachricht ein, die ihn nicht schlafen ließ an diesem Mittag.
Wo der Dschungel endete und der See begann, hatte man ihn gesehen - einen schwarzen Panther. Der Panther war ein seltenes Tier, das wusste Jackson, obwohl er sonst nicht viel von Tieren und von der Jagd verstand. Dass es nur wenige Panther gab, war ihm im Grunde auch egal. Für den Panther empfand er nichts Besonderes. Eigentlich hätte es auch sonst niemanden im Dorf interessiert, dass es ein Tier mehr oder weniger im Dschungel gab. Das Fell eines schwarzen Panthers war aber eine starke Versuchung für die Menschen in der Steppe, eine stärkere Versuchung noch, als es das Elfenbein der Elefanten war.
In der nächsten Stadt, wo die Bahnlinie beginnt, könnte man das Fell eines schwarzen Panthers gut verkaufen, überlegte Jackson. Dann würden wir ein gutes Geschäft haben, an der Küste, dort, wo nur die Reichen wohnen. Jackson seufzte. Die Jagd auf die Tiere im Nationalpark war unter Androhung der Todesstrafe verboten. Jeder wusste das. Hin und wieder schon waren Angehörige aus seiner Sippe bei der Wilderei ertappt und erschossen worden. Dennoch - der Handel lief gut mit Fellen, Elfenbein und Hörnern. Die Behörden waren korrupt und die Bahnlinie erleichterte noch das Geschäft. Jackson hockte sich in den Schatten einer Akazie und blickte in die flimmernde Glut, die über der Steppe brütete.
„Man hat einen Panther gesehen im Dschungel“, sagte Jackson am Abend zu seiner Frau. Serena hockte vor der Feuerstelle und kochte Maisbrei. Sie sah auf, als sie die Worte ihres Mannes vernahm. „Was willst du denn damit sagen?“, fragte sie.
„Eben nur, dass man einen Panther im Dschungel gesehen hat“, brummte Jackson.
„So so, man hat also einen Panther im Dschungel gesehen. Und? Was braucht uns das zu kümmern?“ Serena rührte energisch im Topf. Jackson sagte eine Weile nichts mehr. Sie aßen schweigend, während der Kleine auf dem Boden umher krabbelte und mit Staub und Steinen spielte.
„Weißt du, es wäre doch gut“, begann Jackson wieder, „wenn wir uns keine Sorgen mehr zu machen bräuchten. Einmal nur ein bisschen Glück, dann müssen wir uns nicht mehr fragen, ob das Essen noch bis zum nächsten Regen reicht.“
Serenas Augen funkelten voller Angst. „Bisher sind wir noch satt geworden. Was du tun willst, kann das Leben kosten. Es ist unrecht, den Panther zu jagen. Sein Fleisch ist nicht zum Essen da!“ Serena zitterte und keuchte vor Aufregung. Was hat sie nur, dachte Jackson. So schlimm ist das alles nicht.
Der Kleine stöberte im Dreck eine Kakerlake auf und steckte sie schnell in den Mund, bevor sie ihm die Mutter aus der Hand schlagen konnte. Er gluckste zufrieden.
Später, als es dunkel war, und der Kleine schon schlief, kam Serena zu ihrem Mann. Sie kauerte vor ihm, wartend und lauernd. Jackson streifte ihr das Tuch von den Schultern und streichelte sie überall. Sie atmete schwer. Sie klammerte sich an ihn und sie liebten sich zärtlich und verspielt.
Sie ist eine wunderbare Frau, dachte Jackson, als sie dann beieinander lagen und ruhten. Ich will ihr keinen Kummer machen. Die schwarze Haut ihrer Körper schimmerte seiden im Licht der Sterne. Sie hielten sich umschlungen und genossen den Frieden.
„Weißt du“, flüsterte Jackson leise, „ich werde morgen den Alten fragen, was zu tun ist. Er wird schon den rechten Rat wissen.“
Serena murmelte irgendetwas Zustimmendes und knabberte an seinem Ohr. Dann war sie eingeschlafen. Jackson lag noch lange wach und dachte nach. Als ihn die Träume endlich übermannten, sah er das glänzende Fell des schwarzen Panthers.
Der Alte lebte etwas außerhalb vom Dorf in einer baufälligen Strohhütte. Niemand wusste genau zu sagen, wie alt er wirklich war. Manche behaupteten, er wäre schon zu der Zeit auf der Welt gewesen, als es noch keine Regierung und keine Partei gab und nur Häuptlinge und Könige den dunklen Kontinent beherrschten. Der Alte lebte von den Gaben, die ihm die Menschen aus dem Dorf brachten. Er genoss hohes Ansehen, denn er galt als weise und als ein Mann des Gesetzes. Auf welche Gesetze er sich berief, war freilich immer etwas ungewiss, und so war Jackson sehr gespannt, welcher Rat ihm wohl zu Teil werden würde.
Er grüßte die hagere grauhaarige Gestalt mit Respekt und trug sein Anliegen vor: „Ich will den Panther jagen!“
Der Alte nickte bedächtig mit dem Kopf und kratzte sich hinter dem rechten Ohr. „Ich will sehen, was die Geister des Dschungels dazu sagen“, meinte er. Dann kramte er aus einer Truhe einen ledernen Becher hervor und ließ drei große Krokodilzähne hinein klimpern. Er spuckte darüber und gab einige unverständliche Laute von sich, es klang eher nach einem Husten und Röcheln als nach Worten mit Sinn. Dann ließ er die Zähne aus dem Becher zu Boden purzeln. Vorerst sagte er nichts dazu, fast schien es, als müsse er sich die Antwort erst noch einfallen lassen.
„Nun, was ist?“, drängelte Jackson ungeduldig. Der Alte starrte auf die Zähne im Staub und sagte: „Ich sehe, dass der Panther sterben muss, und ich sehe einen hohen Preis!“
Jackson wunderte sich nicht darüber, dass der Alte mit seinen halbblinden Augen überhaupt noch etwas sehen konnte. Er war nur erleichtert und atmete auf, denn die Botschaft erschien ihm unmissverständlich. Der Alte war etwas nervös. „Nimm die Zähne und den Becher mit, dann wird der Dschungel zu dir sprechen können“, erklärte er. Jackson zuckte gleichgültig mit den Schultern, steckte die Dinge ein und ging davon.
„Die Gesetze des Dschungels sind auf meiner Seite“, berichtete er später seiner Frau. Er knallte triumphierend den Becher mit den Zähnen auf den Tisch. Serena schrak zusammen. „Was weißt denn du schon vom Dschungel?“, zischte sie ihm entgegen.
„Na, vom Dschungel, da weiß ich so viel, wie du eben auch weißt“, erklärte er hochmütig. „Ich werde den Panther töten, und die Soldaten werden mich nicht erwischen. Ich mache es ganz geschickt, um Mitternacht, wenn der Mond aufgeht. Und dann werden wir bald sehr reich sein.“ Er versuchte, Serena in die Arme zu schließen. Sie aber kratzte ihm ins Gesicht und sprang davon. Jackson war überrascht. So böse hatte er sie noch nie erlebt. „Geh nicht, ich bitte dich“, wimmerte sie. „Es wird ein Unglück geschehen.“
„Ha, ich bin ein starker Mann. Mir wird schon nichts passieren!“ Jacksons Entschluss war unerschütterlich.
Serena kniete in der Ecke der Hütte und presste ihren kleinen Sohn an sich. Sie schluchzte und bebte voller Angst. Als Jackson wütend die Tür zuwarf, kippte der Becher vom Tisch, die Zähne fielen in den Staub. Der Kleine fing zu weinen an.
Jackson verließ das Dorf am nächsten Nachmittag. In einem Tuch trug er die Waffen, mit denen er umgehen konnte, den Bogen und die vergifteten Pfeile, den scharfen Speer. An einem Strick führte er eine Ziege mit sich. Er wusste, dass Serena ihm mit traurigen Augen nachblickte, und er drehte sich absichtlich nicht um.
Der Marsch bis hinunter zum See dauerte einige Stunden. Unterwegs traf er nur wenige Menschen. Sie grüßten den Mann mit der Ziege freundlich. Sie denken, ich bin nur ein Bauer, ging es ihm durch den Sinn. Wie dumm sie sind.
Als Jackson endlich den See erreichte, wurde es dunkel. Er gab sich Mühe, einen sicheren Platz zu finden, denn abends kamen viele Tiere zum See, um zu trinken. Auf einem hohen Felsen in einer Mulde versteckte er sich. Der Ziege warf er etwas Heu hin, damit sie fraß und still war. In der Ferne, unter der untergehenden Sonne, sah Jackson zwei Jeeps und ein paar Menschen - Weiße, die auf Safari waren und mit ihren Ferngläsern den See absuchten. Jackson zog sich hinter die Felskante zurück. Niemand wird mich hier finden, dachte er.
Später, als es Nacht war, wurden die Geräusche des Dschungels immer lauter. Es knackte und raschelte im Dickicht. Der Dschungel erhob sich als eine mächtige schwarze Wand und verschluckte die Sterne. Geheimnisvolles Leben war in dieser Schwärze zu erahnen. Geisterhafte Schatten schnauften und streiften umher. Die Weißen waren mit ihren Autos längst schon fort, und Jackson war sich sicher, dass er der einzige Mensch war in dieser urtümlichen Welt. Du bist fremd hier, sagte er sich. Du musst jetzt tapfer sein.
Gegen den silbrigen Schimmer des Sees zeichneten sich die Umrisse von Büffel und Elefanten ab. Auch Antilopen und Wasserböcke konnte Jackson erkennen, und da wusste er, dass der Panther noch nicht in der Nähe war. Er ist sehr stolz, dachte Jackson.
Plötzlich schüttelte es ihn in Erwartung der Jagd. Er legte seine Waffen bereit. Von den Weißen hatte ihm mal jemand gesagt, er fände es in Ordnung, Tiere zu töten, um davon zu leben. Ja, leben will ich, dachte Jackson.
Dann prüfte er die Schärfe der Speerklinge und schnitt der Ziege rasch und geschickt die Kehle durch. Er hängte sie kopfüber in eine Baumgabelung und ließ sie ausbluten. Er konnte es riechen, wie das warme frische Blut aus dem Kadaver hervor-sprudelte, und er wusste, auch der Panther würde es wittern, und es würde ihn wahnsinnig machen vor Gier. Schnell prüfte Jackson die Windrichtung und legte sich dann im Gebüsch auf die Lauer.
Der Mond kam jetzt hinter den Urwaldriesen hervor und spendete bleiches Licht. Die Konturen wurden scharf und die Schatten fächerten in verschiedenen Grautönen auseinander. Plötzlich wurde sich Jackson bewusst, dass es still war im Dschungel. Kein Rascheln und kein Flügelschlagen mehr, die Antilopen und Büffel waren verschwunden.
Ein tiefes Knurren ertönte da aus dem Gehölz und Jackson erzitterte leicht. Der Panther war da! Er schlich als lang geduckter Nachtmahr über die Wipfel heran. Er war groß und voller Kraft. Sein Schwanz peitschte hin und her in Angriffslust. Das dichte dunkle Fell schimmerte blau im Licht des Mondes. Der Panther kam vorsichtig näher. Er war misstrauisch, aber er roch das frische Ziegenblut. In den oberen Ästen des Baumes duckte er sich tief und setzte zum Sprung an auf das Lockfutter.
Jackson hielt den Bogen gespannt und zielte sorgfältig. Er war aufgeregt, sein Puls hämmerte ihm in den Schläfen. Die gelben Lichter des Panthers reflektierten den silbrigen Glanz des Sees. Jackson dachte an die großen angstvollen Augen von Serena. Etwas verkrampfte sich in seiner Seele. Es war wie ein plötzlicher Frost. Serenas Mahnen ging ihm nicht aus dem Sinn. Der Panther fauchte.
Sie wird mir verzeihen müssen, dachte Jackson. Dann zog er die Sehne des Bogens vollends durch und ließ den Pfeil durch die Nachtluft schwirren. Todbringend bohrte er sich in die weiche Flanke des Panthers und versenkte sein Gift in die geschmeidigen Muskeln. Der Panther stürzte vom Baum, wälzte sich am Boden und schlug und biss um sich. Er verrenkte den Kopf und schnappte wütend nach dem peinigenden Schmerz in seiner Seite. Jackson sprang auf und sah zu, und er kämpfte gegen die Angst um das Leben, das aus dem Tier entwich. Rasch schoss er noch einen zweiten Pfeil in die Brust des Panthers, das Ende war nah, die Angst verlor sich. Der Panther war tot!
Jackson gönnte sich eine kurze Pause und bewunderte das glänzende Fell. Dann wollte ihn die mahnende Stimme Serenas wieder plagen. Er riss sich zusammen. Das ist nur die Nacht, sagte er sich. Die macht dich so unruhig.
Er zündete ein Feuer an, um die Hyänen fern zu halten, und dann fing er an, den Panther zu häuten. Er schnitt die Hinterläufe ein bis in den Schritt und hätte nur zu gern übersehen, dass der Panther ein Weibchen war. Jackson zog und zerrte an dem Fell. Das strengte ihn an. Das Fell riss schwer von dem Fleisch. Er hasste dieses Geräusch. Es durchjagte ihn bis in die Knochen. Als er die Bauchdecke teilte, sehnte er sich plötzlich nach Serenas Umarmung, nach ihrer sanften Haut, er hoffte, sie bald zu berühren, denn dann war alles gut. Du musst bei der Sache bleiben, ermahnte er sich.
Das rosige blutige Fleisch des Panthers war immer noch warm, als Jackson ihm die schwarze samtige Decke mit einem Ruck über den Kopf riss. Er wickelte das Fell zusammen, und auf einmal vernahm er wieder die Laute, die aus dem Dschungel drangen. Die Worte des Alten fielen ihm wieder ein, dass der Dschungel zu ihm sprechen könne, aber sofort wusste er auch, dass er den Becher und die Zähne zu Hause vergessen hatte. Das mochte ein Unglück sein. Du spinnst ja, Mann, sagte sich Jackson. Die Welt der Geister ist längst vergangen.
Ein paar Laute schienen ihn Lügen zu strafen, besondere Laute, die zwischen allen anderen Lauten hindurch hartnäckig in sein Bewusstsein drangen. Ein Schnurren und Wimmern war´s, ein scheues Scharren und Tasten. Aus dem Dunkel des Dschungels kam ein Pantherjunges heran. Es wendete unsicher den kleinen Kopf hin und her, knickte unsicher mit den Pfoten ein, suchte nach einer verlorenen Geborgenheit zwischen der Tiefe des Waldes und dem flackernden Feuerschein. Erschrocken und hastig packte Jackson die kleine Katze und erdrosselte sie mit seinen Armen, noch bevor die klagenden Augen ihm den Verstand rauben konnten.
Eigentlich hatte Jackson daran gedacht, im Wald zu übernachten, denn der Weg hierher war lang gewesen und die Jagd hatte ihn Kraft gekostet. Er konnte jedoch keine Ruhe finden. Die beiden wertvollen Felle hatte er zu einem Bündel geschnürt. Seine Hand glitt zögernd darüber hinweg. Etwas schmerzte ihn an der Berührung. Er konnte keine Freude empfinden über seinen Erfolg. Es war, als hielte die Welt eine Strafe für ihn bereit.
Er begab sich, von Unruhe getrieben, auf den Heimweg. Er verließ den Wald mit seiner geheimnisvollen Sprache und kehrte dem silbrigen Glanz des Sees seinen Rücken zu. Mit kräftigen Schritten wanderte er durch die nächtliche einsame Weite der Steppe. Nichts mehr war um ihn herum außer der Weite, und in der Weite drängte er vorwärts voller Angst und böser Ahnungen. Und da die Nacht so leer war, nur angefüllt mit dem, was seine Seele sich erdachte, nahmen seine Befürchtungen konkrete Gestalt an: Während seiner Abwesenheit konnte mit Serena und dem Kind etwas passiert sein.
Jackson wusste wieder von der Angst, die er empfunden hatte, als das Leben aus dem Panther wich, und von dem heftigen Grauen, das er niederkämpfen musste, als er auch das Pantherjunge tötete. Das verwirrte ihn und ihm war zumute, als wären es Serena und das Kind, die von ihm gemordet wurden. Er hoffte geradezu, die beiden würden nur fiebrig und krank auf dem Lager liegen. Zwischen Angst und Hoffnung wanderte Jackson Stunde um Stunde durch die Nacht seinem Dorf entgegen. Die beiden Felle drückten schwer auf seine Schultern.
Als er den Pfad erreichte, der zu seiner Hütte führte, schrie er bereits laut die Namen, die er oft so glücklich und zärtlich geflüstert hatte. Niemand antwortete ihm. Er stürzte durch die Tür und hastete in den kleinen Räumen umher. Serena und das Kind waren fort!
Jackson stieß seine Stirn gegen den Türpfosten, um seine Verzweiflung einzudämmen. Aber sie kamen dennoch - die Erinnerungen an die alten Geschichten über die Stämme aus den Bergen; Menschen, die sich in Geister und Dschungeldämonen verwandeln konnten und in hellen Mondnächten auf Tatzen und Krallen durch die Wälder schlichen. Dann fiel sein Blick auf den umgestürzten Becher. Die langen Zähne lagen im Staub und der Wind hatte aus der Feuerstelle eine Handvoll Asche darüber gestreut.
Was hab´ ich getan, brüllte Jackson. Er sank in die Knie. Mit Armen und Beinen umklammerte er die Felle und presste sein tränennasses Gesicht in die weiche Schwärze. Lange wälzte er sich so hin und her. Zwischen seinen Klagen küsste er die seidigen dunklen Haare. Aber seine Qual ließ sich nicht mindern und im Morgengrauen nahm er einen der vergifteten Pfeile und rammte ihn sich tief in den Bauch.
Gegen Mittag rumpelte der Bus aus der Stadt in das kleine Dorf. Der Bus hätte eigentlich schon am vorhergehenden Abend da sein sollen, aber es gab einen Motorschaden und so konnte er erst am nächsten Tag weiterfahren. Serena stieg mit ihrem Kind aus. Sie hatte auf dem Markt Früchte und Gemüse verkauft und gute Einkünfte erzielt. Das war besser als nutzlos zu Hause zu warten, hatte sie gedacht. Als sie den Pfad zu ihrer Hütte betrat, sah sie die vielen Leute. Und mit dem dumpfen Ton aufsteigender Besorgnis schritt sie ihnen langsam entgegen ...
Sansibar, Tansania 1995
Stromgedanken
Der westliche Pfad führte durch blühenden Hibiskus und Palmenhaine aus den bewohnten Gebieten heraus. Hier gab es nur noch ein paar vereinzelte Hütten von Bauern und Fischern. In den Wipfeln der Akazien und Zedern turnten Affen herum.
Frank schaute durch das grüne Blätterdach zum Himmel hinauf. Die Sonne stand hoch. Es war kurz nach Mittag - genau die richtige Zeit, denn in einer halben Stunde würde der Wind auffrischen. Frank folgte dem geschlängelten Pfad zwischen den schattigen Bäumen hindurch. Die Farben, Gerüche und Geräusche eines afrikanischen Waldes begrüßten ihn. In den Büschen wimmelte es von gelben und blauschwarzen Vögeln. Zwitschernde, pfeifende und gurrende Laute erfüllten den Wald. Weiter vorn aus dem sumpfigen Mangrovengebiet wehte ein Geruch von abgestandenem Wasser heran.
Nach wenigen Minuten tauchte zwischen den bemoosten Stämmen ein Glitzern auf. Kurz darauf trat Frank auf die Lichtung hinaus und ließ seinen Blick über den Viktoria-See schweifen. Die Wasserfläche war spiegelglatt. Sie wirkte fast gläsern. Es waren keine Boote oder Schiffe zu sehen, nur ein paar Vogelschwärme zogen über den See dahin. In diesem Bild wirkten Schönheit und Frieden vereint, aber Frank wusste natürlich, dass im Victoria-See Krokodile, Raubfische und Schlangen hausten. Wen Afrika liebt, den verschlingt es voll Eifersucht, dachte er. Ein flüchtiges Erschauern lag in dieser Erkenntnis. Zu Hause könntest du in der Sonne liegen, sagte er sich, ohne befürchten zu müssen, dass dich eine Mamba in den Hintern beißt.
Am Ende der Lichtung war das alte Bootshaus zu sehen. Auf der Wiese standen Segeljollen und Ruderboote auf Trailern herum. Daniel, der junge Schwarze vom Stamme der Nandi, stand bereits am Zaun und winkte. Sein erwartungsvolles Lachen ertönte über der Lichtung. Eigentlich gehörte der Bootsclub einem Inder, der in Nairobi und Kisumu Handel trieb. Aber der war selten hier. Daniel passte auf alles auf und er konnte gut mit Booten umgehen. Frank ging rüber zu ihm, von seinem Lachen angesteckt.
„Bist du bereit für eine neue Safari über das große Wasser?“ Daniels Augen glänzten und sein Grinsen entblößte seine kräftigen weißen Zähne. „Nur auf Safari weiß ein Mensch, ob sein Herz noch lebendig ist“, antwortete Frank. Es sollte wie ein Scherz klingen.
Daniel vollführte eine Armbewegung über den Horizont. „Dann soll uns unsere Safari heute bis zu den Ufern von Uganda tragen, damit dein Herz vergisst, dass es einmal sterben muss.“ Frank spürte die gute Absicht in diesen Worten, aber ganz so ernst nehmen konnte er sie nicht. Bis nach Uganda wären dreihundert Kilometer über den See zurückzulegen. Das war an einem Nachmittag niemals zu schaffen. Er legte seinen Arm um Daniels Schultern. „Ist das etwa ein kluger Mann, der dem Wind und den Wellen befehlen will?“
Daniels Augen leuchteten. „Der Wind und die Wellen werden unsere Freunde sein. Und heute nehmen wir das schöne Boot aus poliertem Holz, auf dem dein Auge heimlich ruhte.“
Zusammen schoben sie die hölzerne Jolle auf dem Trailer ans Ufer und ließen sie dort zu Wasser. Frank kletterte an Bord und setzte sich an die Pinne. Daniel sprang in den Bug, hisste das Vorsegel und holte die Fockschot dicht. Langsam trieben sie auf den See hinaus. Erwartungsgemäß hatte der Wind zugenommen und blies sanft, aber stetig aus Nordwest. Die Wellen kräuselten sich. Die blanke silbrige Fläche war jetzt mit blaugrauen Schattierungen durchsetzt. Frank drehte kurz in den Wind und setzte das Großsegel straff durch. Dann ging er auf nördlichen Kurs. Uganda, wir kommen, dachte er schmunzelnd.
Das Boot glitt hoch am Wind mit schneller Fahrt dahin. Der gleißende Himmel und der See verschmolzen zu einem Universum. In dieser stillen Weite sprachen sie lange kein Wort. Du bist frei, du könntest zufrieden sein, sagte sich Frank im Stillen. Das intensive Licht blendete ihn. Er beschattete seine Augen und starrte in die Wellen. Die Erinnerungen kamen wieder hoch...
Es war vor einigen Jahren im Sommer am Fluss. Die Stadt war zum Weinfest geschmückt. Unter den Platanen an der Uferpromenade waren Tische und Bänke aufgereiht. An den Weinständen prosteten sich die Leute zu. Die Tanzkapelle spielte alte Hits von den Beatles. Frank stand an der Straßenecke und warf dann und wann einen Blick auf seine Armbanduhr. Er hatte eine Verabredung mit Manuela und er war ziemlich aufgeregt. Natürlich hatte er schon viele Frauen gekannt. Er war längst keine Zwanzig mehr. Aber bei Manuela, da war alles anders.
Plötzlich tauchte sie in der Menschenmenge auf und kam lächelnd auf ihn zu. Sie trug ein langes geblümtes Sommerkleid mit schmalen Trägern. Es passte perfekt zu ihren grünen Augen und ihren dunklen lockigen Haaren. Manuela war eine außergewöhnliche Schönheit. Frank musste sich zusammenreißen, um ein paar freundliche Begrüßungsworte stammeln zu können.
Sie schlenderten an den Kirmesbuden vorbei und ließen sich am Rande des Festplatzes nieder. Sie tranken herben Wein, unterhielten sich über Bücher und über Reisen, und mit ihren Worten und Gedanken tasteten sie sich aufeinander zu. Das Licht der Nachmittagssonne spiegelte sich auf dem Strom und erhitzte ihre Gesichter. Ihre Fingerspitzen berührten sich...
Daniels lautes Rufen holte Frank in die Wirklichkeit zurück. „Siehst du dahinten die neugierigen Hippos?“ Daniel deutete mit dem Arm nach Westen. Dort erstreckte sich eine felsige Landzunge in den See hinein. Frank konnte zunächst nichts Besonderes erkennen, aber dann fielen ihm die kleinen höckerförmigen Unregelmäßigkeiten auf der Wasseroberfläche auf. Und an den wackelnden Ohren erkannte er die Herde von Flusspferden, die dort hauste. Ein riesiges rosafarbenes Maul mit langen Zähnen tat sich jetzt auf und eine Serie von tiefen Grunzlauten ertönte über den See. Die Flusspferde waren weit genug weg, aber Frank fiel sicherheitshalber etwas vom Kurs ab und ging auf halben Wind Richtung Nordost.
Daniel brach in brüllendes Gelächter aus. In seinen Augen blitzte der Schalk. „Ob ein Hippo ein Segelboot fressen kann? Da müssen wir mal den Daktari fragen.“ Daniel gluckste vor sich hin. Frank lachte mit, obwohl er es auf dem Sambesi schon erlebt hatte, dass Flusspferde Kanus angegriffen und mit ihren kräftigen Kiefern zermalmt hatten.
„Hörst du nicht, was sie rufen? Safari njema rufen sie. Denn heute sind sie satt, sie haben schon viele Segelboote gefressen.“ Daniel prustete wieder los und sein Lachen war so ansteckend, dass Frank lauthals mit einstimmte.
Eine Weile ließen sie sich dann vom raumen Wind parallel zum Ufer treiben. Das Boot lag gerade im Wasser und die Wellen rollten langsam darunter hindurch. Frank und Daniel konnten sich in Ruhe unterhalten. Nach wenigen Minuten sah Daniel kopfschüttelnd zum Ufer hin. Seine Mundwinkel verzogen sich spöttisch.
„Ein Fischer, der nur das Ufer anstarrt, wird hungrige Kinder haben. Und ein Herz, das nur die Heimat liebt, kann Uganda nicht finden.“ Frank seufzte. Er luvte an und dann kreuzten sie ein paar Mal gegen den Wind, bis sie das Ufer weit hinter sich gelassen hatten. Frank steuerte hoch an den Wind, so dass sich das Boot weit auf die Seite neigte. Daniel setzte sich auf die gegenüberliegende Kante, hielt sich an den Wanten fest und lehnte sich weit nach hinten, um das Boot auszubalancieren. Frank klemmte die Großschot fest. Er spürte den Druck des Ruders an seiner Hüfte und er genoss die schnelle Fahrt. Seine Gedanken trieben davon...
An einem Sonntag traf er sich mit Manuela zu einem Konzertbesuch in der alten Burg. Bevor es losging, standen sie an den Zinnen und blickten über den Rosengarten auf den Fluss hinunter. Dort zogen Schleppkähne und Ausflugsdampfer vorbei. Frank nahm die Schönheit des Flusstales in sich auf. Er hatte von Leuten gehört, die daran glaubten, dass der Strom zu ihnen sprach. Das fand er albern. Aber dennoch fühlte er sich diesem Fluss auf eigentümliche Art verbunden. Er zog Manuela an sich und küsste sie sanft.
In der Burg wurden ein paar Stücke von Händel aufgeführt. Die Bläser waren grauenhaft, aber die falschen Töne störten Frank nicht. Manuela saß an seiner Seite. Und er war sich sicher, dass er ihr Herz gewonnen hatte. Nachdem das Konzert zu Ende war, wanderten sie Hand in Hand durch die Weinberge. Manuela hatte die Schuhe ausgezogen und ging barfuß über die ausgetrockneten Wege. Der Wind wehte durch ihr Haar. Ihr langes Kleid wippte bei jedem Schritt. Frank sah sie an und überlegte, was er sagen sollte. „Was wollen wir jetzt machen?“, brachte er schließlich hervor.
„Komm doch mit zu mir“, sagte sie leise, „ich hab´ noch Sekt kalt stehen.“ In ihrer Miene war ein verlegenes Lächeln zu erkennen. Als sie ihre Wohnung erreichten, verdunkelte sich der Himmel und ein Gewitter zog auf. Am Sekt hielten sie sich nicht lange auf. Frank streifte Manuela die Träger ihres Kleides von den Schultern. Sie liebten sich auf der breiten Wohnzimmercouch, während draußen der Donner grollte und ein heftiger Regen nieder rauschte.
Danach lagen sie lange beieinander. Frank streichelte Manuelas nackten Körper. Sie lag schweigend an seiner Seite und hatte den Blick in die Ferne gerichtet. Sie ist sehr romantisch, glaubte Frank.
„Hatari!“ Daniels Aufschrei ließ Frank aus seinen Träumen aufschrecken. Das Boot war aus dem Gleichgewicht geraten. Daniel hatte sich in die Mitte begeben, um dort eine kleine Pfütze aufzuwischen. Der Wind drückte das Boot übermäßig stark auf die Seite. Frank steuerte reflexartig nach Lee und versuchte, die Großschot aus der Klemme zu lösen. Aber das Ding saß viel zu fest. Es war zu spät. Das Boot kenterte über steuerbord.
Frank sah noch, wie Daniel mit ausgebreiteten Armen ins Wasser rutschte, dann fiel er selbst in die Tiefe. Der Schreck fuhr durch seine Glieder. Luftblasen und gebrochene tanzende Lichtstrahlen umfingen ihn. Schnell kämpfte er sich zurück an die Wasseroberfläche. Daniel war auch schon aufgetaucht. Er paddelte angestrengt wie ein Hund um das gekenterte Boot herum. Frank erinnerte sich, dass die meisten Menschen hier am See nicht schwimmen konnten. Der Victoria-See war nicht gut zum Schwimmen. Das wusste man. Sie klammerten sich beide an den kieloben treibenden Rumpf. Frank fluchte und spuckte. Er sah Daniels besorgten Blick.
„Wir müssen das Ding wieder aufrichten“, knurrte Frank. Er hatte keine Lust, mit Krokodilen Bekanntschaft zu machen. Frank wusste, dass man eine gekenterte Jolle normalerweise wieder aufrichten konnte. Bei kleinen Kunststoffjollen war das jedenfalls kein Problem. Aber dieses Boot war aus Holz. Die ausgetrockneten Planken saugten sich langsam voll. Der schwere steil in die Tiefe ragende Mast zog es allmählich nach unten.
Frank tauchte. Er versuchte unter Wasser die Schoten und Falle zu lösen, um das Boot vielleicht doch noch aufrichten zu können. Aber es war hoffnungslos. Die ganze Takelage stand unter großer Spannung. Frank schwamm keuchend zu Daniel hinüber. „Was machen wir jetzt?“ Daniel sagte nichts. Auf seiner Stirn zeigten sich zwei große Falten. Frank und Daniel zogen sich auf den Bootsrumpf hinauf, um Kräfte zu sparen.
Frank sah sich um. Das Ufer war weit weg - schwer zu sagen, wie weit genau. Auf dem See war nichts zu sehen. Die Fischer würden erst im nächsten Morgengrauen wieder rausfahren. „Ich werde schwimmen müssen“, sagte Frank leise, aber laut genug, dass Daniel ihn verstand. Daniel wich seinem Blick aus und antwortete auch diesmal nicht. „Also hab Geduld und halt durch. Ich hole Hilfe.“
Frank holte tief Luft. Das Schwimmen scheute er nicht. Er war ein guter Schwimmer. Aber er mochte gar nicht daran denken, welche Ungetüme da unten auf ihn lauern könnten. Er hechtete ins Wasser, tauchte wieder auf und sah sich noch mal um. Keine Zweifel - der Bootsrumpf war bereits um eine Handbreit gesunken. Daniel hob die Hand zum Abschied. Frank hielt mit langen kräftigen Zügen auf das ferne Ufer zu. Du musst einfach nur schwimmen und nicht denken, sagte er sich. Aber nach einer Weile kam ihm die Sache mit Manuela wieder in den Sinn...
Manuela war in einem kleinen Weindorf am Fluss aufgewachsen. Sie kannte jede Bucht in dieser Gegend. An einem Nachmittag im August nahmen sie die Fähre und überquerten den Strom. Auf der anderen Seite lagen die Dörfer weiter auseinander und in den Uferböschungen gab es viele geschützte Plätze. Dort ließen sie sich nieder und packten ihr Picknick aus. Sie probierten Parmaschinken und Melonenscheiben und prosteten sich mit trockenem Sekt zu. Frank war selig zum Sterben.
Manuela sprach wenig. Sie schaute gedankenverloren über das Wasser. Sie lagen auf der schmalen Decke in der Sonne und ließen sich bräunen. Er liebte die vorsichtigen Berührungen ihrer Haut und die aufkommende Ahnung von leidenschaftlichen Umarmungen, die später noch folgen würden. Nach einer Weile standen sie auf und gingen zum Wasser. Der Fluss war kalt. Als Frank mit den Füßen drin stand, fröstelte er. Aber heute gehörte ihm die ganze Welt. Er würde nicht Halt machen - vor gar nichts mehr.
Sie ließen sich ins Wasser gleiten. In der Kälte klammerte sich Manuela an ihn, hielt ihn mit Armen und Beinen umfangen. Er stand fest in der Strömung auf dem kiesigen Grund. Der warme Körper in seinen Armen machte ihn kühn. Er wippte mit den Zehen auf und ab, wagte sich weiter vor, wo die Strömung immer stärker an seinen Beinen zog. Manuela jauchzte. Er suchte ihre Lippen und küsste sie. Er küsste sie mit einer Gier, die ihn selbst erschütterte.
Vielleicht hatte sie das gespürt in diesem Moment, dass seine Liebe so erdrückend und ernst war - so ernst wie der Tod. Vielleicht hatte sie es auch gelesen in seinem Blick, dass er alles gewinnen wollte und dabei alles zerstören konnte. Der Versuch eines Lächelns stahl sich in ihr Gesicht. Sie schien nach Worten zu suchen, nach einem Weg zurück zur Leichtigkeit. „Lass uns einfach Freunde sein“, sagte sie schließlich.
Das war ein Hieb. Das traf ihn mit voller Wucht. Darauf war er nicht gefasst gewesen, nicht im Geringsten. Und in den folgenden Sekunden verlor er den Verstand. Schmerz und Wut machten ihn rasend. Er löste sich aus ihrer Umarmung, packte sie an den Schultern und stieß sie weit von sich. Er stieß sie mit aller Kraft von sich, so wie es der Zorn in ihm verlangte. Manuela strampelte, keuchte und rief seinen Namen, während der Strom sie immer weiter hinauszog.
Frank hätte sie noch retten können. Er wusste das - und er liebte sie ja. Aber er rührte sich nicht. Ihre Hilferufe wehten an ihm vorbei. Er war ein lebloser Fels. Manuela trieb mit der starken Strömung flussabwärts. Eine Weile sah er ihr nach, bis sie seinen Blicken entschwunden - und ihre Rufe verklungen waren…
Frank war jetzt eine Stunde durch den Victoria-See geschwommen. Er war froh, dass er seine Armbanduhr anbehalten hatte. Die Uhr unterteilte die Ewigkeit in kleine Abschnitte. Noch eine viertel Stunde und noch eine und noch eine. Er konnte noch länger aushalten. Das Wasser des Sees war angenehm warm. Aber der Wind trieb ihm Spritzwasser in die Augen und er hatte schlechte Sicht.
Das Ufer schien ihm mittlerweile etwas näher gekommen zu sein. Aber es war immer noch weit genug entfernt, dass kein Anlass zum Aufatmen bestand. Du musst einfach nur schwimmen und nicht denken, ging es ihm erneut durch den Sinn, nur schwimmen und nicht denken. Die Angst vor Krokodilen kam wieder hoch. Wo es Flusspferde gibt, da gibt es keine Krokodile, überlegte er. Aber das beruhigte ihn nicht. Die Landzunge mit den Flusspferden lag in einer ganz anderen Richtung, weit weg. Und mit Flusspferden wollte er schließlich auch nicht zusammenstoßen.
Er sah wieder auf seine Armbanduhr. Seit er den letzten Blick darauf geworfen hatte, waren nur fünf Minuten vergangen. Du bist viel zu ungeduldig, überlegte er, du musst alles ein bisschen gelassener sehen.
Als er den Blick wieder nach vorne richtete, erschrak er auf´s Heftigste. Da schwamm etwas Braunes und Langes im Wasser, keine zehn Meter von ihm entfernt. Das Ding tauchte kurz auf, wurde von den Wellen verdeckt und huschte erneut durch sein Blickfeld.
Frank warf sich zur Seite und schwamm so schnell er konnte im Freistil davon. Adrenalin schoss durch seine Adern. Er kraulte und strampelte, bis seine Lungen pfiffen und schwarze Kreise vor seinen Augen tanzten. Er kam aus dem Rhythmus, schluckte Wasser vor Angst und Erschöpfung. Jetzt musst du büßen, sagte er sich, jetzt musst du büßen für alles, was du getan hast.
Nur langsam beruhigte er sich, ließ sich treiben, ein paar Sekunden lang. Er wusste, wie lächerlich das war, einem Krokodil davon schwimmen zu wollen. Er wandte sich um. Da war nichts - nichts, so weit er sehen konnte. Vielleicht war´s nur ein Stück Treibholz, überlegte er. Ein Stück Holz ist´s gewesen. Du siehst Gespenster, Mann. Er atmete langsam und tief. Es war ihm mulmig zumute, aber er korrigierte seine Richtung und hielt weiter auf das Ufer zu...
Als der Strom Manuela seinen Blicken entzogen hatte, stand er noch eine Weile bewegungslos im kalten Wasser. Unter seinem Zorn kam langsam das Gefühl von Verlassenheit auf. Er ging zurück ans Ufer, wo ihre Decken und Handtücher lagen. Die Sektflasche ragte aus dem Picknickkorb hervor, nicht mal ausgetrunken. Das wollten sie sich für später aufheben. Er kniete im Sand, betäubt und erstarrt. Er wusste nicht, was zu tun war. Er flüsterte in sich hinein, wie sehr er Manuela geliebt hatte. Wie sehr hatte er sie doch geliebt - viel mehr geliebt als alles andere auf der Welt. Und gleichzeitig spürte er, dass da etwas Hässliches und Gemeines in ihm war, und dass er etwas Schreckliches getan hatte. Mit einem Mal brach der Kummer aus ihm hervor. Er weinte und schluchzte haltlos vor sich hin.
Gegen Abend ging er zur Polizei. Er berichtete mit sparsamen Worten, dass sie Schwimmen waren im Fluss, und dass seine Freundin von der Strömung mit fortgerissen wurde. Die Polizisten schüttelten verständnislos die Köpfe. Es sei ja schon oft genug davor gewarnt worden, im Fluss zu schwimmen. Die Strömung sei unberechenbar und habe schon so manches Opfer gefordert. Als sie seine verheulten Augen sahen, wurden sie etwas milder. Vielleicht sei sie ja flussabwärts wieder an Land gespült worden oder ein Schiff habe sie an Bord genommen. Man würde jedenfalls gleich die Wasserpolizei informieren.
Manuela wurde drei Tage später gefunden. Sie lag am sandigen Ufer einer Flussbiegung. Die Polizei berichtete, aus der Ferne habe man meinen können, eine junge hübsche Frau würde sich in der Sonne bräunen lassen. Aber dann habe man erkennen können, dass dort eine Leiche lag, mit starrem Blick, bleich und aufgeschwemmt, mit Fliegen übersät...
Frank war jetzt zwei Stunden durch den See geschwommen. Er warf wieder einen Blick auf seine Armbanduhr, denn er machte sich Sorgen, ob Daniel so lange auf dem sinkenden Boot in Sicherheit war. Du musst dich beeilen, sagte sich Frank. Wenn er umkommt, das stehste nicht durch, diesmal nicht!
Das Ufer war mittlerweile deutlich näher gekommen, da gab´s keine Zweifel mehr. Frank konnte ein paar Leute erkennen, die am Bootsclub zu tun hatten. Er legte jetzt all seine Kraft in seine Schwimmzüge. Verdammtes Afrika, fluchte er vor sich hin, mich erwischst du nicht, noch lange nicht! Es lag nicht an Afrika, dass der Tod seine Spielchen mit ihm trieb, aber es tat gut, auf irgendeine Art von Schicksal zu schimpfen. Die Wut trieb ihn an und er pflügte verbissen durch die Wellen.
Schließlich war es mit seiner Geduld vorbei. Er schrie und winkte. Er schrie, bis er heiser wurde. Und er spürte, dass seine Kräfte langsam nachließen. Es dauerte noch eine Weile, bis die Leute am Ufer auf ihn aufmerksam wurden. Aber dann kamen sie ihm endlich mit einem Motorboot entgegen und halfen ihm aus dem Wasser. Er kniete auf dem Boden und rang nach Atem.
Sogleich machten sie sich auf die Suche nach Daniel. Frank wies ihnen die Richtung. Das war nicht einfach, denn auf dem See gab es keine Orientierungspunkte. Sie fuhren mit dem Motorboot immer weiter hinaus. Frank starrte angestrengt über die glitzernde Wasserfläche. Die Angst fraß sich wie ein glühendes Eisen durch seinen Bauch. Die Männer auf dem Boot schüttelten die Köpfe und wollten umkehren, aber Frank trieb sie weiter. „Nur noch ein paar hundert Meter“, drängelte er.
Plötzlich entdeckten sie Daniel mit dem Fernglas. Sie fuhren heran. Daniel hockte auf dem hölzernen Rumpf, der nur noch wenige Zentimeter aus dem Wasser herausragte. Seine Augen leuchteten froh und sein Grinsen war voller Erleichterung. Er hob lässig grüßend den Arm. „Was hast du so lange gemacht?“, sagte er spöttisch zu Frank. „Hast du Uganda schon vergessen?“
Sri Lanka 2005
Die Viper
Liebe Freunde, die Geschichte, die ich euch zu erzählen habe, berichtet vom Leben, von der Liebe und vom Tod, so wie dies alle guten Geschichten tun und so wie es die Tradition der arabischen Erzählungen verlangt.
Liebe Freunde, die Zeit, in der die orientalischen Märchen entstanden sind, ist lange vorbei. Aber manchmal begegnet man auch heute noch einer verführerischen Prinzessin in der weiten Wüste Afrikas. Manchmal werden aus Männern Helden geboren. Und manchmal geschieht es auch heute noch, dass das vergiftete Blut gebrochener Herzen im glühenden Sand verrinnt und nur die gewaltige Hitze der Sahara die kreisenden Gedanken um Schuld und Verrat in der Seele betäuben kann.
In jenem Sommer führte ich eine Safari in die Wüste hinter dem Chott-Djerid. Meine Kunden traf ich in einem Straßencafé in dem kleinen Berberdorf Kebili. Es war ein junges französisches Ehepaar, wie ich den Reservierungsunterlagen entnahm. Sie kamen etwas zu spät zu dem verabredeten Treffpunkt, aber ich hatte es nicht eilig. Dieses Land und die Wüste gebieten keine Eile, solange man sich ihren Gesetzen fügt. Schon lange war ich aus Europa fort und hier auf Reisen, manchmal von der Erregung des Unbekannten, Unverstandenen gepackt, manchmal in den Reihen der stolzen und eitlen Araber wie ein Freund geborgen, manchmal allein, auch wenn das Alleinsein nicht immer einfach war.
So saß ich gedankenversunken da und genoss die Farben dieses Landes, das strahlende Weiß der Häuser und das Blau, das ich so sehr liebte, in allen Schattierungen, in seiner kraftvollen ruhenden Reinheit, teilweise von rotem und gelbem Lehm geschmückt, so wie es auf den Malereien von August Macke zu sehen ist.
Ein Taxi hielt am Straßenrand und das französische Paar stieg aus. Wir begrüßten uns freundlich. Der Mann namens Pascal war hager, drahtig, wirkte auf den ersten Blick etwas unscheinbar, seine Augen aber sahen mir voller Erwartung und Spannung entgegen. Sein Lächeln beschränkte sich auf die schmalen Winkel seines Mundes.
Die Frau hieß Catherine. Sie hatte ein sonnenverbranntes Gesicht, kurze blonde Haare und bewegte sich auf aufreizende Art. Das Khaki-Kostüm stand ihr gut. Ihr Lachen war laut und herzlich und ihre Augen blitzten provozierend. Ich nahm mir vor, mich in Acht zu nehmen. Ich schmunzelte höflich und verstaute das Gepäck im Landrover.
Wir hatten Verpflegung und Wasser für drei Tage mitgenommen. Die Safari konnte beginnen. Sie führte uns tief hinein in das Gebiet der großen Erg. Hier gab es über hundert Meilen hinweg nur endlose Sanddünen. Wasserstellen waren rar. Nur selten begegnete man anderen Menschen. Der Wüstensand war fein wie Mehl und seine Farbe wechselte zwischen safrangelb und der bleichen fahlen Helligkeit von Stärke. Der Wüstenhimmel war wolkenlos und schien komplett von der riesigen gleißenden Sonne eingenommen zu sein. Die Hitze trieb die Thermometeranzeige auf stellenweise 50 Grad hoch. Ich zog meinen Hut tiefer in die Stirn und wischte mir mit dem Halstuch den Schweiß aus Gesicht und Nacken.
Sicher, die Wüste hat ihren Reiz. Aber der Reiz der Wüste ist nicht von kurzweiliger Art. Die Wüste ist ein schier unbegrenztes Stück Natur, vielleicht der Inbegriff von Natur überhaupt, von erdrückender Gleichförmigkeit, herausfordernd in ihrem Anspruch an den menschlichen Geist, sich selbst zu ertragen, sich selbst genug zu sein. Der Landrover quälte sich mühsam im Vierradantrieb durch den Sand. Ich musste die Dünen schräg über die Luvseite ansteuern, um nicht in den lockeren pulvrigen Tiefen der Leeseite steckenzubleiben.
In den ersten Stunden unserer Fahrt fiel kaum ein Wort. Ich spürte aber, dass Catherine es nicht lange aushalten würde, ohne eine Unterhaltung zu beginnen. Ich betrachtete sie im Rückspiegel. Ihr ganzes Wesen bebte vor Erwartung - Erwartung, die darauf hoffte, es möge zwischen den Menschen im Wagen endlich etwas passieren, Erwartung, die von einer Körper und Geist erfassenden Erregung durchdrungen war.
Pascal wirkte ruhiger und besonnener in seiner Art. Seine seltenen Worte waren sorgfältig gewählt. Er schien mir ein aufmerksam beobachtender Mensch zu sein.
Ich wusste natürlich, dass ich vorsichtig mit meinen Kunden umzugehen hatte. Aber tief in meinem Inneren spürte ich bereits die aufkeimende Hingabe an ein bevorstehendes neues Abenteuer - ein Abenteuer, das für mich noch nicht in Worte zu fassen war, umso geheimnisvoller und gefährlicher jedoch, unwiderstehlich. Die Reifen wimmerten im heißen Sand.
„Was machen Sie sonst noch, wenn Sie nicht gerade auf Safari sind?“, fragte mich Catherine.
„Ich bin Schriftsteller, ich schreibe Geschichten“, antwortete ich.
„Über Ihre Safaris?“
„Hin und wieder, ja!“
„Sie sind wohl ein moderner Karl May, was?“
Catherine sprach mit scharf gewürzter Ironie und lachte herausfordernd. Etwas in ihr war wie ein gieriges Tier. Mein Herz klopfte. Ich gab ihr irgendeine freche Antwort und sah verstohlen zu Pascal. Er nickte bedächtig, zustimmend. Das Spiel war eröffnet. Wir lachten und scherzten miteinander. Wir wurden immer alberner. Worte sprühten in der Luft wie die Funken einer Schmiede. Ein Band wurde geschmiedet, unsichtbar, aber immer fester. Catherine war die Flamme im Mittelpunkt.
Tja, liebe Freunde, wie soll ich es euch sagen, sie machte mich die Hitze der Wüste vergessen. Ich betrachtete sie genauer, wandte meinen Kopf nach hinten. Ihre Augen blitzten immer noch frech. Ihre Lippen glänzten rot und waren leicht geöffnet, und ich stellte mir vor, wie es wäre, sie zu küssen. Der Lauf der Zeit schien bedeutungslos. Ich liebte die Safari und ich liebte das Leben.