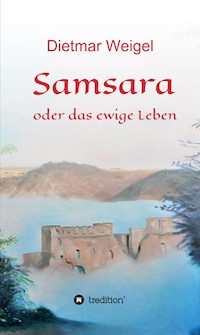
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Klaus Schuster, Anfang fünfzig, hat überraschend seinen Bruder verloren. Er reist nach Indien, um sich von dem Verlust abzulenken. Die Eindrücke des fremden Landes verhindern jedoch nicht, dass die Erinnerungen an die vielen gemeinsamen Jahre wieder hochkommen. Klaus Schuster hält innere Zwiesprache mit seinem Bruder Ralf und betrachtet in der Rückschau ihr Glück und ihre Enttäuschungen, ihre Freiheit und ihr großartiges Leben. Gleichzeitig eröffnet sich ihm die farbenprächtige, schillernde Welt Indiens. Er findet neue Gefährten, setzt sich mit Mythologien, alten Weisheiten und spirituellen Lehren auseinander. Auf abenteuerlichen und nicht immer ungefährlichen Wegen bereist er die Kulturstätten Indiens und verliert dabei sein Herz an die geheimnisvolle schöne Tara. Am Ende begegnet er einer Wahrheit, die erschreckend und heilend zugleich ist, und seine Vergangenheit mit seiner Zukunft verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Autor
Dr. phil. Dietmar Weigel lebt in Rheinland-Pfalz und ist als Lehrer und Schulleiter berufstätig. Er war auf vielen Reisen in Europa, Afrika und Asien unterwegs.
Seit vielen Jahren beschäftigt er sich nebenberuflich mit der Schriftstellerei. Er hat in verschiedenen Autorengruppen im Rhein-Main-Gebiet mitgewirkt und viele Lesungen in Kulturinitiativen, Cafés und Weingütern gehalten. Seine Werke sind in Literaturzeitschriften vertreten. Darüber hinaus sind seine Anthologie (Blaue Dschungelkatzen – 2015) und sein erster Roman (Nix wie weg- 2017) veröffentlicht. Mit dem hier vorliegenden Buch ist sein zweiter Roman erschienen.
Seine Erzählungen sind meist durch Reisen inspiriert. Landschaftliche, kulturelle und mythologische Motive fließen in die Geschichten mit ein und bilden einen farbigen Hintergrund für das fiktionale Geschehen. Schauplätze sind häufig Afrika und Asien.
Die Charaktere begegnen in der Fremde ihren eigenen meist ungelösten Lebensfragen. Sinnliche, tiefenpsychologische und metaphysische Elemente verschmelzen zu einer erzählerischen Dichte. Es entstehen spannungsreiche, abenteuerliche – oft auch bizarre Handlungen.
Beim Göllheimer Kurzgeschichtenwettbewerb 2017 belegte Dietmar Weigel mit seiner Erzählung „Mutprobe“ den ersten Platz. Beim Göllheimer Kurzgeschichtenwettbewerb 2018 belegte er mit seiner Erzählung „Renaturierung“ den zweiten Platz.
Dietmar Weigel
Samsara
oder das ewige Leben
© 2021 Dietmar Weigel
Umschlag, Illustration: Josefine Walther
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-23047-7
e-Book:
978-3-347-23048-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für Volkhard† 2015
Wenn der Abend nahtganz sacht und leis,finden wir uns einim Feuerkreis…
(Erik „Mac“ Martin)
Prolog
„Papa, was brauchen wir alles?“
Der kleine Junge rannte aufgeregt zwischen dem Haus und dem Auto hin und her.
„Mach´ mal langsam“, rief der Vater dem kleinen Jungen aus dem Küchenfenster zu. „Ich habe ja meinen Kaffee noch nicht ausgetrunken.“
Der kleine Junge setzte sich auf die Stufe vor dem Kellereingang und schmollte ein bisschen. Er war jetzt acht Jahre alt – also auf jeden Fall groß genug, um dem Papa bei allen wichtigen Sachen zu helfen. Die Mama fand´s auch toll. Er sollte ja möglichst früh und möglichst viel vom Papa lernen. Sie hatte eigentlich auch nichts dagegen, dass er sich schmutzig machte, na ja, meistens jedenfalls nicht. Heute würden sie Erde umgraben und Blumen pflanzen und gießen. Der kleine Junge war sehr froh, dass er den Papa heute mal für sich alleine hatte. Er wartete ungeduldig. Das war blöd von den Erwachsenen – morgens erst mal stundenlang Kaffee trinken und Zigaretten rauchen, bevor es endlich losgehen konnte.
Aber dann verschwand der Papa endlich vom Küchenfenster und tauchte kurz danach im Kellereingang auf. Er tätschelte seinem Sohn die kurzen blonden Haare, ging über den Hof und öffnete den Kofferraum des Autos. Dann machte er ein nachdenkliches Gesicht und sagte: „Also – wir brauchen den großen Spaten und natürlich auch die kleine Schippe, wenn du mithelfen willst.“
Der kleine Junge lief zurück in den Keller. Er wusste genau, wo alles stand. Der Papa sagte immer „Ordnung ist das halbe Leben“ und wenn etwas nicht auf seinem richtigen Platz war, konnte er ganz schön sauer werden. Der Spaten war also schnell gefunden, aber wo war nur die kleine Schippe abgeblieben? Die hatte ihm die Mama letztes Jahr gekauft, als sie in Italien am Strand waren. Ach ja richtig, die Schippe lag unter der Kellertreppe. Dort lagen auch sein Taschenmesser, sein Lasso und sein Holzschwert. Sowas brauchte man halt, wenn man draußen mit den anderen Kindern spielen wollte.
Der kleine Junge steckte sein Taschenmesser in die Hosentasche und brachte den Spaten und die Schippe nach draußen. Der Papa verfrachtete die Sachen im Kofferraum. „Jetzt brauchen wir noch die beiden großen Gießkannen, die eine mit dem Brausekopf und die andere aus grünem Plastik.“
Der kleine Junge rannte wieder davon, fand die Gießkannen in der Abstellkammer und brachte sie seinem Vater. Der nickte anerkennend und legte die Gießkannen in den Kofferraum. „Ich glaube, wir sollten die Gartenhandschuhe mitnehmen. Die Mama schimpft sonst, wenn wir so schmutzige Fingernägel haben.“
Da war was dran. Die Hosen konnten ruhig schmutzig sein. Das war der Mama egal. Aber schmutzige Fingernägel konnte sie nicht ausstehen. Besonders nicht beim Essen und besonders nicht, wenn Besuch kam. „Man schämt sich ja in Grund und Boden“, sagte die Mama immer. Der kleine Junge verstand zwar nicht, warum man sich wegen schmutziger Fingernägel schämen sollte, aber mit der Mama konnte man über so was nicht reden. Das war zwecklos. Der kleine Junge rannte zurück in den Keller, holte die Gartenhandschuhe und brachte sie seinem Vater. Der machte wieder ein nachdenkliches Gesicht. „Mal überlegen – haben wir auch alles?“
Der Junge klatschte zufrieden in die Hände und öffnete schon die Autotür. Aber dann fiel dem Papa doch noch was ein: „Wir dürfen doch den Blumendünger nicht vergessen!“
Der kleine Junge stand unschlüssig an der Autotür. Er hatte keine Lust mehr, schon wieder in den Keller zu rennen.
„Ist schon gut“, sagte der Papa lachend. „Ich hole das selbst. Ist ja auch zu schwer für dich.“
Also zu schwer war es eigentlich nicht, fand der Junge. Er hatte erst neulich beim Einkaufen einen Sack mit Blumendünger geschleppt. 10 KG hatte darauf gestanden. Das war jedenfalls ganz schön schwer. Gott sei Dank war er ja stark genug. Aber der Papa konnte ruhig auch mal was tragen.
Der Papa brachte den Blumendünger aus dem Keller, hievte den Sack noch in den Kofferraum und machte dann den Kofferraumdeckel zu.
Das wär´ schon mal geschafft, dachte der Junge. Irgendwie war er jetzt schon ein bisschen müde, obwohl die richtige Arbeit noch gar nicht angefangen hatte. Wenn er sich aber genug anstrengte, gab´s danach sicher ein Eis. Das galt für solche Fälle eigentlich als abgemacht.
Gerade als sie losfahren wollten, kam die Mama in den Hof gerannt und schwenkte eine Tasche hin und her. „Ihr habt die Brötchen und den Tee vergessen“, rief sie. Der Papa stieg nochmal aus dem Auto aus, nahm die Tasche und gab der Mama einen Kuss.
Schon wieder dieser blöde Hagebuttentee, dachte der kleine Junge. Eine Flasche Cola wäre ihm viel lieber gewesen. Aber Cola gab´s nur, wenn er Geburtstag hatte. Da konnte man mit der Mama auch nicht drüber reden. Schmutzige Fingernägel und Coca-Cola – das musste für die Mama was ziemlich Schlimmes sein. Aber der Junge tröstete sich mit dem Gedanken, dass es heute Nachmittag ein großes Eis geben würde, mit ganz viel Zitrone.
Die Mama kam zum Auto und öffnete die Autotür. „Na mein Großer, krieg´ ich keinen Kuss?“ Der kleine Junge stöhnte. Wenn sie unbedingt wollte, kriegte sie natürlich einen Kuss. Aber musste das unbedingt jetzt sein? Sie hatten schließlich eine ganze Menge zu tun. Und wenn die Mama ihre komischen Frauenromane las, durfte er ja auch nicht mit ihr schmusen. „Lass mich – ich muss mich konzentrieren“, sagte sie dann immer. Er gab ihr also einen Kuss und dann war´s geschafft. Der Papa stieg ins Auto, und sie fuhren endlich los. Die Mama winkte hinterher.
1.
(Klaus)
Für einen Augenblick war mir schwindelig. Ich stand auf unsicherem Boden und hatte schwarze Punkte vor den Augen. Mein Blick war getrübt und meine Knie wackelten ein bisschen. Aber dann klarte sich alles wieder auf. Ich holte tief Luft und fühlte mich besser. Entschlossen zog ich die Schiebetür des Zugabteils auf und sah in zwei lächelnde, junge Gesichter.
„Hallo, ich bin Krishna. Ich bin ein Gott!“
„Hallo, ich bin Tara. Ich bin eine Träne!“
Na wunderbar, sagte ich mir. Ein Gott und eine Träne – hier biste richtig.
Der junge Mann, der sich Krishna nannte, hatte schwarzes Haar. Es war seitlich kurz geschnitten, aber hinten glitten seine prächtigen Locken bis auf die Schultern herab. In seinem Gesicht strahlten zwei große blaue Augen. Ich war überrascht. Ich hatte noch nie dunkelhäutige Menschen mit blauen Augen gesehen. Und seine Haut war sehr dunkel, fast schon schwarz. Seine leuchtend blauen Augen sahen mich an – fragend und nachdenklich, vielleicht auch ein bisschen spöttisch.
Die junge Frau, die sich Tara nannte, trug ihr Haar zu kunstvoll ineinander verflochtenen Zöpfen hochgesteckt wie eine Krone. Ihre Haarfarbe war bräunlich mit einem Rotschimmer darin. Ihre Hautfarbe hatte einen leicht bronzefarbenen Glanz und war etwas heller, als die ihres Sitznachbarn. Ihr Blick, mit dem sie mich erfasste, war abschätzend, vielleicht ein bisschen herablassend.
Ich stellte mich nun meinerseits vor: „Hallo, ich bin Klaus - weder Gott noch Träne – halt nur irgend so´n Typ, der in der Welt rumlungert.“
Die beiden nickten lächelnd und wissend, so als würden sie mich von irgendwoher kennen, und als hätten sie mich hier erwartet.
Ich stand etwas unschlüssig am Eingang des Zugabteils herum. Außer Tara und Krishna gab es natürlich auch noch andere Menschen, die im Abteil saßen. Aber von denen schien niemand so richtig Notiz von mir zu nehmen. Und keiner machte Anstalten, ein bisschen Platz für mich und meinen Rucksack zu schaffen.
Aber Tara und Krishna rückten auseinander und machten den Platz in ihrer Mitte für mich frei. „Komm, setz dich doch zu uns“, meinte Krishna freundlich.
„Aber ich will euer Beisammensein nicht stören.“
Tara schlug sich auf die Schenkel und lachte. „Keine Sorge“, gluckste sie, „wir hängen ohnehin viel zu oft miteinander rum.“
Krishna ergänzte scherzend: „Und ein Gespräch unter Männern fehlt mir schon lange.“ Tara trat ihm mit gespielter Empörung ans Schienbein. Ich schob also meinen Rucksack unter die Sitzbank und setzte mich.
Eine Weile waren wir still. Der Zug ratterte gleichmäßig über die Schienen. Ich sah durch das vergitterte Fenster auf karge, ausgetrocknete Felder. Die Landschaft wirkte auf den ersten Blick eintönig und leer. Aber überall gab es Menschen, die entweder im steinigen Boden herumkratzten oder vollgeladene Karren durch die Feldwege schoben oder scheinbar nur ziellos dahinwandelten wie Geister ohne Bestimmung. Manchmal waren ganze Menschenschlangen entlang der Bahnlinie aufgestellt und betrachteten den vorbeifahrenden Zug wie ein Phänomen aus einer anderen Welt.
Ich war unterwegs in Indien. Schon oft hatte ich von Indien geträumt. Ich kam aus Deutschland. Mein Name war Klaus Schuster. Ich hatte meinen Bruder Ralf verloren. Klaus Schuster und Ralf Schuster – zwei langweilige Allerweltsnamen - die Telefonbücher waren voll davon. Warum machte ich so viel Aufhebens um mein Schicksal? Traurige Verluste mussten früher oder später alle Menschen verkraften. Manchmal tröstete ich mich mit diesem Gedanken.
Ich hatte meinen Bruder verloren und jetzt war ich hier in Indien. Was ich hier suchte? Schwer zu sagen. Vielleicht einen Weg, mit dem Schmerz fertig zu werden. Vielleicht einen Weg, die Grenze zwischen Leben und Tod zu überwinden. Das war lächerlich. Das war mir klar. Aber ich hatte von Gurus und Sadhus gelesen und von geheimen Weisheiten, die in Jahrtausende alten Schriften verborgen waren. Ich hatte meinen Bruder verloren, aber ich brauchte ihn so sehr.
Der Zug fuhr nach Madras, dem heutigen Chennai. Dort wollte ich die berühmte Kalakshetra-Schule besuchen, ein Institut, in dem die klassischen indischen Tempeltänze gelehrt wurden, und die hinduistische Mythologie, die in den Tänzen ihren Niederschlag fand. Der christliche Glaube in Deutschland hatte mich nie sonderlich berührt. Vielleicht gab es in den Geschichten der hinduistischen Götterwelt eine Erkenntnis, die mir weiterhelfen würde.
Draußen überzog das Licht des späten Nachmittags das Land mit einem fahlen Schimmer, so als sei es aus Gold gegossen und unter dunstbeschlagenen Tüchern geschützt.
Die Waggons des Zuges waren hässlich und schmutzig. Alle Fenster waren vergittert. Es roch nach Schweiß, nach saurem Essen und nach ungereinigten Toiletten. Man hätte meinen können, wir waren in einem Viehtransporter unterwegs. Aber der goldene Schimmer des weiten Landes da draußen war sehr angenehm. Sanftes, heilendes Licht, das durch die Seele floss.
Krishna nahm das Gespräch wieder auf: „Und – bist du nach Indien gekommen, um Erleuchtung zu suchen?“ Seine blauen Augen blitzen frech und herausfordernd.
Noch bevor ich mir eine passende Antwort überlegen konnte, mischte sich Tara ein: „Lass ihn doch in Ruhe. Er muss doch erst mal hier ankommen.“ Da war etwas Mitfühlendes in Taras Worten, das ich ihr auf den ersten Eindruck gar nicht zugetraut hätte. Ich lächelte sie dankbar an und sie lächelte freundlich zurück.
Ich begann von mir zu erzählen: „Wisst ihr, es ist gerade alles nicht so einfach für mich. Aber nach Erleuchtung suche ich eigentlich nicht. Ich suche eher nach neuen Erfahrungen, die mein Leben bereichern können. Ich habe schon viel über Indien gehört und gelesen und ich wollte schon lange mal hierhin. Ich bin einfach neugierig. Und zuhause halte ich es im Moment nicht aus. Ich habe meinen Bruder verloren.“
„Na ja, hier wirst du ihn jedenfalls nicht wiederfinden“, stänkerte Krishna. Das brachte ihm wieder einen Tritt ans Schienbein von Tara ein. Ich sah ihn an. Er kam mir vor wie ein hochmütiger Klugscheißer.
Tara nahm meine Hand und drückte sie leicht. „Hör einfach nicht hin, was er sagt. Er glaubt immer, alles zu wissen, aber er hat keine Ahnung vom wirklichen Leben.“
Krishna zuckte mit den Achseln, lenkte aber ein: „Tut mir leid, Mann. Hab´s nicht so gemeint.“ Er hielt mir die Hand hin. Ich schlug ein und damit war´s wieder gut. „Was willst du eigentlich in Madras machen?“
Ich erzählte ihnen von meinem Vorhaben, die Kalakshetra-Schule zu besuchen.
„Na, dann kommen wir mit. Wir begleiten dich“, erklärte Tara fröhlich.
Ich freute mich über diesen Vorschlag, aber ich war auch verunsichert. „Habt ihr denn nichts anderes zu tun, als einen deutschen Touristen durch die Gegend zu führen?“
„Das ist kein Ding, Alter“, meinte Krishna entschieden. „Im Moment sind wir frei und brauchen uns um nichts anderes zu kümmern.“ Tara nickte bestätigend.
Ich wollte schon fragen, was die beiden eigentlich sonst noch so taten, zum Beispiel wie sie ihr Geld verdienten. Aber von meinen Reisen durch Afrika wusste ich, dass es unter Travellern verpönt war, von der Arbeit zuhause zu sprechen, oder gar mit beruflichem Erfolg zu protzen. Das galt sicher auch bei den Travellern in Indien so. Ich hatte Zeit – gut. Tara und Krishna hatten anscheinend auch Zeit – auch gut. Mehr brauchte ich gar nicht zu wissen. Es konnte vielleicht ganz interessant und vergnüglich werden, mit den beiden eine Weile gemeinsam unterwegs zu sein.
Ich sah mir die anderen Reisenden im Zugabteil genauer an. Da war eine alte, rundliche Frau mit silbergrauem Haar, in einen blauen, goldumsäumten Sari gekleidet. Sie saß in der Ecke zum Gang hin. In der Mitte saßen zwei junge Männer in fleckigen dunklen Hosen und beigefarbenen, verschwitzten Hemden. Sie hatten ihre blanken Füße auf zwei große Bündel gestemmt, so als bewachten sie damit eine wertvolle Fracht. Dann war auf der Bank eine Lücke, die ich anfangs gar nicht bemerkt hatte.
Und schließlich saß dann an der Fensterseite ein vornehm wirkender älterer Herr in schwarzem Geschäftsanzug mit Krawatte und auffallender silberner Krawattennadel. Mein Blick blieb an der Krawattennadel hängen. Ein Symbol war darauf angebracht – eine kleine Erdkugel, über die eine helle, dünne Schnur zu verlaufen schien. Ich konnte es nicht genau erkennen. Der Mann saß mir schräg gegenüber. In freundlicher Absicht suchte ich seinen Blick. Aber er starrte aus dem Fenster und rührte sich keinen Millimeter, so als seien die Menschen um ihn herum die reinste Zumutung für ihn, und als gehöre er eigentlich in eine ganz andere und erhabenere Welt.
Krishna stieß mich von der Seite an und flüsterte in mein Ohr: „Den musst du in Ruhe lassen.“
Ich verstand nicht.
„Komm, wir gehen mal raus auf den Gang“, forderte mich Krishna auf, „ein bisschen die Füße vertreten.“ Also folgte ich ihm nach draußen. Tara lächelte uns hinterher.
Krishna und ich standen am Fenster im Gang. Die Landschaft draußen verlor allmählich ihren Glanz. Die Dämmerung setzte ein und die Farben wurden stumpf.
Krishna erklärte: „Weißt du, dieser Mann, den du so genau angesehen hast, gehört zur Kaste der Brahmanen. Er hält sich für was Besseres. Die Brahmanen wollen mit den unteren Kasten und mit den Kastenlosen so wenig wie möglich zu tun haben.“
Vom indischen Kastensystem hatte ich natürlich schon gehört. Ich wollte mehr darüber erfahren, aber ich traute mich nicht so recht, Krishna danach zu fragen. Er war ja selbst ein Inder und schnell konnte man jemandem mit solch schwierigen Fragen zu nahe treten. Aber er schien meine Gedanken zu erraten und nickte mir auffordernd zu: „Das beschäftigt dich, stimmt`s?“
Ich suchte nach Worten. „Es ist also wahr, dass die unteren Kasten als unrein gelten?“
„Zunächst musst du wissen, dass es vier Hauptkasten gibt – Brahmanen, Kshatryas, Vaishyas, Shudras. Die Brahmanen sind entweder Priester oder haben hohe Stellungen in Politik und Wirtschaft. Darunter sind auch noch Abkömmlinge der ehemaligen Maharadschas. Die Kshatryas sind meistens leitende Beamte oder Angestellte in der Verwaltung oder beim Militär oder bei der Polizei. Die Vaishyas sind in der Regel Landwirte und die Shudras sind Diener und Hausangestellte.“
Krishna machte eine Pause. Aber ich merkte, dass er mit seinen Ausführungen noch nicht fertig war und ich wollte jetzt nicht dazwischen quatschen. Also fuhr er fort: „Neben den Kastenangehörigen gibt es noch die Kastenlosen, die sogenannten Parias. Sie verrichten die niedrigsten Dienste, also Straßenkehren, Müllabfuhr, Klos putzen und so weiter.“
„Letzteres wäre hier im Zug dringend mal nötig“, bemerkte ich. Krishna zuckte mit den Achseln. „Wenn grad keine Parias da sind, die es für einen Hungerlohn oder ein kleines Trinkgeld machen, dann bleibt der Dreck eben liegen. Andere kümmern sich jedenfalls nicht darum.“
„Du meinst, es ist für die höheren Kasten unter ihrer Würde?“
„Nein, das trifft es noch nicht genau. Es hat eher mit der Überzeugung zu tun, nicht zuständig zu sein. Man mischt sich sozusagen nicht in fremde Angelegenheiten ein.“
Das alles verstieß entschieden gegen mein Gerechtigkeitsempfinden. Ich wollte schon meinem Unmut Luft verschaffen, aber Krishna berührte beschwichtigend meinen Arm und redete weiter: „Die ganze Sache mit den Kasten ist für Europäer schwer zu verstehen, ich weiß. Letztlich funktioniert das Kastensystem auch nur, weil strenggläubige Hindus meinen, ihre jetzige Lebenssituation durch ihr früheres Leben verdient zu haben, im Guten wie im Schlechten. Es wird praktisch so gesehen, dass es sich jeder selbst zuzuschreiben hat, ob er in einer höheren oder niederen oder in gar keiner Kaste wiedergeboren wurde. Deshalb nimmt auch jeder sein Schicksal an, wie es ist. Erst wenn man hier seine Pflichten gut erfüllt, kann man im nächsten Leben in eine höhere Kaste aufsteigen. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche.“
„Na ja, es klingt für mich eher so, als hätte man diesen Glauben nur als Vorwand benutzt, um den Reichtum für die Reichen zu sichern und die Armut bei den Armen zu belassen.“ Mir wurde schlagartig klar, dass meine Sichtweise aus hinduistischer Sicht sehr fremd wirken musste.
Krishna schmunzelte. „Du hast nicht ganz unrecht. Die kritischen Denker in unserem Lande werfen den Priestern vor, eine Stelle in den Upanishaden ganz bewusst falsch ausgelegt zu haben, woraus wiederum zu schließen wäre, dass das Kastensystem gar kein göttlicher Wille ist.“
Mir fiel die problematische und blutige Geschichte der christlichen Kirche ein. „Überall dasselbe“, brummelte ich etwas missmutig.
Krishna erzählte weiter: „Was die Verteilung des Reichtums anbelangt – es gibt tatsächlich viele Ausnahmen. Es gibt Brahmanen, die völlig verarmt sind, auch wenn sie in spiritueller Hinsicht hoch angesehen sind. Und es gibt Shudras, die sehr vermögend sind, besonders dann, wenn sie Geschäfte und Dienstleistungen in großen Familienclans organisiert haben. Und trotzdem sind sie bei gesellschaftlichen Anlässen nicht willkommen.
„Das alles kapiert doch kein Mensch!“, wandte ich ein.
„Na ja, man muss eben das Alltägliche und das Religiöse unterscheiden,“ antwortete Krishna. „Im Alltag lassen sich höhere Kasten ja durchaus mit niederen Kasten ein, zum Beispiel bei der Essenszubereitung oder bei der Haushaltsführung oder auch beim Frisör. Bei religiösen Zeremonien käme das aber niemals in Frage. Die Zubereitung von Opferspeisen und das Haareschneiden bei heiligen Handlungen muss unbedingt ein Brahmanenpriester übernehmen. Würde ein Shudra das in solchen Fällen tun, wäre das gleichbedeutend mit einer seelischen, spirituellen Verunreinigung. Parias dürfen bei heiligen Handlungen nicht mal in der Nähe sein. Sie werden weggejagt.“
Ich dachte nach. „Das würde ja erklären, dass viele Inder so oft über Reinheit sprechen, obwohl sie andererseits die unhygienischen Verhältnisse ihres Landes so völlig sorglos hinnehmen.“ Krishna klatschte demonstrativ in die Hände. „Du hast es geschnallt, mein Junge.“
„Was ist eigentlich mit den Frauen hier in Indien?“, wollte ich wissen. „Man hört doch nur Schlimmes.“
Krishna seufzte. Zum ersten Mal wirkte er etwas ratlos. „Das ist ein Riesenproblem. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Da sprichst du am besten mit Tara drüber.“
„Sag mal, du und Tara – wie steht ihr eigentlich zueinander? Seid ihr ein Paar? Oder Geschwister? Oder Freunde? Und zu welcher Kaste gehört ihr denn eigentlich?“
Krishna lachte lauthals drauflos. Ich wusste beim besten Willen nicht, warum. Ich musste ihn offenbar ziemlich entgeistert angestarrt haben, denn er hörte auf zu lachen und sagte: „Mach den Mund wieder zu – und um deine Fragen zu beantworten: Ich bin ein Gott und Tara ist eine Träne! Was kümmert uns der Rest? Das wirste mit der Zeit schon noch verstehen, mein Junge.“
Ich verstand absolut gar nichts. Vielleicht waren Krishnas Worte eine Provokation. Vielleicht handelte es sich aber auch nur um einen Spleen und um dummes Geschwätz. Ich konnte es nicht einordnen, hatte aber auch keine Lust, mich weiter damit zu befassen. Wir gingen zurück ins Zugabteil und ließen uns wieder auf unseren Plätzen nieder.
Es war dunkel geworden. Im Abteil brannte nur eine kleine trübe Funzel. Ich konnte die Personen auf den Bänken nur noch schemenhaft erkennen. Die meisten schienen eingedöst zu sein. Aber ich war hellwach. Wie immer, wenn ich allein meinen Gedanken nachhing, war da ein Sumpf von Traurigkeit in mir. Er zog mich immer stärker hinab. Das war früher nie so gewesen. Aber früher hatte ich mit meinem Bruder Ralf das Leben genossen, so als gäbe es kein Ende.
Dass du hier in Indien rumgammelst, macht ihn auch nicht wieder lebendig, sagte ich mir. Krishna hatte mit seiner blöden Bemerkung schon recht gehabt. Hier würde ich meinen Bruder ja auch nicht wiederfinden.
Eine kleine, warme Hand schlich sich in meine. Tara rückte an mich heran. Sie lehnte ihren Kopf an mich und ich lehnte meinen Kopf dagegen. Krishna schien es nichts auszumachen. Er sagte nichts und rührte sich nicht. Offenbar war Tara wohl wirklich nicht seine Geliebte. Das sollte mir verdammt nochmal sehr recht sein.
„An was denkst du grad?“, flüsterte sie nahe an meinem Ohr.
„Hm – so dies und das.“
„Bist du traurig?“
„Hm – ja – ein bisschen.“
„Irgendwann wirst du es vergessen haben.“
„Ich will doch meinen Bruder nicht vergessen.“
„Dass es weh tut, meine ich.“
„Wie soll das gehen – vergessen und doch nicht vergessen?“
Tara schien nachzudenken. Plötzlich rückte sie etwas von mir ab, richtete sich auf und sah mich an. In der Dunkelheit schimmerten ihre mandelförmigen Augen wie Edelsteine. „Es gibt ein altes Ritual. Ich weiß nichts Genaues darüber, aber es stammt wohl aus dem vedischen Zeitalter, ist über dreitausend Jahre her. Es heißt, mit diesem Ritual könnten die Menschen aus ihrem eigenen Körper heraus, also ihr Selbst und ihr Leben betrachten, ohne es aber mitempfinden zu müssen. Das würde dir doch helfen.“
„Ich glaube nicht an Zauberei!“
„Es ist keine Zauberei, es ist ein Ritual!“
„Lass uns morgen darüber reden.“
Tara kuschelte sich wieder an mich. „Also ihr in Europa, ihr glaubt doch auch an Schizophrenie, an psychische Abspaltungen, an multiple Persönlichkeiten und so weiter.“
„Woher weißt du das alles?“
„Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich hier in Indien nicht nur den ganzen Tag im schlammigen Fluss bade und Lieder für Shiva singe. Wie es der Zufall so will, habe ich auch noch Lesen und Schreiben gelernt.“
„Ich find´ dich voll klasse!“, murmelte ich in ihren schlanken Nacken. Sie knuffte mich mit dem Ellbogen in die Seite. Dann waren wir still.
Im Abteil waren lange tiefe Atemzüge zu hören und hier und da auch ein leises Schnarchen. Das gleichförmige Rattern des Zuges machte mich ebenfalls schläfrig. Meine Augen fielen zu.
Aber meine Gedanken verfolgten mich weiter und ich versuchte, mir vorzustellen, wie das war, aus seinem Körper herauszutreten – vielleicht wie ein Nebel, wie ein Gesicht oder wie ein Gnom, der aus dem Mund oder der Nase oder dem Bauchnabel kam, und dann den Körper beäugte, vielleicht sogar bis hinter die Stirn oder bis tief ins Herz hineinschauen konnte.
In meinem Halbschlaf kam Ralf auf mich zu und umarmte mich. „Ich hab´ was Tolles für dich“, sagte er, und stellte mir ein großes Glas Rotwein hin. Erst mal die Farbe prüfen, das war ja klar. Aber es war gar nicht so einfach. Im Wein schwamm ein milchiges Gesicht. „Können wir morgen darüber reden?“, fragte ich Ralf. „Ist nicht schlimm“, sagte er nur.
So´n Quatsch, fiel mir ein. Ralf würde mir doch nie einen Wein mit einem darin schwimmenden Gesicht anbieten. Er achtete doch auf Qualität.
Ich wusste, dass ich träumte. Und ich wusste auch, wenn man weiß, dass man träumt, dann wird man wach. Ich wurde wach. Ralf hatte seinen Arm um meine Schultern gelegt. Aha, Gott sei Dank. Er war gar nicht tot. Das hatte ich nur geträumt. Aber dann ging ein richtiger Ruck durch meinen Körper und ich schrak auf.
Taras Arm war von meiner Schulter gefallen. Sie brummte irgendwas schlaftrunken vor sich hin und dreht sich halb auf die andere Seite. Mir war heiß. Ich wischte mir mit dem Hemdsärmel übers Gesicht und nahm ein paar Schlucke aus meiner Wasserflasche. Ich lehnte mich wieder zurück, versuchte, mich zu entspannen und wieder Schlaf zu finden, obwohl ich Angst vor den Träumen hatte.
Aber da spürte ich instinktiv, dass die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen auf mir ruhte. Der Brahmane mit der silbernen Krawattennadel sah mich an. Trotz der Dunkelheit konnte ich seinen durchdringenden Blick erkennen. Erst war ich überrascht. Ich begegnete seinem Blick mit Neugier und nickte im höflich zu. Aber der Brahmane grüßte nicht zurück. Und allmählich erstarrten unsere Augen zu metallisch blitzenden Klingen, so als wollten wir uns gegenseitig unsere Schädel durchbohren…
2.
(Ralf)
„Jetzt ist´s aber genug mit diesem Blödsinn!“ Der Papa durchschritt energisch das Wohnzimmer, schnappte sich die Fernbedienung vom Tisch und schaltete das Fernsehprogramm um. „Ich will jetzt die Sportschau sehen!“
Ralf hätte gern noch die Folge von Daktari zu Ende gesehen. Der gutmütige, schielende Löwe Clarence hatte gerade die Einbrecher verjagt. Aber nun stand die Tür zur Küche offen und die Schimpansin Judy sprang auf dem Küchenschrank herum, öffnete die Dosen mit den Haferflocken, dem Mehl, dem Kaffee, ließ alles auf den Boden rieseln und kippte die Milch drüber. Das hätte noch richtig super werden können. Aber wenn Papa die Sportschau gucken wollte, dann war da nichts zu machen. Ralf war sechs Jahre alt. Was hätte er schon machen sollen? Ralf schaute etwas unschlüssig zu seinem größeren Bruder herüber. Klaus war schon zehn. Aber der würde sich natürlich auch nicht mit dem Papa anlegen. Eine Weile sahen sie also auf dem flimmernden Schwarz-Weiß-Bildschirm den Fußballspielen zu, aber dann verdrückten sie sich. Etwas Langweiligeres als die Sportschau gab´s auf der ganzen Welt nicht. Da waren sie sich einig.
Vielleicht war draußen auf dem Spielplatz noch was los. Das konnte man schnell rauskriegen, wenn man aus dem Küchenfenster sah. Der Spielplatz war gleich gegenüber. War natürlich kein Mensch mehr da. Brauchte einen auch nicht zu wundern, denn jedes normale Kind schaute sich jetzt Daktari im Fernsehen an. Unser Papa ist strenger als die anderen, glaubte Ralf. Die anderen Kinder haben´s viel besser als wir.
Sie knieten auf der Eckbank, drückten ihre Nasen an der Fensterscheibe platt und sahen hinaus in den dunkelnden, herbstlichen Samstagnachmittag. Klaus schmollte vor sich hin: „Morgen werden die anderen wieder alles von Daktari erzählen, und wir wissen nichts.“
Ralf überlegte, wie er seinen älteren Bruder trösten konnte. Aber es fiel ihm nicht wirklich was Gutes ein. „Was ist eigentlich bei Daktari dein Lieblingstier?“, fragte er stattdessen. „Meins ist die Judy“, schob er gleich hinterher. Er wollte nicht, dass ihm jemand die Schimpansin streitig machte.
„Ach herrjee – Judy, dieser blöde Affe“, erwiderte Klaus immer noch schmollend. „Die Judy ist doch nur was für die Kleinen.“
Ralf ärgerte sich ein bisschen. Er war zwar erst sechs, aber klein war er nicht mehr. Nächsten Sommer kam er in die Schule. Er grübelte darüber nach, welches Tier wohl seinem Bruder gefallen mochte. Vielleicht Clarence, der schielende Löwe? Aber er ahnte, dass ein schielender Löwe nicht gefährlich genug war, um seinen Bruder zu beeindrucken. Dann schon eher der große Elefant, der bei Daktari im Garten stand und die lauten Trompetenstöße von sich gab, wenn Inspektor Hadley in seinem Jeep zu Besuch kam.
Sie ließen sich der Länge nach auf der Eckbank nieder und steckten die Köpfe zusammen. Klaus fing an zu reden: „Ich weiß, wie wir´s machen…“ Klaus holte tief Luft. Und Ralf war total gespannt. Sein Bruder hatte immer super Ideen. Da würde sonst kein Mensch draufkommen. „Wir denken uns einfach eine neue Daktari-Geschichte aus - also eine, die gar nicht im Fernsehen war. Und morgen auf dem Spielplatz – da bauen wir das nach. Also das Krankenhaus für die Tiere, meine ich, und das Lagerhaus für das Futter und auch den Schrank für die Gewehre mit den Betäubungsspritzen, falls ein Nashorn angerannt kommt, oder so.“
Ralf war sofort begeistert. Na klar, da würden auch die anderen Kinder staunen. „Und was macht die Judy?“
„Nerv´ mich nicht mit deiner blöden Judy!“
Ralf boxte Klaus in die Rippen. Man konnte sich schließlich nicht alles von seinem großen Bruder gefallen lassen. Klaus schubste ihn daraufhin fast von der Bank. Es hätte vielleicht eine richtige Keilerei gegeben, aber Mama kam aus dem Flur in die Küche und rief: „Hört auf, euch zu streiten. Kommt ins Badezimmer. Auf geht´s.“
Na klar, samstags war immer Baden angesagt. Normalerweise konnte einem das mitten im Spiel total den Spaß verderben. Aber heute stand ja eh nichts mehr an. Baden war vielleicht gar nicht so schlecht, fand Ralf. Er krabbelte unter die Eckbank, um dort das Motorboot hervorzuholen, das er gestern aus Legosteinen gebaut hatte und hier vor dem Zugriff seines Bruders versteckt hatte. Das Boot würde er in der Badewanne schwimmen lassen.
Aber Klaus musste natürlich gleich wieder stänkern: „Das Ding schwimmt doch eh nicht. Das ist doch nicht dicht.“
„Und ob das schwimmt!“, widersprach Ralf. Lego ist doch aus Plastik und Plastik schwimmt. Stimmt doch, Mama, oder?“
Aber die Mama verdrehte nur genervt die Augen und ging voran ins Badezimmer. Sie drehte den Wasserhahn auf.
„Ich will ganz viel Schaum!“, sagte Ralf.
„Auf keinen Fall!“, sagte Klaus. „Ich will die Taucherbrille ausprobieren und der Schaum macht das Wasser trüb. Dann kann man ja gar nichts sehen.“
„Ha ha, als ob hier ein Hai drin wäre.“
„Was verstehst du schon von Haien.“
„Na über Haie weiß ich mehr als du. Im YPS-Heftchen war ein Foto von einem Hai. Der hat ein ganzes Fahrrad gefressen.“
„Vielleicht frisst er dir endlich den Kopf ab.“
„Und vielleicht frisst er dir endlich den Pimmel ab.“
„Ihr seid unerträglich, ihr beiden!“, jammerte die Mama. „Womit hab´ ich das bloß verdient?“
Sie einigten sich auf ganz wenig Schaum. Die Jungs ließen ihre Klamotten fallen und stiegen vorsichtig ins heiße Wasser. Es war gar nicht so einfach, in der Wanne Platz zu finden. Denn schließlich mussten das Lego-Boot, die Taucherbrille, die große leere Spüli-Flasche, die Wasserspritzpistole, der Gummi-Dinosaurier, ein kleiner Plastikeimer, eine Plastikschippe und zwei Seifenblasenröhrchen auch noch darin untergebracht werden.
Ralf wollte schon nach seinem Boot greifen, aber Mama schob es zur Seite. „Zuerst mal richtig waschen“, ordnete sie an. Also Abschrubben mit dem Waschlappen. Da kam man nicht dran vorbei. Am schlimmsten war das Haarewaschen, fand Ralf. Wie immer bekam er Seife in die Augen. Es kamen ihm ein paar Tränen, aber er dachte an sein Motorboot und den Dinosaurier, den er darauf schwimmen lassen wollte. Das half ein bisschen, und dann war die ganze Waschprozedur auch endlich vorbei. Die Mama atmete erleichtert auf. Ralf fand das komisch, denn die Mama hatte ja schließlich kein Haarewaschen über sich ergehen lassen müssen.
Mama sagte: „Also ihr beiden, ich lass´ euch jetzt eine Weile allein. Aber nicht mehr als eine halbe Stunde. Dann wird das Wasser zu kalt. Vertragt euch bloß und stellt mir keinen Unsinn an!“ Die Jungs nickten artig.
Als Mama endlich rausgegangen war, schnappte sich Ralf das Lego-Boot und den Gummidinosaurier. Klaus setzte sich die Taucherbrille auf und tauchte unter. Ralf musste feststellen, dass durch die Ritzen zwischen den Lego-Steinen Wasser eindrang und das Boot ziemlich schnell unterging. Dafür schwamm der Gummi-Dinosaurier von ganz allein auf der Wasseroberfläche. Klaus war mittlerweile wieder prustend aufgetaucht. „Hab´ doch gleich gesagt, dass dein Scheiß-Boot nichts taugt.“
„Das kommt nur, weil du mir kein Platz lässt“, verteidigte sich Ralf. „Mit deinem blöden Tauchen machst du zu viele Wellen.“
Aber Klaus störte sich nicht im Geringsten daran, sondern tauchte erneut der Länge nach unter. Das Wasser schwappte über den Badewannenrand. Auf dem Fliesenboden entstanden die ersten Pfützen. Ralf tastete nach dem Lego-Boot, aber sein tauchender Bruder war im Weg. Also stieß er ihm wütend das Knie in die Seite.
Klaus kam wieder hoch. „Du bist doch nur neidisch, weil du dich selbst nicht unter Wasser traust!“, schnauzte er seinen jüngeren Bruder an. Das stimmte zwar, aber das machte Ralf nur noch wütender. Er packte den Gummi-Dinosaurier am Schwanz und warf ihn nach Klaus. Der duckte sich rechtzeitig und das Ding fegte die Zahnputzbecher von der Spiegelablage. Es gab ein ziemliches Geschepper. Erschrocken hielten die Jungs inne. Aber draußen schien es niemand gehört zu haben. Gott sei Dank.
„Da siehst du, was du gemacht hast“, sagte Klaus.
„Du bist doch schuld“, entgegnete Ralf. „Ich brauch´ einfach mehr Platz für mein Boot.“
„Nerv´ mich nicht mit deinem verkackten Boot!“
„Das ist kein verkacktes Boot!“
„Dieses verkackte Boot hätt´ vielleicht besser ´n U-Boot werden sollen!“
„Du bist selber verkackt – verkackt, verkackt, verkackt!“
Das ließ sich Klaus nicht gefallen. Er füllte rasch den Plastikeimer und schüttete Ralf eine volle Ladung von der seifigen Brühe mitten ins Gesicht. Das meiste Wasser schoss aber über den Wannenrand hinaus. Die Pfützen auf dem Fliesenboden verbanden sich zu einem kleinen See. Die dunkelbraunen Fußmatten lösten sich schon von der Stelle. Ralf hatte wieder Seife in die Augen gekriegt. „Das sag´ ich der Mama!“, schimpfte er weinerlich. Für einen Augenblick war dann Ruhe.
„Ich hab´ eine Idee“, erklärte Klaus schließlich. „Wir könnten doch eine Befreiung spielen. Also da unten wär´ ein U-Boot. Darin wären die Menschen eingeschlossen. Ich wär´ ein Taucher und würde ein Loch in das U-Boot schweißen. Du hättest einen Kran auf einem Floß und würdest die Menschen nach oben ziehen. Dann käme ein Wasserflugzeug und würde alle ins Krankenhaus fliegen.“
Ralf dachte nach, während er sich die Seife aus den Augen rieb. Aber er fand die Idee eigentlich ganz gut und hatte im Moment auch keine Lust auf weiteren Streit. Also griff er nach der Spüli-Flasche. „Das ist mein Floß“, sagte er.
Klaus nickte zufrieden, holte tief Luft und tauchte wieder unter. Die Spüli-Flasche war halb mit Wasser gefüllt. Ralf platzierte sie in einem kleinen Häufchen Badeschaum. Dann nahm er die Wasserspritzpistole, hielt sie mit der rechten Hand hoch in der Luft, bewegte sie wie ein Flugzeug und ahmte summend das Motorengeräusch nach. Klaus ließ unter Wasser Luftblasen aufsteigen. Die Spüli-Flasche trieb davon. Ralf versuchte, sie mit der linken Hand zu erreichen. Da er sich aber nicht mehr am Wannenrand abstützen konnte, rutschte er mit seinem Hintern in der Wanne herum, verlor das Gleichgewicht, tauchte ungewollt unter und stieß dabei seinen Ellbogen in Klaus´ Gesicht. Die beiden Jungs kamen fast gleichzeitig prustend und schimpfend wieder hoch. Das Wasser schwappte mit sattem Klatschen auf den Fliesenboden. Die Wanne leerte sich merklich.
„Du weißt überhaupt nicht, wie man richtig spielt!“ Klaus war böse.
„Und du machst dich so fett wie ein Schwein!“ antwortete Ralf.
„Du bist so ein Doofkopp - mit dir spiel´ ich nie wieder!“
„Selber Doofkopp - du hättest mich fast ertrinken lassen – das sag´ ich der Mama!“
Klaus schnappte sich schnell die Spüli-Flasche und drückte den dicken Strahl direkt in Ralfs Gesicht. „Jetzt kannste absaufen, du Penner, mir doch egal.“ Der Wasserstrahl zog noch einen weiten Bogen über das Alibert-Schränkchen, über die hübsch drapierten Toilettenpapierrollen auf der Kommode und über die Aquarellbilder aus der Lüneburger Heide, die über der Kloschüssel hingen.
Ralf hielt schützend die Hände vors Gesicht und strampelte mit aller Kraft mit den Beinen. Das hatte zur Folge, dass Klaus auch eine richtige Dusche abkriegte. Es hatte allerdings weiterhin zur Folge, dass die Wanne nur noch halb voll war, während der See auf dem Fliesenboden immerhin auf Knöchelhöhe anstieg.
Als die Spüli-Flasche leer war, konnte Ralf seine Hände vom Gesicht wegnehmen und endlich mit der Plastikschippe nach seinem Bruder werfen. Diesmal traf er ihn am Kopf. Aber Klaus rächte sich, indem er die Seifenblasenröhrchen Ralf entgegenschmiss. Dabei lösten sich die Verschlüsse und die ganze ölige Seifenblasenbrühe verteilte sich in der Wanne. Unter dem Gestrampel stiegen jede Menge dicker, bunt schillernder Blasen auf, schwebten durchs ganze Badezimmer und hinterließen ihre Schlieren auf der geriffelten Fensterscheibe, auf dem Spiegel, an den Wänden und auf der Tür.
Ralf konnte die Taucherbrille erhaschen, schwang sie am Gummiband herum und wollte sie mit aller Kraft auf Klaus´ Kopf niedersausen lassen. Aber Klaus richtete sich halb auf, konnte Ralfs Arm abfangen und versuchte, die Taucherbrille zurück zu ergattern. Sie zerrten beide hin und her, bis die Taucherbrille plötzlich durchs Badezimmer schoss, zuerst einen Riss im Kunststoffgehäuse der Deckenlampe verursachte und schließlich die Blumenvase und den Glasperlenschmuck auf der Fensterbank zerdepperte. In dem Moment kam Mama rein.
„Ich war´s nicht!“, erklang es gleichzeitig aus den Mündern der beiden Jungs
Mama hatte sicher schon nichts Gutes geahnt, als sie im Flur die Wasserlache sah, die unter der Badezimmertür hervorkam. Nun stand sie inmitten eines Teiches, betrachtete ihre durchweichten Hausschuhe, von denen nur noch die rosafarbenen Bommeln herausragten, rechts und links von schwimmenden Zahnputzbechern eingerahmt, dahinter die dunkelbraunen Fußmatten, wie matschige Inseln im trüben Gewässer treibend.
Dann ließ sie ihren Blick von links nach rechts durchs Badezimmer schweifen, sah das klumpige nasse Klopapier auf dem selbst gehäkelten Deckchen der Kommode, sah die vielen öligen Schlieren, die überall in dicken Tropfen endeten und sah die Scherben der hellgrünen Blumenvase und des Glasperlenschmucks, den sie sich erst vor wenigen Wochen zu ihrem Geburtstag aus einem Katalog bestellt hatte.
Dann blickte sie nach oben, sah die kaputte orangefarbene Deckenlampe, die sie ihrem Mann mit Mühe letztes Jahr im Toom-Markt abgeschwatzt hatte, weil sie so gut zur Gesamteinrichtung passte. In selben Augenblick löste sich von der Deckenlampe eine große bunte Seifenblase, segelte herab und zerplatzte mitten in ihrem Gesicht.
Normalerweise hätte sich Ralf über sowas kaputtgelacht. Aber diesmal traute es sich das nicht. Mama sah ganz weiß aus, so weiß, als ob sie gleich tot wäre. Ralf war daher ganz froh, als endlich die tiefen Falten über Mamas Nase erschienen und das Donnerwetter losging. Es fing an mit „Ihr seid wohl völlig verrückt geworden!“. Es folgte „Man kann euch nicht fünf Minuten allein lassen!“. Es ging weiter mit „Ihr kriegt einfach alles kaputt. Ihr seid die schlimmsten Blagen, die es gibt!“. Dann kam „Euch geht´s einfach zu gut, ´ne Tracht Prügel hättet ihr verdient!“. Jetzt brauchte Mama eine kleine Pause. Ralf merkte, dass sie nach Luft schnappte und mit den Tränen zu kämpfen schien. Ein bisschen leid tat sie ihm schon. Und die beiden Falten über ihrer Nase – die waren heute ganz schön tief. Die waren sowas von tief, die gingen fast bis auf den Knochen.
Mama brachte ihre nächsten Worte hervor: „Den ganzen Tag plagt man sich mit euch ab und das ist der Dank dafür!“
Wenn diese Worte erstmal gefallen waren, war das Schlimmste vorbei. Das wusste Ralf. Und dann kam auch schon der Schlusssatz: „Womit hab´ ich das bloß verdient?“
„Wir machen´s auch nie wieder“, sagte Ralf etwas kleinlaut, obwohl er sich da selbst nicht so hundertprozentig sicher war.
„Bitte sag´s nicht dem Papa“, fügte Klaus noch hinzu. Na klar, auch das musste raus. Schließlich hatten sie keine Lust, am Ende wirklich noch Dresche zu kriegen.
Mama machte ein ziemlich finsteres Gesicht, aber sie begann aufzuräumen und scheuchte die Jungs aus dem Bad raus ins Kinderzimmer. Dort zogen sich ihre Jogging-Anzüge an und warteten diesmal ziemlich tatenlos, bis sie zum Abendessen gerufen wurden.
Die Jungs aßen ihre Salami-Schnitte und tranken ihren Kakao. Mama hatte sich zu ihrem Leberwurstbrot ein paar Gurkenscheiben aufgeschnitten. Papa aß wie jeden Samstag-Abend seinen fürchterlich stinkenden Käse mit Kümmel und Zwiebeln. Das roch im ganzen Haus. Niemals hätten Ralf und Klaus sowas runtergekriegt. Gott sei Dank wurden sie nicht gezwungen, diesen scheußlichen Käse zu probieren. Bei Rosenkohl und Lauchgemüse war´s anders. Da mussten sie ran, ob sie wollten oder nicht. Ralf erinnerte sich, dass er von dem Lauchgemüse einmal auf den Teller gekotzt hatte. Dabei hatte die Mama auch ein paar ganz schön tiefe Falten über der Nase gekriegt. Na ja – vielleicht nicht ganz so tief, wie heute im Badezimmer.
Ralf stieß seinen Bruder möglichst unauffällig mit dem Ellbogen an. „Du bist heute dran mit Fragen“, flüsterte er ihm zu. Klaus flüsterte zurück: „Lass mich doch in Ruhe, ich mach´ das schon noch.“ Aber Ralf drängelte weiter: „Es ist schon gleich acht Uhr.“
Mama hatte mitgekriegt, dass was im Busch war. „Was ist denn jetzt schon wieder los mit euch beiden?“.
„Wir wollten fragen, ob wir heute noch ein bisschen Fernsehen gucken dürfen. Es kommt doch ein Film mit Luis de Funès“, erklärte Klaus zaghaft.
„Lüü dingsbums – was ist´n das wieder für´n Quatsch?“, wollte Papa wissen.
„Ist doch egal“, wand Mama ein. „Heute Abend kommen doch die Schmidts zu Besuch. Heute ist mal was für die Erwachsenen. Es geht nicht immer nur nach eurem Kopf!“
Mama tat fast so, als wären die Schmidts ihre besten Freunde. Dabei zog sie immer mächtig über sie her, kaum dass sie wieder gegangen waren. „Die sind so schrecklich dumm“, sagte Mama immer. Papa sah das anders. Papa konnte sich mit Herrn Schmidt über die Kommunisten unterhalten. Und die Kommunisten mussten was ziemlich Schlimmes sein, denn Papa und Herr Schmidt regten sich gern darüber auf. Na ja – mit Fernsehen war wohl nichts. Aber wenn Besuch kam, machte Mama immer eine Tüte Kartoffelchips auf. Davon konnte man ein bisschen was ergattern. „Lasst für den Besuch auch noch was übrig“, ermahnte Mama wie immer schon im Vorhinein. Die Jungs nickten artig.
Später saßen sie alle zusammen im Wohnzimmer. „Bald wird´s Winter“, sagte Frau Schmidt. „Ruckzuck ist Weihnachten“, sagte Mama. „Ob der Nikolaus euch was bringen wird?“, scherzte Herr Schmidt und kniff Ralf in die Wange. Ralf konnte das auf den Tod nicht ausstehen, aber er lachte fröhlich. Damit war´s am schnellsten überstanden.
„Zu Weihnachten wünsche ich mir einen Kassettenrecorder“, erklärte Klaus. Seine Worte waren leise, aber deutlich genug. Einen Moment lang war es still im Wohnzimmer. „Unsere Kinder wissen nicht, wie gut sie es haben“, sagte Papa. „Wenn ich an meine Kindheit denke – da hatten wir an Weihnachten nicht mal satt zu essen“, ergänzte Mama. „Heute ist halt alles anders“, meinte Frau Schmidt. „Die Jugend soll es doch auch mal besser haben“, fügte sie noch hinzu.
Ralf fand, dass das genau der richtige Augenblick war, um mal kräftig in die Schüssel mit den Kartoffelchips zu langen. Klaus griff unmittelbar danach zu. Schickliche Pausen wären nur zu seinem Nachteil gewesen.
Mama verdrehte die Augen. „Als ob die beiden am Hungertuch nagen würden. Man muss sich ja schämen.“
„Vielleicht werden wir ja an Weihnachten nichts mehr zu essen haben“, bemerkte Klaus. „Kann doch sein, dass ein Krieg kommt oder so.“ Ralf konnte nicht genau einschätzen, ob Klaus´ Worte wirklich nur unschuldig gemeint - oder aber eine ziemliche Frechheit waren. Jedenfalls war es im Wohnzimmer wieder einen Augenblick still. Ralf hatte das Gefühl, seinem Bruder beistehen zu müssen: „Also - wenn wir an Weihnachten nichts zu essen haben, dann kannst du doch deinen Kassettenrecorder wieder verkaufen. Da kriegen wir bestimmt ein paar Kartoffeln für. Und in Kartoffeln ist doch alles drin, was man braucht, stimmt doch, Mama, oder?“ Mama sagte nichts. Aber man konnte schon wieder ein bisschen ihre Falten über der Nase sehen.
„Wie schmeckt der Wein?“, fragte Herr Schmidt. Wie immer hatte er eine Flasche von seinem Lieblingswinzer mitgebracht. „Den kann man trinken!“, sagte Papa. Das sollte heißen, dass Papa den Wein lobte. Das wussten die Jungs. Aber sie wussten natürlich auch, dass Papa über das süße Zuckerwasser von Herrn Schmidt schimpfte, sobald der Besuch wieder gegangen war.
Als die Diskussion über die Kommunisten losging und die Chips fast alle waren, sagten die Jungs „Gute Nacht“ und verdrückten sich ins Kinderzimmer. Eine Weile blätterten sie noch in ihren Comics, bis schließlich die Mama kam und das Licht ausmachte.
„Also wenn ich erstmal groß bin, dann kaufe ich mir jeden Tag eine Riesentonne voll Kartoffelchips ganz für mich allein“, flüsterte Ralf im Dunkeln.
Klaus antwortete: „Und wenn ich erstmal groß bin, dann geh´ ich ganz weit weg - irgendwo in ein anderes Land, wo es zum Beispiel ein blaues Meer gibt und einen Strand und einen Urwald und viele Tiere.“
„Nimmst du mich mit?“, fragte Ralf vorsichtig.
„Na gut – aber nur, wenn du machst, was ich sage.“
„Ich weiß was – wir können doch dorthin gehen, wo die Judy wohnt.“
„Nerv´ mich nicht mit deiner blöden Judy!“
Ralf spürte, dass es jetzt nichts mehr zu sagen gab, und er überließ sich ganz der nächtlichen Stille und dem herannahenden Schlaf.
3.
(Klaus)
Der Zug fuhr in den Bahnhof von Madras ein. In den Waggons drängelten alle mit ihren Gepäckstücken den Ausgängen zu. Hunderte von Menschen schwatzten aufgeregt durcheinander und versuchten, sich gegenseitig zu übertönen.
Ich stand eingeklemmt zwischen den beiden jungen Männern mit ihrer verschnürten Kiste und drei alten Frauen in bunten Saris, die sich prächtig miteinander zu unterhalten schienen und lauthals lachten. Die Männer hatten die Kiste auf die Schultern genommen, sodass sie mir nun von hinten ins Kreuz drückte. Von vorne stieg mir der Geruch von Achselschweiß und billigem Parfüm in die Nase. Es ging nur schrittweise voran. Durch die vergitterten Fenster konnte ich sehen, dass der Bahnsteig genauso überfüllt war, wie der Zug. Ich blickte über eine wogende, laute Menschenmenge hinweg, in der es nicht die kleinste Lücke zu geben schien. Das Rufen der vielen Menschen wurde noch übertönt durch kreischende Lautsprecheransagen, zunächst in einer der vielen indischen Sprachen, die ich nicht verstand, und dann in einem genuschelten Englisch. In der Bahnhofshalle schwebte eine Wolke aus Staub und Ruß und es roch nach Abgasen und Verwesung.
Ich kam endlich aus dem Zug raus, hielt meinen Rucksack mit beiden Armen vor dem Bauch umklammert und versuchte, Tara und Krishna zu finden, die eigentlich nur wenige Meter vor mir sein mussten. Aber ich sah nur in unzählige fremde, dunkle Gesichter, manche davon zahnlos, dreckverkrustet oder mit eitrigen Geschwüren bedeckt. Andere wiederum sehr gepflegt, sorgfältig geschminkt oder mit goldenen Ohren- und Nasenpiercings geschmückt. Ich blickte in ein Meer von schubsenden Gestalten und Bündeln, von zerrissenen, grauen und fleckigen Lumpen. Manche Gruppen waren aber auch in einem leuchtenden Orange oder in sehr saubere, weiße Gewänder gekleidet.
Der Krach hier draußen auf dem Bahnsteig war noch schlimmer als drinnen im Zug. Meine Sinne waren völlig überfordert. Mein ganzes Nervenkostüm schmerzte. Für einen Augenblick verlor ich das Gefühl für Raum und Zeit.
Da griff eine schmale Hand nach meiner Rechten und zog mich weiter. „Bleib einfach in unserer Nähe.“ Taras vertraute Stimme war nahe an meinem Ohr und ihre kleine schlanke Gestalt drückte sich an meine Seite und gab mir Halt. Krishna stand etwas weiter vorne inmitten der Menschenmenge, winkte uns zu und bedeutete uns, ihm zu folgen.





























