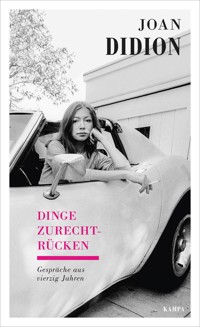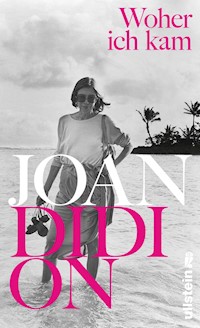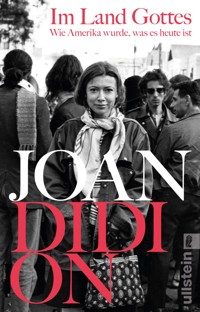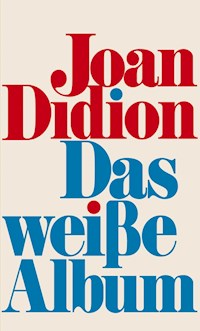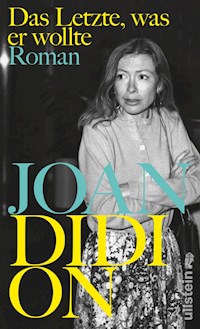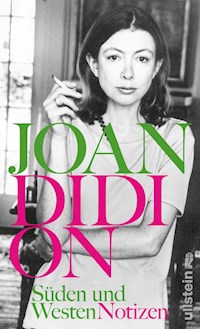19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein außergewöhnliches Werk der Autorin von Das Jahr magischen Denkens und Blaue Stunden Im November 1999 begann Joan Didion, einen Psychiater aufzusuchen, weil ihre Familie, wie sie einem Freund schrieb, "ein paar harte Jahre" hinter sich hatte. Die wöchentlichen Sitzungen notierte sie in einem Tagebuch, das sie für ihren Ehemann John Gregory Dunne anlegte. Ihre Gedanken und Gespräche kreisen um das herzzereißend komplexe Verhältnis zu ihrer Tochter Quintana, um die Alkoholsucht ihrer Tochter, um die Prägungen durch ihre Kernfamilie, ihr literarisches Schaffen und nicht weniger als die Frage nach ihrem Vermächtnis, oder, wie Didion sagte, "was es wert gewesen ist." In Zeilen für John erforscht Joan Didion mit der für ihr Werk typischen Aufrichtigkeit, Präzision und Klarheit ihr Vermächtnis. Sie hinterlässt eine unvergleichlich intime und ehrliche Betrachtung der Elternschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Notizen für John
Joan Didion, geboren 1934 in Sacramento, Kalifornien, arbeitete als Journalistin für verschiedene amerikanische Zeitungen und war Mitherausgeberin der Vogue. Sie gilt als eine der wichtigsten Stimmen der amerikanischen Literatur, die mit ihren fünf Romanen und zahlreichen Essaybänden das intellektuelle Leben der USA im 20. Jahrhundert entscheidend prägte. Joan Didion starb im Dezember 2021 in New York.
Antje Rávik Strubel lebt als Schriftstellerin und Übersetzerin in Potsdam. Für ihre Romane erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Deutschen Buchpreis 2021 für »Blaue Frau«. Sie übersetzt aus dem Englischen und Schwedischen, u.a. Joan Didion, Lucia Berlin und Virginia Woolf.
Im November 1999 beginnt Joan Didion einen Psychiater aufzusuchen, weil ihre Familie, wie sie einem Freund schrieb, »ein paar harte Jahre« hinter sich hat. Die wöchentlichen Sitzungen notiert sie in einem Tagebuch, das sie für ihren Ehemann John Gregory Dunne anlegt. In ihren Notizen kreist sie um das herzzerreißend komplexe Verhältnis zu ihrer Tochter Quintana, die unter einer Alkoholsucht leidet, um die Prägungen durch ihre Kernfamilie, ihr literarisches Schaffen und um nicht weniger als die Frage nach ihrem Vermächtnis oder, wie Didion sagte, »was es wert gewesen ist«.»Ein Meisterstück von einer der Besten.« PEOPLE»Was für ein Erlebnis, Didion dabei zuzusehen, wie sie mit ihrem brillanten Verstand der Tragödie entgegentritt, während der Hurrikan auf ihre Familie zurast.« TELEGRAPH
Joan Didion
Notizen für John
Aus dem Englischen von Antje Rávik Strubel
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
ISBN 978-3-8437-3705-0
© 2025 by Didion Dunne Literary Trust
© der deutschsprachigen Ausgabe: 2026 by Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]
Umschlaggestaltung: zero-media-net, München unter Vorlage eines Designs von Alfred A. Knopf, Inc.
Umschlagmotiv: ©Annie Leibovitz
E-Book-Erstellung powered by pepyrus
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Notizen für John
29. Dezember 1999
5. Januar 2000
12. Januar 2000
19. Januar 2000
2. Februar 2000
9. Februar 2000
16. Februar 2000
1. März 2000
8. März 2000
15. März 2000
22. März 2000
19. April 2000
26. April 2000
3. Mai 2000
10. Mai 2000
17. Mai 2000
24. Mai 2000
31. Mai 2000
7. Juni 2000
JDD
,
JGD
15. Juni 2000
21. Juni 2000
28. Juni 2000
5. Juli 2000
12. Juli 2000
6. September 2000
13. September 2000
20. September 2000
27. September 2000
4. Oktober 2000
11. Oktober 2000
18. Oktober 2000
1. November 2000
8. November 2000
29. November 2000
6. Dezember 2000
13. Dezember 2000
20. Dezember 2000
3. Januar 2001
17. Januar 2001
31. Januar 2001
7. Februar 2001
4. April 2001
3. Juli 2001
26. Dezember 2001
3. Januar 2002
9. Januar 2003 Dr. Kass
Epilog
Anhang
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Kurz nach Didions Tod im Jahr 2021 fand man in einem kleinen Ordner in der Nähe ihres Schreibtisches eine Sammlung von etwa 150 unnummerierten Seiten. In diesem Ordner hatte sie eine Reihe weiterer Dokumente verwahrt (die Notizen des Portiers aus jener Nacht 2003, in der ihr Mann, John Gregory Dunne, gestorben war, die Kopie einer Rede, die sie auf der Hochzeit ihrer Tochter Quintana gehalten hatte, Unterlagen über Zimmerreservierungen im Hotel Bristol in Paris, eine Gästeliste von Weihnachtsfeiern, Computerpasswörter). Die Seiten ergeben eine Art Tagebuch, in dem Didion von Terminen bei einem Psychotherapeuten berichtet, die meisten davon im Jahr 2000. Die Aufzeichnungen richten sich an John. Er ist das »Du« im Manuskript.
Von diesen 150 Seiten, die sich jetzt im Didion Dunne Archiv der New York Public Library befinden, scheint es keine weitere Kopie zu geben. Didions Erben, die Kinder ihres verstorbenen Bruders, richteten das Archiv in der Bibliothek ein. Es ist frei zugänglich.
Ihren ersten Termin hatte Didion bei dem Psychiater und Psychoanalytiker Roger MacKinnon am 15. November 1999. Nach ihrer sechsten Sitzung fing sie mit den Aufzeichnungen für John an. Sie notierte ihre Gedanken und Überlegungen zu den Sitzungen, in die noch weitere angesehene Psychotherapeuten involviert waren. Das Tagebuch endet etwa ein Jahr nach Beginn der Therapie. Darin findet sich auch der Bericht über einen Termin am 7. Juni 2000, an dem John ebenfalls teilgenommen hatte, sodass anzunehmen ist, dass die Aufzeichnungen nicht einfach nur dazu dienen sollten, ihn auf den neuesten Stand zu bringen. Er musste nicht davon in Kenntnis gesetzt werden, was an diesem Tag besprochen wurde. Er war dort.
Einige der Themen des Tagebuchs tauchen in Blaue Stunden auf, das letzte Buch, das Didion schrieb, eine Meditation über das Leben ihrer Tochter. Didion hatte MacKinnon aufgesucht, weil Quintana ihrem eigenen Psychotherapeuten gesagt hatte, ihre Mutter sei depressiv und solle mit jemandem reden. Er hatte das Gefühl, dass die Mutter-Tochter-Beziehung der Kern von Quintanas Problemen war, die zu lösen ihm nicht gelang. Er und MacKinnon taten sich zusammen. Während der Therapie lenkte MacKinnon Didions Aufmerksamkeit auf die Beziehung zu ihren eigenen Eltern, auf das Alter, die Angst vor anderen Menschen und die Bedeutung ihrer Arbeit.
In Didions Computer findet sich ein Brief vom März 2001 an einen alten Freund in Kalifornien, in dem sie die letzten »rauen paar Jahre« mit Quintana beschreibt. »Ich war sogar bei einem Psychologen«, schreibt sie, »was eine außerordentliche Erfahrung war und mich viel offener gemacht hat, als ich es wohl je gewesen bin.«
Notizen für John
29. Dezember 1999
Bzgl. der Nichteinnahme von Zoloft sagte ich, dass ich mich eine Stunde nach der Einnahme so fühlte, als bekäme ich nichts mehr auf die Reihe, wie nach einem Planter’s Punch vor dem Mittagessen in den Tropen. Ich sagte, dass ich versucht hatte, zu begreifen, dass das nicht sein konnte, denn auf dem Beipackzettel stand, dass selbst die doppelte Dosis mehrere Stunden lang überhaupt keine Wirkung zeigte und die stärkste Wirkung bei regelmäßiger Einnahme erst nach 3–5 Tagen eintrat. Mir war klar geworden, dass ich eine sehr begrenzte Vorstellung von meinem körperlichen Wohlbefinden hatte, große Angst vor Kontrollverlust und dass sich meine Persönlichkeit um ein bestimmtes Level von Aktionismus oder Sorge herum organisierte.
Dann sagte ich, dass ich versucht hatte, über die Sorge nachzudenken, die ich in der letzten Sitzung angesprochen hatte. Ich sagte, obwohl sie im Zusammenhang mit meiner Arbeit zur Sprache gekommen war (das Treffen in Los Angeles usw.), war mir im Gespräch mit dir klar geworden, dass sie sich auf Quintana richtete.
»Natürlich«, sagte er. Dann redeten wir darüber, worin meine Sorge in Bezug auf Quintana bestand. Im Grunde darin, dass sie so depressiv werden könnte, dass es gefährlich wäre. Dass sie den Schuh hatte fallen lassen, der Anruf mitten in der Nacht, der Versuch, bei jedem Anruf Rechenschaft über die Gefühle abzulegen. Ich sagte, dass das in gewisser Weise berechtigt wäre, andererseits aber unfair ihr gegenüber, weil sie unsere Sorge ebenso spüren musste wie wir ihre. »Ich vermute, sie spürt insbesondere Ihre Sorge, sagte er. Ich sagte, dass sie das ganz offenkundig tat. Das hatte sie nicht nur zu uns gesagt, sondern auch Dr. Kass gegenüber erwähnt. Sie wollte, dass ich einen Therapeuten aufsuchte, nicht du. Er sagte, er gehe davon aus, dass sie uns beiden die Sorge anmerken würde, dass aber etwas in der Beziehung zwischen ihr und mir dazu führte, dass sie meine Sorge stärker empfand, darin verstrickt war.
»Menschen mit bestimmten neurotischen Mustern sind auf eine andere Weise miteinander verstrickt als Menschen mit gesunden Mustern. Zwischen Ihnen und ihr besteht auf jeden Fall eine sehr starke wechselseitige Abhängigkeit.«
Er wollte wissen, wie alt Quintana1 gewesen war, als wir sie bekamen, die Details der Adoption. Darüber redeten wir eine ganze Weile, und ich sagte, dass ich immer Angst hatte, wir würden sie verlieren. Whalewatching. Die hypothetische Klapperschlange im Efeu auf der Franklin Avenue. Er sagte, dass alle Adoptivkinder die tief sitzende Angst hätten, sie würden wieder weggegeben, und ebenso hätten alle Adoptiveltern die tief sitzende Angst, ihnen könnte das Kind wieder weggenommen werden. Wenn man sich mit diesen Ängsten nicht in dem Moment auseinandersetzte, in dem man sie hatte, verdrängte man sie und fixierte sich krankhaft auf Gefahren, die man kontrollieren konnte – die Schlange im Garten –, statt auf Gefahren, die man nicht kontrollieren konnte. »Offensichtlich haben Sie sich damals nicht mit dieser Angst auseinandergesetzt. Sie haben sie beiseitegeschoben. Das ist Ihr Muster. Sie machen weiter, Sie schlagen sich durch, Sie kontrollieren die Situation durch Ihre Arbeit und Ihre Kompetenz. Doch die Angst ist immer noch da, und als Sie in diesem Sommer festgestellt haben, dass sich Ihre Tochter in einer Gefahr befindet, die Sie nicht kontrollieren oder handhaben können, hat die Angst Ihre Abwehrmechanismen durchbrochen.«
Ich sagte, dass ich möglicherweise überfürsorglich gewesen war, aber nie gedacht hätte, dass Quintana mich auf diese Weise wahrnahm. Einmal hatte sie mich sogar als »etwas distanzierte« Mutter beschrieben. Dr. MacKinnon: »Denken Sie nicht, dass sie Ihre Distanz als Schutzmechanismus gesehen haben könnte? Wenn sie selbst ihre Distanziertheit als Schutz benutzt? Haben Sie mir das nicht gerade erzählt? Sie schaut nie zurück?«
An dieser Stelle redeten wir über Quintana und Stephen, Quintana und Dominique.2 Er fragte, ob ich damit einverstanden sei, wenn er bestimmte Dinge, die in unseren Sitzungen zur Sprache kamen, mit Dr. Kass bespreche, weil er das Gefühl hatte, sie könnten in seinen Sitzungen mit Quintana von Nutzen sein. Ich sagte, ich würde ihn ermutigen, alles zu besprechen, was seiner Meinung nach hilfreich sein könnte.
Um auf die Frage zurückzukommen, warum meine Sorge für Quintana schwieriger war als deine: »Etwas in Ihnen – und das geht weit über Ihre Geburt hinaus – lässt Sie glauben, Sie hätten das Gute nicht verdient. Ich bin sicher, Sie dachten, Sie hätten großes Glück gehabt, als Sie Quintana bekamen, und ich bin außerdem sicher, Sie dachten, Sie hätten es nicht verdient, sondern aus irgendeinem Grund verdient, sie zu verlieren. Das ist ein anormales Denkmuster und lässt Ihre sehr nachvollziehbare Sorge in dieser Situation weitaus größer werden als etwa die Sorge Ihres Mannes. Sie geht über das Eigentliche hinaus. Sie geht auf etwas anderes zurück. Sie sind, aus welchem Grund auch immer, damit aufgewachsen, jederzeit das Schlimmste zu erwarten. Sie erwarten nicht, dass etwas Gutes passiert. Sie besitzen irgendwie nicht die Veranlagung des Leugnens.«
5. Januar 2000
Dr. MacKinnon sagte, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass ich Hilary Califano kannte, er hoffe, es störe mich nicht, sie dort zu sehen. Ich sagte, es würde mich nicht stören, obwohl sich die Frage stelle, was zwei vollkommen erwachsene Frauen hier machten – zwei Frauen, die im Leben standen und deren Abwehrmechanismen, wohl oder übel, recht gut funktionierten.
»Meistens«, sagte er. »Doch manchmal passieren Dinge im Leben, gegen die auch die besten Abwehrmechanismen nichts nützen.«
Ich sagte, dass mich das auf etwas brachte, was er in der letzten Woche gesagt hatte und was mich interessierte – dass ich schon früh meine Arbeit und meine Kompetenz als Abwehr gegen die Angst, Quintana zu verlieren, genutzt hätte. Ich sagte, dass mir aufgefallen war, dass meine Arbeits- und Geldsorgen – die im Spätsommer und zu Herbstanfang sehr ausgeprägt waren – bis zu einem gewissen Grad (ich brach ab)
»Ein Symptom«, sagte er. »Ganz bestimmt.«
»Aber nicht ausschließlich ein Symptom«, sagte ich. »Eine der Sorgen beruhte auf realen Tatsachen.«
»Natürlich. Die Welt verändert sich. Andere Werte kommen in Mode.«
»Genau. Aber die Welt hat sich immer schon verändert, und ich bin immer damit zurechtgekommen. Nur diesen Sommer habe ich mich vielleicht zum ersten Mal im Leben nicht in der Lage gesehen, damit zurechtzukommen. Ich dachte, das liege am Alter. Und zum Teil war es zweifellos auch so. Aber die Sorge war sehr übertrieben. Was das Geld betrifft, haben wir einen neuen Film, und darüber hinaus gibt es andere Möglichkeiten. Und was meine sonstige Arbeit betrifft, besteht das einzig wirkliche Problem darin, dass ich die Zeit dafür finden muss. Aber ich hatte furchtbare Angst.«
»Daraus spricht die Depression.«
»Die aus der Situation mit Quintana in diesem Sommer herrührte.«
»Genau.«
Ich sagte, dass wir in diesem Zusammenhang ein schwieriges Wochenende hinter uns hatten. Es hatte so ausgesehen, als ob es ihr gutginge, sie hatte Besuch von einem guten Freund von außerhalb, der über ihre Situation Bescheid wusste, und als ich wegen einer Augeninfektion in die Notaufnahme musste, machten wir sogar Witze darüber, jeden längeren Urlaub in der Notaufnahme zu verbringen, nur dass es diesmal nicht wegen ihr war. Am Sonntag erhielten wir dann diesen Anruf, gegen 12.30 Uhr. Ich erzählte ihm, wie wir zu ihr in die Wohnung gefahren waren. »Was hat sie gesagt, was passiert war?«, fragte er. Ich erzählte es ihm. Er fragte, ob sie zur Polizei gegangen war. Ich sagte Nein. Du hattest sie gefragt, wo ihre zuständige Polizeistation sei, und sie hatte gesagt, sie wisse es nicht. Ich sagte, dass wir beide es vermieden hatten, ihr zu viele Fragen zu stellen, weil sie zu wacklig schien und es vielleicht als Verhör hätte wahrnehmen können.
»Sie wollten nicht den Eindruck erwecken, ihr Vorwürfe zu machen«, sagte er.
Genau, sagte ich. Wir seien nicht sicher gewesen, aber uns sei beiden klar gewesen, dass sie getrunken hatte. Ob wir Alkohol gerochen hätten, fragte er. Ich sagte, eigentlich nicht, aber die Fenster seien offen gewesen. Es ließ sich nicht so einfach feststellen, sie hatte sich zwar wiederholt, aber nicht gelallt.
»Hatten Sie ein alternatives Szenario?«, fragte er. Ich sagte, wenn ich ein alternatives Szenario hätte entwerfen sollen – und um die widersprüchliche Situation zu verstehen, tat ich das –, hätte ich gesagt, dass sie sich zeitig von ihren Freunden verabschiedet hatte, in eine Bar gegangen war und jemanden kennengelernt hatte, der sie am Ende verprügelte, entweder in der Bar oder auf der Straße oder in ihrer Wohnung. »Wo war das Blut?«, fragte er. Ich sagte, dass zwischen dem Fußende ihres Bettes und dem Bad kein Blut auf dem Boden gewesen war. »Also nicht im vorderen Bereich der Wohnung«, sagte er. Ich verstand, worauf er hinauswollte.
Dann sagte ich, dass etwas an den Anonymen Alkoholikern sowohl dir als auch mir Sorgen bereitete – nicht die Anonymen Alkoholiker als Konzept, sondern ihr unerbittlicher Modus – die Tatsache, dass diese Art theatralischen Scheiterns gewissermaßen ihren Kern ausmachte. Es ging um alles oder nichts. Wenn du einen Drink willst und schwach wirst, endet das nicht nur mit einem Kater und einem Schuldkomplex wie im echten Leben, sondern es endet damit, dass du in der Gosse landest oder in einer Bar, wo du jemanden aufreißt, der dich verprügeln wird.
»Sie gehen davon aus, dass es hier ums Trinken geht«, sagte er.
Nein, sagte ich. Ich glaube nicht, dass es ums Trinken geht. Genau darauf wollte ich hinaus.
Ich sagte, dass du und ich darüber gesprochen hatten und das auch mit Quintana besprechen wollten. Aber wir waren mit einer Reihe von Hindernissen konfrontiert worden. Sie hatte zu tun oder sie wollte nicht zwei Nächte hintereinander die Wohnung verlassen, sodass wir sie vor dem Wochenende nicht wirklich hatten sehen können, und dann war ich überrascht gewesen, auf weitere Hindernisse zu stoßen. In der Zwischenzeit, am Telefon, schien es ihr gut zu gehen, ein Wirbelsturm an Tatkraft – erst heute hatte ich einen Scheck für die Erstattung von Arztkosten bekommen, zusammen mit den nötigen Dokumenten, alles ordentlich markiert und zum Einreichen vorbereitet. Und nun wusste ich nicht, war es produktiv oder eher kontraproduktiv, nach so vielen Tagen noch einmal darauf zurückzukommen?
»Das müssen Sie natürlich herausfinden. Die Frage ist, was Quintana von Ihnen erwartet. Manche erwachsenen Kinder – und ich denke, hier haben wir so einen Fall – haben die Neigung, ihre Eltern in nahezu unmögliche Situationen zu bringen. Wenn du sie konfrontierst, sagt ihr Unbewusstes, du traust ihnen sowieso nicht, was kümmert es mich also, warum tue ich nicht einfach, was ich will, und lüge. Wenn du sie nicht konfrontierst, sagt dasselbe Unbewusste, das ist der Beweis dafür, dass du sie nicht liebst, dass sie dir egal sind. Es ist wie mit kleinen Kindern. Du siehst mich auf der Straße spielen, und es ist dir völlig egal, ob ich von einem Auto überfahren werde, sagen sie, aber wenn du ihnen auf die Straße nachläufst, sagen sie, du erlaubst ihnen nicht, erwachsen zu werden. Ich würde mich fragen, was Quintana für eine Vorstellung davon hat, wie Sie Ihre Liebe ausdrücken und wie ihr Vater seine Liebe ausdrückt – braucht sie Ihre übermäßige Fürsorge? Braucht sie Ihre Vorhaltungen und Ihre Ermahnung? Ist das ihre einzige Vorstellung davon, geliebt zu werden? Oft denken Kinder so, aber bei einer normalen Entwicklung kommt irgendwann der Punkt, an dem sie darüber hinauswachsen.
Ich weiß, dass Dr. Kass – und das ist einer der Gründe, warum er wollte, dass Sie zu mir kommen – versucht, dieses Muster bei Quintana zu durchbrechen, bei dem sie Sie zu einer bestimmten Reaktion zwingt und Sie dann auch entsprechend reagieren.
Jedenfalls glaube ich, dass Sie indirekt mit ihr sprechen können. Ich glaube, Sie können ihr sagen, dass Sie sich fragen, wie Sie ihrer Meinung nach Ihre Liebe für sie zeigen. Denn wenn sie denkt, Sie drücken Ihre Liebe dadurch aus, dass Sie schimpfen oder ihr Vorhaltungen machen oder sie beschützen, sollten Sie darüber reden, und sie sollte mit Dr. Kass darüber reden. Das ist das Muster, um das es, wie wir annehmen, geht, und das ist das Muster, das wir durchbrechen müssen.«
Wie, fragte ich, machen das Kinder normalerweise? »Sie werden erwachsen.« Darauf fragte ich: Wie? »Vertrauen. Sie vertrauen darauf, dass ihre Eltern ihnen vertrauen.«
12. Januar 2000
Ich sagte, dass er am Ende der letzten Sitzung etwas über Vertrauen oder mangelndes Vertrauen zwischen Müttern und Töchtern gesagt hatte – dass das Gefühl des Kindes, dass man ihm vertraut, der Schlüssel zur Abnabelung, zum Erwachsenwerden werden sei –, was ich als irrelevant abgetan, für mich als unbedeutend erachtet hatte.
Ich sagte, dass es mir trotzdem nicht aus dem Kopf gegangen war, und später an jenem Abend oder am nächsten Tag war mir etwas eingefallen, was ich mir im Zusammenhang mit den Recherchen für meinen letzten Roman notiert hatte. Ich hatte es kurz nach dem Tod meines Vaters aufgeschrieben – der Tod meines Vaters war teilweise der Auslöser gewesen, diesen Roman zu schreiben –, doch die Notiz bezog sich nicht auf meinen Vater, sondern auf meine Mutter. Ich hatte sie herausgesucht, und sie war interessant, weil sie auf ein gewisses Misstrauen oder Missverständnis zwischen meiner Mutter und mir hindeutete.
Ich zeigte ihm die Notiz. Nun ja, sagte er. Da haben Sie’s. Außergewöhnliche Erkenntnis.
Außergewöhnlich oder nicht, sagte ich, es helfe nicht unbedingt dabei, mit dem Leben weiterzumachen. Es sei vielmehr kontraproduktiv, wenn man bedenke, dass meine Mutter jetzt 89 sei. Wir würden nichts lösen dadurch, dass wir dem ins Auge sahen.
Es geht nicht so sehr um Sie und Ihre Mutter, oder? Geht es nicht darum, zu klären, wie Sie und ihre Tochter miteinander umgehen? Ist es nicht möglich, dass Sie, da wir alle gewisse Anteile unserer Mütter und Väter mit uns herumtragen, dieses Muster teilweise mit ihrer Tochter reproduzieren?
Ich sagte, dass ich mit ihr darüber tatsächlich neulich beim Abendessen gesprochen hatte. Sie hatte das interessant gefunden, aber die Unterhaltung hatte sich dann vom Persönlichen entfernt und war in eine Diskussion über politische Haltungen in den 1950er Jahren übergegangen.
Es war dennoch ein guter Anfang, sagte er. Sie könnten ein andermal darauf zurückkommen. Je mehr Sie und Ihre Tochter miteinander reden, umso näher kommen Sie dieser Frage.
Ich sagte, dass wir im Augenblick nicht wirklich wussten, woran wir mit ihr waren. Nachdem sie aufgehört hatte zu trinken, schien sie für eine Weile sehr offen zu sein, doch jetzt schien sie wieder verschlossen, abweisend. Einmal hatte sie mich beispielsweise gebeten, sie auf ein Treffen der Anonymen Alkoholiker zu begleiten, und das hatte ich getan. Wir waren in die Kirche gegangen und dann zu diesem Treffen, und danach hatten wir dich zum Mittagessen getroffen, und es war ein sehr guter, offener Tag gewesen. Dann kamen die Feiertage, und sie hatte zu tun, und als ich sie kürzlich fragte, ob ich sie wieder auf ein Treffen begleiten könne, war sie abweisend. Sie sagte, es sei nicht wirklich eine gute Idee, jemanden von außen mitzubringen. Offen gestanden wusste ich nicht einmal, ob sie selbst hingehen würde.
Wollen Sie wissen, wie Sie sie dazu bringen hinzugehen, fragte er. Indem Sie zu einem Treffen der Angehörigen von Alkoholkranken gehen. Gehen Sie regelmäßig hin. Sie müssen eine Gruppe finden, in der die Leute auf Ihrem intellektuellen und sozial-ökonomischen Niveau sind, aber das ist in Manhattan kein großes Problem. Wenn sie weiß, dass Sie das tun, wird sie mit neunzig Prozent höherer Wahrscheinlichkeit selbst an den Treffen teilnehmen. Und ich bin der Meinung, dass sie das braucht. Die Therapie allein wird ihr nicht helfen.
Ich sagte, dass ich ein Problem mit den Treffen der Angehörigen der AA hatte. »Sicher, und sie hat ein Problem mit den AA«, sagte er. »Und jetzt werden Sie sagen, sie ist die Alkoholikerin, nicht Sie. Und ich werde sagen, Sie sind die Mutter einer Alkoholikerin, und sie wird nicht zu den Treffen gehen, wenn sie Ihr Misstrauen spürt. Ich könnte sogar sagen, dass Sie natürlich ein Problem mit den Angehörigentreffen haben, denn Sie haben ein Problem mit Gruppen, Sie trauen ihnen nicht, Sie wissen nicht, was deren Absicht ist. Erinnert Sie das irgendwie an Ihre Mutter?«
Ich sagte, dass das meiner Ansicht nach weit hergeholt war, ich aber darüber nachdenken würde. »Ich gebe Ihnen ein paar Hausaufgaben auf«, sagte er. »Ich habe mit der klassischen Freud’schen Psychoanalyse angefangen, habe einfach zugehört, aber dann war ich mit dem, was dabei herauskam, nicht zufrieden, also habe ich ein paar Techniken der Behavioristen übernommen. Die Behavioristen benutzen Hausaufgaben, um den Prozess zu beschleunigen. Hier ist Ihre Hausaufgabe. Zeigen Sie Ihrer Tochter die Notiz, die Sie mir gezeigt haben. Erzählen Sie ihr nicht davon, sondern zeigen Sie sie ihr, es ist ein interessanter Beleg. Sagen Sie ihr, dass Sie mir das gezeigt haben. Und wenn sie fragt, was ich dazu gesagt hätte, sagen Sie ihr, ich hätte Sie gefragt, ob sich das Misstrauen Ihrer Mutter gegenüber anderen Menschen in Ihrem Misstrauen gegenüber den Treffen der Angehörigen von Alkoholkranken widerspiegele. Hören Sie sich an, was sie dazu sagt. Ich denke, Sie werden überrascht sein, was sich Ihnen dadurch eröffnet.«
Ich sagte, mal sehen. »Ich habe den Eindruck, in Ihrer Stimme genau das zu hören, was Sie in der Stimme Ihrer Tochter hören, wenn Sie sie nach den Anonymen Alkoholikern fragen.«
Dann sagte ich, dass ich ihm ein Gedicht zeigen wollte, das Quintana im Alter von etwa sechs Jahren an einem Strand geschrieben hatte. Ich zeigte es ihm. Die Art, wie sie sich ausdrückte, beeindruckte ihn sehr, als wäre sie »eine geborene Schriftstellerin«. Ich sagte, dass mich die Einsamkeit darin getroffen hatte, weil man es ihr nie anmerkte. Sogar damals hatte sie ihre Gefühle versteckt. »Sie muss dafür außergewöhnliche Gründe gehabt haben.« Ich sagte, dass er wahrscheinlich die Adoption meine, aber es gebe andere Dinge, die für sie traumatisch gewesen sein könnten, besonders der Tod von Juan Carlos, über den sie nie sprach, aber danach träumte sie von einer Todesgestalt, die sie holen kommen wollte, »und ich stehe zwischen den Fronten«. Ich erzählte ihm, dass wir im Herbst nach Juan Carlos’ Tod mit Quintana und Rosie nach New York gefahren waren und Rosie nach Hause gegangen und Quintana von einer Tagesmutter betreut worden war. Und dass sie erst später erwähnt hatte, dass Mrs Soundso gemein gewesen war, und ich sie gefragt hatte, warum sie das nicht eher erzählt hatte, und sie gesagt hatte: »Ich dachte, es sei dein Job, für Mr Preminger zu arbeiten, und es sei mein Job, dass sich Mrs Soundso um mich kümmert.«
»Also hat sie sich in gewisser Weise nicht als Kind gesehen«, sagte er. »Sie hat sich in der Verantwortung einer Erwachsenen gesehen.« Ich sagte, vermutlich schon, und dass ich auch davon ausging, dass das ganz natürlich war, oder so natürlich wie möglich in einer ziemlich ungewöhnlichen Situation: Wir arbeiteten beide zu Hause, sie war das einzige Kind, so etwas wie Erwachsene hier und Kinder da kam gar nicht infrage, wir saßen alle im selben Boot.
Ich sagte, dass Quintana mit drei Jahren auf ihrem ersten Termin gewesen war, bei der William Morris Agency, ich erzählte ihm, wie die Geschichte ausging. »Sie machte sich Sorgen wegen des Geldes«, sagte er. »Sie machte sich Sorgen über etwas, das sie nicht beeinflussen konnte, eine Angelegenheit von Erwachsenen.«
Ich fragte, ob er damit sagen wolle, dass wir zwischen ihr und unseren Alltagsproblemen nicht genügend unterschieden hätten. Ich sagte, dass das etwas gewesen war, was uns an unserem Familienleben gefallen hatte: Wir lebten es alle drei gemeinsam. »Angesichts der Situation«, sagte er, »wage ich zu behaupten, dass sie wahrscheinlich mehr Anforderungen ausgesetzt war, als sie verarbeiten konnte. Quintana war ein Kind, Sie waren die Erwachsenen, und doch begann sie sich irgendwo in ihrem Hinterkopf eindeutig für Sie verantwortlich zu fühlen.«
19. Januar 2000
Ich sagte, dass ich tatsächlich meine Hausaufgaben gemacht hatte. Als Quintana am Montag zum Abendessen gekommen war, »nach einem schwierigen Wochenende, worauf ich später zurückkommen werde«, sagte ich, hatte ich in der Küche erwähnt, dass ich Dr. MacKinnon ein paar Notizen über meine Mutter gezeigt und er mir daraufhin eine Frage gestellt hatte, über die ich mit ihr reden wollte. Dann hatte ich ihr die Notizen gezeigt und gesagt, dass Dr. MacKinnon gefragt hatte, ob ich annehmen würde, dass das Misstrauen meiner Mutter gegenüber Gruppen, gegenüber den möglichen Absichten anderer Menschen, irgendetwas mit meinem eigenen Misstrauen gegenüber den Selbsthilfegruppen für Angehörige von Alkoholikern zu tun haben könnte, über das wir kürzlich gesprochen hatten. Ich sagte, dass du (John) in diesem Augenblick in die Küche gekommen warst und die Unterhaltung leicht abschweifte, doch dann sagte Quintana: »Warte, ich möchte auf das zurückkommen, was Mom gesagt hat.« Als sie meine Frage wiederholte, übersetzte sie sie überraschenderweise so: »Du meinst, ob dein Widerstand gegen die Selbsthilfegruppe der Angehörigen der AA etwas mit meinem Widerstand gegen die AA zu tun hat?«
»Ausgezeichnet«, sagte Dr. MacKinnon. »Dafür bekommen alle eine Eins. Was haben Sie gesagt?«
Ich sagte, ich hätte gesagt, dass ich genau das vermutlich gemeint hatte, ja. Ihre Antwort war: Vielleicht war es so, ja. Sie sagte, sie habe sich in letzter Zeit gegen die Anonymen Alkoholiker gesträubt – sie nahm an, dass das an Molly lag, ihrer Sponsorin, die einen schlechten Nachgeschmack bei ihr hinterlassen hatte, aber ihr wurde klar, dass sie die Treffen vermisste und eigentlich vorhatte, am nächsten Abend zu einem Treffen zu gehen.
»Dann soll sie einen neuen Sponsor suchen«, sagte Dr. MacKinnon.
Ich sagte, dass du genau das gesagt hattest und dass wir eine Weile über »Sponsoren« gesprochen hatten und Quintana dann das Gespräch wieder auf meine ursprüngliche Frage gebracht hatte. Was ich wirklich hatte fragen wollen, wollte sie wissen.
Ich sagte, dass ich vermutlich hatte fragen wollen, ob sie glaubte, es würde ihr helfen, wenn ich eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholkranken besuchen würde.
Ja, sagte sie, sie glaube schon. Ich sagte, in diesem Fall würde ich hingehen, und dass du und ich eigentlich geplant hatten, am Wochenende an einem solchen Treffen teilzunehmen.
Das ist sehr positiv, sagte Dr. MacKinnon. Sehr gut. »Lassen Sie mich da weitermachen. Sie erwähnten, dass Ihr Mann sich an dem Gespräch beteiligte. Das wirft eine Frage auf, die Dr. Kass mit mir diskutiert hat.« Laut Dr. Kass – »und denken Sie daran, das ist mein Bericht dessen, wovon Dr. Kass annimmt, dass Quintana es ihm erzählt, es gibt also mehrere Ebenen der Verzerrung oder möglicher Fehler« – »hat Quintana das starke Gefühl, dass sie es, wenn sie mit Ihnen oder Ihrem Mann zu tun hat, mit einer einzigen Person zu tun hat, dass keiner von Ihnen beiden, vor allem Sie nicht, einen unabhängigen Standpunkt einnimmt, dass Sie sich gegen sie verbünden.«