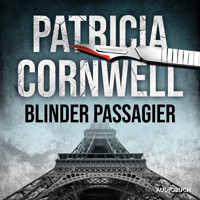10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Als Kay Scarpetta nach einem furchtbaren Einsatz an ihr Institut zurückkehrt, wartet gleich der nächste Fall auf sie: eine in Leinenstoff eingewickelte Frauenleiche, die man auf dem Campusgelände gefunden hat. Es handelt sich um die Informatikstudentin Gail Shipton, die zuletzt in einer beliebten Bar gesehen wurde, in der auch Scarpettas Nichte Lucy gern verkehrt. Ein Zufall? Die forensische Untersuchung legt nahe, dass die Studentin Opfer eines Serienmörders wurde. Bei ihren Ermittlungen gerät Kay Scarpetta in eine Welt, die von modernster Überwachungstechnologie und Designerdrogen beherrscht wird. Noch bedrohlicher allerdings scheint der tiefe Sumpf von organisierter Kriminalität und Korruption auf höchster Ebene, auf den sie bei ihren Ermittlungen stößt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Ähnliche
Patricia Cornwell
Blendung
Ein Kay-Scarpetta-Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Dufner
Hoffmann und Campe
Ich werde euch die Furcht zeigen, in einer Handvoll Staub.
(T.S. Eliot, Das wüste Land,1922)
Wie immer –
Für Staci (du bist die Beste)
1
Cambridge, Massachusetts
Mittwoch, 19. Dezember
4 Uhr 02
Das Schrillen des Telefons übertönt das gnadenlose Prasseln des Regens aufs Dach, das wie ein Trommelwirbel klingt. Ich fahre im Bett hoch. Mein Herz macht einen Satz wie ein aufgeschrecktes Eichhörnchen, als ich einen Blick auf das beleuchtete Display werfe, um festzustellen, wer es sein könnte.
»Was ist los?« Mein Tonfall ist sachlich-nüchtern, als ich Pete Marino begrüße. »Um diese Uhrzeit sicher nichts Gutes.«
Als sich mein adoptierter Windhund Sock enger an mich kuschelt, tätschle ich ihm den Kopf, um ihn zu beruhigen. Dann mache ich Licht und hole einen Block und einen Stift aus der Schublade, während Marino anfängt, mir von einer Leiche zu erzählen, die einige Kilometer von hier vor dem Massachusetts Institute of Technology entdeckt wurde.
»Im Schlamm am Rand eines Sportplatzes des MIT, der Briggs Field heißt. Vor etwa einer halben Stunde«, meldet er. »Ich bin dorthin unterwegs, von wo sie wahrscheinlich verschwunden ist, und fahre dann zum Fundort. Bis du da bist, wird alles abgesichert.« Marinos laute Stimme hört sich an wie immer, so als wäre nichts zwischen uns vorgefallen.
Ich traue meinen Ohren kaum.
»Ich weiß nicht, warum du mich eigentlich anrufst.« Das sollte er nämlich nicht, doch ich kenne den Grund. »Offiziell bin ich noch nicht wieder im Dienst. Ich bin krankgeschrieben.« Meine Stimme klingt in Anbetracht der Umstände ruhig und höflich, und ich bin nur noch ein wenig heiser. »Du solltest besser Luke verständigen oder …«
»Um diese Sache willst du dich bestimmt lieber selbst kümmern, Doc. Das wird sicher ein PR-technischer Albtraum, und du kannst nicht schon wieder einen gebrauchen.«
Natürlich muss er mir sofort mein Wochenende in Newtown, Connecticut, unter die Nase reiben, über das in den Nachrichten ausführlich berichtet wurde und das ich nicht mit ihm erörtern werde. Er ruft mich an, weil er eben Lust dazu hat, und er wird auch nach Lust und Laune herumbohren, damit ich ja nicht vergesse, dass wir unsere Rollen plötzlich getauscht haben, nachdem er ein Jahrzehnt lang Anweisungen von mir entgegengenommen hat. Jetzt führt er das Kommando. Nicht mehr ich. So einfach ist Pete Marinos Weltbild nun einmal.
»Ein PR-technischer Albtraum für wen? Außerdem bin ich nicht für die PR verantwortlich«, füge ich hinzu.
»Eine Tote auf dem Campus des MIT ist ein Albtraum für alle. Die Sache gefällt mir nicht. Ich wäre mitgekommen, wenn du mich darum gebeten hättest. Du hättest nicht allein hinfahren sollen.« Er spricht wieder von Connecticut, und ich tue so, als hätte ich es nicht gehört. »Du hättest mich wirklich fragen sollen.«
»Du arbeitest nicht mehr bei mir. Deshalb habe ich auch nicht gefragt.« Mehr werde ich zu diesem Thema nicht sagen.
»Es tut mir leid. Die Sache war sicher nicht leicht für dich.«
»Es war für niemanden leicht.« Ich huste ein paarmal und greife nach dem Wasserglas. »Haben wir einen Namen?« Ich klopfe Kissen hinter meinem Rücken zurecht. Sock legt den schmalen Kopf auf meinen Oberschenkel.
»Vermutlich handelt es sich um eine zweiundzwanzigjährige Master-Studentin namens Gail Shipton.«
»Wo hat sie studiert?«
»Am MIT. Informatik. Sie wurde gegen Mitternacht als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde sie in der Psi Bar gesehen.«
Die Stammkneipe meiner Nichte, eine Vorstellung, die mir gar nicht gefällt. Die Bar ist ganz in der Nähe des MIT und ein beliebter Treffpunkt für Künstler, Physiker und Computerfreaks wie Lucy. Hin und wieder laden sie und ihre Partnerin Janet mich sonntags dort zum Brunch ein.
»Ich kenne das Lokal.« Das ist alles, was ich dem Mann antworte, der mich im Stich gelassen hat – wie ich sehr wohl weiß, nur zu meinem Vorteil.
Wenn mein Gefühl sich dieser Auffassung nur anschließen würde.
»Offenbar war Gail Shipton gestern am späten Nachmittag mit einer Freundin dort, die sagt, gegen halb sechs habe Gails Telefon geläutet. Gail sei rausgegangen, um den Anrufer besser verstehen zu können, und nie zurückgekommen. Du hättest nicht allein nach Connecticut fahren sollen. Ich hätte dich wenigstens hinbringen können«, beharrt Marino. Er wird sich nicht danach erkundigen, wie ich mich jetzt fühle, nach dem, was er angerichtet hat, weil er einfach abgehauen ist, um beruflich noch einmal neu anzufangen.
Er ist wieder bei der Polizei und scheint dort glücklich zu sein. Wen interessiert es schon, wie es mir wegen seines Verhaltens geht. Er will nur wissen, was in Connecticut los war. Das wollen alle, doch ich habe kein einziges Interview gegeben. Über Dinge wie diese rede ich nicht. Ich wünschte nur, er hätte es nicht aufs Tapet gebracht. Denn ich hatte das grausige Erlebnis in die allerhinterste Schublade meines Hirns verbannt. Und jetzt hat er es wieder herausgeholt.
»Und die Freundin fand es nicht seltsam oder besorgniserregend, dass ihre Begleiterin das Lokal verlassen hat, um zu telefonieren, und danach spurlos verschwand?« Ich bin auf Autopilot und in der Lage, meine Arbeit zu machen, während ich versuche, nichts mehr für Marino zu empfinden. »Ich weiß nur, dass die Freundin es mit der Angst zu tun gekriegt hat, als Gail nicht ans Telefon ging und keine SMS beantwortete.« Er nennt die Vermisste, die möglicherweise tot ist, bereits bei ihrem Vornamen.
Es ist mittlerweile eine Verbindung zwischen den beiden entstanden. Er hat sich in den Fall verbissen und wird nicht mehr lockerlassen.
»Als sie bis Mitternacht noch immer nichts von ihr gehört hatte, hat sie sich auf die Suche gemacht«, spricht er weiter. »Die Freundin heißt Haley Swanson.«
»Was weißt du sonst noch über Haley Swanson?«
»Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.« Das bedeutet, dass er eigentlich gar nichts weiß, weil Haley Swansons Vermisstenanzeige vermutlich zunächst nicht ernst genommen wurde.
»Wundert es dich nicht, dass sie sich nicht schon früher Sorgen gemacht hat?«, frage ich. »Gail wurde um halb sechs zuletzt gesehen, und ihre Freundin hat erst sechs oder sieben Stunden später die Polizei verständigt.«
»Du kennst ja die Studenten hier. Sie trinken, wechseln einfach mit jemandem das Lokal, vergessen die Zeit und kümmern sich einen Scheißdreck um irgendwas.«
»War Gail ein Mensch, der spontan mit einem fremden Menschen mitgegangen wäre?«
»Wenn die Sache sich so entwickelt, wie ich vermute, werde ich eine Menge offene Fragen klären müssen.«
»Klingt, als würden wir noch ziemlich im Dunkeln tappen.« Noch während ich das ausspreche, wird mir klar, dass das ein Fehler war.
»Ich habe nicht lang mit Haley Swanson geredet.« Offenbar glaubt er, sich rechtfertigen zu müssen. »Offiziell nehmen wir Vermisstenanzeigen nicht telefonisch entgegen.«
»Warum hast du dann überhaupt mit ihr gesprochen?«
»Zuerst hat sie die Notrufnummer angerufen, wo man ihr gesagt hat, sie müsse aufs Revier kommen und Anzeige erstatten. So ist die offizielle Vorgehensweise. Man muss persönlich erscheinen.« Inzwischen dröhnt seine Stimme derart, dass ich die Lautstärke meines Telefons herunterregeln muss. »Kurz darauf hat sie noch mal angerufen und eigens nach mir gefragt. Ich habe ein paar Minuten mit ihr geredet, aber sie nicht wirklich ernst genommen. Wenn sie sich solche Sorgen gemacht hätte, hätte sie doch sofort kommen und Anzeige erstatten müssen. Schließlich haben wir rund um die Uhr geöffnet.«
Marino ist erst seit ein paar Wochen beim Cambridge Police Department, weshalb es mir ziemlich eigenartig erscheint, dass eine Fremde ihn namentlich zu sprechen verlangt. Darum ist mir diese Haley Swanson nicht ganz geheuer. Allerdings würde es nichts bringen, das zu erwähnen. Marino wird nicht auf mich hören, sondern glauben, dass ich ihn belehren will.
»Klang sie aufgebracht?«, erkundige ich mich.
»Viele Leute klingen aufgebracht, wenn sie die Polizei anrufen, was aber nicht zwangsläufig heißt, dass sie auch die Wahrheit sagen. Neunundneunzig Prozent aller vermissten Studenten sind gar nicht verschollen. Solche Anrufe sind deshalb hier nicht ungewöhnlich.«
»Kennen wir Gail Shiptons Adresse?«
»Einer dieser superschicken Eigentumswohnblocks in der Nähe des Charles Hotel.« Er diktiert mir die Einzelheiten, und ich schreibe sie auf.
»Ein teures Pflaster.« Ich sehe die eleganten Backsteinhäuser unweit der Kennedy School of Government und des Charles River vor mir. Von dort aus ist es nicht weit zu meinem Institut.
»Wahrscheinlich bezahlen ihre Eltern die Rechnungen, wie fast immer hier in der Stadt der Eliteunis.« Marino lästert gern über Cambridge, wo man, wie er häufig zu sagen pflegt, schon für Dummheit von der Polizei einen Strafzettel bekommt.
»Hat schon jemand nachgeschaut, ob sie vielleicht zu Hause ist und einfach nicht ans Telefon geht?« Inzwischen bin ich hellwach und mache mir ausführlich Notizen, auch wenn ich in Gedanken noch bei der jüngsten Tragödie bin.
Während ich aufrecht im Bett sitze und telefoniere, habe ich sie wieder deutlich vor Augen, und ich werde die Bilder einfach nicht los. Die Leichen und das Blut. Geschosshülsen aus Messing waren wie blankpolierte Pennymünzen überall auf den Fußböden der Grundschule aus rotem Backstein verstreut. Ich sehe es so klar und deutlich, als wäre ich noch dort. Siebenundzwanzig Autopsien, die meisten Toten waren Kinder. Und als ich den blutigen OP-Anzug auszog und mich unter die Dusche stellte, habe ich mich geweigert, über das nachzudenken, was ich gerade getan hatte.
Ich habe auf einen anderen Kanal geschaltet und alles fein säuberlich in Schubladen verstaut. Schon vor Jahren habe ich gelernt, die zerschmetterten menschlichen Körper nicht mehr zu sehen, nachdem ich mit ihnen fertig bin. Ich habe die Bilder gezwungen, dort zu bleiben, wo sie hingehören – am Tatort, im Autopsiesaal und nicht in meinen Gedanken. Doch diesmal bin ich offenbar damit gescheitert. Als ich am vergangenen Samstagabend nach Hause kam, hatte ich Fieber und Schmerzen am ganzen Körper, so als hätte das Böse mich infiziert. Meine Grenze ist überschritten worden. Ich hatte dem Rechtsmedizinischen Institut von Connecticut meine Hilfe angeboten, und keine gute Tat bleibt ungestraft. Wer das Richtige tut, muss dafür büßen. Die dunklen Mächte mögen das nämlich nicht, und Druck macht krank.
»Angeblich war sie dort, um sich zu vergewissern, dass Gail nicht da ist«, erklärt Marino, »und hat den Sicherheitsdienst gebeten, in der Wohnung nachzusehen. Aber es fehlte jede Spur von ihr, und nichts wies darauf hin, dass sie je aus der Bar nach Hause gekommen war.«
Ich merke an, dass die Freundin bei den Portiers in Gail Shiptons Apartmenthaus offenbar bekannt ist, denn sie würden ja nicht jeder x-Beliebigen die Tür öffnen. Während ich das sage, wandert mein Blick zu dem Stapel aus FedEx-Paketen, die noch ungeöffnet neben dem Sofa am anderen Ende des Schlafzimmers stehen. Sie führen mir vor Augen, dass es nicht gut für mich ist, wenn ich tagelang eingesperrt und zu krank bin, um zu arbeiten, zu kochen oder das Haus zu verlassen, und mich außerdem davor fürchte, mit meinen Gedanken allein zu sein. Dann suche ich nämlich nach Ablenkung, und das habe ich offenbar ausgiebig getan.
Die antike Harley-Davidson-Motorradweste und die Gürtelschließe mit dem Totenkopf sind für Marino. Außerdem sind da noch Hermès-Parfüm und Armbänder von Jeff Deegan für Lucy und Janet. Und mein Mann Benton bekommt eine Titanuhr mit einem Zifferblatt aus Fiberglas, die Breguet inzwischen aus dem Programm genommen hat. Er hat morgen Geburtstag, fünf Tage vor Weihnachten, und es ist schwierig, ihm etwas zu schenken, da es nicht viel gibt, was er braucht und nicht schon besitzt.
Weiterhin eine Unmenge von Geschenken für meine Mutter, meine Schwester, unsere Haushälterin Rosa und verschiedene Mitarbeiter. Außerdem noch ein paar Sachen für Sock, für Lucys Bulldogge und die Katzen meines Verwaltungschefs. Keine Ahnung, was in mich gefahren ist, als ich krank im Bett lag und wie besessen im Internet bestellt habe. Ich schiebe es auf das Fieber. Bestimmt werde ich jede Menge Sprüche über die sonst so vernünftige und sparsame Kay Scarpetta und ihre weihnachtliche Einkaufsorgie zu hören kriegen. Besonders Lucy wird es mir genüsslich unter die Nase reiben.
»Gail reagiert weder auf Anrufe, E-Mails noch SMS«, fährt Marino fort, während der Regen laut gegen die Fensterscheibe peitscht. »Auf Facebook, Twitter et cetera wurde auch nichts gepostet. Hinzu kommt, und das ist das Allerwichtigste, dass ihre Personenbeschreibung auf die Tote passt. Ich nehme an, dass sie entführt worden und irgendwo festgehalten worden ist. Dann wurde die Leiche in ein Bettlaken gewickelt und entsorgt. Ich würde dich unter diesen Umständen normalerweise nicht stören, aber ich weiß ja, wie du bist.«
Ja, und außerdem weiß er, wie es mir geht. Ich werde mich auf gar keinen Fall ins Auto setzen und zum MIT oder sonst irgendwohin fahren, nicht, nachdem ich in den letzten fünf Tagen praktisch in Quarantäne verbracht habe. Das teile ich meinem ehemaligen Chefermittler auch klipp und klar mit.
»Wie fühlst du dich denn? Ich habe dich ja vor der Grippeimpfung gewarnt. Wahrscheinlich bist du deshalb krank geworden«, erwidert er.
»Von einem abgetöteten Virus kann man nicht krank werden.«
»Nun, die einzigen beiden Male, die ich mich gegen Grippe habe impfen lassen, habe ich prompt eine gekriegt. Mir war sterbenselend. Es freut mich, dass du wieder kräftiger klingst.« Marino tut so, als sei er besorgt um mich, weil er etwas von mir will.
»Das ist vermutlich relativ. Es könnte besser sein. Aber auch schlimmer.«
»In anderen Worten, du bist stinksauer auf mich. Lass uns doch Klartext reden.«
»Ich habe meine Gesundheit gemeint.«
Stinksauer würde meinen derzeitigen Gemütszustand noch beschönigen. Marino hat keinen Gedanken daran verschwendet, wie ich nun als Chief Medical Examiner des Staates Massachusetts und Leiterin des Cambridge Forensic Center dastehe, nachdem er mir einfach alles vor die Füße geworfen hat. Zehn Jahre lang war er mein Chefermittler, und nun hat er sich beruflich von mir getrennt. Ich wage mir kaum auszumalen, wie man sich bei der Polizei die Mäuler über mich zerreißen wird.
Dabei geht es doch eigentlich gar nicht um mich, sondern um Marino und die Midlife-Crisis, die ihn fest im Griff hat, seit ich ihn kenne. Wäre ich ein indiskreter Mensch, könnte ich überall herumposaunen, dass Marino an Minderwertigkeitskomplexen und einem miserablen Selbstwertgefühl leidet, seit er als Sohn eines gewalttätigen Trinkers und einer schwachen, unterwürfigen Mutter in einem Armenviertel in New Jersey geboren wurde.
Ich bin als Frau unerreichbar für ihn, die Frau, die er bestraft, vermutlich die Liebe seines Lebens und ganz bestimmt seine beste Freundin. Seine Motive, mich mitten in der Nacht anzurufen, sind weder fair noch vernünftig, insbesondere, da er weiß, dass ich mit Grippe im Bett liege. Zeitweise war ich so krank, dass ich schon befürchtet habe, sterben zu müssen, und mir dachte: Aha, das war’s, so fühlt es sich also an.
2
In meiner fieberwahnhaften Erleuchtung hatte ich plötzlich den Sinn des Lebens vor mir, den Zusammenstoß der göttlichen Partikel, aus denen das Universum gemacht ist, und den Tod, der das genaue Gegenteil davon darstellt. Als meine Temperatur auf vierzig Grad stieg, wurde alles sogar noch klarer, einleuchtend und wortgewandt erläutert von dem Kapuzenmann, der am Fußende meines Bettes saß.
Wenn ich nur aufgeschrieben hätte, was er gesagt hat, die flüchtige Formel, die der Natur Substanz verleiht, während der Tod sie ihr wieder entzieht. Die gesamte Schöpfung seit dem Urknall, gemessen an den Erzeugnissen des Verfalls. Rost, Schmutz, Krankheit, Wahnsinn, Chaos, Verderbtheit, Lügen, Verwesung, Zerstörung, tote Zellen, Verdorren, Gestank, Schweiß, Müll, Staub zu Staub, sie alle interagieren auf einer Ebene jenseits der Atome und bilden neue Masse, und so geht es immer weiter bis in alle Ewigkeit. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, wusste aber, dass es anziehend und gütig war, während er mir von Wissenschaft und Poesie erzählte, von hinten erleuchtet von einem Feuer, das keine Wärme abstrahlte.
In diesen Momenten erstaunlicher Klarheit verstand ich, was wir meinen, wenn wir von verbotenen Früchten und von Erbsünde sprechen, vom Hinausschreiten ins Licht, von mit Gold gepflasterten Straßen, von Außerirdischen, Auren, Geistern, dem Paradies und der Hölle und der Wiedergeburt, der Heilung und der Auferstehung von den Toten. Einer Rückkehr als Rabe, Katze, Buckliger oder Engel. Eine Wiederverwertung, so kristallklar in ihrer Präzision und facettenreichen Schönheit, wurde mir offenbart. Der Plan Gottes, des Obersten Physikers, der gnädig, gerecht und humorvoll ist. Und kreativ. Und in uns allen steckt.
Ich sah und wusste. Ich war im Besitz der vollkommenen Wahrheit. Dann forderte das Leben wieder sein Recht und zog mir die Wahrheit mit einem Ruck unter den Füßen weg. Und hier bin ich nun, von der Schwerkraft an den Boden gefesselt. An Gedächtnisschwund leidend. Ich kann mich nicht erinnern oder über das sprechen, was ich verzweifelten Menschen zumindest erklären könnte, nachdem ich ihre Toten versorgt habe. Wenn ich ihre Fragen beantworte, klinge ich bestenfalls klinisch. Und die Fragen sind immer dieselben.
Warum? Warum? Warum!
Wie konnte jemand so etwas tun?
Darauf hatte ich noch nie eine gute Antwort. Obwohl es sie gibt und ich ganz kurz Kenntnis davon hatte. Was ich immer hatte sagen wollen, lag mir auf der Zunge. Und dann kam ich wieder zu mir, und mein Wissen wurde von dem verdrängt, was ich vor kurzem erlebt hatte. Unerträgliche Bilder, die niemand je sehen sollte. Blut und Messing in einem Flur voller weihnachtlich geschmückter Pinnwände. Und dann das Innere des Klassenzimmers. Die Kinder, die ich nicht retten konnte. Die Eltern, die ich nicht trösten konnte. Die beruhigenden Antworten, die ich nicht kannte.
Haben sie gelitten?
Wie lange hat es gedauert?
Das liegt nur an der Grippe, sage ich mir. Schließlich habe ich schon alles erlebt und kann alles verkraften. Und ich spüre, dass sich in mir die Wut regt wie ein schlafender Drache.
»Glaube mir, du möchtest nicht, dass sich jemand anderer drum kümmert«, beharrt Marino, und wenn ich ehrlich mit mir bin, freue ich mich, seine Stimme zu hören.
Ich will ihn nicht so vermissen, wie ich es vor kurzem getan habe. Keinen anderen als ihn hätte ich zu diesem wild gewordenen Medienzirkus mitgenommen. Die Übertragungswagen der Fernsehsender mit ihren auf Stativen montierten Satellitenschüsseln stauten sich in den Straßen, und über unseren Köpfen dröhnten pausenlos Hubschrauber, als würde ein Film gedreht.
Wurden die Schüsse aus nächster Nähe abgegeben?
Wieder meldet sich die Wut, und ich kann mir nicht leisten, ihn zu wecken. Den schlafenden Drachen in mir. Es war besser, dass Marino nicht dabei war. Es hat sich nur nicht so angefühlt. Ich weiß, wie viel er aushält, und er wäre zersprungen wie Glas von einem Vibrieren, das zu schrill für die Ohren ist.
»Ich kann dir nur sagen, dass ich in dieser Sache ein komisches Bauchgefühl habe, Doc«, höre ich seine vertraute Stimme. Doch sie klingt anders, kräftiger und selbstbewusster. »Irgendwo läuft ein perverses Arschloch rum, und das hier war erst der Anfang. Vielleicht hat ihn die Sache, die letztens passiert ist, ja erst auf den Gedanken gebracht.«
»Die Sache in Connecticut?« Ich verstehe nicht ganz, wie er darauf kommt. Er soll endlich aufhören, darüber zu sprechen.
»So funktioniert es doch meistens«, erwidert er. »Irgendein perverses Arschloch äfft ein anderes perverses Arschloch nach, das in einem Kino oder in einer Schule rumballert, um sich wichtig zu machen.«
Ich stelle mir vor, wie er bei diesem Wetter durch die dunklen Straßen von Cambridge fährt. Bestimmt ohne Sicherheitsgurt, und ihm deshalb Vorträge zu halten, ist jetzt, seit er wieder Polizist ist, nichts als Zeitverschwendung. Er ist rasch zu seinen schlechten Angewohnheiten von früher zurückgekehrt.
»Sie wurde nicht erschossen, oder?«, frage ich ihn, und zwar in der Absicht, ihn von seinem schrecklichen Thema abzubringen. »Du bist nicht mal sicher, ob es überhaupt ein Mord ist, richtig?«
»Allem Anschein nach wurde sie nicht erschossen«, bestätigt Marino.
»Dann wollen wir keine Verwirrung stiften, indem wir Vergleiche mit Connecticut anstellen.«
»Es kotzt mich an, dass diese Arschlöcher von den Medien auch noch belohnt werden.«
»Geht uns das nicht allen so?«
»Damit macht man die Sache nur noch schlimmer. Wir sollten die Namen dieser Typen nicht veröffentlichen und sie, verdammt noch mal, in anonymen Gräbern verscharren.«
»Lass uns bei unserem aktuellen Fall bleiben. Wurden offensichtliche Verletzungen festgestellt?«
»Nicht auf den ersten Blick«, antwortet er. »Aber sie hat sich ganz sicher nicht selbst in ein Laken gewickelt, ist barfuß hinausgegangen und hat sich bei Regen in den Schlamm gelegt, um dort zu sterben.«
Dass Marino meinen Stellvertreter Luke Zenner und die anderen Rechtsmediziner am Cambridge Forensic Center übergeht, liegt nicht daran, dass ich am besten qualifiziert bin, obwohl das zutrifft. Marino will, dass alles so wird wie früher, damit die Rollen wieder so verteilt sind wie bei unserer ersten Begegnung. Er arbeitet nicht mehr für mich, sondern kann mich nach Bedarf anfordern. So sieht er die Situation, und er wird mich bei jeder Gelegenheit daran erinnern.
»Das heißt, wenn es dir wirklich zu viel ist …«, sagt er, was bei ihm wie eine Herausforderung klingt. Vielleicht will er mich auch provozieren.
Ich weiß nicht. Wie soll ich im Moment irgendetwas beurteilen? Ich bin total erledigt und ausgehungert und kann einfach nicht aufhören, an gekochte Eier mit Butter und geschrotetem Pfeffer zu denken. Dazu frischgebackenes und noch ofenwarmes Brot und ein Espresso. Für ein Glas eisgekühlten, frischgepressten Blutorangensaft würde ich einen Mord begehen.
»Nein, nein, das Schlimmste habe ich überstanden.« Ich greife nach der Wasserflasche auf dem Nachttisch. »Ich muss mich nur noch ein bisschen sortieren.« Ich nehme einen einzigen großen Schluck; der Durst ist nicht länger unstillbar, und Lippen und Zunge fühlen sich nicht mehr an wie Schmirgelpapier. »Ich habe vor dem Schlafengehen Hustensaft genommen. Kodein.«
»Schön für dich.«
»Ich bin ein bisschen groggy, aber sonst okay. Allerdings ist es keine gute Idee, wenn ich jetzt Auto fahre. Nicht bei diesem Wetter. Wer hat sie gefunden?«
Vielleicht hat er mir das ja schon erzählt. Ich drücke die Hand an die Stirn. Kein Fieber. Ich bin sicher, dass es nun wirklich weg ist, nicht nur mit Ibuprofen medikamentös unterdrückt.
»Ein Mädchen vom MIT und ein Typ aus Harvard, die ein Date hatten und in ihrem Wohnheimzimmer unter sich sein wollten. Kennst du Simmons Hall? Der Riesenkasten, der aussieht wie aus Legosteinen gebaut, auf der anderen Seite der Baseball- und Rugbyfelder des MIT«, erwidert Marino.
Ich stelle fest, das er den Polizeifunk auf voller Lautstärke laufen hat. Bestimmt fühlt er sich wie ein Fisch im Wasser. Bewaffnet und gefährlich, mit einer Dienstmarke am Gürtel und am Steuer eines Zivilfahrzeugs, ausgestattet mit Blaulicht, Sirene und allen anderen Spielzeugen. Damals als Cop hat er seine Dienstwagen aufgemotzt wie seine Harleys.
»Die beiden haben etwas, das sie zuerst für eine Schaufensterpuppe mit Toga gehalten haben, im Schlamm am Spielfeldrand liegen sehen, und zwar innerhalb des Zauns, der das Spielfeld von einem Parkplatz trennt«, erklärt der Marino aus meiner Vergangenheit, der Detective. »Also sind sie durch ein offenes Tor gegangen, um sich die Sache aus der Nähe anzuschauen. Und als sie gemerkt haben, dass es eine in ein Laken gewickelte Frau ist, die drunter nichts anhat und nicht mehr atmet, haben sie die Polizei angerufen.«
»Die Leiche ist nackt?« Was mich wirklich interessiert, ist, ob sie bewegt wurde und von wem.
»Angeblich haben sie sie nicht angefasst. Das Laken ist klatschnass, und offenbar kann man deshalb sehen, dass sie unbekleidet ist. Machado hat mit den beiden geredet, und er ist sicher, dass sie nichts mit ihrem Tod zu tun haben. Wir werden trotzdem DNA-Abstriche nehmen und uns über sie informieren.«
Er fügt hinzu, dass Sil Machado, Detective beim Cambridge Police Department, den Verdacht hat, die Frau könne an einer Überdosis gestorben sein. »Was möglicherweise etwas mit dem schrägen Selbstmord von neulich zu tun hat«, ergänzt er. »Wie du weißt, ist momentan gepanschtes Zeug im Umlauf, das uns Riesenprobleme macht.«
»Was für ein Selbstmord?« Leider hat es, während ich in Connecticut und krank war, eine ganze Reihe davon gegeben.
»Die Modedesignerin, die vom Dach ihres Mietshauses in Cambridge gesprungen ist. Sie hat das Glasdach des Fitnessstudios im Parterre durchschlagen, während drinnen Leute am Trainieren waren«, antwortet er. »Es sah aus, als wäre eine Bombe hochgegangen. Jedenfalls glaubt man, dass da ein Zusammenhang besteht.«
»Warum?«
»Sie denken, es könnten Drogen im Spiel sein, irgendein Mist, den sie eingeworfen hat.«
»Wer sind sie?« Natürlich habe ich den Selbstmord nicht untersucht. Ich greife nach dem Stapel Fallakten auf dem Boden neben meinem Bett.
»Machado. Und auch sein Sergeant und sein Lieutenant«, erwidert Marino. »Inzwischen befassen sich sogar die Ressortleiter und der Polizeichef damit.«
Ich lege die Akten aufs Bett. Es müssen mindestens zwölf Aktenordner sein. Ausdrucke von Autopsieberichten und Fotos, die mein Verwaltungschef Bryce Clark mir jeden Tag mit den Lebensmitteln, die er netterweise für mich einkauft, auf die Veranda legt.
»Die Sorge ist, dass es schlechtes Meth oder irgendeine miese Designerdroge sein könnte, in anderen Worten eine nagelneue Version Badesalz, die zurzeit auf der Straße gedealt wird. Vielleicht hat die Selbstmörderin ja so was genommen«, teilt Marino mir mit. »Eine Theorie lautet, dass Gail Shipton, wenn sie die Leiche ist, sich mit jemandem getroffen hat, der solche üblen Drogen einwirft. Sie hat eine Überdosis erwischt, und er hat die Leiche dann entsorgt.«
»Ist das auch deine Theorie?«
»Auf gar keinen Fall. Wenn man eine Leiche loswerden will, legt man sie doch nicht auf einen dämlichen Uni-Sportplatz, damit auch ja jemand drüber stolpert und einen Riesenschreck kriegt. Und das ist der Punkt. Wenn man nur genug Wirbel macht, kommt es in den Nachrichten, und sogar der Präsident der Vereinigten Staaten interessiert sich dafür. Meiner Ansicht nach ist der Typ, der ihre Leiche am Briggs Field deponiert hat, genau einer von dieser Sorte. Er will Aufmerksamkeit und in die Fernsehnachrichten.«
»Könnte teilweise zutreffen, ist aber vermutlich nicht die ganze Geschichte.«
»Ich maile dir mal ein paar Fotos, die Machado mir geschickt hat«, hallt Marinos dunkle Stimme weiter in meinem Ohr. Derb und aufdringlich.
»Du sollst beim Autofahren nicht simsen.« Ich greife nach meinem iPad.
»Na und, dann verpasse ich mir eben selber einen Strafzettel.«
»Irgendwelche Schleifspuren oder andere Hinweise darauf, wie die Leiche dort gelandet ist?«
»Auf den Fotos kannst du sehen, dass es da wirklich sehr schlammig ist. Leider hat der Regen mögliche Schleifspuren oder Fußabdrücke weggespült. Aber ich war noch nicht dort und habe noch nicht selber nachgeschaut.«
Ich öffne die Fotos, die er mir gemailt hat, und sehe das regennasse Gras und den roten Schlamm am Zaun von Briggs Field. Dann hole ich das Foto von der in Weiß gehüllten Toten näher heran. Sie ist schlank und liegt flach auf dem Rücken. Ihr langes, nasses braunes Haar ist ordentlich um ein hübsches junges Gesicht drapiert, das leicht nach links geneigt und mit Regentropfen bedeckt ist. Das Laken ist wie ein Badehandtuch um ihre Brust gewickelt – so wie in der Sauna.
Etwas daran kommt mir bekannt vor. Ich erkenne eine erschreckende Ähnlichkeit zu den Fotos, die Benton mir vor einigen Wochen geschickt hat, wobei er ein beträchtliches Risiko eingegangen ist. Ohne Genehmigung des FBI hat er mich nach meiner Meinung zu den Mordfällen gefragt, in denen er in Washington ermittelt. Nur dass diese Frauen im Gegensatz zu der hier Plastiktüten über dem Kopf hatten. Außerdem hatten sie Deko-Klebeband um den Hals und noch eine Schleife umgebunden, eine Eigenheit des Täters, die hier fehlt.
Wir wissen ja noch nicht einmal, ob sie ermordet wurde, halte ich mir vor Augen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie einfach überraschend gestorben ist, worauf ihr Begleiter in Panik geraten ist und sie in ein Bettlaken, vielleicht eines aus einem Studentenheim, gewickelt und draußen abgelegt hat, damit sie rasch gefunden wird.
»Wahrscheinlich ist jemand mit dem Auto auf den Parkplatz und nah an den Zaun gefahren, hat das Tor aufgemacht und sie dann reingeschleppt oder -getragen«, spricht Marino weiter, während ich das Bild auf meinem iPad betrachte. Es verstört mich auf einer Ebene, die ich nicht zu fassen bekomme, absolut intuitiv, weshalb ich versuche, meine Gefühle zu rationalisieren. Doch es gelingt mir nicht, und ich darf es ihm nicht sagen.
Benton würde hochkant rausfliegen, wenn das FBI wüsste, dass er seiner Frau geheime Informationen zugänglich gemacht hat. Es spielt keine Rolle, dass ich Expertin und auch für Fälle der Bundespolizei zuständig bin, weshalb es ohnehin sinnvoll gewesen wäre, mich zu Rate zu ziehen. Für gewöhnlich geschieht das auch, allerdings nicht in diesem Fall, und zwar aus unerklärlichen Gründen. Bentons Chef, Ed Granby, kann mich nicht leiden, und es wäre ihm ein Vergnügen, Benton zu degradieren und vor die Tür zu setzen.
»Dieses eine Tor war nicht abgeschlossen«, fährt Marino fort. »Das Pärchen, das die Leiche gefunden hat, sagte, es sei zwar zu, aber nicht abgeschlossen gewesen, als sie kamen. Die übrigen Tore sind mit Ketten und Vorhängeschlössern gesichert, damit außerhalb der Öffnungszeiten niemand Zutritt hat. Also wusste der Täter entweder, dass dieses eine Tor offen ist, hatte einen Schlüssel oder hat einen Bolzenschneider benutzt.«
»Die Leiche wurde drapiert.« Der Nachklang der Kopfschmerzen sorgt dafür, dass mir der Kopf schwer wird. »Auf dem Rücken, Beine zusammen und gerade, ein Arm anmutig auf dem Bauch ruhend, der andere ausgestreckt. Das Handgelenk in einer theatralischen Geste angewinkelt wie bei einer Tänzerin oder als sei sie ohnmächtig auf eine Couch gesunken. Nichts ist in Unordnung. Das Laken ist akkurat um sie gewickelt. Allerdings bin ich nicht sicher, ob es überhaupt ein Laken ist.«
Ich hole das Bild so nah heran, wie es möglich ist, ohne dass es sich in einzelne Pixel auflöst.
»Jedenfalls ist es ein weißes Stück Stoff. Ihre Körperhaltung ist rituell, symbolisch.« Da bin ich ganz sicher, und dass ich ein Flattern im Magen habe, liegt an meiner Angst.
Was, wenn es sich um denselben Täter handelt? Wenn er hier ist? Ich halte mir vor Augen, dass die Fälle in Washington mir deshalb so frisch in Erinnerung sind, weil Benton aus diesem Grund nicht hier ist und weil ich vor nicht allzu langer Zeit die Tatortfotos und die Autopsie- und Laborberichte studiert habe. Eine in weißen Stoff gewickelte Leiche, die entspannt und nicht anzüglich drapiert wurde, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, sage ich mir immer wieder.
»Sie wurde absichtlich so abgelegt«, meint Marino, »weil es für das perverse Arschloch, das sie umgebracht hat, irgendeine Bedeutung hat.«
»Wie konnte jemand die Leiche unbeobachtet dort ablegen?« Ich versuche, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. »Auf einem Sportplatz mitten zwischen den Dienstwohnungen und Studentenheimen des MIT? Das lässt doch darauf schließen, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der sich hier auskennt, möglicherweise einem anderen Studenten, einem Mitarbeiter oder sonst jemandem, der in der Nähe wohnt oder arbeitet.«
»Die Stelle, wo sie liegt, ist nachts nicht beleuchtet«, erwidert er. »Hinter der Tennishalle, du kennst doch diese große weiße Blase, und dann kommen die Sportplätze. Ich hole dich in dreißig, vierzig Minuten ab. Jetzt bin ich vor der Psi Bar. Natürlich geschlossen. Keine Menschenseele in Sicht, alles dunkel. Ich schau mich mal draußen um und sehe nach, wo sie telefoniert haben könnte. Dann komme ich zu dir.«
»Du bist allein«, mutmaße ich.
»Zehn-vier.«
»Dann sei bitte vorsichtig.«
Ich sitze im Bett im Schlafzimmer in unserem Haus aus dem neunzehnten Jahrhundert, das von einem Transzendentalisten erbaut wurde, und sortiere die Akten.
Mit dem Selbstmord, den Marino erwähnt hat, fange ich an. Vor drei Tagen, am Sonntag, dem 16. Dezember, ist die sechsundzwanzigjährige Sakura Yamagata vom Dach ihres neunzehnstöckigen Wohnhauses in Cambridge gesprungen. Die Todesursache ist die, mit der ich bei so einem brutalen Ereignis auch rechnen würde. Mehrfache stumpfe Gewalteinwirkung, traumatische Verletzungen, das Gehirn wurde aus dem Schädel gedrückt. Herz, Leber, Milz und Lunge perforiert. Gesichtsknochen, Rippen, Arme, Beine und Becken sind mehrfach gebrochen.
Ich sehe die Tatortfotos durch, auf denen einige schockiert vor sich hin starrende Menschen zu sehen sind. Viele tragen Sportbekleidung und schlingen wegen der Kälte die Arme um den Leib. Immer wieder ist derselbe, distinguiert wirkende grauhaarige Mann in Anzug und Krawatte zu sehen, der einen entsetzten und benommenen Eindruck macht. Auf einem der Fotos steht er neben Marino, der redet und mit dem Finger auf etwas deutet. Auf einem anderen kauert er mit traurig gesenktem Kopf neben der Leiche, wieder mit einem abgrundtief verzweifelten Ausdruck im Gesicht.
Ganz offensichtlich kannte er Sakura Yamagata persönlich, und ich kann mir den Schrecken der Menschen nur vorstellen, die sich gerade im Fitnessstudio im Parterre aufhielten, als die Leiche auf dem Boden aufschlug. Es war ein dumpfes Geräusch wie von einem schweren Sandsack, hat es ein Zeuge später in einer Nachrichtenmeldung geschildert, die ebenfalls der Akte beiliegt. Gewebe und Blut bespritzten die Glasfront, und Zähne und Knochensplitter haben sich bis zu fünfzehn Meter weit verteilt. Kopf und Gesicht der Toten waren bis zur Unkenntlichkeit zerschmettert.
Wenn sich jemand auf eine Art und Weise umbringt, die zu derart schweren Verstümmelungen führt, muss ich normalerweise an eine Psychose oder an Drogenmissbrauch denken. Und als ich den ausführlichen Polizeibericht durchblättere, fällt mir auf, wie seltsam ich es finde, Marinos Namen und Dienstnummer hier zu lesen.
Diensthabender Beamter: Marino, P.R. (D33.
Ich habe, seit seinem Abschied von der Polizei in Richmond vor zehn Jahren, keinen von ihm verfassten Polizeibericht mehr gelesen. Nun studiere ich seine Schilderung der Vorfälle in einem Luxushochhaus in Cambridge am vergangenen Sonntag.
… Ich traf nach dem Ereignis an o.g. Adresse ein und befragte Dr. Franz Schoenberg. Er teilte mir mit, er sei Psychiater mit Praxis in Cambridge. Sakura Yamagata, eine Modedesignerin, sei seine Patientin gewesen. Am Tage des Vorfalls, um 15:56, übermittelte sie ihm per SMS ihre Absicht, »nach Paris zu fliegen«, und zwar vom Dach ihres Hauses aus.
Etwa um 16:18 erschien Dr. Schoenberg bei o.g. Adresse und wurde durch eine Hintertür zum Dach begleitet. Er sagte mir, er habe sie nackt auf der Dachkante an der Außenseite eines niedrigen Geländers stehen sehen. Sie habe ihm den Rücken zugekehrt und die Arme weit ausgebreitet. Sofort habe er sie angesprochen: »Suki, ich bin da, alles wird gut.« Allerdings habe sie weder geantwortet noch sonst einen Hinweis darauf gegeben, dass sie ihn gehört habe. Im nächsten Moment sei sie nach vorn gekippt, und zwar in einem Sprung, den er als absichtlich beschreibt …
Luke Zenner hat sie obduziert und die nötigen Gewebeproben und Körperflüssigkeiten an die Toxikologie weitergeleitet. Herz, Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse, Blut …
Ich streiche Socks mageren Körper und spüre, wie sich die Rippen des Windhunds beim Atmen leicht heben und senken. Plötzlich fühle ich mich wieder erschöpft, als ob mir das Gespräch mit Marino alles abverlangt hätte. Ich habe Mühe, wach zu bleiben, als ich mir noch einmal die Fotos anschaue und nach denen von dem grauhaarigen Mann suche, der vermutlich Dr. Franz Schoenberg ist. Deshalb hat die Polizei ihn in die Nähe der Leiche gelassen. Deshalb steht er neben Marino. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, Zeuge werden zu müssen, wenn der eigene Patient vom Dach springt. Wie kann man so etwas jemals verarbeiten? Ich krame in meinem noch immer wirren Gedächtnis und frage mich, ob ich den Psychiater schon einmal irgendwo kennengelernt habe.
So etwas verkraftet man nie, denke ich. Über manche Dinge kann man niemals hinwegkommen, das geht nicht …
Gepanschte Drogen, hat Marino vorhin gemeint. Designerdrogen – »Badesalz« – sind seit einem Jahr in Massachusetts ein großes Problem, und wir hatten mit einer Reihe bizarrer Selbstmorde und Unfälle zu tun, die darauf zurückzuführen waren. Es gab auch einen besorgniserregenden Anstieg von Morden und Eigentumsdelikten, insbesondere in der Umgebung von Boston, wo die Section-8-Wohnblocks stehen, die von der Polizei als Sozialhilfeghettos bezeichnet werden. Drogenhändler und Bandenmitglieder bekommen für ein Butterbrot ein gemütliches Dach über dem Kopf und ruinieren dafür das Stadtviertel und terrorisieren ihre Umgebung. Ich gehe im Geiste die Liste der zu erledigenden Dinge durch, rufe meine Büro-Mails auf und bitte die Toxikologie, bei der Analyse im Fall Sakura Yamagata auf die Tube zu drücken und nach Designerdrogen zu suchen.
Mephedron, Methylendioxypyrovaleron und Methylon. Luke hat nicht an Halluzinogene gedacht, danach sollten wir auch Ausschau halten. LSD, Psilocybin, Ergotamin …
Meine Gedanken schweifen ab und kehren wieder zum Thema zurück.
Mutterkornalkaloide können Ergotismus auslösen, auch als Kribbelkrankheit oder Antoniusfeuer bekannt. Die Symptome erinnern an Besessenheit und haben einigen Theorien zufolge zu den Hexenprozessen von Salem geführt. Krämpfe, Spasmen, Wahnvorstellungen, Psychosen …
Mein Blick verschwimmt und wird wieder klar, mein Kopf sackt nach vorn und fährt wieder hoch. Regen prasselt gegen Dach und Fenster. Ich hätte Marino anweisen sollen, dafür zu sorgen, dass jemand ein Zelt aus einer wasserfesten Plane oder einem kunststoffbeschichteten Laken über der Leiche aufbaut, um sie vor dem Wetter und neugierigen Blicken zu schützen. Und mich auch. Ich habe keine Lust, draußen im Regen herumzustehen, nass zu werden bis auf die Haut und mich von Fernsehkameras filmen zu lassen …
Überall wimmelte es von Übertragungswagen, weshalb wir darauf geachtet haben, dass alle Rollos heruntergezogen waren. Ein dunkelbrauner Teppichboden. Dicke geronnene Blutpfützen, die ich riechen konnte, als der Zerfallsprozess einsetzte. Meine Schuhsohlen waren klebrig, als ich im Raum hin und her ging. Es war unmöglich, nicht in Blut zu treten. Alles war voller Blut, und ich gab mir solche Mühe, nicht hineinzutreten und den Tatort gründlich zu untersuchen. Als ob das eine Rolle gespielt hätte.
Denn da ist niemand, den man bestrafen könnte, und außerdem wäre keine Strafe schwer genug. Während ich ruhig und an Kissen gelehnt dasitze, versteckt sich die Wut in einer dunklen Ecke, hält still und schaut mit zitringelben Augen heraus. Ich sehe ihre massige Gestalt und spüre ihr Gewicht am Fußende meines Bettes.
Marino hat sich bestimmt darum gekümmert, dass die Leiche abgedeckt wird.
Die Wut verlagert ihr Gewicht. Geräusch und Rhythmus des Wolkenbruchs wechseln von fortissimo zu pianissimo …
Marino weiß, was er tut.
Fuge von adagio zu furioso …
3
Vor zehn Jahren
Richmond, Virginia
Ein Wolkenbruch ergießt sich über die Einfahrt, setzt das Granitpflaster unter Wasser und peitscht gegen die Bäume. Ein Sommergewitter, ein zorniger Himmel über einer Stadt, der ich den Rücken kehren werde.
Ich kauere schwitzend in meiner Garage und schneide ein Stück Paketband ab. Vom Alkohol fühle ich mich ein wenig ausgelassen und seltsam. Pete Marino, Detective beim Richmond Police Department, will mich betrunken machen, um meinen geschwächten Zustand auszunutzen.
Vielleicht sollte ich ja mit dir schlafen, um es hinter mich zu bringen.
Mit einem Markierstift beschrifte ich Kartons nach den verschiedenen Bereichen meines Hauses in Richmond, das ich aus wiederverwertetem Holz und Stein gebaut habe. Es sollte mein Traumhaus für immer sein: »Wohnzimmer, Badezimmer, Gästezimmer, Küche, Abstellkammer, Waschküche, Büro …« Alles, um mir später das Auspacken leichter zu machen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wohin die Reise gehen soll.
»O Gott, wie ich Umzüge hasse.« Ich fahre mit dem Klebebandabroller über den Karton. Es klingt, als würde Stoff zerrissen.
»Warum ziehst du dann ständig um?« Marino flirtet wie ein Wilder, und ich lasse ihn für den Moment gewähren.
»Ständig?« Ich lache laut über diese alberne Bemerkung.
»Und dann noch in derselben gottverdammten Stadt. Von einem Viertel ins andere.« Er zuckt die Achseln. Offenbar merkt er nicht, was wirklich zwischen uns läuft. »Da verliert man ja den Überblick.«
»Ich ziehe ja nicht ohne guten Grund um.« Ich klinge wie eine Anwältin.
Ich bin Anwältin. Ärztin. Vorgesetzte.
»Lauf, so schnell zu kannst.« Marinos blutunterlaufene Augen heften mich an seine emotionale Pinnwand.
Ich bin ein Schmetterling. Ein Limenitis arthemis. Ein Tigerschwalbenschwanz. Ein Pfauenspinner.
Wenn ich dich lasse, streifst du mir die Farbe von den Flügeln. Dann bin ich eine Trophäe, an der du das Interesse verlieren wirst. Sei mein Freund. Warum genügt dir das nicht?
Ich sichere den Deckel des nächsten Kartons. Der Wolkenbruch vor meiner offenen Garagentür tröstet mich. Dunst weht herein. Einhundert Prozent Luftfeuchtigkeit. Dampfend. Tropfend. Wie eine große heiße Badewanne. Wie im Inneren der Gebärmutter. Wie ein warmer Körper, der sich an meinen schmiegt, ein Austausch warmer Flüssigkeiten auf der Haut und tief in einsamen traurigen Orten. Ich will, dass Hitze und Feuchtigkeit mich umarmen und mich umfangen wie meine durchgeschwitzten Kleider, die an mir kleben, während Marino in einer abgeschnittenen Jogginghose und einem ärmellosen T-Shirt auf einem Klappstuhl sitzt. Sein Gesicht ist von Lust, Begierde und Bier gerötet.
Ich frage mich, wer wohl der nächste aufdringliche Detective ist, mit dem ich konfrontiert werde, und ich habe nicht die geringste Lust darauf. Jemand, den ich ausbilden und ertragen muss, den ich respektieren und verabscheuen werde, den ich irgendwann sattbekomme und doch Sehnsucht nach ihm habe und ihn auf meine Weise liebe. Es könnte auch eine Frau sein, halte ich mir vor Augen. Irgendeine mit allen Wassern gewaschene Ermittlerin, die sich mit dem neuen Chief Medical Examiner verbünden will und alle möglichen Dinge als selbstverständlich voraussetzt.
Ich male mir eine Polizistin aus, die scharf wie ein Schießhund ist, an jedem Tatort und zu jeder Autopsie erscheint, ständig bei mir im Büro steht und sonst mit ihrem dröhnenden Pick-up oder dem Motorrad herumkurvt wie Marino. Eine kräftig gebaute, tätowierte, sonnengebräunte Frau, die eine Jeansweste und ein Bikerkopftuch trägt und mich am liebsten bei lebendigem Leibe auffressen würde.
Ich verhalte mich unvernünftig, unfair, heuchlerisch und beschränkt. Lucy kommandiert die Frauen, für die sie sich interessiert, schließlich auch nicht herum. Sie hat weder Tattoos noch ein Bikerkopftuch. Sie hat es nämlich nicht nötig, zum Raubtier zu werden, um zu bekommen, was sie will.
Diese aufdringlichen Zwangsgedanken will ich nicht. Was ist nur los mit mir?
Trauer bohrt sich mir in die hohlen Organe in Bauch und Brust, bis ich kaum noch atmen kann. Es überwältigt mich, was ich alles zurücklassen muss. Eigentlich geht es nicht um dieses Haus, Richmond oder Virginia. Benton ist tot. Er wurde vor fünf Jahren ermordet. Doch solange ich hiergeblieben bin, habe ich ihn in diesen Räumen und auf den Straßen gespürt, auf denen ich fahre. An brütend heißen Sommertagen und im eiskalten trüben Winter, als sähe er mir zu und erspürte mich und jede Schattierung meines Seins.
Ich nehme ihn in jedem Luftzug und Geruch und auch in den Schatten wahr, die meine Gefühle geworden sind, und zwar als Stimme, die ich nicht erreichen kann und die mir sagt, dass er nicht tot ist. Dass er zurückkommt. Dass es nur ein Albtraum ist, nicht die Wirklichkeit. Dass ich aufwachen werde, und er ist da. Seine haselnussbraunen Augen blicken in meine, seine langen, schlanken Finger berühren mich. Ich spüre seine Wärme, seine Haut, seine makellos geformten Muskeln und Knochen, so unverkennbar, wenn er mich in die Arme nimmt, und dann werde ich so lebendig sein wie früher.
Dann muss ich nicht an einen im Grunde genommen toten Ort ziehen, wo weitere Anteile von mir Zentimeter um Zentimeter und Zelle um Zelle verdorren werden. Ich stelle mir die dichten Wälder hinter meinem Grundstück, den Kanal und die Bahngleise vor. Hier befindet sich das Ufer des James River, der an dieser Stelle steinig ist. Hinter Lockgreen liegt ein Stadtteil ohne Geschichte, eine eingezäunte Enklave aus Neubauten, bewohnt von Menschen mit Geld, denen viel an ihrer Privatsphäre und Sicherheit liegt.
Nachbarn, die ich kaum je zu Gesicht bekomme. Privilegierte, die mich nie nach den jüngsten Tragödien auf meinen Edelstahltischen ausfragen. Ich bin eine Italienerin aus Miami, eine Außenseiterin. Der alte Wachmann hier in Richmonds West End weiß nicht, wo er mich einordnen soll. Sie winken nicht. Sie grüßen nicht. Sie beäugen mein Haus, als würde es dort spuken.
Ich bin allein auf den Straßen spazieren gegangen, durch den Wald zum Kanal, über die rostigen Eisenbahnschienen und zum Wasser, das über die Felsen strömt. Dabei habe ich an den Bürgerkrieg gedacht und an die Kolonie, ein Stück flussaufwärts in Jamestown, vor einigen Jahrhunderten die erste dauerhafte englische Siedlung. Da ich vom Tod umgeben bin, trösten mich diese präsente Vergangenheit, diese Anfänge, die niemals enden, und meine Überzeugung, dass nichts ohne eine bestimmten Grund geschieht und dass irgendwann alles gut wird.
Wie konnte es nur so weit kommen?
Als ich noch einen Karton zuklebe, spüre ich Bentons Tod wie einen eiskalten Atemhauch im Nacken. Die feuchte Luft bewegt sich. Ich bin leer und so unbeschreiblich traurig darüber. Und dankbar für den Regen und seine schweren, alles erfüllenden Geräusche.
»Du siehst aus, als würdest du gleich zu weinen anfangen.« Marino beobachtet mich. »Warum weinst du?«
»Der Schweiß brennt mir in den Augen. Hier drin ist es heiß wie in einem Backofen.«
»Dann mach die verdammte Tür zu und schalt die Klimaanlage ein.«
»Ich will den Regen hören.«
»Warum?«
»Weil ich ihn nie wieder hier drin und so wie jetzt hören werde.«
»Mein Gott, Regen ist Regen.« Er späht zur offenen Garagentür hinaus, als ob der Regen heute anders sein könnte, eine Art Regen, die er noch nie zuvor gesehen hat. Dann runzelt er die Stirn wie immer, wenn er angestrengt nachdenkt. Auf seiner sonnengebräunte Stirn bilden sich Falten. Er beißt sich auf die Unterlippe und kratzt sich am massigen Kiefer.
Marino ist kantig und kräftig gebaut, ein Hüne, der Aggression ausstrahlt. Bevor seine schlechten Angewohnheiten schon recht früh in seinem harten Leben die Oberhand gewonnen haben, muss er beinahe attraktiv gewesen sein. Sein dunkles Haar ist ergraut und mit Pomade über seine Glatze gekämmt, etwas, zu dem er ebenso wenig steht wie zu der Tatsache, dass er vorzeitig kahl wird. Er ist über eins achtzig groß, breit und grobknochig, und wenn seine Arme und Beine nackt sind wie jetzt, werde ich daran erinnert, dass er früher einmal Golden-Gloves-Boxer war und keine Pistole braucht, um jemanden zu töten.
»Ich kapiere einfach nicht, warum du freiwillig zurückgetreten bist.« Er starrt mich an, ohne mit der Wimper zu zucken. »Nur um dann fast noch ein Jahr hier rumzuhängen, damit die Arschlöcher auch genug Zeit hatten, einen Nachfolger für dich zu finden. Das war absolut dämlich. Du hättest nicht freiwillig gehen sollen. Ich scheiß auf die.«
»Lass uns doch ehrlich sein: Ich bin gefeuert worden. Das ist die Wahrheit, die dahintersteckt, wenn man seinen Rücktritt anbietet, weil man den Gouverneur in Verlegenheit gebracht hat«, antworte ich, inzwischen ein wenig ruhiger.
»Du bist dem Gouverneur nicht zum ersten Mal auf den Schlips getreten.«
»Und es wird auch nicht das letzte Mal sein.«
»Weil du nicht weißt, wann man aufhören muss.«
»Ich dachte, das hätte ich gerade getan.«
Er beobachtet jede meiner Bewegungen, als sei ich eine Verdächtige, die gleich zur Waffe greifen könnte. Ich beschrifte weiter Kartons wie Beweisstücke: »Scarpetta«, das heutige Datum, Gegenstände, bestimmt für den Wandschrank im Schlafzimmer eines gemieteten Hauses in Florida, wo ich nicht hinwill. Es fühlt sich an, als katapultiere mich eine Niederlage von apokalyptischen Ausmaßen wieder in den Bundesstaat meiner Geburt.
Zum Ausgangspunkt zurückzukehren, ist das ultimative Scheitern, ein Beweis dessen, dass ich es nicht geschafft habe, mich über meine Herkunft zu erheben. Ich bin nicht besser als meine um sich selbst kreisende Mutter und meine narzisstische, männerfixierte Schwester Dorothy, die ihr einziges Kind Lucy sträflich vernachlässigt hat.
»Was war die längste Zeit, die du an ein und demselben Ort verbracht hast?«, setzt Marino gnadenlos sein Verhör fort und drängt sich damit übergriffig an Orte vor, zu denen ich ihm niemals Zutritt gewähren würde.
Er fühlt sich dazu berechtigt, und das ist meine Schuld, weil ich mit ihm trinke und mich auf eine Art und Weise von ihm verabschiede, die eher wie »Hallo, verlass mich nicht« klingt. Er liest meine Gedanken.
Wenn ich dich ranlasse, wird es vielleicht weniger wichtig.
»Wahrscheinlich in Miami«, erwidere ich. »Bis ich sechzehn war und angefangen habe, an der Cornell University zu studieren.«
»Sechzehn. Auch eines dieser Genies. Du und Lucy, ihr seid aus demselben Holz geschnitzt.« Seine blutunterlaufenen Augen fixieren mich. Darin ist nichts Subtiles zu sehen. »Ich bin schon fast so lange in Richmond, es ist Zeit, weiterzuziehen.«
Ich klebe den nächsten Karton zu, der die Aufschrift »Vertraulich« trägt und Autopsieberichte, Fallstudien und andere Dinge enthält, die ich geheim halten möchte, während er mich mit Blicken auszieht. Vielleicht will er sich ja auch nur ein Bild von mir machen, weil er besorgt ist, ich könnte durchdrehen und wegen des jähen Absturzes meiner Traumkarriere ein bisschen durch den Wind sein.
Dr. Kay Scarpetta, die erste Frau, die zum Chief Medical Examiner des Staates Virginia ernannt wurde, ist nun auch die Erste, die gezwungen war, das Amt aufzugeben … Wenn ich das noch ein einziges Mal in den gottverdammten Nachrichten höre …
»Ich kündige bei der Polizei«, sagt er.
Ich reagiere nicht überrascht, sondern gar nicht.
»Du kennst den Grund, Doc. Du hast damit gerechnet. Genau das hast du gewollt. Warum weinst du? Das ist kein Schweiß. Du weinst. Was ist los? Du wärst sauer, wenn ich nicht hinschmeißen und zusammen mit dir dieses Drecksnest verlassen würde, gib es zu. Hey. Schon gut«, meint er liebevoll. Wie immer versteht er alles falsch, und es wirkt gefährlich tröstend auf mich. »Mich wirst du nicht so schnell los«, fährt er fort, was mich freut, allerdings anders, als er glaubt. Und so unterhalten wir uns weiter in zwei verschiedenen Sprachen.
Er holt zwei Zigaretten aus einem Päckchen und steht auf, um mir eine zu geben. Sein Arm berührt mich, als er das Feuerzeug daran hält. Es flammt auf, und er zieht das Feuerzeug wieder weg, wobei mich sein Handrücken streift. Ich rühre mich nicht und nehme einen tiefen Zug.
»So viel zum Thema aufhören.« Ich meine, mit dem Rauchen.
Nicht, dass er beim Richmond Police Department aufhört. Er wird es tun, und ich sollte das nicht wollen, weil ich keine Hellseherin zu sein brauchte, um das Ergebnis und das Nachspiel vorauszusagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zornig und deprimiert sein und sich entmannt fühlen wird. Er wird immer frustrierter und eifersüchtiger werden und außer Kontrolle geraten. Und eines Tages wird er sich rächen. Er wird mir weh tun. Alles hat seinen Preis.
Ein Ratschen ertönt, als ich den nächsten Karton zuklebe, den ich wie die anderen auf die weiße Mauer aus Pappe schichte, die nach abgestandener Luft und Staub riecht.
»In Florida wohnen. Angeln, auf meiner Harley herumfahren, kein Schnee mehr. Du weißt ja, wie sehr ich kaltes Mistwetter hasse.« Er pustet eine Rauchwolke aus. Als er sich wieder auf seinen Stuhl setzt und sich zurücklehnt, verfliegt sein kräftiger Geruch. »An diesem Provinznest werde ich rein gar nichts vermissen.« Er schnippt Asche auf den Betonboden und schiebt Zigarettenschachtel und Feuerzeug tiefer in die Brusttasche seines schweißfleckigen T-Shirts.
»Du wirst unglücklich sein, wenn du die Polizeiarbeit aufgibst«, sage ich schonungslos.
Aber ich werde es ihm nicht ausreden können.
»Polizist zu sein, ist für dich kein Beruf, sondern Teil deiner Persönlichkeit«, füge ich hinzu.
Ich nehme kein Blatt vor den Mund.
»Du musst Leute verhaften. Türen eintreten. Deine Drohungen auch wahr machen können. Miese Halunken im Gerichtssaal böse anschauen und dafür sorgen, dass sie in den Knast wandern. Das ist deine raison d’etre, Marino, der Sinn deines Lebens.«
»Ich weiß, was raison d’etre bedeutet. Du musst es mir nicht übersetzen.«
»Du brauchst die Macht, Leute zu bestrafen. Dafür lebst du.«
»Merde de bull. Die vielen tollen Fälle, an denen ich gearbeitet habe?« Er zuckt die Achseln. Das Geräusch des Regens wechselt von Prasseln zu Plätschern zu Trommeln. Seine massige Gestalt wird von dem unheimlichen grauen Licht des launischen Nachmittags beleuchtet. »Ich kann mir selber etwas suchen.«
»Was zum Beispiel?« Ich setze mich auf einen Karton und schnippe Asche weg.
»Dich.«
»Man kann sich nicht nur auf einen einzigen Menschen stützen, und heiraten werden wir ganz bestimmt nicht.« Ich bin zwar ehrlich, aber es ist nicht die ganze Wahrheit.
»Ich habe dir auch keinen Antrag gemacht. Hat jemand gehört, wie ich ihr einen Antrag gemacht habe?«, ruft er, als seien noch andere Leute bei uns in der Garage. »Ich habe dich nicht mal gefragt, ob du mit mir ausgehen willst.«
»Das würde auch nicht klappen.«
»Selten so gelacht. Wer könnte schon mit dir zusammenwohnen?«
Als ich die Kippe in eine leere Bierflasche werfe, erlischt sie zischend.
»Ich rede nur davon, für dich zu arbeiten.« Inzwischen weicht er meinem Blick aus. »Ich könnte dein Chefermittler werden, ein gutes Team aufbauen, ein Fortbildungsprogramm entwerfen. Das beste auf der Welt.«
»Du könntest nicht mehr in den Spiegel schauen.« Ich habe recht, aber er glaubt mir nicht.
Er raucht und trinkt, während der Regen auf das graue Granitpflaster vor der großen, quadratischen Öffnung niederprasselt. In der Ferne biegen sich die Bäume, und dunkle Wolken ballen sich zusammen. Und noch weiter weg sind die Bahngleise, der Kanal und der Fluss, der durch die Stadt verläuft, die ich verlassen werde.
»Und dann wirst du auch keinen Respekt vor mir mehr haben, Marino. Es wird so weit kommen.«
»Die Entscheidung steht.« Noch ein Schluck Bier, an der grünen Flasche sammelt sich tropfend Kondenswasser, während er mich noch immer nicht ansehen kann. »Wir haben alles geplant. Ich und Lucy.«
»Merk dir, was ich gerade gesagt habe. Jedes Wort«, entgegne ich von dem zugeklebten Karton aus, auf dem ich gerade sitze. »Nicht anfassen«, steht darauf.
4
Cambridge, Massachusetts
Mittwoch, 19. Dezember
4 Uhr 48
Vor dem Haus dröhnt ein Motor. Als ich die Augen aufschlage, erwarte ich, mit einem Markierstift beschriftete Kartons und einen schwitzenden Marino auf einem Klappstuhl zu sehen. Doch ich habe nur schlichte Möbel aus Kirschholz vor mir, die schon seit mehr als hundert Jahren im Besitz von Bentons neuenglischer Familie sind.
Ich erkenne champagnerfarbene Seidenvorhänge vor den Fenstern, das gestreifte Sofa und den Couchtisch davor, und dann verwandelt sich der braune Parkettboden in einen braunen Teppich. Süßlicher Verwesungsgeruch steigt mir in die Nase. Pfützen aus Blut, so dick wie Pudding. Dunkelrote Schmierer und Tropfen auf Tischen und Stühlen. Mit Wachsmalkreiden und Magic Marker ausgemalte Bilder und Kleiderhaken, an denen Kindertornister hängen, in einem bunten, chaotischen Unterrichtsraum einer ersten Klasse, von deren Schülern niemand mehr lebt.
Die flüchtigen Moleküle zerfallenden Blutes hängen in der Luft. Die roten Blutkörperchen trennen sich vom Serum. Gerinnung und Verwesung. Ich kann sie riechen. Dann nicht mehr. Eine Geruchshalluzination der Rezeptoren meines ersten Schädelnervs, angeregt vom Gedanken an eine Situation, die längst vergangen ist. Ich reibe mir den steifen Nacken und hole tief Luft, der eingebildete Geruch weicht dem Duft von antikem Holz und dem Zitrus-Ingwer-Duftspender mit Holzstäbchen auf dem Kaminsims. Ein leichter Hauch von Rauch und verbranntem Holz des letzten Feuers, das ich vor Bentons Abreise, vor Connecticut, angezündet habe, steigt mir in die Nase. Vor meiner Krankheit. Ich schaue auf die Uhr.
»Verdammt«, schimpfe ich.
Es ist kurz vor fünf. Offenbar bin ich nach Marinos Anruf wieder eingeschlafen, und nun steht er in meiner Auffahrt. Ich schicke ihm eine SMS, dass ich in einer Viertelstunde unten sein werde, weil ich mich an den Marino erinnere, mit dem ich gerade in der schwülen Hitze geredet und Bier getrunken habe. Jedes Bild, jedes Wort aus diesem Traum steht mir so klar vor Augen wie ein Film. Einiges davon sind Bruchstücke dessen, was wirklich geschehen ist, in dem Sommer, als ich vor zehn Jahren Virginia für immer den Rücken gekehrt habe. Manche Details haben meine tiefe Enttäuschung und meine Ängste hinzugedichtet.
Alles ist in seiner Symbolhaftigkeit wahr. Genau das habe damals in der dunkelsten meiner dunklen Zeiten gewusst und empfunden. Dass Benton ermordet worden war. Dass ich aus dem Amt gedrängt wurde, ausgetrickst von der Politik, von weißen Männern in Anzügen, die sich einen feuchten Kehricht um die Wahrheit scherten, geschweige um das, was ich verloren hatte – wie ich es sah, einfach alles.
Ich stelle die Füße auf den Boden und taste nach meinen Pantoffeln. Ich muss mich um einen Tatort kümmern, und Marino holt mich ab, so wie in der guten alten Zeit, damals in Richmond. Er nimmt an, dass es ein unschöner Fall werden wird, und meiner Vermutung nach wünscht er sich genau das. Er sehnt sich nach einem sensationellen Mordfall, um seinem verlorenen Ich auf die Sprünge zu helfen, während er sich aus der Asche dessen erhebt, was er – seiner Ansicht nach – meinetwegen vergeudet hat.
»Tut mir leid«, sage ich zu Sock, als ich ihn wieder wegschiebe und aufstehe. Ich bin zwar noch schwach und mir ist schwindelig, doch es geht mir schon viel besser.
Ich fühle mich gut. Eigentlich sogar seltsam euphorisch. Bentons Gegenwart hüllt mich ein. Er ist nicht tot, Gott sei Dank. Seine Ermordung wurde nur vorgetäuscht, ein geniales Manöver des genialen FBI, um ihn vor dem organisierten Verbrechen zu schützen, einem französischen Kartell, das er unterminiert hatte. Er durfte mir nicht mitteilen, dass er noch lebte und sicher in einem Zeugenschutzprogramm untergebracht war. Er durfte überhaupt keinen Kontakt zu mir haben, nicht den kleinsten Hinweis, während er mich aus der Ferne beobachtete und auf mich achtete, ohne dass ich es wusste. Ich habe ihn gespürt, da bin ich ganz sicher. Mein Traum ist wahr, es hätte einen besseren Weg gegeben, das Problem zu lösen, und ich werde dem FBI die verdorbenen Jahre niemals verzeihen. Diese zerstörten, grausamen Jahre, in denen ich mich elend in den Lügen des FBI verstrickt habe. Mein Herz, meine Seele, mein Schicksal wurden von einem gesichtslosen, hässlichen, nach J. Edgar Hoover benannten Fertigbau aus gesteuert. Inzwischen würden Benton und ich so etwas nie mehr zulassen, niemals im Leben. Wir stehen füreinander an erster Stelle, und er sagt mir die Wahrheit. Er findet Wege, mich wissen zu lassen, was ich wissen muss, damit wir nie wieder so eine entsetzliche Qual durchmachen müssen. Er ist gesund und lebendig und auf Dienstreise. Mehr nicht. Als ich ihn mobil anrufe, um ihm zu sagen, dass ich ihn vermisse, und ihm alles Gute zum Fast-Geburtstag zu wünschen, erreiche ich nur die Mailbox.
Also versuche ich es in seinem Hotel im Norden Virginias, dem Marriott, wo er immer übernachtet, wenn er ein Treffen mit seinen FBI-Kollegen von der Abteilung für Verhaltensforschung hat.
»Mr. Wesley hat ausgecheckt«, meldet der Rezeptionist, als ich ihn bitte, mich mit Bentons Zimmer zu verbinden.
»Wann?« Ich verstehe kein Wort.
»Als ich gerade um Mitternacht meine Schicht antrat.« Ich erkenne die Stimme des Mannes, ruhig und mit einem melodiösen Virginia-Akzent. Er arbeitet seit Jahren in diesem Marriott, und ich habe schon oft mit ihm gesprochen, insbesondere in den letzten Wochen, nachdem es noch einen zweiten und einen dritten Mord gegeben hat.
»Ich bin Kay Scarpetta …«
»Ja, Ma’am, ich weiß. Wie geht es Ihnen? Hier spricht Carl. Sie klingen, als sei Ihre Nase ein bisschen verstopft. Hoffentlich haben Sie sich nicht die Grippe eingefangen, die momentan umgeht. Ich habe gehört, dass sie ziemlich übel sein soll.«
»Es geht mir gut, danke der Nachfrage. Hat er vielleicht erwähnt, warum er früher als geplant auscheckt? Soweit ich informiert bin, wollte er bis zum Wochenende bleiben.«
»Ja, Ma’am. Ich schaue mal nach. Hier steht, dass er am Samstag abreisen wollte.«
»Drei Tage später, da bin ich ein wenig erstaunt. Sie wissen nicht, warum er plötzlich um Mitternacht weg ist?« Ich plappere vor mich hin, während ich versuche zu verstehen, was keinen Sinn ergibt.
»Das hat Mr. Wesley nicht gesagt. Ich habe etwas über den Fall hier gelesen, in dem seine Abteilung ermittelt, auch wenn es nicht viel ist. Das FBI macht ein großes Geheimnis darum, was, wenn Sie mich fragen, die Sache noch verschlimmert, weil ich lieber wüsste, woran ich bin. Schließlich gibt es auch Leute, die keine Pistolen und Dienstmarken haben und nur gruppenweise unterwegs sind, und jetzt trauen wir uns kaum noch ins Einkaufszentrum oder ins Kino. Deshalb wäre es nett, wenn wir ein paar Informationen kriegen würden, da will ich kein Blatt vor den Mund nehmen, Dr. Scarpetta. Die Leute hier sind nervös, viele haben Angst, ich auch. Wenn es nach mir ginge, dürfte meine Frau nicht mehr das Haus verlassen.«
Ich bedanke mich bei ihm und beende so höflich wie möglich das Gespräch. Dabei überlege ich, ob es vielleicht schon wieder einen grausigen Fall gegeben hat. Möglicherweise hat Benton einen neuen Einsatzort. Allerdings passt es nicht zu ihm, mir nicht Bescheid zu sagen. Ich schaue nach, ob er mir eine Mail geschickt hat. Hat er nicht.
»Wahrscheinlich wollte er mich nicht wecken«, meine ich zu meinem faulen alten Windhund. »Das ist einer der Vorteile, wenn man krank ist. Man fühlt sich sowieso schon miserabel, und dann impfen die Leute einem auch noch ein schlechtes Gewissen ein, weil sie einen nicht stören wollen.«
Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick in den Spiegel. Zerknitterter blauer Seidenpyjama, angeklatschter Blondschopf, die blauen Augen glasig. Ich habe ein paar Kilo abgenommen und sehe aus, als würde ich von Träumen aus einer Zeit geplagt, die ich einerseits vermisse, andererseits auch nicht. Ich habe eine Dusche bitter nötig, aber das muss warten.
Stattdessen öffne ich Kommodenschubladen und krame Unterwäsche, Socken, eine schwarze Cargohose und ein schwarzes langärmeliges Hemd mit dem in Gold aufgestickten Emblem meines Instituts heraus. Dann hole ich meine SIG