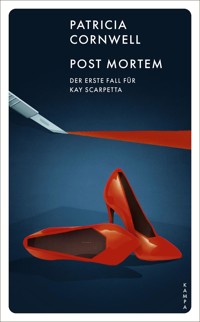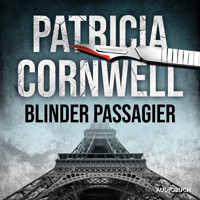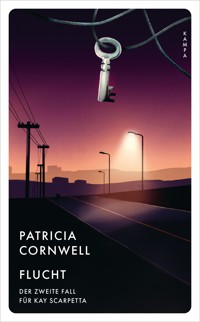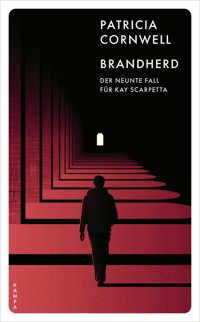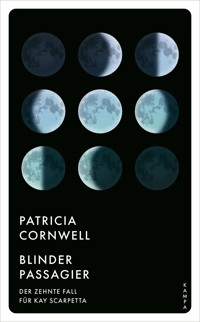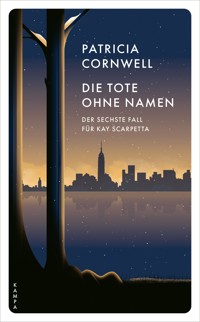
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
Dr. Kay Scarpetta, leitende Gerichtsmedizinerin von Virginia, will noch eine Obduktion abschließen, bevor sie nach Miami fliegt, um mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern. Aber ihre Pläne werden durchkreuzt: Im verschneiten Central Park wird eine nackte Frauenleiche mit kahl geschorenem Kopf gefunden. Der Mord trägt eindeutig die Handschrift von Scarpettas langjährigem Erzfeind Temple Gault, einem hochintelligenten, sadistischen Serienmörder. Trotz ihres schlechten Gewissens – die Mutter liegt im Krankenhaus, die Schwester macht ihr Vorwürfe – muss Scarpetta ihren Weihnachtsbesuch hinten anstellen und für die Ermittlungen nach New York reisen. Gault versucht nicht mal, seine Spuren zu verwischen. Im Gegenteil: Er lässt Scarpetta Botschaften zukommen, ermordet Polizisten in ihrem Umfeld und zeigt ihr so, wie nahe er ihr kommen kann. Denn in Wahrheit hat er es auf die Gerichtsmedizinerin selbst abgesehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Patricia Cornwell
Die Tote ohne Namen
Der sechste Fall für Kay Scarpetta
Aus dem amerikanischen Englisch von Anette Grube
Kampa
Dieses Buch ist Dr. Erika Blanton gewidmet.
(Scarpetta würde Dich eine Freundin nennen.)
Er aber sprach: Was hast du getan?
Die Stimme des Blutes deines Bruders
schreit zu mir von der Erde.
Das erste Buch Mose 4,10
Es ward die Nacht vor der Geburt des Herrn
Sicheren Schritts ging er durch den hohen Schnee im Central Park, und es war spät, aber er wusste nicht genau, wie spät. In jenem Teil des Parks, der The Ramble hieß, ragten die Felsen schwarz zu den Sternen empor, und er sah und hörte seinen eigenen Atem, weil er nicht wie andere war. Temple Gault hatte etwas Magisches, er war ein Gott im Körper eines Menschen. Zum Beispiel glitt er nicht aus, wo andere gewiss ausgleiten würden, und er kannte keine Furcht. Unter dem Schirm seiner Baseballkappe schweifte sein Blick hierhin, dorthin.
An der Stelle – und er wusste genau, wo sie war – ging er in die Hocke, schob die Schöße seines langen schwarzen Mantels beiseite. Er stellte einen alten Armeerucksack in den Schnee und hob die nackten, blutigen Hände in die Höhe, und obwohl sie kalt waren, waren sie nicht eiskalt. Gault mochte keine Handschuhe, nur solche aus Latex, und Latex wärmte nicht. Er säuberte Gesicht und Hände mit dem weichen Neuschnee, formte daraus einen blutigen Schneeball, den er neben den Rucksack legte. Beides durfte er nicht zurücklassen.
Er lächelte sein schmales Lächeln und fühlte sich wie ein übermütiger Hund, der ein Loch im Sand scharrt, während er die jungfräuliche Schneedecke im Park zerstörte, seine Fußspuren verwischte und den Notausgang suchte. Ja, da war er, und er schob mehr Schnee zur Seite, bis er die Alufolie fand, die er zwischen Deckel und Einfassung gesteckt hatte. Er fasste nach dem Ring, der als Griff diente, und öffnete den im Boden eingelassenen Deckel. Darunter lagen die dunklen Eingeweide der U-Bahn, ein Zug fuhr ratternd vorbei. Er ließ Rucksack und Schneeball hineinfallen. Seine Schritte hallten wider, als er auf der eisernen Leiter hinunterstieg.
1
Der Abend des vierundzwanzigsten Dezember war kalt, tückisches schwarzes Eis bedeckte die Straßen, Verbrechen knisterten über den Scanner. Es kam nur selten vor, dass ich nach Einbruch der Dunkelheit durch das Armenviertel von Richmond chauffiert wurde. Normalerweise saß ich selbst am Steuer. Normalerweise war ich die einsame Fahrerin des blauen Leichenwagens, mit dem ich die Schauplätze gewaltsamer, unerklärlicher Todesfälle aufsuchte. Aber heute Abend saß ich auf dem Beifahrersitz eines Crown Victoria, Weihnachtslieder kamen über den Sender, Polizisten sprachen in Codes miteinander.
»Sheriff Santa ist da vorn rechts abgebogen. Wahrscheinlich hat er sich verfahren«, sagte ich.
»Tja, ich glaube, er ist high«, sagte Captain Pete Marino, der das Morddezernat dieses gewalttätigen Viertels leitete, durch das wir fuhren. »Schau dir seine Augen an, wenn wir das nächste Mal anhalten.«
Es überraschte mich nicht. Sheriff Lamont Brown besaß einen Cadillac, trug schweren Goldschmuck und wurde von den Bürgern für die Rolle geliebt, die er im Augenblick spielte. Diejenigen von uns, die die Wahrheit kannten, wagten es nicht, auch nur ein Wort davon verlauten zu lassen. Schließlich ist es ein Sakrileg zu behaupten, es gebe den Weihnachtsmann nicht, aber im Falle dieses Santa Claus war der Heiligenschein eine unglaubliche Anmaßung. Sheriff Brown schnupfte Kokain und steckte jedes Jahr vermutlich die Hälfte dessen, was für die Armen gespendet wurde, in seine eigene Tasche. Er war Abschaum, und erst kürzlich hatte er dafür gesorgt, dass ich als Geschworene antreten musste. Die Abneigung zwischen uns beruhte auf Gegenseitigkeit.
Die Scheibenwischer quälten sich über das Glas. Schneeflocken streiften Marinos Wagen, wirbelten darauf zu wie scheue, in Weiß gekleidete, tanzende Mädchen. Sie schwärmten um Natriumdampflampen und wurden so schwarz wie das Eis, das die Straßen überzog. Es war bitterkalt. Die meisten Menschen in der Stadt waren zu Hause bei ihren Familien, lichtergeschmückte Bäume erhellten Fenster, in Kaminen prasselten Feuer. Karen Carpenter träumte von einer weißen Weihnacht, bis Marino ärgerlich einen anderen Sender suchte.
»Vor Frauen, die Schlagzeug spielen, habe ich keinen Respekt.« Marino drückte den Zigarettenanzünder.
»Karen Carpenter ist tot«, sagte ich, als ob sie das vor weiteren Beleidigungen schützte. »Und außerdem hat sie bei diesem Lied nicht Schlagzeug gespielt.«
»Na klar.« Er zog eine Zigarette aus der Schachtel. »Stimmt. Sie hatte eine dieser Essstörungen. Hab vergessen, wie das heißt.«
Der Mormonen-Tabernakel-Chor stimmte ein Halleluja an. Am nächsten Morgen wollte ich nach Miami fliegen und meine Mutter, meine Schwester und Lucy, meine Nichte, besuchen. Meine Mutter war seit Wochen im Krankenhaus. Früher hatte sie so viel geraucht wie Marino. Ich kurbelte mein Fenster einen Spaltbreit herunter.
»Und dann hat ihr Herz ausgesetzt – daran ist sie letztlich gestorben«, sagte er.
»Daran stirbt letztlich jeder«, sagte ich.
»Nicht hier in dieser Gegend. Hier sterben die Leute an Bleivergiftung.«
Wir fuhren zwischen zwei Streifenwagen – rote und blaue Lichter blinkten – in einem Korso von Polizisten, Reportern und Fernsehteams. Wann immer wir hielten, stellten die Vertreter der Medien ihren weihnachtlichen Eifer unter Beweis, indem sie sich mit Notizblöcken, Mikrophonen und Kameras vordrängten. Begeistert und überaus sentimental berichteten sie, wie Sheriff Santa, übers ganze Gesicht strahlend, vergessenen Kindern und ihren vor Angst neurotischen Müttern Geschenke und Lebensmittel überreichte. Marino und ich verteilten die Decken, die ich dieses Jahr spendete.
Um die Ecke hielten die Wagen in der Magnolia Street vor einem Gebäudekomplex namens Whitcomb Court. Weiter vorn sah ich die leuchtendrote Kutte, als Santa durch das Scheinwerferlicht ging, gefolgt von Richmonds Polizeipräsidenten und anderen hohen Tieren. Fernsehkameras schwebten in der Luft wie Ufos, Blitzlichter explodierten.
Marino beschwerte sich hinter einem Stapel Decken. »Diese Dinger riechen billig. Wo hast du die gekauft, in einer Tierhandlung?«
»Sie wärmen, sind waschbar, und falls es brennt, verströmen sie keine giftigen Gase wie etwa Zyanid«, sagte ich.
»Himmel, wenn einen das nicht in Feiertagsstimmung versetzt«, rief er aus.
Während ich zum Fenster hinaussah, fragte ich mich, wo wir waren.
»Ich würde sie nicht mal in meine Hundehütte legen«, fuhr Marino fort.
»Du hast weder einen Hund noch eine Hundehütte, und ich habe dir auch keine Decke angeboten. Was sollen wir hier? Die Wohnung steht nicht auf der Liste.«
»Das ist eine verdammt gute Frage.«
Reporter, Polizisten, Sozialarbeiter drängten sich vor der Tür einer Wohnung, die aussah wie alle anderen in diesem Komplex, der an Betonbaracken erinnerte. Marino und ich zwängten uns an Kameras vorbei, an Scheinwerfern, die die Dunkelheit erhellten, und Sheriff Santa brüllte: »HO! HO! HO!«
Als wir eintraten, setzte Santa sich gerade einen kleinen schwarzen Jungen aufs Knie und gab ihm ein paar in Geschenkpapier verpackte Spielsachen. Der Junge hieß Trevi und trug eine blaue Kappe mit einem Marihuanablatt auf dem Schirm. Seine Augen waren riesengroß, und er wirkte verwirrt auf dem samtenen roten Knie dieses Mannes. Daneben stand ein silberner, mit Lichtern geschmückter Baum. In dem überheizten kleinen Zimmer war kaum genug Luft zum Atmen, und es roch nach altem Fett.
»Lassen Sie mich durch, Ma’am.« Ein Kameramann schubste mich aus dem Weg.
»Stell sie dort drüben auf.«
»Wer hat die restlichen Spielsachen?«
»Ma’am, Sie müssen einen Schritt zurücktreten.« Der Kameramann warf mich praktisch um. Ich spürte, wie mein Blutdruck anstieg.
»Wir brauchen noch eine Schachtel …«
»Nein, nicht da. Dort drüben.«
»Süßigkeiten? Okay. Hab verstanden.«
»Wenn Sie Sozialarbeiterin sind«, sagte der Kameramann zu mir, »warum stellen Sie sich dann nicht da drüben hin?«
»Wenn Sie Augen im Kopf hätten, würden Sie sehen, dass sie keine Sozialarbeiterin ist.« Marino starrte ihn böse an.
Eine alte Frau in einem sackartigen Kleid, die auf der Couch saß, fing jetzt an zu weinen. Ein hochrangiger Polizist in weißem Hemd und mit etlichen Auszeichnungen an der Jacke setzte sich neben sie, um sie zu trösten. Marino kam näher und flüsterte mir etwas zu.
»Ihre Tochter wurde letzten Monat umgebracht, Nachname ist King. Erinnerst du dich an den Fall?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich erinnerte mich nicht. Es gab so viele Fälle.
»Der Schmarotzer, von dem wir annehmen, dass er sie umgebracht hat, ist ein brutaler Drogendealer namens Jones«, fuhr er fort, um meinem Gedächtnis nachzuhelfen.
Wieder schüttelte ich den Kopf. Es gab so viele brutale Drogendealer, und Jones war nicht gerade ein seltener Name.
Der Kameramann filmte, und als Sheriff Santa mir aus glasigen Augen einen verächtlichen Blick zuwarf, wandte ich das Gesicht ab. Der Kameramann rempelte mich fast um.
»Ich würde das nicht noch einmal tun«, warnte ich ihn in einem Ton, der keinen Zweifel daran ließ, dass ich es ernst meinte.
Die Journalisten hatten ihre Aufmerksamkeit der Großmutter zugewandt, denn sie war der Star des Abends. Jemand war ermordet worden, die Mutter des Opfers weinte, und Trevi war ein Waisenkind, und Sheriff Santa, der jetzt nicht mehr im Rampenlicht stand, setzte den Jungen ab.
»Captain Marino, geben Sie mir eine von den Decken«, sagte eine Sozialarbeiterin.
»Warum sind wir überhaupt hier?« Er reichte ihr den ganzen Stoß. »Können Sie mich vielleicht aufklären?«
»Hier wohnt nur ein Kind«, sagte die Sozialarbeiterin. »Deswegen brauchen wir nur eine.« Sie tat so, als hätte Marino irgendwelche Instruktionen nicht befolgt, nahm eine zusammengefaltete Decke und reichte ihm den Rest zurück.
»Hier sollten aber vier leben. Ich sage Ihnen doch, die Wohnung steht nicht auf der Liste«, murrte Marino.
Ein Journalist kam auf mich zu. »Entschuldigen Sie, Dr. Scarpetta. Warum sind Sie heute Abend hier? Rechnen Sie damit, dass jemand stirbt?«
Er arbeitete für Richmonds Tageszeitung, die mich noch nie freundlich behandelt hatte. Ich tat so, als hätte ich ihn nicht verstanden. Sheriff Santa verschwand in der Küche, was mir komisch vorkam, weil er schließlich nicht hier wohnte und auch nicht um Erlaubnis gefragt hatte. Aber die Großmutter auf der Couch war nicht in der Verfassung, zu bemerken, wohin er gegangen war, oder sich darüber zu wundern.
Ich kniete mich neben Trevi, der allein auf dem Boden saß und seine neuen Spielsachen bestaunte. »Da hast du aber ein tolles Feuerwehrauto«, sagte ich zu ihm.
»Es blinkt.« Er zeigte mir ein rotes Licht auf dem Dach des Autos, das blinkte, wenn er einen Schalter umlegte.
Auch Marino setzte sich neben ihn. »Hast du auch Ersatzbatterien dafür gekriegt?« Er versuchte, missmutig zu klingen, konnte die Anteilnahme in seiner Stimme jedoch nicht verbergen. »Du brauchst die richtige Größe. Siehst du dieses kleine Fach hier? Da gehören sie hinein. Und du brauchst diese kleinen länglichen …«
Der erste Schuss hörte sich an wie die Fehlzündung eines Autos, nur kam dies aus der Küche. Marinos Blick wurde starr, als er seine Pistole aus dem Holster riss, und Trevi rollte sich auf dem Boden zusammen wie ein Tausendfüßler. Ich legte mich schützend über den Jungen, in schneller Folge explodierten Schüsse, als das Magazin einer halb automatischen Waffe in der Nähe der Hintertür leergeschossen wurde.
»Auf den Boden! Auf den Boden!«
»O Gott!«
»Himmel!«
Kameras und Mikrophone fielen krachend hin, als die Leute aufschrien, zur Tür drängten oder sich auf den Boden warfen.
»Alle runter!«
Marino stürmte in Kampfhaltung zur Küche, die Neun-Millimeter in der Hand. Die Schüsse verklangen, und es herrschte Totenstille.
Ich hob Trevi auf, mein Herz hämmerte, und ich begann zu zittern. Die Großmutter saß immer noch auf der Couch, vornübergebeugt, die Hände schützend über den Kopf gelegt, als ob sie in einem abstürzenden Flugzeug säße. Ich setzte mich neben sie, hielt den Jungen fest, der sich völlig versteift hatte. Seine Großmutter schluchzte vor Entsetzen.
»Jesus. Bitte nicht, Jesus.« Sie stöhnte und wiegte sich vor und zurück.
»Alles in Ordnung«, sagte ich mit fester Stimme zu ihr.
»Nicht schon wieder! Ich halte es nicht mehr aus. Lieber Gott, bitte nicht!«
Ich nahm ihre Hand. »Alles in Ordnung. Hören Sie. Es ist vorbei. Es hat aufgehört.«
Sie wiegte sich hin und her und weinte, Trevi hängte sich ihr an den Hals.
Marino tauchte in der Tür zwischen Küche und Wohnzimmer auf, mit angespannter Miene, sein Blick schoss durchs Zimmer. »Doc.« Er winkte mich zu sich.
Ich folgte ihm hinaus auf einen armseligen Hinterhof, in dem Wäscheleinen hingen, und Schneeflocken wirbelten über einen dunklen Haufen auf dem weißen Gras. Das Opfer war jung, schwarz, lag auf dem Rücken und starrte aus kaum geöffneten Augen blind in den milchigen Himmel. Seine blaue Daunenweste hatte winzige Risse. Eine Kugel war durch die rechte Wange in den Kopf gedrungen, und während ich seinen Brustkasten zusammendrückte und eine Mund-zu-Mund-Beatmung versuchte, lief Blut über meine Hände und erkaltete augenblicklich auf meinem Gesicht. Ich konnte ihn nicht retten. Sirenen heulten in der Nacht wie Geister, die gegen den Tod wüteten.
Ich setzte mich schwer atmend auf. Marino half mir auf die Beine, aus den Augenwinkeln sah ich schattenhafte Bewegungen. Ich wandte mich um und sah, wie drei Polizisten Sheriff Santa in Handschellen abführten. Seine Zipfelmütze war heruntergefallen und lag nicht weit von mir entfernt auf dem Boden. Im Strahl von Marinos Taschenlampe blitzten Patronenhülsen auf.
»Was, in Gottes Namen, ist hier los?«, fragte ich geschockt.
»Sieht so aus, als hätte der gute alte Santa Claus den guten alten Santa Crack verärgert, und dann hatten sie hier draußen eine kleine Auseinandersetzung«, sagte Marino aufgeregt und außer Atem. »Deswegen wurde die Parade zu dieser Bude umgeleitet. Sie stand ausschließlich auf der Liste des Sheriffs.«
Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Ich schmeckte Blut und dachte an Aids.
Der Polizeichef tauchte auf und stellte Fragen.
Marino begann zu erklären. »Sieht so aus, als habe der Sheriff in dieser Gegend mehr als nur Weihnachtsgeschenke abliefern wollen.«
»Drogen?«
»Vermutlich.«
»Ich hab mich schon gefragt, warum wir hier sind«, sagte Chief Tucker. »Die Adresse steht nicht auf der Liste.«
»Tja, das ist der Grund.« Marino starrte ausdruckslos auf die Leiche.
»Wissen wir, wer er ist?«
»Anthony Jones von den berühmten Jones Brothers. Siebzehn Jahre alt, war öfter im Gefängnis als unser Doc hier in der Oper. Sein älterer Bruder wurde letztes Jahr von einem Tec-9-Mitglied umgebracht. In Fairfield Court, Phaup Street. Und wir glauben, dass Anthony letzten Monat Trevis Mutter ermordet hat, aber Sie wissen ja, wie es hier zugeht. Niemand hat etwas gesehen. Wir hatten sozusagen keinen Fall. Vielleicht können wir ihn jetzt klären.«
»Trevi? Sie meinen den kleinen Jungen da drinnen?« Die Miene des Chiefs blieb unverändert.
»Ja. Anthony ist vermutlich der Vater des Jungen. Oder vielmehr war er der Vater.«
»Wurde eine Waffe sichergestellt?«
»In welchem Fall?«
»In diesem.«
»Smith & Wesson, Kaliber .38, die Trommel ist leergeschossen. Jones hatte sie noch nicht fallen gelassen, und auf dem Boden haben wir einen Schnelllader gefunden.«
»Er hat fünfmal geschossen und nicht getroffen?«, fragte der Chief, der seine schicke Ausgehuniform trug. Schnee bedeckte seine Kappe.
»Schwer zu sagen. Sheriff Brown hatte eine kugelsichere Weste an.«
»Er trug eine kugelsichere Weste unter der Weihnachtsmannkutte.« Der Chief wiederholte die Fakten, als würde er sich Notizen machen.
»Ja.« Marino inspizierte eine verbogene Wäschestange, der Strahl seiner Taschenlampe suchte das rostende Metall ab. Mit dem Daumen einer behandschuhten Hand fuhr er über eine Delle, die von einer Kugel stammte. »Tja«, sagte er, »dem Bimbo ist es ordentlich an die Wäsche gegangen.«
Ich zuckte zusammen.
Der Chief, der ein Schwarzer war, schwieg einen Moment, dann sagte er: »Ich schlage vor, Sie verzichten in Zukunft auf Scherze, die rassische oder ethnische Anspielungen enthalten.« Er biss die Zähne zusammen.
Der Krankenwagen traf ein. Ich begann zu zittern.
»Verstehen Sie mich nicht falsch, ich wollte nicht …«, setzte Marino an.
Der Chief unterbrach ihn. »Meiner Meinung nach sind Sie der ideale Kandidat für ein Diversity Training.«
»Ich habe bereits eins absolviert.«
»Sie haben bereits eins absolviert, Sir, und Sie werden noch eins absolvieren, Captain.«
»Ich habe drei Kurse hinter mir. Nicht nötig, mich noch einmal hinzuschicken«, sagte Marino, der lieber zu einer Darmuntersuchung gegangen wäre, als an einem weiteren Diversity Training teilzunehmen.
Türen wurden zugeschlagen, eine Metallbahre klapperte.
»Marino, hier gibt’s nichts mehr für mich zu tun.« Ich wollte nicht, dass er sich noch mehr Probleme an den Hals redete. »Und ich muss ins Büro.«
»Was? Du willst ihn dir heute noch vornehmen?« Marino schien zu schrumpfen.
»Angesichts der Umstände halte ich das für eine gute Idee«, sagte ich ernst. »Und morgen fahre ich weg.«
»Sie verbringen Weihnachten im Kreis der Familie?«, fragte Chief Tucker, der ein erstaunlich junger Polizeichef war.
»Ja.«
»Schön für Sie«, sagte er, ohne zu lächeln. »Kommen Sie, Dr. Scarpetta, ich fahre Sie beim Leichenschauhaus vorbei.«
Marino beäugte mich argwöhnisch, während er sich eine Zigarette anzündete. »Ich schau rein, sobald ich hier fertig bin«, sagte er.
2
Paul Tucker war vor ein paar Monaten zum Polize chef von Richmond ernannt worden. Wir hatten uns allerdings nur einmal kurz bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung getroffen. Heute Abend waren wir uns zum ersten Mal am Schauplatz eines Verbrechens begegnet. Was ich von ihm wusste, passte auf eine kleine Karteikarte.
Er war ein Basketball-Star an der Universität von Maryland gewesen und Empfänger eines Rhodes-Stipendiums. Er war körperlich in Superform, außergewöhnlich intelligent und hatte die FBI-Akademie absolviert. Ich glaubte, ihn zu mögen, war mir jedoch nicht sicher.
»Marino meint es nicht böse«, sagte ich, als wir bei Gelb über eine Ampel an der East Broad Street fuhren.
Ich spürte, wie mich Tuckers dunkle Augen neugierig musterten. »Die Welt ist voller Menschen, die es nicht böse meinen und eine Menge Schaden anrichten.« Er hatte eine wohlklingende dunkle Stimme, die mich an Bronze und poliertes Holz erinnerte.
»Das lässt sich nicht bestreiten, Colonel Tucker.«
»Nennen Sie mich Paul.«
Ich bot ihm nicht an, mich Kay zu nennen, weil ich es nach vielen Jahren als Frau in dieser Welt besser wusste. »Es wird nichts nützen, Marino noch einmal zu einem Diversity Training zu schicken«, fuhr ich fort.
»Marino muss Disziplin und Respekt lernen.« Er starrte wieder auf die Straße.
»Auf seine Art verfügt er über beides.«
»Er sollte über beides auf die angemessene Art und Weise verfügen.«
»Sie werden ihn nicht ändern, Colonel. Er ist schwierig, provozierend, hat schlechte Manieren, und er ist der beste Polizist in einem Morddezernat, mit dem ich je zusammengearbeitet habe.«
Tucker schwieg, bis wir am Medical College of Virginia vorbeigefahren und nach rechts in die Fourteenth Street abgebogen waren.
»Sagen Sie mir, Dr. Scarpetta, glauben Sie, dass Ihr Freund Marino ein guter Dezernatsleiter ist?«
Die Frage verblüffte mich. Ich war überrascht gewesen, als Marino zum Lieutenant befördert wurde, und wie vor den Kopf gestoßen, als er Captain wurde. Er hasste die hohen Tiere, und dann wurde er selber einer von denen, die er hasste, und er hasste sie noch immer, als gehörte er nicht dazu.
»Ich glaube, dass Marino ein hervorragender Polizist ist. Er ist unbestechlich, aufrecht, und er hat ein gutes Herz«, sagte ich.
»Wollen Sie meine Frage beantworten oder nicht?« Tucker klang amüsiert.
»Er ist kein Politiker.«
»Daran besteht kein Zweifel.«
Die Uhr am Turm der Main Street Station verkündete die Zeit von ihrer luftigen Höhe über dem alten Bahnhof mit seinem Terrakotta-Dach und dem Netzwerk von Gleisen. Hinter dem Consolidated Laboratory Building parkten wir auf dem für den Chief Medical Examiner reservierten Platz, einem unauffälligen Stück Asphalt, wo für gewöhnlich mein Auto stand.
»Er widmet dem FBI zu viel Zeit«, sagte Tucker.
»Er leistet dem FBI unschätzbare Dienste«, sagte ich.
»Jaja, ich weiß das ebenso gut wie Sie. Aber in seinem Fall führt das zu ernsthaften Problemen. Er ist verantwortlich für den ersten Bezirk und nicht für die Verbrechensaufklärung in anderen Städten. Und ich bemühe mich darum, dass meine Truppe funktioniert.«
»Wenn es irgendwo zu Gewalttätigkeiten kommt, geht das alle etwas an. Gleichgültig, wo unser Bezirk oder unsere Behörde ist.«
Tucker starrte nachdenklich auf das geschlossene Stahltor der Leichenwageneinfahrt vor uns. »Um nichts in der Welt könnte ich um diese Uhrzeit tun, was Sie tun, und niemand ist in der Nähe, nur die Leute in den Kühlfächern.«
»Vor denen habe ich keine Angst«, stellte ich sachlich fest.
»Es mag irrational sein, aber ich hätte eine Riesenangst vor ihnen.«
Das Scheinwerferlicht fiel auf schmutzigen Verputz und Stahl, beide im gleichen langweiligen Beige. Ein rotes Schild an einer Seitentür informierte Besucher, dass alles, was sich dahinter befand, ein biologisches Risiko darstellte, und gab Instruktionen für den Umgang mit Leichen.
»Ich muss Sie etwas fragen«, sagte Colonel Tucker.
Der Wollstoff seiner Uniform rieb am Polster, als er seine Position veränderte und sich mir zuwandte. Ich roch Hermès. Er sah gut aus: hohe Wangenknochen, kräftige weiße Zähne, sein Körper strotzte vor Kraft unter der dunklen Haut.
»Warum tun Sie es?«, fragte er.
»Warum tue ich was, Colonel?«
Er lehnte sich in seinen Sitz zurück. »Sehen Sie«, sagte er, während Lichter über den Scanner tanzten. »Sie sind Anwältin. Sie sind Ärztin. Sie sind ein Chief, ich bin ein Chief. Deswegen frage ich. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«
Ich glaubte ihm. »Ich weiß es nicht«, gestand ich.
Er schwieg eine Weile, dann sagte er: »Mein Vater war Rangierarbeiter, meine Mutter putzte die Häuser reicher Leute in Baltimore.« Er hielt inne. »Wenn ich jetzt nach Baltimore fahre, wohne ich in teuren Hotels und esse in Restaurants im Hafen. Man salutiert vor mir. In manchen Briefen werde ich ›The Honorable‹ angeredet. Ich habe ein Haus in Windsor Farms. Ich befehlige in Ihrer gewalttätigen Stadt mehr als sechshundert Menschen, die Waffen tragen. Ich weiß, warum ich tue, was ich tue, Dr. Scarpetta. Ich tue es, weil ich als Junge keine Macht besaß. Ich lebte mit Menschen zusammen, die keine Macht besaßen, und ich lernte, dass all das Böse, über das in der Kirche gepredigt wurde, im Missbrauch dieser Macht wurzelt, die ich nicht besaß.«
Dichte und Choreographie des Schneefalls waren unverändert. Ich sah zu, wie der Schnee langsam die Motorhaube seines Wagens bedeckte.
»Colonel Tucker«, sagte ich, »morgen ist Weihnachten, und Sheriff Santa hat vermutlich in Whitcomb Court gerade einen Menschen erschossen. Die Medien sind am Durchdrehen. Was raten Sie mir?«
»Ich werde die ganze Nacht im Präsidium sein. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Gebäude überwacht wird. Wollen Sie Polizeischutz für den Nachhauseweg?«
»Ich denke, Marino bringt mich nach Hause, aber wenn ich zu der Ansicht gelange, dass zusätzlicher Schutz nötig ist, werde ich Sie auf alle Fälle anrufen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Situation weiter kompliziert wird durch die Tatsache, dass Brown mich hasst und ich jetzt eine wichtige Zeugin in seinem Fall bin.«
»Wenn nur alle von uns so viel Glück hätten.«
»Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, Glück gehabt zu haben.«
»Sie haben recht.« Er seufzte. »Das hat nichts mit Glück zu tun.«
»Hier kommt mein Fall«, sagte ich, als der Krankenwagen auf den Parkplatz fuhr, ohne Blaulicht und Sirene, denn es gibt keinen Grund zur Eile, wenn Tote transportiert werden.
»Frohe Weihnachten, Chief Scarpetta«, sagte Tucker, als ich aus seinem Wagen stieg.
Ich betrat das Gebäude durch einen Seiteneingang und drückte auf einen Knopf an der Wand. Das Stahltor schwang quietschend auf, und der Krankenwagen passierte. Die Sanitäter öffneten die Hecktür, holten die Bahre heraus und schoben sie eine Rampe hinauf, während ich eine Tür aufschloss, die ins Innere des Leichenschauhauses führte.
Die Neonröhren, die blassen Wände und der Kachelboden verliehen dem Korridor eine trügerische antiseptische Atmosphäre. An diesem Ort war nichts keimfrei. Angesichts sonst üblicher medizinischer Standards war es nicht einmal sauber.
»Soll er in ein Kühlfach?«, fragte mich ein Sanitäter.
»Nein. Fahren Sie ihn in den Röntgenraum.« Ich schloss weitere Türen auf, die Bahre klapperte hinter mir, Blut tropfte auf die Bodenkacheln.
»Sind Sie heute Abend solo?«, fragte ein Sanitäter, der wie ein Latino aussah.
»Leider.«
Ich knöpfte eine Plastikschürze auf, zog sie mir über den Kopf und hoffte, dass Marino bald käme. Im Umkleideraum nahm ich den grünen Chirurgenanzug von einem Regal, zog Schuhschoner und zwei Paar Handschuhe an.
»Sollen wir Ihnen helfen, ihn auf den Tisch zu legen?«, fragte ein Sanitäter.
»Das wäre großartig.«
»Los, heben wir ihn für den Doc auf den Tisch.«
»Klar.«
»Verdammt, dieser Sack hat auch ein Loch. Wir müssen neue besorgen.«
»Wohin soll der Kopf?«
»An dieses Ende.«
»Auf den Rücken?«
»Ja. Danke.«
»Eins, zwei, drei und hoch.«
Wir hoben Anthony Jones von der Bahre auf den Seziertisch, einer der Sanitäter wollte den Reißverschluss des Leichensacks aufziehen.
»Nein, lassen Sie ihn drin«, sagte ich. »Ich will ihn erst röntgen.«
»Wie lange wird das dauern?«
»Nicht lange.«
»Sie werden Hilfe brauchen, wenn Sie seine Lage verändern wollen.«
»Ich nehme alle Hilfe an, die ich kriegen kann«, sagte ich zu ihnen.
»Wir können noch ein paar Minuten hierbleiben. Wollten Sie das wirklich alles allein machen?«
»Ich erwarte noch jemanden.«
Kurz darauf schoben wir die Leiche in den Autopsieraum, und ich entkleidete sie. Die Sanitäter verabschiedeten sich, und im Leichenschauhaus waren nur noch die gewohnten Geräusche zu hören: Wasser, das in Waschbecken ablief, stählerne Instrumente, die klappernd gegen Stahl schlugen. Ich klemmte die Röntgenfilme an Leuchtkästen, wo sich mir die Schatten und Formen seiner Organe und Knochen offenbarten. Kugeln und eine Unmenge scharfkantiger Splitter hatten in Leber, Lunge, Herz und Gehirn wie ein tödlicher Schneesturm gewütet. In seiner linken Pobacke steckte eine alte Kugel, und sein rechter Oberarmknochen wies eine verheilte Fraktur auf. Mr. Jones war wie so viele meiner Patienten gestorben, wie er gelebt hatte.
Ich brachte gerade den Y-förmigen Schnitt an, als jemand am Tor läutete. Ich machte weiter. Der Mann vom Sicherheitsdienst würde sich darum kümmern. Einige Augenblicke später hörte ich schwere Schritte auf dem Korridor, und Marino kam herein.
»Ich wäre schon früher hier gewesen, wenn nicht alle Nachbarn beschlossen hätten, sich den Spaß anzusehen.«
»Was für Nachbarn?« Ich blickte ihn verständnislos an, das Skalpell in der Hand.
»Die Nachbarn von dem Schmarotzer in Whitcomb Court. Wir hatten Angst, dass es zu verdammten Unruhen kommt. Es hat sich in Windeseile herumgesprochen, dass ihn ein Polizist erschossen hat, ausgerechnet Sheriff Santa ihn auf dem Gewissen hat, und dann krochen die Leute aus den Ritzen im Asphalt.«
Marino zog seinen Mantel aus und legte ihn über eine Stuhllehne. Er trug noch immer seine Uniform. »Sie standen überall herum mit ihren Zweiliterflaschen Pepsi und haben in die Kameras gelächelt. Hab meinen Augen nicht getraut.« Er zog eine Schachtel Marlboro aus seiner Hemdtasche.
»Ich dachte, mit deiner Raucherei wäre es besser geworden«, sagte ich.
»Ist es auch. Ich werde ständig besser.«
»Marino, darüber macht man keine Witze.« Ich dachte an meine Mutter und ihre Tracheotomie. Emphyseme hatten sie nicht von ihrer Sucht kuriert; schließlich hatte die Atmung ausgesetzt.
»Okay.« Er kam näher an den Tisch. »Ich sage dir die ganze Wahrheit. Ich rauche eine halbe Schachtel am Tag weniger.«
Ich durchtrennte die Rippen und entfernte die Brustplatte.
»Ich darf weder in Mollys Auto noch in ihrem Haus rauchen.«
»Molly hat recht.« Molly war die Frau, mit der Marino seit Thanksgiving zusammen war. »Wie läuft es mit euch beiden?«
»Wirklich gut.«
»Verbringt ihr Weihnachten zusammen?«
»Klar. Wir fahren zu ihrer Familie nach Urbana. Sie machen einen Riesentruthahn mit allem Drum und Dran.« Er schnippte die Asche auf den Boden und schwieg.
»Das hier wird eine Weile dauern«, sagte ich. »Die Kugeln sind zersplittert, wie du auf den Bildern sehen kannst.«
Marino sah sich das morbide Clair-obscur auf den Leuchtkästen an.
»Was hat er benutzt? Hydra-Shok?«, fragte ich.
»Heutzutage benutzen alle Polizisten hier in der Gegend Hydra-Shok. Vermutlich verstehst du jetzt, warum. Die leisten ganze Arbeit.«
»Seine Nieren haben eine leicht körnige Oberfläche. Das ist ziemlich selten in seinem Alter.«
»Was bedeutet das?« Marino schien neugierig.
»Vermutlich ein Anzeichen für Bluthochdruck.«
Er schwieg, fragte sich wahrscheinlich, ob seine Nieren genauso aussahen, was ich vermutete.
»Es wäre mir eine große Hilfe, wenn du Notizen machen würdest.«
»Kein Problem, solange du jedes Wort buchstabierst.«
Er ging zu einem Tisch und nahm Block und Kugelschreiber. Dann zog er Handschuhe an. Ich hatte gerade angefangen, Maße und Gewicht zu diktieren, als sein Pager losging.
Er löste ihn von seinem Gürtel und hielt ihn hoch, um die Anzeige zu lesen. Seine Miene verdüsterte sich.
Marino ging zum Telefon auf der anderen Seite des Autopsieraums und wählte. Er sprach mit dem Rücken zu mir, und ich verstand nur ab und zu ein paar Worte, welche die Geräusche an meinem Tisch übertönten. Was immer er gerade hörte, es waren schlechte Nachrichten.
Als er auflegte, entfernte ich Bleisplitter aus dem Gehirn und kritzelte Notizen auf eine leere blutige Handschuhschachtel. Ich hielt inne und sah ihn an.
»Was ist los?«, fragte ich, in der Annahme, dass der Anruf etwas mit diesem Fall zu tun hatte, denn was an diesem Abend geschehen war, das war schlimm genug.
Marino schwitzte, sein Gesicht war dunkelrot angelaufen. »Benton hat mir auf meinem Pager eine 911-Nachricht geschickt.«
»Er hat was?«, fragte ich.
»Das ist der Code, den wir vereinbart haben für den Fall, dass Gault wieder zuschlägt.«
»O Gott«, flüsterte ich.
»Ich habe Benton gesagt, dass er dich nicht anzurufen braucht, weil ich hier bin und dich höchstpersönlich informieren kann.«
Ich stützte die Hände auf die Tischkante. »Wo?«, fragte ich angespannt.
»Sie haben im Central Park eine Leiche gefunden. Weiblich, weiß, vermutlich Anfang dreißig. Sieht so aus, als hätte Gault beschlossen, Weihnachten in New York zu feiern.«
Ich hatte mich vor diesem Tag gefürchtet. Ich hatte gehofft und gebetet, dass Gault bis in alle Ewigkeit schweigen würde, dass er vielleicht krank oder gestorben war, in irgendeinem abgelegenen Dorf, in dem niemand seinen Namen kannte.
»Das FBI schickt uns einen Hubschrauber«, fuhr Marino fort. »Sobald du hier fertig bist, Doc, müssen wir los. Der verfluchte Mistkerl!« Er begann, wütend auf und ab zu gehen. »Er musste es heute tun!« Er starrte finster um sich. »Das war Absicht. Er hat es genau geplant.«
»Ruf Molly an«, sagte ich und versuchte, ruhig zu bleiben und schneller zu arbeiten.
»Und ausgerechnet heute habe ich diese Uniform an.«
»Hast du was zum Umziehen dabei?«
»Ich muss schnell nach Hause, meine Waffe muss ich auch hierlassen. Was machst du?«
»Ich habe immer ein paar Sachen hier. Wenn du zu Hause bist, könntest du da meine Schwester in Miami anrufen? Lucy müsste seit gestern dort sein. Sag ihr, was passiert ist, und dass ich nicht kommen kann, zumindest nicht sofort.« Ich gab ihm die Telefonnummer, und er ging.
Es war fast Mitternacht, es schneite nicht mehr, und Marino war zurück. Anthony Jones lag eingeschlossen in einem Kühlfach, alle seine Verletzungen, alte wie neue, waren registriert für eine eventuelle Aussage vor Gericht. Wir fuhren zum Aero Services International Terminal, wo wir hinter Glasscheiben zusahen, wie Benton Wesley, trotz der Turbulenzen, in einem Bell JetRanger zielsicher auf einer kleinen, hölzernen Plattform landete, während ein Tankwagen mit Treibstoff aus dem Schatten glitt. Wolken zogen wie Schleier über das Rund des Mondes.
Ich beobachtete, wie Wesley ausstieg und von den sich drehenden Rotorblättern forthastete. Seine Haltung verriet Zorn, sein Schritt Ungeduld. Er war groß, hielt sich gerade und strahlte eine ruhige Autorität aus, die den Leuten Angst einflößte.
»Das Auftanken wird zehn Minuten dauern«, sagte er, als er bei uns ankam. »Gibt es irgendwo Kaffee?«
»Das ist eine gute Idee«, sagte ich. »Marino, sollen wir dir eine Tasse mitbringen?«
»Nein.«
Wir ließen ihn stehen und gingen zu einer kleinen Lounge.
»Tut mir leid«, sagte Wesley leise.
»Wir haben keine Wahl.«
»Das weiß auch er. Der Zeitpunkt ist kein Zufall.« Er füllte zwei Styroporbecher. »Der Kaffee ist ziemlich stark.«
»Je stärker, desto besser. Du siehst überarbeitet aus.«
»Ich sehe immer so aus.«
»Sind deine Kinder zu Weihnachten nach Hause gekommen?«
»Ja. Alle sind da – außer mir natürlich.« Er starrte einen Augenblick lang ins Leere. »Seine Spiele eskalieren.«
»Wenn es sich wieder um Gault handelt, stimme ich dir zu.«
»Ich weiß, dass er es war«, sagte er mit einer ehernen Ruhe, die über seine Wut hinwegtäuschte. Wesley hasste Temple Brooks Gault. Wesley war zornig und bestürzt über Gaults bösartiges Genie.
Der Kaffee war nicht sehr heiß, und wir tranken ihn schnell. Wesley ließ sich unsere Vertrautheit nicht anmerken, aber ich hatte gelernt, in seinen Augen zu lesen. Er verließ sich nicht auf Worte, und ich hatte ziemliches Geschick darin entwickelt, sein Schweigen zu deuten.
»Komm«, sagte er und berührte mich am Ellbogen. Wir holten Marino ein, als er mit unseren Taschen zur Tür hinausging.
Unser Pilot war Mitglied des Hostage Rescue Teams, des Geiselbefreiungsteams des FBI. Er trug eine schwarze Fliegermontur und beobachtete aufmerksam, was um ihn herum vorging; er sah uns an, um zu verstehen zu geben, dass er unsere Existenz zur Kenntnis nahm. Aber er winkte nicht, lächelte nicht und sagte auch kein Wort, als er uns die Hubschraubertüren öffnete. Wir duckten uns unter den Rotorblättern, und für den Rest meines Lebens würde ich den Lärm und den Wind mit Mord in Verbindung bringen. Es schien, als träfe das FBI, wann immer Gault zuschlug, in einem Mahlstrom aus wirbelnder Luft und glänzendem Metall ein, um mich abzuholen.
Wir jagten ihn nun schon seit mehreren Jahren, und es war unmöglich, eine vollständige Liste seiner Untaten aufzustellen. Wir wussten nicht, wie viele Menschen er abgeschlachtet hatte, es waren mindestens fünf, darunter eine schwangere Frau, die früher für mich gearbeitet hatte, und ein dreizehnjähriger Junge namens Eddie Heath. Wir wussten nicht, wie viele Leben er mit seinen Machenschaften vergiftet hatte, aber meines gehörte mit Sicherheit dazu.
Wesley saß hinter mir und hatte seine Kopfhörer aufgesetzt. Meine Lehne war zu hoch, als das ich ihn hätte sehen können, wenn ich mich umblickte. Die Lichter im Helikopter waren ausgeschaltet, und wir hoben langsam ab, legten uns seitlich und steuerten dann Richtung Nordosten. Über den Himmel trieben Wolken, und Gewässer schimmerten wie Spiegel in der Winternacht.
»In was für einem Zustand ist sie?«, hörte ich Marino plötzlich in meinem Kopfhörer.
»Sie ist steif gefroren«, antwortete Wesley.
»Das heißt, sie könnte seit Tagen tot sein, ohne dass der Verwesungsprozess eingesetzt hat. Stimmt’s, Doc?«
»Wenn sie seit Tagen draußen liegt«, sagte ich, »wäre sie früher gefunden worden, sollte man annehmen.«
»Wir glauben, dass sie gestern Abend ermordet wurde«, sagte Wesley. »Sie war gut zu sehen, saß aufrecht, gelehnt an …«
»Ja, so mag er es, der Irre. Das ist seine Art.«
»Er setzt sie aufrecht hin oder tötet sie im Sitzen«, fuhr Wesley fort. »Bislang zumindest hat er das getan.«
»Soweit wir wissen«, rief ich ihnen ins Gedächtnis.
»Die Opfer, die wir kennen.«
»Richtig. Sie saßen im Auto, auf einem Stuhl, an eine Mülltonne gelehnt.«
»Der Junge in London.«
»Ja, der nicht.«
»Scheint, als wäre er direkt neben die Bahngleise geworfen worden.«
»Wir wissen nicht, wer ihn umgebracht hat.« Wesley wirkte überzeugt. »Ich glaube nicht, dass es Gault war.«
»Warum, glaubt ihr, legt er Wert darauf, dass seine Opfer aufrecht sitzen?«, fragte ich.
»Damit wir wissen, dass er es war«, sagte Marino.
»Verachtung, Hohn«, sagte Wesley. »Es ist seine Handschrift. Vermutlich gibt es eine tiefere Bedeutung.«
Das vermutete auch ich. Alle Opfer Gaults wurden in sitzender Haltung gefunden, mit gesenktem Kopf, die Hände im Schoß oder schlaff an den Seiten herunterhängend, als wären sie Puppen. Die einzige Ausnahme war eine Gefängniswärterin namens Helen. Sie saß zwar in ihrer Uniform auf einem Stuhl, aber ihr Kopf fehlte.
»Bestimmt hat die sitzende Haltung …«, begann ich, aber die von den Stimmen aktivierten Mikrophone funktionierten nie synchron mit dem Tempo der Unterhaltung. Das Sprechen war eine Anstrengung.
»Der Dreckskerl reibt es uns unter die Nase.«
»Ich glaube nicht, dass das der einzige …«
»Jetzt will er, dass wir wissen, dass er in New York ist …«
»Marino, lass mich zu Ende reden. Benton? Die Symbolik?«
»Er könnte die Leichen auf unzählige Arten zur Schau stellen. Aber bislang hat er sich immer für die gleiche entschieden. Er setzt sie aufrecht hin. Das ist Teil seiner Phantasie.«
»Welcher Phantasie?«
»Wenn ich das wüsste, Pete, würden wir jetzt vielleicht nicht in diesem Helikopter sitzen.«
Etwas später ergriff der Pilot das Wort. »Wir haben von der FAA ein SIGMET empfangen.«
»Was zum Teufel ist das?«, fragte Marino.
»Eine Warnung vor Turbulenzen. In New York City ist es windig, die Windgeschwindigkeit beträgt siebenundzwanzig Knoten, in Böen an die siebenunddreißig.«
»Heißt das, wir können nicht landen?« Marino, der es hasste zu fliegen, klang etwas panisch.
»Wir werden tief fliegen, der Wind geht in größerer Höhe.«
»Was heißt hier tief? Haben Sie schon mal gesehen, wie hoch die Häuser in New York sind?«
Ich langte zwischen meinem Sitz und der Tür nach hinten und tätschelte Marinos Knie. Wir befanden uns vierzig Seemeilen vor Manhattan, und ich konnte mit Mühe das Licht erkennen, das auf dem Empire State Building blinkte. Der Mond war riesengroß, Flugzeuge flogen von und nach La Guardia wie schwebende Sterne, und aus Schornsteinen stieg Rauch auf wie große, weiße Federn. Durch das Fenster zu meinen Füßen konnte ich den zwölfspurigen Verkehr auf dem New Jersey Turnpike erkennen, und überall funkelten Lichter wie Juwelen, als ob Fabergé die Stadt und ihre Brücken entworfen hätte.
Wir flogen an der Rückseite der Freiheitsstatue und an Ellis Island vorbei, wo meine Großeltern ihren ersten Eindruck von Amerika bekommen hatten: eine überfüllte Einwanderungsbehörde an einem eiskalten Winterabend. Sie hatten Verona verlassen, wo es für meinen Großvater, den vierten Sohn eines Eisenbahnarbeiters, keine Zukunft gegeben hatte.
Ich stammte von energischen, hart arbeitenden Leuten ab, die zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts aus Österreich und der Schweiz nach Italien ausgewandert waren und denen ich mein blondes Haar und meine blauen Augen verdankte. Obwohl meine Mutter immer wieder versicherte, dass unsere Vorfahren unser italienisches Blut rein erhielten, als Napoleon I. Verona an Österreich abtrat, war ich nicht davon überzeugt. Ich vermutete, dass es genetische Ursachen für meine mehr teutonischen Züge gab.
Macy’s, Reklametafeln und der goldene Torbogen von McDonald’s tauchten auf, als sich New York materialisierte, und der aufgetürmte Schnee auf Parkplätzen und Gehsteigen sah sogar aus der Luft schmutzig aus. Wir flogen um den VIP-Heliport in der West Thirtieth Street und wirbelten das schlammige Wasser des Hudson auf. Dann schwebten wir auf einen Landeplatz neben einem glänzenden Sikorsky S-76, der alle anderen Hubschrauber wie graue Mäuse aussehen ließ.
»Passen Sie auf den hinteren Rotor auf«, sagte der Pilot.
In einem kleinen, nur mäßig warmen Gebäude begrüßte uns eine Frau in den Fünfzigern mit dunklem Haar, einem intelligenten Gesicht und müden Augen. Sie trug einen dicken Wollmantel, Hose, Schnürstiefel und Lederhandschuhe und stellte sich als Commander Frances Penn von der New York Transit Police vor.
»Vielen Dank, dass Sie gekommen sind«, sagte sie und schüttelte jedem von uns die Hand. »Wenn Sie so weit sind – draußen warten Autos.«
Sie führte uns zurück in die bittere Kälte, wo zwei Streifenwagen der Polizei mit laufendem Motor und eingeschalteten Heizungen warteten; in jedem saßen zwei Beamte. Es gab einen peinlichen Augenblick, als wir die Türen öffneten und entschieden, wer mit wem fuhr. Wie so oft in solchen Fällen gab das Geschlecht den Ausschlag, und Commander Penn und ich fuhren gemeinsam. Ich stellte ihr Fragen über die juristische Zuständigkeit, denn in einem so bedeutenden Fall wie diesem gab es viele Leute, die meinten, er fiele in ihren Bereich.
»Die Transit Police ist interessiert an dem Fall, weil wir annehmen, dass das Opfer den Täter in der U-Bahn getroffen hat«, erklärte Frances Penn, die einer der drei Commander der sechstgrößten Polizeieinheit der USA war. »Das war gestern am späten Nachmittag.«
»Woher wissen Sie das?«
»Es ist ziemlich faszinierend. Einer unserer Beamten in Zivil war auf Patrouille in der Station an der Eighty-first Street/Central Park West, und gegen halb sechs Uhr nachmittags – das war gestern – fiel ihm ein seltsames Paar auf, das aus dem U-Bahn-Ausgang am Museum of Natural History kam.«
Wir holperten über Eis und Schlaglöcher, dass ich die Knochen in meinen Beinen spürte.
»Der Mann hat sich sofort eine Zigarette angezündet, während die Frau eine Pfeife in der Hand hielt.«
»Das ist interessant«, sagte ich.
»In der U-Bahn ist das Rauchen verboten, und auch deswegen erinnert sich der Beamte an sie.«
»Bekamen sie eine Strafe?«
»Der Mann. Die Frau nicht, weil sie ihre Pfeife nicht angezündet hatte. Der Mann zeigte dem Beamten seinen Führerschein, von dem wir jetzt glauben, dass er gefälscht war.«
»Sie sagten, das Paar sah seltsam aus. Inwiefern?«
»Sie trug einen Herrenmantel und eine Atlanta-Braves-Baseballkappe. Und ihr Kopf war geschoren. Der Beamte war sich nicht einmal sicher, ob es wirklich eine Frau war. Zuerst nahm er an, dass es sich um ein schwules Paar handelte.«
»Beschreiben Sie den Mann, der bei ihr war«, bat ich sie.
»Mittelgroß, schlank, merkwürdig kantige Gesichtszüge und unheimliche blaue Augen. Sein Haar war karottenrot.«
»Als ich Gault zum ersten Mal sah, war sein Haar platinblond. Und als ich ihn letzten Oktober sah, war es kohlrabenschwarz.«
»Gestern war es definitiv karottenrot.«
»Und heute hat es wahrscheinlich schon wieder eine andere Farbe. Und er hat tatsächlich unheimliche Augen. So intensiv.«
»Er ist sehr schlau.«
»Es gibt keine Beschreibung für das, was er ist.«
»Böse, fällt einem in diesem Zusammenhang ein, Dr. Scarpetta«, sagte sie.
»Bitte nennen Sie mich Kay.«
»Wenn Sie mich Frances nennen.«
»Es scheint also, dass sie gestern Nachmittag im Museum of Natural History waren«, sagte ich. »Was für eine Sonderausstellung läuft dort zurzeit?«
»Haifische.«
Ich blickte zu ihr hinüber, aber ihre Miene blieb ernst, während der junge Beamte beherzt durch den New Yorker Verkehr steuerte.
»Im Moment läuft dort eine Sonderausstellung über Haifische. Vermutlich wird jede Spezies von Anbeginn der Zeit gezeigt«, sagte sie.
Ich schwieg.
»Soweit wir es rekonstruieren können, geschah Folgendes mit der Frau«, fuhr Commander Penn fort, »Gault – nennen wir ihn ruhig so, denn wir sind sicher, dass wir es mit ihm zu tun haben – ging mit ihr in den Central Park, nachdem sie die U-Bahn-Station verlassen hatten. Er führte sie in einen Teil des Parks, der Cherry Hill heißt, erschoss sie und lehnte ihre nackte Leiche an die Brunnenwand.«
»Warum ist sie mit ihm nach Einbruch der Dunkelheit in den Park gegangen? Noch dazu bei diesem Wetter?«
»Wir glauben, dass er sie irgendwie dazu gebracht hat, ihn zu The Ramble zu begleiten.«
»Wo sich Homosexuelle treffen.«
»Ja. Dort ist ein Schwulentreff. Die felsige Gegend ist überwuchert, gewundene Pfade scheinen nirgendwo hinzuführen. Auch die für den Central Park zuständigen Polizisten gehen nicht gern dorthin. Egal wie oft man dort war, man verirrt sich immer wieder. Die Verbrechensrate ist hoch. Fünfundzwanzig Prozent der im Park verübten Straftaten geschehen dort. Hauptsächlich Raubüberfälle.«
»Wenn er sie nach Einbruch der Dunkelheit zu The Ramble geführt hat, muss sich Gault im Central Park auskennen.«
»Ja.«
Das legte die Annahme nahe, dass sich Gault schon eine ganze Weile in New York aufhielt, und dieser Gedanke frustrierte mich schrecklich. Er hatte sich vor unserer Nase herumgetrieben, und wir hatten es nicht gewusst.
»Der Schauplatz bleibt über Nacht abgesperrt«, sagte Commander Penn. »Ich vermute, dass Sie ihn sich ansehen wollen, bevor wir Sie ins Hotel bringen.«
»Auf jeden Fall«, sagte ich. »Gibt es Beweise?«
»Wir haben im Brunnen eine Patronenhülse gefunden, die Schmauchspuren aufweist, wie sie typisch für eine Glock Neun-Millimeter sind. Und wir haben Haare gefunden.«
»Wo waren die Haare?«
»In der Nähe der Leiche, in den Schneckenverzierungen eines gusseisernen Gebildes im Brunnen. Vielleicht hat er sich eine Haarsträhne ausgerissen, als er die Leiche aufsetzte.«
»Welche Farbe?«
»Hellrot.«
»Gault ist zu gewissenhaft, um eine Patronenhülse oder Haare zurückzulassen«, sagte ich.
»Er konnte nicht sehen, wo die Hülse lag«, sagte Commander Penn. »Es war dunkel. Die Hülse war sehr heiß, als sie in den Schnee fiel. Verstehen Sie jetzt, was damit passiert ist?«
»Ja«, sagte ich. »Ich verstehe.«
3
Innerhalb von Minuten trafen Marino, Wesley und ich bei Cherry Hill ein, wo Scheinwerfer aufgestellt worden waren, weil das Licht der alten Straßenlampen an der Peripherie eines runden Platzes nicht ausreichte, der einst ein Wendeplatz für Kutschen und eine Pferdetränke gewesen war. Jetzt war der Platz von hohem Schnee bedeckt und mit gelbem Plastikband abgesperrt.
Den Mittelpunkt dieser unheimlichen Szenerie bildete ein zum Teil vergoldeter, gusseiserner, nun vereister Brunnen, in dem, wie man uns versicherte, zu keiner Zeit des Jahres Wasser sprudelte. Hier war die nackte Leiche einer jungen Frau in sitzender Haltung gefunden worden. Sie war verstümmelt, und ich glaubte, dass Gault das diesmal nicht getan hatte, um Bisswunden zu entfernen, sondern um seine Signatur zu hinterlassen, damit wir den Künstler augenblicklich identifizieren konnten.
Soweit wir im Augenblick wussten, hatte Gault sein jüngstes Opfer gezwungen, sich nackt auszuziehen und barfuß zu dem Brunnen zu gehen, wo heute Morgen ihre steif gefrorene Leiche gefunden worden war. Er hatte ihr aus nächster Nähe in die rechte Schläfe geschossen und Hautstücke von der Innenseite der Oberschenkel und der linken Schulter entfernt. Zwei unterschiedliche Fußspuren führten zu dem Brunnen hin, nur eine davon weg. Das Blut der Frau, deren Namen wir nicht kannten, hatte helle Flecken im Schnee hinterlassen, und jenseits der Arena ihres schrecklichen Todes verschwamm der Central Park in dichten, unheilschwangeren Schatten.
Ich stand dicht neben Wesley, unsere Arme berührten sich, als ob wir die Wärme des anderen brauchten. Er sagte kein Wort, während er konzentriert die Fußspuren, den Brunnen und den fernen dunklen Ramble betrachtete. Ich spürte, wie sich seine Schulter hob, als er tief einatmete, dann lehnte er sich fast an mich.
»Mein Gott«, murmelte Marino.
»Hat man ihre Kleider gefunden?«, fragte ich Commander Penn, obwohl ich die Antwort wusste.
»Keine Spur davon.« Sie sah sich um. »Ihre Fußabdrücke sind erst von dort drüben, vom Rand des Platzes an, die einer Barfüßigen.« Sie deutete auf eine Stelle ungefähr fünf Meter westlich des Brunnens. »Man kann genau erkennen, von wo an sie barfuß gegangen ist. Davor trug sie vermutlich Stiefel. Sohlen ohne Profil, aber mit Absatz. Cowboystiefel vielleicht.«
»Und er?«
»Wir können seine Spuren eventuell bis zu The Ramble verfolgen, aber das ist im Moment noch schwer zu sagen. Dort drüben gibt es so viele Spuren, und der Schnee ist an vielen Stellen verwischt.«
»Also, die beiden verlassen das Museum of Natural History durch den U-Bahn-Eingang, betreten den Park von Westen, gehen möglicherweise zu The Ramble, dann hierher.« Ich versuchte, die einzelnen Teile zusammenzusetzen. »Am Rand des Platzes zwingt er sie offenbar, sich auszuziehen, auch die Schuhe. Sie geht barfuß zum Brunnen, wo er sie mit einem Schuss in den Kopf tötet.«
»So sieht es im Augenblick aus«, sagte ein stämmiger NYPD-Detective, der sich als T.L. O’Donnell vorstellte.
»Wie kalt ist es?«, fragte Wesley. »Oder besser gesagt: Wie kalt war es gestern am späten Abend?«
»Gestern Abend waren es knapp zwölf Grad minus«, sagte O’Donnell, ein zorniger junger Mann mit dichtem schwarzem Haar. »Im Wind waren es minus vierundzwanzig Grad.«
»Und sie hat ihre Kleider und Schuhe ausgezogen«, sagte Wesley mehr zu sich selbst. »Das ist bizarr.«
»Nicht, wenn einem jemand eine Pistole an den Kopf hält.« O’Donnell stampfte mit den Füßen auf. Seine Hände steckten tief in den Taschen seiner dunkelblauen Polizeijacke, die bei dieser Kälte nicht genug wärmte, auch wenn man darunter eine kugelsichere Weste trug.
»Wenn man gezwungen wird, sich in dieser Kälte auszuziehen«, sagte Wesley, »weiß man, dass man sterben wird.«
Alle schwiegen.
»Sonst würde man nicht gezwungen, Kleider und Schuhe auszuziehen. Allein dass man sich auszieht, widerspricht jeglichem Selbsterhaltungstrieb, denn nackt kann man hier nicht lange überleben.«
Wir starrten schweigend auf den schauerlichen Brunnen. Der Schnee darin war rot gefleckt, und ich sah die Abdrücke, die von den nackten Pobacken des Opfers stammten. Das Blut war noch so hell wie zum Zeitpunkt ihres Todes, weil es gefroren war.
»Warum, zum Teufel, ist sie nicht davongelaufen?«, fragte Marino.
Wesley wandte sich abrupt von mir ab und ging in die Hocke, um die Fußspuren zu inspizieren, die wir für Gaults hielten. »Das ist die Frage des Tages«, sagte er. »Warum ist sie nicht davongelaufen?«
Ich ging neben ihm in die Hocke und sah mir ebenfalls die Fußspuren an. Das im Schnee deutlich zu erkennende Muster des Profils war auffällig. Gault hatte Schuhe getragen mit einem komplizierten, erhabenen, rhombischen und gewellten Profil, dem Fabrikatsstempel im Spann und einem kranzförmigen Logo im Absatz. Die Schuhgröße schätzte ich auf vierzigeinhalb oder einundvierzig.
»Wie sind die Spuren gesichert?«, fragte ich Commander Penn.
Inspektor O’Donnell antwortete. »Wir haben die Abdrücke fotografiert, und dort drüben« – er deutete auf eine Gruppe Polizisten auf der anderen Seite des Brunnens – »sind noch bessere. Wir versuchen, einen Abdruck zu machen.«
Einen Abdruck von einer Fußspur im Schnee zu machen war eine riskante Angelegenheit. Wenn der flüssige Dentalgips nicht kalt genug ist und der Schnee nicht hart genug gefroren, bringt man das Indiz zum Schmelzen. Wesley und ich standen auf. Schweigend gingen wir zu den Polizisten auf der anderen Seite des Brunnens, und überall, wohin ich blickte, sah ich Gaults Spuren.
Dass er unverwechselbare Schuhabdrücke hinterlassen hatte, war ihm gleichgültig. Dass er im Park eine unübersehbare Spur hinterlassen hatte, der wir gewissenhaft bis zu ihrem Ende folgen würden, war ihm gleichgültig. Wir waren entschlossen, jeden Ort ausfindig zu machen, an dem er sich aufgehalten hatte, aber auch das kümmerte ihn nicht. Er glaubte nicht, dass wir ihn schnappen könnten.
Die Polizisten auf der anderen Seite des Brunnens besprühten zwei Schuhabdrücke mit einem Wachsspray. Sie hielten die Dosen in sicherem Abstand und so angewinkelt, dass das unter hohem Druck stehende rote Wachs die feinen Details des Profils nicht zerstörte. Ein anderer Polizist rührte in einem Plastikeimer mit flüssigem Dentalgips.
Sobald mehrere Schichten Wachs aufgesprüht wären, musste der Dentalgips kalt genug sein, um ihn darüberzugießen und einen Abdruck zu machen. Die Bedingungen für diese heikle Prozedur waren gut. Weder schien die Sonne, noch wehte Wind, und offensichtlich hatten die Leute von der New Yorker Spurensicherung das Wachs vorschriftsgemäß bei Zimmertemperatur aufbewahrt, da es den Druck nicht verloren hatte. Die Sprühdüse spuckte nicht, das Wachs klumpte nicht wie bei anderen Versuchen, deren Zeugin ich in der Vergangenheit gewesen war.
»Vielleicht haben wir diesmal Glück«, sagte ich zu Wesley, als Marino auf uns zukam.
»Wir werden alles Glück der Welt brauchen«, sagte er und starrte zu den dunklen Bäumen.
Östlich von uns lag das fünfzehn Hektar große Gebiet, das als The Ramble bekannt war, eine abgelegene Gegend mitten im Central Park, berühmt für die vielen Vogelarten, die dort nisteten, und für die gewundenen Pfade durch dicht bewachsenes, felsiges Terrain. Alle Führer, die ich jemals in der Hand gehabt hatte, rieten Touristen dringend davon ab, zu irgendeiner Tages- oder Jahreszeit in The Ramble einsame Wanderungen zu unternehmen. Ich fragte mich, wie Gault sein Opfer in den Park gelockt hatte, wo er sie kennengelernt und was ihn zu der Tat veranlasst hatte. Vielleicht war es einfach nur die Gelegenheit gewesen, die er beim Schopf gepackt hatte, weil er in der Stimmung gewesen war.
»Wie kommt man von The Ramble hierher?«, fragte ich alle, die mir zufällig zuhörten.
Der Polizist, der in dem Dentalgips rührte, blickte mich an. Er war ungefähr so alt wie Marino und hatte feiste, von der Kälte gerötete Wangen.
»Am See entlang führt ein Weg«, sagte er, sein Atem dampfte.
»An welchem See?«
»Man kann ihn jetzt schlecht erkennen. Er ist zugefroren und mit Schnee bedeckt.«
»Wissen Sie, ob das der Weg ist, den sie genommen haben?«
»Das ist ein großer Park, Ma’am. An den meisten Stellen, wie zum Beispiel The Ramble, ist der Schnee zusammengetreten. Von da hält nichts – nicht einmal drei Meter Schnee – die Leute ab, die hinter Drogen oder Sex her sind. Hier bei Cherry Hill ist es anders. Hier dürfen keine Autos fahren, und bei diesem Wetter kommen auch die Reiter nicht bis hierher. Deshalb haben wir Glück gehabt. Wir haben einen echten Tatort.«
»Warum glauben Sie, dass der Täter und sein Opfer bei The Ramble waren?«, fragte Wesley, der Fragen immer direkt und prägnant formulierte, wenn sein kriminalistischer Geist seine umfangreiche Subroutine abspulte und seine ehrfurchtgebietende Datenbank absuchte.
»Einer von uns glaubt, dass er einen Schuhabdruck von ihr dort drüben gesehen hat«, sagte der Beamte, der anscheinend gern redete. »Das Problem ist nur, wie Sie sehen, dass ihre Spuren nicht besonders auffällig sind.«
Wir sahen auf den Schnee, der zunehmend von Fußspuren der Polizisten überzogen war. Die Schuhe des Opfers hatten kein Profil.
»Außerdem«, fuhr er fort, »weil es möglicherweise eine homosexuelle Komponente gibt, denken wir, dass The Ramble vielleicht ihr erstes Ziel war.«
»Was für eine homosexuelle Komponente?«, fragte Wesley.
»Nach einer früheren Beschreibung der beiden schienen sie ein schwules Paar zu sein.«
»Wir sprechen nicht von zwei Männern«, stellte Wesley fest.
»Auf den ersten Blick sah das Opfer nicht wie eine Frau aus.«
»Auf wessen ersten Blick?«
»Der Transit Police. Mit denen sollten Sie reden.«
»He, Mossberg, bist du mit dem Dentalgips fertig?«
»Ich würde noch eine Schicht aufsprühen.«
»Wir haben schon vier. Wir haben eine hervorragende Unterlage, das heißt, natürlich nur, wenn dein Zeug da kalt genug ist.«
Der Beamte namens Mossberg ging in die Hocke und begann, vorsichtig den dickflüssigen Dentalgips in einen mit rotem Wachs überzogenen Abdruck zu gießen. Die Fußspuren des Opfers waren nahe bei den beiden Abdrücken, die wir sicherstellen wollten, ihre Füße waren in etwa so groß wie Gaults. Ich fragte mich, ob wir wohl jemals ihre Stiefel finden würden, und blickte zu der Stelle – ungefähr fünf Meter vom Brunnen entfernt –, an der ihre Spuren die einer Barfüßigen wurden. Fünfzehn Schritte war sie gegangen, geradewegs zum Brunnen, wo Gault ihr in den Kopf geschossen hatte.
Ich sah zu den Schatten außerhalb des erleuchteten Platzes, spürte auf einmal die beißende Kälte, und ich verstand nicht, was im Kopf dieser Frau vorgegangen war. Ich verstand ihre Willfährigkeit nicht.
»Warum hat sie sich nicht gewehrt?«, fragte ich.
»Weil Gault ihr Todesangst eingejagt hat«, sagte Marino, der jetzt neben mir stand.
»Würdest du dich hier aus irgendeinem Grund ausziehen?«, fragte ich ihn.
»Ich bin nicht sie.« Er klang zornig.
»Wir wissen nichts über sie«, fügte der Logiker Wesley hinzu.
»Außer dass sie sich aus irgendeinem bescheuerten Grund den Kopf geschoren hat«, sagte Marino.
»Wir wissen nicht genug, um ihr Verhalten einschätzen zu können«, sagte Wesley. »Wir wissen nicht einmal, wer sie war.«
Ein Einwegfeuerzeug sprühte mehrmals Funken, bevor es Marino mit einer geizigen kleinen Flamme entgegenkam.
»Sie stand völlig unter seiner Kontrolle«, dachte ich laut. »Er hat sie hierhergeführt und ihr gesagt, sie soll sich ausziehen. Und sie hat es getan. Man sieht genau, wo die Schuhabdrücke aufhören und die Spuren ihrer nackten Füße beginnen. Es gab keinen Kampf, sie dachte nicht daran, wegzulaufen. Sie leistete keinerlei Widerstand.«
Marinos Zigarette brannte endlich. Wesley kam aus dem Wald zurück, passte bei jedem Schritt auf, wohin er trat. Ich spürte seinen Blick auf mir.
»Sie hatten eine Beziehung«, sagte ich.
»Gault hat keine Beziehungen«, sagte Marino.
»Er hat seine Art von Beziehungen. So verquer und pervers sie sein mögen. Er hatte eine mit dem Aufseher im Gefängnis von Richmond und mit Helen, der Gefängniswärterin.«
»Ja, und er hat sie beide umgebracht. Helen hat er den Kopf abgeschnitten und ihn in einer verdammten Bowlingtasche auf ein Feld geworfen. Der Farmer, der dieses kleine Präsent gefunden hat, ist bis jetzt nicht wieder in Ordnung. Soweit ich weiß, säuft er wie ein Loch und weigert sich, auf dem Feld irgendetwas anzupflanzen. Er lässt nicht mal seine Kühe drauf weiden.«
»Ich habe nicht gesagt, dass er die Leute, mit denen er eine Beziehung hat, nicht umbringt«, erwiderte ich. »Ich habe nur gesagt, dass er Beziehungen hat.«
Ich starrte auf ihre Fußspuren. Sie hatte Schuhe Größe zweiundvierzig oder dreiundvierzig getragen.
»Ich hoffe, sie machen auch Abdrücke von ihren Spuren«, sagte ich.
Der Polizist namens Mossberg benutzte einen Rührlöffel, um den Dentalgips in jeden Winkel des Abdrucks zu verteilen. Es hatte wieder angefangen zu schneien, harte, kleine, stechende Flocken.
»Von ihren Spuren werden sie keinen Abdruck machen«, sagte Marino. »Sie werden sie fotografieren, und damit hat sich’s, weil sie in keinem Zeugenstand dieser Welt aussagen wird.«
Ich war an Zeugen gewöhnt, die mit niemandem außer mir sprachen. »Ich möchte auch einen Abdruck von ihren Fußspuren«, sagte ich. »Wir müssen sie identifizieren. Die Schuhe könnten uns dabei helfen.«
Marino ging zu Mossberg und seinen Kumpeln, und sie begannen alle, zu reden und mir in regelmäßigen Abständen Blicke zuzuwerfen. Wesley sah in den bewölkten Himmel empor. Es schneite stärker.
»Himmel«, sagte er. »Hoffentlich hört das bald auf.«