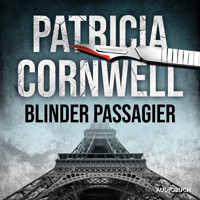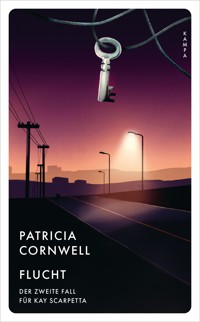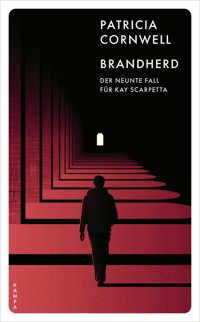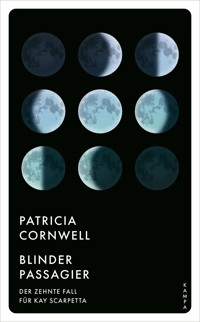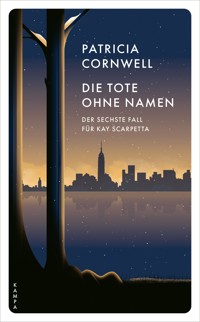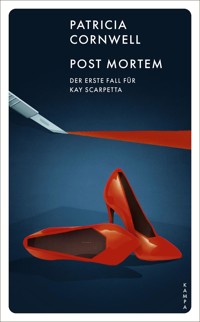
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
Dr. Kay Scarpetta, seit Kurzem Leiterin der Gerichtsmedizin in Richmond, Virginia, erhält frühmorgens einen Anruf von Sergeant Pete Marino von der Mordkommission: »Mr. Nobody« hat wieder zugeschlagen, ein grausamer Serienkiller, der Frauen erwürgt - immer am Samstagmorgen und ohne jedes erkennbare Motiv. Auch scheint es zwischen den Opfern keine Verbindung zu geben. Scarpetta greift bei ihren Ermittlungen auf die neuesten Erkenntnisse der forensischen Forschung zurück. Und tatsächlich bringt die Analyse einer fluoreszierenden Substanz, die der Mörder an jedem der Tatorte hinterlassen hat, Scarpetta schließlich auf die entscheidende Fährte. Doch wird die Zeit reichen, einen weiteren Mord zu verhindern? Der Druck auf Scarpetta wächst: Ihre Vorgesetzten und die Öffentlichkeit wollen Ergebnisse sehen. Und der nächste Samstagmorgen rückt bedrohlich näher ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Patricia Cornwell
Post Mortem
Ein Kay-Scarpetta-Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Daniela Huzly
Kampa
Für Joe und Dianne
1
Am Freitag, dem 6. Juni, regnete es in Richmond. Es begann bei Tagesanbruch und goss in solchen Strömen, dass von den Lilien nur nackte Stängel übrig blieben und der Asphalt und die Gehwege voller Blätter lagen. Bäche flossen über die Straßen, und auf Rasenflächen und Spielplätzen entstanden Teiche. Das Geräusch von Wasser, das gegen das Schieferdach klopft, begleitete mich in den Schlaf, und während die Nacht sich in dem Dunst des beginnenden Samstags auflöste, hatte ich einen schrecklichen Traum.
Ich sah ein weißes Gesicht hinter der regennassen Glasscheibe, ein Gesicht, das so formlos und unmenschlich aussah wie die Gesichter von unförmigen Puppen aus Nylonstrümpfen. Mein Schlafzimmerfenster war dunkel, bis plötzlich das Gesicht auftauchte, etwas Böses, das hereinsah. Ich wachte auf und starrte in die Dunkelheit, ohne etwas zu sehen. Ich wusste nicht, was mich geweckt hatte, bis das Telefon erneut klingelte. Ohne lange herumzusuchen, fand ich den Hörer.
»Dr. Scarpetta?«
»Ja.« Ich tastete nach der Lampe und knipste sie an. Es war zwei Uhr dreißig. Mein Herz pochte wie wild.
»Pete Marino hier. Wir haben wieder eine. Berkley Avenue 5602. Sie kommen wohl besser her.«
Der Name des Opfers, so erklärte er weiter, war Lori Petersen, eine weiße Frau, dreißig Jahre alt. Ihr Ehemann hatte die Tote vor ungefähr einer halben Stunde gefunden.
Einzelheiten waren nicht nötig. In dem Moment, als ich den Hörer abnahm und Sergeant Marinos Stimme erkannte, wusste ich Bescheid. Vielleicht wusste ich es bereits, als das Telefon klingelte. Wer an Werwölfe glaubt, fürchtet den Vollmond. Ich hatte angefangen, mich vor den Stunden zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens zu fürchten, wenn der Freitag zum Samstag wird und die Stadt schläft.
Normalerweise wird der ärztliche Leichenbeschauer, der Bereitschaftsdienst hat, zum Fundort der Leiche gerufen. Aber das hier war nicht normal. Nach dem zweiten Fall hatte ich ausdrücklich darum gebeten, persönlich gerufen zu werden, falls ein weiterer Mord geschehen sollte, egal zu welcher Zeit. Marino war nicht begeistert von dem Gedanken. Von dem Augenblick an, als ich zum Chief Medical Examiner, das heißt zum obersten Gerichtsmediziner von Virginia, ernannt worden war, hatte ich Probleme mit ihm. Ich war mir nicht sicher, ob er Frauen im Allgemeinen oder nur mich nicht mochte.
»Berkley’s in Berkley Downs, Southside«, sagte er herablassend. »Kennen Sie den Weg?«
Ich gab zu, dass ich ihn nicht kannte, und kritzelte die Angaben auf den Notizblock, der immer neben meinem Telefon liegt. Ich legte auf und war auch schon aufgestanden, Adrenalin wirkte wie Espresso auf meine Nerven. Im Haus war es ruhig. Ich griff meine schwarze Arzttasche, die vom jahrelangen Gebrauch schon ganz abgewetzt und mitgenommen aussah.
Die Nachtluft war kühl und feucht, und es brannte kein Licht in den Fenstern der Nachbarhäuser. Ich fuhr mit meinem dunkelblauen Kombi rückwärts aus der Einfahrt und sah zu dem Licht, das über der Veranda brannte, zu dem Fenster im ersten Stock, wo das Gästezimmer lag, in dem meine zehnjährige Nichte Lucy schlief. Das würde ein weiterer Tag im Leben des Kindes werden, an dem ich nicht teilhaben konnte. Ich hatte sie am Mittwochabend vom Flughafen abgeholt, und bis jetzt hatten wir noch nicht oft gemeinsam gegessen.
Auf den Straßen war kein Verkehr, bis ich auf den Parkway kam. Minuten später fuhr ich über den James River. Weit vorn brannten Rücklichter wie Rubine, die Skyline des Stadtzentrums spiegelte sich geisterhaft im Rückspiegel. Zu beiden Seiten breitete sich fächerförmig die Dunkelheit aus, an ihren Rändern feine Ketten aus Lichttupfern. Irgendwo da draußen ist ein Mann, dachte ich. Es konnte jeder sein. Er geht aufrecht, schläft in einem Haus und hat die normale Anzahl Finger und Zehen; er ist wahrscheinlich weiß und viel jünger als ich mit meinen vierzig Jahren. Er ist in nahezu jeder Hinsicht durchschnittlich und fährt vermutlich keinen BMW, besucht keine Bars in teuren Stadtvierteln und keine Bekleidungsgeschäfte auf der Main Street.
Aber er könnte auch genau das tun. Er könnte jeder Beliebige sein und war doch niemand. Mr. Nobody. Die Art von Mensch, die man sofort wieder vergisst, auch wenn man zwanzig Stockwerke in einem Aufzug mit ihm gefahren ist.
Er war zum selbsternannten, unheimlichen Herrscher der Stadt geworden, verfolgte Tausende von Menschen, die er nie gesehen hatte, bis in ihre Gedanken, und verfolgte auch mich. Mr. Nobody.
Die Morde hatten vor zwei Monaten begonnen, es könnte also sein, dass er vor Kurzem aus einem Gefängnis oder einer psychiatrischen Klinik entlassen wurde. In diese Richtung gingen die Vermutungen letzte Woche, aber es wurden täglich neue Theorien aufgestellt.
Ich hatte von Anfang an den starken Verdacht, dass er noch nicht lange in der Stadt war, dass er es vorher irgendwo anders getan hatte und dass er nie in irgendeinem Gefängnis oder einer Klinik gewesen war. Er ging nicht ohne System vor, war kein Amateur und ziemlich sicher nicht »verrückt«.
Wilshire lag zwei Ampeln weiter unten auf der linken Seite, Berkley dann die nächste rechts.
Ich sah die blauen und roten Lichter zwei Häuserblöcke weiter. Der Teil der Straße, der hinter der Nummer 5602 lag, war beleuchtet wie ein Katastrophengebiet. Ein Krankenwagen stand mit laufendem Motor neben zwei zivilen Einsatzfahrzeugen und drei weißen Funkstreifenwagen, deren Blaulichter auf vollen Touren liefen. Das Team von Channel 12 News war eben eingetroffen. Blau-rote Blitze zogen sich die Straße entlang, und mehrere Leute standen in Schlafanzügen und Morgenmänteln vor ihren Häusern.
Ich parkte hinter dem Aufnahmewagen der Fernsehgesellschaft, ein Kameramann lief gerade auf die andere Straßenseite hinüber. Mit gesenktem Kopf, den Kragen meines khakifarbenen Regenmantels hochgeschlagen, ging ich zügig den Kiesweg zum Eingang hinauf. Ich habe es schon immer gehasst, mich in den Abendnachrichten zu sehen. Seit die Morde begonnen hatten, fand mein Büro keine ruhige Minute mehr, die Reporter riefen immer wieder an und stellten immer dieselben taktlosen Fragen.
»Wenn es ein Serienmörder ist, Dr. Scarpetta, heißt das nicht, dass er wahrscheinlich wieder zuschlägt?«
Als ob sie wollten, dass er wieder zuschlug.
»Stimmt es, dass Sie bei dem letzten Opfer Bisswunden entdeckt haben, Doc?«
Es stimmte nicht, aber egal, wie ich so eine Frage beantwortete, ich hatte keine Chance. Sagte ich »Kein Kommentar«, dann meinten sie, es sei wahr. Sagte ich »Nein«, dann stand in der nächsten Ausgabe: »Dr. Kay Scarpetta gibt an, dass auf den Leichen keine Bisswunden entdeckt wurden …« Den Mörder, der die Zeitung wie jeder andere liest, kann so etwas nur inspirieren.
Die letzten Nachrichten schilderten die Tatsachen dramatisch und bis in beängstigende Details. Sie erfüllten längst nicht mehr den Zweck, die Bürger der Stadt zu warnen. Die Frauen, vor allem diejenigen, die allein lebten, wurden immer ängstlicher. Der Verkauf von Handfeuerwaffen und Sicherheitsschlössern war nach dem dritten Mord um fünfzig Prozent gestiegen, und der Tierschutzverein hatte bald keine Hunde mehr – ein Phänomen, das natürlich auch auf der ersten Seite der Zeitungen stand. Gestern hatte die skrupellose, aber preisgekrönte Polizeireporterin Abby Turnbull eine Kostprobe ihrer Dreistigkeit geliefert, indem sie in mein Büro kam, meinen Mitarbeitern einen Vortrag über Pressefreiheit hielt und erfolglos versuchte, an Kopien der Autopsieberichte heranzukommen.
Die Kriminalberichterstattung in Richmond war aggressiv. Die Hauptstadt von Virginia mit ihren zweihunderttausend Einwohnern wurde im vergangenen Jahr vom FBI als die Stadt mit der zweithöchsten Mordrate pro Kopf in den Vereinigten Staaten geführt. Es war nicht ungewöhnlich, dass Rechtsmediziner aus ganz England für einen Monat in mein Institut kamen, um mehr über Schusswunden zu lernen. Es war nicht ungewöhnlich, dass ehrgeizige Polizisten wie Pete Marino dem Wahnsinn von New York oder Chicago entflohen, nur um festzustellen, dass Richmond noch schlimmer war.
Aber diese Sexualmorde waren ungewöhnlich. Der Durchschnittsbürger kann zu Morden im Drogenmilieu keinen Bezug herstellen, ebenso wenig zu einem Obdachlosen, der einen anderen wegen einer Flasche billigen Weins ersticht. Aber diese ermordeten Frauen waren die Kolleginnen, neben denen man bei der Arbeit saß, die Freundinnen, die man zum Einkaufsbummel oder zu einem Drink einlud, die Bekannten, mit denen man auf Partys plauderte, die Menschen, mit denen man in einer Schlange an der Kasse stand. Sie waren irgendjemandes Nachbarin, Schwester, Tochter, Geliebte. Sie lebten in Häusern wie den ihren, schliefen in Betten wie den ihren, wenn Mr. Nobody durch eines der Fenster stieg.
Zwei Streifenbeamte standen an der Eingangstür, die weit offen stand und durch ein gelbes Band versperrt war, auf dem stand: »Polizeiliche Ermittlungen – Betreten verboten«.
»Doc.« Er hätte mein Sohn sein können, dieser Junge in Blau, der auf der obersten Stufe zur Seite trat und das Band hob, um mich darunter hindurchzulassen.
Das Wohnzimmer war tadellos und ansprechend eingerichtet, in warmen rosa Tönen. Auf einer hübschen Kirschholzkommode in einer Ecke standen ein kleiner Fernseher und ein CD-Player. Daneben war ein Regal, auf dem Notenblätter und eine Violine lagen. Unter einem Fenster mit Vorhang, das auf den Vorgarten blickte, stand ein aufklappbares Sofa, und auf dem gläsernen Couchtisch davor lag ein halbes Dutzend Zeitschriften ordentlich gestapelt. Unter ihnen waren der Scientific American und das New England Journal of Medicine. Auf einem chinesischen Drachenteppich mit einem roten Medaillon auf cremefarbenem Grund stand ein Bücherregal aus Walnussholz. Zwei Reihen davon waren vollgestellt mit medizinischen Lehrbüchern.
Eine offene Tür führte auf einen Gang, der die gesamte Länge des Hauses einnahm. Auf der rechten Seite befanden sich einige Zimmer, auf der linken war die Küche, wo Marino und ein junger Beamter mit einem Mann sprachen, von dem ich annahm, dass es der Ehemann war.
Ich registrierte die sauberen Oberflächen, das Linoleum und die Einrichtung in einem gedeckten Weiß, das die Hersteller »Mandel« nennen, und das blasse Gelb der Tapete und der Vorhänge. Meine Aufmerksamkeit wurde auf den Tisch gelenkt. Auf ihm lag ein roter Nylonbeutel, dessen Inhalt von der Polizei untersucht worden war: ein Stethoskop, eine Stablampe, eine Tupperdose, in der einmal eine Mahlzeit gewesen war, und die letzten Ausgaben der Annals of Surgery, des Lancet und des Journal of Trauma. Ich war irritiert.
Marino sah mich kalt an, als ich bei dem Tisch innehielt, dann stellte er mich Matt Petersen, dem Ehemann, vor. Petersen saß zusammengesunken auf einem Stuhl, sein Gesicht war von dem Schock gezeichnet. Er war außerordentlich gut aussehend, fast schön, mit makellos geschnittenen Gesichtszügen, das Haar pechschwarz, seine schöne Haut mit einem Hauch von Bräune. Er hatte breite Schultern und einen schlanken, trainierten Körper, und er trug ein einfaches Hemd und verwaschene Jeans. Sein Blick war auf den Boden gerichtet, seine Hände lagen verkrampft in seinem Schoß.
»Sind die von ihr?« Ich musste es wissen. Die medizinischen Utensilien konnten ihm gehören.
Marinos »Ja« bestätigte es.
Petersens tiefblaue, rot unterlaufene Augen hoben sich langsam. Er schien erleichtert zu sein, als er mich erblickte. Der Arzt war gekommen, ein Funke der Hoffnung, wo es keine gab.
Er murmelte in den abgehackten Sätzen eines überraschten, verstörten Geistes: »Ich habe sie gestern am Telefon gesprochen. Gestern Abend. Sie sagte, sie würde gegen halb zwölf nach Hause kommen, aus der Uniklinik, Notaufnahme. Ich kam hier an, sah, dass die Lichter aus waren, dachte, sie wäre schon zu Bett gegangen. Dann ging ich dort rein.« Seine Stimme hob sich, zitterte, und er atmete tief durch. »Ich ging dort hinein, in das Schlafzimmer.« Seine Augen waren verzweifelt und verquollen, und er flehte mich an. »Bitte. Ich möchte nicht, dass die Leute sie sehen, sie so sehen. Bitte.«
Ich sagte sanft: »Sie muss untersucht werden, Mr. Petersen.«
Eine Faust knallte auf den Tisch in einem überraschenden Wutausbruch. »Ich weiß!« Seine Augen funkelten wild. »Aber all die anderen, die Polizei, jeder!« Seine Stimme zitterte. »Ich weiß, wie das ist! Reporter und alle möglichen Leute, die überall herumwimmeln. Ich will nicht, dass jeder verdammte Wichser sie ansieht!«
Marino zeigte keine Regung. »Ich habe auch eine Frau, Matt. Ich weiß, was in Ihnen vorgeht, okay? Ich gebe Ihnen mein Wort, dass sie mit allem Respekt behandelt wird. Denselben Respekt, den ich erwarten würde, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, okay?«
Der süße Klang von Lügen.
Die Toten können sich nicht verteidigen, und die Vergewaltigung dieser Frau, wie auch die der anderen, hatte erst begonnen. Ich wusste, dass das Ganze erst ein Ende hätte, wenn Lori Petersen vollkommen auseinandergenommen worden war, jeder Zentimeter von ihr fotografiert, und alles für die Experten, die Polizei, Staatsanwälte, Richter und Geschworenen auf dem Präsentierteller lag. Es würden Überlegungen über die Merkmale an ihrem Körper geäußert werden. Es würden kindische Witze und zynische Bemerkungen fallen, als ob das Opfer und nicht der Täter auf der Anklagebank säße, es würde jede Einzelheit ihrer Person und ihrer Lebensweise genau unter die Lupe genommen, beurteilt und in mancher Hinsicht abgeurteilt werden.
Ein gewaltsamer Tod ist ein öffentliches Ereignis, und dies war die Seite meines Berufs, die mich am meisten belastete. Ich tat, was ich konnte, um die Würde der Opfer zu wahren. Aber wenn die Person zu einer Nummer, einem Beweisstück, das weitergereicht wird, wurde, konnte ich nicht mehr viel tun. Die Intimität wird genauso zerstört wie das Leben.
Marino führte mich aus der Küche heraus und ließ einen Officer bei Petersen.
»Haben Sie schon Ihre Fotos gemacht?«, fragte ich.
»Die ID ist gerade drinnen, bestäubt alles«, sagte er und meinte die Leute von der Spurensicherung, die am Tatort arbeiteten. »Ich habe ihnen gesagt, dass sie einen großen Bogen um die Leiche machen sollen.«
Wir blieben im Korridor stehen.
An den Wänden hingen mehrere hübsche Aquarelle und Fotos von ihrem Mann und ihr selbst in den jeweiligen Examensklassen und ein kunstvolles Farbfoto, auf dem das junge Paar vor dem Hintergrund eines Strandes an einem verwitterten Zaun lehnte, die Hosenbeine hochgekrempelt, ihre Haare vom Wind zerzaust, die Gesichter von der Sonne gerötet. Sie war hübsch gewesen, als sie noch lebte, blond, mit feinen Gesichtszügen und einem gewinnenden Lächeln. Sie war in Brown zur Schule gegangen, hatte dann in Harvard Medizin studiert. Ihr Mann hatte seine ersten Studienjahre in Harvard verbracht. Dort mussten sie sich kennengelernt haben, er war offensichtlich jünger als sie.
Lori Petersen. Brown. Harvard. Dreißig Jahre alt. Kurz davor, ihren Lebenstraum zu erfüllen. Nach acht Jahren Medizinstudium. Ärztin. Alles in ein paar Minuten von einem Fremden und seinen perversen Gelüsten zerstört.
Marino berührte meinen Arm.
Ich drehte mich weg von den Fotos, da er meine Aufmerksamkeit auf die offene Tür links vor uns lenkte.
»Hier ist er reingekommen«, sagte er.
Es war ein kleiner Raum mit einem weißen Teppichboden und blauen Tapeten an den Wänden, mit einer Toilette, einem Waschbecken und einem Wäschekorb aus Rattan. Das Fenster über der Toilette stand weit offen, ein dunkles Viereck, durch das kühle, feuchte Luft hereinwehte und die gestärkten Vorhänge bewegte. Dahinter, in der Dunkelheit, dichte Bäume und das drohende Zirpen der Zikaden.
»Das Gitter ist herausgeschnitten worden.« Marinos Gesicht war ausdruckslos, als er mich ansah. »Es lehnt an der Rückseite des Hauses. Direkt unter dem Fenster ist eine Bank. Es sieht so aus, als habe er sich daraufgestellt, damit er hineinsteigen konnte.«
Mein Blick glitt über den Boden, das Waschbecken, die Oberfläche der Toilette. Ich sah weder Schmutz noch Fußabdrücke, aber von meinem Standort aus war es schwer zu beurteilen, und ich hatte nicht die Absicht, das Risiko einzugehen, irgendetwas zu berühren.
»War dieses Fenster verschlossen?«, fragte ich.
»Sieht nicht so aus. Die anderen Fenster waren alle verschlossen. Schon nachgesehen. Sie hätte eigentlich besonders darum besorgt sein müssen, dass dieses hier geschlossen war. Von allen Fenstern ist es das gefährdetste, nicht weit vom Boden, auf der Rückseite, wo niemand sehen kann, was passiert. Im Gegensatz zum Schlafzimmerfenster kann der Kerl, wenn er leise ist, hier ungehört das Gitter herausschneiden, einsteigen und nach unten gehen.«
»Und die Türen? Waren die verschlossen, als der Ehemann nach Hause kam?«
»Er sagt, sie waren es.«
»Also ist der Mörder auf demselben Weg gegangen, wie er gekommen ist«, schlussfolgerte ich.
»Sieht so aus. Ziemlich reinliches Kerlchen, finden Sie nicht?« Er hielt sich am Türrahmen des Bades fest und lehnte sich vor, ohne einzutreten. »Ich sehe nichts, als ob er irgendwie hinter sich hergewischt hätte, um keine Fußspuren auf dem Teppich oder dem Boden zurückzulassen. Es hat den ganzen Tag geregnet.« Seine Augen waren leer, als sie mich ansahen. »Seine Schuhe hätten nass, vielleicht auch verdreckt sein müssen.«
Ich fragte mich, worauf Marino mit all dem hinauswollte. Man konnte ihn nur schwer durchschauen, und ich wusste nie, ob er gut spielte oder einfach nur langsam war. Er gehörte genau zu der Art von Cops, die ich für gewöhnlich mied – arrogant und absolut unnahbar. Sein Gesicht war vom Leben gezeichnet, und lange Strähnen grauen Haars teilten sich in einem tief angesetzten Scheitel und waren über die Halbglatze gekämmt. Er war mindestens einen Meter achtzig groß und hatte einen Bauch vom jahrzehntelangen Trinken von Bourbon oder Bier. Seine unmodisch breite rotweiß gestreifte Krawatte war speckig vom Schweiß vieler Sommer. Marino entsprach dem Klischee eines Action-Film-Helden – ein ordinärer, grober Schnüffler, der vermutlich einen aus dem Maul stinkenden Pudel als Haustier hielt und einen Couchtisch voller Pornohefte hatte.
Ich ging den langen Korridor hinunter und hielt vor dem großen Schlafzimmer an. Ich fühlte, wie ich innerlich dumpf wurde.
Ein ID-Officer war eifrig dabei, alle Oberflächen mit schwarzem Puder zu bestreichen; ein zweiter Officer hielt alles auf Video fest.
Lori Petersen lag auf dem Bett, die blauweiße Decke hing am Fußende herunter. Der Bettbezug war nach unten gezogen und unter ihre Füße gestopft worden, das Leintuch hatte sich an den Ecken gelöst, so dass die Matratzen darunter herausschauten, die Kissen waren auf die rechte Seite ihres Kopfes gedrückt. Das Bett war das Zentrum eines gewaltigen Kampfes, umgeben von der hellen Einrichtung eines Mittelklasseschlafzimmers aus polierter Eiche.
Sie war nackt. Auf dem bunten Flickenteppich rechts von dem Bett lag ihr blassgelber Baumwollmorgenmantel. Er war aufgeschlitzt vom Nacken bis zur Hüfte, und diese Vorgehensweise stimmte mit der bei den ersten drei Opfern überein. Auf dem Nachttisch, der nahe an der Tür stand, stand ein Telefon, das Kabel war aus der Wand gerissen. Die Lampen auf beiden Seiten des Bettes waren ausgeschaltet, ihre Kabel durchtrennt. Mit einem Kabel waren ihre Handgelenke auf den Rücken gefesselt. Das andere Kabel war in teuflisch einfallsreicher Weise um sie gebunden, was ebenfalls mit den anderen drei Fällen übereinstimmte. Es war zunächst um ihren Nacken geschlungen, dann durch das Kabel um ihre Handgelenke hindurchgezogen und fest um ihre Fußgelenke geknotet. Solange ihre Knie gebeugt waren, blieb die Schlinge um ihren Hals locker. Wenn sie ihre Beine streckte, in einem Reflex von Schmerz oder wegen des Gewichts des Vergewaltigers auf ihr, zog sich die Schlinge um ihren Hals zusammen.
Tod durch Ersticken benötigt nur wenige Minuten. Das ist aber eine sehr lange Zeit, in der jede einzelne Zelle des Körpers nach Sauerstoff schreit.
»Sie können hereinkommen, Doc«, sagte der Officer mit der Videokamera. »Ich habe alles gefilmt.«
Vorsichtig trat ich auf das Bett zu, setzte meine Tasche auf dem Boden ab und holte ein Paar Chirurgenhandschuhe heraus. Dann nahm ich meinen Fotoapparat und machte einige Aufnahmen von der Leiche in situ. Ihr Gesicht sah grotesk aus, zur Unkenntlichkeit angeschwollen, blauviolett durch das Austreten von Blut, hervorgerufen durch die enge Schlinge um ihren Hals. Aus der Nase und aus dem Mund waren blutige Sekrete geflossen und hatten das Leintuch verfärbt. Ihr strohblondes Haar war total zerzaust. Sie war relativ schlank, nicht weniger als einen Meter sechzig groß und eindeutig kräftiger als auf den Fotos unten im Gang.
Ihre körperliche Erscheinung war wichtig, denn das Fehlen eines Systems wurde zu einem System. Die vier Ermordeten schienen kein körperliches Merkmal gemeinsam zu haben, nicht einmal die ethnische Herkunft. Das dritte Opfer war schwarz und sehr schlank gewesen, das erste rothaarig und pummelig, das zweite brünett und zart. Sie hatten verschiedene Berufe ausgeübt: eine Lehrerin, eine Schriftstellerin, eine Empfangsdame und nun eine Ärztin. Sie lebten in verschiedenen Vierteln der Stadt.
Ich nahm ein langes Thermometer aus meiner Tasche und prüfte die Temperatur im Zimmer, dann die ihres Körpers. Die Luft hatte einundzwanzig, ihr Körper dreiunddreißigeinhalb Grad. Die Todeszeit kann meist nicht genau bestimmt werden, es sei denn, es gibt einen Zeugen oder die Armbanduhr des Opfers bleibt stehen. Aber Lori Petersen war noch nicht länger als drei Stunden tot. Ihr Körper war ein bis zwei Grad pro Stunde abgekühlt, und die Totenstarre hatte in den kleinen Muskeln bereits eingesetzt.
Ich suchte nach Spuren, die die Fahrt zum Leichenschauhaus nicht überstehen würden. Es gab kein fremdes Haar auf ihrer Haut, aber ich fand eine Vielzahl von Fasern, von denen die meisten zweifellos von der Bettdecke stammten. Mit einer Pinzette nahm ich ein paar davon auf, ganz kleine weiße, und mehrere, die aus einem dunkelblauen oder schwarzen Material zu sein schienen. Ich legte sie in kleine metallene Behälter. Die einzige eindeutige Spur waren der moschusartige Geruch und die Überreste von etwas Durchsichtigem, das aussah wie getrockneter Klebstoff, auf der oberen Vorder- und Rückseite ihrer Beine.
Samenflüssigkeit war bei allen Fällen zu finden gewesen, aber bisher wertlos für serologische Untersuchungen. Der Mörder gehörte zu den zwanzig Prozent der Bevölkerung, die sich durch ihre Eigenschaft als Nonsekretor von den anderen unterschieden. Das hieß, dass man seine Blutgruppenantigene in den anderen Körperflüssigkeiten wie Speichel oder Schweiß oder Sperma nicht nachweisen konnte. Und das bedeutete, ohne Blutprobe konnte seine Blutgruppe nicht bestimmt werden. Er mochte A, B, AB oder sonst etwas haben.
Vor nicht mehr als zwei Jahren wäre die Tatsache, dass der Täter ein Nonsekretor war, ein herber Schlag für die forensischen Untersuchungen gewesen. Aber jetzt gab es die DNA-Analyse, eine neue und ausgesprochen bedeutungsvolle Möglichkeit, den Täter unter allen anderen Menschen eindeutig zu identifizieren, vorausgesetzt, die Polizei hatte ihn gefasst und Proben von ihm entnommen, und er hatte keinen eineiigen Zwillingsbruder.
Marino stand direkt hinter mir.
»Das Badezimmerfenster«, meinte er und sah auf die Leiche, »nun, ihr Ehemann da drinnen sagt«, er deutete mit einem Daumen in Richtung der Küche, »es sei nicht verschlossen gewesen, weil er es letztes Wochenende aufgeschlossen hatte.« Ich hörte nur zu.
»Er sagt, das Badezimmer werde kaum benutzt, es sei denn, sie hatten Gäste. Angeblich hat er letztes Wochenende das Gitter erneuert, er meint, es ist möglich, dass er vergessen hat, das Fenster wieder zu verschließen. Sie« – er schaute wieder zu der Leiche hin – »hatte keinen Grund gehabt, darüber nachzudenken, nahm einfach an, es sei verschlossen.« Er hielt einen Moment inne. »Es ist interessant, dass der Mörder es anscheinend nur an dem Fenster versucht hat, das nicht verschlossen war. Die Gitter vor den anderen Fenstern sind nicht beschädigt.«
»Wie viele Fenster sind auf der Rückseite des Hauses?«, fragte ich.
»Drei. In der Küche, der Toilette und dem Badezimmer hier.«
»Und alle haben schiebbare Fensterrahmen mit einem Schnappschloss auf der Oberseite?«
»Sie haben es erfasst.«
»Das heißt, wenn man von außen mit einer Taschenlampe auf das Schnappschloss leuchtet, kann man wahrscheinlich sehen, ob es verschlossen ist oder nicht?«
»Schon möglich.« Wieder diese ausdruckslosen, unfreundlichen Augen. »Aber nur, wenn man auf etwas steigt. Vom Boden aus kann man das Schloss nicht sehen.«
»Sie erwähnten eine Bank«, erinnerte ich ihn.
»Das Problem dabei ist, dass der Boden hinter dem Haus total schlammig ist. Die Beine der Bank hätten Abdrücke im Rasen hinterlassen müssen, wenn der Kerl sie gegen irgendeines der anderen Fenster gelehnt und sich daraufgestellt hätte. Ein paar meiner Männer schnüffeln gerade da draußen rum. Keine Abdrücke unter den anderen beiden Fenstern. Sieht nicht so aus, als wäre der Mörder in deren Nähe gewesen. Es sieht eher so aus, als wäre er schnurstracks zum Badezimmerfenster am Ende des Gangs gegangen.«
»Ist es möglich, dass das Fenster einen Spalt offen war und dass der Mörder deshalb direkt darauf zuging?«
Marino gab nach: »Alles ist möglich. Aber wenn es einen Spalt offen war, dann hätte sie es vielleicht auch bemerkt, irgendwann während der Woche.«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Im Nachhinein kann man so etwas leicht sagen. Aber die meisten Leute achten nicht besonders auf die Einzelheiten ihrer Häuser, vor allem bei Räumen, die kaum benutzt werden.«
Vor einem Fenster, das auf die Straße zeigte, stand ein Schreibtisch, auf dem sich weitere Beweise dafür befanden, dass Lori Petersen und ich denselben Beruf hatten. Über die Schreibtischunterlage verteilt lagen mehrere medizinische Zeitschriften, die Principles of Surgery und Dorland’s. In der Nähe des Bronzefußes der Tischlampe lagen zwei Datenträger. Auf die Etiketten war mit Filzstift das Datum in Kurzform, 6/1, geschrieben, und sie waren mit I und II nummeriert. Möglicherweise enthielten sie etwas, an dem Lori Petersen gerade in der Uniklinik arbeitete. Im Haus schien kein PC zu sein.
Auf einem Korbstuhl in der Ecke zwischen der Kommode und dem Fenster lagen ordentlich einige Kleider: ein paar weiße Baumwollhosen, ein rotweiß gestreiftes, kurzärmliges Hemd und ein Büstenhalter. Die Kleidungsstücke waren zerknittert, als ob sie getragen und am Ende des Tages auf den Stuhl gelegt worden waren, wie ich es manchmal auch tue, wenn ich zu müde bin, um meine Kleider noch aufzuhängen.
Ich durchsuchte kurz die Toilette und das Badezimmer. Wenn man von dem Bett absah, war das Schlafzimmer sauber und ordentlich. Bis jetzt sah es so aus, als gehöre es nicht zum Modus Operandi des Mörders, zu plündern oder irgendetwas zu stehlen.
Marino beobachtete einen Officer von der Spurensicherung dabei, wie er die Kommoden öffnete.
»Was wissen Sie sonst noch über den Ehemann?«, fragte ich ihn.
»Er ist im Examensjahr in Charlottesville, lebt dort während der Woche, kommt Freitagabend heim. Bleibt über das Wochenende hier und fährt dann am Sonntagabend wieder nach Charlottesville.«
»Was studiert er?«
»Literaturwissenschaft, sagt er«, antwortete Marino und sah überallhin, bloß nicht zu mir. »Er macht gerade seinen Abschluss.«
»Worin?«
»Literatur«, sagte er noch einmal und betonte dabei jede einzelne Silbe.
»Welche Art von Literatur?«
Seine braunen Augen blickten mich emotionslos an. »Amerikanische. Das erzählte er mir, aber ich habe den Eindruck, sein Hauptinteresse gilt dem Theater. Scheint gerade mitten in einem Stück zu stecken. Shakespeare. Hamlet, sagte er, glaube ich. Sagt, er hätte schon einige Rollen gespielt, einschließlich ein paar kleiner Rollen in Filmen, die hier in der Umgebung gedreht wurden, außerdem in einigen Werbespots.«
Die Leute von der Spurensicherung beendeten ihre Arbeit. Einer von ihnen drehte sich um und verharrte, mit dem Pinsel in der Hand.
Marino deutete auf die Datenträger auf dem Tisch und rief so laut, dass es jeder hören konnte: »Sieht so aus, als sollten wir unsere Nase mal in diese Dinger da stecken. Vielleicht ein Stück, das er gerade schreibt?«
»Wir können in meinem Büro einen Blick darauf werfen«, schlug ich vor.
Ein ID-Officer zog etwas unter einem Stapel mit Pullis in einer der unteren Schubladen hervor, ein Messer mit einer langen Klinge und einem Kompass, der in den schwarzen Griff eingearbeitet war, und einem kleinen Schleifstein in einer Tasche des Etuis. Vorsichtig steckte er es in einen Plastikbeutel.
In derselben Kleiderkommode fand sich eine Schachtel mit Kondomen, was, wie ich Marino mitteilte, etwas Ungewöhnliches war, da Lori Petersen, nach dem, was ich im Schlafzimmer gesehen hatte, die Pille nahm.
Marino und die anderen Beamten fingen an, zynische Bemerkungen zum Besten zu geben.
Ich zog meine Handschuhe aus und stopfte sie oben in meine Tasche. »Sie kann jetzt weggebracht werden«, sagte ich.
Die Männer drehten sich im selben Moment um, als ob sie plötzlich an die vergewaltigte tote Frau auf dem zerknitterten, zerwühlten Bett erinnert worden wären. Ihre Lippen waren über den Zähnen zusammengezogen, als ob sie Schmerzen hätte, ihre Augen waren zu kleinen Schlitzen zugeschwollen und starrten blind nach oben.
Der Krankenwagen wurde über Funk informiert, und einige Minuten später kamen zwei Sanitäter in blauen Overalls mit einer Bahre, die sie mit einem sauberen weißen Tuch bedeckt hatten.
Lori Petersen wurde gemäß meinen Anweisungen hochgehoben, die Bettlaken über ihr zusammengeschlagen; die behandschuhten Hände der Sanitäter berührten ihre Haut nicht. Sie wurde vorsichtig auf der Bahre abgelegt, das Tuch am Kopfende befestigt, damit keine Beweisstücke verloren gehen oder hinzugefügt werden konnten. Die Klebestreifen machten ein lautes, reißendes Geräusch, als sie abgezogen und um den Kokon befestigt wurden.
Marino folgte mir aus dem Schlafzimmer, und ich war überrascht, als er sagte: »Ich werde Sie zu Ihrem Wagen begleiten.«
Matt Petersen stand da, als wir hinunter in den Korridor kamen. Sein Gesicht war leer, seine Augen glasig, er starrte mich an, verzweifelt, nach etwas suchend, was nur ich ihm geben konnte. Ein Wort des Trostes. Das Versprechen, dass seine Frau schnell gestorben war und nicht leiden musste. Dass sie erst danach gefesselt und vergewaltigt wurde. Ich konnte ihm nichts sagen. Marino führte mich durch das Wohnzimmer und zur Tür hinaus.
Der Vorgarten war von den Fernsehscheinwerfern erleuchtet, die vor dem Hintergrund der hypnotisierend blinkenden roten und blauen Lichter schwebten. Überall Reporter, die darauf warteten, dass die Leiche endlich über die Eingangstreppen hinuntergetragen und in den Krankenwagen geschoben würde. Ein Fernsehteam war auf der Straße, eine Frau in einem fest zusammengeschnürten Trenchcoat sprach mit ernstem Gesicht in ein Mikrophon, während eine Kamera sie »am Tatort« für die Samstagabendnachrichten aufnahm.
Bill Boltz, der Oberste Staatsanwalt, war gerade angekommen und stieg aus seinem Wagen. Er machte einen abwesenden und schläfrigen Eindruck und zog es vor, den Reportern auszuweichen. Er hatte nichts zu sagen, da er noch nichts wusste. Ich fragte mich, wer ihn benachrichtigt hatte. Vielleicht Marino. Polizisten wimmelten überall herum, einige von ihnen suchten ziellos das Gras mit ihren starken Halogenlampen ab, einige standen neben den weißen Streifenwagen und redeten miteinander. Boltz zurrte seine Windjacke zu und nickte kurz, als unsere Augen sich trafen, dann eilte er den Weg hinauf.
Der Polizeichef und ein Major saßen in einem zivilen beigefarbenen Auto, das Innenlicht war an, ihre Gesichter bleich, und sie nickten hin und wieder und machten Bemerkungen zu Abby Turnbull, der Reporterin. Sie sagte irgendetwas zu ihnen durch das offene Fenster und wartete, bis wir auf der Straße waren, um dann hinter uns herzueilen.
Marino wies sie mit einer Handbewegung und einem »Kein Kommentar« ab.
Er machte den Weg frei. Er war beinahe beruhigt.
»Ist das nicht der letzte Abschaum?«, meinte Marino angewidert und klopfte seine Jacke nach Zigaretten ab. »Ein wahrhafter Affenzirkus.«
Der beginnende Regen war kühl auf meinem Gesicht, als Marino die Tür des Kombis für mich aufhielt. Während ich den Wagen startete, beugte er sich herab und sagte mit einem Grinsen: »Fahren Sie sehr vorsichtig, Doc.«
2
Das weiße Zifferblatt hing wie ein Vollmond am dunklen Himmel, hoch über den Gewölben des alten Bahnhofs, den Gleisen und der Überführung. Die Zeiger der riesigen Uhr waren stehen geblieben, als der letzte Passagierzug vor vielen Jahren hier gehalten hatte. Es war um zwölf Uhr siebzehn gewesen. Es würde immer zwölf Uhr siebzehn an diesem Ende der Stadt sein, wo das städtische Gesundheitswesen beschlossen hatte, ein Krankenhaus für die Toten zu errichten.
Hier war die Zeit stehen geblieben. Gebäude wurden aufgebaut und wieder niedergerissen. Verkehr und Güterzüge krachen und dröhnen wie ein fernes, mürrisches Meer. Die Erde ist voll von unkrautbewachsenem Dreck, voller Trümmer, wo nichts mehr wächst und wo es keine Lichter mehr gibt, wenn es dunkel geworden ist. Hier bewegt sich nichts mehr, außer den Lastwagenfahrern und den Reisenden und den Zügen, die auf ihren Wegen aus Beton und Eisen dahinziehen.
Das weiße Zifferblatt starrte mich an, als ich durch die Dunkelheit fuhr, starrte mich an wie das Gesicht in meinem Traum.
Ich lenkte den Kombi durch ein Tor in dem Drahtzaun und parkte hinter dem Gebäude, in dem ich jeden Tag der vergangenen zwei Jahre verbracht hatte. Der einzige Dienstwagen, der außer meinem auf dem Platz stand, war der graue Plymouth von Neils Vander, dem Fingerabdruckspezialisten. Ich hatte ihn sofort, nachdem Marino mich angerufen hatte, verständigt. Nach dem zweiten Mord war es zu einem Prinzip geworden, sofort zu handeln. Ein weiteres Prinzip war das, dass Vander sofort zu mir ins Leichenschauhaus kommen sollte. Inzwischen war er im Röntgenraum und setzte den Laser in Betrieb.
Aus der Vorhalle schien Licht auf die Straße, und zwei Sanitäter zogen eine Bahre mit einem schwarzen Leichensack aus dem Laderaum eines Krankenwagens. Solche Lieferungen kamen die ganze Nacht hindurch an. Jeder, der in Central Virginia eines gewaltsamen, plötzlichen oder eigenartigen Todes starb, wurde hierher gebracht, egal zu welcher Uhrzeit.
Die jungen Männer in ihren Overalls sahen überrascht aus, als sie bemerkten, dass ich durch die Vorhalle kam und ihnen die Tür, die ins Innere des Gebäudes führte, aufhielt.
»Sie sind früh auf, Doc.«
»Selbstmord aus Mecklenburg«, sagte der andere Sanitäter bereitwillig. »Hat sich vor einen Zug geworfen. Ist über hundert Meter weit mitgeschleift worden.«
»Ja, ja. Nicht mehr viel übrig …«
Die Bahre holperte durch die offene Tür und in den weiß tapezierten Korridor. Der Leichensack schien defekt zu sein oder gerissen. Blut tropfte durch die Unterlage der Bahre hindurch und hinterließ eine rote Spur auf dem Boden.
Das Leichenschauhaus hatte einen spezifischen Geruch, den muffigen Gestank des Todes, den keine noch so große Menge von Duftspray überdecken konnte. Wenn man mich mit verbundenen Augen hierhergebracht hätte, wüsste ich sofort, wo ich mich befand. In diesen frühen Morgenstunden war der Geruch noch scheußlicher, noch unerträglicher als sonst. Die Bahre klapperte laut durch die Halle, als die Sanitäter das Selbstmordopfer zu dem Kühlraum trugen.
Ich ging direkt in das Büro des Leichenschauhauses, wo Fred, der Sicherheitsbeamte, Kaffee aus einem Styroporbecher nippte und darauf wartete, dass die Leute von dem Krankenwagen die Leiche in eine Liste eintrugen. Er saß auf der Ecke des Tisches und hatte sich nach unten gebeugt, damit er nichts sehen konnte, wie er es immer tat, wenn eine Leiche gebracht wurde. Selbst wenn man eine Pistole an seinen Kopf halten würde, könnte man ihn nicht dazu bewegen, irgendjemanden in den Kühlraum zu bringen. Markierungen an den kalten Füßen, die aus den weißen Tüchern herausstanden, hatten eine besondere Wirkung auf ihn.
Er warf einen Blick auf die Wanduhr. Seine Schicht war beinahe zu Ende.
»Wir kriegen wieder eine Erdrosselung rein«, sagte ich zu ihm.
»Du lieber Gott!« Er schüttelte den Kopf. »Ich sag Ihnen, es ist verdammt schwer, sich vorzustellen, dass jemand so etwas tun kann. All diese armen jungen Frauen.« Er schüttelte immer noch den Kopf.
»Die Leiche wird in den nächsten Minuten hier eintreffen, und ich möchte sichergehen, dass die Tür zur Vorhalle geschlossen wird und geschlossen bleibt, sobald die Leiche hier ist, Fred. Draußen wird es vor Reportern nur so wimmeln. Ich möchte niemanden im Umkreis von hundert Metern um dieses Gebäude sehen. Verstanden?« Meine Stimme klang scharf und hart, und ich wusste es. Meine Nerven surrten wie ein Stromkabel.
»Natürlich.« Ein energisches Nicken. »Ich werde aufpassen, werd ich bestimmt.«
Während er sich eine Zigarette anzündete, griff ich nach dem Telefon und wählte die Nummer von meiner Wohnung.
Bertha nahm nach dem zweiten Läuten ab und klang schlaftrunken, als sie heiser »Hallo?« sagte.
»Ich wollte nur hören, ob alles in Ordnung ist.«
»Ich bin da. Lucy hat sich nicht gerührt, Dr. Kay. Schläft wie ein Murmeltier, hat nicht mal gehört, wie ich gekommen bin.«
»Danke, Bertha. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme.«
»Ich werde hierbleiben, bis Sie kommen, Dr. Kay.«
Bertha war in den letzten Tagen auf Abruf bereit, zu kommen. Wenn ich mitten in der Nacht angerufen wurde, dann wurde auch sie angerufen. Ich hatte ihr einen Schlüssel gegeben und sie mit der Alarmanlage vertraut gemacht. Sie kam vermutlich ein paar Minuten nachdem ich gegangen war, bei mir zu Hause an. Dumpf dachte ich daran, dass Lucy, wenn sie in ein paar Stunden aufstehen würde, Bertha anstatt ihrer Tante Kay in der Küche vorfinden würde.
Ich hatte Lucy versprochen, heute mit ihr nach Monticello zu fahren.
Auf einem Transportwagen stand der Stromkasten, kleiner als ein Mikrowellenherd, mit einer Reihe von hellen grünen Lichtern auf der Vorderseite. Er hing wie ein Satellit in der pechschwarzen Dunkelheit des Röntgenraumes, ein Spiralkabel führte von ihm zu einem bleistiftdünnen Stab, der mit Meerwasser gefüllt war.
Der Laser, den wir letzten Winter bekommen hatten, war ein relativ einfaches Gerät.
Unter normalen Lichtquellen geben Atome und Moleküle unabhängig voneinander Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlänge ab. Wird ein Atom aber durch Hitze in einen energiereichen Zustand versetzt und wird dann Licht einer bestimmten Wellenlänge daraufgestrahlt, so kann man das Atom dazu bringen, phasengleiches Licht abzustrahlen.
»Geben Sie mir noch eine Minute.« Neils Vander hantierte an verschiedenen Knöpfen und Schaltern herum, den Rücken mir zugewandt. »Er braucht ziemlich lange, um heute Morgen warm zu werden …« Und mit einem gedrückten Murmeln fügte er hinzu: »Das trifft auch für mich zu.«
Ich stand auf der anderen Seite des Röntgentisches und sah seinen Schatten durch eine getönte Schutzbrille. Direkt vor mir befand sich der dunkle Umriss von Lori Petersens menschlichen Überresten, die Decken von ihrem Bett waren aufgeschlagen, aber immer noch unter ihr. Ich stand eine halbe Ewigkeit in der Dunkelheit, meine Gedanken konzentriert, meine Hände ganz ruhig, meine Sinne klar. Ihr Körper war warm, ihr Leben hatte vor so kurzer Zeit aufgehört, dass es über ihr zu hängen schien wie ein Geruch.
Vander verkündete »Fertig« und betätigte einen Schalter.
Im selben Moment zischte ein schneller synchronisierter Lichtstrahl aus dem Stab, so hell wie ein Blitz. Er schien die Dunkelheit nicht zu vertreiben, sondern sie zu absorbieren. Er leuchtete nicht, sondern glitt über eine kleine Fläche. Vander war ein glitzernder Laborkittel auf der anderen Seite des Tisches, als er den Stab auf ihren Kopf richtete.
Wir untersuchten Zentimeter für Zentimeter des aufgequollenen Fleisches, zarte Fasern leuchteten auf, und ich begann sie mit einer Pinzette einzusammeln. Meine Bewegungen wirkten in der stroboskopischen Beleuchtung abgehackt, erweckten den Eindruck, in Zeitlupe abzulaufen, als ich von dem Röntgentisch zu den Dosen und Umschlägen auf einem Beistelltisch ging. Hin und her. Alles schien ohne Zusammenhang zu sein. Der Laser erhellte die Ecke einer Lippe, einen Fleck von punktförmigen Blutungen auf dem Wangenknochen oder einen Nasenflügel, isolierte jedes Merkmal. Meine behandschuhten Finger, die mit der Pinzette arbeiteten, schienen zu jemand anderem zu gehören.
Der schnelle Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit war schwindelerregend, und die einzige Art, wie ich mein Gleichgewicht halten konnte, war, mich auf einen einzigen Gedanken zu konzentrieren.
»Einer der Jungs, die sie herbrachten«, bemerkte Vander, »erzählte, sie sei Assistenzärztin in der chirurgischen Universitätsklinik gewesen.«
Ich sagte nichts.
»Kannten Sie sie?«
Die Frage überraschte mich. Irgendetwas in mir zog sich zusammen. Meine Fakultät war in der Universitätsklinik, wo sich Hunderte von Medizinstudenten und Assistenzärzten befanden. Es gab keinen Grund, warum ich sie hätte kennen sollen. Ich antwortete nicht, gab nur Anweisungen wie »etwas weiter nach rechts« oder »einen Moment mal so bleiben«. Vander reagierte langsam und bedächtig, er war genauso angespannt wie ich. Ein Gefühl der Hilflosigkeit und Frustration breitete sich langsam in uns aus. Bis jetzt war der Laser kaum nützlicher als ein Staubsauger gewesen, der alle möglichen Teile aufsammelt.
Wir hatten ihn bisher bei ungefähr zwanzig Fällen ausprobiert, von denen nur ein paar seinen Einsatz wert waren. Außer seiner nützlichen Eigenschaft, Fasern und andere Spuren zu finden, kann er auch verschiedene Schweißkomponenten aufdecken, die wie ein Neonschild aufleuchten, wenn sie von einem Laserstrahl getroffen werden. Theoretisch kann ein Fingerabdruck auf menschlicher Haut Licht abstrahlen und damit in Fällen, wo die traditionellen chemischen Methoden keinen Erfolg haben, identifiziert werden. Ich wusste nur von einem Fall, bei dem Abdrücke auf der Haut gefunden worden waren, als eine Frau in einem Thermalbad getötet worden war und der Mörder Sonnenöl auf den Händen gehabt hatte. Weder Vander noch ich erwarteten, dass wir dieses Mal mehr Glück haben würden als bisher.
Der Laserstab suchte mehrere Zentimeter von Lori Petersens rechter Schulter ab, als plötzlich direkt über ihrem rechten Schlüsselbein drei unregelmäßige Abdrücke auftauchten, als ob sie mit Phosphor aufgemalt worden wären. Wir hielten beide inne und starrten sie an. Dann pfiff Vander durch die Zähne, und ein leichter Schauer lief mir über den Rücken.
Vander holte eine Büchse mit Pulver und einen Pinsel und bestrich dann vorsichtig das, was drei latente Fingerabdruckspuren auf Lori Petersens Haut zu sein schienen. Hoffnung keimte in mir auf. »Irgendetwas Brauchbares?«
»Sie sind unvollständig«, antwortete er abwesend, während er anfing, mit einer Polaroidkamera Fotos zu machen. »Die Details der Ränder sind verdammt gut. Gut genug, um sie zu klassifizieren, denke ich. Ich werde sie gleich durch den Computer jagen.«
»Sieht aus, als wäre es derselbe Rückstand«, dachte ich laut. »Dasselbe Zeug auf seinen Händen.« Das Monster hatte sein Opfer wieder gezeichnet. Es war zu schön, um wahr zu sein. Die Fingerabdrücke waren zu schön, um wahr zu sein.
»Sieht aus, als wäre es dasselbe Zeug. Aber er muss diesmal wesentlich mehr davon an seinen Händen gehabt haben.«
Der Mörder hatte noch nie Fingerabdrücke hinterlassen, aber der fluoreszierende Rückstand gehörte schon zu den Dingen, die wir erwarteten. Es gab noch mehr davon. Als Vander anfing, den Hals der Toten abzusuchen, leuchtete eine Anzahl kleiner weißer Sternchen auf, wie Glassplitter auf einer dunklen Straße, die von einem Scheinwerfer getroffen werden. Er hielt den Stab über die Stelle, und ich nahm einen sterilen Tupfer.
Wir hatten dasselbe glitzernde Zeug auch auf den ersten drei Opfern gefunden, am meisten beim dritten Fall, am wenigsten beim ersten. Wir hatten Proben davon ins Labor geschickt. Bis jetzt konnte dieser seltsame Rückstand nicht identifiziert werden, bis auf die Tatsache, dass es sich um einen anorganischen Stoff handelte.
Wir waren nicht sehr viel weiter gekommen, hatten mittlerweile aber eine ziemlich lange Liste von Substanzen, die es sein konnten. In den letzten zwei Wochen hatten Vander und ich mehrere Testserien laufen lassen, hatten alles Mögliche, von der Margarine bis zur Körperlotion, auf unsere Unterarme geschmiert, um zu sehen, was auf den Laser reagierte und was nicht. Es leuchteten weniger Substanzen auf, als wir erwartet hatten, und nichts leuchtete so hell wie die unbekannte, glitzernde Substanz.
Ich schob vorsichtig einen Finger unter das Stromkabel um Lori Petersens Hals und legte eine rote Furche im Fleisch frei. Der Rand war nicht scharf begrenzt – die Erdrosselung hatte langsamer stattgefunden, als ich ursprünglich gedacht hatte. Ich konnte die Abschürfungen sehen, die das Kabel verursacht hatte, als es mehrmals über dieselbe Stelle geglitten war. Es war locker genug, um die Frau eine Zeit lang gerade noch am Leben zu halten. Dann plötzlich war es fest zugezogen worden.
»Versuchen Sie es an den Fesseln um ihre Fußgelenke«, sagte ich ruhig.
Wir tasteten uns weiter nach unten. Dieselben Spuren befanden sich auch dort, aber wieder nur sehr wenige. Der Rückstand, was immer es auch war, war nirgends auf ihrem Gesicht zu finden, ebenso wenig in ihren Haaren oder an den Beinen. Wir fanden einige Spuren auf ihren Unterarmen und eine paillettenförmige Ansammlung auf ihren Oberarmen und Brüsten. Eine Gruppe von kleinen weißen Tupfen klebte auf den Schnüren, die ihre Handgelenke auf dem Rücken zusammenhielten, und auf ihrem zerschnittenen Morgenmantel glitzerten auch einige Tupfen.
Ich ging vom Tisch weg, zündete eine Zigarette an und rekonstruierte.
Der Mörder hatte irgendein Material an den Händen, das überall dort hängen blieb, wo er sein Opfer berührte. Nachdem Lori Petersen ihren Morgenmantel nicht mehr trug, hatte er vielleicht an ihre rechte Schulter gegriffen, und seine Fingerkuppen hatten die Abdrücke oberhalb ihres Schlüsselbeins hinterlassen. In einem Punkt war ich mir sicher: Da die Konzentration der Substanz über ihrem Schlüsselbein am höchsten war, musste er sie hier zuerst berührt haben.
Das war verwirrend, ein Teil, das zu passen schien, aber gar nicht wirklich passte.
Von Anfang an hatte ich angenommen, dass der Mörder seine Opfer sofort mit Gewalt festhielt, sie gefügig machte, vielleicht mit einem Messer drohte, und sie dann fesselte, bevor er ihre Kleider aufschnitt oder irgendetwas anderes machte. Je mehr er berührt hatte, desto weniger blieb von der Substanz auf seinen Händen übrig. Warum diese hohe Konzentration oberhalb des Schlüsselbeins? Lag diese Stelle ihrer Haut bloß, als er seinen Angriff begann? Ich hätte es nicht angenommen. Der Morgenrock war aus einem fein gewebten Baumwollmaterial, weich und dehnbar und so geschnitten, dass er fast wie ein langärmeliges T-Shirt aussah. Er hatte keine Knöpfe oder Reißverschlüsse, und die einzige Möglichkeit, ihn anzuziehen, war, ihn über den Kopf zu ziehen. Sie wäre bis zu ihrem Hals bedeckt gewesen. Wie konnte der Mörder die bloße Haut über ihrem Schlüsselbein berühren, wenn sie ihren Morgenrock noch anhatte? Warum war der Stoff überhaupt in einer so hohen Konzentration vorhanden? Wir hatten vorher nie eine so hohe Konzentration gefunden.
Ich ging hinaus auf den Korridor, wo einige Polizeibeamte an der Wand lehnten und sich unterhielten. Ich bat einen von ihnen, Marino über Funk zu verständigen und ihn zu bitten, mich sofort anzurufen. Kurz darauf hörte ich Marinos Stimme knisternd antworten: »Zehn vier.« Ich schritt schnell über den harten Fliesenboden in dem Autopsieraum mit seinen glänzenden Chromtischen und Waschbecken und Wagen, auf denen die chirurgischen Instrumente lagen. Irgendwo tropfte ein Wasserhahn, und das Desinfektionsmittel roch widerlich süßlich. Das schwarze Telefon auf dem Tisch ärgerte mich mit seinem Schweigen. Marino wusste, dass ich neben dem Telefon wartete, und er genoss dieses Wissen.
Es war zwecklos, Spekulationen darüber anzustellen, was eigentlich falsch gelaufen war und womit es begonnen hatte. Trotzdem dachte ich manchmal darüber nach, was es mit mir zu tun hatte. Als ich Marino zum ersten Mal begegnete, war ich höflich gewesen, hatte ihn mit einem festen, respektvollen Händedruck begrüßt, während seine Augen ausdruckslos wurden.
Zwanzig Minuten vergingen, ehe das Telefon klingelte.
Marino befand sich immer noch in Petersens Haus und befragte den Ehemann, der nach den Worten des Detective »so dämlich wie eine Kanalratte« war.
Ich erzählte ihm von dem Glitzerzeug. Ich wiederholte, was ich ihm bereits erklärt hatte. Es war möglich, dass es von irgendeinem Haushaltsmittel stammte, das in jedem der Mordfälle auftauchte, irgendetwas, nach dem der Mörder suchte und das er in sein Ritual integrierte. Babypuder, Lotionen, Kosmetika, Reinigungsmittel.
Bis jetzt hatten wir viele Dinge ausgeschlossen, was in gewisser Weise der springende Punkt war. Wenn die Substanz nicht in den jeweiligen Häusern zu finden war, was ich eigentlich auch nicht annahm, dann brachte sie der Mörder mit, vielleicht sogar unbewusst, und genau das könnte wichtig sein und uns zu seinem Arbeitsplatz oder in seine Wohnung führen.
»Okay«, kam Marinos Stimme über die Leitung, »ich werde meine Nase mal in die Toiletten und so stecken. Aber ich habe da meine eigene Theorie.«
»Und die wäre?«
»Der Ehemann hier spielt Theater, nicht wahr? Probt jeden Freitagabend, weshalb er so spät heimkommt, richtig? Korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber Schauspieler benutzen Theaterschminke.«
»Nur bei den Kostümproben und in den Aufführungen.«
»Ja«, sagte er schleppend. »Nun, er sagt, dass sie eine Kostümprobe hatten, bevor er heimkam und seine tote Frau gefunden hat. Bei mir klingelt da ein kleines Glöckchen. Meine innere Stimme spricht zu mir …«
Ich unterbrach ihn. »Haben Sie bei ihm die Fingerabdrücke abgenommen?«
»Ja, natürlich.«
»Stecken Sie seinen Bogen in eine Plastiktüte, und wenn Sie herkommen, bringen Sie ihn sofort zu mir.«
Er verstand nicht.
Ich ging nicht näher darauf ein. Ich hatte keine Lust, etwas zu erklären.
Das Letzte, was Marino mir mitteilte, bevor er auflegte, war: »Ich weiß nicht, wann das sein wird, Doc. Ich habe das Gefühl, dass ich für den Rest des Tages hier draußen festsitze.«
Es war nicht anzunehmen, dass ich ihn oder den Fingerabdruckbogen vor Montag hier sehen würde. Marino hatte einen Verdacht. Er verfolgte zielstrebig denselben Weg, den jeder Polizist verfolgt. Ein Ehemann konnte der heilige Antonius sein und in fernen Landen weilen, wenn seine Frau in Seattle ermordet wird, und trotzdem werden die Cops ihn als Ersten verdächtigen.
Private Schießereien, Vergiftungen, Schlägereien und Messerstechereien sind eine Sache, aber ein Lustmord ist etwas anderes. Nur wenige Ehemänner wären so skrupellos, dass sie ihre Ehefrauen fesseln, vergewaltigen und erwürgen würden.
Ich machte die Müdigkeit für meine Konzentrationsschwäche verantwortlich. Ich war seit zwei Uhr dreiunddreißig auf den Beinen, und jetzt war es fast achtzehn Uhr. Die Polizeibeamten, die in das Leichenschauhaus gekommen waren, waren längst fort. Vander war zu Mittag nach Hause gegangen. Wingo, einer meiner Sektionsgehilfen, war kurz darauf gegangen, und ich war die Einzige, die sich noch in dem Gebäude aufhielt.
Die Ruhe, die ich sonst dringend benötigte, störte mich, und ich konnte nicht richtig warm werden. Meine Hände waren steif, die Fingerkuppen fast blau. Jedes Mal, wenn das Telefon im Eingangsbüro klingelte, schreckte ich auf.
Die minimalen Sicherheitsvorkehrungen an meinem Arbeitsplatz schienen außer mir niemanden zu stören. Anträge auf Mittel für angemessene Sicherheitsvorrichtungen waren immer wieder abgelehnt worden. Der Verwaltungsleiter dachte nur an den Verlust von Eigentum, und kein Dieb würde in ein Leichenschauhaus einbrechen, selbst wenn wir einen roten Teppich für ihn auslegen würden und die Türen weit offen ließen. Leichen sind eine bessere Abschreckung als jeder Wachhund.
Die Toten haben mich nie gestört. Die Lebenden fürchte ich.
Nachdem vor einigen Monaten ein bewaffneter Irrer in die Praxis eines Arztes gekommen war und im vollen Wartezimmer um sich geschossen hatte, war ich selbst in einen Metallwarenladen gegangen und hatte eine Kette und ein Vorhängeschloss gekauft, das abends und an Wochenenden benutzt wird, um die vorderen Doppelglastüren zusätzlich zu verschließen.
Plötzlich, während ich an meinem Tisch arbeitete, rüttelte jemand so kräftig an diesen Eingangstüren, dass die Kette immer noch hin- und herschwang, als ich mich endlich zusammennahm und in den Korridor hinunterging, um nachzusehen. Niemand war da. Manchmal versuchen Obdachlose in unsere Toiletten zu kommen, aber als ich hinausschaute, konnte ich niemanden sehen.
Ich ging zurück in mein Büro und war so nervös, dass ich, als ich die Lifttüren auf der anderen Seite des Gangs aufgehen hörte, eine Schere in die Hand nahm und bereit war, sie als Waffe zu benutzen. Es war der Sicherheitsbeamte der Tagschicht.
»Haben Sie eben versucht, durch die vordere Glastür zu kommen?«, fragte ich ihn.
Er schaute neugierig auf die Schere, die ich umklammert hielt, und sagte, er sei es nicht gewesen. Ich bin sicher, die Frage schien ihm eigenartig zu sein. Er wusste, dass die Vordertüren mit Ketten verschlossen waren, und nur er hatte die Schlüssel für die anderen Türen im Gebäude. Er hatte also keinen Grund, durch die Vordertüren zu kommen.
Die unbehagliche Stille trat wieder ein, als ich mich an meinen Tisch setzte und versuchte, den Bericht über Lori Petersen zu diktieren. Aus irgendeinem Grund konnte ich nicht sprechen, konnte es nicht ertragen, die laut ausgesprochenen Worte zu hören. Das Gefühl überkam mich langsam, dass niemand diese Worte hören sollte, nicht einmal Rose, meine Sekretärin. Niemand sollte etwas hören über den glitzernden Rückstand, die Samenflüssigkeit, die Fingerabdrücke, die tiefen Verletzungen an ihrem Hals – und, am schlimmsten, über die Zeichen ihrer Qual. Der Mörder wurde immer grausamer.
Mord und Vergewaltigung reichten ihm nicht mehr. Erst als ich die Fesseln von Lori Petersens Körper entfernt, kleine Schnitte in verdächtige rot gefärbte Hautbereiche gemacht und nach gebrochenen Knochen getastet hatte, wurde mir klar, was sich vor ihrem Tod abgespielt haben musste.
Die blauen Flecken waren so frisch, dass sie an der Oberfläche kaum sichtbar waren, aber die Einschnitte zeigten die zerstörten Blutgefäße unter der Haut, und die Muster sprachen dafür, dass sie mit einem stumpfen Gegenstand, wie einem Knie oder einem Fuß, gestoßen worden war. Auf der linken Seite waren drei Rippen in Serie gebrochen sowie vier Finger. In ihrem Mund fand ich Fasern, die meisten auf ihrer Zunge, was vermuten ließ, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt geknebelt worden war, um zu verhindern, dass sie schrie.
Ich erinnerte mich an die Geige auf dem Musikregal im Wohnzimmer und an die chirurgischen Zeitungen und Bücher auf dem Schreibtisch im Schlafzimmer. Ihre Hände. Sie waren die wertvollsten Instrumente, etwas, womit sie heilte und Musik machte. Er muss ihre Finger absichtlich gebrochen haben, einen nach dem anderen, während sie gefesselt war.
Das Diktiergerät lief und nahm die Stille auf. Ich schaltete es ab und rollte mit meinem Arbeitsstuhl hinüber zum Computer. Der Monitor blinkte, und schwarze Buchstaben liefen über den Bildschirm, als ich anfing, den Autopsiebericht selbst zu schreiben.
Ich sah nicht auf die Zahlen und Notizen, die ich während der Autopsie gemacht hatte. Ich wusste alles über die Frau. Ich hatte ein perfektes Gedächtnis. Die Wörter »ohne pathologischen Befund« spukte mir im Kopf herum. Es hatte ihr nichts gefehlt. Ihr Herz, ihre Lungen, ihre Leber. »Ohne pathologischen Befund.« Sie war vollkommen gesund gewesen. Ich schrieb weiter und weiter, bis ich plötzlich aufschrak. Fred, der Sicherheitsbeamte, stand in meiner Tür.
Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich gearbeitet hatte. Seine Schicht fing um zwanzig Uhr wieder an. Alles, was gewesen war, seit ich ihn zuletzt gesehen hatte, schien wie ein Traum zu sein, ein schrecklicher Traum.
»Immer noch hier?« Dann zögernd: »Da ist so eine Bestattungsgesellschaft unten, um eine Leiche zu holen, aber ich kann sie nicht finden. Die sind den ganzen Weg von Mecklenburg gekommen. Ich weiß nicht, wo Wingo ist …«
»Wingo ist schon vor einigen Stunden nach Hause gegangen«, sagte ich. »Welche Leiche?«
»Jemand namens Roberts, ist von einem Zug überrollt worden.«
Ich überlegte einen Moment. Außer Lori Petersen waren es heute sechs Fälle gewesen. Ich erinnerte mich vage an das Zugunglück. »Er ist im Kühlraum.«
»Sie sagen, sie können ihn dort nicht finden.«
Ich nahm meine Brille ab und rieb mir die Augen. »Haben Sie nachgesehen?«
Sein Gesicht verzog sich zu einem dämlichen Grinsen. Fred trat einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. »Dr. Scarpetta, Sie wissen, dass ich nie in diesen Raum gehe!«
3
Ich bog in meine Auffahrt ein und war erleichtert, dass Berthas Pontiac immer noch dort stand. Die Eingangstür ging auf, noch bevor ich den richtigen Schlüssel heraussuchen konnte.
»Wie ist die Stimmung?«, fragte ich direkt.
Bertha und ich standen in der geräumigen Diele und sahen uns an. Sie wusste genau, was ich meinte. Wir hatten diese Art von Konversation am Ende jeden Tages, an dem Lucy in der Stadt war.
»Ziemlich schlecht, Dr. Kay. Dieses Kind war den ganzen Tag in Ihrem Arbeitszimmer und hämmerte auf Ihren Computer ein. Ich kann Ihnen sagen! Ich setze meinen Fuß gerade mal rein, um ihr ein Sandwich zu bringen und zu fragen, wie es ihr geht, da fängt sie sofort an herumzuzetern, um sich dann gleich wieder dem Computer zuzuwenden. Aber ich weiß ja«, ihre dunklen Augen wurden weicher, »sie ist einfach nur traurig, dass Sie arbeiten müssen.«
Ich hatte Schuldgefühle.
»Ich habe die Abendzeitung gesehen, Dr. Kay. Gott im Himmel!« Sie steckte ihre Arme nacheinander in die Ärmel ihres Regenmantels. »Ich weiß, warum Sie tun mussten, was Sie den ganzen Tag getan haben. Herrgott! Ich hoffe wahrhaftig, dass die Polizei diesen Mann fasst. Es ist so niederträchtig, so gemein.«
Bertha wusste, womit ich mein Geld verdiente, und sie fragte mich nie irgendetwas. Sogar wenn einer meiner Fälle jemanden aus der Nachbarschaft betraf, sie fragte nicht.
»Die Abendzeitung ist da drinnen.« Sie zeigte auf das Wohnzimmer und nahm ihr Notizbuch von dem Tisch neben der Tür. »Ich habe sie unter ein Couchkissen gesteckt, damit sie sie nicht in die Hände bekommt. Ich wusste nicht, ob Sie wollten, dass sie es liest, Dr. Kay.« Sie klopfte mir auf die Schulter und ging hinaus.
Ich beobachtete, wie sie zu ihrem Wagen ging und langsam rückwärts die Auffahrt hinunterfuhr. Ich entschuldigte mich nicht mehr für meine Familie. Bertha war von meiner Nichte, meiner Schwester, meiner Mutter sowohl persönlich als auch telefonisch beleidigt und tyrannisiert worden. Bertha wusste Bescheid. Sie äußerte nie Kritik oder Mitgefühl, und ich hatte sie manchmal im Verdacht, dass sie mich bemitleidete, und das gab mir ein noch schlechteres Gefühl. Ich schloss die Eingangstür und ging in die Küche.
Die Küche war mein Lieblingsraum, mit hoher Decke, modern, aber zweckmäßig eingerichtet, da ich die meisten Dinge, wie Nudeln oder Hefeteig, lieber selbst herstellte. In der Mitte des Kochbereiches war ein Arbeitsplatz aus Marmor, genau in der richtigen Höhe für jemanden, der ohne Schuhe exakt einen Meter sechzig groß war. Auf der anderen Seite stand ein Frühstückstisch, von dem man durch ein Fenster auf die Bäume im Hinterhof und das Vogelhäuschen blickte. Auf den hellen Naturholzschränken und Oberflächen waren Blumensträuße verteilt, die aus meinem leidenschaftlich gepflegten Garten stammten. Lucy war nicht hier. Ihr Geschirr vom Abendessen stand im Geschirrständer, und ich nahm an, dass sie wieder in meinem Arbeitszimmer war.
Ich ging zum Kühlschrank und goss mir ein Glas Chablis ein, lehnte mich an den kühlen Marmor, schloss einen Moment lang die Augen und nippte an dem Wein. Ich wusste nicht, was ich mit Lucy machen sollte.
Letzten Sommer war sie zum ersten Mal hier gewesen, seit ich das Gerichtsmedizinische Institut von Dade County verlassen hatte und aus der Stadt, in der ich geboren worden war und in die ich nach meiner Scheidung wieder zurückkehrte, weggezogen war. Lucy ist meine einzige Nichte. Mit zehn Jahren löste sie bereits Rechenaufgaben, die man erst in der Highschool lernte. Sie war ein Genie, ein unmögliches kleines Biest rätselhafter südländischer Abstammung, deren Vater starb, als sie zur Welt kam. Sie hatte niemanden außer meiner einzigen Schwester, Dorothy, die zu sehr damit beschäftigt war, Kinderbücher zu schreiben, als sich um ihre eigene Tochter zu kümmern. Lucys Verehrung für mich war jenseits jeder vernünftigen Erklärung, und ihre Anhänglichkeit forderte eine Energie von mir, die ich im Moment nicht aufbringen konnte. Während ich nach Hause fuhr, hatte ich mir überlegt, ob ich ihren Flug umbuchen und sie nach Hause nach Miami schicken sollte. Aber ich brachte es nicht übers Herz.
Sie würde es nicht verstehen. Es wäre die endgültige Abweisung in einer ein Leben lang dauernden Serie von Abweisungen, ein weiteres Zeichen dafür, dass sie unbequem und unerwünscht war. Sie hatte sich schon das ganze Jahr über auf diesen Besuch gefreut, und ich hatte mich auch darauf gefreut.
Ich nahm noch einen Schluck Wein und wartete darauf, dass die Stille anfangen würde, meine verhedderten Nerven zu entwirren und meine Sorgen wegzublasen.
Mein Haus lag in einer neuen Siedlung am westlichen Ende der Stadt, wo große Wohnhäuser auf bepflanzten Grundstücken standen und der Verkehr auf den Straßen fast ausschließlich aus Kombis und Familienkutschen bestand. Die Nachbarn waren ruhig, Einbrüche und Vandalismus so selten, dass ich mich nicht erinnern konnte, in letzter Zeit einen Streifenwagen gehört zu haben. Die Ruhe und Sicherheit war jeden Preis wert, eine Notwendigkeit, ein Muss für mich. Es war beruhigend für meine Seele, morgens allein zu frühstücken und zu wissen, dass sich die einzige Aggression vor meinen Fenstern zwischen einem Eichhörnchen und einem Eichelhäher abspielte, die sich um Futter stritten.
Ich atmete tief ein und nahm noch einen Schluck Wein. Ich fürchtete mich davor, ins Bett zu gehen, fürchtete mich vor der Dunkelheit, hatte Angst davor, wie es sein würde, wenn ich meinem Geist erlaubte, zu ruhen und unaufmerksam zu sein. Ich konnte nicht aufhören, Lori Petersen zu sehen. Ein Damm war gebrochen, und meine Vorstellungskraft brach über mich herein und machte aus den Bildern noch schrecklichere.
Ich sah ihn mit ihr, in diesem Schlafzimmer. Fast konnte ich sein Gesicht sehen, aber es war konturenlos, zog nur kurz an mir vorbei wie ein Blitz. Nach der ersten lähmenden Angst, die das Aufwachen durch das Gefühl kalten Stahls an ihrem Hals oder durch seine grauenerregende Stimme hervorgerufen hatte, würde sie zunächst versucht haben, mit ihm zu reden. Sie hatte alles Mögliche gesagt, versucht, es ihm auszureden, während er die Kabel der Lampen durchschnitt und anfing, sie zu fesseln. Sie war Harvard-Absolventin, Chirurgin. Sie hatte versucht, ihren Kopf gegen eine Macht zu gebrauchen, die kopflos ist.