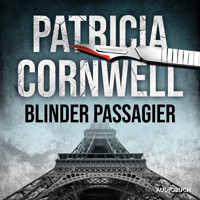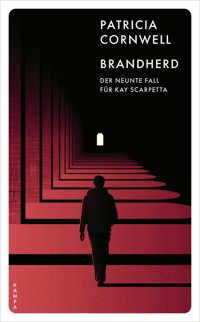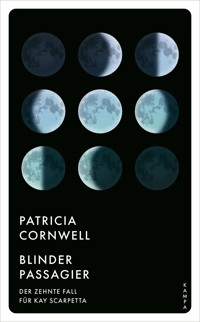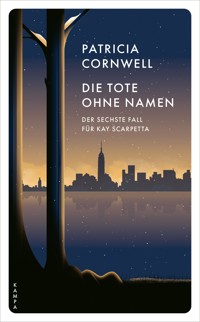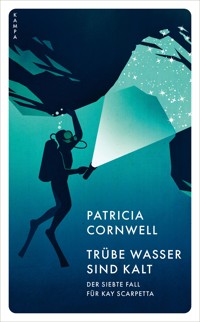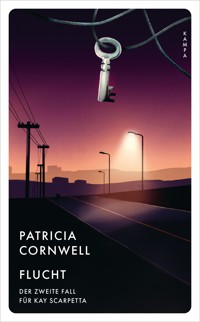
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
Im Kühlraum der Gerichtsmedizin von Richmond liegt die übel zugerichtete Leiche einer jungen Schriftstellerin. Die Autopsie ist abgeschlossen, Dr. Kay Scarpetta kennt jeden Zentimeter von Beryl Madisons Körper: ihre blauen Augen und von der Sonne golden gefärbten Haare, die siebenundzwanzig Schnittverletzungen, die durchtrennte Kehle. Doch wie es zu dem grausamen Mord kommen konnte, ist der Gerichtsmedizinerin ein Rätsel: Am Tatort gefundene Briefe beweisen, dass Beryl Madison zuletzt verängstigt nach Key West geflohen ist, vor einem Unbekannten, der sie ausspionierte und bedrohte. Erst in der Tatnacht ist sie notgedrungen in ihr Haus in Richmond zurückgekehrt - um dort ihrem Mörder offenbar widerstandslos die Tür zu öffnen. Kannte sie den Täter? Und warum ist ihr letztes Manuskript verschwunden? Je mehr sich Kay Scarpetta mit dem Fall befasst, desto bizarrer erscheint ihr das Verbrechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Patricia Cornwell
Flucht
Der zweite Fall für Kay Scarpetta
Aus dem amerikanischen Englisch von von Thomas A. Merk
Kampa
Für Ed, Special Agent
und besonderer Freund
Prolog
Key West, 13. August
An M:
Dreißig Tage sind nun vergangen, voller Sonne, hellen Farben und launischem Wind. Ich denke zu viel nach und träume nicht. Die Nachmittage verbringe ich meistens in Louie’s Backyard, schreibe auf der Veranda des Restaurants und schaue aufs Meer hinaus. Das Wasser ist smaragdgrün gefleckt über dem Mosaik der Sandbänke und ultramarinblau, wo es tiefer wird. Der Himmel ist unendlich weit, und weiße Wolkenbälle ziehen wie Rauchwölkchen dahin. Der beständige Wind lässt die Geräusche von Badenden und Segelbooten, die kurz hinter dem Riff vor Anker liegen, verschwimmen. Die Veranda ist überdacht, und wenn sich ein plötzlicher Sturm zusammenbraut, was häufig am Spätnachmittag der Fall ist, bleibe ich an meinem Tisch, rieche den Regen und schaue zu, wenn er das Wasser aufraut wie gegen den Strich gebürstetes Fell. Manchmal gießt es, während gleichzeitig die Sonne scheint.
Niemand belästigt mich hier. Mittlerweile bin ich ein Mitglied der Familie des Restaurants, so wie Zulu, der schwarze Neufundländer, der Frisbees hinterherplanscht, und die herumstreunenden Katzen, die leise herankommen und höflich auf Reste warten. Louies vierbeinige Pfleglinge essen besser als seine menschlichen. Es tut gut zu sehen, wie die Welt ihre Geschöpfe freundlich behandelt. Ich kann mich über meine Tage hier nicht beklagen.
Es sind die Nächte, vor denen ich mich fürchte.
Wenn meine Gedanken in dunkle Spalten zurückkriechen und ihre furchterregenden Netze spinnen, werfe ich mich in die überfüllten Straßen der Altstadt, von lärmenden Bars angezogen wie eine Motte vom Licht. Walt und P.J. haben meine nächtlichen Gewohnheiten zu einer Kunst hochstilisiert. Walt kommt als Erster ins Haus zurück, in der Abenddämmerung, weil mit seinem Silberschmuck am Mallory Square nach Einbruch der Dunkelheit nichts mehr läuft. Wir machen ein paar Flaschen Bier auf und warten auf P.J. Dann gehen wir aus, in eine Bar nach der anderen, und landen normalerweise bei Sloppy Joe. Wir werden langsam unzertrennlich. Ich hoffe, dass die beiden für immer unzertrennlich bleiben werden. Ihre Liebe erscheint mir nicht mehr länger ungewöhnlich. Nichts erscheint mir mehr so, außer dem Tod, den ich erblicke.
Ich sehe Männer, ausgezehrt und bleich. Ihre Augen sind Fenster, durch die ich gequälte Seelen entdecke. Aids verschlingt wie ein Moloch die Opfergaben dieser kleinen Insel. Komisch, dass ich mich bei den Ausgestoßenen und Sterbenden zu Hause fühle. Es könnte gut sein, dass sie mich alle überleben. Wenn ich nachts wach liege und dem Surren des Ventilators am Fenster lausche, drängen sich mir Bilder auf. Bilder davon, wie es geschehen wird.
Immer wenn ich ein Telefon klingeln höre, erinnere ich mich daran. Jedes Mal, wenn ich jemanden hinter mir gehen höre, drehe ich mich um. Nachts schaue ich in den Schrank, hinter den Vorhang und unters Bett. Dann klemme ich einen Stuhl unter die Türklinke.
Lieber Gott, ich will nicht nach Hause.
Beryl
Key West, 30. September
An M:
Gestern bei Louie kam Brent heraus auf die Veranda und sagte, dass jemand für mich am Telefon sei. Mein Herz klopfte wie wild. Ich ging hinein, aber ich hörte nichts als ein Rauschen, wie bei einem Ferngespräch. Dann war die Leitung plötzlich tot.
Mein Gott, wie fühlte ich mich danach! Ich redete mir ein, dass es nichts weiter als mein Verfolgungswahn sei. Er hätte bestimmt etwas gesagt und sich an meiner Angst geweidet. Es ist unmöglich, dass er weiß, wo ich bin, ausgeschlossen, dass er mich hier aufgespürt hat. Einer der Kellner heißt Stu. Er hat sich kürzlich von einem Freund oben im Norden getrennt und ist hierhergekommen. Vielleicht hat dieser Freund angerufen, und weil die Verbindung schlecht war, klang es so, als habe er »Straw« verlangt anstatt »Stu«. Als ich dann am Telefon war, hat er aufgelegt. Ich wünschte, ich hätte niemandem meinen Spitznamen gesagt. Ich bin Beryl. Ich bin Straw. Ich habe Angst.
Das Buch ist noch nicht fertig. Aber ich habe fast kein Geld mehr, und das Wetter ist umgeschlagen. Heute Morgen ist es finster draußen, und es weht ein starker Wind. Ich bin in meinem Zimmer geblieben, denn wenn ich versucht hätte, bei Louie zu arbeiten, hätte es mir die Seiten aufs Meer hinausgeblasen. Die Straßenlaternen brennen schon. Palmen kämpfen mit dem Wind, ihre Wedel sehen aus wie umgestülpte Regenschirme. Die Welt stöhnt vor meinem Fenster wie ein verwundetes Tier, und wenn der Regen an die Scheibe trommelt, klingt es, als ob eine dunkle Armee einmarschiert wäre und nun Key West belagerte.
Bald muss ich fort von hier. Ich werde diese Insel vermissen. Ich werde P.J. und Walt vermissen. Bei ihnen habe ich mich beschützt, sicher und umsorgt gefühlt. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn ich zurück nach Richmond komme. Vielleicht sollte ich sofort umziehen, aber ich weiß nicht, wohin.
Beryl
1
Ich legte die Briefe aus Key West in den Aktendeckel aus braunem Papier zurück, packte ein Paar weiße Baumwollhandschuhe in meine schwarze Arzttasche und fuhr mit dem Aufzug ein Stockwerk hinunter zur Leichenhalle. Der gekachelte Gang war feucht, der Autopsieraum verlassen und abgeschlossen. Schräg gegenüber dem Aufzug lag der Kühlraum aus Edelstahl, und als ich seine massive Tür öffnete, begrüßte mich der vertraute Schwall kalter, verdorben riechender Luft. Ich musste nicht erst die Zettel an den Zehen überprüfen. Die Rollbahre, die ich suchte, erkannte ich ohne Mühe an dem schlanken Fuß, der unter einem weißen Laken hervorschaute. Ich kannte jeden Zoll von Beryl Madison.
Rauchblaue Augen starrten mich glanzlos aus halb geöffneten Lidern an, das Gesicht war schlaff und von bleichen, offenen Schnitten entstellt, die meisten davon befanden sich auf der linken Seite. Ihr Hals klaffte bis zur Wirbelsäule auf, alle Muskeln unterhalb des Zungenbeins waren durchtrennt worden. Neun eng beieinanderliegende Stichwunden auf dem linken Thorax und Busen standen offen wie große, rote Knopflöcher und lagen fast genau untereinander. Sie waren ihr in rascher Folge mit so brutaler Kraft beigefügt worden, dass auf ihrer Haut noch die Abdrücke des Griffes zu sehen waren. Die Schnitte an ihren Unterarmen und Händen maßen zwischen acht Millimeter und elf Zentimeter in der Länge. Zusammen mit den zwei Wunden an ihrem Rücken, die Stichwunden und ihre durchschnittene Kehle nicht hinzugerechnet, waren ihr siebenundzwanzig Schnittverletzungen zugefügt worden, während sie versucht hatte, die Angriffe einer langen scharfen Klinge abzuwehren.
Ich brauchte keine Fotografien oder Körperdiagramme. Wenn ich meine Augen schloss, konnte ich Beryl Madisons Gesicht, die ihrem Körper zugefügte Gewalt in allen abscheulichen Einzelheiten sehen. Ihre linke Lunge wies vier Einstiche auf. Ihre Halsschlagadern waren beinahe vollständig durchschnitten, Aortabogen, Lungenarterie, Herz und Herzbeutel verletzt worden. Sie war praktisch schon tot gewesen, als der Verrückte sie auch noch fast enthauptet hatte.
Ich versuchte, mir einen Reim auf die Sache zu machen. Jemand hatte gedroht, sie zu ermorden. Sie floh nach Key West. War wie von Sinnen vor Angst. Sie wollte nicht sterben. Und trotzdem passierte es noch in derselben Nacht, in der sie nach Richmond zurückgekehrt war.
Warum hast du ihn ins Haus gelassen? Warum, um Himmels willen, hast du das getan?
Ich zog das Laken wieder gerade und schob die Rollbahre zurück an die Rückwand des Kühlschranks zu den anderen Leichen. Morgen um diese Zeit würde ihr Körper verbrannt und ihre Asche auf dem Weg nach Kalifornien sein. Beryl Madison wäre in diesem Monat vierunddreißig Jahre alt geworden. Sie hatte keine lebenden Verwandten, niemanden auf der ganzen Welt, wie es schien, außer einer Halbschwester in Fresno. Die schwere Tür schloss sich mit einem schmatzenden Geräusch.
Der Teer auf dem Parkplatz hinter dem OCME, dem Büro des Chief Medical Examiner, lag warm und fest unter meinen Füßen, und ich roch die Kreosotdünste, die die für diese Jahreszeit ungewöhnlich warme Sonne von den Eisenbahnviadukten in der Nähe aufsteigen ließ. Es war der 31. Oktober. Halloween.
Die Tür zur Rampe stand weit offen, und einer meiner Assistenten spritzte mit einem Schlauch den Beton ab. Spielerisch formte er aus dem Wasserstrahl einen Bogen und ließ ihn so nahe an mir herunterprasseln, dass ich den Sprühnebel um meine Knöchel spürte.
»Hey, Dr. Scarpetta, seit wann halten Sie sich an den Achtstundentag?«
Es war kurz nach halb fünf. Ich verließ das Büro selten vor sechs.
»Soll ich Sie irgendwohin mitnehmen?«, fügte er hinzu.
»Ich werde abgeholt, danke«, antwortete ich.
Ich bin in Miami geboren. Der Teil der Welt, in dem sich Beryl Madison den Sommer über versteckt hatte, war mir nicht fremd. Wenn ich meine Augen schloss, konnte ich die Farben von Key West sehen. Ich sah strahlendes Grün und Blau und Sonnenuntergänge, die so kitschig sind, dass man sie höchstens dem lieben Gott durchgehen lässt. Beryl Madison hätte niemals nach Hause zurückkehren sollen.
Glänzend wie schwarzes Glas kam ein nagelneuer LTD Crown Victoria langsam auf den Parkplatz gefahren. Weil ich den gewohnten verbeulten Plymouth erwartet hatte, fuhr ich zusammen, als das elektrische Fenster des neuen Ford nach unten summte. »Warten Sie auf den Bus, oder was?«
Eine verspiegelte Sonnenbrille reflektierte mein überraschtes Gesicht. Elektronisch gesteuert sprang die Türverriegelung mit einem entschlossenen Klicken auf, und Lieutenant Pete Marino versuchte, ein gleichgültiges Gesicht aufzusetzen.
»Ich bin beeindruckt«, sagte ich, während ich es mir im luxuriösen Inneren des Wagens bequem machte.
»Gehört mit zu meiner Beförderung.« Er trat aufs Gaspedal und jagte den Motor im Stand hoch.
»Nicht schlecht, was?«
Nach all den Jahren mit abgehalfterten Arbeitskleppern hatte Marino es endlich zu einem Prachthengst gebracht.
Ich bemerkte das Loch im Armaturenbrett, als ich meine Zigaretten herausholte.
»Haben Sie da Ihr Blaulicht reingesteckt oder bloß Ihren Elektrorasierer?«
»Ach, Mist«, schimpfte er, »irgendein Penner hat meinen Zigarettenanzünder geklaut. In der Waschstraße. Mein Gott, ich hatte den Wagen erst einen Tag, können Sie sich das vorstellen? Ich fahr also rein, und die Bürsten brechen doch einfach die Antenne ab! Ich schimpfe natürlich wie blöd herum, bin ganz damit beschäftigt, die Sache klarzustellen und den Pennern die Hölle heiß zu machen …«
Manchmal erinnerte mich Marino an meine Mutter.
»… und erst später bemerke ich, dass der verdammte Zigarettenanzünder verschwunden ist.«
Er hielt inne und kramte in seinen Taschen, während ich meine Handtasche nach Streichhölzern durchwühlte.
»Hey, Chief, ich dachte, Sie wollten das Rauchen aufgeben«, sagte er ziemlich sarkastisch und ließ mir ein Plastikfeuerzeug in den Schoß fallen.
»Tu ich auch«, murmelte ich. »Morgen.«
In der Nacht des Mordes an Beryl Madison war ich ausgegangen. Hatte eine viel zu lange Oper über mich ergehen lassen, gefolgt von ein paar Drinks in einem allzu hochgelobten englischen Pub.
Der pensionierte Richter, der mich eingeladen hatte, machte im späteren Verlauf des Abends der Bezeichnung »Euer Ehren« nicht mehr allzu viel Ehre. Ich hatte meinen Pager zu Hause gelassen.
Weil die Polizei mich nicht hatte erreichen können, hatte sie Fielding, meinen Stellvertreter, zum Tatort gerufen. Deshalb war es jetzt das erste Mal, dass ich das Haus der ermordeten Autorin betreten sollte. Windsor Farms war nicht gerade die Art von Gegend, in der man etwas so Abscheuliches vermuten würde. Große Häuser standen zurückgesetzt von der Straße auf makellosen, parkähnlich gestalteten Grundstücken. Die meisten besaßen Alarmsysteme, und alle waren mit Klimaanlagen ausgestattet, sodass niemand ein Fenster zu öffnen brauchte. Mit Geld kann man sich zwar nicht die Ewigkeit, aber zumindest einen gewissen Grad an Sicherheit erkaufen. Ich hatte noch nie einen Mordfall in den Farms auf den Seziertisch bekommen.
»Offensichtlich hat sie irgendwoher Geld gehabt«, stellte ich fest, als Marino an einem Stoppschild anhielt. Eine Frau mit schneeweißen Haaren, die mit ihrem ebenso weißen Malteserhündchen spazieren ging, schaute uns schief an. Der Hund schnüffelte an einem Grasbüschel herum, bevor er das Unvermeidbare tat.
»Was für ein erbärmlicher kleiner Mopp«, sagte Marino und verfolgte die Frau und den Hund mit einem geringschätzigen Blick. »Ich hasse solche Köter. Kläffen sich die Lunge aus dem Leib und pinkeln überall hin. Wenn ich mir jemals einen Hund anschaffe, dann muss es schon einer mit Zähnen sein.«
»Manche Leute brauchen einfach nur jemanden, der ihnen Gesellschaft leistet«, erwiderte ich.
»Na ja.« Dann knüpfte er an meine Bemerkung von vorhin an. »Beryl Madison hatte Geld, und das meiste davon steckt in ihrer Hütte. Sollte sie Ersparnisse gehabt haben, dann hat sie den Kies da drunten mit den Schwulen in Queer West durchgebracht. Wir sind immer noch dabei, ihre Papiere durchzusehen.«
»Ist irgendetwas davon schon vollständig ausgewertet?«
»Sieht nicht so aus«, antwortete er. »Wir haben herausgefunden, dass sie gar nicht mal so schlecht war als Schriftstellerin. Kohlemäßig, meine ich. Es scheint so, als hätte sie einige Pseudonyme verwendet. Adair Wilds, Emily Stratton, Edith Montague.« Die Spiegelbrille drehte sich wieder in meine Richtung.
Keiner der Namen kam mir bekannt vor, außer Stratton. Ich sagte: »Beryls mittlerer Name war Stratton.«
»Vielleicht kommt daher ihr Spitzname, Straw.«
»Daher und von ihren strohblonden Haaren«, bemerkte ich. Eigentlich hatte Beryl ja honigblonde Haare mit von der Sonne goldgefärbten Strähnen gehabt. Sie war eine zierliche Frau gewesen, mit ebenmäßigen, klassischen Gesichtszügen. Als sie noch lebte, hatte sie vermutlich phantastisch ausgesehen. Jetzt ließ sich das nur noch schwer beurteilen, denn das einzige mir bekannte Foto, das sie lebend zeigte, befand sich in ihrem Führerschein.
»Ich habe mit ihrer Halbschwester gesprochen«, erklärte Marino, »und sie hat mir erzählt, dass Beryl nur von Leuten, denen sie nahestand, Straw genannt wurde. Wem auch immer sie von den Keys da unten geschrieben hat, diese Person muss ihren Spitznamen gekannt haben. Das ist jedenfalls mein Eindruck.«
Er rückte seine Brille zurecht. »Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie diese Briefe fotokopiert hat. Das bereitet mir Kopfzerbrechen. Oder wie viele Leute kennen Sie, die Fotokopien von ihren Privatbriefen machen?«
»Sie haben doch angedeutet, dass sie wie eine Besessene alles archivierte«, erinnerte ich ihn.
»Richtig. Auch das gibt mir zu beißen. Vermutlich hat die Ratte sie schon monatelang bedroht. Aber was hat er genau getan? Was hat er gesagt? Wir wissen es nicht, weil sie weder seine Telefonanrufe auf Tonband aufgenommen noch ihren Inhalt notiert hat. Die Frau macht Fotokopien von persönlichen Briefen, aber wenn jemand ihr droht, sie um die Ecke zu bringen, zeichnet sie nichts auf. Sagen Sie mir, ob das einen Sinn ergibt.«
»Nicht alle Leute denken so wie wir.«
»Nun, manche Leute stecken bis über beide Ohren in Geschichten, von denen niemand etwas erfahren soll, und können deshalb nicht klar denken«, argumentierte er.
Er lenkte den Wagen in eine gekieste Auffahrt und parkte vor einem Garagentor. Das Gras stand viel zu hoch. Schlanker Löwenzahn bewegte sich im leichten Wind hin und her. Ein Schild mit der Aufschrift Zu verkaufen stand neben dem Briefkasten. Quer über der grauen Haustür klebte noch immer ein Stück von dem gelben Klebeband, wie es die Polizei am Tatort verwendet.
»Ihr fahrbarer Untersatz steht in der Garage«, sagte Marino, als wir ausstiegen.
»Ein neuer schwarzer Honda Accord EX. Ein paar Details daran werden Sie vermutlich interessieren.«
Wir standen in der Auffahrt und sahen uns um. Die schrägen Sonnenstrahlen fielen mir warm von hinten auf Schultern und Hals. Die Luft war kühl und das allgegenwärtige Summen der Herbstinsekten das einzig wahrnehmbare Geräusch. Ich atmete langsam und tief durch. Ich war auf einmal sehr müde.
Ihr Haus im Bauhaus-Stil war modern und sachlich schlicht mit einer langgestreckten Vorderfront aus großen Fenstern, die von Pfeilern im Erdgeschoss getragen wurde. Es sah aus wie ein Schiff mit offenem Unterdeck und war genau das Haus, das sich ein wohlhabendes junges Paar bauen würde, aus Feldsteinen und grau geflecktem Holz, mit großen Zimmern, hohen Decken und jeder Menge teurer Platzverschwendung. Der Windham Drive endete an Beryl Madisons Grundstück in einer Sackgasse, was eine Erklärung dafür war, dass niemand etwas gesehen oder gehört hatte, bis es zu spät war. Eichen und Pinien bildeten einen Blättervorhang zwischen Beryl und ihren nächsten Nachbarn und schirmten das Haus auf zwei Seiten gegen die Außenwelt ab. Hinten fiel das Grundstück steil in eine felsige, mit Dickicht bewachsene Senke ab, die in einen unberührten Wald auslief, der so weit reichte, wie ich schauen konnte.
»Verdammt noch mal. Ich möchte wetten, dass sie ihr eigenes Rotwild hatte«, sagte Marino, als wir ums Haus herum nach vorn gingen.
»Ist schon was, oder? Man schaut aus seinem Fenster und glaubt, die ganze Welt gehöre einem ganz allein. Ich wette, dass die Aussicht besonders schön ist, wenn es schneit. Mein lieber Schwan, so eine Hütte hätte ich auch gern. Im Winter würde ich ein nettes Feuerchen machen, mir ein Schlückchen Bourbon genehmigen und einfach die Wälder da draußen betrachten. Reich sein ist schon was Angenehmes.«
»Besonders, wenn man noch am Leben ist, um es zu genießen.«
»Wie wahr!«, erwiderte er.
Herbstlaub raschelte unter unseren Schuhen, als wir um den Westflügel gingen. Ich bemerkte das Guckloch in der Haustür, die sich auf der Höhe des Innenhofs befand. Es starrte mich an wie ein winziges, leeres Auge. Marino schnippte seine Zigarettenkippe in hohem Bogen ins Gras und kramte in einer Tasche seiner kobaltblauen Hose herum. Er hatte sein Jackett ausgezogen, und sein großer Bauch hing über den Gürtel. Sein kurzärmeliges, weißes Hemd war um das Schulterhalfter herum zerknittert, und sein Kragen stand offen.
An dem Schlüssel, den er aus seiner Tasche zog, hing ein gelbes Beweismittelzettelchen, und während ich beobachtete, wie er das Sicherheitsschloss neuester Bauart öffnete, verblüffte mich wieder einmal die Größe seiner Hände. Sie waren zäh und wettergebräunt und erinnerten mich an Baseballhandschuhe.
Er hätte niemals Musiker oder Zahnarzt werden können. Trotz seiner schütter werdenden grauen Haare und eines Gesichts, das so abgetragen aussah wie seine Anzüge, wirkte er immer noch gewaltig genug, um die meisten Leute einzuschüchtern. Große, bullige Polizisten wie er müssen sich selten herumprügeln. Die Schlägertypen auf der Straße schauen ihn einmal an und ziehen den Schwanz ein.
Wir standen in einem Rechteck aus Sonnenlicht in der Eingangshalle und streiften uns Baumwollhandschuhe über die Finger. Das Haus roch muffig und verstaubt, so wie Häuser riechen, die eine Zeit lang unbewohnt waren. Obwohl der Spurensicherungstrupp des Richmond Police Department den ganzen Tatort gründlichst unter die Lupe genommen hatte, war nichts verändert worden. Das Haus befand sich, Marino zufolge, noch in genau demselben Zustand wie zwei Nächte zuvor, als man Beryls Leiche hier gefunden hatte. Er schloss die Tür und knipste das Licht an.
»Sie können deutlich sehen«, hallte seine Stimme, »dass sie den Kerl hereingelassen haben muss. Keine Spur eines gewaltsamen Eindringens, und dabei hat dieser Schuppen eine Drei-Sterne-Alarmanlage.« Er lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Kontrolltafel neben der Tür und fügte hinzu: »Im Moment ist sie ausgeschaltet. Aber sie funktionierte, als wir hier eintrafen. Heulte wie ein Dutzend Feuerwehrsirenen, deshalb fanden wir sie überhaupt so schnell.«
Er erinnerte mich daran, dass der Mord bei der Polizei ursprünglich als »akustischer Alarm« registriert worden war. Die Anlage hatte schon dreißig Minuten ununterbrochen geheult, bis schließlich kurz nach elf Uhr abends einer von Beryls Nachbarn die Notrufnummer der Polizei wählte. Als eine Streife der Sache auf den Grund gehen wollte, sah der Beamte, dass die Vordertür offen stand. Kurz danach forderte er über Funk Verstärkung an.
Das Wohnzimmer war ein Trümmerhaufen. Jemand hatte den gläsernen Couchtisch umgeworfen, und Zeitschriften, ein Kristallaschenbecher, einige Art-déco-Schalen und eine Blumenvase lagen über den indischen Baumwollteppich verstreut. Ein Ohrensessel aus blassblauem Leder lag umgestürzt auf der Seite, daneben ein Kissen des dazu passenden mehrteiligen Sofas. An der weißgetünchten Wand links von einer zur Diele führenden Tür klebten dunkle Spritzer getrockneten Bluts.
»Arbeitet die Alarmanlage mit Zeitverzögerung?«, fragte ich.
»Aber ja. Man öffnet die Tür, und die Anlage summt etwa fünfzehn Sekunden lang, sodass man genügend Zeit hat, um einen Code einzutippen, bevor sie losgeht.«
»Dann muss sie die Tür geöffnet, die Alarmanlage abgeschaltet, den Täter hereingelassen und die Anlage wieder eingeschaltet haben, während er noch da war. Sonst wäre sie später, als er das Haus verließ, nicht losgegangen. Interessant.«
»Ja«, antwortete Marino, »verdammt interessant.«
Wir standen im Wohnzimmer neben dem umgeworfenen Couchtisch, der über und über mit schwarzem Fingerabdruckpuder bestäubt war. Bei den Zeitschriften auf dem Boden handelte es sich um Nachrichtenmagazine und literarische Publikationen, alle einige Monate alt.
»Haben Sie auch irgendwelche aktuellen Tageszeitungen oder Magazine gefunden?«, fragte ich. »Wenn sie sich irgendwo eine Lokalzeitung gekauft hat, könnte das vielleicht wichtig sein. Wir sollten nachprüfen, wo sie hinging, nachdem sie das Flugzeug verlassen hatte.«
Ich sah, wie er die Zähne aufeinanderbiss. Marino wurde sauer, wenn er glaubte, ich wolle ihm erzählen, wie er seinen Job zu erledigen habe.
Er sagte: »Es waren ein paar Sachen oben im Schlafzimmer bei ihrer Aktentasche und ihren Koffern. Ein Herald aus Miami und ein Blättchen, das Keynoter heißt und hauptsächlich aus Immobilienanzeigen für die Key-Inseln besteht. Vielleicht hat sie daran gedacht, dort hinunterzuziehen? Beide Zeitungen stammen vom Montag. Sie muss sie auf dem Rückweg nach Richmond gekauft haben, vielleicht auf dem Flughafen.«
»Würde mich interessieren, was ihr Grundstücksmakler dazu zu sagen hat …«
»Ich weiß, was er dazu zu sagen hat, nämlich gar nichts«, unterbrach er mich. »Er hat keine Ahnung, wo Beryl war, und hat ihr Haus nur ein einziges Mal in ihrer Abwesenheit jemandem gezeigt. Irgendeinem jungen Paar, dem dann der Preis zu hoch war. Beryl wollte dreihundert Riesen für den Schuppen.« Er schaute sich mit undurchdringlicher Miene um. »Sieht so aus, als ob jetzt jemand ein Schnäppchen machen könnte.«
»In der Nacht, in der sie ankam, hat Beryl doch ein Taxi vom Flughafen nach Hause genommen.«
Hartnäckig kam ich wieder auf die Einzelheiten des Falles zu sprechen.
Er nahm sich eine Zigarette und deutete damit herum.
»Wir fanden die Quittung dort in der Diele, auf dem kleinen Tisch an der Tür. Haben den Fahrer schon überprüft, der Knabe heißt Woodrow Hunnel und ist dumm wie Bohnenstroh. Er sagt, dass er am Taxistand des Flughafens gewartet habe. Sie ist bei ihm eingestiegen. Das war kurz vor acht, und es regnete in Strömen. Er ließ sie etwa vierzig Minuten später vor ihrem Haus aussteigen, trug ihr, wie er sagte, noch die beiden Koffer zur Tür und verschwand wieder. Das Fahrgeld betrug sechsundzwanzig Dollar, Trinkgeld inklusive. Ungefähr eine halbe Stunde später war er zurück am Flughafen und nahm neue Fahrgäste auf.«
»Sind Sie sicher, oder hat er Ihnen das bloß erzählt?«
»So gottverdammt sicher, wie ich hier stehe.« Er klopfte mit der Zigarette auf seinen Knöchel und fingerte mit dem Daumen am Filter herum.
»Wir haben die Geschichte überprüft. Hunnel hat uns keine Märchen erzählt. Er hat der Lady kein Haar gekrümmt. Hatte keine Zeit dafür.«
Ich folgte seinen Augen zu den dunklen Spritzern neben der Tür. Die Kleidung des Mörders musste voller Blut gewesen sein. Es war unwahrscheinlich, dass ein Taxifahrer seine Fahrgäste mit blutverschmierten Kleidern herumkutschierte.
»Sie kann noch nicht lange zu Hause gewesen sein«, sagte ich, »gegen neun ist sie heimgekommen, und um elf ruft ein Nachbar wegen der Alarmanlage an, die eine halbe Stunde lang geheult hat. Das bedeutet, dass der Mörder gegen halb elf das Haus verlassen haben muss.«
»Tja«, antwortete er, »dieser Teil der Geschichte bereitet mir auch das meiste Kopfzerbrechen. Nach dem, was in den Briefen steht, muss sie panische Angst gehabt haben. Deshalb verheimlicht sie auch ihre Rückkehr nach Richmond, so gut es geht, schließt sich in ihrem Haus ein und legt sogar ihre .38er griffbereit auf die Küchentheke, die zeige ich Ihnen, wenn wir dort sind. Dann peng! Es klingelt an der Haustür. Aber dann? Wir wissen nur, dass sie die Ratte hereingelassen und sofort die Alarmanlage wieder eingeschaltet hat. Es muss jemand gewesen sein, den sie gekannt hat.«
»Ich würde auch einen Fremden nicht ausschließen«, sagte ich. »Wenn er vertrauenerweckend war, hat sie ihn vielleicht aus irgendeinem Grund hereingelassen.«
»Um diese Zeit?« Er musterte mich kurz und ließ die Augen durch das Zimmer schweifen.
»Hat er vielleicht um zehn Uhr in der Nacht Zeitschriftenabonnements oder Eiskrem verkauft, oder was?«
Ich antwortete nicht. Ich wusste auch nicht weiter. Wir blieben an der offenen Tür zur Diele stehen.
»Da ist das erste Blut«, sagte Marino und schaute auf die eingetrockneten Spritzer an der Wand. »Genau hier hat er sie zum ersten Mal erwischt. Ich stelle mir vor, dass sie wie wahnsinnig davongelaufen ist und er mit dem Messer hinterher.«
Ich rief mir die Schnittwunden in Beryls Gesicht, an ihren Armen und Beinen ins Gedächtnis.
»Ich vermute«, fuhr er fort, »dass er sie hier am linken Arm, am Rücken oder im Gesicht verletzt hat. Das Blut an der Wand ist von der Klinge weggespritzt. Sie war voller Blut, weil er sie schon mindestens einmal erwischt hatte, und als er wieder ausholte, wurden die Tropfen weggeschleudert und landeten an der Wand.«
Die Flecken hatten elliptische Form, maßen etwa sechs Millimeter im Durchmesser und wurden zunehmend länglicher, je weiter entfernt sie sich links vom Türrahmen befanden. Die Blutspur war mindestens drei Meter lang. Der Angreifer hatte mit voller Kraft ausgeholt, wie ein hart schlagender Squash-Spieler. Ich spürte die Emotionen, die sich hinter diesem Verbrechen verbargen. Das war keine Wut mehr. Es war etwas Schlimmeres.
Warum hat sie ihn nur hereingelassen?
»Aufgrund der Spritzer nehme ich an, dass der Penner etwa hier stand«, sagte Marino und ging ein paar Meter von der Tür weg nach links. »Er holt aus, trifft sie, und als die Klinge ausschwingt, fliegt das Blut davon und spritzt an die Wand. Die Spur beginnt, wie Sie sehen können, hier.« Er deutete auf die obersten Tropfen, die sich fast auf der Höhe seines Kopfes befanden. »Dann führt sie nach unten und hört ein paar Zentimeter über dem Boden auf.« Er machte eine Pause und blickte mich herausfordernd an. »Sie haben sie doch untersucht. Was meinen Sie? Ist er Rechts- oder Linkshänder?«
Jeder Polizist will das wissen. Obwohl ich ihnen jedes Mal antworte, dass auch ich da nur raten könne, stellen sie diese Frage immer wieder.
»An dieser Blutspur kann ich das nicht erkennen«, sagte ich. Mein Mund war trocken und schmeckte nach Staub. »Es hängt nur davon ab, in welchem Winkel er zu ihr stand. Was die Wunden in ihrer Brust anbelangt, so verläuft der Einstichwinkel ganz leicht von links nach rechts. Das könnte bedeuten, dass er Linkshänder ist. Aber auch hier kommt es darauf an, wo er sich befand.«
»Es ist interessant, dass sich alle Verletzungen, die sie sich beim Abwehren seiner Angriffe eingehandelt hat, auf der linken Seite ihres Körpers befinden. Stellen Sie sich vor, wie sie davonläuft, während er sie angreift. Und zwar von links anstatt von rechts. Daher mein Verdacht, dass er Linkshänder ist.«
»Es hängt alles davon ab, in welcher Position sich Opfer und Täter zueinander befanden«, wiederholte ich ungeduldig.
»Ja«, murmelte er knapp. »Alles hängt von irgendwas anderem ab.«
Hinter der Tür war Holzfußboden. Eine mit Kreidestrichen markierte Spur von Blutstropfen führte zu einer Treppe etwa zehn Meter weiter links. Bevor Beryl die Treppe hinauflief, war sie hier entlanggerannt. Ihr Schock und ihre Angst waren stärker als ihre Schmerzen. Fast an jeder Stufe sah ich auf der Holztäfelung der linken Wand verschmierte Blutspuren, wo ihre zerschnittenen Finger nach Halt gesucht hatten.
Die schwarzen Flecken sah man auf dem Boden, an den Wänden, an der Decke. Beryl war bis ans Ende des Gangs im ersten Stock gelaufen, wo sie einen Augenblick lang nicht mehr weitergewusst hatte. Hier gab es sehr viel Blut. Bevor die Jagd weiterging, war sie offensichtlich in ihr Schlafzimmer geflüchtet, wo sie ihm vielleicht entkam, indem sie über das riesige Bett kletterte, während er um es herumlief. Hier warf sie entweder mit ihrer Aktentasche nach ihm, oder die Tasche lag, was wahrscheinlicher war, auf dem Bett und wurde heruntergestoßen. Die Polizei fand sie auf dem Teppich, offen und umgestülpt. In der Nähe waren Papiere verstreut, unter ihnen die Fotokopien der Briefe aus Key West.
»Was für Papiere haben Sie sonst noch gefunden?«, fragte ich.
»Quittungen, ein paar Reiseführer, eine Informationsbroschüre mit einem Stadtplan«, antwortete Marino. »Ich mache Ihnen Kopien davon, wenn Sie wollen.«
»Ja, bitte«, sagte ich.
»Wir haben dort drüben auf der Kommode auch einen Stapel maschinengeschriebener Seiten entdeckt.« Er deutete mit dem Finger.
»Vermutlich handelt es sich um das Manuskript, das sie auf den Keys geschrieben hat. Sie hat mit Bleistift eine Menge Bemerkungen an den Rand gekritzelt. Keine verwertbaren Fingerabdrücke. Nur verwischte und ein paar unvollständige, die von ihr selbst stammen.«
Das Bett war bis auf die Matratze abgezogen, die blutbefleckte Steppdecke und die Laken hatte man ins Labor geschickt. Sie war langsamer geworden und immer schwächer. Sie hatte die Kontrolle über ihre Bewegungen verloren. Schließlich wankte sie zurück in den Gang und rutschte auf dem orientalischen Gebetsteppich, den ich auf den Tatortfotos gesehen hatte, aus. Auf dem Boden des Gangs fand ich an dieser Stelle blutige Schleifspuren und Handabdrücke. Beryl hatte sich noch in das Gästezimmer neben dem Bad geschleppt, wo sie schließlich starb.
»Ich persönlich«, sagte Marino, »glaube, es hat ihm Freude bereitet, sie durch das halbe Haus zu hetzen. Er hätte sie sicher schon unten im Wohnzimmer töten können, aber das hätte ihm den Spaß an der Sache verdorben. Vermutlich hat er die ganze Zeit über gegrinst, während sie blutete, schrie und um ihr Leben bettelte. Sie schaffte es schließlich noch bis in dieses Zimmer hier und brach zusammen. Ende der Vorstellung. Der Spaß war vorbei. Also machte er Schluss mit ihr.«
Das Zimmer vermittelte eine winterliche Stimmung. Die Einrichtung wirkte fahl und gelb wie Sonnenschein im Januar. Der Holzboden in der Nähe des Doppelbettes war schwarz, und an den Wänden sah ich schwarze Streifen und Tropfen. Die Tatortfotos zeigten Beryl auf dem Rücken liegend, die Beine gespreizt, die Arme um den Kopf geschlungen. Ihr Gesicht war auf das Fenster gerichtet, dessen Vorhänge zugezogen waren. Sie war nackt. Auf den Fotos konnte ich zunächst nicht erkennen, wie sie aussah oder welche Haarfarbe sie hatte. Alles, was ich sah, war Rot. Die Polizei hatte neben der Leiche blutige, khakifarbene Hosen gefunden. Ihre Bluse und ihre Unterwäsche fehlten.
»Dieser Taxifahrer, von dem Sie gesprochen haben, Hunnel, oder wie er heißt, konnte er sich daran erinnern, was Beryl anhatte, als sie am Flughafen bei ihm einstieg?«, fragte ich.
»Es war dunkel«, antwortete Marino. »Er war sich nicht sicher, aber er meinte, dass sie Hosen und eine Jacke getragen habe. Wir wissen, dass sie Hosen trug, als sie angegriffen wurde, diese khakifarbenen, die wir hier gefunden haben. Eine dazu passende Jacke lag auf einem Stuhl in ihrem Schlafzimmer. Ich glaube nicht, dass sie sich umgezogen hat, als sie nach Hause kam. Sie warf einfach nur ihre Jacke über den Stuhl. Was immer sie sonst noch getragen hat – eine Bluse, ihre Unterwäsche –, hat der Mörder mitgenommen.«
»Als Andenken«, dachte ich laut.
Marino starrte auf die schwarzen Flecken am Boden, wo die Leiche gelegen hatte.
Er sagte: »Ich sehe das so: Er bringt sie hier drinnen um, reißt ihr die Kleider vom Leib und vergewaltigt sie oder versucht es zumindest. Dann ersticht er sie und schneidet ihr fast den Kopf ab. Schade, dass der Laborbericht über ihre Leiche in dieser Beziehung so wenig hergibt«, fügte er hinzu. Er meinte damit, dass in den Abstrichen, die wir gemacht hatten, kein Sperma nachgewiesen werden konnte. »Schaut so aus, als müssten wir uns die DNA aus dem Kopf schlagen.«
»Außer, wenn etwas von dem Blut, das wir untersuchen, von ihm stammt«, antwortete ich. »Ansonsten können Sie die DNA-Analyse vergessen.«
»Haare haben wir auch keine gefunden«, sagte er.
»Nur ein paar, die mit den ihrigen übereinstimmten.«
Das Haus war so still, dass unsere Stimmen viel zu laut klangen. Überall waren diese hässlichen Flecken. Ich sah wieder Beryls Verletzungen vor mir, die Einstiche, die Spuren des Griffs, die brutale Wunde an ihrem Hals, die wie ein gähnendes, rotes Maul aufklaffte. Ich ging hinaus in den Gang. Der Staub reizte meine Lungen. Das Atmen fiel mir schwer.
Ich bat Marino: »Zeigen Sie mir, wo Sie ihre Pistole gefunden haben.«
Als die Polizei in der Nacht am Tatort eintraf, hatte sie Beryls .38er Automatic auf der Küchentheke neben der Mikrowelle gefunden. Die Pistole war geladen und gesichert. Die paar Fingerabdrücke, die das Labor darauf identifizieren konnte, stammten von ihr selbst.
»In ihrem Nachttisch lag eine Schachtel mit Patronen«, sagte Marino. »Vielleicht hat sie dort auch die Pistole aufbewahrt. Ich denke, dass sie ihr Gepäck nach oben getragen und ausgepackt hat. Sie stopfte ihre schmutzige Kleidung in den Wäschekorb im Badezimmer und verstaute die Koffer im Schlafzimmerschrank. Irgendwann holte sie dabei ihre Kanone heraus. Ein sicheres Zeichen dafür, dass sie verdammt nervös gewesen sein muss. Wollen wir wetten, dass sie mit der Knarre in der Hand in jedes Zimmer schaute, bevor sie sich halbwegs beruhigte?«
»Ich hätte es sicher getan«, bemerkte ich.
Er schaute sich in der Küche um. »Vielleicht kam sie hierher, um etwas zu essen.«
»Kann sein, dass sie das vorhatte, aber gegessen hat sie nichts«, antwortete ich. »In ihrem Magen waren etwa fünfzig Milliliter einer dunkelbraunen Flüssigkeit. Wenn sie etwas gegessen hat, so war es, als sie starb, bereits vollständig verdaut. Oder, präziser gesagt, als sie angegriffen wurde. Die Verdauung hört bei starkem Stress oder Angst sofort auf. Hätte sie, kurz bevor der Mörder sie erwischte, etwas gegessen, so wäre es noch in ihrem Magen gewesen.«
»Es ist sowieso nicht allzu viel zu beißen da«, sagte er, als er die Tür des Kühlschranks öffnete.
Drinnen fanden wir eine verschrumpelte Zitrone, zwei Stückchen Butter, eine Ecke gammeligen Käse und eine Flasche Tonicwasser. Die Tiefkühltruhe sah ein wenig vielversprechender aus, bot aber auch nicht viel mehr. Sie enthielt ein paar Packungen Hühnerbrüste, diverse Fertiggerichte und etwas gefrorenes Hackfleisch. Kochen, so schien es, war für Beryl weniger eine Leidenschaft als ein notwendiges Übel gewesen. Ich dachte daran, wie meine eigene Küche aussah. Diese hier wirkte dagegen niederschmetternd nüchtern. Winzige Staubpartikel schwebten in dem fahlen Licht, das durch die Schlitze der teuren grauen Jalousien vor dem Fenster über dem Spülbecken fiel. Die Spüle und das Becken waren leer und trocken. Die modernen Küchengeräte sahen unbenutzt aus.
»Sie könnte natürlich auch hierhergekommen sein, um etwas zu trinken«, mutmaßte Marino.
»Wir haben in ihrem Blut keinen Alkohol gefunden«, entgegnete ich.
»Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht daran gedacht hat, einen Drink zu nehmen.«
Er öffnete einen Hängeschrank über der Spüle. Die drei Regale waren bis zum letzten Zentimeter vollgepackt. Jack Daniel’s, Chivas Regal, Wodka, Liköre, aber etwas fiel mir besonders auf. Vor dem Cognac im obersten Regal stand eine Flasche mit Barbancourt-Rum aus Haiti, fünfzehn Jahre alt und so teuer wie ein guter Single Malt.
Ich nahm die Flasche mit meiner behandschuhten Hand heraus und stellte sie auf die Theke. Sie hatte keine Steuerbanderole, und die Versiegelung des goldenen Schraubverschlusses war noch intakt.
»Ich glaube nicht, dass sie den hier gekauft hat«, sagte ich zu Marino. »Vermutlich stammt er aus Miami oder aus Key West.«
»Sie meinen, sie hat ihn aus Florida mitgebracht?«
»Es wäre gut möglich. Aber eines ist sicher. Sie hat eine Menge von gutem Schnaps verstanden. Barbancourt ist etwas ganz Wunderbares.«
»Mir scheint, ich sollte Sie in Zukunft Dr. Connaisseur nennen.«
Es lag kein Staub auf der Flasche Barbancourt, wohl aber auf einigen anderen in nächster Nähe.
»Vielleicht erklärt das, warum sie in die Küche ging«, fuhr ich fort. »Vermutlich kam sie herunter, um den Rum aufzuräumen. Möglicherweise dachte sie auch gerade an einen Schlummertrunk, als jemand an der Tür klingelte.«
»Ja, aber das erklärt nicht, warum sie die Kanone hier auf der Theke liegen ließ, als sie die Tür aufmachte. Sie hatte doch schreckliche Angst, oder? Irgendwie glaube ich immer noch, dass sie jemanden erwartete, dass sie das Schwein gekannt hat. Hey, warten Sie mal! Sie hat doch diesen ausgefallenen Schnaps da mitgebracht. Will sie den etwa ganz allein trinken? Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass sie sich ab und zu mal ein wenig Unterhaltung gegönnt hat, irgendeinen Kerl mit hierhernahm. Verdammt, vielleicht ist das sogar dieser ›M‹, dem sie von den Keys aus schrieb. Möglicherweise hat sie ihn in der Mordnacht erwartet.«
»Sie spielen mit dem Gedanken, ›M‹ könne der Mörder sein?«, fragte ich.
»Sie nicht?«
Er wurde aggressiver, und langsam ging mir sein Herumgespiele mit der unangezündeten Zigarette auf die Nerven.
»Ich ziehe jede Möglichkeit in Erwägung«, antwortete ich, »zum Beispiel auch die, dass sie niemanden erwartete. Sie war in der Küche, räumte den Rum weg und überlegte vielleicht, ob sie sich einen Drink eingießen sollte. Sie war nervös und hatte ihre Pistole neben sich auf die Theke gelegt. Als es läutete oder jemand klopfte, schreckte sie auf …«
»Genau!«, unterbrach er mich. »Sie erschrickt, ist aufgeregt. Warum soll sie ihre Kanone hier in der Küche lassen, wenn sie die Tür öffnen geht?«
»Hatte sie denn Übung?«
»Übung?«, fragte er, und unsere Augen trafen sich. »Übung worin?«
»Im Schießen.«
»Keine Ahnung. Wieso?«
»Wenn sie keine hatte, dann war für sie das Mitnehmen der Waffe kein unbewusster Reflex, sondern eine Entscheidung, die sie bewusst treffen musste. Viele Frauen schleppen jahrelang Tränengas in der Handtasche mit sich rum. Wenn sie dann irgendwann einmal angegriffen werden, denken sie erst an das Tränengas, wenn alles vorbei ist. Und warum? Weil sie einfach keinen Verteidigungsreflex haben.«
»Ich weiß nicht …«
Aber ich wusste es. Ich besaß einen .38er Ruger-Revolver, den ich mit Silvertips, so etwa der gefährlichsten Munition, die man käuflich erwerben kann, geladen hatte. Ich trug ihn nur deshalb ständig mit mir herum, weil ich damit ein paarmal im Monat auf dem Schießstand übte. Wenn ich allein zu Hause war, fühlte ich mich mit der Waffe wohler als ohne. Und da war noch etwas anderes. Ich dachte an das Wohnzimmer, wo die Kaminwerkzeuge ganz gerade in ihrem Messingständer hingen. Obwohl Beryl in diesem Raum mit ihrem Angreifer gekämpft hatte, war sie nicht auf die Idee gekommen, den Schürhaken oder die Schaufel als Waffe zu benutzen. Sie hatte keinen Verteidigungsreflex. Ihr Reflex war die Flucht, ob sie nun die Treppe hinauflief oder nach Key West flog.
»Vielleicht war ihr die Pistole fremd, Marino«, erklärte ich. »Es klingelt an der Tür. Sie ist nervös und verwirrt. Sie geht ins Wohnzimmer und schaut durch den Spion. Wer immer davor steht, sie vertraut ihm genug, um die Tür zu öffnen. Und die Pistole zu vergessen.«
»Oder aber sie hat ihren Besucher erwartet.«
»Das wäre auch gut möglich. Vorausgesetzt, jemand wusste, dass sie zurück war.«
»Vermutlich wusste er es«, meinte er.
»Und vielleicht ist er ›M‹«. Ich sprach aus, was Marino hören wollte, und stellte die Flasche Rum zurück ins Regal.
»Bingo! Jetzt ergibt das Ganze schon mehr Sinn, oder?«
Ich schloss die Tür des Hängeschranks. »Sie wurde monatelang bedroht und war außer sich vor Angst, Marino. Es fällt mir schwer zu glauben, dass ihr Mörder ein enger Freund von ihr gewesen ist und Beryl nicht den geringsten Verdacht gehabt haben sollte.«
Er sah verärgert aus, als er auf die Uhr blickte und einen weiteren Schlüssel aus seiner Tasche kramte. Es war vollkommen unlogisch, dass Beryl einem Fremden die Tür aufgemacht hatte. Aber es war noch unlogischer, dass jemand, dem sie vertraute, ihr all das angetan haben könnte. Warum hat sie ihn hereingelassen? Diese Frage ließ mich nicht mehr los. Ein auf einer Seite geschlossener, überdachter Durchgang verband das Haus mit der Garage. Die Sonne war eben hinter den Bäumen versunken.
»Am besten sage ich es Ihnen gleich«, gestand Marino, als das Schloss aufsprang. »Ich war erst kurz bevor ich Sie anrief zum ersten Mal hier. Ich hätte natürlich in der Mordnacht das Tor aufbrechen können, sah aber keinen Grund dafür.« Er zuckte mit den Achseln und zog seine massiven Schultern hoch, als ob er mir beweisen wollte, dass er damit wirklich ein Tor, einen Baum oder einen Müllcontainer umrennen konnte. »Sie war nicht mehr hier drinnen, seit ihrer Abreise nach Florida. Wir brauchten eine ganze Weile, bis wir den verflixten Schlüssel gefunden hatten.«
Ich hatte noch nie eine getäfelte Garage gesehen. Der Boden war mit teuren roten Fliesen aus Italien gekachelt.
»War das hier wirklich als Garage gedacht?«, fragte ich.
»Da ist ein Garagentor, oder?« Er holte noch weitere Schlüssel aus seinen Taschen. »Ist schon ein beeindruckendes Plätzchen, um die Karre nicht nass werden zu lassen, was?«
Die stickige Luft roch staubig, aber die Garage war tipptopp sauber. Außer einem Rechen und einem Besen, die in einer Ecke lehnten, war nichts von den üblichen Werkzeugen, Rasenmähern und anderem Gerümpel zu sehen, das man hier erwartete. Die Garage sah eher wie der Ausstellungsraum eines Autohändlers aus. Der schwarze Honda stand auf den Fliesen in der Mitte des Raums. Er war so sauber und glänzend, dass er nagelneu und unbenützt aussah.
Marino schloss die Fahrertür auf und öffnete sie. »Bitte, nehmen Sie Platz«, sagte er.
Ich setzte mich in den Sitz aus elfenbeinfarbenem Leder und starrte durch die Windschutzscheibe auf die getäfelte Wand. Marino trat zurück und bat: »Bleiben Sie einfach sitzen, okay? Schauen Sie sich in Ruhe um, und sagen Sie mir dann, was Ihnen so alles auffällt.«
»Wollen Sie, dass ich ihn anlasse?«
Er gab mir den Schlüssel.
»Dann öffnen Sie bitte das Garagentor, damit ich uns nicht mit den Abgasen vergifte«, fügte ich hinzu.
Mit zerfurchtem Gesicht suchte er herum, bis er den richtigen Knopf fand, der das Tor öffnete.
Das Auto sprang gleich beim ersten Mal an, der Motor schnurrte leise und kraftvoll vor sich hin. Radio und Klimaanlage waren eingeschaltet. Der Benzintank war viertelvoll, der Kilometerstand zeigte weniger als zwölftausend Kilometer. Das Schiebedach stand ein Stück weit auf. Auf der Ablage des Armaturenbretts lag der Abholschein einer Reinigung, datiert vom 11. Juli, einem Donnerstag. Beryl hatte einen Rock und eine Kostümjacke abgegeben und diese Kleidungsstücke vermutlich nie abgeholt. Auf dem Beifahrersitz fand ich den Kassenzettel eines Lebensmittelgeschäfts, auf dem das Datum vom 12. Juli stand. Um zehn Uhr vierzig am Vormittag hatte sie einen Kopfsalat, Tomaten, Gurken, Rinderhackfleisch, Käse, Orangensaft und eine Rolle Pfefferminzbonbons gekauft. Das Ganze kostete neun Dollar und dreizehn Cent, und sie hatte bei der Kassiererin mit zehn Dollar bezahlt.
Neben dem Kassenzettel entdeckte ich einen schmalen weißen Briefumschlag, wie ihn Banken verwenden. Er war leer, ebenso ein braunes Ray-Ban-Sonnenbrillenetui mit strukturierter Oberfläche, das daneben lag.
Auf dem Rücksitz befanden sich ein Wimbledon-Tennisschläger und ein verknittertes weißes Handtuch. Ich beugte mich über den Sitz und nahm es an mich. Auf dem Frotteerand stand in kleinen blauen Buchstaben »Westwood Racquet Club«. Denselben Namen hatte ich auf einer Sporttasche aus rotem Vinyl oben in Beryls Schrank gesehen. Marino hob sich sein Knallbonbon bis zum Schluss auf. Ich wusste, dass er alle diese Dinge schon begutachtet hatte und sie mir nur noch einmal im Zusammenhang vorführen wollte. Es handelte sich nicht um Beweismittel im engeren Sinn. Der Mörder war nie in der Garage gewesen. Marino wollte mich ködern. Er hatte das getan, seit wir das Haus betreten hatten. Es war eine seiner Gewohnheiten, die mich fürchterlich irritierte.
Ich machte den Motor aus und stieg aus dem Wagen. Die Tür schloss sich mit einem soliden, gedämpften Geräusch.
Er sah mich auffordernd an.
»Ein paar Fragen«, sagte ich.
»Schießen Sie los!«
»Westwood ist ein exklusiver Club. War sie dort Mitglied?«
Er nickte.
»Wann hat sie dort das letzte Mal einen Platz reserviert?«
»Am Freitag, dem 12. Juli, um neun Uhr früh. Sie hatte eine Trainerstunde. Einmal in der Woche nahm sie so eine Stunde, viel mehr Tennis spielte sie nicht.«
»Wenn ich mich richtig erinnere, flog sie am Samstag, dem 13. Juli, am frühen Morgen von Richmond ab und kam kurz nach Mittag in Miami an.«
Er nickte wieder.
»Sie nahm also ihre Trainerstunde und ging danach geradewegs in das Lebensmittelgeschäft. Vielleicht war sie auch noch auf ihrer Bank. Wie auch immer, irgendwann, nachdem sie ihre Besorgungen erledigt hatte, muss sie sich plötzlich entschlossen haben abzureisen. Denn wenn sie gewusst hätte, dass sie am nächsten Morgen wegfliegen würde, wäre sie nicht mehr einkaufen gegangen. Sie hatte ja gar keine Zeit, all die Sachen, die sie gekauft hatte, zu essen, und sie hat sie auch nicht in den Kühlschrank gelegt. Ganz offensichtlich hat sie alles außer dem Hackfleisch und vielleicht der Rolle Pfefferminzbonbons weggeworfen.«
»Klingt logisch«, kommentierte Marino nicht allzu enthusiastisch.
»Sie ließ ihr Brillenetui und die Sachen auf dem Rücksitz im Auto liegen«, fuhr ich fort, »außerdem schaltete sie weder das Radio noch die Klimaanlage aus und ließ das Schiebedach offen stehen. Es sieht so aus, als sei sie in die Garage gefahren, hätte den Motor ausgeschaltet und wäre mit der Sonnenbrille auf der Nase ins Haus gerannt. Vielleicht ist etwas passiert, als sie mit dem Auto vom Tennis und ihren Besorgungen nach Hause fuhr …«
»Und ob etwas passiert ist. Gehen Sie um das Auto herum, und schauen Sie sich die andere Seite an – besonders die Beifahrertür.«
Das tat ich.
Was ich sah, ließ meine Gedanken wild durcheinanderpurzeln. Direkt unter dem Türgriff hatte jemand den Namen BERYL, mit einem Herz drum herum, in den glänzenden schwarzen Lack gekratzt.
»Ganz schön schaurig, oder?«, sagte Marino.
»Wenn er das tat, während das Auto im Club oder vor dem Lebensmittelgeschäft parkte«, überlegte ich, »hätte ihn doch bestimmt jemand dabei gesehen.«
»Ja. Deshalb vermute ich auch, dass er es schon vorher getan hat.« Er machte eine Pause und ließ seinen Blick über die eingeritzten Buchstaben gleiten. »Wann haben Sie das letzte Mal auf die Beifahrertür Ihres Wagens geschaut?«
Das konnte Tage her sein. Vielleicht auch eine Woche.
»Sie ging also Lebensmittel einkaufen.« Jetzt endlich zündete er die verdammte Zigarette an. »Viel hat sie ja nicht gekauft.« Er nahm einen tiefen, hungrigen Zug. »Wahrscheinlich passte alles in eine Tüte. Wenn meine Frau nur eine oder zwei Tüten hat, stellt sie sie immer vorn ins Auto, auf die Fußmatte oder auf den Beifahrersitz. Auch Beryl ging vielleicht um das Auto herum auf die Beifahrerseite, um die Lebensmittel dort hineinzustellen. Und da sah sie, was in den Lack gekratzt war. Vielleicht wusste sie, dass es an diesem Tag passiert sein musste. Vielleicht auch nicht. Das ist nicht so wichtig. Aber es hat ihr einen solchen Schrecken verpasst, dass sie ausgerastet ist. Sie rast nach Hause oder vielleicht auch zur Bank, um Bargeld abzuheben. Bucht den nächsten Flug weg von Richmond und haut ab nach Florida.«
Ich ging mit ihm aus der Garage und folgte ihm zurück zu seinem Auto. Die Nacht brach schnell herein, die Luft war kalt. Während er den Motor anließ, starrte ich stumm durchs Seitenfenster hinüber zu Beryls Haus. Die scharfen und dunklen Konturen seiner Fenster verschwammen im Schatten. Auf einmal gingen die Lichter auf der Terrasse und im Wohnzimmer an.
»Meine Fresse«, murmelte Marino. »Na, schließlich haben wir ja Halloween.«
»Ein Zeitschalter«, sagte ich.
»Im Ernst?«
2
Auf meiner langen Fahrt nach Hause schien der Vollmond über Richmond. Nur die hartnäckigsten Kinder drehten noch ihre Halloween-Runden von Haus zu Haus. Die Scheinwerfer meines Wagens beleuchteten ihre grässlichen Masken und furchteinflößenden kleinen Silhouetten. Ich fragte mich, wie oft sie heute wohl vergeblich an meiner Tür geläutet hatten. Mein Haus war ganz besonders beliebt bei ihnen. Ich hatte keine Kinder und schenkte ihnen vielleicht deshalb immer übertrieben viele Süßigkeiten. Morgen würde ich vier volle Tüten Schokoladenriegel an meine Mitarbeiter verteilen müssen.
Als ich die Treppe hinaufstieg, begann das Telefon zu klingeln. Kurz bevor sich der Anrufbeantworter einschaltete, riss ich den Hörer von der Gabel. Die Stimme war mir zunächst fremd, aber dann erkannte ich sie, und mein Herz schlug plötzlich schneller.
»Kay? Ich bin’s, Mark. Gott sei Dank bist du zu Hause …« Mark James’ Stimme klang so, als spräche er vom Boden eines Ölfasses, und ich konnte im Hintergrund Autos vorbeifahren hören. »Wo bist du?«, brachte ich heraus, und ich wusste, dass sich das so anhörte, als sei ich ziemlich entnervt. »Auf dem Highway 95, etwa achtzig Kilometer nördlich von Richmond.«
Ich setzte mich auf die Bettkante.
»In einer Telefonzelle«, fuhr er fort. »Du musst mir beschreiben, wie ich zu deinem Haus komme.« Ein lauter Lastwagen dröhnte vorüber, dann erst konnte er weitersprechen: »Ich würde dich gern sehen, Kay. Ich war die ganze Woche über in Washington und habe seit dem späten Nachmittag versucht, dich zu erwischen. Jetzt habe ich einfach auf gut Glück ein Auto gemietet. Ist das okay?«
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte.
»Ich dachte, wir könnten zusammen etwas trinken und ein wenig darüber reden, wie es uns ergangen ist«, sagte der Mann, der mir einmal das Herz gebrochen hatte. »Ich habe ein Zimmer im Radisson reserviert. Morgen früh fliegt eine Maschine von Richmond zurück nach Chicago. Ich dachte … Ich habe etwas mit dir zu besprechen.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, was Mark und ich zu besprechen hätten.
»Ist es okay?«, fragte er noch einmal.
Nein, es war nicht okay! Doch ich sagte: »Aber natürlich, Mark. Ich freue mich darauf, dich zu sehen.«
Nachdem ich ihm den Weg beschrieben hatte, ging ich ins Badezimmer, um mich frisch zu machen. Ich rekapitulierte. Dreizehn Jahre waren vergangen, seit wir zusammen Jura studiert hatten. Jetzt war mein Haar mehr grau als blond, und als ich Mark das letzte Mal gesehen hatte, trug ich es lang. Meine Augen waren auch nicht mehr so blau wie früher. Der unvoreingenommene Spiegel erinnerte mich unbarmherzig und kalt daran, dass ich die neununddreißig schon überschritten hatte und dass es so etwas wie Gesichtslifting gab. Mark war in meiner Erinnerung immer noch knapp fünfundzwanzig, wie damals, als er das Objekt meiner Leidenschaft und Abhängigkeit und schließlich meiner tiefsten Verzweiflung geworden war. Seit es mit ihm vorbei war, hatte ich nur noch gearbeitet.
Er fuhr anscheinend immer noch schnell und liebte ausgefallene Autos. Weniger als fünfundvierzig Minuten später öffnete ich meine Haustür und beobachtete, wie er aus seinem gemieteten Sterling stieg. Er war immer noch der Mark, den ich gekannt hatte, mit demselben durchtrainierten Körper und seinem selbstbewussten, langbeinigen Gang. Energisch stieg er die Stufen hinauf und lächelte ein wenig. Nach einer schnellen Umarmung blieb er einen Moment lang verlegen in der Diele stehen und wusste nicht, was er sagen sollte. »Trinkst du immer noch Scotch?«, fragte ich schließlich.
»Das hat sich nicht geändert«, erwiderte er und folgte mir in die Küche.
Ich holte den Glenfiddich aus der Bar und mixte ihm automatisch seinen Drink, wie ich es vor so langer Zeit getan hatte. Zwei Schuss Whisky, Eis und einen Spritzer Selterswasser. Er folgte mir mit den Augen, als ich durch die Küche ging und die Drinks auf den Tisch stellte. Er nahm einen Schluck, starrte in sein Glas und ließ die Eiswürfel darin herumkreisen, so wie er es früher getan hatte, wenn er gestresst war. Ich sah ihn lange und aufmerksam an, seine eleganten Gesichtszüge, hohen Wangenknochen und seine klaren grauen Augen. Sein dunkles Haar färbte sich an den Schläfen etwas grau.
Dann lenkte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf das sich langsam in seinem Glas drehende Eis. »Ich nehme an, du arbeitest jetzt bei einer Kanzlei in Chicago?«
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und schaute mich an. »Ich mache jetzt hauptsächlich Berufungen, nur ab und zu noch einen Prozess. Gelegentlich treffe ich Diesner, und von ihm weiß ich, dass du jetzt hier in Richmond bist.«
Diesner war der Chief Medical Examiner in Chicago. Ich sah ihn auf Kongressen, und wir saßen zusammen in einigen Komitees. Er hatte nie erwähnt, dass er Mark James kannte, und woher er über meine Verbindung zu Mark informiert war, war mir ein Rätsel.
»Ich habe den Fehler begangen, ihm zu erzählen, dass ich dich auf der Universität gekannt habe. Jetzt bringt er von Zeit zu Zeit die Rede auf dich, um mir einen Stich zu versetzen«, erklärte Mark, der meine Gedanken erraten hatte.
Das glaubte ich gern. Diesner war so mürrisch wie ein alter Ziegenbock und nicht gerade ein besonderer Freund von Strafverteidigern. Einige seiner theatralischen Schlachten im Gerichtssaal waren bereits Legende geworden.
Mark sagte: »Wie die meisten Forensiker ist Diesner immer für die Anklage. Wenn ich einen Mörder vertrete, bin ich für ihn automatisch der böse Bube. Manchmal schaut er bei mir rein und erzählt mir ganz beiläufig von einem Artikel, den du gerade veröffentlicht hast, oder von einem besonders schauerlichen Fall, an dem du arbeitest. Dr. Scarpetta. Die berühmte Chief Scarpetta.« Er lachte, aber nicht mit den Augen.
»Du behauptest, wir stünden immer nur auf Seiten der Anklage, und das ist nicht fair«, antwortete ich. »Es sieht nämlich nur so aus. Wenn unsere Beweise für den Angeklagten sprechen, kommt ein Fall gar nicht erst vor Gericht.«
»Kay, ich weiß doch, was los ist«, sagte er in diesem Lass-gut-sein-Ton, an den ich mich noch sehr gut erinnerte. »Mir ist klar, was du täglich anschauen musst. Und wenn ich du wäre, würde ich die Schweinehunde auch am liebsten auf dem elektrischen Stuhl sehen.«
»Ja, du weißt, was ich anschauen muss, Mark«, fing ich an. Es war ein uralter Streit zwischen uns. Ich konnte es einfach nicht glauben. Er war noch nicht einmal fünfzehn Minuten hier, und wir knüpften genau dort wieder an, wo wir damals aufgehört hatten. Einige unserer schlimmsten Kräche hatten sich um genau dieses Thema gedreht. Als ich Mark zum ersten Mal traf, war ich bereits eine fertig ausgebildete Ärztin und Forensikerin und studierte in Georgetown Jura. Ich hatte die dunkle Seite des Verbrechens gesehen, die Grausamkeit und die sinnlosen Tragödien. Ich hatte mit meinen behandschuhten Händen in den blutigen Niederungen des Todes herumgewühlt, während Mark, der Wunderknabe von einer Elite-Universität, sich unter einem Schwerverbrechen das mutwillige Verkratzen des Lacks an seinem Jaguar vorstellte. Mark wollte damals Anwalt werden, weil sein Vater und sein Großvater bereits Anwälte gewesen waren. Ich war Katholikin, Mark Protestant. Meine Herkunft war italienisch, seine so englisch wie die von Prinz Charles. Ich war in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, er in einem der wohlhabendsten Wohnviertel Bostons. Ich hatte mir eine Ehe mit ihm früher einfach himmlisch vorgestellt.
»Du hast dich nicht verändert, Kay«, sagte er. »Außer, dass du entschlossener und härter wirkst. Ich wette, dass man sich im Gerichtssaal ganz schön vor dir in Acht nehmen muss.«
»Ich glaube nicht, dass ich hart bin.«
»Das soll keine Kritik sein. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass du phantastisch aussiehst.« Er sah sich in der Küche um. »Und Erfolg hast du anscheinend auch. Bist du glücklich?«
»Ich mag Virginia«, antwortete ich und sah ihn dabei nicht an. »Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, sind die Winter hier, aber ich glaube, dass du es in dieser Hinsicht noch schlimmer getroffen hast. Wie kannst du es in diesen scheußlichen sechs Monaten nur in Chicago aushalten?«
»Um die Wahrheit zu sagen, ich habe mich noch immer nicht daran gewöhnt. Aber für dich wäre es nichts. Du als Gewächshausblume aus Miami würdest dort nicht einen einzigen Monat bleiben.« Er nippte an seinem Drink. »Bist du verheiratet?«
»Ich war es.«
»Hmmm.« Er legte die Stirn in Falten, während er nachdachte. »War da nicht ein Tony sowieso …? Jetzt fällt es mir ein. Du hattest da was mit Tony … Benedetti, richtig? Am Ende unseres dritten Jahres.«
Es erstaunte mich, dass Mark das bemerkt hatte, mehr noch, dass er sich daran erinnerte.
»Wir sind geschieden. Schon lange«, erwiderte ich.
»Das tut mir leid«, sagte er mit sanfter Stimme.
Ich griff nach meinem Drink.
»Hast du einen Freund, einen netten womöglich?«, fragte er.
»Im Moment habe ich niemanden. Ob nett oder nicht.«
Mark lachte nicht mehr so viel wie früher. Freiwillig und sachlich erklärte er: »Vor ein paar Jahren hätte ich fast geheiratet, aber es hat nicht hingehauen. Oder vielleicht sollte ich ehrlich sein und gestehen, dass ich in der letzten Minute panische Angst bekam.«
Es fiel mir schwer, zu glauben, dass er nie geheiratet hatte. Wieder ahnte er, was ich dachte.
»Das war nach dem Tod von Janet.« Er zögerte. »Ich war verheiratet.«
»Janet?«
Seine Eiswürfel kreisten wieder. »Ich lernte sie in Pittsburgh kennen, nachdem ich Georgetown verlassen hatte. Sie war Steueranwältin in der Kanzlei.«
Ich beobachtete ihn genau, und was ich sah, verblüffte mich. Mark war anders als früher. Seine Ausstrahlung, die ich damals so anziehend gefunden hatte, hatte sich verändert. Ich konnte nicht genau sagen, wie, aber ich glaubte, dass sie dunkler, schwermütiger geworden war.
»Ein Autounfall«, erklärte er. »An einem Samstagabend. Sie fuhr los, um Popcorn zu holen. Wir wollten uns den Spätfilm ansehen. Ein Betrunkener kam ihr auf ihrer Spur entgegen. Er hatte nicht einmal das Licht seines Autos angeschaltet.«
»O Gott, Mark, das tut mir leid«, sagte ich. »Das ist ja schrecklich.«
»Es passierte vor acht Jahren.«
»Hattet ihr Kinder?«, fragte ich leise.
Er schüttelte den Kopf.
Wir schwiegen.
»Meine Kanzlei eröffnet ein Büro in Washington«, bemerkte er, als sich unsere Blicke trafen.
Ich antwortete nicht.
»Es könnte sein, dass ich nach Washington versetzt werde und dorthin ziehen muss. Wir expandieren wie verrückt und sind jetzt etwa hundert Anwälte mit Büros in New York, Atlanta und Houston.«
»Wann würdest du denn umziehen?«, fragte ich ihn ganz ruhig.
»Am 1. Januar nächsten Jahres.«
»Ist das sicher?«
»Ich habe die Schnauze voll von Chicago, Kay. Ich brauche Tapetenwechsel. Ich wollte es dich wissen lassen, das ist der Grund, weshalb ich hier bin, oder sagen wir, der Hauptgrund. Ich möchte nicht nach Washington ziehen und dort irgendwann zufällig mit dir zusammentreffen. Ich würde gern in Nord-Virginia wohnen. Du arbeitest in Nord-Virginia. Früher oder später würden wir uns sicher im Theater oder in einem Restaurant zufällig über den Weg laufen. Das will ich nicht.«
Ich stellte mir vor, im Konzertsaal des Kennedy Center zu sitzen und drei Reihen vor mir Mark zu entdecken, der einer hübschen, jungen Begleiterin etwas ins Ohr flüsterte. Ich wurde an einen alten Schmerz erinnert, einen Schmerz, der damals so intensiv gewesen war, dass ich ihn körperlich gespürt hatte. Ich hatte nie einen anderen Mann als ihn angeschaut. Er war der alleinige Brennpunkt meiner Gefühle gewesen. Zuerst hatte nur ein Teil von mir geahnt, dass dies nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Später wusste ich es dann genau.
»Das war mein Hauptgrund«, wiederholte er, jetzt ganz der Anwalt, der sein Eröffnungsplädoyer hält, »aber da ist noch etwas anderes, was mit uns beiden nichts zu tun hat.«
Ich sagte nichts.
»Vor ein paar Tagen wurde hier in Richmond eine Frau ermordet. Beryl Madison …«
Mein erstaunter Gesichtsausdruck ließ ihn einen Moment innehalten.
»Berger, einer unserer Seniorpartner, erzählte mir davon, als er mich in meinem Hotel in Washington anrief. Ich würde gern mit dir darüber sprechen.«
»Was hast du damit zu tun?«, fragte ich. »Hast du sie etwa gekannt?«
»Flüchtig. Ich habe sie einmal getroffen, letzten Winter in New York. Unser Büro dort befasst sich mit Medienrecht. Beryl hatte Probleme, einen Streit über einen Vertrag, und sie beauftragte Orndorff & Berger damit, die Sache für sie ins Reine zu bringen. Ich war zufällig in New York, als sie eine Unterredung mit Sparacino, dem für ihren Fall zuständigen Anwalt, führte. Sparacino lud mich ein, mit den beiden im Algonquin zu Mittag zu essen.«
»Wenn du glaubst, dass dieser Streit, den du erwähnt hast, irgendetwas mit ihrer Ermordung zu tun haben könnte, dann solltest du das der Polizei erzählen, nicht mir«, sagte ich ärgerlich.
»Kay«, antwortete er, »meine Kanzlei weiß nicht das Geringste davon, dass ich mit dir rede, okay? Als mich Berger gestern anrief, ging es um etwas ganz anderes, verstehst du? Er hat im Verlauf des Gesprächs den Mord an Beryl Madison erwähnt, weil er wollte, dass ich mich in den hiesigen Zeitungen über den Fall informiere.«
»Gut. Im Klartext heißt das, informiere dich über den Fall, bei deiner Ex-…«
Ich spürte, wie ich rot wurde. Ex-was?
»So ist es nicht.« Er blickte zur Seite. »Ich dachte an dich und wollte mit dir telefonieren, bevor Berger anrief, bevor ich die Sache mit Beryl erfuhr. Zwei verdammte Nächte lang habe ich vor dem Telefon gesessen. Ich habe mir deine Nummer von der Auskunft geben lassen, aber ich habe mich einfach nicht getraut, dich anzurufen. Wenn Berger mir nicht erzählt hätte, was passiert ist, hätte ich es vermutlich nie getan. Vielleicht war Beryl ein willkommener Vorwand. So viel gebe ich zu. Aber es ist nicht so, wie du denkst …«
Ich hörte nicht zu. Es erschreckte mich, wie gern ich ihm glauben wollte. »Wenn deine Kanzlei sich für den Mord interessiert, dann sag mir genau, warum.«
Er dachte einen Moment lang nach. »Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein berechtigtes Interesse an dem Mord haben. Vielleicht kommt es aus einem ganz persönlichen Gefühl des Schreckens heraus. Es war ein fürchterlicher Schock für diejenigen von uns, die sie gekannt hatten. Außerdem kann ich dir verraten, dass sie sich mitten in einem ziemlich heftigen Streit befand. Aufgrund eines Vertrags, den sie vor acht Jahren unterschrieben hatte, wurde ihr ganz schön übel mitgespielt. Die Geschichte ist sehr kompliziert. Und sie hat etwas mit Cary Harper zu tun.«
»Dem Schriftsteller?«, fragte ich verblüfft. »Dem Cary Harper?«