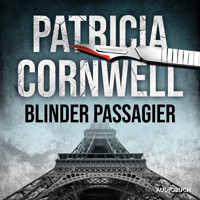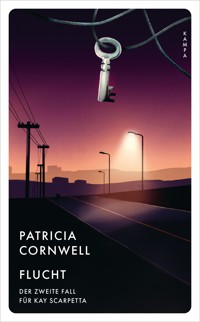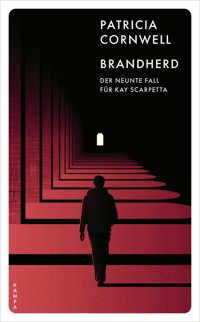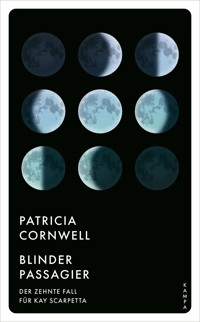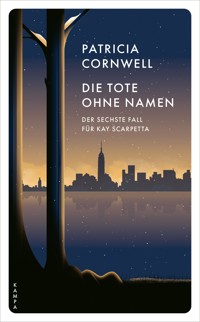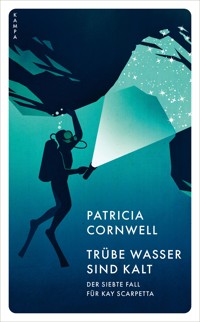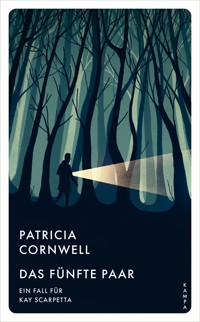
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
In Williamsburg, Virginia geht ein Serienmörder um, der es auf junge Liebespaare abgesehen hat. Vier Pärchen sind in den vergangenen zwei Jahren vermisst gemeldet und erst Monate später tot aufgefunden worden - immer im Wald und schon so verwest, dass selbst eine erfahrene Gerichtsmedizinerin wie Kay Scarpetta keine Todesursache feststellen konnte. Als die Tochter der neuen staatlichen Drogenbeauftragten - eingesetzt vom Präsidenten persönlich und landesweit gefeiert - und ihr Freund verschwinden, bekommen Scarpetta und das Team des Richmond Police Department nicht nur den Druck der Presse zu spüren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Patricia Cornwell
Das fünfte Paar
Der dritte Fall für Kay Scarpetta
Aus dem amerikanischen Englisch von Georgia Sommerfeld
Kampa
Dieses Buch ist
Michael Congdon gewidmet.
Wie immer, danke.
1
Am letzten Augusttag, einem Samstag, begann ich schon vor Morgengrauen zu arbeiten. Ich bekam nicht mit, wie die Sonne den Tau vom Gras leckte und der Himmel strahlend blau wurde. Den ganzen Vormittag kam Leiche nach Leiche auf die Stahltische, und der Raum besaß keine Fenster: Das Labor-Day-Wochenende hatte in Richmond mit einer Anhäufung von Verkehrsunfällen und Schießereien begonnen.
Es war zwei Uhr nachmittags, als ich endlich in mein Haus im West End zurückkam. Schon an der Tür hörte ich Bertha, die jeden Samstag bei mir sauber machte, in der Küche herumwirtschaften, und das Telefon begann zu klingeln. Bei ihrer Einstellung hatte ich sie angewiesen, Anrufe zu ignorieren.
»Hallo«, begrüßte ich sie. »Ich bin nicht da.«
Bertha hörte auf mit Bodenwischen. »Es hat vor ’ner Minute schon mal geklingelt«, berichtete sie. »Und ein paar Minuten davor auch schon. Jedes Mal derselbe Mann.«
»Ich bin nicht zu Hause«, wiederholte ich.
»Wie Sie meinen, Dr. Kay.« Der Schrubber kam wieder in Bewegung.
Ich öffnete die Kühlschranktür und versuchte die körperlose Nachricht des Anrufbeantworters, die in die sonnendurchflutete Küche drang, zu überhören. Wo war der Geflügelsalat? Auf den Signalton folgte eine vertraute männliche Stimme: »Doc? Hier spricht Marino …«
O Gott!, dachte ich, griff mir den Geflügelsalat und schloss die Kühlschranktür mit einem Hüftschwung. Lieutenant Pete Marino vom Morddezernat Richmond war seit Mitternacht im Dienst gewesen, und ich hatte ihn vorhin kurz gesehen, als er bei mir im Obduktionsraum vorbeischaute, wo ich gerade die Kugeln aus einem seiner Fälle entfernte. Eigentlich hatte er den verbleibenden Rest des Wochenendes mit Angeln am Lake Gaston verbringen wollen – und ich freute mich auf anderthalb faule Tage.
»Ich habe schon mehrfach versucht, Sie zu erreichen. Benton hat mich gerade eben informiert. Ich muss sofort los. Sie können mich über den Pager …«
Das klang dringend. Ich nahm den Hörer ab. »Was gibt es?«
»Gott sei Dank! Mann, wie ich diese Anrufbeantworter hasse! Ich habe schlechte Neuigkeiten: Man hat wieder ein verlassenes Auto gefunden. In New Kent County – auf einem Rastplatz an der Sixty-four. In westlicher Fahrtrichtung.«
»Heißt das, dass wieder ein Paar verschwunden ist?« Adieu, Faulheit.
»Fred Cheney, weiß, neunzehn. Deborah Harvey, weiß, neunzehn. Zum letzten Mal gesehen gestern Abend gegen acht, als sie vom Haus der Harveys in Richmond nach Spindrift aufbrachen.«
»Und der Wagen steht auf dem Rastplatz Richtung Westen?«, fragte ich verdutzt: Spindrift, North Carolina, liegt etwa dreieinhalb Stunden östlich von Richmond.
»Richtig. Sieht so aus, als hätten sie in die Stadt zurückgewollt. Ein Trooper hat den Jeep Cherokee ungefähr vor einer Stunde entdeckt. Keine Spur von den beiden.«
»Ich fahre sofort los«, erklärte ich.
Bertha hatte zwar weitergeputzt, aber ich wusste, dass ihr kein Wort entgangen war. »Ich schalte die Alarmanlage ein, wenn ich gehe«, versprach sie.
»Okay. Vielen Dank.« Furcht kroch in mir hoch, als ich mir meine Handtasche schnappte und aus dem Haus hastete.
Bis jetzt waren es vier Paare – alle vermisst gemeldet und schließlich tot aufgefunden. In einem Achtzig-Kilometer-Umkreis von Williamsburg.
Die Fälle, die in der Presse unter der Bezeichnung »Pärchen-Morde« liefen, waren rätselhaft. Niemand hatte eine Erklärung oder eine wenigstens halbwegs einleuchtende Theorie, nicht einmal das FBI und sein Violent Criminal Apprehension Program – kurz VICAP –, dem eine landesweite Datenbank zur Verfügung stand, die über einen Computer lief, der in der Lage war, vermisste Personen nicht identifizierten Leichen zuzuordnen und Serienverbrechen aufzuzeigen.
Als vor mehr als zwei Jahren das erste Paar gefunden worden war, hatte man ein VICAP-Regionalteam um Hilfe gebeten. Es bestand aus FBI Special Agent Benton Wesley und Lieutenant Pete Marino vom Richmond Police Department. Ein weiteres Paar verschwand. Und noch eines. Und ein viertes. In allen vier Fällen waren die vermissten Teenager tot und verwesten irgendwo in einem Waldstück, ehe die Meldung VICAP erreichte, ja noch ehe NCIC – das National Crime Information Center – ihre Beschreibungen an sämtliche Polizeistationen der USA hatte durchgeben können.
Ich erreichte die I-64 East und beschleunigte. In meinem Kopf tauchten Erinnerungen auf an Stimmen, Knochen, verrottete Kleidungsstücke unter faulenden Blättern, hübsche junge Gesichter von Vermissten in Zeitungen, kummervolle Eltern bei Fernsehinterviews – und an meinem Telefon.
»Es tut mir leid wegen Ihrer Tochter.«
»Bitte sagen Sie mir, wie meine Kleine gestorben ist. O mein Gott, hat sie leiden müssen?«
»Die Todesursache steht noch nicht fest, Mrs. Bennett. Mehr kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen.«
»Soll das heißen, Sie wissen es nicht?«
»Es sind nur noch Knochen übrig, Mr. Martin. Wenn das Gewebe fehlt, sind damit auch die Hinweise auf oberflächliche Verletzungen verschwunden, und es ist äußerst schwierig …«
»Ich denke, Sie haben Medizin studiert, also sagen Sie mir, was meinen Jungen umgebracht hat. Die Cops haben was von Drogen gefaselt. Hören Sie das, Lady? Er ist tot, und die wollen einen Junkie aus ihm machen!«
Chief Medical Examiner ratlos: Dr. Kay Scarpetta nicht in der Lage, Todesursache zu nennen.
Rätselhaft.
Acht junge Menschen waren tot, und ich hatte keine Ahnung, woran sie gestorben waren. Jeder Rechtsmediziner stößt hin und wieder auf unklare Fälle, aber diese Massierung war höchst ungewöhnlich – und sie schienen auch noch alle miteinander in Zusammenhang zu stehen.
Ich öffnete das Schiebedach, und das schöne Wetter hob meine Stimmung. Es war um die achtundzwanzig Grad warm, und bald würde sich das Laub färben. Nur im Herbst und im Frühling vermisste ich Miami nicht. Die Sommer in Richmond waren genauso heiß, doch es fehlte der Meereswind, und die Luftfeuchtigkeit war grauenhaft. Und auch im Winter litt ich, denn ich verabscheue Kälte. Aber Frühling und Herbst fand ich herrlich hier. Geradezu berauschend.
Der Rastplatz an der I-64 in New Kent County lag, wie sich herausstellte, genau fünfzig Kilometer von meinem Haus entfernt und sah aus wie alle Rastplätze in Virginia: Picknicktische, Grills, Holztonnen für Abfall, gemauerte Toilettenhäuschen, Speisen- und Getränkeautomaten und junge Bäume, aber nirgends waren Urlaubsreisende oder Trucks zu sehen. Dafür wimmelte es von Polizeifahrzeugen.
Ein graublau uniformierter Trooper kam mit ernster Miene auf mich zu, als ich vor der Damentoilette anhielt. »Tut mir leid, Ma’am.« Er beugte sich zu meinem offenen Fenster herunter. »Dieser Rastplatz ist heute geschlossen. Ich muss Sie bitten weiterzufahren.«
»Dr. Kay Scarpetta, Chief Medical Examiner«, stellte ich mich vor und zog den Zündschlüssel ab. »Ich bin auf Ersuchen der Polizei hier.«
»Zu welchem Zweck, Ma’am?«
»In meiner amtlichen Eigenschaft als staatliche Leichenbeschauerin.«
Er musterte mich skeptisch: Ich sah tatsächlich nicht sehr danach aus. In meinem Jeansrock, dem pinkfarbenen T-Shirt mit »Oxford«-Aufdruck und den Sportschuhen war ich bar jeden Statussymbols, und mein Dienstwagen stand zwecks neuer Bereifung in der Werkstatt. Auf den ersten Blick wirkte ich wohl eher wie ein nicht mehr ganz taufrischer Yuppie.
»Können Sie sich ausweisen?«
Ich kramte meine Marke aus der Handtasche und gab ihm zusätzlich meinen Führerschein. Er betrachtete beides eingehend und wurde sichtlich verlegen.
»Lassen Sie Ihren Wagen ruhig hier stehen, Dr. Scarpetta. Die Leute, die Sie suchen, sind da hinten.« Er deutete in die Richtung des Parkareals für Trucks und Busse. »Schönen Tag noch«, fügte er mit routinemäßiger Höflichkeit hinzu und trat zurück, um mich aussteigen zu lassen.
Als ich um das Häuschen herumgegangen war, sah ich weitere Polizeifahrzeuge, einen Abschleppwagen mit blinkender Lichtleiste und mindestens ein Dutzend Beamte in Uniform und Zivil. Den braunen Jeep Cherokee bemerkte ich erst, als ich fast schon davor stand – etwa auf halber Strecke der Auffahrt, ein gutes Stück von der Fahrbahn entfernt in einer leichten Senke, mit der Nase an einem Baum, dessen Blätter ihn teilweise verdeckten. Ich trat näher heran und schaute durch das Fenster auf der Fahrerseite: Der mit beigefarbenem Leder ausgestattete Innenraum war sehr gepflegt, das Gepäck auf dem Rücksitz ordentlich verstaut. Die Scheiben waren halb heruntergelassen. Der Zündschlüssel steckte. Als seien die Insassen des Wagens nur kurz ausgestiegen. Gespenstisch. Die Reifenspuren hatten sich tief in den grasbewachsenen Boden gegraben.
Marino sprach mit einem schlanken blonden Mann, den er mir als Jay Morrell von der State Police vorstellte. Er schien die Aktion zu leiten.
»Kay Scarpetta«, ergänzte ich, als Marino mich lediglich als »Doc« einführte.
Morrell blickte mich durch seine dunkelgrüne Ray-Ban an und nickte. In seinem Straßenanzug und mit dem Schnurrbart, der wie der erste Versuch eines Teenagers wirkte, männlich auszusehen, vermittelte er nicht gerade den Eindruck eines erfahrenen Beamten, und auch seine Beflissenheit deutete mehr auf einen Neueinsteiger hin.
»Viel wissen wir noch nicht«, erklärte er in einem Ton, als teile er mir damit etwas ungeheuer Wichtiges mit. »Der Jeep gehört Deborah Harvey. Sie und ihr Freund – äh … Fred Cheney – verließen das Haus der Harveys gestern Abend gegen acht. Sie wollten nach Spindrift, wo die Harveys ein Strandhaus haben.«
»War Deborahs Familie zu Hause, als die beiden losfuhren?«, fragte ich.
»Nein, Ma’am.« Die Brillengläser starrten mich an wie Insektenaugen. »Die anderen waren schon vorausgefahren. Deborah und der Junge nahmen ihren Wagen, weil sie am Montag wieder zurückwollten. Sie studieren im zweiten Jahr in Carolina.«
»Bevor sie aufbrachen«, Marino zog seine Zigaretten aus der Tasche, »sagten sie in Spindrift Bescheid, dass sie zwischen Mitternacht und ein Uhr früh da sein würden. Den Anruf nahm einer von Deborahs Brüdern entgegen. Als sie um vier noch immer nicht eingetroffen waren, rief Pat Harvey die Polizei an.«
»Pat Harvey?« Ich starrte Marino ungläubig an.
»O ja«, antwortete Officer Morrell. »Diesmal haben wir es mit der Prominenz zu tun. Mrs. Harvey ist bereits auf dem Weg hierher. Vor ungefähr«, er schaute auf seine Uhr, »einer halben Stunde hat ein Hubschrauber sie abgeholt. Ihr Mann – äh … Bob Harvey –, ist geschäftlich in Charlotte. Er wollte irgendwann morgen zurückkommen. Soviel ich weiß, hat man ihn noch nicht erreichen können.«
Pat Harvey war der Kopf des staatlichen Anti-Drogen-Programms, was ihr bei den Medien die Bezeichnung »Drogen-Zarin« eingebracht hatte. Vom Präsidenten persönlich eingesetzt und vor kurzer Zeit auf der Titelseite von Time abgebildet, war sie eine der mächtigsten und meistbewunderten Frauen Amerikas.
»Was ist mit Benton?«, fragte ich Marino. »Weiß er, dass Deborah Harvey Pat Harveys Tochter ist?«
»Keine Ahnung, gesagt hat er nichts. Aber wir haben auch nur ganz kurz miteinander gesprochen. Als er anrief, war er gerade in Newport News gelandet und wollte sich schnellstens einen Mietwagen besorgen.«
Damit war meine Frage beantwortet: Das FBI würde Benton Wesley nicht einfliegen, wenn ihm nicht bekannt wäre, um wessen Tochter es sich bei dem vermissten Mädchen handelte. Merkwürdig, dass er es Marino gegenüber nicht erwähnt hatte – immerhin war er sein VICAP-Partner. Ich versuchte in Marinos Gesicht zu lesen, wie er dieses Verhalten empfand. Vergeblich. Lediglich seine spielenden Kiefermuskeln deuteten darauf hin, dass er unter Spannung stand. Auf der beginnenden Glatze über dem vollen Gesicht glänzten Schweißperlen.
»Ich habe zunächst mal jede Menge Männer herbeordert, um den Verkehr fernzuhalten«, resümierte Morrell. »Wir haben die Toilettenhäuschen überprüft und uns ein bisschen umgesehen, um ausschließen zu können, dass die jungen Leute sich in der unmittelbaren Umgebung befinden. Sobald die Hunde eintreffen, nehmen wir uns den Wald vor.«
Unmittelbar hinter der Kühlerhaube des Jeep begann ein Gewirr aus Unterholz und Bäumen, das so dicht war, dass man nur eine Blätterwand sah. In einiger Entfernung zog ein Habicht seine Kreise über den Wipfeln. Obwohl Einkaufszentren und Wohnviertel sich immer weiter an der I-64 entlangzogen, war dieser Streifen zwischen Richmond und Tidewater noch unberührt. Die schöne Gegend wirkte heute trotz des Sonnenscheins düster und bedrückend.
»Scheiße!«, fluchte Marino, als Morrell sich entfernt hatte.
Wir gingen langsam nebeneinanderher.
»Tut mir leid um Ihren Angelausflug«, sagte ich.
»Na ja, so geht’s doch immer, stimmt’s? Ich habe den verdammten Trip schon seit Monaten geplant. Wieder nichts. Wie üblich.«
»Mir ist etwas aufgefallen«, wechselte ich das Thema. »Wenn man die I-64 verlässt, teilt sich die Abfahrt sofort in zwei Spuren: Die eine führt hierher, die andere zum vorderen Teil des Rastplatzes, der für Pkw reserviert ist. Mit anderen Worten: Es sind Einbahnstraßen. Wenn man sich einmal entschieden hat, welches Areal man ansteuern will, kann man es nicht mehr rückgängig machen, ohne eine beträchtliche Strecke in der verkehrten Richtung zu fahren und Gefahr zu laufen, mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenzuprallen – und gestern Abend war hier bestimmt massenhaft Betrieb. Schließlich ist Labor-Day-Wochenende.«
»Richtig. Der Jeep ist mit Sicherheit absichtlich zu seinem jetzigen Standort gebracht worden. Wahrscheinlich war unserem großen Unbekannten auf dem vorderen Parkplatz zu viel los. Also nahm er die Zufahrt für Trucks und Busse. Hier stand sicher kaum jemand, und so konnte er sich unbemerkt absetzen.«
»Und offenbar wollte er vermeiden, dass der Jeep schnell gefunden wird – weshalb hätte er ihn sonst dort drüben abstellen sollen?«
Marino starrte in Richtung Wäldchen. »Ich werde allmählich zu alt für dieses Geschäft«, knurrte er.
Er war ein notorischer Meckerer und erschien am Schauplatz eines Verbrechens stets mit vorgeblichem Widerwillen. Wir arbeiteten schon so lange zusammen, dass ich mich daran gewöhnt hatte – doch diesmal war seine üble Laune echt. Das konnte nicht allein von dem verpatzten Angelausflug herrühren. Vielleicht hatte er Krach mit seiner Frau.
»Sieh mal einer an«, murmelte er, als sein Blick zufällig zu dem Toilettenhäuschen wanderte. »Der einsame Rächer ist eingetrudelt.«
Ich wandte mich um und sah die schmale, vertraute Gestalt Benton Wesleys aus der Herrentoilette auf uns zukommen. Sein »Hallo« konnte man nur ahnen. Die silbergrauen Schläfen waren nass und die Revers seines blauen Anzugs wasserbespritzt, als habe er sich das Gesicht gewaschen. Er zog eine Sonnenbrille aus der Brusttasche und setzte sie auf.
»Ist Mrs. Harvey schon da?«, fragte er.
»Nee«, antwortete Marino.
»Und die Presse?«
»Auch nicht.«
»Sehr gut.« Wesley presste die Lippen aufeinander, wodurch seine scharfen Züge noch härter und unnahbarer wirkten als sonst. Neuerdings blockte er so meisterhaft ab, dass ich manchmal das Gefühl hatte, einem Fremden gegenüberzustehen. Früher einmal hatte ich ihn attraktiv gefunden, doch seine Distanziertheit nahm ihm jede Ausstrahlung.
»Wir wollen diese Sache so lange wie möglich geheim halten«, fuhr er fort. »Wenn sie bekannt wird, bricht die Hölle los.«
»Was wissen Sie über das Paar, Benton?«, fragte ich.
»Nur sehr wenig. Nachdem Mrs. Harvey die beiden als vermisst gemeldet hatte, rief sie den Director zu Hause an und der wiederum mich. Offenbar haben ihre Tochter und Fred Cheney sich auf dem College kennengelernt und gehen seit dem ersten Studienjahr miteinander. Scheinen fleißig und anständig zu sein. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass sie sich mit schrägen Typen eingelassen hätten, jedenfalls behauptet Mrs. Harvey das. Allerdings ist sie wohl nicht übermäßig angetan von der Beziehung – sie erscheint ihr zu eng.«
»Vermutlich der wahre Grund dafür, dass die beiden im eigenen Wagen ans Meer fahren wollten«, sagte ich.
»So sehe ich das auch.« Wesley warf einen Blick in die Runde. »Höchstwahrscheinlich war das der wahre Grund. Der Director vermittelte mir den Eindruck, dass die Aussicht, Deborahs Freund in Spindrift zu haben, Mrs. Harvey nicht gerade begeisterte. Die Tage sollten der Familie gehören. Mrs. Harvey wohnt die Woche über in Washington und hat ihre Tochter und die beide Söhne während des Sommers kaum gesehen. In letzter Zeit gab es anscheinend Differenzen zwischen ihr und dem Mädchen. Vielleicht haben sie sich gestritten, bevor die Familie gestern früh nach North Carolina abfuhr.«
»Könnten die beiden durchgebrannt sein?«, fragte Marino. »Sie lesen Zeitungen, sehen Nachrichten. Letzte Woche lief die Sondersendung über die Pärchenmorde. Wäre doch möglich, dass die sie auf die Idee gebracht hat zu verschwinden.«
»Möglich ist vieles«, antwortete Wesley. »Und auch deshalb möchte ich die Medien raushalten, solange es geht.«
Auf dem Weg zum Jeep gesellte sich Morrell zu uns. Ein blauer Kastenwagen kam herangefahren und hielt ein paar Meter von uns entfernt. Ein Mann und eine Frau in dunklen Overalls stiegen aus, öffneten die Heckklappe und ließen zwei japsende, schwanzwedelnde Bluthunde heraus. Sie hakten lange Leinen in ihre Gürtel und packten die Hunde an den Geschirren.
»Salty, Neptune – bei Fuß!«
Ich konnte nicht erkennen, welcher Name zu welchem Hund gehörte. Beide waren groß und beige und hatten faltige Gesichter und Schlappohren. Morrell streckte grinsend die Hand aus. »Wie geht’s denn, Kumpel?« Salty oder Neptune belohnte seine Freundlichkeit mit einem nassen Kuss und einem Stups ans Knie.
Die Hundeführer kamen aus Yorktown und hießen Jeff und Gail. Gail war ebenso groß wie ihr Partner und wirkte ebenso kräftig. Sie erinnerte mich an Farmersfrauen, die ich gesehen hatte: die Gesichter von harter Arbeit und Sonne gegerbt und eine stoische Ruhe ausstrahlend, die daraus resultierte, dass sie die Natur verstanden und ihre Geschenke und Bestrafungen gleichermaßen akzeptierten.
An der Art, wie sie den Jeep musterte, erkannte ich, dass sie nach Anzeichen dafür suchte, dass die Gerüche verändert worden waren.
»Niemand hat ihn angerührt«, beantwortete Marino ihre unausgesprochene Frage und bückte sich, um einen der Hunde hinter den Ohren zu kraulen. »Wir haben bisher nicht mal die Türen aufgemacht.«
»Wissen Sie, ob sonst jemand drin gewesen ist – vielleicht derjenige, der den Jeep gefunden hat?«
»Das Kennzeichen wurde ganz früh heute Morgen über Ticker als BOLOs rausgegeben …«, begann Morrell zu erklären.
»Was zum Teufel ist BOLOs?«, unterbrach ihn Wesley.
»Die Abkürzung von ›Be On the Lookouts‹.«
Wesleys Gesicht zeigte nicht die geringste Regung, als Morrell eifrig fortfuhr: »Trooper sind ja meist unterwegs und bekommen keine Telefaxe. Also wurde BOLOs sofort nach Eingang der Vermisstenmeldung über Funk gesendet, und gegen ein Uhr mittags erhielten wir die Nachricht, dass der Jeep gefunden worden war. Der Beamte, der ihn entdeckte, versichert, er habe lediglich durch die Fenster geschaut, um zu prüfen, ob sich jemand im Wagen befinde.«
Ich hoffte, dass das stimmte. Die meisten Polizisten können der Versuchung nicht widerstehen und öffnen Türen und stöbern auf der Suche nach einem Hinweis auf den Wagenhalter im Handschuhfach herum.
Jeff packte beide Hunde am Geschirr und führte sie Gassi. Gail fragte: »Haben Sie irgendwas, bei dem die Hunde die Witterung aufnehmen können?«
»Pat Harvey ist gebeten worden, etwas mitzubringen, das Deborah kürzlich getragen hat«, sagte Wesley.
Wenn Gail überrascht oder beeindruckt davon war, wessen Tochter sie suchen sollte, so ließ sie es sich nicht anmerken.
»Sie wird per Hubschrauber eingeflogen«, erklärte er und warf einen Blick auf seine Uhr. »Müsste jeden Moment eintreffen.«
»Die sollen bloß nicht hier landen!« Gail trat zum Jeep. »Ich kann nichts brauchen, was alles durcheinanderwirbelt.«
Sie schaute durch das Fahrerfenster und ließ den Blick durch das Wageninnere gleiten. Dann musterte sie den schwarzen Plastikgriff an der Außenseite der Tür.
»Am ergiebigsten dürften die Sitze sein«, meinte sie. »Wir werden Salty an dem einen schnuppern lassen und Neptune an dem anderen. Aber erst müssen wir mal reinkommen, ohne etwas anzufassen. Hat jemand einen Bleistift oder Kugelschreiber?«
Wesley zog einen Kugelschreiber aus der Hemdtasche und gab ihn ihr.
»Ich brauche noch einen«, sagte sie.
Erstaunlicherweise hatte keiner von uns anderen ein Schreibwerkzeug bei sich. Dabei hätte ich geschworen, in meiner Handtasche mindestens ein halbes Dutzend herumzutragen.
»Wie wär’s mit einem Messer?« Marino kramte in seinen Jeans.
»Perfekt.« Den Kugelschreiber in der einen Hand und das Schweizermesser in der anderen, drückte Gail den Knopf an der Außenseite der Tür hinein und zog gleichzeitig den Griff zurück, hakte dann die Spitze ihres hohen Stiefels unter die Tür und zog sie vorsichtig auf.
Das charakteristische Tschoptschoptschop von Rotorblättern wurde hörbar und rasch lauter. Augenblicke später kreiste ein rotweißer Bell Jet Ranger über dem Rastplatz und sank dann langsam herunter, was unter ihm einen kleinen Hurrikan auslöste. Der Lärm war ohrenbetäubend, die Bäume schwankten, und das Gras wurde flach gedrückt. Mit zusammengekniffenen Augen hockten Gail und Jeff neben ihren Hunden, die Geschirre fest im Griff.
Marino, Wesley und ich zogen uns zu den Toilettenhäuschen zurück und beobachteten die Landung von dort. Für einen Moment sah ich Pat Harveys Gesicht – es war völlig ausdruckslos. Dann fing sich das Sonnenlicht in der Glasscheibe der Kanzel und machte sie undurchsichtig.
Sie stieg mit eingezogenem Kopf aus dem Hubschrauber. Der Rock wirbelte um ihre Beine. Wesley wartete in sicherer Entfernung – und dennoch flatterte seine Krawatte über seine Schulter wie der Schal eines Doppeldeckerfliegers.
Bevor Pat Harvey zur Verantwortlichen für das landesweite Anti-Drogen-Programm berufen worden war, war sie zunächst Oberste Staatsanwältin in Richmond gewesen und dann US-Staatsanwältin für Ost-Virginia. Ihre hochkarätigen Rauschgift-Prozesse hatten gelegentlich auch Opfer einbezogen, die ich auf dem Tisch gehabt hatte, doch ich war nie in den Zeugenstand gerufen worden, man hatte nur meine Berichte angefordert. Mrs. Harvey und ich waren einander bisher nicht begegnet.
Im Fernsehen und auf Zeitungsfotos wirkte sie immer streng. In natura war sie sehr weiblich und attraktiv, schlank und jugendlich. Die Sonne brachte goldene und rote Lichter in den kurzen kastanienbraunen Haaren über dem fein geschnittenen Gesicht zum Leuchten. Wesley stellte uns einander vor, und Pat Harvey gab jedem von uns die Hand, aber sie lächelte nicht und sah auch keinem in die Augen.
»Ich habe ein Sweatshirt mitgebracht.« Sie gab Gail eine Papiertüte. »Aus Debbies Zimmer in Spindrift.«
»Wann war Ihre Tochter denn zuletzt dort?«, fragte Gail, ohne die Tüte zu öffnen.
»Anfang Juli. Mit ein paar Freunden. Übers Wochenende.«
»Und Sie sind sicher, dass sie es getragen hat – nicht eine ihrer Freundinnen?«
Die Frage traf Mrs. Harvey überraschend. Zweifel stand in ihren dunkelblauen Augen. Sie räusperte sich. »Ich nehme an, dass Debbie es anhatte, aber beschwören kann ich es nicht. Ich stand nicht daneben.« Sie schaute an uns vorbei in den Jeep, und ihr Blick blieb an dem Zündschlüssel hängen, an dem ein silbernes »D« baumelte. Ich sah, wie sie um Fassung kämpfte. Schließlich wandte sie sich wieder uns zu und sagte mit bewundernswert fester Stimme:
»Debbie muss eine Tasche dabeigehabt haben. Leuchtend rot. Aus Nylon. Eine von diesen Sporttaschen mit Klettverschluss. Haben Sie die im Wagen gefunden?«
»Wir haben ihn noch nicht durchsucht«, erwiderte Morrell. »Das dürfen wir nicht, bevor die Hunde drin waren.«
»Sie müsste auf dem Vordersitz liegen, möglicherweise auch auf dem Boden.«
Morrell schüttelte den Kopf.
Jetzt meldete sich Wesley zu Wort: »Mrs. Harvey, wissen Sie, ob Ihre Tochter eine größere Geldsumme bei sich hatte?«
»Ich hatte ihr fünfzig Dollar für Essen und Benzin gegeben. Ob sie darüber hinaus etwas mitnahm, weiß ich nicht. Natürlich fuhr sie nie ohne Kreditkarten und Scheckbuch.«
»Kennen Sie den Stand ihres Bankkontos?«
»Ihr Vater gab ihr letzte Woche einen Scheck«, antwortete sie. »Fürs College, für Bücher und so weiter. Ich bin ziemlich sicher, dass sie ihn bereits eingereicht hat. Dann müssen mindestens tausend Dollar darauf sein.«
»Ich möchte Sie bitten, sich zu vergewissern, dass das Geld nicht abgehoben wurde.«
»Das werde ich nachher sofort tun.«
Ich sah, wie Hoffnung in ihr erwachte: Ihre Tochter hatte Bargeld, Kreditkarten und ein volles Konto, es sah nicht so aus, als habe sie ihre Tasche im Jeep zurückgelassen, was bedeuten konnte, dass sie wohlauf und mit ihrem Freund durchgebrannt war.
»Hat Ihre Tochter je gedroht, mit ihrem Freund wegzulaufen?«, fragte Marino unverblümt.
»Nein.« Ihr Blick kehrte zu dem Jeep zurück, und sie fügte hinzu, was sie gern glauben wollte: »Aber das heißt nicht, dass sie es nicht getan hat.«
»In welcher Stimmung war sie, als Sie das letzte Mal mit ihr sprachen?«, forschte Marino weiter.
»Sie war verärgert«, antwortete sie tonlos. »Es gab einen Wortwechsel, bevor meine Söhne und ich aufbrachen. Gestern früh.«
»Weiß sie von den verschwundenen Pärchen?«
»Natürlich. Wir haben darüber gesprochen und Vermutungen angestellt.«
»Wir sollten anfangen«, wandte sich Gail an Morrell.
»Sie haben recht.«
»Noch eins.« Gail sah Mrs. Harvey an. »Können Sie uns vielleicht sagen, wer am Steuer saß?«
»Fred, nehme ich an. Auf längeren Strecken fuhr meistens er.«
Gail nickte. »Ich brauche noch mal den Kugelschreiber und das Messer.« Nachdem sie beides von Wesley und Marino wiederbekommen hatte, öffnete sie die Beifahrertür. Dann holte sie einen der Hunde. Er bewegte sich, die Nase am Boden, im Gleichschritt mit seiner Herrin, und seine Ohren schleiften durch das Gras, als seien sie mit Blei gefüttert.
»Los, Neptune, setz deine Zaubernase ein!«
Schweigend und voller Spannung beobachteten wir, wie sie Neptune zu dem Platz dirigierte, auf dem vermutlich Deborah gesessen hatte. Plötzlich zuckte er zurück, als sei er auf eine Klapperschlange gestoßen, und riss sich aufjaulend los. Dann stand er mit eingeklemmtem Schwanz da, die golden schimmernden Rückenhaare wie einen Kamm aufgestellt. Ein eisiger Schauer überlief mich.
Winselnd und zitternd wie Espenlaub hockte sich Neptune nieder und entleerte seinen Darm.
2
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, graute mir vor der Zeitung.
Die Schlagzeile war so groß, dass man sie aus einem Block Entfernung hätte lesen können:
TOCHTERDER »DROGEN-ZARIN« UNDFREUNDVERMISST – POLIZEIBEFÜRCHTETVERBRECHEN
Nicht nur hatten die Reporter ein Bild von Deborah Harvey aufgetrieben, es gab auch eine Aufnahme davon, wie der Jeep abgeschleppt wurde, und ein Archivfoto von Bob und Pat Harvey, das die beiden Hand in Hand bei einem Strandspaziergang in Spindrift zeigte. Während ich den Artikel las und nebenbei an meinem Kaffee nippte, musste ich an die Familie von Fred Cheney denken. Der Junge gehörte nicht zur Prominenz – würde er allein vermisst, stünde die Meldung irgendwo klein unter »Vermischtes« –, doch seine Leute machten sich mit Sicherheit ebensolche Sorgen wie die Harveys.
Fred war offenbar der Sohn eines Geschäftsmannes von der Southside – ein Einzelkind, dessen Mutter im vergangenen Jahr gestorben war, als ein Aneurysma in ihrem Gehirn platzte. Dem Bericht zufolge war Freds Vater derzeit bei Verwandten in Sarasota, wo die Polizei ihn endlich am vergangenen Abend erreicht hatte. Die Möglichkeit, dass sein Sohn mit Deborah durchgebrannt sei, bezeichnete Mr. Cheney als höchst unwahrscheinlich, da ein solches Verhalten Freds Charakter völlig zuwiderlaufe. Der Junge galt als fleißiger Student und war Mitglied des Uni-Schwimmteams. Deborah strebte einen akademischen Grad mit Auszeichnung an und war eine hochbegabte Leichtathletin, die zu olympischen Hoffnungen berechtigte. Sie wog gerade einmal fünfundvierzig Kilo, hatte schulterlanges dunkelblondes Haar und die feinen Züge ihrer Mutter. Fred war breitschultrig und schlank, mit welligen schwarzen Haaren und haselnussbraunen Augen. Sie wurden als attraktives Paar beschrieben – und als unzertrennlich.
»Man sah nie den einen ohne den anderen«, wurde ein Freund zitiert. »Und der Tod seiner Mutter schweißte die beiden noch fester zusammen. Ich weiß nicht, wie er ihn ohne Debbies Hilfe verkraftet hätte.«
Natürlich folgte im Anschluss an den aktuellen Bericht eine Zusammenfassung der vier Fälle der Pärchen, die vermisst und später tot aufgefunden worden waren. Mehrere Male fiel mein Name. Ich wurde als »frustriert«, »ratlos« und »unkommunikativ« bezeichnet. Natürlich konnte der Schreiber nicht nachfühlen, wie es war, Tag für Tag Opfer von Morden, Selbstmorden und Unfällen zu obduzieren. Es gehörte für mich ebenso zur Routine, wie mit Familien zu sprechen, vor Gericht als Zeugin auszusagen und Vorträge vor Sanitätern und auf Polizeiakademien zu halten.
Ich war vom Küchentisch aufgestanden und starrte in den sonnigen Morgen hinaus, als das Telefon klingelte. Wahrscheinlich ist es Ma, dachte ich: Sie rief oft sonntags um diese Zeit an, um mich zu fragen, wie es mir gehe und ob ich in der Kirche gewesen sei. Also nahm ich meinen Kaffee, setzte mich bequem zurecht und hob den Hörer ab.
»Dr. Scarpetta?«
»Am Apparat.« Eine Frau. Ich kannte sie – aber woher?
»Pat Harvey. Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie zu Hause belästige.«
»Sie belästigen mich ganz und gar nicht«, erwiderte ich freundlich. »Was kann ich für Sie tun?«
»Die Männer haben die ganze Nacht da draußen gesucht, und sie sind noch dort. Es wurden noch mehr Beamte eingesetzt – und weitere Hubschrauber und zusätzliche Hunde.« Sie sprach immer schneller. »Nichts. Keine Spur von den beiden. Bob hat sich der Suchmannschaft angeschlossen. Ich sitze ganz allein hier. Wäre es Ihnen …« Sie zögerte. »Wäre es möglich, dass Sie herüberkämen – vielleicht zum Mittagessen?«
Nach einer langen Pause stimmte ich zu. Als ich den Hörer auflegte, haderte ich bereits mit mir, denn ich wusste genau, was auf mich zukommen würde: Pat Harvey würde mich nach den anderen Paaren ausfragen wollen. An ihrer Stelle täte ich das auch.
Ich ging ins Schlafzimmer hinauf und zog meinen Morgenrock aus. Dann nahm ich ein langes heißes Bad und wusch mir die Haare, während meine Mailbox Anrufe aufnahm, auf die ich nur reagieren würde, wenn es sich um Notfälle handelte.
Eine Stunde später schlüpfte ich in ein khakifarbenes Leinenkostüm, lief hinunter und hörte die Aufzeichnungen ab: fünf Anrufer – ausnahmslos Reporter, die erfahren hatten, dass ich zu dem Rastplatz in New Kent County gerufen worden war, was sie als unheilverheißend interpretierten.
Ich griff zum Telefon, um Pat Harvey abzusagen, doch dann sah ich sie wieder vor mir, wie sie aus dem Hubschrauber stieg, die Tüte mit dem Sweatshirt ihrer Tochter in der Hand. Und plötzlich hatte ich auch die anderen Eltern vor Augen. Also legte ich den Hörer wieder auf, schloss die Haustür ab und stieg in meinen Wagen.
Menschen, die im Dienst der Öffentlichkeit stehen, können ihre Privatsphäre nur sichern, wenn sie über Vermögen verfügen. Dies war hier offensichtlich gegeben: Die Harveys wohnten in der Nähe von Windsor über dem James River in einem schlossähnlichen Bau im Stil der Jefferson-Ära. Ich schätzte das Anwesen auf mindestens fünf Morgen. Es war von einer hohen Ziegelmauer umgeben, an der in regelmäßigen Abständen Schilder mit der Aufschrift »Privatbesitz« angebracht waren. Als ich in die lange, von Bäumen beschattete Zufahrt einbog, wurde ich von einem massiven schmiedeeisernen Gitter aufgehalten, das sich jedoch elektronisch gesteuert öffnete, bevor ich mein Fenster herunterlassen konnte, um die Sprechanlage zu betätigen, und kaum war ich hindurchgefahren, schloss es sich lautlos wieder. Ich parkte vor einem römischen Portikus neben einem schwarzen Jaguar. Die Säulen hatten keine Kehlung, waren aus roten Ziegeln und mit Weiß abgesetzt.
Als ich ausstieg, ging die Haustür auf, und Pat Harvey erschien. Sie trocknete sich die Hände an einem Geschirrhandtuch ab und lächelte mich tapfer an. Ihr Gesicht war blass, die glanzlosen Augen ließen erkennen, dass sie zwei Nächte kaum geschlafen hatte. »Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, Dr. Scarpetta. Bitte treten Sie doch ein.«
Die Halle war riesig. Ich folgte der Hausherrin durch einen Empfangssalon, dessen Einrichtung aus dem achtzehnten Jahrhundert stammte. Der Boden war mit Orientteppichen bedeckt, an den Wänden hingen echte Impressionisten, und neben dem Kamin stand ein kunstvoll aufgeschichteter Stoß Buchenscheite. Die Küche war funktionell, aber gemütlich.
»Jason und Michael sind mit ihrem Vater draußen«, erklärte Mrs. Harvey. »Sie kamen heute früh zurück.«
»Wie alt sind die beiden?«, fragte ich.
»Jason ist sechzehn, Michael vierzehn. Debbie ist unsere Älteste.« Sie schaltete den Herd aus, zog Topfhandschuhe an, holte eine Quiche aus dem Backofen und stellte die Form auf eine Kochplatte. Ihre Hände zitterten, als sie ein Messer und einen Pfannenwender aus einer Schublade nahm. »Möchten Sie Wein, Tee oder Kaffee? Es ist nur ein ganz leichtes Essen. Zum Nachtisch habe ich einen Obstsalat gemacht. Ich dachte, wir setzen uns auf die Veranda. Ist Ihnen das recht?«
»Sehr«, erwiderte ich. »Und ich nehme Kaffee.«
Sie füllte Wasser in die Maschine und Kaffeepulver in den Filter. Ich musterte sie verstohlen – eine verzweifelte Frau, die es sich nicht gestattete, ihre Verzweiflung zu zeigen.
Als wir vor den offenen Glasschiebetüren auf der Veranda saßen und auf den Fluss hinunterschauten, der sich wie ein glitzerndes Band durch die sonnenüberflutete Landschaft zog, kam sie zum Thema: »Haben Sie eine Erklärung für die Reaktion des Hundes?«
Ich hatte eine – aber die wollte ich ihr nicht sagen.
»Offensichtlich hat sich nur er erschreckt, der andere nicht.« Es war eher eine Frage als eine Feststellung.
Tatsächlich hatte Salty sich völlig anders verhalten als Neptune: Nachdem er den Fahrersitz abgeschnuppert hatte, zog Gail ihn am Geschirr zurück, hakte die Leine darin fest und kommandierte: »Such!« Der Hund schnüffelte die Ausfahrt entlang, zerrte Gail über den Parkplatz zur Interstate und hätte sich in seinem Eifer kopfüber in den Verkehr gestürzt, wenn Gail nicht »Bei Fuß!« geschrien hätte. Ich beobachtete, wie die beiden an dem bepflanzten Grünstreifen entlanggingen, der die Fahrbahnen in Richtung Westen von denen in Richtung Osten trennte, und dann auf den Rastplatz zusteuerten, der gegenüber jenem lag, auf dem Deborahs Jeep gefunden worden war. Und dort drüben – auf dem Parkplatz – verlor der Hund die Witterung.
»Ist daraus zu schließen, dass, wer immer Debbies Cherokee als Letzter fuhr und auf dem Rastplatz in Richtung Westen abstellte, die Interstate überquerte und auf dem gegenüberliegenden Parkplatz einen Wagen stehen hatte, mit dem er dann wegfuhr?«
»Das ist eine Möglichkeit.« Die Quiche duftete herrlich, doch ich hatte keinen Appetit.
»Welche gibt es sonst noch, Dr. Scarpetta?«
»Fest steht nur, dass der Hund eine Witterung aufgenommen hat – von was oder wem, weiß ich nicht. Es kann Deborahs Geruch gewesen sein, Freds oder der einer dritten Person …«
»Der Jeep stand Stunden dort«, unterbrach mich Pat Harvey. Sie starrte in die Ferne. »Es kann doch jeder Beliebige eingestiegen sein, um nach Geld und Wertsachen zu suchen. Vielleicht ein Anhalter, jemand, der zu Fuß unterwegs war und anschließend über die Interstate auf die andere Seite wechselte.«
Ich ersparte es mir, sie an das Offensichtliche zu erinnern: Die Polizei hatte im Handschuhfach Freds Brieftasche gefunden, samt Kreditkarten und fünfunddreißig Dollar in bar. Es sah nicht so aus, als sei das Auto durchsucht worden. Soweit man es beurteilen konnte, fehlte nichts – außer den jungen Leuten und Deborahs Tasche.
»Die Reaktion des ersten Hundes war spektakulär«, kehrte Pat Harvey zum Ausgangspunkt des Gesprächs zurück. »Irgendetwas hat ihn regelrecht in Panik versetzt. Ein Geruch, den der andere nicht aufgenommen hat. Der Platz, auf dem Debbie wahrscheinlich gesessen hat …« Ihr Blick traf meinen, ihre Stimme erstarb.
»Ja, es sieht so aus, als hätten die beiden Hunde unterschiedliche Gerüche wahrgenommen.«
»Dr. Scarpetta, ich bitte Sie, ehrlich zu sein.« Ein kaum merkliches Beben. »Nehmen Sie keine Rücksicht auf meine Gefühle. Bitte! Es ist doch klar, dass das Tier sich nicht grundlos aufgeregt hat. Bestimmt haben Sie Erfahrung mit Suchhunden … Bluthunden. Ist Ihnen jemals zuvor bei einem von ihnen ein derartiges Verhalten aufgefallen?«
Allerdings. Zweimal. Einmal, als ein Bluthund einen Kofferraum beschnupperte, der sich später als Transportbehälter für ein Mordopfer erwies, das in einem Müllcontainer gefunden wurde. Das zweite Mal, als die Witterung zu einer Stelle an einem Highway führte, wo eine Frau vergewaltigt und erschossen worden war. Doch ich sagte nur: »Bluthunde reagieren stark auf pheromonale Gerüche.«
»Wie bitte?« Sie sah mich verständnislos an.
»So bezeichnet man bestimmte Ausdünstungen. Zum Beispiel solche, die dem sexuellen Anreiz dienen«, erklärte ich in sachlichem Ton. »Sie wissen, dass Hunde ihr Revier markieren und angreifen, wenn sie Furcht registrieren?«
Sie nickte schweigend.
»Wenn jemand sexuell erregt, nervös oder ängstlich ist, laufen verschiedene hormonelle Prozesse im Körper ab. Es scheint, als könnten Spürhunde – speziell Bluthunde – die Pheromone riechen, die bestimmte Drüsen ausschütten, wenn …«
»Bevor Michael, Jason und ich nach Spindrift aufbrachen, klagte Debbie über Krämpfe«, unterbrach sie mich. »Sie hatte ihre Periode bekommen. Könnte das eine Erklärung sein? Wenn sie auf dem Beifahrersitz saß, kann es dann nicht dieser Geruch gewesen sein, den der Hund aufnahm?«
Die Lösung, die sie anbot, rechtfertigte nicht die heftige Reaktion des Hundes.
»Nein, das reicht sicher nicht aus«, beantwortete sie ihre Frage selbst. Sie ließ den Blick ziellos herumwandern und zerknüllte ihre Serviette auf dem Schoß. »Es wäre kein Grund für einen Hund, aufzujaulen und das Fell aufzustellen. O mein Gott! Es ist wie bei den anderen Pärchen, nicht wahr?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Aber Sie glauben es! Die Polizei ist auf jeden Fall dieser Meinung – sonst wären Sie gestern nicht dorthin gerufen worden. Ich will wissen, was mit ihnen geschehen ist – mit den anderen.«
Ich antwortete nicht.
»Nach dem, was ich gelesen habe«, hakte sie nach, »waren Sie jedes Mal am Fundort – von der Polizei hinbestellt.«
»Das ist richtig.«
Sie griff in eine Tasche ihres Blazers, zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus und strich es glatt. »Bruce Phillips und Judy Roberts«, begann sie zu lesen, als gäbe sie mir eine wichtige Information. »Ein Liebespaar aus der High School, das am 1. Juni vor zwei Jahren verschwand. Sie hatten eine Freundin in Gloucester besucht und kamen nie zu Hause an. Am nächsten Morgen wurde Bruces Camaro an der U 17 gefunden. Der Schlüssel steckte im Zündschloss, die Türen waren nicht abgeschlossen, die Fenster heruntergelassen. Zehn Wochen später wurden Sie zu einem Waldstück gerufen, das knapp zwei Kilometer östlich vom York River State Park liegt, wo Jäger auf die teilweise skelettierten, mit den Gesichtern nach unten liegenden Leichen gestoßen waren – etwa sechs Kilometer von der Stelle entfernt, wo Bruces Wagen abgestellt worden war.«
Ich erinnerte mich, dass die lokale Polizei damals VICAP um Hilfe gebeten hatte. Was Marino, Wesley und der Beamte aus Gloucester nicht wussten, war, dass im Juli ein zweites Paar als vermisst gemeldet worden war – einen Monat nach dem Verschwinden von Bruce und Judy.
»Als Nächste haben wir Jim Freeman und Bonnie Smyth.« Mrs. Harvey blickte kurz auf und sah mich an. »Sie verschwanden am letzten Samstag im Juli nach einer Pool-Party bei den Freemans in Providence Forge. Spät an jenem Abend brachen Jim und Bonnie auf – er wollte sie nach Hause fahren. Am folgenden Tag fand ein Polizeibeamter aus Charles City Jims Chevrolet Blazer etwa sechzehn Kilometer vom Haus der Freemans entfernt verlassen auf – und am 12. November, dreieinhalb Monate später, entdeckten Jäger in West Point ihre Leichen …«
Es war nicht zu fassen: Sie musste über hervorragende Verbindungen verfügen! Jedenfalls bekam sie ihre Informationen offensichtlich schneller als ich: Es kostete mich jedes Mal erbitterte Kämpfe, den wahren Grund der Ermittlungen zu erfahren. Ich führte den Mangel an Kooperation darauf zurück, dass inzwischen viele Köche in diesem Brei rührten.
Mrs. Harvey fuhr fort: »Im März des folgenden Jahres ereignete sich der nächste Fall: Ben Anderson war aus Arlington gekommen, um seine Freundin, Carolyn Bennett, bei deren Eltern in Stingray Point an der Chesapeake Bay abzuholen. Kurz vor sieben machten sie sich auf die Fahrt nach Norfolk zur Old Dominion University, wo sie im ersten Semester studierten. Am Abend darauf meldete sich ein Trooper bei Bens Eltern, der ihnen eröffnete, dass der Dodge ihres Sohnes etwa acht Kilometer östlich von Buckroe Beach an der I-64 aufgefunden worden sei. Der Schlüssel steckte im Zündschloss, die Türen waren unabgeschlossen, und unter dem Beifahrersitz lag Carolyns Brieftasche. Die teilweise skelettierten Leichen wurden sechs Monate später in der Jagdsaison gefunden, in einem Waldgebiet, fünf Kilometer südlich der Route 199 in York County.«
Diesmal hatte ich nicht einmal eine Kopie des offiziellen Polizeiberichts bekommen, und als Susan Wilcox und Mike Martin im vergangenen Februar verschwunden waren, hatte ich es aus der Morgenzeitung erfahren. Die beiden waren unterwegs zum Haus von Mikes Eltern in Virginia Beach gewesen, um dort die Semesterferien zu verbringen, als sie sich, wie die Paare vor ihnen, scheinbar in Luft auflösten. Mikes blauer Kombi wurde am Colonial Parkway in der Nähe von Williamsburg entdeckt. An der Antenne war ein weißes Taschentuch befestigt – das Signal für einen Motorschaden. Der lag jedoch, wie die Polizei bei ihrer späteren Untersuchung feststellte, nicht vor. Am 15. Mai fanden ein Vater und sein Sohn auf der Truthahnjagd die verwesten Leichen in einem Waldstück zwischen der Route 60 und der I-64 in James City County.
Wieder einmal hatte ich Knochen zusammengepackt, um sie zur abschließenden Begutachtung dem forensischen Anthropologen der Smithsonian Institution in Washington zu schicken. Acht junge Menschen – und trotz der ungezählten Stunden, die ich mich mit jedem von ihnen befasst hatte, konnte ich nicht sagen, woran sie gestorben waren.
»Falls es, was Gott verhüten möge, noch ein nächstes Mal geben sollte, dann warten Sie nicht, bis die Leichen auftauchen«, hatte ich Marino gebeten. »Benachrichtigen Sie mich sofort, wenn der Wagen gefunden worden ist.«
»Okay. Sie können ja zur Abwechslung mal den Wagen obduzieren, nachdem die Leichen uns nicht weitergebracht haben«, antwortete er in einem missglückten Versuch, witzig zu sein.
»In allen Fällen«, fuhr Mrs. Harvey fort, »waren die Autotüren nicht abgeschlossen, steckte der Schlüssel im Zündschloss, gab es keinerlei Anzeichen für einen Kampf und wurde anscheinend nichts gestohlen. Der Modus Operandi war überall derselbe.« Sie faltete das Blatt zusammen und steckte es wieder ein.
»Sie sind gut informiert«, stellte ich fest. Vermutlich hatte sie die vorausgegangenen Fälle durch ihre Mitarbeiter recherchieren lassen.
»Worauf ich hinauswill, ist Folgendes«, erklärte sie, ohne auf meine Bemerkung einzugehen. »Sie waren von Anfang an dabei, haben alle Leichen untersucht, und doch wissen Sie anscheinend nicht, was zum Tod der jungen Leute geführt hat.«
»Das stimmt, ich habe keine Ahnung.«
»Wirklich nicht – oder sagen Sie das nur, Dr. Scarpetta?«
Unvermittelt konnte ich sie mir im Gerichtssaal vorstellen, wie sie einen Angeklagten durch ihre bloße Ausstrahlung an die Wand drückte. Gottlob hatte ich sie nicht gegen mich. »Ich wüsste nicht, weshalb ich das tun sollte«, erwiderte ich ruhig.
»Aber Sie glauben, dass sie ermordet wurden?« Diesmal war es eher eine Feststellung als eine Frage.
»Ich glaube jedenfalls nicht, dass junge, gesunde Menschen aus heiterem Himmel ihre Autos stehen lassen und in den Wald gehen, um dort eines natürlichen Todes zu sterben, Mrs. Harvey.«
»Und wie steht es mit den Theorien, was sagen Sie zu denen? Ich nehme doch an, dass Sie sie kennen.«
Ich kannte sie.
Vier verschiedene Gerichtsbezirke und mindestens ebenso viele Detectives arbeiteten an diesen Fällen – und jeder von ihnen hatte mehrere Hypothesen. Zum Beispiel: Die Pärchen waren Drogenkonsumenten und auf einen Dealer gestoßen, der eine neue, tückische Designerdroge verkaufte, die mit den herkömmlichen toxikologischen Tests nicht nachzuweisen war. Oder: Es gab okkulte Hintergründe. Oder: Die Pärchen waren Mitglieder eines Geheimbundes und die Todesfälle in Wahrheit die Folgen eines Selbstmord-Pakts.
»Ich halte nichts von den Theorien, die ich gehört habe«, sagte ich.
»Und weshalb nicht?«
»Meine Ergebnisse erhärten sie nicht.«
»Und was erhärten Ihre Ergebnisse?«, fragte sie scharf. »Welche Ergebnisse überhaupt? Ich denke, Sie sind zu keinen gekommen?«
Dunst hatte das leuchtende Blau des Himmels zu zartem Pastell verblassen lassen, durch das ein silbern schimmerndes Flugzeug eine weiße Spur zog. Schweigend beobachtete ich, wie der Kondensstreifen langsam zerfloss. Wenn Deborah und Fred das gleiche Schicksal erlitten hatten wie die anderen Pärchen, dann würden wir sie nicht so bald finden.
»Debbie hat Drogen niemals angerührt!« Pat Harvey blinzelte die aufsteigenden Tränen zurück. »Und sie hat auch keinen Hang zu Sekten oder irgendwelchen obskuren Kulten. Sie ist himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt wie jeder normale Teenager, aber sie würde nie …« Sie rang um Fassung.
»Sie müssen sich dem Hier und Jetzt stellen«, sagte ich leise. »So schwer das auch ist. Wir wissen nicht, was mit Ihrer Tochter passiert ist, wir wissen nicht, was mit Fred passiert ist, und es kann lange dauern, bis wir es erfahren. Können Sie mir noch irgendetwas über Deborah erzählen – über die beiden? Jede Kleinigkeit kann wichtig sein!«
»Heute Morgen kam ein Polizeibeamter«, berichtete sie mit einem tiefen, zittrigen Seufzer. »Er nahm Kleidungsstücke von ihr mit – und ihre Haarbürste. Er sagte, die Kleider seien für die Hunde, und die Bürste werde gebraucht, damit man die Haare mit denen vergleichen könne, die man vielleicht im Jeep fände. Möchten Sie Debbies Zimmer sehen?«
Ich nickte.
Über eine polierte Hartholztreppe gelangten wir in den ersten Stock. Deborahs Reich lag im Ostflügel, wo sie sehen konnte, wie die Sonne aufging oder sich über dem James River ein Unwetter zusammenbraute. Es war kein typisches Jungmädchenzimmer: die Einrichtung skandinavisch, schlicht im Design, aus herrlichem hellen Teakholz, der Überwurf des Bettes in zarten Blau- und Grüntönen gehalten, der indische Teppich in Rosé und Pflaumenblau. Im Bücherregal standen Lexika und Romane, und über dem Schreibtisch waren zwei Borde Trophäen und Dutzenden von Medaillen an leuchtenden Bändern vorbehalten. Auf dem dritten darüber eine gerahmte Fotografie von Deborah auf dem Schwebebalken, den Rücken gewölbt, die Hände in schwebender Balance wie zierliche Vögel: ein Bild der Disziplin und Eleganz – wie ihr Zimmer. Ich brauchte nicht ihre Mutter zu sein, um zu erkennen, dass dieses Mädchen etwas Besonderes war.
»Debbie hat jedes Stück selbst ausgesucht«, sagte Mrs. Harvey, während ich mich umschaute. »Die Möbel, den Teppich, die Farben. Niemand würde auf die Idee kommen, dass sie hier vor ein paar Tagen fürs College gepackt hat.« Sie blickte zu den Reisetaschen und dem Schrankkoffer hinüber, die in einer Ecke standen, und räusperte sich. »Sie ist so ordentlich. Das hat sie wohl von mir.« Und mit einem kurzen, schwachen Lächeln fügte sie hinzu: »Ich bin überaus ordentlich.«
Ich erinnerte mich an Deborahs Jeep: innen und außen makellos, das Gepäck sorgfältig verstaut.
»Ich habe mir oft Sorgen gemacht, dass wir sie zu sehr verwöhnen.« Mrs. Harvey trat ans Fenster und schaute hinaus. »Mit Kleidern, mit dem Wagen, mit Geld. Bob und ich hatten viele Diskussionen darüber. Dass ich in Washington arbeite, hat die Sache nicht gerade vereinfacht. Aber als ich letztes Jahr dorthin berufen wurde, kamen wir alle gemeinsam überein, dass es ein Unding wäre, die Familie zu entwurzeln – und Bob hat hier seine Arbeit. Wir hielten es für unkomplizierter, wenn ich mir in Washington ein Apartment nähme und an den Wochenenden heimkäme – und wir abwarteten, was die nächste Wahl bringen würde.«
Eine lange Pause folgte.
Schließlich sprach sie weiter: »Ich muss gestehen, dass es mir immer schwergefallen ist, Debbie etwas abzuschlagen. Es ist schwierig, vernünftig zu sein, wenn man das Beste für seine Kinder will, vor allem dann, wenn man sich an die Wünsche und Sorgen erinnert, die man in ihrem Alter hatte. Die Unsicherheit, was die Kleidung betraf, die Komplexe wegen der äußeren Erscheinung. Wenn man erfuhr, dass die Eltern es sich nicht leisten konnten, einen zum Hautarzt, zum Kieferorthopäden oder zum Schönheitschirurgen zu schicken. Aber wir haben uns bemüht, ein vertretbares Maß einzuhalten.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Manchmal war ich allerdings nicht sicher, ob wir die richtige Entscheidung getroffen hatten. Nehmen wir zum Beispiel den Jeep. Ich war dagegen, aber ich hatte nicht die Kraft, mich durchzusetzen. Typisch für sie, dass sie ein praktisches Fahrzeug wollte, mit dem sie bei jedem Wetter und sicher …« Sie brach ab.
Zögernd fragte ich: »Sie erwähnten vorhin das Thema Schönheitschirurgie – betrifft das Ihre Tochter?«
»Große Brüste sind unvereinbar mit Leichtathletik, Dr. Scarpetta«, antwortete sie. »Mit sechzehn war Debbie in dieser Hinsicht bereits übermäßig entwickelt. Sie litt aus zweierlei Gründen darunter: Erstens war es ihr peinlich, und zweitens behinderte es sie beim Sport. Das Problem wurde vergangenes Jahr behoben.«
»Dann ist dieses Foto erst kürzlich entstanden«, schloss ich daraus, denn die Deborah, die ich darauf sah, hatte eine perfekte Figur mit kleinen, festen Brüsten und Hinterbacken.
»Letzten April.«
Wenn ein Mensch in Kalifornien vermisst wird und möglicherweise tot ist, interessieren sich Angehörige meines Metiers zwangsläufig für anatomische Besonderheiten – sei es eine Hysterektomie oder eine Wurzelbehandlung oder sei es, dass Narben von einem kosmetischen Eingriff existieren –, die bei einer Identifizierung hilfreich sein könnten. Das waren die Punkte, auf die ich bei den Vermissten-Beschreibungen des National Crime Information Center – kurz NCIC – speziell achtete, Hinweise, auf die ich baute, denn Schmuck und anderer persönlicher Besitz lieferte, wie ich im Lauf der Jahre gelernt hatte, nicht unbedingt den gewünschten Aufschluss.
»Was ich Ihnen gerade erzählt habe, ist streng vertraulich«, erklärte Mrs. Harvey. »Debbie legt großen Wert auf ihre Intimsphäre. Wir legen alle sehr großen Wert auf unsere Intimsphäre.«
»Ich verstehe.«
»Das gilt auch für ihre Beziehung zu Fred«, fuhr sie fort. »Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, gibt es hier keine Fotos und auch sonst keine sichtbaren Symbole dafür. Ich bin sicher, die beiden haben Bilder, Geschenke und Erinnerungsstücke ausgetauscht, doch sie hat das stets geheim gehalten. Beispielsweise bemerkte ich kurz nach ihrem Geburtstag im letzten Februar an ihrem rechten kleinen Finger einen schmalen Goldreif mit Blumenmuster. Sie äußerte sich nicht dazu, und ich fragte sie nicht danach, aber ich bin überzeugt, sie hatte ihn von Fred bekommen.«
»Halten Sie ihn für einen in sich gefestigten jungen Mann?«
»Fred ist sehr gefühlsbetont, aber ich kann nicht sagen, er sei labil. Ich habe wirklich keinen Grund zur Klage. Allerdings fürchte ich manchmal, dass die Bindung zwischen den beiden zu eng sein könnte. Sie sind wie …«, sie suchte nach dem richtigen Wort, »… süchtig. Ja, das trifft es: Es kommt mir vor, als seien sie eine Droge füreinander.« Sie wandte sich ab und lehnte ihre Stirn an die Fensterscheibe. »O Gott, ich wünschte, wir hätten ihr den verdammten Jeep nie gekauft.«
Ich schwieg.
»Fred hat keinen Wagen. Sie hätte mit uns …«
»Sie hätte mit Ihnen ans Meer fahren müssen«, beendete ich den Satz für sie.
»Dann wäre sie jetzt nicht verschwunden!« Unvermittelt durchquerte sie den Raum und trat auf den Flur hinaus – als könnte sie es keine Sekunde länger im Zimmer ihrer Tochter aushalten. Ich folgte ihr die Treppe hinunter und durch die Halle. Als ich ihr die Hand hinstreckte, drehte sie ihr Gesicht zur Seite, damit ich ihre Tränen nicht sah.
»Es tut mir leid.« Wie oft würde ich diesen Satz in meinem Leben wohl noch sagen?
Als ich die Stufen hinunterging, schloss sich die Haustür leise hinter mir. Ich hoffte, dass, sollte ich Pat Harvey noch einmal begegnen, dies nicht in meiner Eigenschaft als Gerichtsmedizinerin geschähe.
3
Eine Woche verging, bis ich wieder von jemandem hörte, der mit dem Harvey-Cheney-Fall zu tun hatte. Am Montag, als ich gerade bis zu den Ellbogen in Blut steckte, rief Benton Wesley an – er wollte mit Marino und mir sprechen und lud uns zum Abendessen ein.
»Ich glaube, Pat Harvey macht ihn nervös«, sagte Marino auf der Fahrt zu Wesley. Vereinzelte Regentropfen klatschten auf die Windschutzscheibe. »Mir ist es scheißegal, ob sie sich aus dem Kaffeesatz lesen lässt oder Kontakt mit Billy Graham aufnimmt.«
»Hilda Ozimek liest nicht aus dem Kaffeesatz«, erwiderte ich.
»Die Hälfte dieser Etablissements mit der Handfläche als Zunftzeichen sind nichts anderes als Deckmäntel für Puffs.«
»Das ist mir bekannt«, antwortete ich missmutig.
Er öffnete den Aschenbecher. Rauchen war wirklich eine unappetitliche Angewohnheit. Wenn er noch einen einzigen Stummel in den Behälter quetschen könnte, käme er ins Guinness-Buch der Rekorde. »Sie haben also schon von Hilda Ozimek gehört«, sagte er.
»Eigentlich weiß ich von ihr nur, dass sie irgendwo in einem der Carolinas lebt.«
»In South Carolina.«
»Bleibt sie länger bei den Harveys?«
»Nein.« Marino stellte die Scheibenwischer ab, als die Sonne sich zwischen zwei Wolken hindurchmogelte. »Ich wünschte, das verdammte Wetter würde sich mal entscheiden. Sie ist gestern abgereist. Wurde per Privatjet nach Richmond und zurück geflogen – das muss man sich mal vorstellen!«
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir zu sagen, wie das bekannt geworden ist?« Es überraschte mich schon, dass Pat Harvey Hilfe bei einer Hellseherin gesucht hatte – aber noch mehr überraschte mich, dass sie es jemandem erzählt haben sollte.
»Es würde mir nichts ausmachen – aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Als Benton mich anrief, ließ er lediglich durchblicken, dass die gute Hilda etwas in ihrer Kristallkugel gesehen hat, das Mrs. Harvey aufs Höchste beunruhigte.«
»Nämlich?«
»Keinen Schimmer: Er hat sich nicht näher darüber ausgelassen.«
Ich gab auf. Entweder wusste er wirklich nichts, oder er wollte nichts sagen – und wenn ich Letzteres festgestellt hätte, wäre ich nur gekränkt gewesen.
Wesley und ich hatten früher gern zusammengearbeitet und einander Achtung, ja sogar Herzlichkeit entgegengebracht – doch jetzt erlebte ich ihn zugeknöpft und reserviert, und ich konnte mich des Verdachts nicht erwehren, dass sein verändertes Verhalten mit Mark James zusammenhing, mit dem ich vor anderthalb Jahrzehnten eine Beziehung geführt hatte und der vor zwei Jahren plötzlich wieder in mein Leben getreten war. Als Mark einem Ruf nach Colorado folgte, um mir künftig aus dem Weg zu gehen, gab er gleichzeitig auch seinen Job in Quantico auf, wo er die Leitung der National Academy’s Legal Training Unit des FBI innegehabt hatte. Wesley hatte damit seinen Kollegen und Partner verloren und machte wahrscheinlich mich dafür verantwortlich. Die Bindung zweier Freunde kann stärker sein als die zwischen Eheleuten, und FBI-Partner stehen mit größerer Loyalität zueinander als ein Liebespaar.
Eine halbe Stunde später verließ Marino den Highway, und kurz darauf verlor ich vor lauter Rechts- und Linksabbiegen die Übersicht auf den Straßen, die uns tiefer ins Land führten. Ich hatte mich in der Vergangenheit oft mit Wesley getroffen – aber stets in seinem oder meinem Büro. Noch nie war ich in sein Haus eingeladen worden, das inmitten der Bilderbuchlandschaft Virginias mit ihren Feldern und Wäldern, von weißen Zäunen umgebenen Weiden und weit verstreuten Scheunen und Farmhäusern lag. Als wir sein Viertel erreichten, kamen wir an langen Zufahrten vorbei, die zu großen Häusern auf weitläufigen Grundstücken führten, wo vor Zweier- und Dreiergaragen europäische Limousinen parkten.
»Ich wusste nicht, dass es so nah bei Richmond eine Washington-Schlafstadt gibt«, sagte ich.
»Was? Sie leben schon vier, fünf Jahre in dieser Gegend und haben noch nichts von der Invasion der Nordstaatler gehört?«
»Wenn man aus Miami stammt, hat man nicht ständig den Bürgerkrieg im Kopf«, erwiderte ich.
»Klar, Miami liegt ja gar nicht in diesem Land! Ein Ort, wo darüber abgestimmt wird, ob Englisch die offizielle Sprache ist, gehört nicht zu den Vereinigten Staaten.«
Marinos abschätzige Bemerkungen über meine Geburtsstadt waren nichts Neues für mich. Er bremste ab und bog in eine gekieste Zufahrt ein. »Keine üble Hütte, was?«, grinste er. »Die Bundesbehörden scheinen ein bisschen besser zu zahlen als die Stadtverwaltung.«
Das mit Holzschindeln verkleidete Haus hatte Grundmauern aus Feldsteinen und Erkerfenster. Rosenbüsche säumten die Front, Ost- und Westflügel wurden von Magnolien und Eichen beschattet. Als wir ausstiegen, schaute ich mich nach Hinweisen um, die mir Aufschluss über den Privatmann Benton Wesley geben konnten. Über dem Garagentor hing ein Basketballkorb, und neben einem mit einer Plastikplane abgedeckten Holzstoß stand ein roter Rasenmäher, an dem frisches Gras klebte. Der Garten mit Blumenbeeten, Azaleen und Obstbäumen wirkte liebevoll gepflegt. Die gemütliche Sitzecke neben dem Gasgrill weckte in mir die Vorstellung, wie Wesley und seine Frau an Sommerabenden dort an ihren Drinks nippten, während sie darauf warteten, dass die Steaks fertig würden.
Marino klingelte. Wesleys Frau öffnete. Sie stellte sich mir als Connie vor. »Ben ist kurz nach oben gegangen«, erklärte sie lächelnd und führte uns in einen Wohnraum mit rustikaler Einrichtung und offenem Kamin. Ich hatte noch nie gehört, dass jemand Wesley Ben nannte. Connie war schätzungsweise Mitte vierzig, eine attraktive Brünette mit so hellbraunen Augen, dass sie fast golden schimmerten. Ihr Gesicht erinnerte an das ihres Mannes, doch sie strahlte eine Sanftheit aus, die die Schärfe der Züge schnell vergessen ließ. Ich fragte mich, inwieweit sie mit seiner Arbeit vertraut war.
»Möchten Sie ein Bier, Pete?«, fragte sie.
Er ließ sich in einem Schaukelstuhl nieder. »Ich bin heute der Fahrer – also nehme ich lieber Kaffee.«
»Kay – was darf ich Ihnen bringen?«
»Auch Kaffee, bitte.«
»Ich freue mich so, Sie endlich kennenzulernen«, sagte sie, und sie meinte es offensichtlich ernst. »Ben hat mir schon seit Jahren von Ihnen erzählt. Er hält sehr viel von Ihnen.«
»Danke sehr.« Das Kompliment verblüffte mich – aber das Folgende traf mich wie ein Schock.
»Als wir Mark das letzte Mal sahen, musste er mir versprechen, Sie zum Essen mitzubringen, wenn er wieder in Quantico wäre.«
»Das ist nett«, brachte ich mit einem mühsamen Lächeln hervor. Wesley erzählte ihr also nicht alles. Der Gedanke, dass Mark in Virginia gewesen sein könnte, ohne sich bei mir zu melden, schmerzte fast körperlich.
Als sie hinausging, um nach dem Essen zu sehen, fragte Marino: »Haben Sie in letzter Zeit was von ihm gehört?«
»Denver ist schön«, antwortete ich ausweichend.
»Wenn Sie mich fragen – ich finde das Ganze zum Kotzen. Zuerst versetzen sie ihn nach Quantico, und dann verfrachten sie ihn für irgendeinen Geheimauftrag nach Westen. Noch ein Grund, warum man mich auch für Millionen nicht dazu brächte, bei dem Verein einzusteigen.«
Ich antwortete nicht.
»Und Privatleben gibt’s nicht«, fuhr er fort. »Der altbekannte Satz trifft’s genau: Wenn Hoover gewollt hätte, dass du Frau und Kinder hast, hätte er dir keine Dienstmarke gegeben.«
»Hoover ist doch Schnee von gestern.« Ich starrte auf die Bäume hinaus, die sich im Wind wiegten. Es sah aus, als würde es bald wieder regnen – und diesmal richtig.
»Kann schon sein – aber auch heute hat man bei dem Job kein Privatleben.«
»Haben wir das denn, Marino?«
»Stimmt auch wieder.«
Schritte kamen näher, und dann trat Wesley ein. Er war noch in »Arbeitskleidung«, eleganter grauer Anzug und dezente Krawatte zu weißem Hemd mit gestärktem Kragen. Letzteres hatte den Tag fast ohne Knitterfalten überstanden – sein Träger hingegen wirkte strapaziert. »Hat Connie Ihnen schon etwas zu trinken angeboten?«
»Unser Kaffee kommt gleich«, beruhigte ich ihn.
Er sank in einen Sessel und schaute auf seine Uhr. »Wir werden in etwa einer Stunde essen.«
»Ich habe keinen Pieps von Morrell gehört«, eröffnete Marino das Gespräch.
»Kein Wunder. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Keine brauchbaren jedenfalls.«