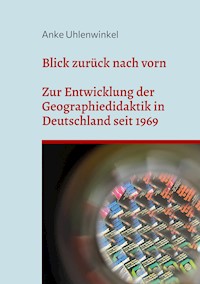
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Buch stellt die Geschichte der Geographiedidaktik im Zeitraum von 1969 bis zum Ende der 1990er Jahre dar. Es behandelt damit zugleich die Zeit der Etablierung des Faches, der Reform und des beginnenden Einschnitts in der Geschichte des Faches. Die Zeit der Etablierung wird behandelt, da die Fachdidaktiken und damit auch die Geographiedidaktik in den 1970er Jahren an deutschen Universitäten erstmals eingerichtet wurden. Die Zeit der Reform wird behandelt, da die Entstehung des Zweigs der Didaktik in der Geographie mit einer breiten Reformbewegung in der Bezugswissenschaft korrespondierte. Kulminationspunkt dieser bezugswissenschaftlichen Reform war der Kieler Geographentag von 1969, dessen Aussagen auch im Kontext der sich gerade erst etablierenden Fachdidaktik immer wieder diskutiert wurden. Das Ende der hier erzählten Geschichte fiel eher zufällig mit den großen Veränderungen im Bildungswesen zusammen: den Umorientierungen an den Schulen infolge des sogenannten PISA-Schocks und der Bologna-Reform an den Universitäten. Die Konsequenzen dieser Zäsuren für die Geographiedidaktik waren damals nicht absehbar. Heute ließen sie sich auf der Grundlage der Kenntnis der ersten drei Jahrzehnte der Fachgeschichte gut interpretieren. Diese ersten drei Jahrzehnte waren in weiten Teilen durch kontroverse Ansätze geprägt, die sich manchmal berührten und vermischt wurden, oft aber auch gegeneinander standen. Ein Zeichen für eine lebendige Wissenschaft. Wie ein roter Faden zog sich dabei die Sorge um den Bedeutungsverlust des Faches durch die Argumentationen. Mit ihr wurden die jeweils präferierten Ansätze gerne begründet. Die konträren Ansätze wurden dagegen als Gefahr für das Fach gesehen. Unabhängig von den verschiedenen Ansätzen hat es immer wieder kognitiv anspruchsvolle Vorschläge für die Durchführung von Geographieunterricht gegeben. Viele dieser Vorschläge sind aus unterschiedlichen Gründen in Vergessenheit geraten und lohnen wiederentdeckt zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
0 Vorwort
1 Eine junge Disziplin auf dem Weg ins Erwachsenenalter
2 Gute Geschichten, schlechte Geschichten und eine komplexe Geschichte
2.1 Gute Geschichten
2.1.1 Gerlachs „Rückblick auf die Entwicklung der Fachdidaktik“
2.1.2 Schultzes „Kritische Zeitgeschichte“
2.1.3 Hoffmanns „Weg der Curriculumdiskussion“
2.2 Schlechte Geschichten
2.2.1 Die Welt zu Hause – zu Hause in der Welt
2.2.2 Lebensraum Stadt
2.2.3 Die „Rettung“ der Physischen Geographie
2.2.4 Die Bedeutung des Raumes
2.2.5 Können statt Wissen
2.2.6 Entwicklung der Geographiedidaktik
2.3 Die Notwendigkeit einer komplexen Geschichte
3 Der qualitative Ansatz
3.1 Erfassung des kommunikativen Funktionsgedächtnisses
3.2 Erfassung des kulturellen Funktions- und Speichergedächtnisses
4 Die Reform
4.1 Die Akteure...
4.1.1 Eugen Ernst
4.1.2 Robert Geipel
4.1.3 Hartwig Haubrich
4.1.4 Barbara Kreibich
4.1.5 Arnold Schultze
4.2 ... und was sie bewegte
4.2.1 Diskussionen im Umfeld der Fachdidaktik
4.2.1.1 Studenten auf dem Geographentag in Kiel
4.2.1.2 Bildungspolitik und allgemeindidaktische Diskussion
4.2.2 Aufbruch der Didaktiker
4.2.2.1 Praktisch
4.2.2.2 Theoretisch
4.2.2.2.1 „Allgemeine Geographie statt Länderkunde“
4.2.2.2.2 Lernzielorientierter Geographieunterricht
4.2.3 Aufbruch der Schulgeographen
4.2.3.1 Vorsicht: Didaktiker!
4.2.3.2 Vorsicht: Gesellschaftslehre!
4.2.4 Aufbruch der Fachwissenschaftler: Die Münchener Sozialgeographie
4.2.5 Großprojekte
4.2.5.1 Schulbücher
4.2.5.2 Lehrplanempfehlungen
4.2.5.3 Das Raumwissenschaftliche Curriculum-Forschungsprojekt (RCFP)
4.2.6 Die „Schmuddelkinder“
4.3 Die 70er Jahre – eine Zusammenfassung
5 Die ruhigen 80er Jahre
5.1 Die Akteure...
5.1.1 Eberhard Kroß
5.1.2 Jürgen Newig
5.1.3 Wulf Schmidt-Wulffen
5.1.4 Helmut Schrettenbrunner
5.2 ... und was sie bewegte
5.2.1 Ende der Aufbruchstimmung
5.2.2 „Wir richten uns ein im didaktischen Haus“
5.2.2.1 Raumverhaltenskompetenz
5.2.2.2 Vom Zankapfel Topographie zum Orientierungsraster
5.2.2.2.1 Landschaftsgürtel
5.2.2.2.2 Kulturerdteile
5.3 Die 80er Jahre – eine Zusammenfassung
6 Die 90er Jahre – ein Schritt vor und zwei zurück?
6.1 Die Akteure...
6.1.1 Egbert Daum
6.1.2 Ingrid Hemmer
6.1.3 Tilmann Rhode-Jüchtern
6.2 ... und was sie bewegte
6.2.1 Im Zeichen der Wiedervereinigung
6.2.2 Erwacht aus dem Dornröschenschlaf
6.2.2.1 Raumverhaltenskompetenz - revisited
6.2.2.2 Bewahrung der Erde
6.2.2.3 Schlüsselprobleme
6.2.3 Die Schmuddelkinder kehren zurück
6.2.3.1 Konstruktivismus
6.2.3.1.1 Spurensuche
6.2.3.1.2 Perspektivenwechsel
6.2.3.1.3 Interessenforschung
6.2.3.1.4 Teilnehmerzentrierung
6.2.4 Verbandspolitik: Grundlehrplan gegen Curriculum 2000+
6.3 Die 90er Jahre – eine Zusammenfassung
7 Die Spitze des Pfeils: PISA
8 Ausblick
0 VORWORT
Die hier vorgelegte Arbeit erzählt die Fachgeschichte der Geographiedidaktik von ihren Anfängen in den 1960er und 70er Jahren bis zur Bologna-Reform. Sie ist im Sinne von Gerhard Hard keine „gute Geschichte“, denn sie läuft auf keinen zuvor bestimmten Endpunkt hinaus, sondern beschreibt die vielen verschiedenen Argumentationsstränge, die es immer schon gegeben hat und die miteinander einmal mehr, einmal weniger im Gespräch waren. Man könnte sie von daher als vielperspektivisch und nicht zuletzt in vielen Teilen auch kontrovers beschreiben – ein Merkmal für eine „schlechte Geschichte“?
Dem Text liegt meine 2006 eingereichte Habilitationsschrift zugrunde. Er wurde leicht überarbeitet. Eine Reihe von Abbildungen wurden herausgenommen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht nur, die Fotos meiner Interviewpartner. Die Publikation derartiger Fotos wäre unter heutigen Bedingungen nicht mehr opportun. Zudem lassen sich von nahezu allen Personen Bilder im Netz finden. Ebenfalls verzichtet wurde auf den Anhang, der Schulbuchseiten von Vertretern verschiedener Ansätze zeigt. Sie hatten ursprünglich einen rein illustrativen Charakter. Eine Analyse der Seiten hinsichtlich ihrer didaktischen Stärken und Schwächen, die nach wie vor reizvoll wäre, hätte den Rahmen der Habilitationsschrift gesprengt. Sie vorzunehmen sollte einem eigenen Projekt vorbehalten bleiben.
Dass dieser Text in einem großen zeitlichen Abstand zu seiner Entstehung veröffentlicht wird, verdankte sich zunächst der erzählten Geschichte, deren damalige Rezeption auf unerwarteten Unwillen stieß, der seinerseits als eine Vorstufe der heute sogenannten „cancel culture“ betrachtet werden kann. Später kamen biographische Faktoren hinzu, die für von „cancel culture“ Betroffene nicht untypisch sind. Inzwischen aber ist Zeit und Ruhe, das Projekt zu seinem gebührlichen Abschluss zu bringen.
Verbunden damit ist die Hoffnung, dass die sich inzwischen deutlicher abzeichnenden Folgen der Schulreformen nach PISA und der Bologna-Reform an den Universitäten für die Geographiedidaktik auf dem Hintergrund dieser Geschichte besser abgeschätzt werden können.
Ich danke meinen damaligen Gutachtern Wolfgang Schramke, Hans-Dietrich Schultz und Jürgen Lethmate für ihre Kommentare und Hinweise. Ich danke insbesondere Hans-Dietrich Schultz, dem es nicht gelungen war, mich von der Universität Bremen an die HU Berlin abzuwerben, dass er mich trotzdem bis heute durch alle Höhen und Tiefen mit Rat und Tat begleitet hat. Und ich danke ihm und Gerhard Hard dafür, dass sie hartnäckig darauf bestanden hat, dieses Buch doch noch zu veröffentlichen. Zudem danke ich den vielen hier nicht explizit genannten „Gefährten überall im Land“ (Taylor) und darüber hinaus. Und ich danke, um es in Heike Egners Worten zu sagen, „dem Leben, das einigen Schurken erlaubt hat, meinen eingeschlagenen Weg abrupt zu beenden“.
1 EINE JUNGE DISZIPLIN AUF DEM WEG INS ERWACHSENENALTER
Mit der Bildungsreform der 60er und 70er Jahre haben die Erziehungswissenschaften an den Universitäten in vielen europäischen Ländern einen enormen Aufschwung erfahren (Hofstetter, Schneuwly 2000, S. 9): an zahlreichen Orten wurden neue Lehrstühle errichtet und die institutionellen Rahmenbindungen für die Entwicklung dieser Wissenschaft geschaffen. In Deutschland wurden gleichzeitig auch die Fachdidaktiken eingerichtet (Merzyn 2002, S. 94). Sie standen im Prinzip vor derselben Aufgabe wie die Erziehungswissenschaften: Sie mussten sich im Umfeld der bereits existierenden Wissenschaften etablieren, d. h. sie mussten ihren Forschungsgegenstand bestimmen (Hofstetter, Scheuwly 2000, S. 4), „große“, die Disziplin übergreifende Fragestellungen entwickeln (ebd., S. →), Konzepte und theoretische Modelle erstellen (ebd., S. →), Regeln für die wissenschaftliche Arbeit definieren (ebd., S. →) und die Ausbildung des Nachwuchses organisieren (ebd., S. →f). Wie die Erziehungswissenschaften mussten sich die Fachdidaktiken dabei in zwei Spannungsfeldern bewegen, die die Disziplinen zugleich beleben und in Frage stellen konnten (ebd., S. 5). Das erste Spannungsfeld ergibt sich aus dem Verhältnis zu den anderen, bereits etablierten Wissenschaften (Merzyn 2002, S. 94f). Für die Erziehungswissenschaften sind das vor allem die „Mutterwissenschaften“ Philosophie, Psychologie und Soziologe (ebd., S. →). Für die Fachdidaktiken sind es in den meisten Fällen zunächst, und vielleicht auch nur scheinbar, die jeweiligen Fachwissenschaften – scheinbar, weil es durchaus gute Gründe dafür gibt, die Fachdidaktik als eine Erziehungswissenschaft anzusehen (vgl. Köck 1990; Jank, Meyer 2002, S. 29f; Merzyn 2002, S. 103f; Schramke, Uhlenwinkel 2002, S. 200f). Das zweite Spannungsfeld ergibt sich aus dem Verhältnis von theoriegeleiteter Forschung und praktischer Anwendung, sei es im Rahmen des Schulunterrichts oder der Bildungspolitik (Hofstetter, Schneuwly 2000, S. 6). Diese Problematik findet sich nicht nur in den Erziehungswissenschaften und den Fachdidaktiken, sie ist im Prinzip für alle Fächer kennzeichnend, besonders aber für jene, die einen direkten Bezug auf ein Berufsfeld aufweisen (ebd., S. →). Für die Geographiedidaktik kann sich dieses Spannungsfeld allerdings als zweifach problematisch erweisen, hat sich doch bereits ihre Mutterwissenschaft „in einem bestimmten Verhältnis zum Staat institutionalisiert“ (Lévy 2005, S. 135), in dem sie „die Aufgabe übernommen [hat], das staatliche Territorium zu naturalisieren und so insbesondere in der Schule an der Schaffung eines staatlichen Gemeinschaftssinnes mitzuwirken“ (ebd., S. →).
Wie haben die jungen Disziplinen ihre Etablierung gemeistert? Für die Erziehungswissenschaften in verschiedenen europäischen Ländern kommen Hofstetter und Schneuwly (2000) in einer Synopse zu ernüchternden Ergebnissen:
Es gibt kaum übergreifende Fragestellungen. Die Forschung ist fragmentiert, wobei die einzelnen Projekte oft sehr klein sind (ebd., S.
→
).
Die Forschung zeigt kaum eigenständige Theoriebildung und führt kaum zu einem verbesserten Gesamtverständnis (ebd., S.
→
).
Die Qualität der Forschung entspricht nicht den Standards der Sozialwissenschaften (ebd., S.
→
).
Die finanziellen Ressourcen sind gering (ebd., S.
→
).
Internationale Kontakte sind selten (ebd., S 10).
Die interne Nachwuchsförderung ist begrenzt (S.
→
– vgl. Merzyn 2002, S. 95).
Der Konflikt zwischen praktischer Anwendung und Theoriebildung führt eher zu Lagerbildungen als zu konstruktiven Weiterentwicklungen (Hofstetter, Schneuwly 2000, S. 10).
Diese Ergebnisse sind ernüchternd. Sie sollten aber mehr zum Nachdenken anregen als beunruhigen. Geht man davon aus, dass auch „epistemologische[.] Wendepunkte“ (Lévy 2005, S. 134) in den etablierten Wissenschaften wie etwa der „’linguistic turn’ – also das Bewußtwerden der zentralen Bedeutung von Sprache für das menschliche Handeln“ (ebd., S. →) - oft mehrere Jahrzehnte brauchen, um sich allgemein durchzusetzen, dann ist die dreißig- bis vierzigjährige Disziplingeschichte der Erziehungswissenschaften und Fachdidaktiken vergleichsweise kurz. Im Grunde genommen umfasst diese Zeit gerade eine, bestenfalls anderthalb Forschergenerationen. Da Disziplingeschichte immer von Menschen gemacht wird, ist es diese eine, erste Generation, die auch in der Geographiedidaktik für den Stand der strukturellen Etablierung des Faches verantwortlich ist.
In der Community der deutschen Geographiedidaktiker waren zu Beginn des 21. Jahrhunderts 51 Professoren aktiv, d. h. im Dienst (Schramke, Uhlenwinkel 2002, S. 193). Für 38 von ihnen stand im Laufe von weniger als 10 Jahren die Pensionierung an (ebd., S. →). Sie stellten die jüngere Gruppe der ersten Generation von Geographiedidaktikern, die die Reformen der 70er Jahre persönlich miterlebt haben, sei es als engagierte Mitarbeiter oder als distanzierte Beobachter. Die Väter dieser Reformen waren um das Jahr 2000 bereits im Ruhestand, obwohl der Altersunterschied zwischen ihnen und den Jüngeren oft nur wenige Jahre betrug.
Diese erste Generation von Geographiedidaktikern, die mit ihren Ideen, ihren Leistungen und ihren Versäumnissen im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, war aber nicht nur verantwortlich für die Ausgestaltung der strukturellen Rahmenbedingungen des jungen Faches. Ihre Aufgabe musste – zumindest implizit – auch darin bestehen, ein „Regelwerk der Bedeutungen und Symbole“ (Helbrecht 2003, S. 149) zu schaffen, mit dessen Hilfe die Identität des Faches nach innen und außen dargestellt und gefestigt werden konnte. Mittel der kollektiven Identitätsbildung sind sowohl das kommunikative als auch das kulturelle Gedächtnis (Erll 2005, S. 27). Das kommunikative Gedächtnis entsteht „durch Alltagsinteraktionen [und] hat die Geschichtserfahrungen der Zeitgenossen zum Inhalt“ (ebd., S. →). Im Rahmen der Fachdidaktik entwickelt sich das kommunikative Gedächtnis bei Tagungen, Verbandssitzungen, auf Exkursionen oder am Telefon, also überall dort, wo Fachdidaktiker aufeinandertreffen und sich „Geschichten erzählen“. Diese Geschichten müssen „keineswegs vollständig, konsistent und linear sein – sie bestehen im Gegenteil häufig aus ziemlich widersprüchlichen Fragmenten“ (Welzer 2005, S. 165f), die es den einzelnen Mitgliedern der Kommunikationsgemeinschaft erlauben, „konstruktive Verknüpfungen her[zu]stellen, die mit den tatsächlichen Ereignissen nichts oder nur wenig zu tun haben“ (ebd., S. →). Obwohl sich so jeder seine eigene Geschichte bastelt, erlaubt es die häufige Wiederholung der Erinnerung allen Kommunikationspartnern, „von der Fiktion ausgehen, sie würden über dasselbe sprechen und sich an dasselbe erinnern“ (ebd., S. →). Unter der Hand aber entsteht eine „kunstvolle Montage, zu der im Lauf der Jahre immer etwas hinzugefügt und aus der etwas anderes entfernt wird“ (ebd., S. →). Die Bedeutungszuschreibungen des kommunikativen Gedächtnisses sind somit im höchsten Grade veränderlich (Erll 2005, S. 28), sie spiegeln immer nur das wieder, was im Moment des Erinnerns als relevant angesehen wird. Im Gegensatz zum kommunikativen Gedächtnis handelt es sich beim kulturellen Gedächtnis „um eine an feste Objektivationen gebundene, hochgradig gestiftete und zeremonialisierte [...] Erinnerung“ (ebd., S. →), die „einen festen Bestand an Inhalten und Sinnstiftungen“ (ebd., S. →) transportiert. Im Rahmen der Fachdidaktik, die kaum über Denkmäler (ebd., S. →) oder institutionalisierte Feste (ebd., S.28) verfügt, artikuliert sich das kulturelle Gedächtnis vor allem in Rückblicken, Festreden, Memoranden und Lehrplanempfehlungen. Wie das kommunikative Gedächtnis ist auch das kulturelle Gedächtnis „ein retrospektives Konstrukt“ (ebd., S. →), das sich allerdings durch eine größere „Geformtheit“ (ebd., S. →), „Organisiertheit“ (ebd., S. →) und „Verbindlichkeit“ (ebd., S. →) auszeichnet.
Sowohl das kommunikative als auch das kulturelle Gedächtnis der Geographiedidaktik wird vor allem von jenen Vertretern der Geographiedidaktik geformt, die über das Umfeld der eigenen Universität hinaus über das zu verfügen scheinen, was Kotre „Generativität“ nennt (Kotre 2004). Er versteht darunter das „Bedürfnis, die eigene Substanz in Formen von Leben und Werk einzubringen, die das Selbst überleben“ (ebd., S. →). Generativität ist weder mit Kreativität (ebd., S. →) noch mit Verantwortlichkeit (ebd., S. →) gleichzusetzen, denn sie bezieht sich nicht nur auf Fertigkeiten und Überzeugungen, die weitergegeben werden sollen, sondern auch auf diejenigen - meist jüngeren - Menschen, die diese Fertigkeiten und Überzeugungen in ihr eigenes Tun integrieren sollen (ebd., S. →). Der Anteil von Menschen, die über eine solche Generativität verfügen, liegt nach amerikanischen Untersuchungen bei Männern im Alter von 47 Jahren zwischen 31 (Arbeiter) und 41 (Harvard-Absolventen) Prozent (ebd., S. →), bei Harvard-Absolventen im Alter von 60 Jahren sogar bei 83 Prozent (ebd., S. →).
Die generativen Vertreter der ersten Geographiedidaktiker-Generation haben, besonders dann, wenn sie die Bühne verlassen, mit einem Problem zu tun, das per Definition in ihrem Weg angelegt ist: sie müssen loslassen lernen (ebd., S. →) und mit den Resultaten ihrer Bemühungen umgehen können, auch und gerade dann, wenn die junge Generation ihre Ideen und Vorstellungen auf eine ganz eigene Art weiterentwickelt (ebd., S. →). An dieser Stelle wird die Beschäftigung mit der jüngeren Geschichte des Faches zukunftsrelevant, denn die jüngere Generation, die im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts auf die Professorenstellen nachrückt, muss sich „im Kontext von Deutungen und Gegendeutungen selbst einen Weg zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (...) suchen, um eine eigene professionelle Identität zu entwickeln“ (Schultz 2004a, S. 186 – Herv. i. O.) und womöglich selbst einen generativen Weg einzuschlagen. Dazu ist es kaum hilfreich, die „’wahre’ und einzig ‚richtige’ Geschichte“ (ebd., S. →) der Geographiedidaktik zu erzählen, an deren „Ende die gegenwärtigen Fachdidaktiker stehen“ (ebd., S. →). Vielmehr muss es darum gehen, die unterschiedlichen Interessen und Interpretationen der einzelnen Fachvertreter aufzuzeigen und Spielräume deutlich zu machen (ebd., S. →). Diese Freiräume zu erkennen und für die eigene Entwicklung zu nutzen, ist die Aufgabe der Jüngeren.
Tab. 1: Einige gesellschaftliche Eckpunkte in der Geschichtlichkeit dreier Geographiedidaktiker2 (Quellen: Geburtsjahre aus: Dittmann, 2001; historische Ereignisse ausgewählt aus: Die interaktive Jahrhundert-Chronik, 2001, ergänzt durch: Baratta 2002, Sp. 847 und Sp. 1040; 2003, Sp. 1084 und 1117; 2004, S. 10, 13, 18 und 178; Ehlers 1996, S. 338; Know-Library 2005; ZDF 2005)
Beide – sowohl die ältere als auch die jüngere Generation – müssen sich bei dem Prozess der Weitergabe und Weiterentwicklung von Ideen der eigenen Geschichtlichkeit (Hentig 1996, S. 85) oder Historizität (Mayring 2002, S. 34) bewusst sein. In der Geschichtlichkeit des eigenen Seins sieht von Hentig „eine gern verdrängte Realität“ (ebd. S. →), die sich weder durch ein ausgeprägtes „Geschichtsbewusstsein“ (ebd., S. →) noch durch „Geschichtswissen“ (ebd., S. →) erhellen lasse. Vielmehr bezeichnet er mit Geschichtlichkeit „die
Schwierigkeit, Identität im Wandel zu erkennen und die Chance für Veränderung und Vielfalt in der Geltung von bleibenden Gesetzen“ (ebd., S. →f). Ein Bewusstsein der eigenen Geschichtlichkeit beinhaltet für ihn sowohl die bewusste Reflexion des eigenen Lebenskontextes (ebd., S. →) als auch ein „Bewusstsein von epochalen Veränderungen in der Welt durch Fernsehen und Computer, Gentechnik und Atomenergie“ (ebd., S. →). Schon bei einer überaus oberflächlichen Betrachtung der Geschichtlichkeit von Geographiedidaktikern als Geschichtlichkeit verschiedener Generationen zeigen sich deutliche Schwierigkeiten für Verständigungsprozesse zwischen Positionen, „die keine einfache Kausalität [haben], sich auch nicht aus mehreren Kausalitäten zusammensetzen [lassen]“ (ebd., S. →), sondern in den jeweiligen Lebensgeschichten gewachsen sind (ebd., S. →). Hartwig Haubrich, dessen Kindheit in die Jahre des Nationalsozialismus fällt, vermutet in seinen Erinnerungen, dass diese Zeit „für die heutige Generation ein Leben auf einem anderen Stern“ (Haubrich 2004) bedeute. Trotz der unfraglich düsteren deutschen Geschichte fallen in diese Jahre aber auch Entdeckungen, Erfindungen und Hervorbringungen, die bis heute Menschen weltweit faszinieren oder für sie nützlich sind, sei es nun der Bau der Golden Gate Bridge, die Entdeckung der Höhlen von Lascaux oder die Entwicklung des Farbfilms. Alle diese Dinge gehörten für die nachfolgende Generation bereits zur unhinterfragten Umgebung. Diese erste Nachkriegsgeneration erlebte in ihrer Jugend die Verbreitung des Massenmedium Fernsehens, das für die darauffolgende Generation genauso zum alltäglichen Umfeld gehörte wie die Gastarbeiter, die inzwischen nach Deutschland gekommen sind. Jede Generation ist somit in je eigene gesellschaftspolitische Umstände eingebunden, erlebt die gleichen gesellschaftspolitischen Umstände in einem anderen Lebensalter. Jeder einzelne Vertreter der verschiedenen Generationen wiederum erlebt diese Bedingungen aufgrund unterschiedlicher Lebensumstände und Erfahrungen anders und in der Regel „völlig einmalig“ (ebd., S. →).
Die Identität eines Faches wird von der Geschichtlichkeit und Generativität seiner Vertreter geprägt. Um es den nachwachsenden Geographiedidaktikern möglich zu machen, ihren jeweiligen Standort zu definieren, bedarf es aber auch einer komplexen Geschichte, die über das derzeitige Funktionsgedächtnis des Faches hinausgeht, das „als formatives Selbstbild das Leben bestimmt und dem Handeln Orientierung gibt“ (Assmann 1999, S. 134f). Natürlich ist auch eine komplexe Geschichte das Konstrukt des jeweiligen Autors, denn die „historischen Zusammenhänge werden nicht ge funden, sonders er funden, sie liegen nicht schon vor, sondern sie entstehen erst in der Werkstatt des Historikers“ (Schultz 2004a, S. 182 – Herv. i. O.). Dieses Konstrukt ist allerdings bereits die Beobachtung der Beobachtung, ein „Gedächtnis zweiter Ordnung, ein Gedächtnis des Gedächtnisses, das in sich aufnimmt, was seinen vitalen Bezug zur Gegenwart verloren hat“ (Assmann 1999, S. 134). Ob die komplexen Geschichten am Ende gut sind oder nicht, das hängt zwar auch davon ab, ob sie ihrem Gegenstand gerecht werden (ebd., S. →), vor allem aber geht es darum, Geschichten zu erzählen, die „in sich kohärent und widerspruchsfrei sind, ein Lektürevergnügen bieten und eine fruchtbare (nicht etwa wahre) Perspektive auf die Vergangenheit eröffnen“ (ebd., S. →f – Herv. i. O.).
In dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, eine solche komplexere Geschichte zu erzählen. Bevor ich das tue, möchte ich allerdings zunächst kurz betrachten, welche Geschichten das kulturelle Gedächtnis des Faches bisher bereithält – und welche eher nicht.
1 In diesem ersten Jahr beförderte die Deutsche Lufthansa 74.000 Passagiere – so viele wie 2005 an einem durchschnittlichen Vormittag (ZDF 2005).
2 Gut 70 Lebensjahre auf einige „repräsentative Eckdaten“ zu reduzieren, kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Selbst Günter Grass (1995) kann rund 150 Jahre deutscher Geschichte nicht in weniger als 37 Geschichten verdichten; es ist eben ein „weites Feld“. Und der Fischer Weltalmanach nennt in seiner Jahreschronik für den Zeitraum von Juli 2004 bis Juni 2005 allein 122 Ereignisse (Baratta 2005, S. 10-21). Deswegen habe ich hier „auf den Anspruch intendierter Vollständigkeit“ (Brieske, Fieberg 2006, S. 46) verzichtet und eine Auswahl getroffen, die vielleicht gerade aufgrund des Fehlens von erwarteten Ereignissen zum Nachdenken anregt (ebd., S. 46). Ausgewählt wurden sowohl Ereignisse, die zu Veränderungen des Alltags, aber auch der fachlichen – geographischen wie pädagogischen - Sichtweisen führen konnten, als auch Ereignisse, die selbst von allgemein interessierten Erwachsenen oft kaum wahrgenommen werden, obwohl ihnen in bestimmten Wissenschaften eine große Bedeutung zukommt. Daneben finden sich einige, aber nicht zu viele politische Eckdaten, die die Einordnung erleichtern sollen.
2 GUTE GESCHICHTEN, SCHLECHTE GESCHICHTEN UND EINE KOM-PLEXE GESCHICHTE
Als 1978 auf einer Tagung in Münster eine erste Bilanz zu den Reformen seit dem Kieler Geographentag 1969 gewagt werden sollte, wies Hard (1979) mit Blick auf die Fachwissenschaft darauf hin, dass Geographen, besonders dann, wenn sie „sich zur Methodologie und Geschichte ihrer Disziplin äußern“ (Hard 1979, S. 14), dazu neigten, „gute Geschichten zu erzählen“. Unter einer „guten Geschichte“ verstand er dabei unter Bezug auf Schreier eine Geschichte, „die die anerkannten Werte bestätigt und die herrschende Ordnung als die beste erscheinen lässt“ (Schreier 1978, S. 90f; zit. n. Hard 1979, S. 14). Dabei könne es vorkommen, dass zur gleichen Zeit auffallend unterschiedliche „gute Geschichten“ erzählt werden, die „keineswegs konsistent zu sein brauchen“ (Hard 1979, S. 14), denn ein Autor, der sich um die „gute Geschichte“ der Geographie bemühe, schreibe zunächst einmal auf, „was sie für ihn bedeuten soll“ (ebd., S. →). Besonders bei Autoren, die die Geschichte des Faches selbst eine Zeitlang mitgemacht haben, also generativ tätig waren, werde aus der Fachgeschichte sehr schnell eine autobiographische Geschichte – und solch eine Geschichte unterliegt „im hohen Grade der ‚retrospektiven Fälschung’“ (Bartels, Hard 1975, S. 3), denn sie ist immer geprägt vom „eigentlichen Interesse des Gedächtnisses: das Selbst mit Sinn zu versorgen“ (Kotre 1998, S. 110). In der Geographiedidaktik wurden solche „guten Geschichten“ in Form von „Bilanzen“ schon Mitte bis Ende der 70er Jahre publiziert (Schultze 1979a, S. 2; 1979b, S. 69; vgl. dazu auch Schramke 1981a, S. 186). Sie haben allesamt daran gearbeitet, dem damaligen Stand der Geographiedidaktik aus der Perspektive des jeweiligen Autors heraus „Legitimation, Identität, Sinn und Logik“ (Hard 1979, S. 15) zu verleihen und damit das Fundament für die jeweils gewünschte weitere Entwicklung zu legen.
2.1 GUTE GESCHICHTEN
Schramke vermutete schon zu Beginn der 80er Jahre, dass die „guten Geschichten“ der Geographiedidaktik aus „zwei deutlich verschiedenen Interessenlagen heraus und von Mitgliedern wenigstens zweier Fach-‚Fraktionen’ vorgelegt“ (Schramke 1981a, S. 186) worden seien. Das Motiv der einen, eher länderkundlich orientierten Fraktion sei dabei gewesen, die für das Fach als schädlich angesehene Reformphase für abgeschlossen zu erklären, um „in eine neue, ‚ordentlichere’, ‚gemäßigtere’ oder konservativere Epoche der Geographiedidaktik aufbrechen zu können“ (ebd., S. →). Die andere Fraktion, in der sich viele aktive Reformer befanden, habe dagegen das Interesse gehabt, dass „gesichtet und gesichert werden (solle), was eigentlich die Reform des Geographieunterrichts sollte, was sie erreichte und welche Reform-Essentials es zu verteidigen“ (ebd., S. →) gelte. Ihnen sei es bei der Formulierung ihrer Texte auch darum gegangen, „den Gruppenzusammenhang in der Reform-Gemeinde angesichts einer deutlichen Abkühlung des ‚Reform-Klimas’ zu stärken“ (ebd., S. →). Wenn in den nächsten Kapiteln nicht nur zwei, sondern drei „gute Geschichten“ vorgestellt werden, dann deshalb, weil die Lage im Nachhinein doch nicht so einfach zu sein scheint: Neben der Diskussionslinie „Allgemeine Geographie statt Länderkunde“ gab es mindestens noch den Ansatz der Lernzielorientierung, der sich nicht eindeutig einer der beiden Richtungen zuordnen lässt. Darüber hinaus spiegelte sich zumindest in einer der hier vorgestellten Geschichten auch noch eininstitutioneller Machtkampf (vgl. Kap. 2.1.3), der sowohl in der Auseinandersetzung um die Inhalte als auch in der Diskussion um die didaktischen Ansätze ausgefochten wurde. Die Reform-Gemeinde war alles andere als ein geschlossenes Lager, sondern sie war zersplittert in einzelne Fraktionen, die alle versucht haben, ihre jeweiligen Bemühungen als die einzig „folge-richtige Ordnung“ (Schramke 1981a, S. 186) darzustellen. Dabei haben sie ihre Geschichten zwar aus zum Teil sehr ähnlichen Versatzstücken zusammengesetzt, deren Wirkungen aber unterschiedlich gedeutet. Wieso im Endeffekt doch auffallend unterschiedliche Erzählungen entstehen, soll an den „guten Geschichten“ von Gerlach (1977), Schultze (1979a; 1979b) und Hoffmann (1978) gezeigt werden.
2.1.1 GERLACHS „RÜCKBLICK AUF DIE ENTWICKLUNG DER FACHDI-DAKTIK“
Die Bilanz von Gerlach (1977), damals Professor an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, gehört zu den ersten Rückblicken, die Ende der 70er Jahre veröffentlicht wurden. Interessant daran ist, dass Gerlach weder in der Reformphase noch danach durch allzu große aktive Mitarbeit an der geographiedidaktischen Entwicklung aufgefallen ist: In der Bibliographie von Schramke (1983) und in der Datenbank Schulpraxis 2001 (Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 2001) findet sich nur ein weiterer geographiedidaktischer Beitrag von ihm: „Der Bauboom im Oberengadin“ (Gerlach 1980), in dem „die Auswertungssendung3 einer Geographiestunde mit Schulfunkeinsatz (...) wörtlich abgedruckt“ ist (Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 2001) und der „ohne Literaturangaben“ auskommt (Schramke 1983, S. 309). Auch in der Liste der Mitarbeiter am RCFP (Fürstenberg 1980, S. 14f) lässt sich der Autor nicht finden. Gerlach selbst zitiert in seinem Rückblick lediglich einen weiteren eigenen Aufsatz: „Die Großstadt als Thema eines fächerübergreifenden Erdkundeunterrichts“ von 1967 (Gerlach 1977, S. 38). Welche gute „gute Geschichte“ konnte solch ein „stiller Beobachter“ über die Reform erzählen?
Für Gerlach begann die Reform bereits an der „Wende von den fünfziger zu den sechziger Jahren“ (Gerlach 1977, S. 35). Ausgangspunkt: das Problem der Stofffülle, das auch im Erdkundeunterricht unübersehbar geworden sei. Die Fachdidaktik habe mit „bisweilen äußerst konträren Positionen“ (ebd., S. →) auf das Problem reagiert. Diese Positionen ließen sich grob zwei Grundansätzen zuordnen: Dem der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und dem der „Öffnung gegenüber den empirischen Sozialwissenschaften“ (ebd., S. →). Die geisteswissenschaftliche Pädagogik zeichne sich vor allem dadurch aus, dass sie „ihre Bildungsgüter vor dem Hintergrund verbindlicher anthropologischer Leitbilder auswählte“ (ebd., S. →)4, während die stärker an den Erziehungswissenschaften orientierten Ansätze sich dadurch auszeichneten, dass sie die „Erkenntnisse über Verhaltensnormen und Verhaltensweisen in der heutigen Gesellschaft für die Formulierung von Zielen und Inhalten des Unterrichts“ (ebd., S. →) nutzten.
Zum Ansatz der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zählte Gerlach sowohl die am exemplarischen Prinzip orientierten Vorstellungen von Schultze, Schüttler und Wocke (ebd., S. →), als auch die Bemühungen z. B. von Geipel oder Fick, neue, allgemeingeographische Stoffe in den Geographieunterricht aufzunehmen. Schultze, Schüttler und Wocke hätten in ihren Ansätzen „die intensive Sachdurchdringung an einzelnen überschaubaren, wenn auch unterschiedlich gearteten Raumbeispielen“ (ebd., S. →) gefordert und „den Wert fachspezifischer Erkenntnisse gegenüber extensiver Stoffaneignung“ (ebd., S. →) betont. Dazu hätten sie die Inhalte des Erdkundeunterrichts „nach Schwierigkeits-graden“ (ebd., S. →) eingestuft. Der konventionellen Stoffanordnung „vom Nahen zum Fernen“ sei so „eine klare Absage“ (ebd., S. →) erteilt worden. Auch Geipel und Fick hätten die Absicht gehabt, „facheigene Methoden auch als Verfahrensweisen jener Wissenschaft bewusstzumachen, die den verwickelten Beziehungen zwischen Raum und Gesellschaft nachgeht“ (ebd., S. →). Ihr Hauptanliegen sei allerdings gewesen, sich der Herausforderung durch neu eingeführte Integrationsfächer wie Gemeinschaftskunde oder Arbeitslehre zu stellen (ebd., S. →), indem sie neue, allgemeingeographische Inhalte aufbereiteten und versuchten, ihre „besondere Eignung als fächerübergreifende Unterrichtsgegenstände möglichst deutlich herauszuarbeiten“ (ebd., S. →). Zu diesen Inhalten hätten u. a. „die Probleme der modernen Großstadt, des Verkehrs, der Industrie, auch der heutigen Agrarlandschaft“ (ebd., S. →) gezählt.
Im Rahmen dieses Ansatzes empfand Gerlach die „prononciert vorgetragene Position Schultzes“ (ebd., S. →) als besonders kritisch: Er habe die „Bedeutung des Begrifflich-Kognitiven für die geographische Bildung des Schülers“ (ebd., S. →) überbetont und argumentiert, dass das Einzige, „was sich tatsächlich exemplarisch erarbeiten ließe, (...)‚ das kategoriale Grundgefüge ‚der Geographie‘, (...) der Wirklichkeitsaspekt dieser Wissenschaft als fundamentale Erfahrung und ‚Struktureinsicht’5“ (ebd., S. → – Herv. A. U.) sei. Dieser Vorschlag habe „in jenem 1970 von demselben Autoren veröffentlichten Konzept [gegipfelt], nach dem die dem Fach eigenen Kategorien und Strukturen als das Nicht-Singuläre und demzufolge allein Übertragbare nur an allgemeingeographischen Exempeln erschließbar“ (ebd., S. → – Herv. A. U.) seien.
In der zweiten Hälfte der 60er Jahre sei es dann zunächst in den Erziehungswissenschaften zu „einer allgemeinen Abwendung von jener bildungstheoretischen Konzeption“ (ebd., S. →) gekommen. Der eigentliche Umschwung in der Geographiedidaktik habe mit der Rezeption der 1967 erschienenen Curriculumtheorie Robinsohns eingesetzt. Robinsohns Forderung sei es gewesen, Unterricht nicht länger an „durch Tradition sanktionierten Bildungszielen“ (ebd., S.
36) oder am „auf unreflektierter Konvention basierenden Wissenskanon“ (ebd., S. →) auszurichten, sondern an den Qualifikationen, die der Schüler für die Bewältigung späterer Lebenssituationen benötigte. Mit dieser Forderung sei die Vorstellung einher gegangen, dass für diese Aufgabe die traditionellen Fächer nicht mehr nötig seien – eine Annahme, die die Vertreter der Geographie ebenso wie die Vertreter anderer Fächer zu entkräften versuchten: „Es war vor allem Geipel (vgl. 1968) zu verdanken, dass sich die Fachdidaktik sehr bald dem allgemeinen Auftrag gestellt und um den Nachweis bemüht hat, dass auch und auf welchem Wege gerade der Geographieunterricht dem Schüler helfen kann, sein Leben heute und morgen zu meistern und jene Verhaltensdispositionen zu entwickeln, die zugleich als gesellschaftlich notwendig erachtet werden“ (ebd., S. →). Hauptaufgabe sei es dabei zunächst geworden, „den Unterricht auf allen Stufen an differenzierte Lernziele zu binden“ (ebd., S. →). Bald habe man allerdings erkennen müssen, dass es nicht gelingen könne, fachliche Lernziele aus übergeordneten Lernzielen zu deduzieren. Als Folge habe man sich auf die Formulierung fachlicher Lernziele beschränkt (ebd., S. →). Dabei seien vor allem die Vorstellungen der Münchener Sozialgeographie hilfreich gewesen, mit deren „Daseinsgrundfunktionen als Suchinstrument und Relevanzfilter“ (ebd., S. →) die Lebenssituationen, für die der Geographieunterricht qualifizieren könne, bestimmt werden konnten. Ergebnis der Diskussion sei es, dass „die Sachverhalte der Allgemeinen Geographie, am regionalen Beispiel aufgezeigt, in Zukunft auf allen Schulstufen eine beträchtliche Rolle spielen werden“ (ebd., S. →). Der Länderkunde billige man „mittlerweile nur noch einige, jedoch nachdrücklich unterstrichene Bedeutung als geographische Methode zur ‚Gesamtfaktorenschau’ zu. (...) Die Zuweisung regionalgeographischer Themen an die oberen Klassen der Sekundarstufe I und II, an denen nach neuesten Konzepten Einsichten in die komplexen Strukturen von ausgewählten Staaten und Wirtschaftsräumen und deren Wandel erarbeitet werden sollen, weist genau in diese Richtung“ (ebd., S. →).
Für Gerlach hat die Geschichte so einen guten Ausgang genommen: Mit der Ausrichtung des Unterrichts an Lernzielen ist „das Problem der stofflichen Alternativen endgültig in den Hintergrund gedrängt worden“ (ebd., S. →). Die „radikalen Forderungen der Studenten auf dem Kieler Geographentag, wonach die Länderkunde, weil angeblich unwissenschaftlich, problemlos und konfliktverschleiernd, ‚abgeschafft’ werden müsse“ (ebd., S. →), seien damit ebenso vom Tisch wie die Position Schultzes (ebd., S. →). Die Länderkunde habe sich über die Wirren der Reform einen – wenn auch nicht mehr den unumstritten einzigen - Platz im Geographieunterricht erhalten können. Gleichzeitig bestehe auch „Einigkeit (...) darüber, dass zur Einfügung der behandelten Einzelobjekte in die größeren räumlichen Zusammenhänge wie zum Zurechtfinden auf der Erde dem Schüler in Zukunft globale Orientierungsraster und Ordnungssysteme dienen sollen, die neben einem kontinuierlich auszuweitenden topographischen Wissen fest in dessen Vorstellung zu verankern sind“ (ebd., S. →).
Die dieser „guten Geschichte“ zugrunde liegende Kernaussage dürfte allerdings etwas anders lauten: Gerlach ging es nicht in erster Linie um eine – wenn auch nur teilweise - Rettung der Länderkunde. Das Bedrohliche war nicht die allgemeine Geographie an sich; bedrohlich war eher die von Schultze erhobene Forderung nach „begrifflich-kognitivem“ Verstehen. Ein theoretisch fundierter Unterricht, der auf begründete Einsichten zielte, schien ihm offensichtlich viel beunruhigender als ein wenig beschreibende allgemeine Geographie, die sich in den älteren Schulbüchern ja durchaus auch schon finden ließ6. Um diesen Anspruch an wissenschaftspropädeutisches Denken und Arbeiten abzuwenden, kam die Lernzielorientierung gerade recht: sie erlaubte durch die teilweise Lösung von der sich ebenfalls im Wandel befindenden Fachwissenschaft Geographie eine Tradierung konventioneller Inhalte im Schulfach Geographie.
2.1.2 SCHULTZES „KRITISCHE ZEITGESCHICHTE“
Im Gegensatz zu Gerlach zählt Schultze zu den prominentesten und – wie man an Gerlachs „guter Geschichte“ sehen kann - umstrittensten Vertretern der Reform. Mit seinem Aufsatz „Allgemeine Geographie statt Länderkunde!“ (Schultze 1970a) hatte er in der Fachdidaktiker- und Schulgeographengemeinde für einige Unruhe gesorgt. Knapp 10 Jahre später zog er eine „kritische Bilanz“7 (Schultze 1979b, S. 78) der Reformjahre. Trotzdem bezeichnete Schramke (1981, S. 189) Schultzes Erzählung schon kurz nach ihrem Erscheinen als „gute Geschichte“, die sehr breit rezipiert worden sei8 und „vermutlich vielen Seminaren und Prüfungsvorbereitungen zum Thema ‚Geschichte der Geographiedidaktik in der BRD’ zugrundegelegt“ werde (Schramke 1981a, S. 187). Dass diese Geschichte heute immer noch gerne erzählt wird, verdankt sich vermutlich auch dem Umstand, dass Schultze einer der wenigen damaligen Bilanz-Autoren ist, der seine Geschichte - wenn auch in Teilen verändert - immer wieder neu aufgeschrieben und publiziert hat (Schultze 1996b; Schultze, 1998). Ein weiterer Grund mag darin liegen, dass der Zeitpfeil (vgl. Abb. 1), mit dem Schultze seine Bilanz in der Geographischen Rundschau illustrierte, einen kontinuierlichen Fortschritt des Faches suggerierte9.
Pfeildarstellungen wie diese haben immer das grundsätzliche Problem, dass sie in ihrer „graphischen Eindimensionalität und textlichen Formelhaftigkeit “ (Schultz 2004b, S. 45 – Herv. i. O.) blind sind „für Durchdringungen, Überblendungen, von der herrschenden Meinung Bekämpftes und Verdrängtes, für Vorläufer oder Wiedergänger, die es alle gegeben hat und gibt“ (ebd., S. →). Dementsprechend zeigte auch Schultzes Pfeil auf der inhaltlichen Ebene 1970 einen markanten und unwidersprochenen Umschwung von der Länderkunde zur allgemeinen bzw. exemplarischen bzw. thematischen Geographie. Auf der methodischen Ebene stellte er einen Umschwung vom exemplarischen Erdkundeunterricht zur Lernzielorientierung fest. Als Gründe für diese Umschwünge wurden diverse inhaltliche, methodische und pädagogische Impulse aufgeführt, die in verschiedenen Pfeilformen auf den „breiten Kontinuitätsfluss“ (Schramke 1981a, S. 188) einwirkten. Offen blieb dabei, woher diese Innovationen stammten, warum sich manche von ihnen durchsetzten und andere nicht, und wenn sie sich durchsetzten, warum gerade diese zu dieser Zeit (Daum 1980b, S. 343; 1980c, S. 57; Schramke 1981a, S. 188). Für das Verständnis des hinter dem Pfeil steckenden Konstrukts scheint es allerdings auch interessant herauszufinden, warum das „Exemplarische“ mit dem Umschwung von 1970 aus der „Methodik“-Zeile in die „Inhalt“-Zeile wechselte.
Abb. 1: Schultzes Pfeildarstellung der Fachgeschichte (Quelle: Schultze, 1979a, S. 3)
Im Text erklärte Schultze die im Pfeil dargestellte Zäsur im Jahre 1970 mit dem Zusammenwirken verschiedener Ansätze, die in den Jahren zuvor sowohl in der Pädagogik als auch in der Geographiedidaktik diskutiert worden waren:
1. Schon vor 1960 seien Geographiedidaktiker von den Vorstellungen zum exemplarischen Prinzip erreicht worden (Schultze 1979a, S. 3), das sie beeindruckt habe, weil sie darin „eine Chance [sahen], die Stoffmenge zu reduzieren“ (ebd., S. 3). Der besonders vom Physikdidaktiker Martin Wagenschein entwickelte Ansatz des exemplarischen Prinzips zielte darauf, Schüler durch die Beobachtung von konkreten Gegenständen die zugrundeliegenden allgemeinen Gesetze selbst erarbeiten zu lassen (Wagenschein 1965, S. 81) und dabei auch die Methoden der Erkenntnisgewinnung zu reflektieren (Wagenschein 1956, S. 20f). Dieses Vorgehen – so Schultze - setze aber Gegenstände voraus, aus denen sich auch exemplarisch elementare Einsichten gewinnen ließen. Die Länderkunde mit ihrem idiographischen Ansatz habe solche Gegenstände nicht bieten können: „Erst mit der Hinwendung zum allgemeingeographischen Konzept lösten sich die Widersprüche auf“ (Schultze 1979a, S. 3).
2. Ebenfalls in den Jahren vor 1970 habe „eine Reihe engagierter Lehrer“ (ebd., S. 3) begonnen, an Unterrichtsprogrammen zu arbeiten. Deren Ursprung war – anders als Wagenscheins Ansatz vom exemplarischen Prinzip - in den Vorstellungen des Behaviorismus zu suchen (Jander 1982, S. 290; Jank, Meyer 1991, S. 297). Aus der Grundstruktur der Programme, die meistens aus vier Bausteinen (der Information, der Frage, der Antwort durch den Schüler und der Antwortbestätigung) bestanden, ergab sich ein überaus kleinschrittiges Vorgehen (Jander 1982, S. 290), bei dem der Schüler zwar entsprechend seinem individuellen Lerntempo voranschreiten konnte (ebd., S. →), aber im Grunde nur Fakten und exakt beschreibbare Fertigkeiten lernte (ebd., S. →). Auch dieser Ansatz schien für Schultze ein Schritt in die richtige Richtung, denn einige der Autoren der geographischen Unterrichtsprogramme hätten schon bald gemerkt, „dass Länderkunde sich schwer oder gar nicht programmieren lässt, dass allgemeingeographische Themen sich dagegen aufbauend programmieren lassen“ (Schultze 1979a, S. 3).
3. Die 1967 von Robinsohn formulierte Forderung, dass die Schule Kinder und Jugendliche für die Bewältigung zukünftiger Lebenssituationen zu qualifizieren habe und dass geprüft werden müsse, was die einzelnen Fächer dazu leisten könnten, habe bei den Geographiedidaktikern eine solche Unruhe bezüglich des Stellenwertes ihres Faches ausgelöst, dass sie sich sehr zügig den Anforderungen der neuen Theorie gestellt hätten. Schon vor 1970 hätten sie Begriffe wie „Lernziele“ und „Lernzielorientierung“ aufgenommen, ohne sie jedoch mit Inhalt füllen zu können: „Als Anfang 1970 das allgemeingeographische Konzept neue theoretische Klarheit brachte, da war damit auch die Tür offen für die Idee der Lernzielorientierung“ (ebd., S. →).
Auf der Fachdidaktikertagung in der Reinhardswaldschule 1968 hätten die Vertreter der Münchener Sozialgeographie und eine Mitarbeiterin Robinsohns eine „Affinität der beiden Ansätze“ (ebd., S. →) entdeckt. Ausschlaggebend sei das von der Münchener Sozialgeographie entwickelte Konzept der Daseinsgrundfunktionen (arbeiten, wohnen, sich versorgen, sich bilden, sich erholen, am Verkehr teilnehmen und in Gemeinschaft leben) gewesen, das die Forderung Robinsohns, die Schüler sollten für die Bewältigung von „Lebenssituationen“ qualifiziert werden, mit einem geographischen Inhalt füllte. Geipel und andere Sozialgeographen hätten diese Impulse aus der Curriculumtheorie aufgenommen und sie in die Fachdidaktik hineingetragen (ebd., S. →).
Auffallend an diesen 1970 zusammenfließenden „Strömungen“ ist, dass drei der vier Konzepte in einer wissenschaftstheoretischen Tradition standen (vgl. Abb. 2). Diese Tradition ging von einem „empirisch-analytischen Wissenschaftsverständnis“ (Jank, Meyer 1991, S. 297) aus. Dagegen stand ein Konzept, nämlich das des exemplarischen Lernens, in der Tradition der bildungstheoretischen Didaktik (ebd., S. →). Dieses eine Konzept war 1970 Ausgangspunkt für Schultzes Forderung nach allgemeingeographisch orientiertem Unterricht (Schultze 1970a, S. 1); die allgemeine Geographie bildete für ihn geradezu „das Korrelat zum exemplarischen Prinzip“ (ebd., S. →). Diese enge Verbindung zwischen Inhalt und Methode drückte er bereits damals in dem Begriff „allgemeingeographisch-exemplarischer Unterricht“ (ebd., S. →) aus. In der Rückschau am Ende der 70er Jahre gab ihm dieser zusammengesetzte Begriff die Möglichkeit, den methodischen Wandel auf einer anderen Ebene zu formulieren, als Gerlach (1977) es in seiner „guten Geschichte“ tat: nicht weg von der länderkundlichen Stoffhuberei hin zum „Begrifflich-Kognitiven“, sondern vom exemplarischen Prinzip zur Lernzielorientierung. Damit kann er die behavioristisch orientierten Strömungen nicht nur in seine „gute Geschichte“ integrieren, er kann die Hinwendung zur Allgemeinen Geographie sogar zum Schlüssel für die Durchsetzbarkeit all dieser Strömungen machen.
Abb. 2: Didaktische Landkarte „Unterrichtskonzepte“ (Quelle: Jank, Meyer, 1991, S. 294)
Warum aber sollte Schultze sein eigenes Licht „allgemeine Geographie“ derart unter den Scheffel „Lernzielorientierung“ stellen? Die Antwort dürfte in der schon von Schramke (1981 S. 188 – vgl. Fußnote 7) zitierten Einschätzung Schultzes liegen, „dass der ‚Karren der Reform’ ins Stocken geraten ist“ (Schultze 1979a, S. 2). Dieses Stocken auf die Durchsetzung der allgemeinen Geographie zurückzuführen, ergäbe aber keine „gute Geschichte“. Folgerichtig schloss Schultze in der Bilanz, dass es die Lernzielorientierung sei, die „bisher nicht den erhofften Erfolg gebracht“ (ebd., S. →) habe. Dafür konnte er eine Reihe von Gründen anführen:
1. Robinsohn sei davon ausgegangen, dass es oberste zu definierende Lernziele gebe, aus denen die Fachinhalte quasi abgeleitet werden könnten. Diese Position habe Ernst übernommen und versucht, aus dem Richtziel „Emanzipation“ die Lernziele des Faches herzuleiten (vgl. Ernst 1970, S. 189). Der Zusammenhang zwischen Richt- und Groblernzielen sei aber „keineswegs so dicht und logisch konsequent (...), wie damals geglaubt wurde“ (Schultze 1979a, S. 5).
2. Die Unterscheidung von kognitiven und instrumentalen Lernzielen - von Ernst in die Diskussion eingeführt - sei falsch (vgl. Meyer, Oestreich 1973, S. 214). Instrumentale Lernziele wie Kartenlesen seien in Wirklichkeit kognitive Lernziele. Mit der Unterscheidung zwischen den beiden Lernzieltypen werde die „neue pädagogische Theorie (verbogen), bis sie auf die in der Geographie übliche, uralte Unterscheidung von Inhalten und ‚Techniken’ passt“ (Schultze 1979a, S. 6).
3. Die Formulierung affektiver Lernziele habe bisher nur auf einer sehr allgemeinen Ebene stattgefunden. Besonders Ernst neige dazu, sie einfach in der Formulierung „’Fähigkeit (= kognitiv) und Bereitschaft (= affektiv)’“ (ebd., S. →) zu koppeln.
4. Das „radikale Umdenken von den Inhalten des Unterrichts zu den Qualifikationen des Schülers“ (ebd., S. 5) werde an vielen Stellen nicht gemeistert. Viele Lehrer und Didaktiker bemerkten nicht, dass es bei der Lernzielformulierung um die Begründung statt nur um die Nennung von Inhalten gehe (ebd., S. 5). Diese Begründungen müssten außerhalb des Faches, nämlich in der Lebenswelt der Schüler gewonnen werden, weswegen „an sich“ wichtige Themen nicht unbedingt auch im Unterricht behandelt werden müssten (ebd., S. →).
Mit dieser eigentlich „schlechten“ Geschichte war Schultzes gute „gute Geschichte“ gerettet. Die Lernzielorientierung, die bei Gerlach noch als Rettung der Länderkunde erschien, hat aus Schultzes Perspektive die Chance, die in der Wende zur allgemeinen Geographie gelegen habe, nicht genutzt. Sie hat stattdessen lauter ungeklärte Probleme hinterlassen, während die allgemeine Geographie weiter an der Spitze des Entwicklungspfeils steht und darauf wartet, dass ihr Potential entfaltet wird.
2.1.3 HOFFMANNS „WEG DER CURRICULUMDISKUSSION“
Hoffmann (1978), ein engagierter Fachleiter aus Bremen (Feller 1993, S. 9), der u. a. Mitglied des „Neu-Isenburger-Kreises“ (ebd., S. →) und des Lenkungsausschusses des RCFP war (Geipel 1978a, S. 15), würde die Geschichten von Gerlach und Schultze vermutlich beide für schlechte „gute Geschichten“ halten, in denen Meinungsunterschiede „als eine rein innerfachliche Angelegenheit aufgefasst (werden), als ob es sich nur um einen ‚Schulenstreit’ unter Fachkollegen handelte“ (Hoffmann 1978, S. 47). Dabei gehe es vor allem darum, den „jahrzehntealten Konsens“ (ebd., S. →) über die „Grundmuster der Lehrpläne“ (ebd., S. →), der durch äußere Bedingungen in Gefahr geraten sei, in neuer Form wiederherzustellen. Die Geschichte, die aus dieser Sicht der Dinge erzählt wurde, war im Grunde genommen weder eine gute „gute“ noch eine schlechte „gute“, sondern eine „unendliche Geschichte“.
Es mag sein, dass eine Bedingung für solch eine unendliche Geschichte schon in der langen, reihenden Aufzählung der unterschiedlichen bildungspolitischen und wissenschaftstheoretischen Veränderungen (ebd., S. →f.) gegeben war, auf die mit einem neuen Lehrplan reagiert werden sollte:
1. Die Einführung des Fachs Gemeinschaftskunde in der Oberstufe (Saarbrücker Rahmenvereinbarung von 1960).
2. Der Aufbau von Gesamtschulen, die sich oft „vom traditionellen Fächerkanon lossagten“ (ebd., S. →) und stattdessen integrierte Lernbereiche ins Leben riefen.
3. Die Lehrplan-Revisionen durch die Kommissionen der jeweiligen Kultusministerien, die sich an dieser Fächerintegration ausrichteten.
4. Die Diskussion über Inhalte und Methoden in der allgemeinen Pädagogik, die mehr als zuvor auch auf die Fächer übergriff.
5. Die Didaktik der politischen Bildung, die auch auf das eigenständige Fach Geographie einwirkte.
6. Die Veränderung in der Fachdidaktik der Geographie selbst: Aufgabe des Anordnungsprinzips „vom Nahen zum Fernen“, exemplarisches Prinzip und Diskussion über Begriffe und Arbeitsweisen.
7. Die Veränderungen innerhalb der Fachwissenschaft Geographie: wissenschaftstheoretische Grundlegung, Prioritäten der Forschung, Berücksichtigung der Ergebnisse der Gesellschaftswissenschaften, quantitative Forschungsmethoden.
8. Neue Bereiche der beruflichen Anwendung der Geographie.
Die ersten Bemühungen um eine angemessene Reaktion auf all diese Veränderungen sah Hoffmann in einer Sitzung des Geographentages in Bad Godesberg 1967, wobei er vorweg feststellte, dass „die Jahreszahl 1967 (...) anscheinend ein willkürliches Datum“ (ebd., S. →) sei, da es „auch vorher allerlei Bemühungen um eine bessere didaktische Grundlegung des Geographieunterrichts gegeben“ (ebd., S. →) habe. Das Besondere an Bad Godesberg sei aber, dass hier die Stadtgeographie als „eine wichtige inhaltliche Komponente“ (ebd., S. →) in den Vordergrund gerückt worden sei. Ebenso seien „Sozialgeographie und prozessuale Betrachtungsweise akzeptiert“ worden (ebd., S.48). Diese wichtigen „Stoßrichtungen kommender Aktivitäten“ (ebd., S. →) seien in den zwei Folgejahren bis zur historischen Sitzung auf dem Kieler Geographentag „konsequent aufgebaut“ (ebd., S. →) worden. Zur Weiterarbeit auf dieser Grundlage seien dort vom Vorstand des Verbandes Deutscher Schulgeographen drei Arbeitskreise eingerichtet worden („Grundsatzfragen des Schulfaches Geographie“, „Lehrpläne“ und „Ausbildung der Geographielehrer“), die zunächst „nur durch eine lose Korrespondenz in Verbindung“ (ebd., S. →) geblieben seien. In Hoffmanns weiterer Erzählung kam dabei dem Arbeitskreis „Lehrpläne“, der zu diesem Zeitpunkt aus drei Personen bestand (ebd., S. →) und an dem er selbst beteiligt war, eine besondere Rolle zu. Zunächst habe es in dem Arbeitskreis drei verschiedene Ansätze oder auch nur Perspektiven gegeben:
1. Jonas, der Fachleiter in Göttingen war (Jonas 1970, S. 212), habe ein Konzept vorgestellt, das für die Sekundarstufe I vor allem einen an der allgemeinen Geographie orientierten Unterricht vorsah, der in der 11. Klasse um die länderkundliche Perspektive erweitert werden sollte, bevor die Schüler dann in den Jahrgangsstufen 12 und 13 in Gemeinschaftskunde unterrichtet würden (Hoffmann 1978, S. 49).
2. Hoffmann selbst habe sich zum einen an der von Robinsohn, Klafki u. a. geführten allgemein-didaktischen Diskussion und zum anderen an den fachwissenschaftlichen Diskussionen um die Sozialgeographie orientiert (ebd., S. →). Er habe „eine orientierende Einführung in Karte und Globus“ (ebd., S. →) und eine „stärkere Berücksichtigung der Begriffe und Arbeitsweisen im Lehrplan“ (ebd., S. →) vorgeschlagen.
3. B. Kreibich habe „eine Fülle von einzelnen Anregungen“ aus dem amerikanischen „High School Geography Project (HSGP)“ und der Arbeit an der TU München eingebracht.
Zu Beginn der 70er Jahre habe es mehrere äußere Anlässe (Veröffentlichung der Beiträge von Schultze, Hendinger und Ernst in der Geographischen Rundschau, Ergebnisse der Arbeit an den „Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre Sekundarstufe I“ des Landes Hessen) gegeben, die den Verband Deutscher Schulgeographen dazu veranlasst hätten, die Arbeit in den Arbeitskreisen zu intensivieren. Dies sei unter anderem bei drei Treffen in Neu-Isenburg geschehen (ebd., S. 52). In Neu-Isenburg trafen sich deutlich mehr Kollegen, als zuvor in den Arbeitskreisen tätig waren, so dass wiederum neue Konzepte in die Diskussion eingeflossen seien: Jonas habe jetzt einen lernzielorientierten Ansatz verfolgt, Hoffmann und Kreibich hätten den sozialgeographischen Ansatz ausgebaut. Richter habe seinen Entwurf für die Orientierungsstufe „streng nach den Daseinsgrundfunktionen“ gegliedert (ebd., S. →); Bauer, Kirchberg und Schultze hätten Überlegungen zur Stufengliederung vorgestellt (ebd., S. →). Von diesen Vorschlägen hätten sich im Laufe der Diskussion die Ansätze von Bauer und Hoffmann / Kreibich als ernsthafte Alternativen herauskristallisiert.
Bereits zu Beginn des nächsten Jahres habe es erneut ein Ereignis gegeben, das den Arbeitskreis dazu zwang, seine Tätigkeit nochmals zu intensivieren: Die Konzeption und Beantragung des Raumwissenschaftlichen Curriculum-Forschungsprojekts unter Federführung von Geipel stellte sich „für den Arbeitskreis (...) jedenfalls (...) als Termindruck dar“ (ebd., S. →). Der verbindliche Lehrplanentwurf, der jetzt entstehen sollte, sei in der Eile allerdings eher auf einen Konsens hinausgelaufen, der „von allerlei Zufälligkeiten mitbestimmt wurde“ (ebd., S. →). Trotzdem war hiermit die Arbeit des „Neu-Isenburger-Kreises“ abgeschlossen.
Allerdings erwies sich bald, dass die Geschichte hier noch nicht zu Ende war, denn die Lehrplankommissionen der Bundesländer seien mit dem Konsens nicht zufrieden gewesen (ebd., S. →), da er immer noch keinen „didaktisch abgesicherten, einigermaßen ausdiskutierten Gesamtplan“ (ebd., S. →) erbrachte habe. Sie hätten ihre jeweils eigenen Pläne erstellt, und es habe ein “Auseinanderdriften der Schulgeographie“ gedroht (ebd., S. →). Um dies zu verhindern, sei auf einer Tagung 1972 in Köln abermals ein „Orientierungsrahmen“ (ebd., S. →) erstellt worden, der „neben Begriffen, Arbeitsweisen, Lernzielen und Verhaltensdispositionen auch die räumliche Anordnung der Beispiele und Fallstudien“ (ebd., S. →) erfassen wollte. Zu Beginn des Jahres 1975 sei es dann zu einem erneuten Treffen gekommen, diesmal zwischen den Vertretern der Lehrplankommissionen aller Bundesländer (ebd., S. →). Bei diesem Treffen wurde ein neuer Konsens formuliert, der als „Empfehlung zu Richtlinien und Lehrplänen für Geographie im Sekundarbereich I (Klassen 5-10)“ (VDSG 1975) publiziert wurde. Auch dieser Plan habe wieder „Kompromisscharakter“ (ebd., S. →) und „theoretische Schwächen“ gehabt (ebd., S. →), aber man dürfe „an das Endergebnis der Verbandsbemühungen nicht jede theoretische Elle anlegen“ (ebd., S. →), denn es gebe einen „Unterschied zwischen der Forschungsund Lehrtätigkeit eines pädagogischen Universitätsinstituts und den freiwilligen Wochenendbemühungen von Verbandsarbeitskreisen“ (ebd., S. →f). Immerhin, das scheint für Hoffmann die gute Nachricht zu sein, habe der Verband – wieder einmal – eine allgemein verbindliche Richtlinie formuliert und damit den Geographieunterricht weitergebracht.
Die „gute Geschichte“, die dieser Erzählung zugrunde lag, lässt sich eigentlich nur in Bezug auf die reale oder scheinbare Definitionsmacht für das Schulfach Geographie verstehen. Bis zur Einrichtung geographiedidaktischer Lehrstühle an den Universitäten lag diese Definitionsmacht vor allem beim Verband Deutscher Schulgeographen als dem alleinigen Vertreter der schulischen Fachinteressen. Als in den 60er und 70er Jahren immer mehr professionelle Fachdidaktiker an den Universitäten begannen, ihre Vorstellungen vom Fach zu formulieren, musste der Verband um seine Definitionsmacht fürchten. Folgerichtig engagierte er sich vor allem in der Lehrplanarbeit. Und auch wenn die so formulierten Lehrpläne eher laienhaft waren, so waren sie doch die des Verbandes.
2.2 SCHLECHTE GESCHICHTEN
Neben den offiziell erzählten „guten Geschichten“ gibt es in der Entwicklung der Geographiedidaktik auch eine ganze Menge schlechter Geschichten. „Schlecht“ erscheinen diese Geschichten vor allem deswegen, weil die jüngeren Bemühungen um das Schulfach Geographie – sei es nun durch die Lehrerschaft oder die Didaktiker – die Entwicklungen in der Gesellschaft ebenso zu ignorieren oder sogar zu konterkarieren scheinen wie den Stand der Forschung in der zugehörigen Fachwissenschaft und in der Pädagogik. In Bezug auf die Fachwissenschaft führt das dazu, dass man selbst von angehenden Studierenden „immer wieder mit dem veralteten und höchst unvollständigen Bild einer Stadt-, Land-Fluss-Erdkunde konfrontiert“ (Baade, Gertel, Schlottmann 2005, S. 30) wird, das „den heutigen Auffassungen zum Gegenstand und zur Methodik der wissenschaftlichen Geographie“ (ebd., S. →) kaum gerecht wird. In Bezug auf die Pädagogik sieht man sich hehren Zielformulierungen gegenüber, obwohl unübersehbar ist, dass „die vormals vorgenommen Ableitungen von Unterrichtsinhalten aus gesellschaftlich vorgegebenen Normen [...] heute angesichts der Vielzahl pluraler Entwürfe nicht mehr aus[reichen]“ (Scheunpflug 2001b, S. 14). Oft werden dabei tatsächliche Errungenschaften der Reformjahre – und seien es nur erste Schritte gewesen – dem Vergessen preisgegeben. Das Strickmuster dieser Geschichten ist häufig ebenso einfach wie das der guten Geschichten: Aufgrund von Veränderungen im gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Umfeld kommt ein Autor in den Reformjahren zu der Aussage, dass sich der Geographieunterricht oder die Geographiedidaktik darauf in Zukunft einstellen müssten. Fünfundzwanzig bis dreißig Jahre später – die Gesellschaft oder die Wissenschaft haben sich so weiterentwickelt, wie der Autor vermutet hat – findet sich bei modernen Autoren genau die Vorstellung wieder, gegen die sich der Alt-Autor zuvor gewendet hatte. Solche Geschichten erscheinen manch einem Schulgeographen oder Geographiedidaktiker vielleicht als gut, in ihrem gesellschaftspolitischen oder fachwissenschaftlichen Umfeld müssen sie allerdings als zumindest anachronistisch erscheinen.
2.2.1 DIE WELT ZU HAUSE – ZU HAUSE IN DER WELT
Der an der Länderkunde ausgerichtete Geographieunterricht konnte lange Zeit davon leben, für einen großen Teil der Bevölkerung die wichtigste Informationsquelle über andere Weltengegenden zu sein. In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde diese Monopolstellung immer mehr in Frage gestellt: Zunächst probehalber konnten 4000 Haushalte am 26. 11. 1952 die erste „Tagesschau“ empfangen (Weber 2001, S. 79). Knapp zwei Jahre später, am 1. 10. 1954, begann die Ausstrahlung des ARD-Fernsehprogramms (ebd., S. 79). Durch die Gründung des ZDF am 6. 6. 1961 wurde dieses Angebot um ein weiteres Programm ergänzt (ebd., S. →). Die Anzahl der Haushalte mit Fernsehgerät stieg in den nächsten neun Jahren von etwa 4 Millionen (1961) auf über 15 Millionen (Schildt 2001, S. 8). Da es sich beim Fernsehen um ein vor allem visuelles Medium handelt, wurden Informationen so für ein breites Publikum – vom Kind über den einfachen Arbeiter bis zum Akademiker - zugänglich (Postman 1987, S. 94). Aber die Welt wurde den Menschen nicht nur nach Hause gebracht, immer mehr Deutsche begannen auch, die Welt selbst zu erkunden: „Die Inlandsreisen der Bundesdeutschen stiegen von 9,8 Mill. 1962 auf 18 Mill. 1973, die Auslandsreisen von 6,2 auf 18,5 Mill.“ (Armanski 1978, S. 13), womit zu Beginn der 70er Jahre die Zahl der Auslandsreisen auch im Vergleich zur Zahl der Inlandsreisen kräftig angestiegen war. Immer mehr Menschen in Deutschland bekamen so die Möglichkeit, sich anders als über den Schulunterricht über fremde Länder zu informieren oder diese sogar persönlich kennen zu lernen.
Angesichts solcher Veränderungen verwundert es von daher kaum, wenn Hendinger zu Beginn der 70er Jahre fragte, ob die „Länderkunde im Zeitalter moderner Massenmedien (Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen, populäre Sachbücher) als Informationsquelle und bei dem zunehmenden Abbau räumlich-zeitlicher Distanzen durch moderne Verkehrswege und ständige Geschwindigkeitserhöhung noch eine genügende Lernmotivation für den Schüler“ (Hendinger 1970, S. 158) biete und Gerlach auch am Ende der Reformphase noch forderte, „das Schema der konzentrischen Kreise durch einen Modus der Stoffverteilung zu ersetzen, der nicht mehr im Widerspruch zu den soziologischen wie psychischen Bedingungen ‚moderner Weltaneignung’ steht“ (Gerlach 1977, S. 35; vgl. Haubrich 1984b, S. 524; Daum 1990, S. 18). Die aus diesen Feststellungen gezogenen Folgerungen für den Unterricht lagen auf der Hand: Man konnte sich nicht länger darauf konzentrieren, den Schülern Länder oder geographische Gegenstände näher zu bringen. Die Gegenstände waren schon da. Jetzt kam es eher darauf an, die Informationen ordnen und erklären zu können (vgl. Haubrich 1984b, S. 520). Dafür erschien ein an allgemeingeographischen Fragestellungen orientierter Lehrplan geeigneter als ein an der Länderkunde orientierter Plan.
In den zwei Jahrzehnten, die auf die „guten Geschichten“ der Bilanzen folgten, hat sich einiges mehr verändert. Nicht nur, dass es seit dem 1. 1. 1985 mit SAT1 das erste private Fernsehprogramm gab (Baumann u. a. 2001, Sp. 776), was in der Folgezeit die Wahlmöglichkeiten für die Zuschauer erheblich erhöht hat. 1990 starteten dazu täglich weltweit 55.000 Flugzeuge, mit denen 1,2 Billionen Passagierkilometer zurückgelegt wurden (Gruppe von Lissabon 1997, S. 33), und die WTO schätzte die Zahl der Auslandsreisen für das Jahr 2000 weltweit auf etwa 684 Millionen (Baratta 2001, Sp. 1247). Hinzugekommen ist aber vor allem auch ein globales Netzwerk persönlicher Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten. Während 1965 85% der Telefonleitungen weltweit in Europa und Nordamerika verlegt waren, hatten 30 Jahre später 190 Länder Zugang zum Telefonnetz (Cohen, Kennedy 2000, S. 253). Viele ländliche Gebiete, besonders in den ärmeren Ländern, deren Anschlusskosten ans Telefonnetz als zu hoch erschienen, sind heute – zumindest, wenn es sich die Einwohner leisten können - mit dem Handy erreichbar (Aden 2000, S. 66; Cohen, Kennedy 2000, S. 253). Statt der lediglich 89 Gespräche, die das einzige transatlantische Telefonkabel 1965 zur gleichen Zeit übermitteln konnte, konnten 1995 etwa 1 Million über Kabel- und Satellitennetzwerke übertragene Gespräche gleichzeitig geführt werden. Und die Kosten für diese Gespräche sind rapide gesunken: Ein Drei-Minuten-Gespräch über den Atlantik kostete 1965 noch 90 Dollar, 1995 dagegen nur 3 Dollar (Cohen, Kennedy 2000, S. 252). Parallel zu den Möglichkeiten persönlicher Kommunikation ist durch die Einrichtung des Internets auch der persönliche Zugriff auf Informationen erleichtert und beschleunigt worden. Und obwohl an dieses Informationsnetz im Jahr 2002 nur 9,8% der Weltbevölkerung, vor allem in den USA, Europa sowie Ost- und Südostasien, angeschlossen waren (Baratta 2003, Sp. 1308), waren die Zuwachsraten doch beträchtlich, wenn man bedenkt, dass 7 Jahre zuvor lediglich 2 % der Weltbevölkerung über einen Internetzugang verfügten (Cohen, Kennedy 2000, S. 254).
Diese technischen Veränderungen haben „wichtige Konsequenzen für das gesellschaftliche Zusammenleben“ (Werlen 2000, S. 23), wobei im hier diskutierten Zusammenhang die Erweiterung der „potentiellen und tatsächlichen Aktionsreichweiten“ (ebd., S. →) des Einzelnen von besonderem Interesse ist (vgl. Abb. 3). Dabei kommt es auf der einen Seite zu einer „Ausdehnung des Bereichs der unmittelbaren Erfahrung“ (ebd., S. →), wobei dieser Bereich auf der anderen Seite aber nicht mehr in sich geschlossen ist. Verschiedene Autoren konstatieren deshalb eine „Verinselung“ von Aktivitäten (Eickhorst 1998, S. 26; vgl. Daum 1990, S. 19; Schramke 1999a, S. 12; Sieverts 2001, S. 91), die Entstehung von „unsichtbaren Territorien“ (Reutlinger 2003, S. 133 – vgl. Daum 1990, S. 19) oder eine „Ortspolygamie“ (Beck 1997, S. 129). Die Verinselung bezieht sich vor allem auf Aktivitäten, denen in verschiedenen Teilräumen der Wohnumgebung nachgegangen wird: im Supermarkt, im Schwimmbad, in der Reitschule oder bei Freunden. Die Räume zwischen diesen Aktivitätsräumen werden von den Nutzern dieser „Inseln“ möglichst schnell überwunden und kaum wahrgenommen (Daum 1990, S. 19; Eickhorst 1998, S. 28; Sieverts 2001, S. 92). Unsichtbare Territorien werden dort gebildet, wo mittels Handys „unsichtbare soziale Netze von Jugendlichen über eine Stadt gesponnen werden“ (Reutlinger 2003, S. 133), die es ihnen erlauben, ohne Ko-Präsenz an den Aktivitäten anderer teilhaben zu können (ebd., S. →). Auch unterstützt von diesen unsichtbaren Territorien kann Ortspolygamie entstehen, wenn jemand „Grenzen getrennter Welten – zwischen Nationen, Religionen, Kulturen, Hautfarben, Kontinenten usw. – überschreitet und deren Gegensätze in einem Leben beherbergen muss oder darf“ (Beck 1997, S. 129). Das kann sowohl innerhalb einer Stadt geschehen, als auch einen beständigen Ortswechsel zwischen weit entfernten Orten bedeuten. Beides führt dazu, dass emotionale Nähe nicht unbedingt in der unmittelbaren Nähe, sondern über weitere Distanzen hergestellt werden kann und wird (Beck 1997, S. 130; Vielhaber, 2003a, S. 2). Für den Geographieunterricht bedeutet das, „dass die Barrieren niedrig geworden sind, weil die Ferne sich uns förmlich aufdrängt – selbst in unserer Nähe“ (Kroß 1991a, S. 43). Die Zeiten, in denen „die Annäherung an die Ferne ein didaktisches Problem war“ (ebd., S. →), sind somit endgültig vorbei.
Abb. 3: Veränderung der Aktionsreichweiten (Quelle: Werlen, 2000, S.25; nach Thrift, 1996, S. 42)
Angesichts dieser gesellschaftlichen Entwicklungen verwundert es nicht, wenn Kroß meint, man könne „den Eindruck haben, dass die Entwicklung nicht linear verläuft, sondern eher zirkulär“ (Kroß 1991b, S. 11). Denn bereits Mitte der 90er Jahre stellte Schultze in seiner Einleitung zu den „40 Texten zur Didaktik der Geographie“ fest, dass einige Bundesländer „ihre allgemeingeographischlernzielorientierten Richtlinien (revidieren) und zu länderkundlichen Konzepten zurück(kehren)“ (Schultze 1996b, S. 31). Diese „neuen“ Richtlinien „orientieren sich in ihrem Aufbau wie in der Zeit vor 1970 wieder am Prinzip vom Nahen zum Fernen und sehen von Klasse 5 bis 10 eine Stoffanordnung in konzentrischen Kreisen vor – mit dem eigenen Bundesland als ‚Heimat’ im Zentrum“ (Kroß 1991b, S. 11).





























