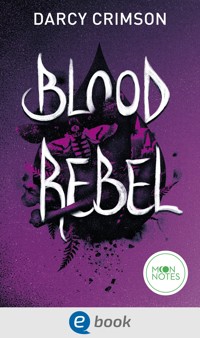
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Never trust a Vampire Cara ist Anfang zwanzig, lebt in Neapel und ist ein absoluter Freigeist. Als sie mit ihren Freund*innen auf eine illegale Untergrundparty in den Katakomben eingeladen wird, sagt sie also sofort zu. Inmitten der unterirdischen Gänge und Kammern begegnet Cara nicht nur vielen seltsamen Gestalten, sondern auch der mysteriösen Kisa. Die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen und ihr gemeinsamer Tanz endet in einem intensiven Kuss, der Cara atemlos zurücklässt. Als sie schließlich die wahren Absichten der Fremden durchschaut, ist es längst zu spät: Kisa beißt zu und trinkt von ihrem Blut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über dieses Buch
NEVER TRUST A VAMPIRE
Cara ist Anfang zwanzig, lebt in Neapel und ist ein absoluter Freigeist. Als sie mit ihren Freund*innen auf eine illegale Untergrundparty in den Katakomben eingeladen wird, sagt sie also sofort zu. Inmitten der unterirdischen Gänge und Kammern begegnet Cara nicht nur vielen seltsamen Gestalten, sondern auch der mysteriösen Kisa. Die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen und ihr gemeinsamer Tanz endet in einem intensiven Kuss, der Cara atemlos zurücklässt. Als sie schließlich die wahren Absichten der Fremden durchschaut, ist es längst zu spät: Kisa beißt zu und trinkt von ihrem Blut.
Für alle, die einen Regenbogen im Herzen tragen.
Dieses Buch ist für euch. Für uns.
Prolog
Blutrotes Licht fließt über das Vulkangestein. Fauliger Gestank verbeißt sich in meiner Nase, und die allgegenwärtige Kälte überzieht meine Arme mit einer Gänsehaut. Ich streiche mit den Fingerkuppen über die rauen Tunnelwände und kann immer noch nicht ganz begreifen, dass ich tatsächlich hier bin.
Schon von Kindesbeinen an wurde mir eingebläut, dass ich mich von dem unerforschten Labyrinth unterhalb meiner Heimatstadt besser fernhalten soll. In Neapel sagt man, die Katakomben bedeuten nichts als Ärger. Das Betreten der Bereiche außerhalb der Touristen-Hotspots ist nicht ohne Grund strikt verboten. Woche für Woche ist die Polizei damit beschäftigt, Unruhestifter aus den Tunneln zu vertreiben oder verschollene Jugendliche wiederzufinden. Denn nicht jeder, der sich in das Untergrundreich hinabwagt, schafft es zurück an die Erdoberfläche. Die Menschen tendieren dazu, das wirre Geflecht aus unterirdischen Kammern und Stollen zu unterschätzen. Einmal falsch abgebogen, verliert man die Orientierung und verirrt sich in den scheinbar endlosen Windungen.
Ich habe eigentlich immer geglaubt, ich wäre schlau genug, um mich von solch einer Gefahr fernzuhalten. Aber eigentlich war ja klar, dass es genau deshalb irgendwann passieren musste.
»Habt ihr schon mal eine Untergrundparty besucht?«, fragt der hochgewachsene Fremde über seine Schulter hinweg, während er mich und meine Freundin selbstsicher durch die verästelten Gänge führt.
Ich verneine knapp, woraufhin ein schmales Lächeln an seinen Lippen zupft. »Wie aufregend«, raunt er und schiebt seine in zwei runde Gläser eingefasste Sonnenbrille zurecht. Wieso zum Teufel trägt jemand an einem Ort wie diesem eine Sonnenbrille? Kommt er sich hier unten nicht lächerlich damit vor? Ich runzle die Stirn.
»Keine Sorge, wir sind gleich da«, meint er schließlich und richtet seinen Kopf wieder nach vorn.
Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Kerl. Ich kann nicht genau zuordnen, was mich so an ihm stört, aber da ist etwas in seinem Wesen … etwas Lauerndes. Liegt es an seinen fließenden Bewegungen, die den knielangen Mantel, der seine Glieder wie nachtschwarze Tinte umspielt, kaum zum Rascheln bringen? Seinem herausfordernden Tonfall? Oder doch an etwas ganz anderem?
»Mir ist nicht wohl bei der Sache«, murmle ich meiner besten Freundin Franca zu, die knapp hinter mir durch den Tunnel eilt und versucht, mit uns Schritt zu halten. Sie schnauft lautstark, und obwohl ich sie nicht direkt ansehe, erahne ich, wie sie übertrieben die Augen verdreht.
»Stell dich nicht so an, du Spaßbremse. Jetzt ist es sowieso zu spät, um umzukehren«, entgegnet sie.
Die Naivität in ihren Worten schockiert mich beinahe. Hat sie wirklich gar keine Bedenken? Nimmt sie die komische Ausstrahlung des Fremden überhaupt nicht wahr?
»Es steht euch natürlich jederzeit frei, zu gehen, vorausgesetzt, ihr findet den Ausgang«, erklärt der Mann mit einem Grinsen, das uns einen Blick auf seine spitzen Zähne gewährt.
Sofort weiß ich, woran er mich erinnert. An ein Raubtier auf der Jagd. Er lockt und lauert, bevor er uns mit einem gezielten Biss erlegen wird. Selten habe ich mich so unwohl gefühlt wie in diesem Moment. Wie Beute, die nur darauf wartet, angegriffen zu werden.
Der Fremde hat uns bereits zu Beginn unseres Abstiegs in diese Unterwelt erklärt, dass alle Gäste erst zum Ende der Party wieder nach draußen geführt werden. Vor einer Stunde klang das alles nach einer coolen Idee, aber jetzt … Was haben wir uns dabei gedacht, einem Unbekannten in die Katakomben zu folgen? Und dazu noch für eine illegale Untergrundparty. Wir hatten wirklich schon bessere Einfälle.
Plötzlich höre ich aus der Ferne leise Klänge. Mit jedem Schritt wird die Musik lauter und der Bass stärker. Bald wummern die Vibrationen durch den Boden direkt in meine Knochen bis hinauf in mein Herz. Mein Puls beschleunigt sich im Takt der Melodie, sobald ich die Silhouetten anderer Menschen entdecke. Sie drängen sich in die Höhle, lehnen rauchend an den Tunnelwänden oder ziehen sich in die Ausbuchtungen der Gänge zurück. Allein der Anblick anderer Menschen erleichtert mich. In der Masse sind wir sicher. Zumindest glaube ich das.
»Eine letzte Warnung, bevor ich euch verlasse«, meint der Fremde mit einem Mal und wendet sich nun vollständig in unsere Richtung. Durch seine dunkle Kleidung wirkt er wie ein lebendiger Schatten in unserer Mitte.
»Bleibt möglichst in der Nähe der Haupthöhle. Wir wollen ja nicht, dass sich jemand verirrt oder Schlimmeres passiert, richtig? Schließlich sind wir alle hier, um ein bisschen Spaß zu haben.« In seinen Worten schwingt ein drohender Unterton mit, der mich rätseln lässt, was wohl schlimmer sein könnte, als sich in einem unterirdischen Labyrinth zu verlaufen und niemals wieder herauszufinden.
Trotzdem reagiere ich nicht auf die Warnung, im Gegensatz zu Franca, die eifrig nickt. Sie glüht förmlich vor Euphorie und tritt nervös von einem Fuß auf den anderen. Bestimmt stürzt sie sich gleich in die Menge und vergisst innerhalb von drei Sekunden, dass ich mich an ihrer Seite befinde. Das sähe ihr ähnlich.
»Dann wünsche ich euch beiden viel Vergnügen.« Mit diesen Worten kehrt uns der Fremde den Rücken zu.
Ich blinzle einmal, und schon ist er in der Menschenmasse vor uns verschwunden. Allerdings klebt seine bedrohliche Aura immer noch an mir und lässt sich auch nicht so schnell vertreiben. Aus Reflex will ich nach Francas Hand greifen, aber ich fasse ins Leere. Ruckartig sehe ich mich um und entdecke meine Freundin ein paar Meter weiter. Voller Elan bewegt sie sich auf eine Gruppe düsterer Gestalten zu, um mit ihnen gemeinsam zu tanzen. Ich schaffe es gerade einmal, einen Schritt in ihre Richtung zu setzen, bevor sich der Kreis für sie öffnet und sie inmitten des Gewirrs aus Armen, Beinen, Händen und Köpfen verschwindet. Genau, wie ich es vorhergesagt habe. Anscheinend konnte sie die Spaßbremse, scusi … ich meine natürlich, ihre beste Freundin nicht schnell genug loswerden.
»Verdammt«, murre ich. Die Musik schwillt an, und am liebsten würde ich hinter Franca herrennen und sie aus der Menge zerren. Die Menschen schwanken und hüpfen im Takt der Musik. Sie werfen ihre Arme in die Luft, johlen und brüllen. Eine Duftwolke aus Parfüm, Schweiß, Alkohol und Rauch schlägt mir entgegen, sobald ich mich näher auf die feiernden Nachtschwärmer zubewege. Ich ziehe die Nase kraus und wende mich kurzerhand von den Partygängern ab. Ich bin eindeutig noch zu nüchtern, um die Nacht sorglos durchfeiern zu können.
»Ich hätte mich niemals auf diese Aktion einlassen sollen«, zische ich mir selbst zu und recke den Hals auf der Suche nach einer Bar. Wenn ich mich nicht auf Franca verlassen kann, dann wenigstens auf die Tatsache, dass Alkohol diesen Abend ein wenig erträglicher machen wird.
Während mein Blick über die Menge wandert, die von Scheinwerfern mit weinrotem Licht übergossen wird, gerate ich ins Stocken. Nur wenige Meter von mir entfernt lehnt eine junge Frau an der Höhlenwand, und sie macht keinen Hehl daraus, dass sie mich beobachtet. Ich verharre. Warte. Mustere sie ebenfalls.
Diese Party ist soeben um einiges interessanter geworden.
Ein einladendes Lächeln bildet sich auf den dunkel geschminkten Lippen der Frau, und ihre Augen leuchten auf. Plötzlich spüre ich eine Art Sog von ihr ausgehen, den ich auf diese Weise noch nie wahrgenommen habe. Gleichzeitig scheint die Luft um sie herum förmlich zu sirren. Sie besitzt zwar eine ähnlich gefährliche Ausstrahlung wie unser Fremdenführer, doch aus irgendeinem unerfindlichen Grund fasziniert sie mich dadurch nur umso mehr. Mein Herz pocht derart laut, dass ich befürchte, es könnte jede Sekunde aus meinem Rippenkäfig ausbrechen. Dennoch versuche ich, mir nichts anmerken zu lassen, und gehe langsam auf sie zu. Je näher ich an sie herantrete, desto bewusster wird mir, dass diese Frau meinen Untergang bedeuten könnte.
1. Kapitel | Flucht
»Das kann nicht dein Ernst sein, Cara!« Der Tonfall meiner Mutter klettert verräterisch in die Höhe, was mich reflexartig den Kopf einziehen lässt. Hilflos blicke ich zu meinem Vater hinüber, meine letzte Rettung. Doch dieser schüttelt nur enttäuscht den Kopf. Großartig, er lässt mich also auch im Stich.
»Was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen?«, versuche ich, mich selbst zu verteidigen. Ich hasse es, dass meine Stimme bebt und so meine Unsicherheit offenbart.
»Du könntest zur Abwechslung mal die Zähne zusammenbeißen und dein Studium bis zum Ende durchziehen! Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder! Weißt du, wie viel Geld dein Vater und ich bisher in deine Ausbildung investiert haben, ohne dass du irgendeine Art von Gegenleistung erbringen musstest?«
Die alte Leier. Ich habe diese Art von Gespräch schon mehrfach mit meiner Mutter geführt. Jedes Mal, wenn ich den Studiengang gewechselt oder abgebrochen habe, hat sie mich mit meinem Bruder Dante verglichen. Aber nicht jeder von uns kann sich durch ein langjähriges Medizinstudium beißen. So, wie ich sie kenne, wirft sie mir als Nächstes Verantwortungslosigkeit und fehlende Reife vor.
»Du musst endlich lernen, Verantwortung zu übernehmen, und erwachsen werden! Du wirst nicht ewig herumdümpeln und den Berufswunsch alle zwei Monate wechseln können!«
Bingo.
»Jura war einfach nichts für mich«, murmle ich und verschränke die Arme vor der Brust, um mich von ihr abzuschotten.
»Jura, Kommunikationsdesign, Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte … für dich kommt einfach gar nichts infrage!«, braust meine Mutter auf. Ihre schwarzen Locken wirbeln wie eine dunkle Gewitterwolke um ihren Kopf herum, während ihre braunen Augen Blitze in meine Richtung schießen. Ich wusste natürlich, dass sie nicht gerade begeistert über den erneuten Studienabbruch sein würde, allerdings habe ich nicht mit so einem starken Ausraster gerechnet.
»Tut mir leid. Ich will mir eben ein paar Möglichkeiten offenhalten«, zische ich, woraufhin sie wütend die Hände in die Hüften stemmt. Dio mio! Sie bleibt stur. Eigentlich war das ja zu erwarten. Meine Eltern arbeiten beide in sicheren Bürojobs für dasselbe Touristikunternehmen. Gewissheit und Routine sind alles, was sie brauchen, um ein zufriedenstellendes Leben zu führen. Aber ich brauche mehr! Mehr Spannung, mehr Kontakte, mehr … von allem! Ich will einfach nicht hinter einem Schreibtisch hocken und stur irgendwelche Daten abarbeiten. Ich will mir nicht während eines jahrelangen Studiums den Hintern plattsitzen. Und erst recht will ich nicht für den Rest meines Lebens tagein, tagaus das Gleiche machen.
»Du verbaust dir deine Zukunft, Cara! Denk doch mal darüber nach …«, setzt meine Mutter erneut an. In ihren Augen bin ich vermutlich eine absolute Versagerin. Bloß weil ich mit Anfang zwanzig noch keinen konkreten Plan für den Rest meines Lebens ausgearbeitet habe. Das verdammte Studium habe ich sowieso nur angefangen, um Mamma und Babbo zufriedenzustellen und weil ich keine andere Option hatte.
»Ich habe darüber nachgedacht«, unterbreche ich sie, woraufhin sie die Stirn in Falten legt. Nach und nach kriecht eine verräterische Röte ihren Hals empor und breitet sich auf ihren Wangen aus. Mein Vater weicht unauffällig ein paar Schritte zurück, als würde er die nahende Explosion bereits vorausahnen und rechtzeitig fliehen wollen.
»Du bist so ein undankbares Kind! Du weißt nichts von dieser Welt und erwartest, dass dir einfach alles zufliegt! Das ist verdammt respektlos!«, speit meine Mutter mir entgegen. Zwischen ihren Augenbrauen pulsiert nun eine Ader, und plötzlich wird mir bewusst, wie viel schlimmer dieser Streit im Vergleich zu den vorherigen ist. Beim ersten Studiengangswechsel war sie noch verständnisvoll und hat mich getröstet, weil ich mich wie eine Versagerin gefühlt habe. Beim zweiten hat sie zwar mit den Zähnen geknirscht, aber mir dennoch Mut zugesprochen. Beim dritten wurde sie bereits passiv-aggressiv und hat mich dadurch deutlich spüren lassen, was sie von meiner Entscheidung hält. Und jetzt hindert sie gar nichts mehr. Der ganze Frust und die zurückgehaltene Wut quellen aus ihr heraus, als wäre ein Damm gebrochen.
»Das war’s, Cara! Ich bin es leid, dabei zuzusehen, wie du dir deine Zukunft verbaust! Das war das letzte Mal, dass du deinen Vater und mich ausgenutzt hast. Basta!«, schmettert sie mir entgegen.
Obwohl ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen, bohrt sich jedes einzelne Wort tief in meinen Verstand und lässt mich daran zweifeln, ob der erneute Studienabbruch wirklich gut durchdacht war.
»Von uns bekommst du keinen Euro mehr. Sieh zu, wie du allein zurechtkommst und endlich Geld verdienst.« Mit diesen Worten wendet sich meine Mutter von mir ab und stöckelt energisch auf ihren mörderisch hohen Stilettos davon.
Wie vom Donner gerührt bleibe ich stehen und starre ihr hinterher, selbst als sie längst durch die Wohnzimmertür gestürmt und das Echo ihrer Schritte verklungen ist. Ich weiß, ich sollte in diesem Moment so etwas wie Schuld oder Zorn verspüren, aber stattdessen erfüllt mich eine tiefe Erleichterung darüber, dass dieses Gespräch endlich überstanden ist, auch wenn es katastrophal lief. Bereits vor drei Wochen habe ich mich exmatrikulieren lassen und diese Unterhaltung seitdem vor mir hergeschoben. Als der Brief der Universität Neapel Federico II heute im Briefkasten lag, konnte ich nicht länger prokrastinieren und musste endlich reinen Tisch machen. Auf eine seltsame Art und Weise tut es gut, es endlich hinter mich gebracht zu haben.
»Sie wird sich bestimmt wieder beruhigen. Gib ihr ein wenig Zeit, um das alles zu verarbeiten«, sagt plötzlich mein Vater, der wieder auf mich zutritt und mir ein schwaches Lächeln schenkt. Im Vergleich zu meiner temperamentvollen Mutter gleicht seine Persönlichkeit einem lauen Sommertag.
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, murmle ich und senke den Blick auf meine Stiefelspitzen. Dieses Mal habe ich es wirklich versaut.
»Du musst sie verstehen. Für deine Mutter ist all das sehr frustrierend. Sie will nur das Beste für dich«, flüstert er.
Mamma ist also frustriert? Was soll ich dann erst sagen? Ich mache das doch nicht absichtlich. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich bereits meinen ersten Studiengang durchgezogen. Warum gehen alle davon aus, dass mir nicht bewusst ist, welch eine schwerwiegende Entscheidung ich treffe? Denken sie, es fällt mir leicht, eine weitere Zukunftsperspektive in die Tonne zu treten?
»Du verstehst das nicht«, stöhne ich auf. »Ich bin nicht wie du oder Mamma. Ich bin einfach nicht für diese Berufswelt gemacht. Ich weiß ja nicht einmal, was ich morgen frühstücken will. Wie soll ich da entscheiden, was ich die nächsten fünfzig Jahre machen will?« Ich brauche Möglichkeiten, Variationen, Alternativen. Nicht jeden Tag die gleiche Eintönigkeit für den Rest meines Lebens.
Mein Vater runzelt die Stirn. Er versteht mich nicht. Hat es noch nie verstanden. Wie auch? Er führt ja genau das Leben, vor dem ich mich fürchte.
»Und wie willst du dann jemals finanzielle Sicherheit erhalten? Unabhängig sein? Dir ein eigenes Leben aufbauen? Dein kleiner Aushilfsjob wird dich nicht ewig über Wasser halten«, entgegnet er. »Gerade Frauen müssen finanziell unabhängig sein, Carissima, das weißt du doch!«
Ich beiße mir auf die Zunge, um ihm nicht recht zu geben. Genau diese Fragen halten mich jede Nacht wach und haben mich bisher davon abgehalten, das Jurastudium nicht schon vor zwei Semestern abzubrechen. Mein Blut kocht, Zorn brodelt in meinem Bauch. Ja, verdammt! Es macht mich wütend, dass er recht hat.
»Darüber will ich jetzt nicht reden«, murre ich und weiche erneut seinem Blick aus. Meine Eltern machen sich Sorgen, das ist mir bewusst. Aber ihre Sorge macht mich krank. Ich will selbst entscheiden, was das Beste für mich ist. Warum können sie das nicht akzeptieren? Ich verlange nur ein bisschen Verständnis, nichts weiter.
»Cara …«
»Ich muss hier raus«, falle ich meinem Vater ins Wort. Wenn ich mir noch einen weiteren Vorwurf anhören muss, verliere ich womöglich den letzten Rest meiner Selbstbeherrschung. Ohne ihn anzusehen, eile ich an ihm vorbei und verlasse das Zimmer. Keine Minute später habe ich unsere Wohnung hinter mir gelassen und eile das ramponierte Altbautreppenhaus hinab. Die lauten Stimmen meiner Eltern, die mich bis nach unten verfolgen, ignoriere ich.
Ohne Rücksicht stoße ich die knarzende Holztür zu unserem Innenhof auf und stolpere auf die Straße hinaus. In meiner Hast renne ich beinahe einen alten Mann über den Haufen, der mich wüst beschimpft, bevor er seinen Weg Richtung Piazza fortsetzt. Ich schlage die entgegengesetzte Richtung ein und vergrabe die Fäuste in den Taschen meiner Jeansjacke, um ihr verräterisches Zittern zu verbergen. Die Empörung über den Ausraster meiner Mutter sitzt tief in meinen Knochen und bringt meinen gesamten Körper zum Vibrieren. Ihre Worte hallen ohne Unterlass durch meinen Kopf und hämmern von innen gegen meine Schläfen.
Ich brauche ganz dringend Ablenkung. Zum Glück weiß ich genau, wo ich diese finde. Entschlossen stopfe ich die Vorwürfe meiner Eltern gedanklich in einen Karton, den ich mental mit einem »NICHTÖFFNEN«-Schild versehe, und konzentriere mich dann voll und ganz auf den Weg vor mir. Ich mustere die eng aneinandergedrückten Gebäude, von denen jedes eine andere Fassade besitzt, als sähe ich sie zum ersten Mal in meinem Leben. Manche wirken sauber und ordentlich verputzt, manche strotzen nur so vor Graffiti und schief aufgehängten Plakaten. Einheitlichkeit ist im Quartieri Spagnoli von Neapel ein Fremdwort; genau deswegen liebe ich diese Gegend so sehr. Hier fällt niemand aus dem Rahmen, weil es gar keinen gibt.
Aus den Geschäften, die sich im Erdgeschoss der Häuser befinden, strömen mir unterschiedlichste Gerüche und Geräusche entgegen. Ein Metzger bietet sein frisches Fleisch direkt neben einem bunt gemischten Klamottenladen feil, und gleich daneben preist ein asiatischer Schnellimbiss seine gebratenen Nudeln an. Die Vielfalt in der Via Pasquale Scura überfordert mich jedoch heute mit ihren vielen Reizen. Obendrein muss ich darauf achten, dem entgegenkommenden Strom aus Passanten und einer gelegentlichen Vespa aus dem Weg zu springen, wenn ich auf die Straße ausweichen muss.
Routiniert schlängle ich mich an den vielen Tischen und Stühlen vorbei, die von den Restaurants und Cafés direkt auf dem Bürgersteig platziert wurden. Menschen lachen und plaudern miteinander, während schwerer Zigarettenrauch in der Luft hängt. Normalerweise würde ich entspannt an den Fremden vorbeischlendern und ein paar Fragmente ihrer Unterhaltungen aufschnappen, doch heute fehlt mir dazu die Ruhe. Stattdessen hetze ich an ihnen vorbei Richtung Stazione di Montesanto.
Sobald das zweistöckige Gebäude in Sicht kommt, atme ich tief durch. Mit ihren riesigen Fensterfronten wirkt die Bahnstation zwar viel zu modern zwischen den bunten Häusern und kleinen Gassen, aber für mich ist sie ein vertrauter Anblick, der mich gleich etwas klarer denken lässt.
Ich gliedere mich in den Fluss aus Menschen ein, der die breiten Treppen zu den Bahngleisen hinabströmt, und fische zeitgleich mein Monatsticket aus der Jackentasche. Nebenbei lasse ich meinen Blick über die metallischen Säulen gleiten, die mit unzähligen Schnörkeln und Ornamenten verziert sind. Dieser Bahnhof ist inzwischen längst zu meinem zweiten Zuhause geworden. Ich nutze ihn seit über fünfzehn Jahren fast täglich. Er ist mein Tor zur Welt. Von hier aus gelange ich in Windeseile an jeden Punkt der Stadt, kann zur Uni fahren, Freunde besuchen oder … fliehen. So wie ich es jetzt gerade tue. Schnell schüttle ich den Kopf, um diesen Gedanken wieder loszuwerden.
Nachdem ich die Ticketkontrolle hinter mich gebracht habe, steuere ich die Metropolitana in Richtung Napoli San Giovanni Barra an und haste die Stufen zum Bahnsteig hinab, um den einfahrenden Zug noch rechtzeitig zu erwischen. Schwer atmend komme ich im Eingangsbereich der Metro zum Stehen und klammere mich an einer Stange fest, bevor sich die automatischen Türen hinter mir zischend schließen. Eine Sekunde später nehme ich bereits den penetranten Schweißgeruch wahr, der immerzu in den Zügen mitfährt. Über meinem Kopf flackert die Deckenbeleuchtung, was den drückenden Schmerz hinter meinen Schläfen verstärkt. Mein Blick schweift über den Haltestellenplan direkt über der Tür, und ich seufze erleichtert auf. Bis ich mein Ziel erreiche, dauert es zum Glück nicht mehr lange. Jetzt gerade gibt es nur eine Person, der ich mich anvertrauen kann: Franca.
Sie wird wissen, wie sie mich aufmuntern kann. Sie ist die Einzige, die ich gerade sehen will. Wenn mich jemand versteht, dann sie.
2. Kapitel | Unterschlupf
Keuchend erklimme ich die Treppenstufen der Stazione di Napoli Mergellina und schaue mich blinzelnd um. Immer wenn ich eine Weile in der Untergrundwelt von Neapel abgetaucht war, brauche ich einen Moment, um mich an der Oberfläche wieder zurechtzufinden. Das satte Grün der Bäume und die einheitlich beigefarbenen Fassaden der Gebäude irritieren mich für einen Augenblick, denn ich bin die durchgewürfelte Architektur meines Heimatviertels zu sehr gewohnt. Franca wohnt im Gegensatz zu mir in Chiaia. Dieser berühmte Stadtteil gehört zu den malerischsten Seiten von Neapel und strotzt nur so vor teuren Boutiquen und traditionellen neapolitanischen Geschäften. Und dazu noch der idyllische Hafen, der ein paar Straßen weiter liegt. Manchmal kann ich gar nicht glauben, dass sie wirklich hier wohnt. Selbst ihr kleines Apartment muss ein Vermögen kosten.
Obwohl ich meine Freundin mindestens einmal die Woche besuche, laufe ich jedes Mal aufs Neue staunend durch die Gassen, bewundere den klassischen Baustil der Gebäude und werfe einen sehnsüchtigen Blick in die vielen Schaufenster. Nichtsdestotrotz muss man auch dabei immer aufpassen, nicht von irgendwelchen anderen Verkehrsteilnehmern umgenietet zu werden. Als ich versuche, einen Zebrastreifen zu überqueren, fährt mir ein Fahrradfahrer beinahe über den Fuß. Ich presse die Lippen fest zusammen, um einen Fluch zu unterdrücken. Das ist eben Neapel. Ich liebe und hasse diese Stadt zugleich.
Glücklicherweise dauert es nicht lange, bis ich endlich vor der auf Hochglanz polierten Tür zum Stehen komme, die in Francas Wohnhaus führt. Entschlossen presse ich meinen Daumen auf ihr Klingelschild und warte ab. Erst jetzt kommt mir der Gedanke in den Sinn, dass meine Freundin womöglich gar nicht zu Hause ist. Immerhin ist es Freitagnachmittag. Sie könnte noch in der Uni sitzen, auf einem Date mit Enno sein oder …
Ein lautes Summen durchbricht meine Gedankenspirale. Erleichtert drücke ich die Tür auf und trete in das dunkle Treppenhaus. Ich stapfe hinauf ins dritte Stockwerk, wo mich Francas offene Wohnungstür begrüßt. Völlig selbstverständlich gehe ich über die Schwelle, streife meine Doc Martens ab und stelle sie neben die ordentlich aufgereihten Schuhe meiner Freundin. Ich folge ihrem fröhlichen Singsang in die Küche, wo Franca gerade ein Blech mit frischem Focaccia-Teig in den Ofen schiebt. Blonde Korkenzieherlocken umrahmen ihr Gesicht, sobald sie breit grinsend zu mir aufschaut. Meine beste Freundin besitzt eine natürliche Schönheit, die mich schon immer ein wenig neidisch gemacht hat. Selbst ungeschminkt und in einer vollgesauten Schürze sieht sie aus wie ein Engel.
»Du solltest wirklich aufhören, deine Wohnungstür einfach offen stehen zu lassen. Ich hätte ein Serienmörder sein können.« Mit diesen Worten begrüße ich sie, bevor ich sie in eine Umarmung ziehe.
»Pff. Für wie naiv hältst du mich? Ich hab natürlich vorher die Kameras gecheckt«, entgegnet sie schnell und stellt die Temperatur am Ofen ein.
Ach ja, stimmt. Manchmal vergesse ich, dass ihre Familie so wohlhabend ist, dass sie sogar in ihrer Zweizimmerwohnung ein topmodernes Sicherheitssystem eingebaut haben.
»Was machst du überhaupt hier? Ich dachte, wir wollten uns erst morgen treffen.« Das leichte Zucken ihrer Augenbraue entgeht mir nicht. Offenbar ist Franca gestresst. Irgendetwas beunruhigt sie. Und ich kann mir schon genau denken, was.
»Ich wollte nur ein bisschen reden. Heute war ein ziemlich beschissener Tag. Falls ich dich störe, kann das aber auch noch bis morgen warten.« Das Letzte, was ich jetzt möchte, ist, eine Last für meine Freundin zu sein. Sie ist zwar immer für mich da, wenn ich sie brauche, dennoch will ich sie mit meinen Problemen nicht runterziehen. Franca führt im Vergleich zu mir ein sorgenfreies Leben und kann nicht nachvollziehen, warum ich mir meines so schwer mache.
»Quatsch, du störst nie! Komm, ich schenke uns ein Glas Wein ein, und dann kannst du mir in Ruhe erzählen, was los ist. Später wollte vielleicht noch Enno vorbeischauen, aber er hat bestimmt nichts gegen einen Abend zu dritt einzuwenden.« Francas strahlendes Lächeln täuscht beinahe über die versteckte Bedeutung ihrer Worte hinweg. Allerdings nur beinahe.
»Enno kommt vorbei? Habt ihr etwa ein Date geplant?«, hake ich nach und grinse wissend.
Francas Blick weicht meinem sofort aus und irrt ziellos durch den Raum. Sie ist eine katastrophal schlechte Lügnerin.
»Nein, wir wollten bloß ein bisschen … z-zusammen lernen für die Klausur in … Medienästhetik«, bringt sie viel zu schnell hervor und verhaspelt sich auch noch. Selbst wenn ich Franca nicht bereits seit unserer gemeinsamen Schulzeit kennen würde, hätte ich ihre Lüge sofort durchschaut.
»Wenn du das sagst«, lenke ich ein. Es ist seit Wochen mehr als offensichtlich, dass Enno und sie endlich den nächsten Schritt wagen und einander daten. Wir drei waren während der gesamten Schulzeit ein festes Gespann und kaum voneinander zu trennen. Über die Jahre hinweg konnte ich sehr gut beobachten, wie Franca und Enno sich immer wieder heimliche Blicke zugeworfen oder scheinbar zufällige Berührungen ausgetauscht haben. Die beiden waren hoffnungslos ineinander verliebt und haben sich lange Zeit nicht getraut, sich die Gefühle für den jeweils anderen einzugestehen. In den letzten Wochen gab es jedoch einige Fortschritte. Die beiden unternehmen Sachen zu zweit, halten zwischendurch Händchen, wenn sie glauben, dass ich nicht hinsehe, und wirken inniger als je zuvor. Ich freue mich für sie. Wirklich. Allerdings versetzt es mir trotzdem einen kleinen Stich, dass sie mich bisher nicht eingeweiht haben. Bestimmt werden sie ihre Gründe haben, dennoch fühle ich mich dadurch ausgeschlossen. Vorher gab es uns drei: Enno, Franca und Cara. Jetzt gibt es nur noch Enno und Franca. Und Cara.
Ich schlucke den galleartigen Geschmack der Eifersucht hinunter und folge Franca ins Wohnzimmer, in das mit Müh und Not eine Couch und ein kleiner Tisch hineinpassen. Neapolitanische Wohnungen gleichen in der Regel einer möblierten Streichholzschachtel. Doch meine Freundin hat es sich hier durchaus gemütlich gemacht. Von der Decke hängen mindestens zehn Pflanzen, deren Ranken teils bis zum Boden reichen. Die Wände wurden mit bunten Stoffen behängt, und in jeder Zimmerecke liegen Bücher herum, weil kein Platz mehr für ein richtiges Regal übrig blieb. Ich steige über einen der Stapel hinweg, um zur Couch zu gelangen, und falle mit einem Seufzen in die weichen Polster.
»Also, was gibt’s?« Franca lässt sich neben mir nieder und schaut abwartend zu mir. Sie will also keine Zeit verschwenden und direkt zur Sache kommen.
»Ich habe meinen Eltern von der Exmatrikulation erzählt. Sie waren … nicht gerade begeistert«, erkläre ich vage. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, um die Ereignisse nicht noch einmal zu durchleben. Trotzdem muss ich darüber reden, sonst platze ich.
»Lass mich raten, deine Mutter konnte es überhaupt nicht nachvollziehen und hat einen riesigen Aufriss um die ganze Sache gemacht«, schlussfolgert Franca richtig.
Ich nicke. »Das alles frustriert mich so sehr. Ich will ihnen nicht weiter auf der Tasche liegen oder von ihnen abhängig sein. Aber was wäre die Alternative? Mein Leben lang in einem Beruf arbeiten, den ich nicht leiden kann?« Ich kralle die Finger in eines der Sofakissen und lasse auf diese Weise meine unterdrückten Gefühle raus.
»Ich verstehe ihre Bedenken und kann nachvollziehen, dass sie nicht die finanziellen Mittel haben, mich ewig zu unterstützen; und das erwarte ich auch gar nicht von ihnen. Ich habe immerhin einen Nebenjob und lege mir notfalls einen zweiten oder dritten zu.« Wie so ziemlich alle Studierenden in Neapel kellnere ich neben der Uni in einem kleinen Restaurant und verdiene mir so einen Großteil meines Lebensunterhalts. Dennoch bestanden meine Eltern bisher darauf, mein Studium zusätzlich zu finanzieren.
»Die sollen sich nicht so anstellen!«, braust Franca auf. »Sie können froh sein, dass du dich überhaupt bemühst. Eltern sollten ihre Kinder bedingungslos unterstützen, egal welche Entscheidungen diese für ihre Zukunft treffen. So sehe ich das.«
Ich knirsche mit den Zähnen und hoffe, dass Franca es nicht bemerkt. Mir war schon klar, dass so eine Antwort kommen würde. Auch wenn meine Freundin es nicht wahrhaben will, sie urteilt aus einer sehr privilegierten Position heraus. Ihre Mutter ist eine angesehene Firmenchefin, und Geldsorgen waren bei ihr nie ein Thema. Als Tochter aus gutem Hause hatte Franca es immer leichter und in Sachen Studium völlig freie Wahl. Sie muss weder ihre Miete selbst bezahlen noch für ihre Lebensmittel oder andere Ausgaben aufkommen. Alles geht auf die Rechnung ihrer Mutter, und das hat sowohl positive als auch negative Folgen.
Franca lebt ein sehr entschleunigtes Leben. Sie hängt bereits jetzt mehrere Semester in ihrem Studium der Medienwissenschaft hinterher, weil sie lieber mit ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen rumhängt und schwänzt, anstelle zu lernen. Sie kann tun und lassen, was sie will, während ihre beste Freundin manchmal nicht weiß, wie sie die Miete ihres mickrigen Studierendenwohnheimzimmers zahlen soll. Ich stöhne auf. Vielleicht war es doch ein Fehler, hierherzukommen. Ich hätte den Frust einfach in mich hineinfressen sollen, statt Franca mit meinen Sorgen zu belästigen.
»Du verstehst das nicht –«, setze ich gerade an, als mich ein lautes Klingeln unterbricht.
Franca springt auf, streicht ihre Cordhose glatt und richtet ihre Bluse, die vor Blumenmustern überquillt.
»Das ist bestimmt Enno. Warte hier, ich mach kurz auf!«, ruft sie mir zu, während sie sich bereits auf dem Weg zur Tür befindet.
Ich lehne den Kopf gegen die Wand hinter mir und unterdrücke einen weiteren entnervten Laut. Ein paar Sekunden später lugt ein brünetter Haarschopf durch die Tür, und Enno begrüßt mich mit einem überraschten »Cara! Che bello! Ich wusste gar nicht, dass du auch kommen würdest«.
Ich verkneife mir den Kommentar, dass das gar nicht mein Plan war für den heutigen Tag. Eigentlich wollte ich meinen Eltern einen kleinen Besuch abstatten und danach ganz in Ruhe nach einem neuen Studiengang suchen oder mich nach Ausbildungen erkundigen. Aber dazu fehlt mir nach dem eskalierten Streit heute definitiv die Lust. Ich kann mich morgen noch um meine Zukunft kümmern, schließlich rennt sie mir nicht davon.
»Cara braucht ganz dringend Ablenkung. Darin sind wir doch Experten, oder nicht?«, meint Franca und stellt sich direkt neben Enno. Kurz streicht sie mit ihren Fingern über seine Hand.
Unauffällig verdrehe ich die Augen. Die beiden sind wirklich unsagbar schlecht darin, ihre Beziehung geheim zu halten.
Kurz darauf sitze ich zwischen den beiden eingequetscht auf der Couch, lausche ihrem Gespräch und fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen. Enno erzählt von einer Klausur, für die er in den kommenden Wochen viel lernen muss. Seine Eltern sind beide Akademiker und sehr streng, was seine Leistungen angeht. Da er noch bei ihnen daheim wohnt, ist er täglich dazu gezwungen, ihren unmenschlich hohen Erwartungen gerecht zu werden. Wenn sie eine Tochter wie mich hätten, wären die beiden vermutlich längst an die Decke gegangen. Eigentlich kann ich mich glücklich schätzen, dass meine Eltern bisher recht verständnisvoll waren … na ja, mal abgesehen von dem emotionalen Ausbruch heute Nachmittag.
»… was denkst du, Cara?«, unterbricht Franca plötzlich meinen Gedankenfluss.
Ich blinzle sie an und gebe ein fragendes »Hm?« von mir. Worüber haben sie zuletzt gesprochen? Ennos Klausur?
»Es ist schlimmer, als wir bisher dachten«, murmelt Enno.
»Ein akuter Fall von overthinking. Da helfen nur besonders harte Maßnahmen«, stimmt Franca ihm zu und eilt in die Küche, bloß um kurz darauf mit einer dickbäuchigen Flasche Rotwein und drei Gläsern zurückzukehren. Der Anblick reißt mich aus meiner apathischen Haltung und sorgt dafür, dass ich mich aufrechter hinsetze.
»Ein bisschen Wein verleiht dir bestimmt eine ganz neue Perspektive«, meint Franca lachend und entkorkt den Lacryma Christi Rosso. Sie füllt unsere Gläser bis zur Hälfte und reicht mir eines davon.
Ich nippe an dem Wein und muss zugeben, dass er überraschend gut schmeckt. Würzig und süß. Obwohl ich keine große Alkohol-Liebhaberin bin, weiß ich einen guten Wein trotzdem zu schätzen. Heute kann ich jeden Tropfen gebrauchen, wenn er mir dabei hilft, den Streit mit meinen Eltern zu vergessen. Der Tag war wirklich beschissen, um es milde auszudrücken. Ich stürze den restlichen Inhalt des Glases in einem Schluck hinunter. Angenehm kühl rinnt der Wein meine Kehle hinunter.
Franca grinst mich breit an, während sie mein Glas wieder auffüllt. Der bittere Nachgeschmack des Alkohols klebt hartnäckig an meinem Gaumen, aber langsam gewöhne ich mich daran.
Hoffentlich werde ich diese Entscheidung nicht bereuen.
3. Kapitel | Vagabondi
Inzwischen verstehe ich, warum meine Eltern uns drei immer abfällig die »Vagabondi« nennen. Denn nachdem wir fast zweieinhalb Weinflaschen geleert haben, zieht es uns nach draußen auf die Straße. Stundenlang wandern wir ziellos durch die Gassen Neapels, bis die Abenddämmerung einsetzt, dann steigen wir in die Metropolitana und fahren einfach drauflos, bis uns die Bahn wieder in der Nähe des Hafens ausspuckt. Inzwischen spüre ich die Wirkung des Alkohols deutlich. Meine Bewegungen sind schwerfälliger, sodass ich auf den Treppenstufen stolpere oder Franca anremple. Jedes Mal entweicht mir dabei ein Kichern.
Franca hat recht: Nach all dem Stress mit der Uni und meinen Eltern brauche ich einfach ein bisschen Entspannung.
Mein Blick schweift durch die engen Gassen, die sich im Laufe der Abendstunden mit Einheimischen füllen. Ihre Stimmen verschwimmen zu einem lauten Brummen, das mein Trommelfell zum Vibrieren bringt.
Die bunten Hausfassaden leuchten intensiver als zuvor. Die Farben fließen ineinander und lassen die Umgebung verschwimmen. Das faszinierende Lichtspiel fesselt meine ganze Aufmerksamkeit, weshalb ich zunächst gar nicht merke, wie ich stehen bleibe. Erst als mich Enno zur Seite reißt, weil ein Vespa-Fahrer mich beinahe umfährt, kann ich mich von der hypnotisierenden Wirkung der Farben und Lichter losreißen. Ein weiteres Kichern stolpert über meine Lippen. Ich weiß nicht einmal, wieso, denn es gibt keinen Grund dafür. Aber es fühlt sich gut an.
Enno jedoch scheint es im Gegensatz ganz und gar nicht gut zu gehen. Im Gegensatz zu Franca und mir, die kaum aus dem Lachen herauskommen, schaut er sich immer wieder hektisch um. Er reibt sich über das Brustbein und wirkt panisch. Der Alkohol schlägt ihm wohl auf den Magen. Auf seiner Stirn bilden sich dicke Schweißperlen, und er atmet so hektisch, als würde er jeden Moment umkippen.
»Dio mio! Du musst dich entspannen, Enno«, meint Franca, während ihr geheimer Freund weiter nach Luft ringt. Dennoch bleibt er nicht stehen.
Schritt für Schritt gehen wir weiter, vorbei an Restaurants und Cafés, die aus allen Nähten platzen. Der deftige Geruch von gebackenem Teig und geschmolzenem Käse dringt mir in die Nase, und gleich darauf knurrt mein Magen auffordernd. Was würde ich jetzt für eine Margherita geben! Es sollte keine allzu große Überraschung sein, dass Pizza mein Lieblingsgericht ist, immerhin bin ich in der Stadt geboren, in der sie erfunden wurde. Ich könnte mich tagelang von nichts anderem ernähren.
»Lasst uns zum Hafen gehen. Dort ist vielleicht weniger los«, schlägt Franca vor. Überraschenderweise wirkt sie am nüchternsten. Vermutlich, weil sie ihre Grenzen kennt und sich nicht gnadenlos betrunken hat, so wie Enno und ich.
Trotzdem sind wir nach wie vor in der Lage, Franca Richtung Hafen hinterherzustolpern, der glücklicherweise nicht allzu weit entfernt liegt. Wir quetschen uns an tratschenden Menschengrüppchen und parkenden Autos vorbei, bis wir aus den Häuserreihen ausbrechen und sich das Meer vor uns erstreckt.
Endlich kann ich tief durchatmen. Der salzige Duft des Golfs von Neapel wäscht meine panischen Gedanken hinfort. Mein Puls verlangsamt sich stetig und passt sich dem Rhythmus der Wellen an. Auch Enno entspannt sich deutlich neben mir. Er saugt die Luft nicht mehr hektisch ein, sondern nimmt wieder gleichmäßige Atemzüge.
Meine Aufmerksamkeit wandert kurz weg von meinen Freunden und hin zu dem gigantischen Vulkan, der auf der gegenüberliegenden Seite des Golfs thront und dessen Spitze von Nebelschwaden verschleiert wird. Der Vesuv ist Neapels stiller Wächter. Immer sichtbar, egal wo man sich befindet. Die Sicht auf den uralten Schicksalsberg strahlt eine unfassbare Ruhe und Beständigkeit aus, weshalb ich ab und an vergesse, dass der Vulkan weiterhin aktiv ist und jederzeit ausbrechen könnte. Für den Moment genieße ich jedoch seinen monumentalen Anblick im goldenen Licht der Abenddämmerung und blende die Gefahr einer Eruption aus. Zumindest bis ich mich widerwillig von der Aussicht lösen muss, um meinen Freunden zu folgen.
Franca führt uns zielsicher zur Fontana dell’Immacolatella, einer Brunnenskulptur an einem Eckpunkt des Hafens, die von einem kleinen grünenden Garten umgeben ist. Inmitten der hohen Bauten und überfüllten Via Partenope wirken die Büsche und Bäume wie eine rettende Oase. Der Anblick der drei großen Bögen, die mit aufwendigen Schnörkeln und Skulpturen versehen sind, entspannt mich auf der Stelle. Der kleine Brunnen unterhalb des mittleren Bogens plätschert leise vor sich hin.
Wir steuern zu einem Stück Rasen direkt neben der Hecke, wo wir es uns gemütlich machen. Das Gras unter meinen Händen fühlt sich verführerisch weich an, sodass ich dem Drang widerstehen muss, mich einfach hinzulegen.
Stattdessen schaue ich zu meiner Freundin hinüber, die verdächtig nah an Enno herangerutscht ist und ihn besorgt mustert. Sein Kreislauf scheint sich immerhin stabilisiert zu haben, und er ringt sich sogar ein kleines tapferes Lächeln für Franca ab, bevor sich seine Lider flatternd schließen und er den Kopf auf ihrer Schulter ablegt. Die beiden sind schon ein bisschen süß.
Gerade will ich mich gedanklich meinem eigenen katastrophalen Liebesleben widmen, als ein langer Schatten auf uns fällt. Ich rechne bereits mit einem Ordnungswächter, der uns von der Rasenfläche verscheuchen will, und lege den Kopf in den Nacken, um hochzuschauen. Statt in das Gesicht eines Polizisten blicke ich jedoch geradewegs in das eines ominösen Fremden. Er ist völlig in Schwarz gekleidet, und ein langer Ledermantel lässt ihn wie einen Goth aussehen. Dazu kommt eine Rundglasbrille, die ebenfalls dunkel getönt ist.
Skeptisch runzle ich die Stirn, weil der Fremde inmitten dieser bunten Stadt wie ein wandelnder Tintenfleck aussieht. Erst als sich seine Mundwinkel auseinanderbiegen und ein strahlend weißes Lächeln sowie zwei unnatürlich spitze Eckzähne entblößen, wirkt er wie ein richtiger Mensch.
»Buonasera. Entschuldigt bitte, mein Name ist Cas. Darf ich euch kurz stören?«, fragt er. Seine Stimme ist sanft und bringt jedes einzelne Haar an meinen Armen dazu, sich aufzustellen.
Franca und ich tauschen kurz einen Blick aus. Sie zuckt nichtssagend mit den Schultern und murmelt ein leises »Klar«.
Der Fremde streicht sich kurz über den Kopf und zieht den Zopf mit seinen Locs fester. »Ihr wirkt wie eine lockere Truppe, die offen für neue Erfahrungen ist«, setzt er an. Der Text wirkt einstudiert.
Was jetzt wohl kommt? Will er uns irgendetwas andrehen? Oder uns für eine Sekte rekrutieren? Alles ist möglich.
»Meine Freunde und ich stellen monatlich eine inoffizielle, exklusive Party auf die Beine. Ihr seid unsere perfekte Zielgruppe. Jung, witzig, Spaß suchend …«
Okay, seine Ansprache wird von Sekunde zu Sekunde skurriler. Was will er von uns? Ist er eine Art Animateur, der uns für seine Feier anwerben will?
»Ich könnte euch eine Einladung beschaffen, wenn ihr wollt«, bietet er schließlich an, und jetzt bin ich vollends verwirrt.
»Warum?«, bricht es aus mir heraus, bevor ich mich zurückhalten kann. Der Alkohol macht mich mutiger, als ich es eigentlich bin. »Warum solltest du das tun? Wir kennen uns gar nicht. Und was soll das überhaupt bedeuten: inoffizielle Party?«
Das Lächeln von Cas verrutscht ein wenig, als hätte er nicht mit so viel Gegenwind gerechnet. Was hat er erwartet? Dass wir sofort dankbar annehmen, sobald er uns dieses dubiose Angebot macht? Nein, danke.
»Nun ja, es bedeutet so viel wie: illegal. Die Feier findet nicht in den gängigen Clubs statt, sondern in den Katakomben. Sehr exklusiv und sehr geheim. Nur geladene Gäste kommen hinein.«
Seine Erklärung steigert meine Verwirrung noch weiter. Habe ich das gerade richtig verstanden? Er und seine Freunde wollen eine Party in den Katakomben unterhalb Neapels veranstalten? In den Gängen und Stollen, die für die Öffentlichkeit absolut verboten sind? Hat er völlig den Verstand verloren?
»Das ist doch lebensmüde!«, entfährt es mir. Selbst unter der Restwirkung des Alkohols weiß ich, wie unfassbar riskant es wäre, sich in das Labyrinth unterhalb der Stadt zu begeben. Mal abgesehen davon, wie unverantwortlich es ist, dort eine Party zu veranstalten. Immer wieder kommt es vor, dass Häuser oder Straßen aufgrund der Instabilität durch die hohlen Gänge unterhalb der Erdoberfläche absacken. Wir wären in Lebensgefahr!
»Ich habe schon davon gehört«, schaltet sich Franca neben mir plötzlich in das Gespräch ein. Ich schaue sie überrascht an, ihre Augen glitzern verräterisch. Oh, oh, ich kenne diesen Blick. Er verheißt nichts Gutes. »An der Uni wird oft unter der Hand von den wilden Partys in den Katakomben berichtet. Es soll fast unmöglich sein, an eine Einladung zu kommen.«
»Nun, ich serviere euch eine auf dem Silbertablett. Wir wählen unsere Gäste selbst aus, das macht den ganzen Reiz aus«, erklärt Cas und richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf Franca, als würde er ganz genau wissen, dass sie den Köder schlucken wird. Im Gegensatz zu mir besitzt meine Freundin nämlich keinerlei angeborene Skepsis. Sie geht mit einer kindlichen Naivität durch die Welt, die schon oft dazu geführt hat, dass ich sie vor Schlimmerem bewahren musste.
»Das ist eine einmalige Chance. Nehmt ihr die Einladung an?«, fragt er und übt auf diese Weise Druck aus.
»Nein!«, antworte ich vehement, während Franca zeitgleich ein entzücktes »Ja!« von sich gibt.
Schockiert starren wir uns an. Sie tut so, als könnte sie nicht fassen, dass ich so eine einmalige Gelegenheit ausschlagen würde. Ich hingegen blicke auffordernd zu Enno hinüber, der verdächtig still geblieben ist. Doch er scheint dem Gespräch nicht ganz folgen zu können und zieht unentschlossen die Schultern hoch. Von ihm kann ich also keine Unterstützung erwarten.
In diesem Moment meldet sich Cas erneut zu Wort. »Ich werte das jetzt einfach mal als Zusage. Bestimmt schaffst du es auch noch, deine Freunde zu überzeugen.«
Ich bin von seiner Dreistigkeit so schockiert, dass mir auf die Schnelle kein geeigneter Konter einfällt. Franca hat er nun definitiv am Haken. Sie nickt eifrig und grinst den Mann breit an.
Ich sitze einfach nur fassungslos daneben.
»Wir treffen uns bei Anbruch der nächsten Vollmondnacht genau hier. Seid pünktlich«, fordert er, lächelt ein letztes Mal in die Runde und geht dann auf eine junge Frau zu, die nicht weit von uns entfernt auf ihn wartet.
Ihre Erscheinung reißt mich für einen flüchtigen Moment aus meiner Entrüstung. Sie ist hochgewachsen und verbirgt offensichtlich sehnige Muskeln unter einem eng anliegenden schwarzen Hemd. Die Fremde wendet ihren Kopf in unsere Richtung, wodurch mir ihr Sidecut auffällt, der ihre spitzen Gesichtszüge betont. Unsere Blicke verhaken sich für einen Wimpernschlag ineinander, und ich sehe deutlich, wie ihre Iriden in einem unheilvollen Rotton aufglühen. Aber ich komme nicht dazu, das weiter zu hinterfragen, denn mein Puls stolpert, und ich erstarre am ganzen Körper. Von der Frau geht ein Sog aus, der mich beinahe dazu verleitet, aufzustehen und auf sie zuzugehen. Ich zwinge mich jedoch dazu, an Ort und Stelle zu verweilen und ihr dabei zuzusehen, wie sie gemeinsam mit dem Fremden in einer angrenzenden Gasse verschwindet. Ich könnte schwören, dass sie einen letzten Blick zu uns zurückwirft. Zu mir.
Ich warte, bis die beiden außer Sicht- und Hörweite sind und sich mein Puls wieder normalisiert hat, bevor ich mich zu meiner Freundin beuge und zische: »Was soll der Scheiß, Franca? Der Typ ist total unheimlich! Du wirst die Einladung doch nicht ernsthaft annehmen, oder?«
»Du verstehst das nicht, Cara. Diese Partys sind legendär. Ich habe sie bisher für ein Gerücht gehalten, weil es eine absolute Seltenheit ist, eingeladen zu werden. Ich habe schon so viele Geschichten aus den Katakomben gehört und immer gehofft, dass ich irgendwann zu den Auserwählten gehören darf.«
»Hörst du dir eigentlich selbst zu? Weißt du nicht, wie gefährlich es ist, die Katakomben zu betreten? Es könnte so viel schiefgehen –«
»Oder es wird die beste Nacht unseres Lebens. Du machst dir immer so viele Sorgen. Stattdessen könntest du diese Gelegenheit einfach als das sehen, was sie ist: eine einmalige Erfahrung!« Franca ergreift meine Hand und zieht einen Schmollmund. »Ich würde mir nie verzeihen, diese Chance ungenutzt gelassen zu haben.«
»Du vertraust diesem dahergelaufenen Fremden wirklich mehr als deiner besten Freundin? Hast du nicht gemerkt, wie seltsam er sich ausgedrückt und benommen hat? Er will dich nur locken, Franca. Ich weiß nicht, was sich hinter dieser Party verbirgt, aber es kann nichts Gutes bedeuten«, erkläre ich meine Bedenken.
»Fein. Du musst ja nicht mitkommen, wenn dir das alles zu suspekt ist. Dann gehe ich eben allein«, meint sie und will mir ihre Hand entziehen.
Instinktiv halte ich sie fest und atme einmal tief durch. Ich fasse es nicht, dass ich das hier wirklich tue. Mein eigener Puls dröhnt mir lautstark in den Ohren und macht es mir unmöglich, klar zu denken. »Ich lasse dich auf gar keinen Fall allein gehen«, stelle ich klar.
»Dann musst du wohl mitkommen. Und wer weiß, vielleicht siehst du ja auch die mysteriöse Fremde wieder«, schlussfolgert Franca mit einem wissenden Grinsen.
Blut schießt mir in die Wangen und bringt mein gesamtes Gesicht zum Glühen. War mein Interesse an der Frau so offensichtlich? Auf jeden Fall drängt Franca mich mit ihrer Aussage in eine Ecke und weiß es ganz genau. Meine Freundin ist manipulativer, als ich bisher dachte.
Ich presse die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen und nicke knapp. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, sie zu beschützen, dann habe ich wohl keine andere Wahl.
Dennoch scheint es so, als hätte ich mit diesem Nicken meine Zukunft besiegelt. Ich kann nicht aufhören, an die versteckten Tunnel und Kammern unterhalb Neapels und die Warnungen zu denken, die uns eingehämmert wurden, seit wir laufen können: Die Katakomben dürft ihr unter keinen Umständen betreten.
4. Kapitel | Eine einzige Enttäuschung
Ich fasse es nicht, dass ich mich wirklich darauf einlasse. Begleitet von einem Seufzen ziehe ich einen spitz zulaufenden Lidstrich entlang meines Wimpernkranzes. Dank meiner jahrelangen Übung gelingt es mir in Rekordzeit. Franca turnt zeitgleich um mich herum. Sie eilt zwischen dem Wohn- und Badezimmer hin und her, während sie an ihrer Hochsteckfrisur herumzupft. Uns bleiben nur noch knappe drei Stunden bis zur Abenddämmerung und damit zu dem Treffen mit dem geheimnisvollen Fremden, der uns vor ein paar Wochen zu der Party in den Katakomben eingeladen hat.
Es liegt mir auf der Zunge, Franca erneut Vernunft einreden zu wollen oder sie zur Besinnung zu bringen. Wir müssen nicht zu dieser Party gehen. Wir könnten uns stattdessen einen schönen Abend hier in ihrer Wohnung machen. Eine Serie gucken, auf der Couch herumlümmeln und Pizza essen. Das klingt geradezu himmlisch im Vergleich zu den möglichen Gefahren, die uns in den Katakomben erwarten.
Aber nicht einmal Enno hat es geschafft, sie davon zu überzeugen, die Feier nicht zu besuchen. Ich musste ihm hoch und heilig versprechen, ein Auge auf Franca zu haben und sie im Notfall aus den Katakomben herauszuzerren. Er selbst verbringt den Abend mit seinen Eltern, die ihn auf eine wichtige Gala mitschleppen und keine Abwesenheit dulden. Insgeheim glaube ich, dass Franca erleichtert darüber ist. Auf diese Weise muss sie sich nicht gegen zwei Skeptiker behaupten, sondern nur gegen einen. Mich.
Statt den Mund zu öffnen und einen weiteren Umstimmungsversuch zu wagen, bleibe ich auf dem Boden sitzen und lege meinen Schmuck an. Vor mir habe ich all meine Silberringe fein säuberlich aufgereiht. Ohne Ringe gehe ich nicht aus dem Haus. Sie sind so etwas wie mein Markenzeichen. Ich suche mir einen breiten aus, in dessen Mitte ein schwarzer Edelstein prangt, und stecke ihn mir auf den Mittelfinger. Weitere Ringe wandern auf meinen Daumen und meinen Zeigefinger. Die Schmuckstücke geben mir ein seltsames Gefühl von Sicherheit, als wären sie ein Teil meiner Rüstung.
Jetzt fehlt nur noch die Frisur. Unschlüssig betrachte ich mein leicht gewelltes schulterlanges Haar im Spiegel.
Wie so oft wünsche ich mir die schwarzen Locken meiner Mutter herbei. Ich habe ihre Haare schon als kleines Kind bewundert und gehofft, dass meine sich im Laufe der Zeit mehr kringeln würden, aber bis auf ein paar Wellen und die dunkle Haarfarbe habe ich leider nichts von meiner Mutter geerbt.
Plötzlich beginnt das Smartphone neben mir auf dem Boden zu vibrieren, und reißt mich damit aus den Gedanken. Ich blinzle irritiert und hebe es an. Wenn man vom Teufel spricht. Vom Anruferbild strahlt mir das Antlitz meiner Mutter höhnisch entgegen. In den letzten anderthalb Wochen habe ich es kein einziges Mal gesehen. Die Funkstille zwischen uns hat mir mehr zugesetzt, als ich zugeben will. Allerdings habe ich mich auch nicht dazu in der Lage gefühlt, das Schweigen zu brechen. Was hätte ich auch sagen sollen? Entschuldige, dass ich so eine Enttäuschung bin?
Mein Vater hat mich im Gegensatz zu meiner Mutter mit Anrufen und Textnachrichten bombardiert. Er hat versucht, mich in belanglose Gespräche zu verwickeln, nur um schlussendlich darauf zu sprechen zu kommen, dass es noch nicht zu spät sei, das Jurastudium fortzusetzen und meine Mutter auf diese Weise zu besänftigen. Inzwischen drücke ich seine Anrufe meist weg, sobald sein Foto auf meinem Display aufleuchtet. Ich will mir nicht jeden Tag anhören müssen, was für einen schrecklichen Fehler ich begangen habe und was ich hätte besser machen können.
Und auch bei diesem Anruf sträubt sich alles in mir dagegen, ihn anzunehmen. Am liebsten würde ich das Handy gegen die Wand pfeffern. Stattdessen beobachte ich, wie sich das Display verdunkelt und das Bild meiner Mutter wieder verschwindet.
Mir bleibt keine Zeit, um meine Entscheidung zu bereuen, denn Franca betritt gleich darauf das Wohnzimmer, und es verschlägt mir kurzzeitig die Sprache. Sie trägt ein Kleid, das so kurz ist, dass es diese Benennung gar nicht verdient hat. Der verführerische Look wird durch ihre dunkel geschminkten Augen und den blutroten Lippenstift perfekt abgerundet. Und trotzdem blinzle ich meine Freundin überrascht an. Ich habe noch nie miterlebt, dass sich Franca so aufreizend kleidet.
Meine Freundin mustert mich ebenfalls von oben bis unten. »Du wirst doch wohl nicht so zur Party gehen, oder?«, will sie wissen. Fragend schaue ich an mir runter. Im Vergleich zu Franca wirke ich mehr als underdressed in meinem schlichten Shirt und der zerschlissenen Jeans.
Ohne einen weiteren Kommentar wirft Franca mir ein kurzärmeliges Hemd und eine schwarze Hose an den Kopf.
»Zieh das an. Vertrau mir, es wird dir garantiert gut stehen«, fordert sie, begleitet von einem schiefen Grinsen.
Skeptisch betrachte ich die Sachen, bevor ich die Kleidung wechsle. Das Hemd ist zweifarbig und genau in der Mitte geteilt. Meine linke Hälfte wird in weißen Stoff gehüllt, die rechte in schwarzen. Durch die kurzen Ärmel kommt das Tattoo auf meinem rechten Unterarm gut zur Geltung: eine rote Motte. Sie bildet einen deutlichen Kontrast zu meiner farblosen Kleidung. Die schwarze Hose hat einen breiten, lockeren Schnitt und wird durch eine silberne Kette komplettiert, die an den Gürtelschnallen baumelt.
Ich betrachte mich von allen Seiten im Spiegel und bin beeindruckt darüber, wie gut die Kleidungsstücke miteinander harmonieren. Selbst meine geliebten Doc Martens passen zum Outfit.
»Die Teile habe ich noch in meinem Schrank gefunden. Anscheinend sind das die letzten Überreste meiner Goth-Phase aus der Schulzeit. Ich bin mir sicher, dass sie eine gewisse geheimnisvolle Fremde ansprechen werden, der wir vor Kurzem begegnet sind«, meint Franca grinsend.
Ich schnaube amüsiert auf. Es ist kein Geheimnis, dass meine Lieblingsfarbe Schwarz ist und ich mich nur äußerst selten in buntere Farben kleide. Unwillkürlich wandern meine Gedanken zu der jungen Frau mit den glühend roten Augen, die den Fremden begleitet hat. Ob sie auch auf der Party sein wird?
»Bist du bereit, ein bisschen Spaß zu haben?«, fragt Franca schließlich, als ich mich endlich vom Anblick meines Spiegelbildes löse.
Zögerlich nicke ich und ergreife Francas Hand. Ihr strahlendes Lächeln erhellt meine Welt und lässt mich für kurze Zeit all meine Sorgen vergessen. Egal was heute Abend geschieht, ich schwöre mir in diesem Moment, Franca mit allem zu beschützen, was ich habe.
Der Himmel über uns verfärbt sich Stück für Stück. Das zuvor helle Blau nimmt einen lilafarbenen Unterton an und geht schließlich in ein strahlendes Gold über. Alles in allem ein fast schon unwirklicher Farbzauber, den der Sonnenuntergang am Horizont entstehen lässt. Zumindest für diesen Anblick hat es sich gelohnt, herzukommen, denke ich mir, während ich mich gegen das metallische Geländer lehne. Mein Blick wandert zum Vesuv, dessen dunkle Umrisse sich gegen den bunten Horizont abheben und auf diese Weise einen scharfen Kontrast kreieren. Knapp oberhalb der Vulkanspitze wacht der volle Mond über das Land und ergießt sein silbriges Licht über Neapel.
»Wie lange dauert das denn noch?«, beschwert sich Franca hinter mir und reißt mich damit aus den Gedanken.
Ich wende mich ihr zu und sehe, dass sie sich auf einem der Sockel der Fontana dell’Immacolatella niedergelassen hat. Der Anblick der Brunnenskulptur weckt Erinnerungen an den unheimlichen Fremden, der uns in jener Nacht angesprochen hat. Wie war sein Name? Cas? Bisher ist er nicht aufgetaucht, auch wenn wir uns penibel an seine Anweisungen gehalten haben. Es ist Vollmond, und wir waren sogar zwei Stunden vor Anbruch der Nacht am vereinbarten Treffpunkt.
»Ich gebe ihm noch eine halbe Stunde. Wenn er dann nicht auftaucht, verschwinden wir. Tutto chiaro?«, biete ich an.
Franca nickt bloß und fokussiert die Umgebung, als würde sie vermuten, dass der Fremde sich jeden Moment aus den Schatten der benachbarten Gebäude schält.
Ich verkneife mir ein entnervtes Seufzen und versuche, nicht daran zu denken, dass wir den Abend entspannt auf der Couch hätten verbringen können.
Stattdessen stehe ich mir die Beine in den Bauch und beobachte, wie die letzten Strahlen der Sonne zwischen den Wellen versinken. Gleichzeitig erhellt sich Neapel mit jeder vergehenden Sekunde ein wenig mehr. Straßenlaternen leuchten auf, Fenster erhellen sich, und die unzähligen Motorrad- und Autofahrer schalten ihre Scheinwerfer ein. Die Stadt pulsiert vor Licht und Leben und macht so die Nacht zum Tag.
»Franca, wir warten schon eine halbe Ewigkeit auf diesen Bastardo. Lass uns endlich gehen«, meine ich. Inzwischen bemühe ich mich nicht einmal mehr, meinen entnervten Unterton zu verbergen.
»Per favore«, schiebe ich noch schnell hinterher. Der Typ wird nicht auftauchen. Er hat sich vermutlich nur einen Spaß mit uns erlaubt, als er uns zu dieser geheimen Untergrundparty eingeladen hat.
Franca blickt sich unsicher um, sucht ein letztes Mal die Straßen ab und lässt dann die Schultern sinken. Niedergeschlagen zieht sie die Mundwinkel nach unten. Sie gibt endlich auf.
»Entschuldigt die Verspätung«, ruft mit einem Mal jemand mit tiefer Stimme.
Irritiert wenden wir uns beide leicht nach rechts, wo sich gerade ein Mann neben uns stellt.
Ich erkenne ihn sofort wieder. Die schwarze Kleidung, die seltsame Brille und das verwegene Grinsen. Cas. Aber … wie ist das möglich? Noch vor einem Sekundenbruchteil stand niemand neben uns.
Unauffällig linse ich an Cas vorbei, doch ich entdecke keine weiteren Personen in seiner Nähe. Keine Spur von der geheimnisvollen Fremden, die ihn das letzte Mal begleitet hat. Ich bemühe mich, meine Enttäuschung zu verbergen.
Stattdessen werfe ich Franca einen unsicheren Seitenblick zu, allerdings ist diese komplett auf unseren mysteriösen Gastgeber fokussiert. Ihre Augen weiten sich, und ein schiefes Lächeln verzerrt ihren Mund.
»Wo habt ihr euren kleinen Freund gelassen? Will er sich diese Erfahrung wirklich entgehen lassen?«, möchte Cas wissen. Er muss Enno meinen, immerhin war dieser während seiner Einladung in jener Nacht ebenfalls anwesend.
Ich bereite mich gerade darauf vor, eine schnippische Antwort zu geben, als Franca abwinkt und ganz nebenbei meint: »Er hatte keine Zeit. Aber wir beide bringen genug gute Laune für drei Leute mit.«
Was zur Hölle redet sie da? Ich starre meine Freundin entgeistert an, als sie mit ihren Wimpern klimpert und breit lächelt. Meine Abneigung gegenüber dieser ganzen Idee muss deutlich spürbar sein, denn der Mann wendet sich skeptisch in meine Richtung und lässt fragend eine Augenbraue in die Höhe wandern.
»Na, wenn das so ist«, meint er trotzdem nur und kehrt uns den Rücken zu. »Folgt mir bitte. Falls ihr euch traut …«
Franca stößt mir ihren Ellenbogen in die Rippen, weil ich mich zunächst nicht von der Stelle bewege. Selten in meinem Leben habe ich ein derart schlechtes Bauchgefühl verspürt. Meine Intuition brüllt mir förmlich entgegen, Cas nicht zu folgen. Ich sollte Francas Hand nehmen und mit ihr schleunigst abhauen, bevor es zu spät ist.





























