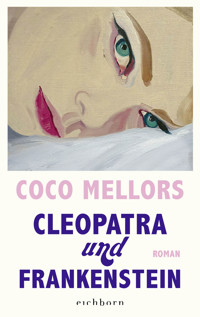23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei ungleiche Schwestern, wo zuvor vier waren: Ein Jahr nach Nickys Unfalltod treffen sich Avery, Bonnie und Lucky in New York wieder, um den Verkauf ihres Elternhauses zu verhindern. Doch Nicky hat eine solche Lücke hinterlassen, dass die übrigen drei nacheinander völlig aus der Bahn geraten. Gelingt es ihnen, aus dem existenziellen Scherbenhaufen gemeinsam etwas Neues entstehen zu lassen?
Nach dem internationalen Bestseller CLEOPATRA UND FRANKENSTEIN legt Coco Mellors ihr zweites Buch vor, das ihrem Debüt an Warmherzigkeit, sprachlicher Brillanz und psychologischem Tiefgang in nichts nachsteht. Ein unvergessliches Schwesterngespann und ein einzigartiger Roman!
»Selten war ein einziges Buch so reich an großartigen Figuren und gleichzeitig an neuer, erschütternder, aber vor allem herzerwärmender Erkenntnis!« Johanna von Festenberg, Elle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Drei ungleiche Schwestern, wo zuvor vier waren: Ein Jahr nach Nickys Unfalltod treffen sich Avery, Bonnie und Lucky in New York wieder, um den Verkauf ihres Elternhauses zu verhindern. Doch Nicky hat eine solche Lücke hinterlassen, dass die übrigen drei nacheinander völlig aus der Bahn geraten. Gelingt es ihnen, aus dem existenziellen Scherbenhaufen gemeinsam etwas Neues entstehen zu lassen?
ÜBER DIE AUTORIN
Coco Mellors ist in London und in New York aufgewachsen, wo sie auch ihr Studium an der NYU absolvierte und das prestigeträchtige Goldwater Fellowship erhielt. Ihre Texte sind u.a. in der beliebten »Modern Love«-Kolumne der NEW YORK TIMES erschienen, sowie im Onlinemagazin THE CUT. CLEOPATRA UND FRANKENSTEIN ist ihr erster Roman. Er wurde in viele Sprachen verkauft, eine TV-Adaption mit Warner Bros. ist in Arbeit. Coco Mellors lebt heute mit ihrem Mann in Los Angeles.
COCO MELLORS
BLUESISTERS
ROMAN
Aus dem Englischen von Lisa Kögeböhn
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der englischen Originalausgabe:
»Blue Sisters«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2024 by Coco Mellors
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text-und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
unter Verwendung einer Vorlage von:
Cover art by Gill Button / Illustration Division
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-6461-2
eichborn.de
luebbe.de
lesejury.de
Für Daisy,die von Anfang an für mich da war.
Und für Henry,der versprochen hat, es bis zum Schluss zu sein.
PROLOG
Eine Schwester ist keine Freundin. Woher kommt der Drang, eine Beziehung, die so ursprünglich und komplex ist wie die zwischen Geschwistern, auf etwas derart Austauschbares und Banales wie Freundschaft zu reduzieren? Und dennoch wird dieser Status immer wieder zur Charakterisierung der innigsten Verbindungen herangezogen. Meine Mutter ist meine beste Freundin. Mein Mann ist mein bester Freund. Nein. Wahre Schwesternschaft, nachdem dir im selben Mutterleib Fingernägel gewachsen sind, du schreiend aus demselben Geburtskanal gepresst wurdest, ist nicht dasselbe wie Freundschaft. Ihr wählt einander nicht aus, es gibt keine zaghafte Phase des Kennenlernens. Ihr seid Teil voneinander, von Anfang an. Nimm eine Nabelschnur – dick, sehnig, unansehnlich und doch lebensnotwendig – und vergleiche sie mit einem Freundschaftsbändchen aus buntem Garn. Das ist der Unterschied zwischen Schwester und Freundin.
Die älteste der Blue-Schwestern, ihre Anführerin, ist Avery. Sie kam weise und lebensmüde auf die Welt. Mit vier Jahren ging sie allein vom Kindergarten nach Hause in die elterliche Wohnung in der Upper West Side und verkündete, sie sei zu erschöpft, um weiterzumachen. Doch sie machte weiter, immer weiter. Avery brachte allen Schwestern bei, wie man vom Einmeterbrett springt, wie man Deli-Katzen unterm Kinn krault, um sich mit ihnen anzufreunden, und wie man Karten mischt, ohne sie zu zerknicken. Sie hasst Obrigkeiten, aber liebt Struktur. Sie hat ein fotografisches Gedächtnis; in der Highschool ist sie einmal ins Schularchiv eingebrochen, um sich die Sozialversicherungsnummern der gesamten Klassenstufe einzuprägen und ihre Mitschüler·innen den Rest des Schuljahrs in den Wahnsinn zu treiben, indem sie sie mit ihren neunstelligen Nummern ansprach.
Mit sechzehn machte sie ihren Highschool-Abschluss und absolvierte innerhalb von drei Jahren einen Bachelor an der Columbia University. Dann tauchte sie unter, um sich einer »anarchistischen, nicht-hierarchischen, konsensbasierten Gemeinschaft« alias Kommune anzuschließen, ehe sie kurze Zeit in San Francisco auf der Straße lebte, wo sie anfing, Heroin zu rauchen und schließlich auch zu spritzen. Ohne dass ihre Familie davon wusste, ging sie ein Jahr später in eine Entzugsklinik und ist seitdem clean. Im Anschluss schrieb sie sich für ein Jurastudium ein, in dem ihr fotografisches Gedächtnis ihr endlich zugutekam.
Es heißt, seine Prinzipien erkenne man erst, wenn sie nervig werden, und Avery ist das beste Beispiel dafür. Sie ist extrem prinzipientreu und oft genervt. Sie wäre gern Dichterin oder Dokumentarfilmerin geworden, ist aber Anwältin. Jetzt, mit dreiunddreißig, lebt sie mit ihrer Frau Chiti, einer sieben Jahre älteren Therapeutin, in London. Sie hat alle Studienkredite abbezahlt und besitzt Möbelstücke, die nahezu dieselbe Summe gekostet haben. Noch weiß sie es nicht, aber in wenigen Wochen wird sie ihr Leben und ihre Ehe auf eine Weise gegen die Wand fahren, wie sie es niemals für möglich gehalten hätte. Avery wäre gern durch und durch Rückgrat, ist aber zugleich weicher Kern.
Zwei Jahre nach Averys Geburt bekamen ihre Eltern Bonnie. Bonnie hat eine leise Stimme und einen starken Willen. Ihre Sprache ist die des Körpers. Mit sechs konnte sie auf den Händen laufen. Mit zehn konnte sie fünf Mandarinen gleichzeitig jonglieren. Sie machte erst Ballett, dann Bodenturnen, passte aber nie in die Schar biegsamer, femininer Mädchen. Als sie fünfzehn war, bekam sie von ihrem Vater Boxhandschuhe, nachdem sie ein Loch in ihre Zimmerwand geschlagen hatte, und fand ihre wahre Leidenschaft. Bonnies erstes Mal beim Boxen war vermutlich wie für andere der erste Sex. Ach, deshalb die ganze Aufregung.
Bonnie huldigt dem Gott der Disziplin. Nachdem sie schweigend den frühen Niedergang ihrer Schwester mit angesehen hatte, schwor sie sich, niemals auch nur einen Tropfen Alkohol anzurühren. Ihre Drogen sind Schweiß und Gewalt. Das hat sie bis in die IBA-Frauenweltmeisterschaften gebracht, neben den Olympischen Spielen der bedeutendste Amateurinnenwettbewerb im Boxen, wo sie Silber im Leichtgewicht gewann, bevor sie Profi wurde. Bonnie ist, was angesichts ihrer Sportart niemand vermuten würde, die sanfteste der Schwestern. Sie bekommt Eiswürfel aus der Form, ohne sie auf die Arbeitsplatte zu knallen. Babys und Hunde vertrauen ihr instinktiv. Sie ist eine schlechte Lügnerin. Auch wenn ihr Körper einer massiven Eichentür gleicht, ist ihr Wesen durchschaubar wie ein Fenster. Mit inzwischen einunddreißig Jahren – auf dem Höhepunkt ihrer Boxkarriere – hat Bonnie nach einer krachenden Niederlage sowohl New York als auch dem Sport den Rücken gekehrt. Sie ist nach Venice Beach, Los Angeles, geflohen, wo sie einen Job als Türsteherin in einer leicht zwielichtigen Bar angenommen hat.
Die meisten Menschen gehen durchs Leben, ohne das Gefühl zu kennen, eine Berufung zu haben und flüchtige Alltagsfreuden einem Traum zu opfern, der wenn überhaupt erst Jahre später in Erfüllung gehen wird. Es hebt dich von anderen ab, ob du willst oder nicht. Das kann zermürbend sein, einsam und hart, aber wenn es wirklich deine Berufung ist, hast du keine andere Wahl. So fühlte sich Boxen für Bonnie an. Und trotzdem findet man sie jetzt in irgendeiner Seitenstraße in Venice, wo sie leere Pints einsammelt, beschwipsten Frauen ins Taxi hilft und Zigarettenstummel auffegt, keine Spur mehr von der anarchischen, erbarmungslosen Kämpferin, zu der das Boxen sie gemacht hatte.
Ihre Eltern wünschten sich als Nächstes einen Sohn, doch nach zwei Fehlgeburten, über die nie wieder gesprochen wurde, bekamen sie Nicole, die immer nur Nicky genannt wurde. Von allen Mädchen war Nicky die Mädchenhafteste. Sie machte Kaugummiblasen, die so groß waren wie ihr Kopf. Sie hörte bis ins Erwachsenenalter ganz unironisch Teen Pop. Ihr Lieblingshobby als Kind war, Schmetterlinge aus Raupen zu züchten, die sie mit winzigen Kürbisstückchen fütterte. Mit zehn kaufte sie sich den ersten Bügel-BH, um gut vorbereitet zu sein. Bis zum Highschool-Abschluss hatte sie bereits fünf Freunde gehabt. Sie plante gern die kompletten Outfits der Woche im Voraus, einschließlich passender Unterwäsche. Sie konnte sich im fahrenden Taxi mit flüssigem Eyeliner perfekte Katzenaugen schminken, ohne den Schwung nach oben zu versauen. Nicky war bei den Jungs beliebt, zog aber Mädchenfreundschaften vor. Am College schloss sie sich einer Studentinnenverbindung an, womit ihre Schwestern sie gnadenlos aufzogen, aber das war ihr egal. Da ihre Schwestern die meiste Zeit mit ihrer eigenen Karriere beschäftigt waren und Nicky sie vermisste, suchte sie sich eben eine Wahlfamilie aus Freundinnen.
Wenn Avery die Vernünftige und Bonnie die Stoische war, dann war Nicky die Sensible. Sie war ein Jahrmarkt der Gefühle, die sie nie zu verbergen versuchte. Manchmal war sie ein wild kreiselndes Karussell, manchmal die Karambolage im Autoscooter und manchmal die regungslos wartende Zielscheibe in der Schießbude. Sie war die geborene Mutter, aber ihr Körper hatte anderes im Sinn. Nach jahrelangen monatlichen Qualen wurde Mitte zwanzig Endometriose bei ihr diagnostiziert. Obwohl sie mit siebenundzwanzig starb, war sie kein typisches Mitglied dieses Clubs; sie war weder Sängerin in einer Band, noch führte sie ein sonderlich wildes Leben, und trotzdem starb sie jung. Hätte man Nicky gefragt, hätte sie gesagt, ihr Leben sei sogar außergewöhnlich gewöhnlich, als Englischlehrerin in der zehnten Klasse einer Highschool in der Upper West Side, zehn Blocks von ihrem Elternhaus entfernt. Es mochte ein bescheideneres Leben als das ihrer Schwestern sein, doch sie empfand es nie so. Sie liebte ihre Schüler·innen und träumte davon, eines Tages eine eigene Familie zu gründen. Nichts an ihrem Leben deutete auf ihren Tod hin, außer der Tatsache, dass sie Schmerzen hatte.
Ein Jahr nach Nickys Geburt versuchten ihre Eltern ein letztes Mal ihr Glück mit dem langersehnten Sohn. Und bekamen Lucky. Versehentlich innerhalb von fünfzehn Minuten zu Hause geboren, machte Lucky sehr schnell klar, welchen Platz innerhalb der Familie sie einnehmen würde. Wie alt Lucky auch sein mag, sie wird immer das Baby sein. Zu Nickys ersten Worten gehörte mein Baby, und fortan schleppte sie das winzige Wesen überall mit hin. Die beiden blieben unzertrennlich, aber klein blieb Lucky nicht. Sie brachte es auf einen Meter achtzig. Ihre Eltern hatten vier Versuche, etwas Heißbegehrtes zu erschaffen: weibliche Schönheit. Bei Lucky war es ihnen gelungen. Selbst ihr schiefes Gebiss mit den ungewöhnlich spitzen Eckzähnen verleiht ihrem Lächeln etwas Sinnliches, Wölfisches. Kürzlich hat sie sich ohne Einverständnis ihrer Agentur die Haare scheren und weiß bleichen lassen. Jetzt sieht sie aus wie eine Mischung aus Barbie, Billy Idol und einem Husky. Lucky arbeitet als Model, seit sie vierzehn ist, und war schon überall auf der Welt unterwegs, was im Umkehrschluss bedeutet, sie war schon überall auf der Welt einsam.
Wenn Lucky einen Raum betritt, ist es, als glitte ein Zitteraal in ein Goldfischglas. Sie ist schlagfertig und insgeheim schüchtern. Während ihrer Zeit in Tokio hat sie sich das Gitarrespielen beigebracht und ist sogar ziemlich gut darin, würde sich aber niemals trauen, vor anderen aufzutreten. Sie liebt Computerspiele, liebt eigentlich jede Form von Eskapismus. Im Augenblick lebt sie allein in Paris. Sie hat die Worte Ich brauche einen Drink dieses Jahr schon einhundertzweiunddreißig Mal gesagt. Häufiger als Ich liebe dich in ihrem ganzen Leben. In ihrer Wohnung in Montmartre hängen die gerahmten blauen Schmetterlinge, die Nicky ihr vor ihrem Tod geschenkt hat, über ihrem Bett, aber sie schläft nur selten. Lucky ist sechsundzwanzig Jahre alt und heillos verloren. Alle hinterbliebenen Schwestern sind es.
Doch was sie nicht wissen: Solange du am Leben bist, kannst du auch gefunden werden.
KAPITEL EINS
Lucky
Lucky war spät dran. Unentschuldbar, unumkehrbar, unter Umständen sogar jobgefährdend spät dran. Um zwölf hatte sie ein Fitting für eine Couture-Show im Marais, aber das war vor zehn Minuten gewesen, und sie war immer noch in der Metro, kilometerweit entfernt. Den gestrigen Abend hatte sie auf einer Fashion-Week-Party verbracht, sich am Gratisalkohol bedient (wenn es nach Lucky ging, der beste Alkohol) und zwei Street Artists in Festanstellung kennengelernt, die unbedingt ihren Ruf als Kreative am Rand der Gesellschaft wiederherstellen wollten. Sie hatten ihr angeboten, sie hinten auf dem Motorrad zu einem leerstehenden Gebäude mitzunehmen, dem Haus eines ehemaligen Diplomaten im 16. Arrondissement, das sie taggen wollten. Lucky war nicht sonderlich scharf darauf, ein historisches Gebäude mit Sprühdosen zu verunstalten, aber sie war immer dafür zu haben, das Ende des Abends nach hinten zu verschieben.
Das Gebäude war stärker gesichert als erwartet, mit Überwachungskameras gespickt und von einem abschreckenden Stacheldrahtzaun umgeben, sodass sie stattdessen das Rollgitter eines Tabacs um die Ecke besprühten. Die Street Artists sprayten libertäre Slogans, die durch die Pariser 1968er-Proteste populär geworden waren – Es ist verboten zu verbieten! –, während Lucky sich für eine klassische Darstellung von Penis und Eiern entschied. Auf den Stufen vorm Palais de Tokyo sahen sie sich den Sonnenaufgang an, tranken flaschenweise Veuve-Clicquot-Rosé, den sie von der Party hatten mitgehen lassen, und gingen danach noch zu Lucky, um einen Joint zu rauchen. Auf den vorhersehbaren Versuch der beiden Männer hin, einen flotten Dreier anzuleiern, schlug Lucky vor, die beiden sollten doch die Frau in der Mitte weglassen und es sich gegenseitig besorgen, ehe sie vollständig bekleidet auf dem Bett einschlief und Stunden später in der leeren, glücklicherweise nicht leergeräumten Wohnung von der unverblümten Erinnerung ihrer Agentin, sich heute vorm Fitting doch bitte die Haare zu waschen, wieder aufwachte.
Heute war außerdem Nickys erster Todestag.
Während die Metro durch den Tunnel sauste, checkte Lucky ihr Handy und sah einen verpassten Anruf inklusive Mailboxnachricht von Avery, die sie garantiert dazu bringen wollte, diesen Tag und die dazugehörigen Gefühle »aufzuarbeiten«, sowie eine formell wirkende E-Mail ihrer Mutter, die sie gekonnt ignorierte. Sie vermisste die New Yorker Subway mit ihrem Schmutz, der zuverlässigen Unzuverlässigkeit und dem fehlenden Handyempfang; die Pariser Metro war geradezu aufdringlich effizient, und selbst unter der Erde hatte man durchgehend Empfang. Hier konnte man sich nirgendwo verstecken. Ohne Averys Nachricht abzuhören, ließ Lucky das Handy zurück in die Tasche gleiten. Seit Nickys Beerdigung vor einem Jahr hatte sie niemanden aus ihrer Familie mehr gesehen. An jenem Abend hatte ein heftiger, heißer Wind in der Stadt geweht; er riss Restauranttische um und fegte Mülltonnen durch die Straßen, beschädigte Stromkabel und brach Äste im Central Park ab. Und er verstreute Lucky und ihre Schwestern in unterschiedliche Winkel der Welt, ohne jede Absicht, nach Hause zurückzukehren.
Sie war inzwischen eine Viertelstunde zu spät. In der Hektik hatte sie ihre In-Ear-Kopfhörer vergessen, ein Versehen, das ihr den ganzen Tag verderben würde. Lucky konnte keinen Häuserblock weit gehen, ohne sie sich in die Ohren zu stecken und eine musikalische Barriere zwischen sich und der Welt zu errichten. Aber sie hatte es in Rekordzeit vor die Tür geschafft, weil sie ihr übliches Frühstück bestehend aus einer Marlboro Red und einer Ibuprofen hatte ausfallen lassen und in den Kleidern von gestern Abend aufgebrochen war. Verstohlen schnupperte sie an ihrem T-Shirt. Etwas verraucht, etwas verschwitzt, aber im Großen und Ganzen okay.
»Je voudrais te sentir.«
Luckys Blick huschte zu dem Mann, der ihr gegenübersaß und sie gerade angesprochen hatte. Er hatte das nervöse, nagerartige Gesicht eines Beutetiers, aber die Augen einer Raubkatze. Zwischen seinen Beinen klemmte eine große Volvic-Flasche, die auf sie gerichtet war. Er grinste.
»Was?«, fragte sie, obwohl sie gar nicht wissen wollte, was der Mann gesagt hatte, geschweige denn sich mit ihm unterhalten wollte.
»Ah! Du bist Américaine?«, fragte er in typisch Englisch-Französischem Mischmasch.
»Yup.«
Lucky nickte und griff wieder nach ihrem Handy, um Desinteresse zu signalisieren.
»Du bist wunderschön«, sagte er und beugte sich zu ihr.
»Mhm, danke.«
Sie hielt den Blick aufs Handy geheftet. Kurz überlegte sie, ihrer Agentin eine Nachricht zu schicken, dass sie spät dran war, entschied sich aber dagegen. Das würde die Verspätung nur offiziell machen. Lieber den tröstlichen Schwebezustand so lange wie möglich genießen, ehe irgendjemand mitbekam, dass sie es wieder einmal verkackt hatte.
»Und so groß«, fuhr der Mann fort.
In ihrer dunklen Vintage-Levi’s und dem schwarzen bauchfreien Top wirkte Lucky tatsächlich so lang und gerade wie ein Ausrufezeichen. Sie zog Kopf und Schultern ein, damit er weniger von ihr sah, und verwandelte sich in ein Fragezeichen.
»Mon dieu!«, sagte er leise zu sich selbst. »T’es trop sexy.«
Sie hätte aufstehen und gehen sollen. Sie hätte ihm ein Fick dich entgegenschleudern sollen. Sie hätte sich seine Wasserflasche schnappen – seinen bescheuerten großen blauen imaginären Phallus – und in der Faust zerquetschen sollen. Stattdessen zeigte sie auf ihr Handy.
»Sorry, ich muss …«
Sie verzog das Gesicht und tat so, als müsse sie jemanden anrufen. Hektisch scrollte sie durch ihre Kontakte. Aber wen sollte sie anrufen? Sie wollte mit niemandem sprechen. Aus Gewohnheit suchte sie Nickys Namen und tippte auf Anrufen. Die Schwestern teilten sich einen Familien-Handyvertrag, der über Avery lief; wahrscheinlich hatte sich Avery den Kummer erspart, Nickys Nummer zu kündigen, indem sie einfach weiter ihren Anteil zahlte. Lucky wusste nicht, wo Nickys Handy jetzt war, wahrscheinlich mit leerem Akku in irgendeiner Schublade, aber sie war froh, dass ihr wenigstens das blieb. Die Stimme ihrer Schwester drang an ihr Ohr.
Dies ist die Mailbox von Nicky, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Viel Spaß!
Sie kicherte, das Aufnehmen der Nachricht war ihr unangenehm gewesen. Im Hintergrund hörte Lucky ganz leise ihr jüngeres Ich lachen, unwissend, welcher Verlust in der Zukunft auf sie wartete.
»Ich möchte dich kennenlernen«, beharrte der Mann.
»Ich telefoniere«, sagte Lucky.
»Ah, d’accord.« Der Mann lehnte sich zurück und hob in einer lächerlich galanten Geste die Hände. »Wir reden später.«
Es war nicht das erste Mal, dass sie Nicky nach deren Tod anrief; der Drang, mit ihrer Schwester zu sprechen und ihr zu erzählen, wie das Leben ohne sie war, ließ sich einfach nicht unterdrücken. Wenn sie anrief, kam sie sich vor wie eine Amputierte, die sich immer wieder hinstellen will, weil sie glaubt, sie hätte noch Beine.
»Hi, ich bins«, sagte Lucky nach dem Signal. »Ich … Also, ich wollte nur mal Hallo sagen.«
Sie sah zu dem Mann rüber, der gar nicht erst so tat, als würde er nicht lauschen.
»Hier ist gerade Fashion Week und alles etwas hektisch, also eigentlich wie immer, aber ich wollte trotzdem anrufen, weil … Na ja, ist irgendwie schon ein großer Tag für dich, oder? Ein Jahr! Ich kann es nicht fassen. Also ja, ich wollte bloß anrufen und dir … Nee, natürlich nicht gratulieren. Fuck, ist ja schließlich keine Feier. Ich wollte dir nur sagen, dass ich an dich denke. Ich denke ständig an dich. Und ich vermisse dich. Natürlich.« Lucky räusperte sich. »Ja, das wars. Hab dich lieb.« Lucky wartete darauf, dass sie irgendetwas spürte, irgendeine kosmische Energieverschiebung, die ihr zeigte, dass ihre Schwester zuhörte. Nichts. »Außerdem nervt Avery. Tschüs.«
Sie legte auf und sah aus dem Fenster. Sie waren fast in Saint Paul, wo sie aussteigen musste. Als sie sich entknotete, um aufzustehen, streckte der Mann die Hand nach ihrem Arm aus. Sie zuckte zusammen, als hätte er sie mit einem Streichholz versengt.
»Kann ich deine Nummer haben?«
Die Bahn fuhr in die Station ein und bremste, und Lucky verlor das Gleichgewicht. Er grinste, als sie ins Taumeln geriet. Seine Zähne waren tabakbraun verfärbt.
»Du bist so sexy«, sagte er.
Der Mann musterte sie mit besitzergreifendem Blick, als suche er sich ein Törtchen in der Patisserie aus. Die Wasserflasche ragte noch immer zwischen seinen Beinen hervor.
»Darf ich?«, fragte sie und zeigte darauf. Die Bahn hielt an.
»Die hier?«, fragte er verblüfft. Er reichte ihr die Plastikflasche. »Mais bien sûr.«
Sie nahm ihm die Flasche aus der Hand, schraubte den Deckel ab und kippte ihm das restliche Wasser in den Schritt. Mit einem Schrei sprang der Mann auf, als sich ein dunkler Fleck auf seiner Jeans ausbreitete. Lucky stürmte Richtung Tür und zog am silbernen Hebel, dieser sonderbaren Apparatschaft, die es nur in der Pariser Metro gab, und die Türen sprangen auf. Vom Bahnsteig aus hörte sie noch, wie er ihr Schlampe hinterherrief, während sich die Fahrgäste zwischen ihnen in den Waggon schoben. Sie rannte die Treppe hoch, zwei Stufen auf einmal, und trat in den Sonnenschein.
Auf der Place des Vosges flogen steinerne Bögen über Lucky hinweg, als sie zu der Adresse rannte, die ihre Agentin ihr genannt hatte. Zwei ältere Männer, die im identischen olivgrünen Trenchcoat einträchtig rauchten, drehten sich nach ihr um. Sie klingelte und ging durch eine blaue Tür mit abgeplatztem Lack, die in den Innenhof führte. Auf der gegenüberliegenden Seite führte eine hohe Wendeltreppe nach oben; ihre Schritte in den schweren Stiefeln hallten von den Steinmauern wider, als sie die Treppe erklomm und auf jedem Stockwerk Halt machte, um zu verschnaufen. Die Schachtel pro Tag, die sie seit dem Teeniealter rauchte, rächte sich bei solchen Aktivitäten. Das letzte Stück musste sie sich am Treppengeländer nach oben ziehen. Eine Frau mit strengem dunklem Nackendutt und einem geschlängelten Maßband um den Hals stand in der Tür und erwartete sie.
»Ich weiß, ich bin zu spät«, keuchte Lucky. »Je suis désolée.«
»Und Sie sind?«, fragte die Frau in spitzem Tonfall.
»Lucky –« Sie schnaufte. »Blue.«
»Luu-ki?«, wiederholte die Frau mit Blick auf ihr Klemmbrett. Hinter ihr hörte Lucky emsiges Nähmaschinengeratter. »Sie sind nicht zu spät. Sie sind viel zu früh. Ihr Fitting ist um zwei.«
Lucky stützte die Hände auf den Knien ab und ächzte.
»Ich dachte, um zwölf?«
»Falsch gedacht. Bitte kommen Sie um zwei wieder. Ciao!«
Mit einem nachdrücklichen Klick wurde ihr die Tür vor der Nase zugemacht. Lucky widerstand der Versuchung, sich an Ort und Stelle zusammenzurollen und auf der Türschwelle zu schlafen wie eine streunende Katze, bis sie dran war. Langsam schleppte sie sich die Treppe hinunter.
Weil sie nichts zu tun hatte, trottete sie auf der Suche nach einer Bar durch die sonnengesprenkelten Straßen des Marais. Das Adrenalin ihrer Volvic-Vendetta und des darauffolgenden Gehetzes zum Fitting ebbte ab und offenbarte die leisen Anfänge eines Katers, der brutal zu werden versprach, wenn sie ihn nicht im Keim erstickte. Es war Anfang Juli, und trotz des milden Wetters hatte sich diesen Sommer eine ruhelose Stimmung in Paris breitgemacht. Ein Generalstreik und der daraus resultierende Stau erfüllten die Luft mit dunstigem Smog, und nachdem es vermehrt zu Messerstechereien in U-Bahnstationen und Wohngebieten gekommen war, hatte die Polizeipräsenz auf den Straßen heftig angezogen. Doch im Marais mit seinen Boutiquen, vollen Bars und trubeligen Cafés war von alledem glücklicherweise kaum etwas zu spüren.
Lucky hörte eine Frauenstimme, die von der gegenüberliegenden Straßenseite ihren Namen rief, und als sie sich umdrehte, entdeckte sie ihre Freundin Sabina, eine rothaarige Französin und Modelkollegin, über deren Körper Lucky einmal einen Designer hatte sagen hören, er sei wie hundert Kilometer einwandfreier Straßenbelag, draußen vor einem Café mit zwei Male Models. Sie winkte Lucky rüber.
»Na, wenn das mal nicht das Punk-Partygirl ist«, sagte der Größere der beiden, Cliff, als sie näher kam.
Cliff war ein ehemaliger australischer Profisurfer, der es in dieser Saison zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hatte, indem er in Mailand nur mit einem goldenen String bekleidet über den Laufsteg gelaufen war. Trotzdem war es unmöglich, ihn auf sein Äußeres zu reduzieren; die enorme Größe seines Egos verhinderte das. Noch dazu ließ ihn das Wissen, dass er die Modewelt jederzeit hinter sich lassen und zu einem Van-Life auf der Jagd nach der perfekten Welle zurückkehren könnte, seine aktuelle Jobwahl völlig zwiespaltlos betrachten, anders als Lucky, deren Schönheit sowohl für ihren Unterhalt als auch eine gewisse Scham sorgte. Außer dem Modeln hatte sie noch nie einen Job gehabt, was sich für sie so anfühlte, als hätte sie noch nie einen Job gehabt. Sie hätte es niemals zugegeben, aber sie beneidete Cliff um seine Freiheit.
»Ciao, Gold-Ei«, sagte sie, nahm eine Zigarette aus der Packung vor ihm und steckte sie sich zwischen die Lippen. »Hab dich gar nicht erkannt mit Klamotten an.«
Das andere Model, ein milchgesichtiger Amerikaner, den Lucky nicht kannte, lachte und beugte sich vor, um ihr Feuer zu geben. Er hatte nicht nur die Haarfarbe eines Golden Retrievers, sondern schien auch genauso eifrig und wahllos jedem gefallen zu wollen. Vor den Männern stand je ein großes Bier, Sabina schwenkte ein kleines Glas Weißwein, ohne daraus zu trinken. Lucky winkte dem Kellner und bestellte ein Bier, bevor sie sich setzte.
»Hey, ich bin Riley«, sagte der junge Typ.
»Ich brauche einen Drink«, sagte Lucky und lehnte sich zurück, wobei sie einen blassen Streifen Bauch freilegte.
»Das ist Lucky«, sagte Sabina. »Ma sœur.«
Lucky bestätigte das mit einem angedeuteten Nicken. Sabina hatte die für Einzelkinder charakteristische Tendenz, Freund·innen als Familienmitglieder zu rekrutieren; in Wahrheit wussten die beiden, abgesehen von ihren jeweils letzten Kampagnen und Lieblingsdrinks, kaum etwas übereinander.
»Ach, du bist Amerikanerin!«, sagte Riley. Er hatte einen leichten Südstaatenakzent, der seine Vokale klingen ließ wie in Baumwolle gehüllt. »Ich warte schon den ganzen Tag darauf, jemanden aus Amerika zu treffen.« Er hob sein Bier. »Happy vierten Juli!«
Lucky pustete eine dünne Rauchsäule gen Himmel.
»Danke, ich feiere nicht.«
Dieses Jahr, nächstes Jahr, jedes Jahr für den Rest ihres Lebens würde der Vierte nur noch der Tag sein, an dem Nicky gestorben war. Riley runzelte die Stirn.
»Aber du bist doch Amerikanerin, oder?«, fragte er.
»Nicht ganz«, sagte sie. »New Yorkerin.«
»Aber jetzt wohnt ihr in Paris«, sagte Sabina. »Also müsst ihr den Tag der Bastille feiern.«
»Wann ist der?«, fragte Cliff.
»Nächste Woche schon«, sagte Sabina.
»Der Juli scheint der Monat zu sein, um sich aus den Fängen der Tyrannei zu befreien«, bemerkte Cliff.
»Also, ich vermisse es«, sagte Riley. »Ich war am Vierten noch nie im Ausland. Meine Familie schmeißt jedes Jahr eine große Grillparty.«
»Tja, tut mir leid«, sagte Sabina, »in Frankreich wird nicht gegrillt.« Sie stellte ihr Glas weg und winkte ab. »Ich kann das nicht trinken. Ich hab immer noch Kopfweh von heute Morgen. Was müssen die backstage auch vorm Frühstück Sekt ausschenken?«
»Weil es das Einzige ist, was ihr Girls zu euch nehmt«, konterte Cliff. »Wie war das noch gleich? Champagner, Koks und unverbindlicher Sex?«
Sabina ignorierte ihn einfach. Sie sah hoch Richtung Himmel, der einen trüben Grauton angenommen hatte.
»Sieht nach Regen aus, non?«
»Oh Mann«, sagte Riley. »Meine nächste Show ist draußen.«
»Meine auch«, sagte Lucky.
»Meine erste Fashion Week, und es regnet«, sagte er niedergeschlagen.
Cliff stimmte den Refrain von »Ironic« von Alanis Morissette an, mit erstaunlich melodischer Stimme. It’s like raaaaain on your wedding day.
»Hallo? Das ist haute couture«, sagte Sabina. »La crème de la crème. Die lassen dich nicht nass werden, glaub mir.«
»Du meinst wohl die Klamotten«, sagte Lucky, dann wandte sie sich an Cliff. »Also, was meintest du vorhin über weibliche Models? Ist ja nun nicht so, als wärt ihr Typen das Paradebeispiel für Zurückhaltung und gesunden Lebensstil.« Sie tippte gegen Cliffs fast leeres Bierglas.
»Wir vertragen wenigstens was, im Gegensatz zu euch.« Er zeigte mit dem Finger auf sie. »Wer nichts isst, sollte auch nichts trinken.«
»Ich esse«, sagte Lucky und griff nach dem Bierglas, das gerade vor ihr abgestellt worden war, »damit ich trinken kann.«
Cliff lachte und bestellte noch eine Runde.
»Was du kannst, kann ich schon lange.«
»Ich wette, ich vertrage mehr als du«, sagte Lucky.
Cliff hob sein Glas und trank den letzten Schluck.
»Das wollen wir doch mal sehen.«
Eine Stunde später hatte Lucky fünf Drinks intus und setzte gerade zur lustigsten Geschichte aller Zeiten an. Die Traurigkeit, die am Vormittag wie Schmutz an ihr geklebt hatte, war mit jeder neuen Runde mehr und mehr von ihr abgewaschen worden.
»Mit neunzehn hab ich ein Jahr lang in Tokio gelebt«, erzählte sie. »Das war ziemlich cool, aber ich war eventuell etwas unvernünftig, ihr kennt das, ewig aufbleiben, Termine verpennen, quasi alles, was man nicht tun sollte, wenn man ganz am Anfang steht.«
Lucky zeigte mit dem Finger auf den jungen Riley und zog warnend eine Augenbraue hoch.
»Das kommt mir jetzt ein bisschen vor wie Wasser predigen und Wein trinken, Lucky«, sagte Cliff. »Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du das alles immer noch genauso machst.«
»Hey, ich brauche keine Ratschläge«, sagte Riley. »Ich bin dreiundzwanzig, ich weiß, was ich tue.«
»Ich auch!«, rief Sabina. »Ich bin sogar schon seit drei Jahren dreiundzwanzig.«
Lucky lachte und nahm noch einen Schluck aus ihrem Glas.
»Meine Agentur hat schon gedroht, mich rauszuschmeißen, aber dann wurde ich völlig unerwartet für eine Kampagne gebucht. Irgendeine blöde kommerzielle Marke, aber trotzdem, Geld ist Geld. Meine Agentin ruft also an und sagt zu mir: ›Lucky, wenn du auch nur eine Minute zu spät zum Shooting kommst, bist du gefeuert. Eine Minute.‹«
»Ich weiß, was kommt«, sagte Riley. »Du bist zu spät, sie feuern dich, aber du wirst trotzdem ein berühmtes Model.«
»Hältst du sie für berühmt?« Sabina schnappte nach Luft. »Berühmter als mich?«
Riley sah zwischen den beiden hin und her.
»Nein, ich meine, j-ja«, stammelte er. »Ich meine, keine Ahnung. Ihr seid beide wunderschön.«
»Sie verarscht dich«, sagte Lucky.
»Tut sie nicht«, sagte Cliff. »Egal, ich bin eh berühmter als ihr beide zusammen.«
Sabina rümpfte die Nase.
»Keiner von uns ist berühmt«, sagte Lucky. »Egal, zurück zur Geschichte. Am Abend vor dem Shooting gehe ich früh ins Bett, fest entschlossen, rechtzeitig aufzustehen. Aber ich wohnte in einem Modelapartment in Shibuya, das im Grunde nicht viel anders war als ein Bordell. Ich liege also im Bett und versuche, brav zu sein, da stürmt eine Horde Mädels rein und kreischt: ›In Harajuku ist eine Eröffnungsparty, der ultraheiße Schauspieler, der letztes Jahr den Cowboyastronautendingsda im Oscar-Gewinnerfilm gespielt hat, ist auch da, eine von uns muss ihn abschleppen, los, zieh dir Schuhe an, wir müssen los.‹ Und, keine Ahnung, ich habe null Willenskraft, also schwöre ich bei Gott, nur einen Drink zu trinken, und gehe mit.«
Lucky machte eine Pause, um den Rest ihres Biers herunterzukippen, drehte sich zum Kellner um und signalisierte ihm, ihr noch eins zu bringen.
»Und was dann?«, fragte Cliff. »Bitte sag, dass du gefeuert wurdest.«
Lucky stieß einen genüsslichen Rülpser aus und grinste.
»Schlimmer. Ich mache die Nacht durch …«
»Und der Schauspieler?«, fragte Sabina.
»Den hat sich eine Russin geschnappt.«
Sabina rümpfte die Nase.
»Typisch.«
»Am nächsten Morgen wache ich auf und hab natürlich den Termin um eine Stunde verpasst. Habt ihr schon mal einen Job verschlafen?«
»Ich hätte fast meine SATs verpasst, weil meine Mom mich nicht rechtzeitig geweckt hat«, sagte Riley mit großem Ernst.
Lucky nickte.
»Also kennst du das Gefühl.«
Sie ließ unter den Tisch fallen, dass dazu auch noch der Comedown von einer wilden Mischung aus Ecstasy, Angel Dust und Kokain kam, in Japan alles drei extrem schwer zu beschaffen. Doch natürlich war es Lucky gelungen, denn was Partydrogen anging, war sie quasi ein Trüffelschwein.
»Als ich endlich aufwache, hat mich meine Agentin schon fünfzehnmal angerufen«, erzählte sie weiter. »Ich rufe sie zurück, und sie fragt, wo ich bin, wieso ich nicht rangehe. Spontan erzähle ich ihr, ich sei mit Konjunktivitis aufgewacht und konnte nicht ans Telefon gehen, weil ich nichts sehen kann. Bescheuert, ich weiß, aber ich war noch nicht ganz auf der Höhe.«
Cliff schnaubte.
»Und das hat sie dir geglaubt?«
»Natürlich nicht. Sie meinte, sie bräuchte eine Bescheinigung vom Arzt, dass ich wirklich eine Infektion hätte, sonst würde mich die Agentur feuern, und ich müsste zurück nach New York. Scheiß drauf! Aber ja, ich geriet trotzdem in Panik. Und beschloss, dass es nur eine Lösung gab: Mir selbst eine Konjunktivitis zu verpassen und dann zum Arzt zu gehen.«
»Warte«, unterbrach Sabina. »Was ist Konjunktivitis? Kriegt man das von Sex?«
Riley, der gerade einen Schluck Bier genommen hatte, verschluckte sich.
»Nur, wenn der Typ schlecht zielt«, sagte Cliff.
Lucky beugte sich über den Tisch und schlug ihn, dann tippte sie sich ans Auge, um Sabina zu zeigen, was sie meinte.
»Bindehautentzündung.«
»Ah, conjonctivite!«, rief Sabina. »Je comprends.«
»Was, die Verbindung konntest du jetzt nicht herstellen?«, fragte Cliff. »Das ist praktisch dasselbe Wort.«
»Psst«, sagte Sabina. »Hör auf, mit mir zu flirten.«
»Jedenfalls«, sagte Lucky, »war mein Plan, alles Dreckige anzufassen, was ich finden konnte, und mir dann ins Auge zu fassen. Da Tokio bekanntlich supersauber ist, war das gar nicht so einfach. Aber zum Glück wohnte ich ja mit zwölf absolut ekelhaften Models zusammen. Die schmierige Arbeitsplatte? Super. Die Klobrille? Perfekt! Der Arsch von einem ihrer Schoßhündchen? Okay, wird getätschelt.«
»Bah!«, schrie Riley, spürbar begeistert.
»Ich gehe zum Arzt, und meine Augen sind, wie ihr euch vorstellen könnt, ziemlich rot von der ganzen Aktion. Der Arzt würdigt mich keines Blickes. ›Was brauchen Sie?‹ Ich sage, ich brauche eine Krankschreibung. Er gibt mir den Wisch, und schon bin ich wieder draußen. So einfach. Ich rufe meine Agentin an und sage, ich hab die Bescheinigung. ›Super‹, sagt sie. ›Aber da ich von vornherein wusste, dass du lügst, habe ich dem Kunden gesagt, dass du auf Reisen warst und dein Flug Verspätung hat. Sie meinten, du kannst morgen kommen.‹ Tja, Happy End, oder? An dem Abend gehe ich rechtzeitig ins Bett. Wache gut gelaunt auf und … habe Bindehautentzündung.«
»Mais non!«, quietschte Sabina.
»Mais oui, Motherfucker!«, schrie Lucky.
Zwei Französinnen mittleren Alters sahen empört vom Nachbartisch zu ihnen rüber. Lucky winkte ihnen fröhlich zu.
»Also bist du richtig am Arsch«, sagte Cliff.
»Genau. Meine Augen sind total rot und geschwollen. Ich verpasse das Shooting und verliere den Kunden.«
»Und die Agentur? Haben sie dich gefeuert?«, fragte Riley.
»Fast.« Lucky nickte. »Sie haben mich quasi auf Bewährung behalten. Aber ein paar Wochen später habe ich auf einer Party den Chefredakteur der Vogue Japan getroffen. Der Typ hat Humor, also hab ich ihm die Story erzählt. Er fand sie so lustig, dass er mich kurz darauf im Ernst gebucht hat. Das war quasi der Anfang meiner Editorial-Karriere.«
»Du bist echt ein Glückspilz, Lucky.« Cliff schüttelte den Kopf.
»Lucky ist wie eine Katze«, sagte Sabina. »Sie hat neun Leben.«
»Deine Eltern hatten wohl schon so eine Ahnung, als sie dich Lucky genannt haben«, sagte Riley.
»Meine Eltern hatten überhaupt keine Ahnung«, sagte Lucky und zündete sich noch eine Zigarette an. »Haben sie bis heute nicht.«
Stille breitete sich am Tisch aus. Mit dem Ende der Geschichte war auch die dunkle Welle der Traurigkeit zurückgekehrt, die sie jeden Moment mit sich zu reißen drohte. Sie wollte nicht an ihre Eltern denken, nicht an Nicky, nichts, was sich außerhalb dieses kleinen Cafétischs befand, aber ihre Familie war immer da, immer bereit, sich in den Vordergrund zu drängen.
Ihre Schwestern waren nachsichtiger, aber Lucky wusste, dass sie einen schlechten Dad gehabt hatten. Da waren sie sicher nicht die Einzigen. In ihrem ganzen Leben hatte sie höchstens eine Handvoll Menschen getroffen, die einen guten Dad hatten. Und die waren alle komisch. Kinder, die mit liebevollen Vätern aufwuchsen, hatten die gleiche weichgespülte Blauäugigkeit wie Kinder, die an Orten wie Malibu aufwuchsen, ein Leben in ewigem Sonnenschein. Sie mussten sich kein dickes Fell zulegen. Lucky hatte die Theorie, eine Kindheit mit einem schlechten Dad sei so, als würde man an einem Ort mit langen, rauen Wintern aufwachsen. Es härtet ab. Außerdem bereitet es dich auf die Wirklichkeit vor, in der Sommer kein Lebensstil, sondern eine Jahreszeit ist, und die meisten Männer keine Chance auslassen, dir wehzutun. Vielleicht glaubten das aber auch nur die Menschen, die mit einem schlechten Dad aufgewachsen waren.
Das Witzige daran war, dass ihr Vater nicht etwa kaltherzig war, nicht immer zumindest. Launenhaft, so würde sie ihn beschreiben. Unbeständig wie das Wetter. Ebenso wie man regelmäßig einen Blick aus dem Fenster wirft, um herauszufinden, wie der Tag wird, behielten sie auch ihn im Auge. Lucky und ihre Schwestern konnten seine Laune daran ablesen, wie er die Wohnungstür schloss. Genau wie niemand auf die Idee käme, bei Hagel zu picknicken, gab es gewisse Dinge, die man in Anwesenheit eines wütenden Dads nicht tat. Kein Streit um die Fernbedienung, keine lauten Telefongespräche mit Freundinnen, keine Tränen wegen einer schlechten Note, kein Gelächter über einen schlechten Witz, kein Gejammere gegenüber ihrer Mom, dass sie Hunger hätten. Er war der einzige Mann im Haus, aber gleichzeitig war er das Haus. Sie lebten in seinen Launen.
Lucky hatte seine blauen Augen und das helle Haar geerbt und redete sich gern ein, das sei die einzige Ähnlichkeit. Er war ein schottischer Amerikaner in der dritten Generation, mit einer Kindheit, in der es dermaßen von katholischen Nonnen gewimmelt hatte, dass es, wie er zu sagen pflegte, jeden zum Atheisten gemacht hätte. Er las leidenschaftlich gern und hielt noch bis in seine Trinkerjahre an der Ein-Buch-pro-Woche-Gewohnheit fest, aber seine eigentliche Religion war Sport. Football, Boxen, Golf, Fahrradfahren – er guckte alles. Genau wie Bonnie war er mehr in seinem Körper als in seinem Geist zu Hause. Er hätte Profisportler werden sollen, aber obwohl er es mit Football-Stipendium ans College geschafft hatte, sorgte ein Muskelfaserriss im Oberschenkel dafür, dass er nach dem Abschluss einen Job in einer Bank annahm, den er den Rest seines Lebens behalten sollte. Egal, wie heftig oder häufig er sich betrank, er war immer rechtzeitig bei der Arbeit. Aus dem Grund konnte ihre Mutter auch nie zugeben, dass er ein Problem hatte. Welcher Alkoholiker behielt denn bitte über Jahre seinen Job? Ihrer, wie sich herausstellte.
Es fiel Lucky leicht zu sagen, dass sie einen schlechten Vater hatte. Schwieriger war es, sich einzugestehen, dass ihre Mutter auch nicht viel besser war. Sie war in einem heruntergekommenen Anwesen in Sussex aufgewachsen, als einzige Tochter einer depressiven Mutter und eines schlimmen Trinkers von Vater, die der typisch britischen Kombination von Upperclass und völlig pleite angehörten, »nobel ohne Zobel«, wie ihre Mutter es nannte. Als sie ins Teeniealter kam, hatte ihr Vater den Großteil seines Erbes verprasst. Auch noch nachdem ihre Mutter den späteren Dad der Mädchen kennengelernt und geheiratet hatte, hegte sie eine tiefe Verachtung für das britische Klassensystem, dem sie entflohen war.
Lucky wusste nicht viel über das Leben ihrer Mom, aber sie wusste, dass ihre Mutter die Flucht aus diesem unglücklichen Zuhause, dem ganzen verdammten Land, ergriffen hatte, sobald sie konnte. Sie landete in New York und fing an, downtown in einer Galerie zu arbeiten. Damals hatte sie seidiges rotbraunes Haar bis zur Taille und ein hübsches, tulpenförmiges Gesicht. Sie behauptete, sie wäre hauptsächlich eingestellt worden, um im Minirock im Schaufenster zu stehen und reiche Männer in die Galerie zu locken, aber mit ihrem guten Auge für junge Künstler·innen hatte sie ihre Chefs überzeugt, einige frühe Arbeiten von Maler·innen zu kaufen, die inzwischen weltberühmt waren.
Hätte ihre Mutter keine Kinder bekommen, hätte sie Galeriedirektorin oder gefeierte Kuratorin werden können, davon war Lucky überzeugt, aber nach Averys Geburt hatte sie aufgehört, in der Galerie zu arbeiten. Dann, als Avery fünfzehn und Lucky acht war, hatte ihre Mutter angefangen, als Museumsführerin zu arbeiten, und es ihrer Ältesten überlassen, auf die anderen aufzupassen. Sie behauptete, sie bräuchten das Geld, was stimmte, aber wahrscheinlich verdiente sie pro Stunde weniger als eine von ihnen als Babysitterin bekommen hätte. In erster Linie hatte sie es satt, Mutter zu sein, eine Rolle, in die Avery fortan klaglos schlüpfte. Lucky gab es nur ungern zu, aber Avery war eine bessere Mom als die meisten Menschen sich wünschen konnten, und trotzdem hatte sie nicht vor, sie heute zurückzurufen.
Sie schnipste die Zigarettenasche in den muschelförmigen Aschenbecher und stieß den Rauch aus. Sie hätte gern eine Falltür in ihrem Kopf geöffnet, um darin zu verschwinden, an einen Ort, an dem keine Erinnerungen mehr zu ihr dringen konnten, und es gab nur eine Möglichkeit, das zu erreichen. Sie schob ihr leeres Bierglas beiseite und schenkte den anderen ihr wölfisches Grinsen.
»Sollen wir was Stärkeres bestellen?«
Lucky machte sich auf den Rückweg durch die taubengrauen Straßen, die vor ihren Augen verschwammen wie ein impressionistisches Gemälde. Sie hatte kurz überlegt, auf der Toilette mit Riley zu vögeln, aber er schien eher der anhängliche Typ zu sein, sodass sie die extrem vernünftige Entscheidung getroffen hatte, stattdessen pünktlich zum Fitting zu erscheinen. Sie wich einem Hund aus und stolperte, ihre Fingerspitzen streiften den Gehweg, dann richtete sie sich wieder auf. Sie war höchstens leicht angetrunken. Sie vertrug Alkohol besser als jeder Kerl, dachte sie selbstzufrieden. Zumindest besser als Cliff, der gerade eine sentimentale A-capella-Version von John Lennons »Imagine« für die kichernde Sabina zum Besten gegeben hatte, als Lucky gegangen war.
Auf dem ehemals ruhigen Innenhof hinter der blauen Holztür herrschte inzwischen geschäftiges Treiben. Ein langer weißer Laufsteg war in der Mitte der gepflasterten Fläche aufgebaut worden, und um ihn herum wurden nun von Arbeiter·innen Stühle verteilt, Kabel verlegt und der Bereich für die Fotograf·innen eingerichtet. In der Modebranche prallten zwei Welten aufeinander, wurde Lucky wieder einmal bewusst: Eine emsige Schar von Bühnenarbeiter·innen würde in den nächsten Stunden Herkulesarbeit leisten und dann von der Bildfläche verschwinden, als wäre sie nie dagewesen, damit Lucky und ihresgleichen auf ihrem Werk in seidenen Roben durch ein Meer von Zuschauer·innen schweben konnten.
Sie umrundete einen Mann mit einem schwankenden Stuhlturm, der so hoch war, dass es als Zirkuskunststück durchgegangen wäre, und erklomm erneut die schwindelerregende Wendeltreppe. Alles drehte sich, als sie das stickige Atelier betrat. Eine warme Wolke menschlicher Ausdünstungen stieg ihr in die Nase. Über ihr drehte sich nutzlos ein Deckenventilator und verteilte die Hitze im Raum, statt sie zu bekämpfen. Eine Frau schob einen überquellenden Kleiderständer mit sorbetfarbenen Taftkleidern an ihr vorbei, ohne sie zu beachten.
Lucky spürte, wie ihr Kopf synchron mit dem Ventilator Karussell fuhr. Sie trat ans Fenster und beugte sich an die frische Luft, atmete tief ein. Das Atelier ging zum Hof hinaus, und Lucky konzentrierte sich auf die kahle Stelle im Haar des Mannes, der dort unten gerade den strahlend weißen Laufsteg polierte. Sie versuchte ihren dröhnenden Schädel zu beruhigen.
»Sieht es nach Regen aus?«
Lucky drehte sich um. Die Stylistin mit dem strengen Haarknoten und dem Maßband von vorhin eilte heran.
»Wir fürchten alle, dass es regnet«, erklärte die Stylistin und klaubte sich eine silberne Sicherheitsnadel von den Lippen.
Lucky steckte den Kopf wieder aus dem Fenster, um den Himmel zu begutachten. Links war er grau, rechts blassblau.
»Fifty-fifty«, sagte sie.
Die Worte fühlten sich wie pelzige Früchte auf ihrer Zunge an. Die Stylistin runzelte unmerklich die Stirn.
»Alors, hier entlang, bitte.«
Lucky wurde in eine noch heißere Ecke des Raumes geführt, wo ihr Outfit mit Polaroid von ihr auf einem Samtbügel hing. Es war ein Neckholder-Ballkleid mit ausgestelltem Rock in der Form eines umgedrehten Martiniglases. Der Stoff war zuckrig rosa, wie die Unterseite einer Katzenpfote. Über das kunstvoll drapierte Korsett wand sich ein silbernes Paillettengeäst mit funkelnden Kirschblüten. Die Stylistin sah Lucky erwartungsvoll an.
»Allein die Applikation hat dreihundert Stunden gedauert«, sagte sie.
Aber Lucky konnte nicht antworten, sie musste sich voll und ganz darauf konzentrieren, ihre Jeans auszuziehen, ohne umzukippen. Nachdem es ihr gelungen war, sich Jeans und T-Shirt zu entledigen, stand sie schwankend in Unterwäsche da, mit einer Unbefangenheit, die ihr schon früh in ihrer Modelkarriere eingeimpft worden war. Falls sich die Stylistin eine entzückte Reaktion erhofft hatte, musste Lucky sie leider enttäuschen. Mit ihren schmuddeligen Socken stieg sie in das steife Kleid. Sie spürte, wie sie von hinten ins Korsett geschnürt wurde, ihre Rippen wurden eingequetscht, es kniff an der Taille.
»Wunderschön«, seufzte eine Schneiderin an ihrem Arbeitsplatz. »Wie eine Prinzessin.«
Lucky stieß einen leisen Rülpser aus.
»Die Designer sind gleich da, um es sich anzusehen«, sagte die Stylistin. »Aber ich schaue noch kurz, wie es sitzt.«
»Könnte ich ein Glas Wasser haben?«, krächzte Lucky.
Irritiert reichte ihr die Stylistin eine Flasche Volvic mit Sprudel und Erdbeergeschmack. Lucky nahm vorsichtig einen Schluck. Sie hasste Erdbeeren. Kaum hatten die süßlichen Blasen ihren Magen erreicht, wusste sie, dass das ein Fehler gewesen war. Sie rannte zum offenen Fenster, und ein brauner Schwall Bier und Wodka brach aus ihr hervor, wobei das Korsett wie eine Magenpumpe wirkte. Stinkende Galle brach sich wellenartig Bahn. Lucky starrte hinunter auf die Lache, die gerade aus ihr herausgekommen war und jetzt rorschachartig den weißen Laufsteg sprenkelte. Der Mann mit der kahlen Stelle, den sie ein paar Minuten zuvor beobachtet hatte, sah jetzt entsetzt zu ihr hoch, nachdem er der Sintflut knapp entronnen war. Hinter sich hörte sie die spitzen Schreie der Schneiderin und der Stylistin, die sie anflehten, kein Erbrochenes aufs Kleid zu tropfen. Lucky war zur Hälfte drinnen und zur Hälfte draußen, ihr Oberkörper hing über dem Fensterbrett. Kurz kam ihr der Gedanke, wie schön es wäre, für immer dort zu bleiben, in diesem Zwischenraum, weder hier noch da, dann wischte sie sich einen sauren Spuckefaden vom Mund. Vor ihr schimmerten die schrägen Pariser Dächer im Licht. Die Sonne war endlich herausgekommen.
KAPITEL ZWEI
Bonnie
Bonnie wurde noch vor Sonnenaufgang von den Geräuschen eines Eindringlings geweckt. Jemand machte sich an ihrer Wohnungstür zu schaffen und versuchte einzubrechen. In Sekundenschnelle schnappte sie sich den Baseballschläger, den sie neben dem Bett liegen hatte, und schoss ins kleine Wohnzimmer. Alles ruhig, und bis auf den Stapel Kartons in der Ecke und einen Klappliegestuhl war der Raum leer. Die Straßenlaternen malten schwefelgelbe Streifen auf den nackten Boden. Sie stand stocksteif da und lauschte. Wieder rüttelte die Tür im Rahmen. Bonnie hielt die Luft an und schlich mutig durchs Zimmer, bis sie nah genug an der Tür war, um mit einem leisen Klicken aufzuschließen. In einer fließenden Bewegung riss sie sie auf und ließ den Schläger durch die Luft sausen. Mit einem metallischen Geräusch kam er auf dem Boden zu ihren Füßen auf. Sie ließ den Blick über den leeren Laubengang schweifen, gesäumt von den nassen Handtüchern, die die Nachbarskinder über Nacht auf der Brüstung zum Trocknen aufhängten, und schüttelte den Kopf. Sie kämpfte mal wieder mit sich selbst.
Im Augenblick schlief Bonnie meistens bis mittags. Durch ihren Job als Türsteherin im Peachy’s, einer Bar in der Nähe, war sie oft erst um drei oder vier Uhr morgens zu Hause. Das genaue Gegenteil ihres Tagesrhythmus in den Jahren zuvor, denn da war sie jeden Tag vor Sonnenaufgang aufgestanden, um mit dem Training zu beginnen, und hatte noch vor dem Frühstück mehr körperliche Aktivitäten hinter sich, als die meisten Menschen in einer ganzen Woche zusammenbekamen. Trainieren tat sie zwar noch immer, aber längst nicht mehr mit der gleichen Intensität, mit der sie sich auf Wettkämpfe vorbereitet hatte. In diesen Phasen hätte man ihr Training genausogut als Leben bezeichnen können, denn daneben gab es für sie nichts.
Bonnie ging wieder ins Bett und fiel in flachen, fieberhaften Schlaf. Das nächste Mal wachte sie davon auf, dass irgendwo in der Wohnung ihr Handy klingelte. Sie benutzte es so selten, dass sie sich nicht gleich erinnern konnte, wo es war, manchmal ließ sie es tagelang auf dem Kühlschrank oder dem Badewannenrand liegen. Sie schleppte sich aus dem Bett ins Wohnzimmer und fand es auf einem der ungeöffneten Kartons, auf dem Display blinkte Averys Name. Es war früher Nachmittag, sogar für ihre Verhältnisse spät.
»Aves«, sagte sie mit rauer Stimme.
Sie hörte ihre Schwester aufatmen.
»Bon Bon, endlich. Was sagst du zu dieser fucking E-Mail von Mom?«
Bonnie runzelte die Stirn.
»Welche E-Mail?«
»Hast du die noch nicht gesehen? Bist du gerade erst aufgestanden?«
Bonnie ging in die Küche, drehte das Wasser auf und beugte sich vor, um direkt aus dem Hahn zu trinken.
»Ich hab doch jetzt ein Klapphandy«, sagte sie und wischte sich den Mund ab. »Da ist nix mit E-Mail. Was steht denn drin?«
»Okay, mach dich auf was gefasst«, sagte Avery. »Warte, ich les sie dir vor … Moment … Liebe Mädchen, kaum zu glauben, dass schon ein Jahr ohne unsere geliebte Nicky vergangen ist. Ich schreibe euch, weil die Wohnung, wie ihr wisst, die letzten zwölf Monate leer gestanden hat und euer Vater und ich die schwierige Entscheidung getroffen haben, sie zu verkaufen. Falls ihr noch irgendetwas von Nickys Sachen haben wollt, holt sie euch bitte bis Ende des Monats. Das Umzugsunternehmen kümmert sich um den Rest. Ich verbleibe in Liebe, eure Mutter.«
Bonnie schnappte unwillkürlich nach Luft. Damit hatte sie nicht gerechnet. Ihre sechsköpfige Familie hatte in einer Dreizimmerwohnung in einem Altbau in der Upper West Side gewohnt, die ihre Eltern vor Jahrzehnten weit unter Marktwert gekauft hatten. Avery hatte sich das größere Kinderzimmer mit Bonnie geteilt, Lucky und Nicky das kleinere. Ihre Eltern schliefen dort, wo eigentlich der Essbereich gewesen wäre, der mit einem bemalten Raumteiler vom Wohnzimmer abgetrennt war.
Bonnie hatte einmal gehört, dass ein Hai in einem Aquarium zwanzig Zentimeter, in der Freiheit hingegen zwei Meter lang wird. Doch die Wohnung ihrer Kindheit schien den entgegengesetzten Effekt gehabt zu haben. Bonnie und ihre Schwestern wuchsen und wuchsen, bis sie nicht mehr hineinpassten. Sie selbst zog kurz nach ihrem siebzehnten Geburtstag aus, um ihre Amateurinnenkarriere zu beginnen, Nicky zog fürs College in einen anderen Bundesstaat, und Lucky, die mit fünfzehn gescoutet wurde, modelte kurz darauf überall auf der Welt. Als endlich alle weg waren, verschwand Avery und tauchte ein Jahr später clean und fest entschlossen, Jura zu studieren, wieder auf. Nachdem ihr Vater in Rente gegangen war, zogen ihre Eltern aufs Land, vorgeblich, weil die Stadt seiner Gesundheit abträglich war, in Wirklichkeit jedoch, weil sie seiner Trinkerei zuträglich war. Nicky und sie zogen wieder dort ein und zahlten ihren Anteil an der Hypothek, während Nicky Englisch an einer Highschool in der Nähe unterrichtete und Bonnie zumindest in den Pausen zwischen Wettkampfreisen und Trainingscamps dort wohnte und in Pavels Boxclub an ihren Fähigkeiten arbeitete. Bis zuletzt war es eine gute Lösung für alle gewesen.
»Was soll das heißen, ich verbleibe eure Mutter?« Avery wurde lauter. »Als stünde zur Debatte, dass sie nicht unsere Mutter bleibt?«
»Ziemlich kaltherzig, ja«, stimmte Bonnie zu. »Sogar für ihre Verhältnisse.«
Sofort überkam sie ein schlechtes Gewissen. Sie versuchte, niemals schlecht über ihre Mutter zu sprechen, aber in Wahrheit standen sie sich nicht nahe. Avery und Nicky waren immer das bindende Glied zwischen den Schwestern und ihrer Mutter gewesen. Am meisten hatte sich ihre Mutter für Nicky interessiert, obwohl sie mit keiner ihrer Töchter viel gemeinsam hatte. Da sie Sport hasste und Bonnie anders als Nicky keinen großen Sinn für Kunst zeigte, hatte immer eine respektvolle Distanz zwischen den beiden geherrscht. Avery hingegen übernahm als Erwachsene die Rolle der pflichtbewussten Tochter, vermutlich um ihre Abwesenheit während der Drogenabhängigkeit wiedergutzumachen, besuchte ihre Eltern alle paar Jahre upstate und rief an Feiertagen und Geburtstagen an. Doch Bonnie spürte den heißen Groll, den Avery ihnen gegenüber insgeheim hegte und der wie Magma unter der Oberfläche ihrer Fürsorglichkeit brodelte. Lucky und Bonnie hatten ihre elterlichen Bedürfnisse seit ihrer Jugend ausgelagert, Lucky an ein wechselndes Team aus Booker·innen und Agent·innen und Bonnie an ihren Boxtrainer, Pavel Petrovich. Die wenigen mütterlichen Ratschläge und aufmunternden Worte, die sie brauchten, holten sie sich bei Avery. An wen Avery sich wandte, bevor sie Chiti hatte, wusste Bonnie bis heute nicht.
»Meinst du, wir sollten sie anrufen?«, fragte Bonnie und hatte jetzt schon Angst davor.
»Hab ich«, entgegnete Avery knapp. »Sofort nach Erhalt der E-Mail.«
Bonnie verkniff sich ein Grinsen. Avery war einfach eine typische Anwältin.
»Und?«, fragte sie.
»Und sie verkaufen sie wirklich. Sie haben schon einen Kaufinteressenten.«
»Wow«, war alles, was Bonnie herausbekam. Sie wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Averys Empörung schien für sie beide zu reichen.
»Den Rest des Telefonats hat sie mir von ihrem neuen Dünger für den Garten vorgeschwärmt«, sagte Avery und wurde vor Genervtheit noch lauter. »Das war wieder so typisch. Wir telefonieren so selten, und wenn wir es dann tun, geht es buchstäblich um irgendwelche Scheiße.«
Ihre Mutter hatte sie immer gut versorgt und nie geschlagen – das rief Bonnie sich gern in Erinnerung. Aber sie war völlig überfordert. Sie war keine Mutter, die Befriedigung aus der Hausarbeit oder dem Kochen zog, und trotzdem bat sie nie um Hilfe. Jeden Abend wappnete sie sich für die Aufgabe, die vier zu versorgen, wie eine Forscherin den anstrengendsten Teil einer Expedition in Angriff nimmt, die sie längst bereut, sich aber fest vorgenommen hat, sie durchzuziehen. Bonnies Ansicht nach machte Avery ihrer Mutter Angst, Bonnie machte sie ratlos, Nicky wickelte sie um den Finger und Lucky flog unter ihrem Radar. Ideal war natürlich nichts davon.
Bonnies Gefühle ihrem Vater gegenüber waren komplizierter. Sie war gleichzeitig stolz und peinlich berührt, weil er mehr Interesse an ihr als an seinen anderen Töchtern gezeigt und häufig gewitzelt hatte, sie sei der Sohn, den er nie hatte. In ihrer Kindheit hatte er sie abends mit in den Central Park genommen, wo sie auf dem Great Lawn schweigend den Ball hin und her warfen, bis das letzte Licht über den Rasen gewandert war, und das einzige Geräusch waren das leise Klatschen von Leder auf Haut sowie von Zeit zu Zeit ein anerkennendes Brummen nach einem besonders guten Fang gewesen. Auf dem Nachhauseweg legte er ihr seine schwere Hand in den Nacken und schob sie vorwärts, und in ihr kämpften widerstrebende Gefühle von Freude und Klaustrophobie, einerseits der Wunsch nach seiner Aufmerksamkeit und andererseits der ebenso starke Drang, ihr zu entfliehen, ihm zu entfliehen, und frei, befreit von dieser Last zurück in Sicherheit, zu ihren Schwestern zu rennen. Als Bonnie fünfzehn wurde und das Boxen für sich entdeckte, weitete sich seine Trinkerei, die zuvor außerhalb ihres Zuhauses oder nach ihrer Bettgehzeit stattgefunden hatte, auf die frühen Abendstunden aus, in denen sie sonst zusammen gespielt hatten. Obwohl sie sich Sorgen um ihn machte, erinnerte sie sich am deutlichsten an ihre Erleichterung darüber, seine Hand nicht mehr in ihrem Nacken spüren zu müssen.
»Also, was denkst du?«, fragte Avery. »Sollen wir versuchen, sie aufzuhalten?«
Bonnie wusste nicht, was sie denken sollte. Die Wohnung war das einzige Zuhause, das sie je gekannt hatte, zugleich ein Mühlstein um den Hals und ein Anker. Das letzte Jahr über hatte Avery die Hypothek und die monatlichen Instandhaltungskosten übernommen, damit die Wohnung leer stehen konnte, aber allen war klar, dass das keine Dauerlösung war. In ihrer Familie, das wusste Bonnie aus Erfahrung, war es am besten, eine neutrale Haltung einzunehmen.
»Was denkst du denn?«, fragte sie.
»Ich bin dafür«, sagte Avery entschlossen. »Das ist schließlich auch unser Zuhause, sie haben kein Recht dazu.«
»Abgesehen von der Tatsache, dass sie die Besitzer sind«, murmelte Bonnie.
»Mir doch egal!«, erwiderte Avery gereizt. Sie klang jetzt genauso wie früher als Teenie. »Würde es dir wirklich nichts ausmachen, wenn sie sie verkaufen?«
Bonnie hatte die Wohnung immer geliebt, aber nach dem, was dort passiert war, konnte sie keinen Fuß mehr hineinsetzen.
»Na ja, es ist ihre Wohnung und ich … kann ihren Wunsch respektieren«, sagte sie lahm.
»Mein Gott, ich wünschte, ich wäre so nonchalant wie du«, sagte Avery.
Bonnie lachte zurückhaltend.
»Ich weiß nicht mal, was das heißt.«
»Das heißt, dass du im Gegensatz zu mir nicht an einem stressbedingten Herzinfarkt sterben wirst.«
»Aber was ist mit Nickys ganzem Kram?«, fragte Bonnie.
In der Hinsicht war sie weniger nonchalant. Am anderen Ende der Leitung stieß Avery einen langgezogenen Seufzer aus.
»Ich weiß«, sagte sie. »Eine von uns muss hinfahren und alles in Sicherheit bringen.«
»Ich bin ja am nächsten dran …«, setzte Bonnie an, ihr Herz klopfte.
»Schon okay«, beeilte sich Avery zu sagen. »Das würde niemand von dir erwarten. Ich überlege mir was.«
Bonnie atmete auf. Dass Avery diejenige in der Familie war, die sich immer um alles kümmern musste, betrübte und erleichterte sie gleichermaßen.
»Danke«, sagte sie leise.
»Ich kann nicht fassen, dass es schon ein Jahr her ist«, sagte Avery mit gedämpfter Stimme.
»Ich weiß …« Bonnie lächelte traurig in sich hinein. »Zeit ist echt eine krasse Sache.«
»Du klingst sehr nach L.A. Wie ist es überhaupt?«
Bonnie ging durchs Wohnzimmer und trat hinaus auf den Laubengang, kniff die Augen gegen das helle Sonnenlicht zusammen.
»Super. Ich schaue gerade aufs Meer.«
In Wirklichkeit konnte Bonnie gerade mal den Hinterhof sehen, wo eine Möwe einen Pizzarand aus einer Mülltüte zerrte. Sie wohnte in einer leicht heruntergekommenen Straße einen Block vom Strand entfernt, in einem von mehreren maroden Gebäuden, deren Apartments noch zur Kurzzeitmiete verfügbar waren, gern genutzt von einer wechselnden Belegschaft von Surfer·innen, Studierenden, Saisonarbeitskräften, alternden Hippies und funktionierenden Drogenabhängigen – den Menschen, die Venice das verliehen, was Makler·innen gern »Lokalkolorit« nannten, die selbst allerdings noch kein Maklerbüro von innen gesehen hatten.
»Schön«, sagte Avery. »Ich schaue gerade auf eine Akte.«
»Jetzt noch? Ist es nicht schon spät bei dir?«
»Kennst mich doch«, sagte Avery.
Und das tat Bonnie. Für Avery war Arbeit an die Stelle von Drogen getreten: Mit ihrer Hilfe blendete sie die Welt aus.
»Hast du irgendwas unternommen, um … na ja, zum Gedenken?«, fragte Avery.
»Noch nicht. Du?«
»Bis jetzt nur, euch alle anzurufen. Wenn wir irgendeine Tradition etablieren wollen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.«
Bonnie pustete sich eine Strähne aus den Augen.
»Was hätte Nicky denn gefallen? Ist ja nicht so, als gäbe es eine Anleitung fürs Trauern.«
Averys Stimme nahm den resoluten Tonfall an, der normalerweise für Klient·innen reserviert war.
»Warte, ich gucke mal nach.« Bonnie hörte sie tippen. »Wie … begeht … man … einen … Todestag.«
Bonnie schüttelte den Kopf und schnaubte leise. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Möwe, die auf der Suche nach weiteren Schätzen wie wild auf die Mülltüte einhackte.
»Aves, ich glaube, da müssen wir auf unser Bauchgefühl hören. Das Internet kann uns nicht sagen, was wir tun sollen.«
»Das Internet kann uns immer sagen, was wir tun sollen. Siehst du, hier ist eine Liste.« Avery las vor. »Nummer eins, das Grab besuchen … Okay, wir sind nicht in New York, also geht das nicht. Nummer zwei, Schmetterlinge freilassen …«
Bonnie prustete.
»Okay, warte, ich hol schnell mein Netz.«
Avery lachte.
»Nummer drei klingt schon sinnvoller. Einen Brief, ein Gedicht oder einen Blog schreiben.«
»Ein Gedicht? Einen Blog? Was sind das für Leute?«
»Okay, okay. Nummer vier: das Lieblingslied der Verstorbenen anhören.«
»Weißt du, was das war?«
»Nee, aber Lucky bestimmt«, sagte Avery.
»Lucky würde uns wahrscheinlich irgendeinen Death-Metal-Track sagen, um uns zu verarschen.«
»Falls sie je an ihr Handy geht, werden wir es herausfinden.«
Jetzt nahm Averys Stimme die Spitze an, mit der sie zu kaschieren versuchte, dass sie verletzt war, auch wenn sie es niemals zugeben würde. Bonnie wusste, wie gern sie einen Draht zu ihrer jüngsten Schwester entwickelt hätte, die selbst so flatterhaft war wie ein Schmetterling. Bonnie hätte ihr gern gesagt, dass man Lucky nur lieben konnte, wenn man ihren Freiheitsdrang akzeptierte. Lass sie kommen und gehen, wie es ihr passt, dann wird sie irgendwann auf deiner Hand landen. Aber wie gewöhnlich beschloss Bonnie, sich nicht einzumischen.
»Okay, weiter«, sagte Avery. »Fünf, wir könnten eine besondere Gedenkfeier abhalten. Sechs, liebevolles Andenken durch Blumen …«
»Klingt alles nicht nach Nicky.«
»Ich weiß. Okay, der letzte Vorschlag auf der Liste lautet, sich hinzusetzen.«
»Das wars?« Bonnie runzelte die Stirn. »Das ist der Vorschlag? Sich hinsetzen?«
»Mehr steht da nicht. Setzen Sie sich hin.«
»Na, das werden wir wohl hinbekommen.«
»Ich sitze schon an meinem Schreibtisch. Meinst du, ich soll mich woanders hinsetzen?«
»Ja, setz dich woanders hin. Vielleicht auf den Boden.«
»Okay, dann setz dich auch auf den Boden.«
Bonnie hockte sich vor der Tür auf den Boden, lehnte sich mit dem Rücken an die Außenwand und schloss die Augen. Sie konnte die Möwen hören und ihre Nachbarn, die unterdrückt stritten, Ich habs dir gesagt, ich habs dir gesagt, wiederholte der Mann, und dahinter das träge Tosen der Wellen. Die Sonne strahlte golden durch ihre Augenlider. Die Luft schmeckte nach Salz und Müll und Licht.
»Hast du das Gefühl, das bringt was?«, fragte sie.
»Ich glaube, das soll gar nichts bringen«, sagte Avery. »Es soll uns nur die Möglichkeit geben, uns an sie zu erinnern und, na ja, unsere Trauer zu spüren.«
»Toll«, sagte Bonnie.
»Spürst du sie?«
»Meine Trauer? Glaub schon. Vielleicht bin ich aber auch nur hungrig.« Das sollte witzig sein, aber am anderen Ende der Leitung blieb Avery still. »Und du?«, fragte sie zaghaft. »Spürst du was?«
Sie hörte Averys flachen Atem durchs Handy.
»Ich bin so wütend«, flüsterte Avery. »Ist das nicht krank? Ich weiß, ich sollte traurig sein, aber die meiste Zeit bin ich einfach nur wütend auf sie.«
»Ich glaube, das ist … normal? Oder? Frag doch mal Chiti, die weiß das bestimmt.«
»Es fühlt sich aber nicht normal an. Ich würde ihr am liebsten wehtun. Wenn sie hier wäre, würde ich ihr gegen den Hals boxen.«
Bonnie grinste.
»Ziemlich komische Stelle, um jemanden zu boxen.«
»Na ja, ich würde ja nicht ihr Gesicht treffen wollen. Nur in der Nähe, damit sie weiß, wie wütend ich bin.«
»Versteh ich schon. Ich würde ihr auch gegen den Hals boxen.«
»Ja, aber du würdest sie damit wahrscheinlich umbringen.«
»Zu spät.«
Die Worte hingen wabernd zwischen ihnen.
»Wie gehts dir wirklich, Bon Bon?«, fragte Avery. »Wie läuft die … Nachtclub-Sache?«
»Gut.« Bonnie zuckte mit den Schultern. »Heute Abend arbeite ich wieder.«
Weit weg in London gab Avery ein missbilligendes Brummen von sich. »Was machst du eigentlich da? Wir sind doch keine L.A.-Menschen.«
»Ich vielleicht schon«, sagte Bonnie.