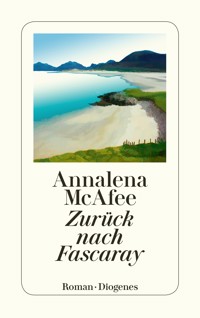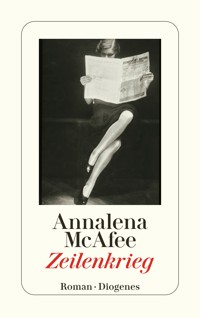12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eve – eine Künstlerin mit einem Faible für Blumen und junge Männer – bereitet in London eine große Museumsretrospektive vor. Aber ihr Leben ist in Aufruhr: Ihre Ehe steht vor dem Aus, ihre Tochter ist eine Enttäuschung, ihre größte Rivalin setzt ihr zu, und ihre Affäre mit dem weitaus jüngeren Luka ist so berauschend wie gefährlich. Eve jedoch ist alles andere als ein zartes Pflänzchen. Die Geschichte einer kompromisslosen Künstlerin, die ihre Passion über alles stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Annalena McAfee
Blütenschatten
roman
Aus dem Englischen von pociao und Roberto de Hollanda
Diogenes
Für Jane Maud und Mary Kane Shilling
Wie ein Mann ist, so sieht er.
William Blake, Brief an Reverend Dr. J. Trusler (1799)
1
Nacht. Winter. Eine Straße in der Stadt. Das Echo von Eves Schritten hallt über den breiten Bürgersteig, als sie an den düsteren georgianischen Häusern mit Stuck und Säulengängen und dem privaten Garten in der Mitte vorbeigeht. Grüne Kränze an allen Haustüren stellen guten Geschmack und ein festliches Gemeinschaftsgefühl zur Schau, doch die meisten Häuser liegen im Dunkeln. In Nummer 19 verleihen die Lampen des großen Schlafzimmers im zweiten Stock den geschlossenen roten Vorhängen einen feurigen Schimmer. Drei Türen weiter flimmern die Fenster im Erdgeschoss blau – jemand hat die Spätnachrichten an, döst gemütlich vor den katastrophalen Berichten aus einer zerfallenden Welt –, und im Souterrain fällt der matte bernsteinfarbene Schein einer Nachttischlampe durch die Ritzen der Jalousien.
Wenige Schritte weiter in Nummer 31 ist der Salon im ersten Stock schamlos erleuchtet – hässliche abstrakte Gemälde und unförmige Skulpturen grell zur Schau gestellt. Ein großer Ficus, dessen grüne Blätter glänzen, als wären sie künstlich, ist mit bunten Lichterketten und schillernden Weihnachtskugeln geschmückt – silberne Planeten, die in einem funkelnden Sonnensystem kreisen. Der Raum gleicht einer leeren Kulisse; die Schauspieler haben die Bühne verlassen. Es ist eine arbeitsame Straße, und man geht hier früh zu Bett. Aber in Nummer 43 ist man sicher noch wach. In Anlehnung an den Jazzpianisten Thelonious Monk behauptete Kristof immer, dass die Welt gegen Mitternacht interessanter wird.
Und da ist er, eingerahmt vom rechten Teil des erleuchteten Fenster-Tryptichons im Erdgeschoss. Sie sieht sein Profil in einem Ledersessel vor dem Bücherregal aus geschnitztem Eichenholz, das Eve und er in Berlin gekauft haben. In einer Hand ein Glas Rotwein, in der anderen die auf die Stereoanlage gerichtete Fernbedienung, mit der er Monk, Coltrane oder Evans aufruft. In den Regalen über seinem Kopf reihen sich Dutzende von Weihnachtskarten aneinander – das übliche Sammelsurium von billig gedruckter schlechter Kunst und einfallslosen, auf die Schnelle verfassten Festtagswünschen, Zeugnisse eines regen Soziallebens und einer weitverzweigten, überwiegend funktionalen Familie. Ihm gegenüber, im linken Fensterpaneel, ebenfalls im Profil und mit Weinglas, seine neue Geliebte: die Rothaarige, zufrieden im Sessel zusammengerollt wie eine orange Katze, die sich uneingeschränkt zu Hause fühlt. Zwischen ihnen, im mittleren Fenster, leuchten aus einem großen Terrakotta-Topf auf dem Schreibtisch die vollen, blutroten Zungen eines Weihnachtssterns.
Der Kranz an der Eingangstür – Stechpalme, rote Beeren, silbern besprühte Tannenzapfen – erinnert sie an Blumengestecke auf Beerdigungen im East End, Chrysanthemenkissen mit der Aufschrift »Dad«, »Mum« oder »Nan«. Auf diesem, schießt es ihr in einem Anflug makabrer Phantasie durch den Kopf, könnte »Eve« stehen, ein stacheliger Blumengruß für sie, die nicht so heiß geliebte, noch nicht ganz Verblichene. Es ist kaum fünf Monate her, dass sie dieses Haus und ihre Ehe verlassen hat. Kristof hat keine Zeit verschwendet.
Sie schaudert in der Dunkelheit der Straße, und ihr Atem bildet eine eisige Wolkenlandschaft in der Nachtluft. Das Kinn im Schal vergraben schaut sie durch das Fenster auf das stilvolle Tableau. Es könnte ein Vermeer sein, ein leuchtendes, häusliches Interieur. Ihr Mann, ihr Haus, ihr Leben. Vorbei. Sie wendet sich wieder der Dunkelheit zu, geht um den verschlossenen Garten mit seinen schattigen immergrünen Büschen und kahlen Bäumen hinter dem mit Speerspitzen bewehrten Zaun herum. Wie alle Anwohner dieser Straße besaß auch sie den Schlüssel zu diesem Privatgarten, und zu Beginn des Frühlings saß sie gerne auf der Bank unter den prallen Blüten der Magnolie. Jetzt ist ihr der Garten ebenso verschlossen wie das Haus, in dem sie zwanzig Jahre gelebt hat.
Es dauerte ein ganzes Leben, um es aufzubauen, und nur eine Sekunde, um es zu zerstören. Familienleben. Das ging als Erstes flöten. Dann die Würde, und mit ihr der gute Ruf. Alles andere folgte in den Strudel. Nur ihre Arbeit ist geblieben. Der Junge fing ihren Blick ein und hielt ihn fest. Standbild, dann Rücklauf. Wenn sie könnte, würde sie bis zum Anfang vor mehr als drei Jahrzehnten zurückspulen – noch ehe der Junge geboren und sie selbst erst um die dreißig war –, zum Beginn des Familienlebens, das sie so resolut zerstört hat.
Sie ballt die behandschuhten Fäuste in der Wärme ihrer Taschen, streckt sie dann wieder und läuft weiter, in der Hoffnung, dass diese Inventur – alles, was sie verloren hat, alles, was bleibt – ihren hektischen Geist beruhigen wird.
In der fernen, intensiven Zeit nach der Kunstakademie, als sie sich in New Yorks fiebriger Lower East Side herumtrieb und entschlossen war, sich in der Kunstszene zu behaupten, war ihrem jungen Ich die Beziehung mit dem zehn Jahre älteren Kristof, damals bereits ein aufstrebender Star in der Architekturszene, ebenfalls wie ein Ende vorgekommen – wie ein Happy End nach Verwirrung, Unsicherheit, Einsamkeit und chaotischen Ablenkungen, die sie als Teenager und junge Frau beinahe aus der Bahn geworfen hätten. Dass sie sich damit auch von Freiheit und Spontaneität verabschiedete, schreckte sie nicht. Davon hatte sie genug gehabt. Wählen zu können war nur eine andere Art von Tyrannei. Steckte denn nicht auch im Gebundensein ein Fünkchen Freiheit? Weniger Optionen bedeuteten mehr Klarheit. Es wurde allmählich Zeit, Glück und Partnerschaft eine Chance zu geben.
Jetzt fängt es an zu regnen. Sie kramt in ihrer Handtasche nach dem Regenschirm, einem Objekt, das sie als junge Frau verschmäht hätte. Zu uncool. Let the hard rain fall. Doch an diesem risikoscheuen Ende des Lebens in einer unwirtlichen Landschaft sucht man Schutz, wo immer man ihn findet.
Besser an die Vergangenheit denken, wo die wenigen Fallen, in die man stolperte, höchstens Fleischwunden verursachten. Als Kunststudentin hatte sie sich ausschließlich dem Vergnügen und der Arbeit gewidmet. Ein kreatives, hyperaktives Chaos war ihr Medium. Der Umzug nach New York – drei wilde Postpunks aus dem heruntergekommenen London der siebziger Jahre, losgelassen in einer Stadt, in der man mit Ideen und einem gewissen kämpferischen Stil noch überleben konnte – war der Beginn des Tohuwabohus gewesen. Doch als sie mit Kristof nach Europa zurückkehrte, wurden Fleiß und Ordnung zur Regel. Mit der Schwangerschaft hatte sie Glück gehabt – ein paar Monate lästiges Unwohlsein, gefolgt von einem Kaiserschnitt und kaum negativen Auswirkungen auf ihre Arbeit.
Eine Kritikerin und marxistische Feministin schrieb später, die »Mutterschaft« habe Eve beflügelt, sie von einem formalen Stillleben-auf-Leinwand-Abklatsch – »einer obsessiven Imitation, die der Natur den Spiegel vorhält und eher abbildet als erzählt« – mittels »eines indirekten Dialogs mit botanischer Illustration« und »kunstvollem Flirt mit dem Genre« zu einer dynamischen »multi-medialen Erforschung des Lebens« geführt, »indem sie die Zeit anhält und das Empfinden über die Analyse, das Sein über das Tun stellt«. Eve tobte, als sie die Rezension las: Nahmen Kritiker je das Wort »Vaterschaft« in den Mund, wenn sie das Werk männlicher Künstler besprachen? Trotzdem stand diese Expertin anscheinend wenigstens auf ihrer Seite. Und letztlich hatte die Rezension ihrer Reputation auch nicht geschadet.
Das Baby jedoch tat sein Bestes, um alles durcheinanderzubringen. Nancy war gierig und wählerisch, seit sie ihren zornigen Blick zum ersten Mal auf die wartende Welt gerichtet und losgebrüllt hatte. In den ersten Jahren machte sie ihnen nachts die Hölle heiß, und Eve beobachtete hohläugig, schuldbewusst und verzweifelt, wie ihre gleichaltrigen Freundinnen sich aus verbissenen, auf die Arbeit fixierten Feministinnen in verträumte, träge, kindernärrische Madonnen verwandelten. Selbst Mara, der kurzgeschorene Hitzkopf aus ihrem Kunstakademie-Triumvirat, hatte der Versuchung nicht widerstehen können. Kaum war sie zurück in London und hatte die kleine, mit Hilfe ihres bereitwilligen schwulen Freundes gezeugte Esme an der Brust, wurde Mara Novak zu einer sanften Ernährerin, die von Raffael hätte stammen können. Hatte sie ihr Leben lang Transparente gemalt, die Nacht für sich reklamiert und gegen das Patriarchat demonstriert, um so zu enden? Doch ihre Esme schlief jede Nacht durch. »Sie meldet sich erst gegen sieben«, prahlte die neuerdings zu Wiederholungen neigende Mara, als wäre diese Fähigkeit ihrer Tochter irgendwie der Beweis für ihre eigene moralische Überlegenheit.
Was sagte das über Eve aus, die wegen ihres schreienden Kindes mindestens sechs Mal die Nacht aufstehen musste? Nicht umsonst setzen repressive Systeme Schlafentzug als Folter ein. Eine Zeitlang hatte sie sogar die unausstehliche Wanda beneidet, ihre reizlose, neurotische, untalentierte Mitbewohnerin, die in New York blieb, um ihre fragwürdige Karriere voranzutreiben, und behauptete, ihr Nachwuchs bestehe aus Kunstwerken und Performances – einer wirren Ansammlung von ich-besessenen Happenings, »Aktionen« und Installationen. Sie ringe »mit der Stellung der Frau im Universum«, hatte sie erklärt. Ein Kind zu haben würde sie nur ablenken. Vielleicht hatte sie recht. Sie blieb als Einzige von ihnen kinderlos. Sie war auch die mit der geringsten Begabung. Man musste sich nur ihre Karriere ansehen und dann die ihrer Freundinnen.
Die Scheinwerfer eines auf sie zukommenden Wagens glühen im heftigen Regen, als er in einem Schwall von Licht und rhythmischem Wummern vorbeizischt. Drum ’n’ Bass? Grunge? Worin besteht das Vergnügen, sich in einer Blechbüchse vor der Außenwelt zu verbarrikadieren und sein Gehör markerschütternden Dezibel auszusetzen? In zehn Jahren ist der Fahrer stocktaub. Eve wird sich ihrer Gereiztheit bewusst – sie klingt wie eine wütende Matrone aus dem Umland – und reißt sich zusammen. Vielleicht ist es für den Fahrer ein Mittel, sich wieder an der Macht zu fühlen. Die Kontrolle zurückzugewinnen, wie es dieser verlogene politische Slogan propagiert. Und mit dem zwanghaften Bedürfnis, sich von der Welt abzukapseln, kennt Eve sich besser aus als die meisten anderen.
Während der ersten Jahre ihrer Beziehung heuchelte Kristof Verständnis für ihre Bedürfnisse und sorgte dafür, dass sie stets ein Atelier zur Verfügung hatte. Doch als das Baby kam, hatte Eve keine geistige Kapazität mehr, geschweige denn Zeit und Energie für kreative Arbeit.
Das waren die Jahre der Wut. Während Kristof sich in der Öffentlichkeit profilierte, hatte sie das Gefühl zu schrumpfen. Sie wurde zwischen den nicht enden wollenden Anforderungen des Familienlebens derart aufgerieben, dass sie genauso gut in Nancys Puppenhaus hätte ziehen können. Würde Kristof es überhaupt merken? Schließlich griff er ein und schickte ihr eine Reihe von hübschen unbedarften Au-pair-Mädchen zu Hilfe, eine parfümierte Reiterattacke, aus deren vollgestopften Satteltaschen sich Wimpernbürstchen, Lippenstifte, benutzte Papiertaschentücher und alberne Illustrierte ergossen. Die Mädchen hielten Nancy so gut unter Kontrolle oder zumindest außer Hörweite, dass man manchmal das Gefühl hatte, nicht das Kind, sondern das Personal behindere mit leidenschaftlichen Telefonaten und tränenreichen Rückzügen in das jeweilige Zimmer den Frieden und Fortgang des Haushalts.
Es gibt so viele Arten, ein Leben zu vermessen. Es heißt, die meisten Menschen, die auf dem Sterbebett eine Bestandsaufnahme machen, zählten ihre Beziehungen auf – gewonnene oder verlorene Liebe. Für Eve ist das in dieser erschütternden Zeit eine zu schwierige Rechnung. »Was von uns übrig bleibt, ist unsre Liebe nur«, lautete die wenig überzeugende Zeile eines Dichters, der ungleich präziser festgestellt hatte: »Der Mensch gibt das Elend an den Menschen weiter.« Geschwindigkeit machte eine andere Art der Kalkulation auf. Von der wohligen Zeitlupe der Kindheit über das sich langsam beschleunigende, erfrischend rosige Super-8-Narrativ der Jugend und die zunehmend atemberaubende Verwischtheit des Alters bis zum Schnell-sonst-ist-es-weg-Abspann am Ende. Das war’s, Leute! Und dann gab es noch die Höhen. Gipfel, die man erklommen hatte, Abgründe, in die man gefallen war, in puncto Karriere, Gefühle oder Beziehungen, über die sie im Moment einfach nicht nachdenken konnte.
Für Kristof, der sein ganzes Leben wie eine akribisch ausgearbeitete, maßstabsgetreue Zeichnung geführt hatte, wäre das wahrscheinlich die bevorzugte Methode. Seine Kurve war von dem Post-Hippie-Büro, das preiswerte Wohnhäuser und Gemeindebauten entwarf, bis zu globalen Hochhaus-, Finanz- und Regierungsprojekten nach oben verlaufen, genauso wie das damit verbundene Gehalt.
Und auch Wohnungen waren ein Maßstab – für Eve verlief die Entwicklung vom Haus ihrer Kindheit, einem Pseudo-Tudor-Kasten, der in einem Londoner Randbezirk nichts als Langeweile und Kleinkariertheit ausbrütete, über schmuddelige Studentenbuden im Stadtzentrum, eine turbulente Haus-WG im ehemaligen Hugenottenviertel vor dem Umzug nach New York bis zu einem schäbigen Apartment mit Wanda und Mara über einem Bestattungsunternehmen in Alphabet City. Von da waren es nur ein paar Häuserblocks in Richtung Südwesten zu ihrer ersten Bleibe mit Kristof, einem ehemaligen »Dime-Museum« in der Bowery, wo sie sich mit neun anderen Künstlern und Musikern ein spärlich möbliertes Loft teilten. Nach diesem Maßstab war Delaunay Gardens mit all seinen Annehmlichkeiten ihr persönlicher Höhepunkt gewesen. Von hier ging es kopfvoran abwärts.
Ein Vibrieren schreckt sie aus ihren Gedanken auf. Das Handy. Sie bleibt stehen und nimmt es aus der Handtasche. Ein verpasster Anruf von Ines Alvaro in New York. Eve schaltet es aus und lässt es wieder in die Tasche zurückfallen. Zu spät, Ines.
Obwohl die Jahre in New York nervenaufreibend waren – kreativer Tatendrang und Ehrgeiz, die auf eine gleichgültige Welt prallten; der verwirrende Zauberwürfel von Beziehungen –, kämpfte Eve gegen die Rückkehr nach London an. Kämpfte und verlor. Am Ende tauschten sie das unkonventionelle New York gegen das ausgeleuchtete Aquarium eines perfekt gewarteten Doppelhauses in London, einem von Kristofs ersten Serienwohnblöcken am Ufer der Themse, und von da war es nur ein Katzensprung – besser gesagt eine lange Fahrt mit der Tube – zu diesem georgianischen Einfamilienhaus, das besitzergreifend über den gemeinschaftlich genutzten Garten wacht.
Sie geht weiter durch die menschenleeren Straßen, die schwarz im Regen glänzen, weg von der erstickenden Sicherheit ihrer Vergangenheit auf eine ungewisse Zukunft zu. Zu spät, um umzukehren.
Im Lauf der Jahre hatte es noch andere Erwerbungen gegeben: das Cottage in Devon, ihre gemeinsame Wochenendzuflucht, inzwischen schon längst wieder verkauft, das Chalet in Chamonix, dem sie keine Träne nachgeweint hatte (Skifahren hatte sie nie wirklich gelernt, und die Kälte war unerträglich), das Penthaus in Tribeca im obersten Stock des Gebäudes, das Kristof zum Hauptquartier seiner Firma in den Vereinigten Staaten gemacht hatte, und – bei dem Gedanken daran zuckt sie unwillkürlich zusammen – die umgebaute Scheune in Wales, ihr persönliches, abgeschiedenes Paradies. Das aufzugeben war ihr am schwersten gefallen.
In dieser Scheune, die sich in einem Eichenwald unterhalb der walisischen Black Mountains versteckte, beschäftigte sie sich zum ersten Mal eingehender mit ihrem Thema, züchtete in einem edwardianischen Treibhaus einjährige Pflanzen aus Samen, pflanzte sie in dem fünf Morgen großen Landbesitz aus, pflückte sie, genoss die göttliche Seligkeit genauer Prüfung und Auslese, sortierte minderwertige Exemplare aus und trug die erlesensten zu einem viktorianischen Zeichentisch unter dem Nordfenster. Hier zeichnete oder malte sie sie, fing ihre Unsterblichkeit in akribisch vollendeten Abbildern ein und hielt ihre vergängliche Schönheit in der Zeit fest, ehe ihre zarten, gebrochenen Formen auf den Komposthaufen bei ihren unzulänglichen Artgenossen landeten.
In Wahrheit war sie keine besonders gute Gärtnerin. Die Ausfallquote zwischen Samen und Setzlingen war hoch. Es fehlte ihr an Geduld und Hingabe – ihre Erfahrungen als Mutter hätten ihr eine erste Warnung sein sollen –, und die Suche nach jemandem, der sich während ihrer Abwesenheit zuverlässig um die Stecklinge kümmerte, hatte sich als ebenso schwierig erwiesen wie die nach einer verlässlichen Kinderbetreuung. Trotzdem gab es Erfolge. Duftwicken, Cosmos, Rittersporn, Feuernelken. Diese Bilder, durchscheinende Aquarelle auf Pergament, befanden sich inzwischen alle in Privatsammlungen in Japan. Heute kümmert sich jemand anders um Eves Stück Land in Wales. Sie fragt sich, ob die blasierte Rothaarige am Fenster jemals Kompost unter den Fingernägeln hatte.
Eve hatte sich, wie ihre Namenspatronin, selbst aus dem Paradies verbannt und Arkadien den Rücken zugekehrt, um mit einem entsprechenden Mann nackt durch die Wildnis zu wandern. Es war eine Entrümpelung von existenziellem Ausmaß. Sie hatte alles hinter sich gelassen, bis auf das Londoner Atelier. Kristof hatte die baufällige Fabrik am Kanalufer im Osten der Stadt vor zehn Jahren, als ihre Ehe noch tragfähig war, gekauft und umgebaut: ein Geschenk zu ihrem fünfzigsten Geburtstag, nachdem sie – das zumindest gab er zu – die Rolle einer gefälligen, wenn auch nicht gänzlich klaglosen Geisha für seine erfolgreiche Karriere gespielt hatte.
Das umgebaute Gebäude war groß genug, um die im Werden begriffenen Werke zu beherbergen – riesige Leinwände, die Videoausrüstung, Kanister mit Konservierungsmitteln, Industriekühlschränke und Pigmentbehälter. Und was früher einmal ein Labyrinth von Hinterzimmern gewesen war (die Buchhaltungs- und Verwaltungsräume von Barlett’s Sweet Factory), ist jetzt ihr Zuhause. Das winzige Schlafzimmer hatte Kristof für die wenigen Nächte entworfen, die sie dort verbrachte, wenn die Arbeit es erforderte. Nicht gerade eine Nonnenzelle – allein das Doppelbett widerspricht dieser Ästhetik –, und in den vergangenen acht Monaten war es die perfekte Kulisse für ihre Affäre gewesen. Außerdem gab es eine anständige Dusche, eine brauchbare Küchenzeile, ein Büro, eine Waschküche und einen kleinen, aber gut ausgestatteten Fitnessraum. Die räumliche Aufteilung des Gebäudes ist genau richtig: neunzig Prozent Arbeit, zehn Prozent Leben.
Nachdem sie heute Abend ihr altes Leben aufgesucht hat – das parallele Universum, nur einen Wimpernschlag entfernt, in dem sie zusammen mit Kristof noch über ein schwankendes, mit Gütern, Besitz, Freunden, Verbindungen und öffentlichem Ansehen vollgestopftes Reich präsidiert –, eilt sie nun, wenige Tage vor Weihnachten, dieser Zeit schamloser Exzesse, in die strenge Nüchternheit des neuen Lebens zurück.
Auch das Exil hat seine Annehmlichkeiten, wie Adams Eva sicher am eigenen Leib erfahren hat. Das Paradies mit seinem endlos wiedergekäuten Glück muss stinklangweilig gewesen sein, und der plötzliche Fluch der Sterblichkeit wird ihm eine frische und süße Intensität verliehen haben. Nur die Dummen und Gleichgültigen blieben ungerührt angesichts der Gefahren, die in der Wildnis lauern. Die erste Eva hatte die säuselnden Argumente der Schlange gehört, sie abgewogen und ihre Entscheidung getroffen. Adam spielte dabei keine große Rolle. Auch er hatte sich als Langweiler entpuppt.
Die Eve aus dem einundzwanzigsten Jahrhundert musste nicht überredet werden. Es ist reiner Zufall, ein glücklicher Fehltritt oder eine fatale Entgleisung, dass sie hier ist – das Auge ans Guckloch gepresst, um das Diorama ihrer früheren Welt zu betrachten, nicht dort, als friedliche Statuette in einer vertrauten Kulisse, die nicht ahnt, dass sie da draußen, im Dunkeln, ein Publikum hat. Ein verhängnisvoller Schritt, eine köstliche, taumelnde Kapitulation, und das alte Leben war Vergangenheit, rauschte an ihr vorbei, als sie fiel. Wie einfach es ist, loszulassen.
2
Wozu diese Eile? Sie verlangsamt ihre Schritte. Wozu diese Eile? Das Unheil kann warten. Sie fühlt sich seltsam entrückt, als ginge sie durch eine leere Filmkulisse, und sehnt sich nach einem Umweg. Nach irgendetwas, das sie von dieser allumfassenden Panik ablenkt. Sie biegt in die lange Straße mit Handwerkerhäusern ein, deren Bewohner im neunzehnten Jahrhundert – Werktätige, Ammen, Verkäufer, Köche – für die angemessene Bequemlichkeit in den Häusern der Bewohner von Delaunay Gardens verantwortlich waren. Heute wohnen in der Crecy Avenue junge Akademiker – Ärzte, Finanzberater, Anwälte –, die im einundzwanzigsten Jahrhundert über die Gesundheit der neuen Bewohner von Delaunay Gardens wachen, ihre Vermögen verwalten und Scheidungsvereinbarungen aushandeln.
Es ist ein hübscher Anblick – schlichte Landhäuser, die von einem philanthropisch angehauchten viktorianischen Gutsherrn mit einem Faible für Neugotik in die Stadt verpflanzt worden sind. Nancy und ihr blöder Ehemann Norbert hatten eins davon kaufen wollen. Kristof, der sich leicht beschwatzen ließ, wollte ihnen dabei helfen, doch Eve hatte es ihnen ausgeredet. Es wäre zu nah gewesen. Erwachsenwerden hat etwas mit Abstand zu tun. Für Eve hatte Altwerden offenbar auch etwas mit Abstand zu tun.
Der Regen hat aufgehört. Sie schüttelt den Schirm aus, rollt ihn zusammen und steckt ihn in die Handtasche. Dann beschleunigt sie ihren Gang wieder und erkennt, dass sie entgegen aller Vernunft nicht in ihre Zukunft eilt, sondern versucht, ihre Gedanken hinter sich zu lassen.
Abgesehen von den diskreten Kränzen, dem kitschigen Ficus in Nummer 31 und diesem scheußlichen Weihnachtsstern würde man in Delaunay Gardens nicht merken, dass Weihnachten vor der Tür steht. In der Crecy Avenue dagegen haben die jungen Akademiker die Saison mit offenen Armen begrüßt und ihren Kindern zweifelsohne jeden Wunsch erfüllt, wenn auch nicht ohne eine gewisse Ironie. Bunte Lichterketten blinken, Weihnachtskugeln glänzen, und in einem Fenster grinst, gefangen in einer erleuchteten Schneekugel, der Kopf des Weihnachtsmanns: Inbegriff unbekannter Gefahren, die sich in die Häuser ahnungsloser Schläfer schleichen.
Eve konnte Weihnachten noch nie ausstehen – aufgesetzte Freude, kitschiges Dekor, Konsumzwang und Völlerei – und hat Nancy schon früh über den Mythos des Weihnachtsmanns aufgeklärt. Einige Eltern im Kindergarten warfen ihr vor, den anderen Kindern »das Fest zu verderben«, nachdem Nancy vorübergehend zu einer missionierenden Rationalistin mutiert war. Laut gängiger Ansichten galt: Je liebevoller die Eltern, desto ausgeklügelter und beständiger die Lüge. Doch wie Eve schmerzlich hatte lernen müssen, gibt es Lügen, und es gibt Lügen.
Jetzt nähert sie sich der Tube Station, wo die Straßen vor Leben sprühen. Das schmale Lowry House, ein von Feuchtigkeit durchsetzter dreißigstöckiger Monolith, ragt wie das Stein gewordene schlechte Gewissen aus dem wohlhabenden Viertel auf. Heute bildet es das Gegenstück zu den Häusern der Ammen, Köche und Verkäufer des neunzehnten Jahrhunderts. Betreuerinnen von Jungen und Alten anderer Leute, jene, die in Fast-Food-Lokalen bedienen, oder Lagerarbeiter, die in den riesigen Hallen des Internethandels Waren verpacken und verschicken. Manche Frauen, die in den Häusern von Delaunay Gardens und der Crecy Avenue saubermachen, wohnen ebenfalls hier.
Eve und Kristof waren einmal hier gewesen auf der Suche nach Marie, einer jungen Vietnamesin, die zwölf Jahre bei ihnen in Delaunay Gardens geputzt und fast ihr ganzes Gehalt an ihre Eltern in Hanoi geschickt hatte. Vor zweieinhalb Jahren, unmittelbar nach der Abstimmung über den Brexit, war Marie, die sich zuvor nie auch nur einen einzigen Tag freigenommen hatte, drei Tage lang nicht zur Arbeit gekommen und nicht an ihr Handy gegangen. Zur gleichen Zeit verschwand auch ein ziemlich wertvolles Weintablett von Georg Jensen aus dem Haus. Eve wollte sofort zur Polizei gehen, doch Kristof meinte, sie sollten Marie nach jahrelangem, tadellosem Dienst die Chance geben, sich zu erklären und das Tablett zurückzugeben. So waren sie zusammen zum Lowry House gegangen, um sie zur Rede zu stellen.
Das Hochhaus stand in dem Ruf, nachts ein Tummelplatz für Drogenhändler und Jugendbanden zu sein. An diesem Morgen am Wochenende begegneten Kristof und Eve lauter saubere und fröhliche Kinder, die in dem schäbigen Gemeinschaftsgarten Fußball spielten und Fahrrad fuhren. In der wie zu erwarten mit Graffiti übersäten Eingangshalle waren noch mehr kleine Fahrräder und Rollstühle abgestellt. Auf dem schwarzen Brett des Anwohnerverbands wurde in fünf Sprachen zu einem Gemeindeessen eingeladen. Es gab einen Ferienbetreuungsplan und für ältere Bewohner Konzerte in der Musikhalle, außerdem handschriftliche Anzeigen, in denen Möbel und Babysachen zum Verschenken angeboten wurden. Zumindest tagsüber war es keineswegs Fagins Höhle, sondern die vielschichtige, kinderfreundliche und funktionale cité du ciel, von der Le Corbusier geträumt hatte.
Maries Wohnung, die sie sich laut eigener Aussage mit drei Kusinen teilte, befand sich im einundzwanzigsten Stockwerk. Kristof und Eve hatten den nach scharfen Desinfektionsmitteln riechenden Aufzug zusammen mit zwei Teenagern betreten, beide um die fünfzehn, hübsche schwarze Mädchen, eine mit Hijab und knöchellangem Rock, die andere mit ungebändigter Afro-Frisur, abgeschnittenen Jeans und einem rosa Sweatshirt mit dem Aufdruck »Love«.
Soweit Eve verstehen konnte, schwatzten und kicherten sie über einen bestimmten Jungen ihrer Schule: »Er hält sich für so sexy …«, bis zum achtzehnten Stock, wo sie den Aufzug verließen und sich noch einmal zu Kristof und Eve umdrehten. »Bye«, sagten sie wie aus einem Mund, kicherten weiter und winkten den beiden Fremden mittleren Alters zum Abschied, ehe sich die Aufzugtür schloss.
Vor Maries Wohnungstür standen ordentlich aufgereiht sechs Schuhe. Zwei Paar Männerturnschuhe und ein Paar Ballerinas. Eve und Kristof klingelten. Aus dem Innern drangen Stimmen, panisches Flüstern, wie es schien. Sie warteten volle fünf Minuten, bis die Tür endlich aufging. Durch einen zehn Zentimeter breiten, mit einer Kette gesicherten Spalt starrte sie das furchtsame Gesicht einer älteren Frau an.
»Nein, Marie ist nicht da«, sagte sie. »Weggegangen.«
»Wohin?«, fragte Kristof.
»Urlaub«, sagte die Frau, dann schloss sie die Tür.
In den zwölf Jahren, die sie sie gekannt hatten, war Marie kein einziges Mal in Urlaub gefahren. Eine Woche später erfuhr Kristof, dass sie von der Einwanderungsbehörde in der Tube verhaftet und nach Hanoi abgeschoben worden war. Sechs Monate später fanden sie das Jensen-Tablett im Keller. Es war hinter das Champagnerregal gerutscht.
Heute Nacht ist der Betonklotz festlich erleuchtet, ein pulsierender, aufrechter Vegas-Strip. Es wirkt, als feierten alle hier die Geburt Christi oder sehnten die Ankunft des Weihnachtsmanns herbei. In den Fenstern der unteren Etagen sieht Eve flackernde, zweidimensionale Glocken, leuchtende Rentiere, schimmernde Schneemänner, neonfarbene Stechpalmenkränze. Weiter oben verschwimmen und verschmelzen die Umrisse dieser funkelnden Symbole von Geselligkeit und verwandeln das Lowry House in eine vertikale Stadt aus Licht.
Jetzt fällt ihr wieder ein, wie sie in der New Yorker Zeit hörte, dass die ganzjährige Weihnachtsbeleuchtung der Fassaden in der Lower East Side Bedingung für einen Mietvertrag in den entsprechenden Häusern war. Die Besitzer waren Hell’s Angels, eigentlich völlig unglaubwürdige Verfechter des Festes der Liebe. Heute sind diese Gebäude verschwunden, die Biker haben sie an Spekulanten verkauft, die sie entkernt und zu eleganten Stadthäusern und Eigentumswohnungen umgebaut haben. Die ganzjährige Festbeleuchtung ist ebenfalls Geschichte.
In einer ungleichen Welt erfordert der soziale Aufstieg ein gewisses Maß an Diskretion. Je mehr man auszuposaunen hat, desto leiser sollte man flüstern. Ein früherer Liebhaber von Mara, der als Dialekt-Coach für Filmschauspieler tätig war, hatte Eve einmal die Physiologie des Akzents erklärt und behauptet, der gedehnte Tonfall der englischen Oberschicht entstünde durch den minimalen Einsatz von Lippen und Zunge, vergleichbar etwa der Bauchredekunst. Aristokraten mussten keine Energie für Artikulation oder Stimmresonanz aufbringen, ihr Personal beugte sich vor, nahm die Anweisungen entgegen und lauschte auf jedes gemurmelte Wort.
Seit Eve und Kristof vor drei Jahrzehnten mit der frisch geborenen Nancy nach Delaunay Gardens gezogen waren, hatte das Viertel einen beachtlichen sozialen Aufstieg hingelegt. Damals gab es kleine Geschäfte, die Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Haushaltswaren verkauften. An ihrer Stelle stehen nun professionell geführte Boutiquen mit teuren Klamotten, Duftkerzen und Yogamatten in punktuell beleuchteten Schaufenstern, die an Kunstwerke einer Galerie in der Cork Street erinnern.
Gentrifizierung. Oder Re-Gentrifizierung. Eve und Kristof waren Teil dieser Wiederbelebung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Als sie hierher zogen, war Delaunay Gardens heruntergekommen und chaotisch, kurzzeitig ein Hausbesetzerkollektiv mit Graffiti drinnen wie draußen, und in einem Winkel des verwahrlosten Gartens verbargen sich die Reste eines Baumhauses über einer kleinen Marihuanaplantage.
Neben der U-Bahn-Station gibt es einen letzten Überlebenden der alten Ordnung. Der familiengeführte Tante-Emma-Laden hat noch geöffnet und verkauft Lebensmittel, Spirituosen und Lotteriescheine. Die Familie hat gewechselt – früher waren es Bangladeschi, heute Afghanen –, doch die schmalen Gänge mit Dosen und Schachteln und die zweckmäßigen Schaufensterauslagen, die man den lokalen Bräuchen der Saison entsprechend mit kupfernen Raupenspuren aus verstaubtem Lametta aufgemöbelt hat, sehen noch genauso aus wie damals, als Eve und Kristof hier ankamen.
Auf der anderen Straßenseite vor dem Bull and Butcher, heute in Bull and Broker umbenannt, ist die letzte Runde eingeläutet worden. Gruppen von Rauchern bibbern draußen in der Kälte und ziehen an ihren Kippen und E-Zigaretten. Wann war sie das letzte Mal in einem Pub? Auf jeden Fall vor dem Rauchverbot.
Eve hatte nie geraucht, abgesehen von einem gelegentlichen Zug an einem Joint. Sie hatte sich nie darauf einlassen wollen. Wanda, die Gauloise-Zigaretten rauchte, weil sie glaubte, dass sie ihr den geheimnisvollen Nimbus einer Françoise Hardy verliehen, hatte nachts immer einen Riesenwirbel gemacht, wenn sie in einem rund um die Uhr geöffneten Kiosk Nachschub besorgen musste. Eve hatte andere Laster. Doch aus Gründen der Liberalität hält auch sie nichts vom Rauchverbot – wenn Leute ihre Gesundheit ruinieren wollen, bitte sehr. Sie zahlen genügend Steuern auf ihre Drogen, um ihre eigene Gesundheitsversorgung und auch die der scheinheiligen Nichtraucher zu finanzieren. Eve bewundert David Hockney weniger für seine Kunst – die späten Gemälde sind zu grell, die Linienführung bewusst ungenau – als für seine hartnäckige Angewohnheit zu rauchen, egal wo.
Der Gruppe vor dem Pub nach zu urteilen haben die jungen Leute das Rauchen nicht aufgegeben, für sie ist es noch immer gelebte Chancengleichheit.
In Eves Jugend waren Pubs vorrangig Männern vorbehaltene Orte und unbegleiteten Frauen gegenüber nicht gerade gastfreundlich. Dann verwandelte sich die Railway Tavern in eine Art Erweiterung der Kunstakademie. In ihrem holzgetäfelten Dämmerlicht wurde bei einem Pint Cider über Liebesaffären, Hochschulpolitik und zeitweise, so schien es, sogar die Weltpolitik entschieden. Damals war das Rauchen in Innenräumen noch erlaubt, und der gelegentlich von einem Hauch Marihuana gewürzte blaue Dunst galt als ein ebenso wesentlicher Bestandteil der Kneipenatmosphäre wie der Weihrauch im Hochamt oder Trockeneis bei einer Inszenierung von Phantom der Oper.
Die alten Stammgäste, viele von ihnen ehemalige Soldaten, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, beäugten die bunte Mischung von Kunststudenten mit Verachtung. »Die wissen gar nicht, wie gut sie es haben«, lautete die Anklage. »Die wissen nicht, dass alles irgendwann ein Ende hat«, hätte es besser getroffen, fand Eve. Die Veteranen verschwanden, als der neue Besitzer Live-Bands engagierte, um eine junge, konsumfreudigere Kundschaft anzulocken. Das war in der aufregenden Punk-Ära, als Pöbeleien, die man zu drei Gitarrenakkorden brüllen konnte, noch als Stil durchgingen. Die alten Soldaten, die Hitler und Mussolini in der Normandie und Catania standgehalten hatten, kapitulierten am Ende vor den Sex Pistols und X-Ray Spex.
Dieses Demo-Band von Erinnerungen scheint ihre einzige Abwehrstrategie gegenüber dem schleichenden, vagen Gefühl von Angst zu sein. Sie steigt die Stufen zur Tube hinab und hält ihre Fahrkarte an die automatische Schranke, die sich bereitwillig öffnet. Noch so eine Innovation. Und keine schlechte. In gemessenem Tempo befördert die Rolltreppe sie nach unten auf den Bahnsteig, wo es stinkt wie im Grab einer Mumie. Zumindest daran hat sich nichts geändert, hier ist es genauso wohltuend widerlich und vertraut wie damals, als sie ein Teenager war und vor der Enge ihres Zuhauses in die Galerien, Clubs und Konzerthallen im Zentrum von London flüchtete.
Ein Windstoß kommt auf, wie ein warmes Gebläse, das ihr das Haar zerzaust. Die Bahn rattert an ihr vorbei, jedes Fenster ein einzelnes Bild auf einer Filmrolle, mit eigener Starbesetzung und einer komplizierten Hintergrundgeschichte, ehe sie quietschend zum Stehen kommt.
So viel Zeit hat sie in ihrer Jugend in diesem unterirdischen Labyrinth verbracht, dessen Venen und Arterien Teile der Bevölkerung in das pulsierende Herz von London pumpen. 1979 inspirierte es sie zu ihrem ersten größeren Werk, Underground Florilegium, das im Lauf der Jahre immer wieder reproduziert, kopiert und raubkopiert worden war. Darin hatte sie auf Harry Becks klassischer Tube-Map aus den 1930er Jahren die Namen der Stationen mit ihren botanischen Bildern ersetzt.
Was ihre persönliche Reputation angeht, so ist Eve mit dem Fluch von Verbindungen und Bezügen geschlagen – angefangen bei Florian Kiš und seinem unauslöschlichen, allgegenwärtigen Porträt von ihr, über Kristof bis hin zu der abscheulichen Wanda Wilson. Ruhm ist, wie Florian immer sagte, eine billige optische Täuschung. Wenn Eves Werk überhaupt einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist, dann ist das Underground Florilegium der Grund dafür. Aber ebenso wie die demütigende Assoziation mit den »Berühmtheiten« wurmt – wie blöd muss ein Publikum sein, das einer Betrügerin wie Wanda Wertschätzung entgegenbringt! –, ärgert es Eve, dass sie lediglich für eine Arbeit bekannt ist, die sie gleich nach dem College beendet hat. Die Lizenzgebühren, die weiterhin ein anständiges Einkommen bringen, sind nur ein schwacher Trost.
Leicht benebelt von Angst nimmt sie im Abteil Platz. Angesichts dieser verletzenden öffentlichen Wahrnehmung war es schwer, weiterzumachen, ihrer Vision treu zu bleiben und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Sie weiß nicht mehr, wie oft Menschen, die ihr bei einem von Kristofs Events vorgestellt wurden, sagten: »Oh, ich liebe Ihr Florilegium!« Oder schlimmer noch: »… Ihre Tube-Map!«
Doch jetzt, auf dem nächtlichen Heimweg zu ihrem Atelier und dem großen Werk, das sie gerade fertiggestellt hat, ist sie zumindest von ihrer kreativen Rehabilitation überzeugt. Der jahrelange Kampf hat sich gelohnt. Sie hat einen schrecklichen Preis zahlen müssen, aber niemand wird mehr die bahnbrechende Qualität ihrer letzten Arbeit in Zweifel ziehen: ein Aufbruch, sicherlich, doch auch die Summe einer lebenslangen Suche. Alle Wege, egal ob intellektueller, technischer, ästhetischer oder emotionaler Natur, haben sie hierher geführt.
Vor all den Jahren benutzte sie im Underground Florilegium eine lachsrosa Dahlie, um diese Tube-Station darzustellen. Dieselbe marxistisch-feministische Kritikerin, die ihr späteres Werk so gepriesen hat, argumentierte, dass die Dahlie »den körperlichen Verfall und eine Parodie der bürgerlichen Konformität darstellt, die das materiell wohlhabende, geistig verarmte Viertel definierte, in dem die Künstlerin lebt«. Diese Kritikerin hatte von London genauso wenig Ahnung wie von Eve. Aber es wäre sinnlos und auch ein wenig rüde gewesen, darauf zu antworten, dass das Florilegium mehr als ein Jahrzehnt vor Eves Umzug in diese Gegend fertiggestellt worden war, dass sie damals keinerlei Verbindung zu Delaunay Gardens hatte, dass Lachsrosa die einzige Farbe war, die ihr in diesem Moment zur Verfügung stand und eine stilisierte Dahlie eine willkommene Herausforderung für eine junge Künstlerin war, die dabei war, ihre Fähigkeiten auszuloten.
Sie war damals einundzwanzig, frei und ungebunden nach dem Abschluss an der Kunstakademie und wohnte in Londons East End. Nur selten fuhr sie nach Westen, in den langweiligen Vorort, wo ihre Mutter nach der Scheidung allein in dem Fachwerkhaus lebte, das zuvor das Heim der ganzen Familie gewesen war. Es schien, als wären in diesem trostlosen Randbezirk ganze Jahrhunderte verstrichen, Zivilisationen aufgestiegen und untergegangen, während ihre Mutter sich bis zum Tod kaum veränderte und höchstens ein bisschen kleiner wurde.
Eve war immer eine Außenseiterin gewesen und hatte gegen die Grenzen in der Familie aufbegehrt. »Genau wie dein Vater«, hatte ihre Mutter gesagt, kurz bevor sie starb. Doch das war nur die halbe Wahrheit. Ihr Vater war vor der Familie geflüchtet – vor Eve, ihrem jüngeren Bruder und ihrer Mutter –, nur um in einem anderen Vorort von London, sechzehn Meilen nordöstlich, mit seiner ehemaligen Sekretärin ein ähnliches Arrangement aufzubauen.
Sandra, die Sekretärin, war vorlaut und vollbusig, eine der gröberen serveuses von Toulouse Lautrec, in einen Londoner Bezirk des zwanzigsten Jahrhunderts verpflanzt. Sie trug hochhackige Lackschuhe, ein süßliches Parfüm und einen knalligen, kirschroten Lippenstift, der auf den großen gelben Zähnen schmierige Flecken hinterließ, wie Spuren von Zahnfleischbluten. Als direkte Replik an die ehemalige Familie ihres neuen Mannes setzte sie auf die Schnelle einen Sohn und eine Tochter in die Welt, doch trug die Mutterschaft keineswegs zur Verfeinerung ihres Stils bei. Eve war von der neuen Frau ihres Vaters nicht aus Loyalität zu ihrer Mutter abgestoßen, sondern weil diese Frau einfach nur peinlich war. Nicht einmal als Erwachsene ertrug sie es, in der Öffentlichkeit mit ihr zusammen gesehen zu werden.
Als sich ihre Eltern scheiden ließen, war Eve noch ein Teenager, doch die Generalprobe hatte Jahre gedauert – das Geschrei, die Tränen, das ewige mürrische Schweigen, in dem Eve und ihr Bruder Brieftauben spielten und Botschaften zwischen den zwei stummen Lagern hin und her trugen, ehe die Schlacht erneut aufgenommen wurde. Beim Auszug ihres Vaters war sie erleichtert, und dass ihre Mutter sich wochenlang schluchzend und klagend ins Bett zurückzog, nahm sie kaum zur Kenntnis. Sie selbst war bereits ganz woanders, entweder in der Schule – sie war schon immer eine hochkonzentrierte Schülerin gewesen –, bei ihrem Samstagsjob in einem Plattenladen, bei ihrem Freund oder den Attraktionen von London; ständig war sie unterwegs nach Osten, ins Herz der Stadt.
Auf der Kunstakademie dehnte sie ihr Revier noch weiter nach Osten und Norden aus (wenn auch nur selten bis in die neue Heimat ihres Vaters). Die abgelegenen Randbezirke im Westen und Norden waren im Underground Florilegium kaum vertreten, und der Süden der Stadt war ein weißer Fleck, auf ihrer Karte als »Terra Incognita« verzeichnet. Und so war es bis heute.
Damals glaubte sie, dass Reisen eine notwendige Bedingung für ein erfülltes Leben sei, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen zurückgelegter Entfernung und angeeignetem Wissen gebe. Sie wurde schnell eines Besseren belehrt, bei ihren kurzen Ausflügen auf dem Hippiepfad und der Begegnung mit zahllosen Schwachköpfen, die in ihrem solipsistischen Nomadentum, einem Privileg der Jugend, quer durch Europa bis nach Griechenland trampten oder durch Indien wanderten, Millionäre im Vergleich mit den Einheimischen, aber extra barfuß, und auf der Suche nach einem Ich, das die Mühe kaum wert war. »We are stardust, we are golden …«
Sie suchte nach Splitt statt Glitter, so wie die Musik von akustischer Introspektion über bombastischen Stadionrock zum Punk überging – roh und durch und durch authentisch, wie es damals schien. So machte sie sich nach New York auf, hungrig nach transformativer, urbaner Erfahrung, begierig, Grenzen zu sprengen, angetrieben von universellem Zorn und überzeugt, dass diese Transplantation sie zu einer besseren Künstlerin machen würde. Das Experiment brachte jedoch nur begrenzt kreative Resultate. Sein vorrangiger Nutzen bestand darin, eine psychische und geographische Distanz zwischen sich und ihrer Familie zu schaffen. Und auch, wie sie jetzt erkennt, sich dem Einfluss von Florian Kiš zu entziehen.
Später, als ›Plus eins‹ oder Anhängsel eines erfolgreichen Gatten, folgten Reisen in isoliertem Luxus – Plätze in der First Class, Übernachtungen in Fünfsternehotels –, die für ihr Selbstbild merkwürdigerweise schädlich und in ihrer Erinnerung austauschbar waren. Manchmal fragte sie sich, ob sie dabei war, den Verstand zu verlieren, die bevormundete Patientin in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt zu werden, wo die Bettwäsche aus exquisitem Leinen bestand und sie jeden Abend ein Schokolädchen auf dem Kopfkissen erwartete.
Jetzt spürt sie, wie ihr Fokus sich verengt, sich auf die kindliche Begeisterung für das Unmittelbare und Winzige richtet, die stille Erregung kleiner Schritte, die man aufmerksam beobachtet. Eine Blüte, die sich schützend kräuselt, den sanften Bogen von Faden und Staubbeutel, den dicken Fruchtknoten eines Blütenstempels und sein eichelähnliches Staubgefäß. Auch darin lässt sich Weisheit finden.
Welche Blume würde sie in einem aktualisierten Underground Florilegium für die Dahlie benutzen? Keine Magnolie. Die war schon von dem tristen Vorort ihrer Jugend besetzt. Eine rostrote Chrysantheme – die langweiligste Blüte von allen, heimisch auf Garagenvorplätzen und in Hospizen? Die grobe Fackellilie, rotglühender Schürhaken mit feurigen Stacheln? Dann fällt es ihr ein, und sie lächelt. Aber ja doch, die grellen Zungen des Weihnachtssterns. Vermutlich hat Kristofs neue Flamme diese ordinäre Pflanze ausgewählt. Kristof hat einen besseren Geschmack. Was wird es nächstes Jahr sein, wenn sie sich erst richtig eingenistet hat? Eine blinkende Lichterkette und das glitzernde Abbild einer Krippe?
Auch heute Nacht bringt die U-Bahn Eve wieder nach Osten, zu ihrem Atelier – irgendetwas in ihr sträubt sich gegen das Wort »Zuhause«. Es gelingt ihr einfach nicht, sich auf das Grauen zu konzentrieren, das ihr bevorsteht. Stattdessen denkt sie an die Zeit vor vierzig Jahren zurück, als sie Stratford, die Tube-Station, die dem Atelier am nächsten lag, im Underground Florilegium mit einem lieblichen Veilchen darstellte. »Als Verweis«, lautete die absurde Beschreibung eines Kritikers, »auf den Barden des anderen Stratfords, 130 Meilen weiter westlich am Fluss Avon: Ich weiß ’nen Ort, wo wilder Thymian steht: ein Abhang ganz mit Veilchen übersät.«
Damals war das Atelier noch eine Fabrik, in der eine Heath-Robinson-Anordnung von Röhren und Trichtern zuckerduftenden Rauch ausstieß und lange Reihen von Förderbändern, überwacht von Arbeitern in Overalls und mit Haarnetzen, kariesfördernde Süßigkeiten für die Jugend der Nation ausspuckten. Eve hatte die Archivbilder gesehen. Heute ist es still in ihrem asketischen Kunsttempel, ihrem Allerheiligsten: eine Mahnung gegen Gier, Mittelmäßigkeit und die ostentativen Klischees der Weihnachtszeit.
3
Eingelullt wie ein Baby in der Wiege schließt sie die Augen, und das sanfte Schwanken des U-Bahn-Wagens hält ihre Alpträume in Schach.
Im Februar dieses Jahres, zwei Monate vor ihrer Ausstellung in der Sigmoid Gallery, bemerkte ein Journalist, der für das Magazin einer Zeitung arbeitete und Eve im Atelier interviewte, dass es hier für jemanden, der die Natur malt, »wenig Natur gibt«. Gewiss, da war der aktuelle Schwerpunkt, schmetternde Zwillingstrompeten eines Rittersterns in einem Zinktopf gegenüber seinem riesigen Abbild, Öl auf Leinwand, das an der Ostwand lehnte. Doch der Besucher zeigte auf das viele Glas, den rostigen Stahl, die freiliegenden Backsteine und nackten Glühbirnen; auf die Assistenten-Teams, die wichtigtuerisch mit Leinwänden hin und her liefen, Leitern verschoben, Kabel verlegten, mit Farbtuben und Pinseltöpfen vollgestopfte Wägelchen durch die Gegend rollten und mit Kameras hantierten, auf die Computer und Drucker, die Bottiche mit Gesso und Leinöl, Terpentin und Konservierungsflüssigkeiten, Mikroskop und Vergrößerungsglas, und schließlich die Tabletts mit Seziermessern auf dem langen Refektoriumstisch aus Eiche, der den Raum unterteilte. Draußen, hinter den dreistöckigen Glasfenstern, schimmerte der Kanal mit seiner zähflüssigen Ölpatina im Morgenlicht.
»Nicht gerade der natürliche Lebensraum einer Pflanzenkünstlerin«, sagte er.
Eve warf ihm einen ihrer durchbohrenden Blicke zu und sagte ruhig: »Wirklich?«
Sie verabscheute die Bezeichnung »Pflanzenkünstlerin« mindestens so sehr wie »Blumenmalerin«, den anderen herabsetzenden Ausdruck. Warum nicht einfach »Künstlerin«?
Später hatte der Journalist geschrieben: »In diesem Moment fühlte ich mich, als würde ich auseinandergenommen, wie ein Gegenstand, der einer kalten Prüfung durch die Künstlerin ausgesetzt ist. Kelch, Staubgefäß, Stempel … vom Samenkorn bis zur Seneszenz mit einem einzigen forensischen Blick aufgespießt.«
Sechs Monate später, im August, hatten alle Mitarbeiter bis auf einen gehen müssen. Niemand außer der Gerstein-Kuratorin Ines Alvaro, einer forschen, aufdringlichen jungen Frau, die Eves große Retrospektive in New York organisierte, und Hans, Eves Kunsthändler und Besitzer der Rieger Gallery in der Cork Street, durften das Atelier betreten. Und auch das nur auf Einladung.
Ines verfolgte ihre eigene, rein geschäftliche Agenda. Bei dieser Retrospektive ging es ebenso um den Aufbau ihres Rufs als Kuratorin wie um das Werk von Eve Laing. Hans trug herbstfarbene Tweedanzüge und blinzelte hinter einer Brille mit Schildpattrahmen, ohne jemals indiskret zu werden. Falls er sich überhaupt für Eves Privatleben interessierte, so ließ er es sich nicht anmerken, und wenn doch einmal ein intimes Detail ans Licht kam, verzog er widerwillig den Mund und tupfte sich mit einem seidenen Paisley-Taschentuch über die Mundwinkel. Lüsternheit war geschmacklos. Für Hans Rieger wie auch für Eve zählte nur das Werk.
An der nächsten Station steigt ein Teenager-Paar ein, eng umschlungen, und lässt sich auf den Sitz ihr gegenüber fallen. Das Mädchen lehnt den Kopf an die Schulter des Jungen. Unsterbliche Jugendliche, die auf ihre Schönheit und Liebe vertrauen und nicht ahnen, welche Hölle vor ihnen liegt.