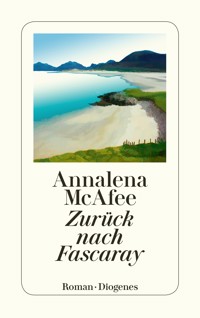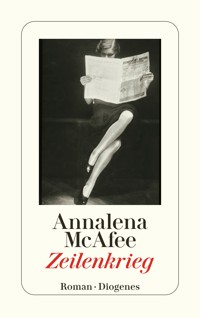
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hochpolitische Reportagen versus locker-flockige Unterhaltung: Honor Tait, 80, und Tamara Sim, 27, sind beide Journalistinnen, doch sie verkörpern völlig verschiedene Welten. Zwei Generationen, zwei Charaktere und ein atemberaubender Showdown. Ein Roman, bei dem es nicht nur um das gedruckte Wort, sondern auch um die Schicksale zwischen den Zeilen geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Annalena McAfee
Zeilenkrieg
Roman
Aus dem Englischen
von Pociao
Titel der 2011 bei Harvill Secker, London,
erschienenen Originalausgabe: ›The Spoiler‹
Copyright © 2012 by Annalena McAfee
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2012 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto: Yva
Copyright © IMAGNO/Austrian Archives
Die Übersetzerin dankt dem
Deutschen Übersetzerfonds Berlin für
seine großzügige Unterstützung
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24287 4 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60192 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] I sing of News, and all those vapid sheets The rattling hawker vends through gaping-streets; Whate’er their name, whate’er the time they fly, Damp from the press, to charm the reader’s eye.
George Crabbe, ausThe Village and the Newspaper
Das Internet ist eine weitere elektronische Modeerscheinung, die früher oder später von den Kräften des Markts relativiert werden wird. Im Moment brauchen seine fanatischen Vertreter dasselbe Mitgefühl und dieselbe Toleranz wie einst die Esperantisten und Funkamateure… Das Internet wird eine Weile zeigen, was es kann, und dann seinen Platz unter den weniger bedeutenden Medien einnehmen.
Simon Jenkins,The Times, 4. Januar 1997
Täuschung und Betrug, Erpressung… unverhohlene Ausspähung der Opfer eines Verbrechens und ihres Schmerzes, Diffamierung gewöhnlicher Leute, die Zeugen der Ereignisse wurden, Jagd auf diverse Prominente, ihre Familien und Freunde, allein zur Auflagensteigerung (…) weniger im Sinne von Heimarbeit als im Ausmaß einer industriellen Revolution.
[7] 1
London, 17. Januar 1997
Sie hatte noch zwei Stunden, um allzu Privates zu beseitigen. Alles, was nach Eitelkeit, Dummheit und Schlimmerem aussah, musste verschwinden. Chaos war nicht das Problem; ihre Haushilfe hatte erst heute Morgen aufgeräumt, und wenn Honor Tait auch zur Unordnung neigte, so hatte sie sich doch nie an Dinge gehängt, und auch nicht an Menschen. Dank einer Scheidung, einem Tod, einem Hausbrand, einem völlig unsentimentalen Naturell und ihrem ständigen Unterwegssein hielt sich der übliche Krempel für eine Frau ihres Alters in Grenzen. Sie hatte sich stets auf das Nötigste beschränkt, in der Liebe wie im Leben. Mehr als Handgepäck war nicht drin. Was aber hatte sich in dieser Wohnung in London angesammelt? Welcher Plunder hatte überlebt und könnte sie womöglich verraten?
Schwer atmend und in ungewohnter Panik betrachtete sie prüfend Möbel, Bilder und Bücherregale. Das meiste stammte natürlich von Tad. Dies hier war seine Junggesellenwohnung gewesen und später, nach der Hochzeit, ihre gemeinsame Stadtwohnung. Jetzt war es ihre Witwenklause. Er hatte gewissermaßen die Inneneinrichtung übernommen: die Gemälde und gerahmten Fotografien gekauft, die [8] Vorhänge ausgesucht, seiner Vorliebe für StaffordshireFiguren und Sèvres-Porzellan gefrönt und an den beiden fleckigen Lehnsesseln gehangen, die er in einem Antiquitätengeschäft in Edinburgh aufgetan hatte. Wie ein mittelalterlicher Mönch seine Handschriften hatte er darin wuchtige Stoffmusterbücher studiert. Trotz einer trauten Ehe war ihr Zuhause das siebenhundert Meilen nördlich von London gelegene Glenbuidhe geblieben mit seinem wohltuenden Mangel an Komfort und Maida Vale das seine. So wie Honor damals nichts an dem Apartment verändern wollte, so hatte sie auch, nachdem Tad nicht mehr da war, kein Bedürfnis verspürt, es umzuräumen – die Bühne abzubauen, wie er gesagt hätte. Nun aber würde man sie für die Sammelwut und den zweifelhaften Geschmack ihres verstorbenen Mannes zur Rechenschaft ziehen.
Gegenstände, die derart vertraut waren, dass Honor sie gar nicht mehr wahrnahm, willkürlich angehäufte Bücher und Bilder, unerbetene Geschenke und allerlei Kinkerlitzchen, wertloser Kitsch, von der Haushilfe sorgfältig abgestaubt und arrangiert – all das konnte nun gegen sie verwendet werden. Dabei war ohnedies schon viel zu viel über Honor gesagt und geschrieben worden; ein Inquisitor nach dem anderen hatte Gerüchte, Fehlinformationen, Andeutungen und falsche Darstellungen aufgegriffen, blankpoliert und als Tatsachen hingestellt.
Noch heute ärgerte sie der Vogue-Artikel, zu dem Bobby sie überredet hatte. Er war mehr als ein Jahr alt, doch jedes Mal, wenn sie eine Ausgabe sah, was im Wartezimmer eines Arztes so gut wie unvermeidlich war, fühlte sie sich erneut von den abstrusen Behauptungen (und dem Foto!) [9] erniedrigt. Jemanden in einem Absatz von knapp dreihundert Wörtern derart abzukanzeln, in den Dreck zu ziehen und in ein falsches Licht zu rücken – das war schon eine Leistung. Honor hatte im Radio gesprochen, in Woman’s Hour (was für ein Getue für acht Minuten Sendezeit), und hatte sich bei Melvyn in Start The Week Gehör zu verschaffen versucht – neben einem tranigen Wissenschaftler, einem Geistlichen, der sich offenbar immer noch auf der Kanzel wähnte, und einem Schriftsteller mit exzentrischen Ansichten über Tierschutz.
Unlängst war dann noch die South Bank Show dazugekommen (wieder Melvyn: Gab es denn keine anderen vernünftigen Moderatoren mehr?). Als sie von Anfang an klarstellte, dass ihr Privatleben tabu war, hatte man ihr versichert, die Sendung werde sich ausschließlich auf ihre Arbeit konzentrieren, und sie war dumm genug gewesen, sich einzubilden, es ginge tatsächlich darum, ihren »Platz als Journalistin am Puls der Zeit« zu würdigen. Und was war dabei herausgekommen? Eine Halbtote beschwor in düsterem Licht Weltereignisse herauf, die niemandem noch irgendetwas bedeuteten, wie die zittrige Miss Havisham, die sitzengelassen immer noch von ihrer Hochzeit träumte.
Sie hatten das Interview mit Archivmaterial und Aufnahmen aus Schottland, Paris, Spanien, Deutschland und Los Angeles aufgepeppt, dazu jede Menge Künstler, Poeten, Politiker, Wichtigtuer aus Hollywood, sowie drei aufeinanderfolgende Ehemänner eingeblendet – eine parodistische Verkürzung ihres Lebens auf sechs flackernde Filmminuten. Die Programmmacher hatten sich an ihre Zusage gehalten und sich alle Fragen nach Familie, Ehemännern oder [10] Liebhabern verkniffen, doch die indiskrete Bildergalerie war unerbittlich.
Die Recherche-Leute hatten ein Werbefoto von Maxime ausgegraben, auf dem er seine Zigarettenspitze schwenkte wie einen Taktstock, überragt von seinem eigenen Schatten, extravagant wie Noel Coward, doch ohne dessen Witz, Wärme oder maskuline Ausstrahlung. Sandor Varga tauchte gleich zweimal auf: elegant und düster als Honors Bräutigam in Basel, und dann, zehn Jahre später, feist und selbstgefällig in Begleitung des billigen Flittchens, für das er sie verlassen hatte. Ihrem dritten und letzten Mann Tad hatte die Dokumentation seltsamerweise weniger Aufmerksamkeit geschenkt als der überschätzten Elizabeth Taylor – der Kommentator hatte sich zu der albernen Titulierung »Hollywood-Queen« verstiegen –, mit der Tad und Honor zufällig auf irgendeiner Galaveranstaltung fotografiert worden waren. Tads Arbeit wurde mit ein paar Ausschnitten aus seinen Filmen vorgestellt, was sich als zweischneidiges Schwert entpuppte: Aus dem Zusammenhang gerissen wirkte seine Komik kindisch und gekünstelt und die ständigen Anspielungen auf Sex eher verklemmt als locker. Er hatte ihr leidgetan, der arme Kerl, obwohl er nun in St. Marylebone in Frieden ruhte.
Ihrem eigenen Lebenswerk zollte man Respekt mit Filmmaterial aus dem Krieg – verwackelte Bilder von der Front, aus Madrid, Polen, der Normandie, Buchenwald, Berlin und Incheon. Schattenhafte Gestalten huschten durch eine algerische Kasba in den Fünfzigern – noch mehr Archivmaterial –, ja es gab sogar ein rührseliges Foto von ihr, Ende der sechziger Jahre in einem Weimarer Waisenhaus, wo sie einen verschreckten Säugling in den Armen hielt.
[11] 1956 stellten sich ungarische Studenten sowjetischen Panzern entgegen, und dreizehn Jahre später (drei Sekunden im absurden Schnelldurchlauf) folgten tschechoslowakische Kommilitonen ihrem Beispiel, während jenseits zweier Grenzen, in Paris, die privilegierten Söhne der Bourgeoisie – meistens waren es Söhne –, zukünftige Gesetzgeber, Akademiker, Politiker und Experten, Revolution spielten, Schaufenster eintraten und Pflastersteine oder Brandbomben gegen einfache Gendarme schleuderten.
Auf einem Foto aus den Fünfzigern in einem koreanischen Schützengraben sah Honor, zerzaust und schlammverschmiert, weniger wie eine Kriegsberichterstatterin bei der Arbeit aus als wie eine Debütantin, die man noch mit der Schönheitsmaske überrascht hatte. Die meisten Ausschnitte aber zeigten eine junge Frau mit glänzendem, gepflegtem, bis auf die Schultern reichendem Haar, die strahlte wie das olympische Feuer, damit nur ja jeder sie schön fand, begehrte, ihre Intelligenz bewunderte oder sie um ihren Erfolg beneidete. Die Gegenüberstellung dieser springlebendigen Göttin mit der zittrigen alten Frau in dem Fernsehinterview war ein grausames Vanitas-Symbol, ein Ozymandias der Moderne: »Seht meine Werke, Mächt’ge, und erbebt.« Die Freunde und Liebhaber, die für wenige Sekunden über den Bildschirm flimmerten, mochten inzwischen nur noch Geister sein, in ihren Gräbern verwesen oder längst als Asche dem Wind übergeben worden sein, das schrecklichste Gespenst von allen aber war Honor Tait, die Überlebende, die fassungslos ihrem eigenen Verfall zusah.
Was für eine demütigende Sache der Ruhm doch heutzutage war! Scheinbar hatten jede Menge Menschen zu [12] nachtschlafender Zeit nichts Besseres zu tun, als mit offenem Mund Kulturprogramme im Fernsehen zu verfolgen. Überall war sie erkannt worden – von Taxifahrern, Oberkellnern, Ladenbesitzern, wildfremden Menschen bei einer Vernissage, Passanten auf der Straße. Ein Straßenarbeiter mit orangefarbener Schutzjacke, der unweit von der Praxis ihres Arztes in der Wimpole Street Gerüststangen schulterte, zog den Helm vor ihr und rief: »Schreiben Sie weiter!«
Und dann war T. P. Kettering aufgetaucht, der katzbuckelnde Akademiker, der sich ihr als »offizieller Biograph« angedient hatte und dann, nachdem sie dankend abgelehnt hatte, verdeckt ermittelte. Sein Buch, das unter einem geradezu absurd aufgeplusterten Titel – Veni Vidi: Honor Tait, Zeugin unserer Zeit – in einem obskuren Universitätsverlag erschienen war, entpuppte sich als ein farbloser Zitatenverschnitt. Juristen hatten ihm die Spitze genommen, doch den endgültigen Todesstoß hatte ihm Honors unausgesprochene Drohung versetzt, dass sie zu jedem den Kontakt abbrechen würde, der mit dem fraglichen Buch oder seinem Verfasser auch nur das Geringste zu tun hatte. Martha Gellhorn hatte zu Honors Ärger Kettering ein unverbindliches Zitat für das Cover geliefert. Das Buch hatte sehr schlechte Kritiken bekommen. (»Eine spannende Biographie über die außergewöhnliche Honor Tait bleibt ein Desiderat«, erklärte Bobby im Telegraph, »doch dieses fade Fabrikat ist weit davon entfernt.«) Das Buch war glücklicherweise untergegangen, Kettering ebenfalls. Honors Schadenfreude darüber, dass er dem Alkohol verfallen war und als Ghostwriter die Autobiographie eines Fußballstars verfasste, grenzte ans Unanständige.
[13] Aus den Registern anderer Biographien oder den Presseausschnitten, die Kettering als Quelle gedient hatten, konnte sie ihren Namen nicht löschen und auch ihre eigenen Werke nicht aus den Archiven entfernen. Vieles davon war bereits gemeinfrei. Also galt es, das bisschen Würde und Privatsphäre zu retten, das noch zu retten war.
Deshalb musterte sie jetzt ihre Wohnung mit den Augen einer Fremden, und zwar einer übelwollenden Fremden: einer Journalistin. Was ausgerechnet ihr nicht schwerfallen sollte. Doch sie war alt und aus der Übung – seit acht Jahren hatte sie keine neue Reportage mehr veröffentlicht, und ihren Artikel über das Elend der vietnamesischen Boat People in Hongkong hatte der New Statesman vor einem halben Jahr, sich unterwürfig herauswindend, abgelehnt. Der New Journalism, dem man sie einst zurechnete, war von einem noch neueren abgelöst worden, der sie befremdete. Wie die nouvelle vague im französischen Kino oder die Wespentaillen und Petticoats des New Look von Dior war Honor Taits unverwechselbare Art des New Journalism – subjektiv und doch mit Sachverstand und engagiert – in dieser ironischen, modernen Zeit so out wie Sesselschoner. Nur bewusste Traditionalisten, nostalgische Spinner mit einer Vorliebe für Vintage und Bakelit-Ästhetik wussten ihren Ansatz noch zu schätzen.
Sie stand in der Mitte des Raums, zaudernd, zerbrechlich und unfrisiert in einem alten Morgenmantel aus Seide mit Paisleymuster. Neuerdings hatte sie einen gelegentlich auftretenden Tick entwickelt, ein unwillkürliches Kopfnicken, das sich verstärkte, wenn sie aufgeregt war, so wie jetzt, und den Eindruck nachdrücklicher Zustimmung vermittelte, [14] obwohl das Gegenteil der Fall war. Mit der Linken klammerte sie sich an die Rückenlehne des einen von Tads guten alten Lehnsesseln und drehte sich langsam im Kreis herum, kniff die wässrigen blauen Augen zusammen und betrachtete das Zimmer so angespannt, als schnüffelte sie in einem fremden Tagebuch.
Angefangen bei den Wänden: den Bildern und Fotos. Wie lange war es her, dass sie sie zum letzten Mal bewusst betrachtet hatte? Dieses Aquarell von grünspanigen Wellen und schlammbraunen Bergen – war das Antrim in Irland oder der Westen von Schottland? Loch Buidhe in den Highlands war es jedenfalls nicht. Für diese geschützte Senke war es zu offen und wild. Wohl einer von Tads Spontankäufen, ohne jeden Bezug zu ihrem Leben und grottenschlecht. Honors junge Interviewerin würde Schwierigkeiten haben, aus dieser stümperhaften Seelandschaft irgendwelche abwertenden Schlüsse zu ziehen, es sei denn, sie war eine Kunstkennerin, was angesichts des Niveaus der meisten Zeitungsleute von heute, ja der meisten jungen Leute überhaupt, eher unwahrscheinlich war. Für jemanden, der gern flotte Sprüche machte, mochte das Bild eine gewisse Vorliebe für konventionelle Sonntagsmaler oder keltische Melancholie widerspiegeln. Eine komplett falsche, aber harmlose Missdeutung.
Die Tuschezeichnung von Tristan und Isolde könnte schon verfänglicher sein. Tad jedenfalls hatte Anstoß an ihr genommen. Zuerst hätte er die Zeichnung am liebsten zerstört, sie mit seinen fleischigen Händen in der Mitte durchgerissen oder sie zumindest wieder dort vergraben, wo er sie gefunden hatte, in einem Stapel unbeachteter Papiere in [15] Glenbuidhe. Trotz seiner Eifersucht und Wut, dass Honor – die er geheiratet hatte, als sie beide schon mittleren Alters waren – jemals einem anderen Mann hatte nahe sein können, war er am Ende dem typisch amerikanischen Respekt vor dem Ruhm erlegen. Tad selbst hatte nach eingehender Betrachtung und zahllosen Dialogen, die eines Plato würdig gewesen wären, schließlich den sperrigen Ebenholzrahmen ausgesucht und das Bild über seinen Kamin in London gehängt, wo es bis heute geblieben war. Der Künstler hatte die beiden Liebenden in einer einzigen Linie vereint, und wenn die Interviewerin in einem unbeobachteten Moment die Zeichnung aufmerksam betrachtete – sagen wir, während Honor in der Küche gerade Tee kochte –, könnte sie die Widmung entdecken, die er mit seiner winzigen, eckigen Schrift vertikal in den Faltenwurf von Isoldes Gewand gekritzelt hatte: Für Honor von Jean. Je t’embrasse.
Ihre Freundschaft war schon mehrmals durchgekaut worden, in Cocteau-Biographien, aber auch in den wenigen Würdigungen von Honors Werk. Zuletzt hatte Kettering sie wieder aufgewärmt und einem gelangweilten Publikum vorgesetzt. Die South Bank Show hatte ruckelnde Bilder von der Premierenparty zu Le Bel Indifférent gezeigt, wo Picasso wie üblich vor den Kameras herumalberte. Dabei hatten sich die Programmmacher Honors Maßgabe entsprechend aller Erklärungen enthalten und statt eines informativen Kommentars einen perlenden Gitarrensoundtrack von Django Reinhardt und seinem Hot Club de France unterlegt. »Oh, Lady Be Good.« Eine Aufforderung, die man in ihren Kreisen damals nicht oft hörte.
Ihr Techtelmechtel mit Cocteau hatte viele Jahrzehnte vor [16] der Hochzeit mit Tad – ihrem letzten und besten Ehemann – stattgefunden, doch Zeit hatte für ihn noch nie eine Rolle gespielt. Er brauchte auch keine Beweise für eine Liebschaft. Tads Eifersucht – rückblickend, gegenwärtig und vorausschauend – schien der Ausdruck eines Wahns zu sein, der mit dem Rest seiner Person nichts zu tun hatte. Wie eine böse Tat in einer guten Welt.
Doch davon einmal abgesehen: Welches Interesse konnten diese endlosen Verbindungen, Trennungen, die Opiumsucht und Besäufnisse unter den Künstlern und Bohemiens von Paris – wann war das noch? Vor sechzig Jahren? Fünfundsechzig? – für die Leser des S*nday Magazine am Ende des Jahrtausends noch haben? Heutzutage war es Kunst, die Leinwand mit Körperflüssigkeiten zu beschmieren, oder man breitete seine persönlichen Unzulänglichkeiten vor einem gaffenden Publikum aus. Jeder war heute ein Künstler, alle trieben es wie die Kanickel und tranken Alkohol wie Wasser. Opium oder das heutige Gegenstück – was war es doch gleich? Kokain? Ecstasy? – war auf den Galadiners der Industriebosse ebenso verbreitet wie unter Verkäuferinnen, die miteinander ausgingen, oder in den Pubs der Vorstädte. Die Skandale von gestern waren heute nur noch Fußnoten. Wer erinnerte sich schon an Cocteau? Und wer von den wenigen Kennern der ominösen Vorgeschichte, die tatsächlich wussten, wer er war, interessierte sich noch für ihn? Das Bild konnte bleiben. Außerdem war es zu schwer, als dass sie es ohne Hilfe hätte abnehmen können.
Gegenüber von dem Cocteau hing in einem unbehandelten Eichenrahmen ein Ölgemälde von ihr, das vor zehn Jahren entstanden war: steife Frisur, karminrot geschminkte [17] Lippen, frostiger Gesichtsausdruck. Es wirkte streng, ja einschüchternd, doch irgendetwas daran, die schonungslose Ehrlichkeit vielleicht oder die Abgeklärtheit – die heilige Honor, über jegliche Versuchung erhaben – hatte Tad gefallen, trotz seiner natürlichen Abneigung gegen den Künstler. Daniel war damals in seinem ersten, und wie sich herausstellte, einzigen Semester an der Slade School of Fine Art. Sie zerrte das Bild von der Wand und fluchte über die Anstrengung, die sie dieser Handgriff kostete. Doch kaum lehnte das Bild an der Fußleiste, bemerkte sie bestürzt ein gespenstisches dunkles Rechteck auf der Tapete, ähnlich dem gähnenden Geviert, das im Museum in Boston auf die Rückkehr des gestohlenen Vermeer wartete. Die Abwesenheit des Porträts könnte mehr Spekulationen auslösen als seine Gegenwart. Besser sie ließ es hängen. Mühsam balancierte sie es wieder auf den Haken. Ihr Herz begann zu rasen, bei jedem Schlag durchfuhr sie ein kleiner Stich. Sie setzte sich und rang nach Luft.
Trotz Honors anfänglicher Weigerung hatte ihre Verlegerin sie schließlich überredet, die Reporterin bei sich zu Hause zu empfangen. Ruth Lavenham, Gründerin und Cheflektorin von Uncumber Press, gab sich gern als mütterliche Freundin, war aber in Wirklichkeit eine knallharte Geschäftsfrau. Der lästige Besuch würde sich positiv auf den Verkauf von Honors neuem Buch auswirken, hatte Ruth gesagt. Und das, so die in ein Lächeln verpackte Warnung, wäre auch für Uncumber Press gut, den tapferen David in einer Verlagswelt von mächtigen Goliaths. Honor war ihr zu Dank verpflichtet. Vor zwei Jahren, gleich nach Tads Tod, hatte Ruth sie vor der Pleite gerettet, indem sie ihre [18] Sammlung früher journalistischer Texte unter dem Titel Zeugen, Zeichen, Zahnbürsten nachdruckte. In den fünfziger Jahren waren sie bei Faber erschienen, inzwischen aber längst vergriffen gewesen. Der Nachdruck, in dem auch ihre Reportage über die Befreiung von Buchenwald enthalten war, für die Honor den Pulitzerpreis bekommen hatte, wurde zu einem Achtungserfolg. Honor Tait wurde »wiederentdeckt« und konnte, noch erfreulicher, einige ihrer drückendsten Schulden begleichen. Jetzt hofften sie, das Kunststück mit dem Folgeband, Depeschen aus dem Dunkeln: Honor Taits gesammelte Werke, wiederholen zu können. Und für einen dritten Band nächstes Jahr gab es bereits Fahnen. Ruth hatte auch schon einen Titel, Mit unbestechlichem Blick, doch den fand Honor unmöglich.
»Ach, komm«, hatte Ruth gesagt, als sie sich über die Vorabwerbung für die Depeschen unterhielten, »ein Interview für die angesehenste Zeitung des Landes? In der vertrauten Umgebung deiner Wohnung? Was ist denn so schlimm daran? Werbetechnisch bringt es unendlich viel mehr als eine doppelseitige Anzeige.«
Und ist auch unendlich viel billiger. Deshalb hatte Honor kapituliert. Aber sie wusste, dass es ein Fehler war. Die wenigen Male, die sie sich auf ein Interview eingelassen hatte, durfte niemand in ihre Wohnung. Sogar für einen wohlgesonnenen Journalisten würde diese mitsamt ihrer Einrichtung ein Schlüsselloch in ihre Psyche sein, ohne Vorhänge, ausgeleuchtet bis in die dunkelsten Winkel. Die Aufnahmen für die South Bank Show mit Melvyn waren in der London Library gemacht worden, wo sie sich in einem Moment von narzisstischem Leichtsinn, für den das Foto dann die [19] gerechte Strafe war (Vogelscheuche im Vorraum der Hölle), schon einmal hatte ablichten lassen, für Vogue.
Hotels, neutrales Niemandsland, unberührt von irgendwelchen Andenken oder Hinweisen, waren für solche Begegnungen am geeignetsten. Nicht einmal der resoluteste und boshafteste Reporter konnte einen für die nüchterne Inneneinrichtung, die Flecken auf dem Sofa oder den muffigen Geruch im Raum verantwortlich machen. Aber selbst in einer solchen Allerweltseinrichtung aus beigefarbenem Leder und Chrom, wo es an Büchern lediglich die Gideon-Bibel und die Gelben Seiten gab, konnte man in die Falle tappen. So war es dem armen John Updike ergangen. Sie hatte ihm ihr Mitgefühl in einem Brief bekundet, nachdem eine Zeitungsreporterin unter einem Sessel seines Hotelzimmers eine vergessene Unterhose entdeckt und den weißen Slip in ihrem Artikel als Symbol für die typisch männliche oberflächliche Einstellung gegenüber Sex in Updikes Romanen benutzt hatte. Diese Bigotterie war Honor zuwider. Doch hier in ihrer Wohnung gab es dank ihrer Haushilfe keine schmutzige Wäsche zu entdecken.
Es war eine alte Masche: sich auf ein scheinbar unbedeutendes Objekt stürzen und es zum Schlüssel für die Psyche des Besitzers erklären. Wie sonst sollte man ein ganzes Leben aus einer einstündigen Unterhaltung und ein bisschen Recherche im Zeitungsarchiv herausdestillieren? Honor hatte selbst mehr als einmal diesen Trick angewandt, zumal wenn der Interviewpartner wenig mitteilsam war. Jeder Nippes ist beredt. Sogar in der allerneuesten Version des New Journalism bleibt manches beim Alten. Sie erinnerte sich an ihr eigenes Jagdfieber, als sie ein Netsuke-Maultier auf [20] McArthurs Schreibtisch in Tokio, ein Theaterplakat für eine Max-Miller-Vorstellung in Becketts Höhle in Montparnasse, Shakespeares Sonette auf dem Nachttisch von Madame Chiang Kai-sheks Krankenzimmer oder ein signiertes Foto von Ida Lupino in de Gaulles spartanischer Kommandozentrale in Carlton Gardens entdeckt hatte.
Könnten ihre Fotos, die Tad vor langer Zeit im Bücherregal und an den Wänden verteilt hatte, solch prüfenden Blicken standhalten? Eine Schwarzweißaufnahme zeigte sie als junge Kriegsreporterin, geschmeidig wie eine Löwin, in fescher Uniform zwischen den grinsenden todgeweihten Jungs vor ihrem Einsatz in der Normandie. Daneben ein Bild für Collier’s Weekly, das Kult geworden war: Honor neben Franco, dem frisch ernannten Militärgouverneur der Kanarischen Inseln. Von der Taille aufwärts war sie absoluter Profi, mit gezücktem Block und Stift in einer Pose angestrengter Aufmerksamkeit, wie eine Stenographin aus den Dreißigern. »Nehmen Sie einen Brief auf, Miss Tait.« Ab der Taille aber war sie ganz Showgirl. Die langen, sonnengebräunten Beine in maßgeschneiderten Shorts und hochhackigen Sandalen sahen aus, als wären sie aus den Ziegfeld Follies entliehen. Das Bild ging um die Welt. »Die Nachrichten-Dietrich« nannte man sie. Alles nachzulesen. Teil des Mythos. Daran war jetzt nichts mehr zu ändern.
Der Ausschnitt aus dem Paparazzo-Foto eines Abendessens bei Kerzenschein – einer Benefizveranstaltung für Amerikas Progressive Party – könnte problematischer sein. In seiner ganzen Größe, mit Sinatra an ihrer Seite, der ihr etwas ins Ohr flüsterte, hatte das Bild für Aufsehen gesorgt. Als es entstand, war er noch verheiratet gewesen, hatte sich [21] aber offen mit Ava Gardner gezeigt. Die Klatschreporter hatten sich überschlagen, wenn auch in dem heuchlerischen Ton dieser prüden Zeit, als Normalsterbliche noch neidisch das Treiben der Götter bestaunten. Jetzt waren die Sterblichen auf dem Vormarsch, und die Götter standen am Pranger und wurden mit faulen Tomaten beworfen. Sie nahm das Foto von der Wand, hielt es einen Augenblick in der Hand, bewunderte – ja, warum es nicht zugeben? – ihr gardeniengeschmücktes Dekolleté und wie das Licht ihre Schultern umschmeichelte. Die Blüten waren so weich und taufrisch wie ihr argloses junges Gesicht, das der Fotograf augenscheinlich in einem Zustand präkoitalen Schmachtens eingefangen hatte. Wie die Kamera lügen kann, und manchmal zu unserem Vorteil! Für damalige Begriffe war sie eine reife Dame; sie hatte ihren dreißigsten Geburtstag bereits hinter sich, dazu einen Krieg, eine unglückliche Ehe und mehrere wild bewegte Affären. Zwei weitere Kriege – drei, wenn man Algerien mitzählte – standen vor der Tür. Honor war nicht in der richtigen Stimmung für diese Art von Abend gewesen, aber ihre alte Freundin Lois, die damals für Henry Wallace Wahlkampf machte und Unterstützung rekrutierte, hatte sie unter Druck gesetzt. Zu ihrem Ärger hatte Honor feststellen müssen, dass nicht Alvin Tilly, der progressive Dramatiker und einer der Hollywood-Eleven, als ihr Sitznachbar vorgesehen war, sondern der Schnulzensänger Frank Sinatra. Auch Sinatra hatte sich den Abend wohl anders vorgestellt, doch zumindest den Schein der Höflichkeit gewahrt. Die vermeintlichen Anzüglichkeiten, die er ihr vor der Kamera ins Ohr geflüstert hatte, waren in Wirklichkeit Bemerkungen über das antifaschistische Flüchtlingskomitee.
[22] Zwanzig Jahre später hatte Tad in einem weiteren Anfall von Eifersucht das Bild zerschnitten und den Sänger, dessen Grinsen an einen gefallenen Engel gemahnte, wie auch die umstehenden Fotografen und Fans entfernt. Das vollständige Original hingegen war Eigentum einer der großen Agenturen und nach wie vor im Umlauf. Man hatte es in der jüngsten Dokumentation benutzt. Die Nachwelt hatte auf ihre grausame, launische Art Sinatras Vierzig-Watt-Talent in der Erinnerung erstrahlen lassen, während unzählige größere Künstler daneben verblassten. Würde Honors Interviewerin mit dem lächerlichen Namen Tamara Sim die Manipulation erkennen und folgern, dass Honor aus enttäuschter Liebe womöglich selbst zur Schere gegriffen hatte? Würde es die junge Frau auf eine falsche Fährte locken? Honor hatte nicht das Bedürfnis, den Monitor beziehungsweise sein Sonntagsmagazin zu irgendwelchen zweideutigen Kommentaren zu ermutigen.
Noch im Jahr 2000 empörten sich Zeitungsreporter trotz ihres eigenen chaotischen Privatlebens, ihrer Alkoholprobleme, eigener Drogenabhängigkeit und der obskursten sexuellen Praktiken angesichts banaler ehelicher Untreue immer noch so wie eine alte Jungfer zu Zeiten Eduards VII., wenn zum ersten Mal ein Mann die Hosen vor ihr runterließ. Honor gestattete diesem Blatt das Eindringen in ihre Privatsphäre nur bis zu einem bestimmten Punkt und auch nur aus einem Grund: um das verdammte Buch zu verkaufen. Besser gesagt, um an Geld zu kommen und ein paar Rechnungen zu bezahlen. Es war klüger, auf Nummer sicher zu gehen. Das Foto musste verschwinden. Sie umklammerte es und steuerte, erneut nach Atem ringend, auf ihren Sessel zu. Sie musste sich hinsetzen.
[23] Sieben Meilen entfernt in Hornsey, in einer schmalen Straße mit unterteilten Doppelhäusern, saß Tamara Sim im ewigen Dämmerlicht ihrer Souterrainwohnung und betrachtete sich mit zusammengekniffenen Augen im Spiegel. Lippenstifte lagen wie leere Patronenhülsen auf dem Schminktisch verteilt, neben ihr ein Arsenal an Kosmetikpinseln, während sie ihr Make-up mit der unendlichen Sorgfalt eines jungen Mädchens auf dem Weg zu seinem ersten Date auftrug. Was in gewisser Weise auch zutraf.
Als die Redakteurin des Monitor per Mail angefragt hatte, ob Tamara für das angesehene S*nday Magazine ein Interview mit Honor Tait führen wolle, hatte sie sofort zugesagt.
»Aber KLAR! Journalistische Ikone der alten Schule! Mit BEGEISTERUNG!!!…« So hatte Tamaras Antwort begonnen.
In Wahrheit war sie überrascht gewesen, dass die legendäre Reporterin überhaupt noch lebte. Ihre Kenntnisse über Taits Œuvre waren begrenzt – ein Artikel über die Frau eines chinesischen Diktators aus den Fünfzigern hatte zur Pflichtlektüre im Medienwissenschaftsstudium gehört. Der Dozentin zufolge hatte die Tait sich in einer Schwesternuniform in das Krankenhaus geschlichen, wo die alte Frau behandelt wurde, und eine geschlagene Stunde an deren Bett verbracht. Das Porträt aber war ebenso trocken und öde wie ein hochkarätiger Leitartikel, und schließlich hatte Tamara ihr Examen gemacht, ohne es auch nur zu Ende gelesen zu haben.
Mit chinesischer Geschichte oder Geschichte überhaupt hatte sie noch nie etwas anfangen können. Mit journalistischen Ikonen der alten Schule ebenso wenig. Hintergrundartikel über ausrangierte Autoren gehörten nicht zu Tamaras [24] Repertoire, und die Zeit – gut drei Wochen – war knapp bemessen. Doch Lyra Moores kurze Aufforderung per Mail »zum achtzigsten Geburtstag und dem Erscheinen von Honor Taits neuem Buch per 19. Februar viertausend Wörter über Leben und Werk für die S*nday-Ausgabe vom 30. März« zu liefern, hatte sie elektrisiert.
Vier Tage pro Woche arbeitete Tamara beim Monitor als Textarbeiterin und gelegentliche Autorin für Psst!, die wöchentliche Fernsehzeitung mit dem üblichen Promiklatsch – ein plumper Prolet im Vergleich zu dem ambitionierten, geradezu metaphysischen S*nday Magazine. Die grellbunte Welt von Psst!, bevölkert mit sexsüchtigen Soap-Opera-Stars und rivalisierenden Boy-Groups, magersüchtigen Bräuten von Fußballhelden oder drogenabhängigen TV-Moderatoren, war von den intellektuellen Aristokraten des S*nday Magazine so weit entfernt wie Pluto, sowohl als Planet als auch in der Disney-Variante. Lyra Moores elegantes, intellektuelles Blatt, dessen Seiten wie Seide raschelten, galt als das britische Pendant zum New Yorker, mit dem zusätzlichen Reiz von Fotos. Erst vor kurzem waren Umberto Ecos Gedanken über mittelalterliche Ästhetik, eine lange Kierkegaard-Abhandlung von George Steiner sowie ein Essay von Susan Sontag über Polaroidfotografie darin erschienen, illustriert mit sehr persönlichen, geheimnisvollen, anrührend schlecht komponierten Sofortbildern, die im März des vergangenen Jahres von den unlängst belagerten Einwohnern Sarajewos gemacht worden waren. Keinen der drei Namen hatte Tamara je gehört. Sie kämpfte sich zwar nach Kräften durch ihre Beiträge, hatte aber keine Lust, sich eingehender mit ihnen zu beschäftigen, indem sie auch noch [25] die Bücher las. Ganz abgesehen davon – wo hätte sie die Zeit hernehmen sollen?
Sie entschied sich gegen den aufreizend roten Lippenstift, der die ersten Anzeichen eines Herpes nur unterstreichen würde, wischte ihn mit einem Papiertuch ab und griff zu Frosted Pink. Heute musste sie professionell wirken. Gepflegt, aber nicht arrogant. Knielanger dunkelblauer Rock, weiße Hemdbluse, beiger Trenchcoat und flache Pumps, ein dezentes Outfit. Prinzessin Diana hätte es beim offiziellen Besuch eines Kinderkrankenhauses tragen können.
Tamara wusste, dass dieser Auftrag ihr Durchhaltevermögen auf eine schwere Probe stellen würde, denn er erforderte ein ausführliches Interview, das sie sozusagen über Nacht mit Mehrsilbern gespickt niederschreiben musste. Viertausend Wörter, das stand fest, waren eine Herausforderung für sie, die Bildunterschriften von zwei Sätzen gewohnt war, zwölfzeilige Charts oder zwei Absätze über das, was Promis so widerfuhr. Ihre gelegentlichen Interviews umfassten maximal achthundert Wörter. Zwei Mal hatte sie Artikel von jeweils tausend Wörtern für den Sunday Sphere geliefert – ein Stück Scheckbuchjournalismus über eine transsexuelle Stripperin, die behauptete, mit dem Fernsehmoderator einer Kindersendung geschlafen zu haben, und einen Enthüllungsbericht über den halbwüchsigen Sohn eines hohen Polizeibeamten, der mit Rauschgift zu tun hatte. Aber vier Mal so lang? Das bedeutete jede Menge Tipperei, ganz zu schweigen von der Recherche.
Es war beängstigend, andererseits war ein Auftrag von Lyra Moore die größte denkbare Auszeichnung. Fünf Jahre nach dem Start des S*nday Magazine schwang immer noch [26] stille Bewunderung mit, wenn ihr Name fiel, nur an der typographischen Marotte im Titel wurde gelegentlich Anstoß genommen. Snobs bewunderten Lyra Moores Magazin wegen seines intellektuellen Anspruchs, während pragmatische Journalisten es um sein großzügiges Budget beneideten. Eine Feld-Wald-Wiesen-Reporterin wie Tamara, die als Freie weder Bezahlung im Krankheitsfall noch Urlaubstage, Pensionsrückstellungen oder Zugang zu einer Altersvorsorge erwarten durfte und obendrein einen kranken Bruder am Hals hatte, konnte sich eine solche Karrierechance nicht entgehen lassen.
Später hatte sie sich gefragt, ob ihre Antwort, die sie postwendend zurückgebeamt hatte, vielleicht zu überschwenglich gewesen war: »…COOL!!!… Ich BEWUNDERE sie!… Freue mich WAHNSINNIG!!… Super Zeitung!!… Phantastische Mitarbeiter!!!…« Würde Lyra Moore nicht eine gewisse Distanziertheit bevorzugen, so wie sie selbst sie auch an den Tag legte? Auf Tamaras Mail und auch alle folgenden Nachrichten und Anrufe hatte sie nicht reagiert. Konnte man sich – wie bei Männern – zu sehr für etwas begeistern?
Als ständige Einrichtung bei Psst! war Tamara eine »feste Freie« mit der Arbeitsplatzsicherheit eines Tagelöhners auf einer Wanderbaustelle. Doch solange sie nützlich war und die Protektion des Psst!-Redakteurs genoss, hatte sie zumindest ein Einkommen und vier Tage in der Woche, montags bis donnerstags, einen Schreibtisch. Die übrigen drei Tage blieben ihr, um für andere zu freelancen. Sie hatte Artikel für die tägliche Rubrik namens Monitor Extra geschrieben, auch bekannt als ME2, die von einem hohläugigen Adrenalinjunkie namens Johnny Malkinson geleitet wurde. [27] Dabei handelte es sich vor allem um Charts, Telefonumfragen und Statements, doch allmählich machte Tamara sich durch Zweitverwertungen auch über den Monitor hinaus einen Namen als zuverlässige Lieferantin von humorvollem, preiswertem Kurzfutter.
Tamara war ehrgeizig und nicht wählerisch. Als angehende Reporterin hatte sie ein Praktikum – drei Monate – beim Sydenham Advertiser absolviert und war dann als anpassungsfähige Mitarbeiterin für diverse Publikationen von Verbänden und Unternehmen tätig gewesen, darunter Rappeln in der Kiste: Die Stimme der Verpackungsindustrie; Glasur heute: Vierteljahresschrift des staatlich geprüften Instituts für Lebensmitteldesign und Die Mangel: Nachrichten aus der Wäsche- und Reinigungsindustrie. Dann war sie aufgestiegen zu Fachzeitschriften, die sich an Hobbybergsteiger, Gesellschaftstänzer und Wellensittichfreunde wandten, hatte zu landesweit vertriebenen Publikumsmagazinen gewechselt – Glow oder Chick’sChoice – und sich schließlich als freie Mitarbeiterin in Nachrichtenspalten, Unterhaltungsteilen, Alltagskolumnen, Reiserubriken und Wochenendbeilagen vieler regionaler und überregionaler Zeitungen vorgearbeitet, sowohl bei seriösen Blättern als auch in der Regenbogenpresse. Dabei hatte sie eine breite Allgemeinbildung erworben und sich mit den Vorteilen von Eispickeln aus Aluminium und Hosen aus Polypropylen, den jeweiligen Vorzügen von Kohlenstofftetrachlorid und Perchloräthylen, dem Unterschied zwischen Mambo und Merengue sowie der korrekten Schreibweise von Melopsittacus vertraut gemacht.
Im Zuge ihrer diversen Verpflichtungen war sie Business-[28] Class geflogen und hatte die Welt gesehen. In Mexiko-Stadt, wo sie über die Expo Pack 1995 berichten sollte, hatte sie eiskalte Daiquiris und drei Tage flüchtigen Sex mit einem Kartongroßhändler aus Nebraska genossen, sich in San Diego anlässlich eines dreitägigen Workshops über das stilvolle Anrichten von Salat in einen italienischen Fotografen verliebt und Höllenqualen ausgestanden, weil er ihre Gefühle nicht erwiderte, und auf Mauritius, wo sie an einer Vogelmediziner-Konferenz zur Behandlung von klinischer Megabakteriose teilnahm, zum ersten und letzten Mal einen Schnupperkurs in Tiefseetauchen mitgemacht. Sie war stolz auf ihre Vielseitigkeit und sah, wenn sie an ihre Position bei Psst! dachte, ihr Arbeitsleben als Spiegelbild ihres Liebeslebens an: Sie spielte mit, hatte Spaß und empfand keinerlei Druck, sich fest zu binden, ehe die richtige Zeitung ein verlockendes Angebot machte. Erst dann würde sie ein seriöses und monogameres Anstellungsverhältnis ins Auge fassen. Hätte Tim Farrow, Chefredakteur des Sunday Sphere, mitgespielt, wäre eine befriedigende Lösung an beiden Fronten in Sicht. Doch er entpuppte sich als schwere Enttäuschung.
Sie durfte nicht an Tim denken, das ruinierte nur ihre Wimperntusche. Sie hatte ihm zwei Wochen hinterhergeweint, jetzt musste sie sich zusammenreißen und wieder auf die Beine kommen. Der neue Auftrag kam genau im richtigen Moment. Eine Tür schließt sich, und schon tut sich die nächste auf. Sie hatte sich im Brachland der Branchenpresse abgestrampelt und im Basislager der Boulevardzeitungen fleißig Klinken geputzt. Jetzt, in diesem Stadium ihrer Karriere, mit siebenundzwanzig, konnte sie sich ehrgeizigere Ziele setzen und sich auf das S*ndayMagazine[29] konzentrieren, den Mount Everest der britischen Zeitungswelt. Mit ein wenig Beharrlichkeit winkte ihr eine feste Mitarbeiterstelle oder auch ein fetter Vertrag als freie Mitarbeiterin beim angesehensten Blatt des Vereinigten Königreichs.
Stirnrunzelnd betrachtete sie sich im Spiegel. Sie wünschte, sie könnte sich einen Friseurbesuch leisten. Ihre Strähnchen brauchten dringend eine Auffrischung, der Schnitt – eine billige Imitation von Dianas Pagenkopf – ging gerade noch. Sie sammelte ihren Notizblock, einen Stift und das Tonbandgerät ein und verstaute alles in ihrer Handtasche.
Jeder wusste, wie schwierig Honor Tait war. Selbst ihre Verlegerin räumte es ein und hatte Tamara davor gewarnt, irgendwelche Details aus Taits Privatleben anzusprechen. Doch Tamara war gewappnet. Im Archiv des Monitor hatte sie sich die Akte über Honor Taits Leben und Werk besorgt, dazu Ausdrucke der Verlagsinfos, ein Vorabexemplar der Depeschen und eine weitere unappetitlich dicke Hardcover-Schwarte, eine Sammlung von Taits frühen journalistischen Arbeiten, trostlos und öde wie ein Lehrbuch der Soziologie. Offenbar enthielt sie auch den Artikel, für den sie den Pulitzer-Preis bekommen hatte. Zwar hatte Tamara bislang keine Zeit gehabt, einen genaueren Blick hineinzuwerfen, sich aber trotzdem ein paar Fragen auf dem Block notiert. Auf dem Weg zur Bushaltestelle und zu ihrem Interview fühlte sie sich gerüstet und bereit zum Kampf.
[30] 2
Honors Kräfte ließen nach; die Energie, die ihr die erste Tasse Kaffee am Morgen schenkte, wich immer schneller dem überwältigenden Bedürfnis nach einem Nickerchen. Sie musste dies hier zu Ende bringen. Noch eine Dreiviertelstunde. Tads Foto auf dem Beistelltisch aus Rosenholz konnte bleiben. Mit seinen Augenfältchen, dem weißen Haar und den rosigen Wangen sah er aus wie ein frisch rasierter Weihnachtsmann von Selfridges, ein Schutzheiliger des guten Willens und der Beständigkeit: ihr untadeliger verstorbener, letzter Ehemann. Er hatte ihr sein Konterfei voll naiver Selbsteingenommenheit zu einem Hochzeitstag überreicht. Gab es einen besseren Beweis seiner Ergebenheit?
Das einzige Foto in der Wohnung, das sie ihrerseits in einen selbstgekauften Fertigrahmen aus Plexiglas gesteckt hatte, stand in sicherer Entfernung von neugierigen Reporterblicken auf ihrem Nachttisch. Die Sommersonne hatte das zerzauste Haar des Jungen gebleicht; das Hemd war aus der von einem Stoffgürtel gehaltenen kurzen Hose gerutscht. Honor trug einen gepunkteten Rock mit Lackledergürtel und hielt ihn an der Hand – ein wenig zu fest. Hinter ihnen war die imposante georgianische Fassade von Glenbuidhe Lodge zu sehen, hängende Fuchsien umrahmten die [31] Eingangstür, im Wohnzimmerfenster ein Flaschenschiff mit geblähten Segeln, einer von Tads Bestechungsversuchen. Daniel hielt den Kopf zur Seite geneigt, als posierte er schüchtern für die Fotografin, Lois, die den Jungen für die Osterferien im Schlafwagen hergebracht hatte; sein linkes Auge war zugekniffen, wie geblendet vom grellen Licht. Später schickte sie Honor das Foto und legte ein paar anmaßende Zeilen dazu: »Pass auf ihn auf, Honor. Er ist zerbrechlicher, als man glaubt.« Honor hatte den Zettel ins Feuer geworfen. Tad hatte sie gedrängt, auch das Foto zu vernichten, und sie hatte es jahrelang versteckt. Sie brachte es nicht über sich, es wegzuwerfen, obwohl sie sich ihrer Gefühlsduselei schämte. Doch jetzt war auch Tad gegangen, und sie konnte tun und lassen, was sie wollte.
Auf dem Kaminsims, über dem Schlund des Kohle imitierenden Gasfeuers, lehnte eine Ansichtskarte. Sie zeigte eine anmutige Gestalt mit einem Kuli-Strohhut in einem Reisfeld. Es war der obligatorische Gruß aus Saigon von Tads Patentochter, die das letzte Jahrzehnt damit verbracht hatte, die Zeit zwischen Schule und Uni zu überbrücken. Honors eigene Jahre in Saigon waren von anderem Kaliber gewesen. Keine unbeschwerten Rucksacktouristen, die von einem exotischen Ort zum anderen drifteten und gar nicht merkten, dass dies genauso imperialistisch war wie die Eroberungen früherer Generationen, keine Vergnügungsfahrten auf dem Fluss, keine peinlichen Studentenbesäufnisse in einheimischen Bars, keine Volkstänze oder Märkte mit Kunsthandwerk. Nur Lärm, Schlamm, Bomben, Blut und überwältigendes Grauen. Aber auch Kameradschaft und sogar Leidenschaft. Wenn Kollegen neben dir sterben, sind [32] Körper und Geist nur noch von der rein animalischen Lust erfüllt, am Leben zu sein. Außer Dienst, jenseits des Schlachtfelds, waren sie regelrecht übereinander hergefallen. Zurück in England hatte sie bisweilen auf steifen Beerdigungen einen ähnlichen höllischen Lebenshunger verspürt, ohne ihn je stillen zu können. Das professionelle Pokerface des Leichenbestatters, das Flüstern und erstickte Schluchzen der Trauernden, das getragene Schreiten des Leichenzugs, all das konnte wenig pietätvolle Gelüste auslösen.
Sie hätte die Ansichtskarte schon vor Monaten wegwerfen sollen; sie war nur ein Staubfänger. Als sie sie jetzt zerriss, nahm sie sich vor, dasselbe mit einer anderen Karte jüngeren Datums zu tun, die noch in ihrem Umschlag in der Diele lag. Es war eine geschmacklose Donald-McGill-Karikatur von gaffenden Jungs und überdimensionalen Brüsten, mit einer spöttischen Nachricht auf der Rückseite, halb Provokation, halb Bettelbrief, bei deren Anblick eine neugierige Reporterin möglicherweise die Augenbrauen hochzog. Doch zunächst musste sie sich auf das Wohnzimmer konzentrieren. Dies war die Bühne des Interviews.
Um den Sockel einer Messinguhr auf dem Kamin hing eine Kette mit komboloi, Gebetsperlen aus Jade, ein Souvenir von den Kykladen. Sie konnte bleiben, ebenso Tads Schottenrock aus Staffordshire – man hätte eine überaus blühende Phantasie gebraucht, um sich daraus etwas zusammenzureimen. Die Totenmaske von Keats, Tads Geschenk nach ihrer Versöhnung in Rom, und die Schneekugel mit der kleinen Nonne – ein lustiges Mitbringsel von Lois – waren bestimmt auch nicht besonders interessant. Aber der geflügelte Phallus aus Marmor, die Replik einer [33] Gottheit aus Pompeji, diese Votivgabe von Lucio, einem übermütigen jungen Toskaner, die Tad in einem glücklichen Moment amüsant gefunden hatte, könnte ein Problem darstellen. Sie hielt den kühlen Stein in der Hand. Übertrieb sie nicht ein bisschen? Nein, es war besser, kein Risiko einzugehen. Die kleine Schneeschwester nahm sie auch gleich mit. Nonnen und Penisse: Aus dieser Zusammenstellung könnte eine verzweifelte Journalistin durchaus etwas machen. Honor hätte es unter ähnlichen Umständen auch getan.
Im Besenschrank in der Diele hatte sie ein Plätzchen als Versteck freigeräumt. Wie viel Müll sich im Lauf eines Lebens ansammelt! Haufenweise Mist und überflüssiges Zeug, selbst wenn man viel wegwirft und einen Widerwillen gegen dekorativen Krimskrams hat. Es sah so aus, als wäre sie letzten Endes trotz aller Anstrengungen doch noch zu einer vollbeschäftigten Kuratorin all dieses Plunders geworden. Eine Art Lumpensammlerin. Dass das meiste davon einmal Tad gehört hatte, spielte keine Rolle. Jetzt war es ihres, dieses kleine Museum nostalgischer Fetische, und es ganz aufzulösen würde sie eine übermenschliche Anstrengung kosten.
Wenn sie die Wohnung verließ, um sich mit Ruth zu einem Arbeitslunch zu treffen, mit Clemency oder Inigo eine Vernissage oder mit Bobby oder Aidan einen Kammermusikabend zu besuchen, verspürte sie immer wieder den Drang, einfach weiterzugehen, ein Taxi zum Flughafen zu nehmen, in eine Stadt zu fliegen, in der sie noch nie gewesen war, in ein Land, das sie kaum kannte, und noch einmal ganz von vorn anzufangen. Eine Mietwohnung, wenig Besitz und bloß keine verdammten Bilder, Bücher oder billiger Schnickschnack. [34] Womöglich könnte sie mit dem Ballast auch die vergeudeten Jahre und die körperliche Erniedrigung des Alters abschütteln. Sie bekäme noch einmal eine Chance, und diesmal würde sie alles richtig machen.
Während sie den eingesammelten Kram in dem Fach hinter dem Staubsauger versenkte, schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, dass sie ihn vielleicht nie wieder herausholen würde. Nur aus Pietät gegenüber Tad, dem ihre regelmäßigen Säuberungsaktionen körperliches Unbehagen bereitet hatten, warf sie den ganzen Mist nicht einfach in den Müllschlucker.
Und jetzt die Bücher. Honor zog einen Schemel vor das Regal, setzte sich und widerstand kaum der Verlockung, wenigstens für einen Moment die Augen zu schließen. Sie musste sich konzentrieren. Litt sie schon an Verfolgungswahn? Mittlerweile registrierte sie peinlich genau alles, was auf eine beginnende Demenz hindeutete, nachdem ihr die ersten Symptome von Alzheimer bei ihrer Freundin Lois, deren Vergesslichkeit und Verwirrung, nicht weiter aufgefallen waren.
Früher, als Honor noch zu jung gewesen war, um es besser zu wissen, hatte sie an das Klischee geglaubt, dass das Alter seine guten Seiten hat und einem die Meinung der anderen zunehmend gleichgültig wird. Stattdessen rannte sie hin und her, regte sich auf und strapazierte ihre Nerven, nur um auf Tamara Sim und ihre Leser einen guten Eindruck zu machen. War das noch ein vernünftiger Schutz gegen Spott? Kein Mensch findet Gefallen an Demütigungen, egal, in welchem Alter. Oder verlor sie allmählich den Verstand? In letzter Zeit beunruhigten sie Anrufe, bei [35] denen niemand sich meldete. Auch früher hatten sie Anrufe von Psychopathen bekommen; Tad und sie hatten ihre Nummer zwei Mal ändern lassen. Es war ganz einfach. Doch statt nach dem Hörer zu greifen und die British Telecom zu verständigen, unternahm sie nichts, starrte nur ängstlich das Telefon an und fuhr hoch, wenn es klingelte.
Erst letzte Woche hatte sie in der Zeitung von einer Alterskrankheit namens Paraphrenie gelesen, und die Symptome – Verfolgungswahn, die fixe Idee, Nachbarn, Freunde, die Familie und Fremde seien nur darauf aus, einen zu hintergehen – waren ihr bekannt vorgekommen. Sie wusste, dass ihr Leben dem Ende entgegenraste, selbst wenn sie das Glück hätte, bei Verstand zu bleiben. Das gnadenlose Nachlassen der Kräfte hatte schon vor Jahren begonnen, ein groteskes Zipperlein folgte auf das nächste. An manchen Tagen kam Honor sich vor wie Hiob, der auf die nächste Plage wartet. Im Gegensatz zu ihm wusste sie allerdings, dass sie niemanden dafür verantwortlich machen konnte. Mit ihrer Rolle als Archivarin körperlicher Altersbeschwerden hatte sie sich widerwillig abgefunden, auch wenn immer peinlichere Körperteile dazukamen. Aber Wahnsinn? Das wäre unannehmbar.
Sie griff eine Handvoll Bücher aus dem Regal und stapelte sie unbeholfen in die Armbeuge. Immer wenn die Ängste überhandnahmen, zwang sie sich, innezuhalten und sich zu vergewissern, dass sie noch vernünftig denken konnte. Sie wusste, dass ihre Einwände gegen ein Interview bei sich zu Hause gerechtfertigt waren; als Jägerin, die nun selbst zur Gejagten geworden war, kannte sie die Tricks und die Fallen. Sie hatte viele Männer und auch ein paar Frauen [36] privat und beruflich aufgrund ihrer Bücherregale beurteilt. Raoul Salan mit seiner für einen Militäroffizier peinlichen Ausgabe des Kleinen Prinzen zum Beispiel. Als sie dem Labour-Mann Harold Wilson die Romantik seiner in Kunstleder gebundenen Gesamtausgabe von Catherine Cookson ankreidete, war sie möglicherweise übers Ziel hinausgeschossen. Sie gehöre ihm nicht einmal, hatte er sich nach der Veröffentlichung ihres Artikels beschwert. Befriedigender war da schon der Vatikan gewesen, der eine kleinere Inquisition in Gang gesetzt hatte, nachdem sie in Collier’sWeekly berichtet hatte, in der Apostolischen Bibliothek Die Geschichte der O. neben der Wolke des Nichtwissens entdeckt zu haben. Und beim Anblick einer Erstausgabe von Pu der Bär auf dem Nachttisch eines Kinohelden der fünfziger Jahre hatte sie hastig ihre Kleider zusammengesucht und war in die Nacht von Santa Monica geflohen.
Nun war ihre eigene Bibliothek an der Reihe. Graham Greenes Romane; Erstausgaben, handsigniert. Sie zu verbergen würde nichts bringen, außerdem würde sie bestimmt nicht alle vierunddreißig Bände zum Besenschrank schleppen. Aber Isadora Talbots Stunde der Schnecke? Wo kam denn das her? Möglicherweise würde Tamara Sim glauben, dass Honor diesen reißerischen Feminismus guthieß; dabei hatte Honor nicht das geringste Interesse daran. Warum sollte sie ihre Zeit mit einer schrillen Wichtigtuerin vergeuden, die ihr menopausenbedingtes Selbstmitleid zum Manifest erklärt hatte?
Honor bekam ständig unverlangt Bücher zugeschickt, die sie automatisch neben der Haustür stapelte, um sie zusammen mit alten Zeitungen und Zeitschriften zum Altpapier [37] zu geben. Die Haushilfe, eine Flüchtlingsfrau aus Ruanda, hatte wohl stillschweigend angenommen, dieses richtige Buch sei versehentlich zwischen all den pastellfarbenen, ungebundenen Leseexemplaren gelandet. Es gab nichts Deprimierenderes als das Geräusch, das eine schwere Luftpolsterversandtasche macht, wenn sie durch den Briefschlitz auf die Fußmatte plumpst. Die Verleger schienen zu glauben, dass Honor in ihren letzten Jahren nichts Besseres zu tun hatte, als hirnlosen Schwachsinn zu lesen und ihnen dann Superlative zu liefern, die sie auf den Einband drucken konnten – gratis versteht sich.
Wo war sie stehengeblieben? Gedichte: Aidans drei Bände, Tom Eliot, MacNeide und Larkin. Eine vom British Film Institute sanktionierte Biographie über Tads Arbeit, langweilig wie die Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine. Ein paar Fotobücher, die sie in Zusammenarbeit mit Robert Capa und Jane Bown veröffentlicht hatte – die Magnum-Ära. Ah! Und was war das? Trainingsprogramm zur körperlichen Ertüchtigung der Royal Canadian Air Force, ein altes Penguin-Taschenbuch mit orangefarbenem Rücken, das Gesundheit, Schönheit und ewiges Leben im Tausch für eine tägliche Viertelstunde elende Plackerei versprach. Tad, der nie im Leben bewusst Sport getrieben hatte, pflegte zu sagen, dass er sich schon schlanker und jünger fühlte, wenn er es nur im Regal stehen sah. Es konnte kaum etwas Lachhafteres geben als den Ehrgeiz, mit über siebzig noch fit zu sein. Es hatte einem nichts auszumachen, wenn sich der Körper allmählich in einen Klumpen faulendes Fleisch verwandelte, und die Hoffnung, dass man diesen Prozess aufhalten und den bevorstehenden Untergang mit täglichen [38] körperlichen Verrenkungen verhindern könnte, war geradezu aberwitzig. Weg damit, weg mit Psychiatrie, Philosophie und Anthropologie, mit R. D. Laing, Alan Watts, Carlos Castaneda, Hokuspokus, den Tad vermutlich in seiner Haight-Ashbury-Phase angeschafft hatte.
Sie warf alles auf den Haufen, der zum Entsorgen bestimmt war. Das Regal musste ohnehin ausgemistet werden. Wozu erst noch ins Altpapier, am besten kippte man alles gleich in den Müllschlucker. Sie würde es in einer Tüte neben die Haustür stellen, mit einem Zettel für die Hilfe, neben das Bündel mit den ungelesenen Weihnachts- und Silvesterausgaben und vielen Seiten Fernsehprogramm. Warum sollte sie eine Beilage mit einer Abbildung von Bing Crosby auf dem Cover lesen wollen? Und glaubte man etwa ernsthaft, mit einem Gratismuster von Weihnachtssternsamen oder Aspirin neue Leser anlocken zu können?
Sie sah sich ein letztes Mal im Zimmer um. Als sie die Haushilfe losgeschickt hatte, um Blumen zu kaufen, war diese mit ein paar verdächtig rosa Lilien zurückgekommen, deren flammender Schlund einen Duft verströmte, bei dem Honor die Augen tränten. Jetzt standen sie in einer Vase neben dem gerahmten Foto von Tad. Der Tisch sah nun aus wie ein Altar am Wegesrand, und ihr neues Buch, Depeschen, thronte darauf wie eine Bibel, die sich über sie lustig machte: Miserere mei. Wie auch immer, der Strauß brachte vielleicht etwas Weiblichkeit in die Wohnung. Sie selbst konnte Schnittblumen nicht ausstehen, egal welche; sie erinnerten sie an Leichenhallen. Ihre Freunde wussten Bescheid, aber Gäste, die zum ersten Mal zum Abendessen kamen, brachten gelegentlich teure Sträuße mit, in der Hoffnung, sich bei ihr [39] einzuschmeicheln. Dann heuchelte sie Begeisterung, legte die Blumen in die Spüle und sagte, sie werde später nach einer passenden Vase suchen. Immer war es ihre Hilfe, die die Blumen rettete, die Stengel anschnitt, die einzelnen Blüten sorgsam arrangierte und sie am Schluss, wenn die Blätter schrumpelten und das Wasser nach Latrine stank, in den Müllschlucker warf.
Honor blieb am Fenster stehen, angezogen vom Geschrei eines Kindes in dem gemeinsam genutzten Garten. Es klang wie das Kreischen einer Möwe. Eine junge Mutter, vielleicht auch ein Kindermädchen, stieß ein Kind auf der Schaukel an, die an den kahlen unteren Ästen einer Platane hing.
Theoretisch gehörte der Garten den Bewohnern der vier herrschaftlichen Wohnresidenzen, deren Hinterhöfe er in Beschlag nahm. Die Bewohnerversammlung – Wichtigtuer mit viel Zeit – hatte vor kurzem, nach energischer Lobbyarbeit der jungen Eltern, die massenweise in dieses Viertel geströmt waren, dort die Kinderschaukel installiert, ohne sich um das seit hundert Jahren geltende Verbot von Ballspielen und sonstigen Aktivitäten zu scheren.
Das Rondell war von einem schwarzen schmiedeeisernen Zaun umgeben, was so aussah, als seien das spärliche Gras, die im Winterschlaf liegenden Beete, rußschwarzen Sträucher und ein paar kahle Buchen im Schatten der imposanten Platanen gefährdet wie eine vom Aussterben bedrohte Spezies im Zoo. Das Kind stieß noch einen Schrei aus, wie die zwei Töne einer Warnhupe, dann flog es von der Schaukel in die Arme seiner Mutter und aus Honors Gesichtsfeld hinaus. Die Zeit wurde knapp.
Sie ging ins Badezimmer, um es auf etwaige Flecken oder [40] Gerüche zu überprüfen. Schließlich wollte sie Klischees über Inkontinenz im Alter keine neue Nahrung geben und wusste, dass sich eine Stippvisite im Bad für einen rücksichtslosen Reporter durchaus lohnte. Selbst in unpersönlichen Hotelzimmern kann eine neugierige Nase fündig werden, auch ohne vergessene Unterhosen unter dem Sessel. Sie erinnerte sich an ihre eigene Genugtuung, als sie in Saigon eine Flasche Haarfärber auf dem Waschbecken des schmallippigen Generals Minh entdeckte. Die Lowe-Karikatur über dem Wasserkasten – Honor als junge Brünnhilde, die Hitler und Stalin an den Haaren hinter sich herzog – war ungefährlich, doch der Fußpuder und die Salbe gegen Hämorrhoiden auf der Badewannenablage (weitere Hinterlassenschaften von Tad) könnten sie der Lächerlichkeit preisgeben. Ebenso der Tiegel mit Youth-Dew-Feuchtigkeitscreme, ein unbeabsichtigt grausames Geschenk von Tads schöner Patentochter, die es vermutlich im Duty-free-Shop irgendeines Flughafens erstanden hatte.
Vor allem Medizinschränke konnten jede Menge unappetitlicher Wahrheiten ans Licht bringen. Ihrer enthielt eine Miniaturapotheke von verschreibungspflichtigen Tabletten, Salben und Tinkturen, die ihre jeweils eigene schmutzige Geschichte erzählten. Honor bezweifelte, dass Tamara Sim den Unterschied zwischen Benzodiazepinen und Nicardipin kannte, aber sicher konnte sie nicht sein. Sie kippte das Ganze in eine Plastiktüte, um es irgendwo anders zu verstauen, und ließ nur die Zahnbürste (sie besaß noch fast alle Zähne, wenngleich sie teilweise so braun waren wie der abgelutschte Rest eines Karamellbonbons), eine bescheidene Parfumflasche, ein Röhrchen Aspirin und eine Packung Pflaster stehen.
[41] Noch zehn Minuten. Sie merkte, dass sie schon wieder außer Atem geriet und das Herzstechen schlimmer wurde. Sie holte sich ein Glas Wasser, kramte ihre Tabletten aus der Tüte und nahm zwei davon. Sie sollte sich hinsetzen, aber sie musste sich noch anziehen. Sauber, frisiert und würdevoll – auf mehr konnte man in ihrem Alter nicht hoffen. Als junges Ding hatte sie eine Schwäche für Kleider gehabt: elegante Schnitte, sinnliche Stoffe, gedeckte Farben, den Highlands im Herbst entlehnt, mit raffinierten Details. Als sie fünfzig wurde und das Chaos in ihrem aus allen Nähten platzenden Ankleidezimmer betrachtete, einem gutsortierten Museum der Mode aus der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, die in der schottischen Feuchtigkeit langsam vermoderte, ging ihr auf, dass sie niemals lang genug leben würde, um all diese Sachen zu tragen, selbst wenn sie jeden Tag etwas anderes anzog. Später hatte sich das als Trugschluss erwiesen: Sie sollte ihre Garderobe um viele Jahrzehnte überleben. Noch am gleichen Nachmittag sortierte sie vieles aus, und fast ein Vierteljahrhundert später tat ein Brand ein Übriges. Heute machte ihr bescheidener Kleiderschrank hier in Holmbrook Mansions einer Nonne Ehre.
Sie entschied sich für ein schwarzes Kleid, das erst vor kurzem aus der Reinigung gekommen war, schlicht und schmal geschnitten, mit eckigem Ausschnitt und Glockenärmeln, dazu eine dunkle Strumpfhose, um die Adern zu verbergen, die ihre Beine marmorierten wie einen Blaukäse, und graue Lackpumps, bequem genug für die Ballenzehen. Sie sah an den bestrumpften Beinen hinab: unansehnlich wie die Stümpfe eines Leprakranken. Welcher Witzbold hatte diese Miranda bloß in Caliban verwandelt? Nach einigem [42] Fummeln mit dem Verschluss gelang es ihr, die Kette aus Süßwasserperlen anzulegen; dann griff sie nach einer goldenen Uhr, deren Zifferblatt mit Markasit umrahmt war. Obwohl sie das engste Loch nahm, baumelte sie lose wie ein Armband an ihrem Handgelenk.
Sie kehrte noch einmal ins Badezimmer zurück und warf einen Blick in den trüben Spiegel des Medizinschränkchens. Es war der Einzige, den es in der Wohnung noch gab, seit sie zu der befreienden Erkenntnis gelangt war, dass die beste Möglichkeit, sich gegen die Verzweiflung über sein verfallendes Äußeres zu schützen, darin bestand, es nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Wenn sie wollte, konnte sie ein Schwarzweißfoto aus ihrer Dietrichzeit betrachten und sich erinnern. Doch selbst dann war Vorsicht geboten. Bei einem bestimmten Lichteinfall konnte ihr das Glas im Fotorahmen einen Streich spielen und die Umrisse ihres verschrumpelten Ichs auf die sorglose Schöne projizieren.
Sie steckte das Haar, grau und fein wie Zigarettenrauch, zu einer Art Knoten zusammen. Lippenstift? Lidschatten? Lieber nicht. Es war besser, sich der Kamera ungeschminkt zu stellen als mit verschmierten Clownspuren, die sie ihren zitternden Händen und der nachlassenden Sehkraft verdankte. Sie nahm das Parfum, das Aidan aus Budapest mitgebracht hatte, und sprühte sich ein wenig hinter die Ohren. Dann verteilte sie noch ein paar Spritzer im Badezimmer. Sie war bereit für das Verhör.
Tamara saß gegenüber der herrschaftlichen Backsteinfassade, hinter der die Tait wohnte, im Café, nippte an einem lauwarmen Kaffee und ging ihre Zeitungsausschnitte durch. [43] Bucknell hatte Verspätung. Als man ihr in der Bildredaktion des Monitor eröffnet hatte, er sei der einzige Fotograf, der für das Interview zur Verfügung stünde, war sie fast explodiert. Wieso nicht Snowdon? Oder Bown? Wenn Lyra Moore erfuhr, dass ausgerechnet der unterbelichtete Bucknell mit dem Job betraut worden war, würde sie toben. Tamara hatte versucht, Lyra vorzuwarnen, doch die antwortete nicht auf ihre Mails, und wenn Tamara bei ihr anrief, steckte sie immer gerade in einer Besprechung. Bucknell hatte keinen Charme, war linkisch und mürrisch. Er rauchte Kette, hatte feuchte Hände, und seine Bilder waren flache Frontalaufnahmen, nichtssagend wie Fahndungsfotos der Polizei. Einen schlechteren Kollegen konnte man sich für ein so heikles Interview nicht vorstellen.
Eine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren, gab es nicht; Tamara stand in der Monitor-Hierarchie zu weit unten, und Bucknell war zu unbeliebt, als dass man ihnen eins der seltenen Mobiltelefone zugeteilt hätte. Sie könnte versuchen, von einer öffentlichen Zelle aus zu telefonieren. Die Bildredaktion könnte Bucknell anfunken (einen Pager hatte er zumindest – ihren hatte man ihr kurz vor Weihnachten im Bus geklaut) und auch Honor Taits Verlegerin anrufen, um sie von der Verspätung zu unterrichten und sich zu entschuldigen. Aber vermutlich würde Tamara zwanzig Minuten brauchen, bis sie eine Telefonzelle gefunden hatte, und dann feststellen, dass ein Säufer sie als Pissoir missbraucht hatte und obendrein der Hörer abgerissen war. Sie verfluchte Bucknell. Andererseits konnte sie sich so noch ein bisschen vorbereiten.
Honor Tait war äußerst produktiv gewesen. Tamara fragte [44] sich, wie dick wohl in zwanzig Jahren der Umschlag mit ihren eigenen Arbeitsproben sein würde. Sie war zum jetzigen Zeitpunkt eher einfallsreich als produktiv, Expertin darin, die eigene Arbeit weiterzuverwerten. Sogar die Grünen hätten noch von ihren Energiespartechniken lernen können. Manchmal recycelte sie dieselbe Geschichte vier- oder fünfmal und verkaufte sie an mehrere Abnehmer. Wie ihr Interview mit Lucy Hartson letztes Jahr, das ursprünglich ein Auftrag von Psst! gewesenwar, aber von den PR-Leuten einer Fernsehgesellschaft arrangiert wurde, denen es darum ging, die Werbetrommel für Herzdame zu rühren, ein neues Kostümdrama zur Hauptsendezeit. Die Antworten, die sie bekommen hatte, waren nichts als heiße Luft – »Ich habe Georgette Heyers Bücher schon immer geliebt…«, offenbarte Lucy. »Es ist ein großes Privileg, mit einer so talentierten Besetzung zu arbeiten… Als Nächstes würde ich gerne einen modernen Part übernehmen, vielleicht in einem Actionthriller.« Über ihren Ex-Boyfriend Tod Maloney, den drogenabhängigen Bassgitarristen der Broken Biscuits, hatte die Schauspielerin dummerweise nichts erzählen wollen und nur gesagt: »Wir waren sehr verschieden«, oder: »Es wurde Zeit für etwas Neues.« Im Übrigen war die Trennung »in aller Freundschaft« über die Bühne gegangen – eine fadenscheinige Ausflucht, längst widerlegt von den Paparazzi-Fotos eines Faustkampfs, den die beiden sich einen Monat zuvor vor einem Nachtclub in Soho geliefert hatten. Doch immerhin hatte Tamara für den Immobilienteil des Telegraph ein paar Zeilen über Lucys neue Wohnung in Islington abzweigen können. »Das Badezimmer, eine kühle Oase aus Kalkstein und gebürstetem Stahl, erfüllt den ästhetischen [45] Anspruch eines Luxus-Spa.« Außerdem hatte sie für den Courier eine Bildstrecke über zum Scheitern verurteilte Rock’n’Roll-Romanzen untertitelt. Am Ende hatte sie dann noch Hartsons beiläufiges Eingeständnis, dass sie mehrmals nach Los Angeles geflogen war, um sich Botox spritzen zu lassen – »Alle, die da drüben im Geschäft sind, machen das, glauben Sie mir« –, für einen ganzseitigen Enthüllungsbericht im Evening Standard ausgeschlachtet.
Doch das Lukrativste waren Fortsetzungsgeschichten. Noch bevor das Interview in Psst! erschien, hatte Tamara Maloney angerufen, der nach einer Drogenrazzia während seines Auftritts soeben gegen Kaution wieder freigekommen war. Nach ein paar Komplimenten zu seinem neuesten Album hatte sie ihm gesteckt, dass Lucy Hartson ihnen »alles« über die Trennung erzählt habe, und ihm angeboten, seine eigene Version der Geschichte zu liefern. Zum Glück war er offenbar gerade auf Drogen, Speed, nicht Tranquilizern. Seine Tirade hatte eine Dreiviertelstunde gedauert. Nachdem sie das schlimmste Geschwafel und etliche paranoide Behauptungen gestrichen hatte, war das Ganze als doppelseitiger Bericht unter der Schlagzeile »EDELFLITTCHEN: Sexy Lucy bricht mir das Herz!, sagt Biscuits starker Mann« im Sunday Sphere erschienen. Dieses Interview war es gewesen, das Tim auf sie aufmerksam gemacht hatte, der soeben Chefredakteur des Sunday Sphere geworden war. Er war »auf der Suche nach jungen Talenten«, wie er ihr zwei Monate später in ihrer ersten Nacht erklärte, kurz nachdem sie den Sohn eines hohen Polizeibeamten mit Cannabis geködert hatte, bis er schließlich anbiss und sie ihren großen Coup landete.
[46] Bei dem Gedanken an Tim füllten sich Tamaras Augen mit Tränen. Draußen trommelte der Regen mitfühlend an die Fensterscheibe. Oder war es spöttisch? Sie tupfte sich mit der Serviette die Augen. Die Wimperntusche schien zu halten. Schließlich wandte sie sich wieder den Artikeln zu, ein langes Leben voller unbedingtem Einsatz, zusammengeschrumpft auf ein paar Zeitungsausschnitte. Honor Tait war eine Schönheit gewesen, und die frühen Fotos, viele in Gesellschaft von Soldaten und Politikern, offenbarten den Glamour eines Filmstars und ein bezauberndes Lächeln. Bis heute galt sie als männermordende Sirene, die nicht viel für Frauen übrighatte. Simon, Tamaras Chef und Verbündeter bei Psst!, hatte die Tait ein paar Jahre zuvor bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennengelernt und behauptet, dass ihr Interesse an ihm nicht nur professioneller Natur gewesen sei.
»Sie ist ein richtiger Vamp«, hatte er Tamara gesagt, als er von ihrem Auftrag erfuhr. »Immer auf Männerfang. Je jünger, umso besser, offenbar. Doch auch sonst lässt sie nichts anbrennen – mich wollte sie gar nicht wieder gehen lassen.«
Simon zufolge war Honor bedeutender als Martha Gellhorn und dermaßen eingebildet, dass sie Snowdon beauftragt hatte, ihr Passfoto zu machen.
»Man nennt sie auch die Messalina von Maida Vale«, hatte er hinzugesetzt. »Es heißt, dass sie für Sex mit jungen Männern zahlt.«
Tamara rümpfte die Nase. In dem Alter? Was für eine Vorstellung – aber der Hinweis auf die Messalina war verwirrend. War das nicht der italienische Ferienort, wo das Management des Monitor letztes Jahr seine Klausur veranstaltet [47] hatte? Zog Honor Tait durch europäische Badeorte, um attraktive junge Männer aufzugabeln? Tamara beschloss, den Hinweis zu ignorieren – im Zweifelsfall war es besser, nicht weiter nachzufragen. Es sparte Zeit, und die ungeschminkten Tatsachen waren auch so interessant genug.
»Nein – echt? Sie bezahlt dafür?«, hatte sie nur gefragt.
»Na klar! Was meinst du denn, wie sie sonst an jemanden rankäme?«
Tamara hatte unbehaglich gelacht. Simon liebte Klatsch und Tratsch – wie alle Leute. Seine Geschichten waren immer witzig, ob sie auch stimmten, sei dahingestellt.
Sie warf einen Blick auf die Uhr – noch immer keine Spur von Bucknell – und blätterte noch einmal in dem wiederaufgelegten Buch. Sechzig Jahre Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften, die zum Teil heute gar nicht mehr existierten – News Chronicle, Reynold’s News, Collier’s Weekly. Berichte über den Spanischen Bürgerkrieg in den Dreißigern, das Nachkriegsberlin in den Vierzigern, Algerien und China in den Sechzigern, Vietnam in den Siebzigern… Tamara gähnte. So viele Daten und Ortsnamen auf einmal erschlugen sie einfach; es war so, als studierte man einen alten Fahrplan.
Als sie sich wieder die Presseausschnitte vornahm, stellte sie erleichtert fest, dass auch Artikel über Honor Tait dabei waren, nicht nur von ihr. Diese waren kürzer, ließen sich leichter ausschlachten und waren praktischerweise bebildert. Die Tait Mitte der vierziger Jahre – an ihrer kurvenreichen Figur wirkte das sittsame Twinset fast anrüchig –, als man sie für ihre Reportage über die Befreiung eines Konzentrationslagers der Nazis mit dem Pulitzer-Preis auszeichnete. [48] Da musste sie etwa im selben Alter gewesen sein wie Tamara. Es gab sogar ein noch früheres Foto, das in einem Strandcafé aufgenommen worden war; darauf trug sie ein enges, rückenfreies Oberteil und knappe Shorts, die ihre langen Beine zur Schau stellten. Ihr Gesprächspartner, ein adretter Mann in Uniform, der aussah wie ein kleiner Steuerbeamter, starrte anerkennend auf ihre Knie. Die Bildunterschrift lautete: Das Golden Girl des Pressekorps, Honor Tait, beim Interview mit dem Militärgouverneur der Kanarischen Inseln, Francisco Franco, zwei Wochen bevor dessen Putschversuch den Spanischen Bürgerkrieg auslöste.
Ein anderer Ausschnitt zeigte sie etwa um dieselbe Zeit in einem Schnellboot. Die Augen gegen die Sonne abgeschirmt, betrachtete sie den Horizont, wobei ihre Haut einen dunklen Kontrast zu dem weißen Bikini bildete und ihr unbefangenes Lachen perfekte Zähne entblößte, das blonde Haar wie ein Banner flatternd im Wind. So steht sie zusammen »mit Joseph Patrick Kennedy junior, Sohn des US-Botschafters« am Ruder.
Schmeichlerische Klatschkolumnisten erwähnten sie in den papyrusdünnen Zeitungsausschnitten in einem Atemzug mit Ava Gardner, Rita Hayworth und Jane Russell, Fotografen hatten sie auf Hollywood-Partys und Broadway-Premieren abgelichtet. Eine Aufnahme – glitzernd, mit Blitzlicht geschossen, in Schwarzweiß – zeigte, wie sie mit dem frisch verheirateten Paar Arthur Miller und Marilyn Monroe aus einem Restaurant in Bel Air kam. Auf den ersten Blick ließ sich kaum unterscheiden, welche der beiden Frauen die Filmdiva war und welche die unerschrockene Reporterin.
[49] Angeblich hatte die Tait eine Affäre mit Sinatra gehabt – es gab ein Bild von ihnen, anlässlich eines »intimen Dinners für zwei«, das so gestellt und makellos wirkte wie ein Standbild aus einem klassischen Fünfziger-Jahre-Streifen. Sie trug ein Anstecksträußchen aus weißen Blumen, und ihre feuchten Lippen lächelten, während er ihr etwas ins Ohr flüsterte. Mit Liz Taylor war sie befreundet, nachdem sie in dritter Ehe Tad Challis geheiratet hatte, den amerikanischen Regisseur von einst heißgeliebten, heute vergessenen britischen Filmkomödien. Sie war mit Nurejew im Urlaub, hatte mit Picasso gefeiert, war fotografiert worden, wie sie zusammen mit Freunden, darunter Louis Armstrong, in einem Pariser Jazzclub fröhlich eine verdächtig dicke Zigarre rauchte oder sich in einem engen Satinkleid – hoher IQ und tiefer Ausschnitt, hieß es in der Bildunterschrift – auf einer Hollywood-Party an Orson Welles schmiegte.
Was Hollywood anbelangte, kannte Tamara sich bestens aus. Die langen Nächte und Marathonwochenenden, an denen sie sich im Fernsehen alte Schwarzweißfilme angesehen hatte, ihr Wissensschatz und ihr Abschluss in Medienwissenschaften erwiesen sich als unbezahlbar. Selbst bei Psst!, wo sich die Elite der TV-, Pop- und Kino-Kenner versammelte, galt sie als Kapazität. Ihre Diplomarbeit hatte sie über Liebesschnulzen aus Hollywood geschrieben und sich als Quelle obskurer Details aus dem Showbusiness einen Namen gemacht. Bei Psst! überlebte niemand auch nur eine Woche, wenn er in Pop und Prominenz nicht sattelfest war, Tamara aber erwies sich als Großmeisterin. Sie wusste über das Privatleben von Stars besser Bescheid als über die Vergangenheit ihrer eigenen Familie oder Freunde. Sie kannte [50] alle Hintergründe zu den Rivalitäten zwischen den Spice Girls, Madonnas stürmische Beziehung mit Carlos Leon und ihren Wutanfällen am Set von Evita, zu Michael Jacksons Hautkrankheit und seiner kürzlichen Eheschließung mit einer spießigen Krankenschwester.
All diese Informationen saugte sie auf wie ein Schwamm, sie brauchte nur einen Blick auf die fette Schlagzeile einer Film- oder Fernsehzeitschrift am Kiosk zu werfen, und schon hatte sich ihr die ganze Story ins Gedächtnis eingeprägt. Wer hatte eine Affäre mit wem? Wer sollte welche Rolle in welcher Soap, welchem Film bekommen? Wer machte gerade eine Entziehungskur? Wer müsste eine machen? Wer hatte sich einer Schönheitsoperation unterzogen? Wer hätte eine nötig? Wer war insgeheim schwul? Wer heterosexuell? All dies lieferte ihr Gesprächsstoff mit Freunden und Kollegen und machte ihren Job amüsant, aber auch anstrengend. Bei Psst! verbanden sich mehr als bei jedem anderen Job zuvor ihre persönlichen Interessen auf angenehme Weise mit dem Berufsleben.