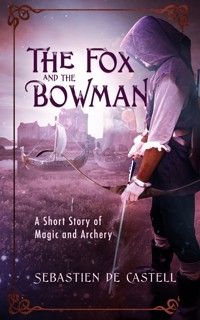8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Falcio ist der Anführer der Greatcoats. In der Kunst des Kampfes ebenso geschult wie im Gesetz des Reiches Tristia, ziehen die Greatcoats als reisende Gesetzeshüter durchs Land, um Gerechtigkeit zu bringen und das Wort des Königs zu verbreiten. Sie sind Helden. Oder vielmehr waren sie es, bis sie tatenlos zusahen, wie die dunklen Herzöge von Tristia das Königreich übernahmen und den Kopf des Königs auf einen Pfahl spießten. Nun bewegt sich Tristia am Rande des Untergangs, und die Barbaren an den Grenzen warten nur darauf, ins Land einzufallen. Die Herzöge reigieren mit Willkür und Chaos, und die Greatcoats sind weit verstreut, gebrandmarkt als Verräter, Diebe und Mörder. Ihren legendären Uniformen sind nur noch Fetzen, die an eine ruhmreiche Vergangenheit erinnern. Alles, was ihnen geblieben ist, ist ein letztes Versprechen, dass sie ihrem getöteten König gaben. Das Versprechen, eine letzte Mission zu erfüllen. Doch wenn sie damit Erfolg haben wollen, müssen sie sich wieder vereinen – oder miterleben, wie die Welt um sie herum in Feuer untergeht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Andreas Decker
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96481-4
© 2014 Sebastien de Castell
Die kanadische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Traitor’s Blade« bei Penguin, Kanada.
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Covergestaltung: www.buerosued.de
Datenkonvertierung: Tobias Wantzen, Bremen
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Für meine Mutter MJ, die mich als kleiner Junge einmal zur Seite nahm und sagte:
»Hör zu, wir müssen Geld verdienen, und das geht am einfachsten, wenn man ein Buch schreibt.«
Allerdings erwähnte sie nicht, dass sie noch nie ein Buch verkauft hatte.
1
LORD TREMONDI
Man stelle sich einen Augenblick lang vor, man hätte sich seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt. Nicht die einfachen, plausiblen Dinge, von denen man seinen Freunden erzählt, sondern den Traum, den man tief im Herzen bewahrt, den man selbst als Kind niemals laut in Worte fassen würde. Man stelle sich beispielsweise vor, man hätte sich danach verzehrt, ein Greatcoat zu sein, einer jener legendären Magister und Fechter, die das Land vom kleinsten Dorf bis zur prächtigsten Stadt bereisen und dafür sorgen, dass jeder Mann und jede Frau, egal ob von hoher oder niederer Geburt, das Gesetz des Königs für sich in Anspruch nehmen kann. Für viele ein Beschützer – für manche sogar ein Held. Man fühlt also den Greatcoat, den schweren Ledermantel, das Symbol des Amtes, auf den Schultern, das täuschend geringe Gewicht der eingenähten Knochenplatten, die einen wie eine Rüstung schützen, und die Dutzenden verborgenen Taschen, die mit den nötigen Werkzeugen und Schlichen, esoterischen Tränken und Pillen gefüllt sind. Man greift nach dem Schwert an der Seite, von dem Wissen beflügelt, dass einem als Greatcoat beigebracht wurde, falls nötig, zu kämpfen. Schließlich verfügt man über die entsprechende Ausbildung, jeden anderen Mann im Duell zu bezwingen.
Und jetzt stelle man sich vor, diesen Traum in die Tat umgesetzt zu haben – sämtlichen Hindernissen zum Trotz, die Götter und Heilige in die Welt setzen. Man ist also ein Greatcoat geworden. Aber halt, tatsächlich sollte der Traum noch ehrgeiziger sein: Man stelle sich vor, zum Ersten Kantor der Greatcoats erhoben worden zu sein, und seine beiden besten Freunde stehen einem zur Seite. Nun versuche man sich vorzustellen, wo man ist, was man sieht, was man hört, welches Unrecht man bekämpfen will …
»Sie ficken schon wieder«, sagte Brasti.
Ich zwang meine Augen auf und erhielt zur Belohnung den verschwommenen Blick auf den Korridor des Gasthauses, einen pompös dekorierten, aber schmutzigen Gang, der einen daran erinnerte, dass die Welt einst wohl ein hübscher Ort gewesen war, nun aber langsam verrottete. Kest, Brasti und ich bewachten den Korridor von dem Komfort heruntergekommener Stühle aus, die aus dem Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss stammten. Uns gegenüber befand sich eine große Eichentür, die zu Lord Tremondis gemietetem Zimmer führte.
»Lass es sein, Brasti«, sagte ich.
Er schenkte mir einen bewusst vernichtenden Blick, der allerdings nicht besonders effektiv war; Brasti ist etwas zu hübsch, als ihm oder sonst jemandem guttut. Starke Wangenknochen und ein breiter, von einem kurzen rotblonden Bart eingerahmter Mund machen ein Lächeln noch strahlender, das ihn meistens vor den Kämpfen bewahrt, die er mit seinen Worten anzettelt. Sein meisterliches Bogenschießen erledigt den Rest. Aber wenn er versucht, einen niederzustarren, sieht er einfach nur aus, als würde er schmollen.
»Was soll ich denn bitte schön sein lassen?«, fragte er. »Soll ich nicht mehr davon sprechen, dass du mir ein Heldenleben versprachst? Damals, als ich mich bei den Greatcoats verdungen habe, weil du mich dazu überredet hast? Stattdessen nenne ich keine Münze mein Eigen und werde verachtet und verdinge mich notgedrungen als niederer Leibwächter für reisende Händler. Oder die Tatsache, dass wir hier sitzen und unserem großzügigen Gönner – was übrigens eine höfliche Bezeichnung ist, da er uns bis jetzt noch keine lausige schwarze Kupfermünze gezahlt hat – dabei zuhören müssen, wie er eine Frau vögelt? Zum übrigens wievielten Mal seit dem Abendessen? Dem fünften? Wie schafft der fette Sack das überhaupt? Ich meine …«
»Könnten Kräuter sein«, unterbrach Kest ihn und streckte sich mit der natürlichen Anmut eines Tänzers.
»Kräuter?«
Kest nickte.
»Und was versteht der sogenannte ›größte Fechter der Welt‹ von Kräutern?«, wollte Brasti wissen.
»Vor ein paar Jahren verkaufte mir ein Apotheker ein Gebräu, das den Schwertarm angeblich auch dann noch stark hält, wenn man halb tot ist. Ich habe es benutzt, als ich ein halbes Dutzend Meuchelmörder abwehren musste, die einen Zeugen umbringen wollten.«
»Und, hat es funktioniert?«, fragte ich.
Kest zuckte mit den Schultern. »Kann ich wirklich nicht sagen. Sie waren bloß zu sechst, also war es keine richtige Prüfung. Aber ich hatte die ganze Zeit über einen ordentlichen Ständer.«
Hinter der Tür ertönte ein schweres Grunzen, dem ein Stöhnen folgte.
»Bei allen Heiligen! Können die nicht einfach aufhören und schlafen?«
Wie zur Erwiderung wurde das Stöhnen lauter.
»Wisst ihr, was ich merkwürdig finde?«, fuhr Brasti fort.
»Hältst du in absehbarer Zeit die Klappe?«, fragte ich.
Brasti ignorierte mich. »Ich finde es merkwürdig, dass sich ein vögelnder Adliger fast so anhört wie einer, der gefoltert wird.«
»Du hast also schon viele Adlige gefoltert?«
»Du weißt schon, was ich meine. Hier hört man nur Stöhnen und Grunzen und kleine spitze Schreie, nicht wahr? Irgendetwas läuft da verkehrt.«
Kest hob eine Braue. »Und wie klingt richtiges Vögeln?«
Brasti schaute sehnsuchtsvoll zur Decke. »Die Frau muss viel öfter begeistert jauchzen, so viel steht fest. Und es muss mehr süße Worte geben. So wie: ›O Brasti, ja so, genau da an der Stelle! Du legst dich mit Herz und Seele ins Zeug!‹«
»›Du legst dich mit Herz und Seele ins Zeug‹? Sagen Frauen im Bett wirklich so was?«, wollte Kest wissen.
»Hör auf, den lieben langen Tag nur mit dem Schwert zu üben, geh mit einer Frau ins Bett, und du wirst es herausfinden. Komm schon, Falcio, hilf mir hier.«
»Ist schon möglich, aber es ist so verdammt lange her, ich erinnere mich nicht mehr.«
»Ja, natürlich, der heilige Falcio. Aber du hast doch sicherlich mit deiner Frau …«
»Lass es«, sagte ich.
»Ich wollte nicht … ich meine …«
»Bring mich nicht dazu, dir eine reinzuhauen, Brasti«, sagte Kest leise.
Schweigend saßen wir ein paar Minuten da, während Kest Brasti meinetwegen finster anstarrte und der Lärm aus dem Schlafzimmer ununterbrochen weiterging.
»Ich kann noch immer nicht begreifen, wie er das schafft«, fing Brasti schließlich wieder von vorn an. »Ich frage dich noch einmal, Falcio, was machen wir hier eigentlich? Tremondi hat uns noch nicht einmal bezahlt.«
Ich hob die Hand und bewegte die Finger. »Hast du seine Ringe gesehen?«
»Klar«, sagte Brasti, »groß und protzig. Oben mit einem wie ein Rad geformten Edelstein.«
»Das ist der Ring eines Karawanenlords – was du wissen würdest, hättest du der Welt vor deinen Augen einmal Beachtung geschenkt. Damit versiegeln sie bei ihrer jährlichen Zusammenkunft ihre abgegebene Stimme – ein Ring, eine Stimme. Nicht jeder Karawanenlord schafft es jedes Jahr zur Zusammenkunft, also haben sie die Möglichkeit, ihren Ring an jemanden zu verleihen, der dann bei allen wichtigen Abstimmungen für sie stimmt. Und wie viele Karawanenlords gibt es noch einmal?«
»Das weiß doch keiner genau, es ist …«
»Zwölf«, sagte Kest.
»Und an wie vielen seiner Finger steckten diese protzigen Ringe?«
Brasti starrte zu Boden. »Ich weiß es nicht … vier oder fünf?«
»Sieben«, sagte Kest.
»Sieben«, wiederholte ich.
»Das bedeutet also, er könnte … Also gut, Falcio, worum geht es dieses Jahr bei der Abstimmung der Lords?«
»Alles Mögliche«, sagte ich nüchtern. »Wechselkurse, Abgaben, Handelsbestimmungen. Ach ja, und die Sicherheit.«
»Die Sicherheit?«
»Seit die Herzöge den König umgebracht haben, verfallen die Straßen. Die Herzöge geben weder Geld noch Männer, nicht einmal, um die Handelswege zu verteidigen, und die Karawanenlords müssen für jede Reise ein Vermögen für Wächter aufbringen.«
»Na und?«
Ich lächelte. »Tremondi will vorschlagen, dass die Greatcoats die Straßenhüter werden sollen, was Autorität, Respekt und ein anständiges Leben bringt. Wir sorgen dafür, dass ihre kostbare Fracht nicht in die Hände von Banditen fällt.«
Brasti sah wenig überzeugt aus. »Sie würden zulassen, dass wir die Greatcoats wieder zusammenrufen? Also statt mein Leben damit zu verbringen, als Verräter aus jeder überfüllten Stadt und jedem von den Göttern verlassenen Dorf verjagt und von einem Ende des Landes zum anderen gehetzt zu werden, würde ich auf den Handelswegen reisen und Banditen verprügeln? Und dafür sogar bezahlt werden?«
Ich grinste. »Und so hätten wir eine viel bessere Gelegenheit, des Königs …«
Brasti winkte ab. »Bitte, Falcio. Er ist seit fünf Jahren tot. Wenn du die verfluchten Charoite des Königs bis jetzt noch nicht gefunden hast … und übrigens weiß noch immer keiner, was man damit eigentlich anstellen …«
»Ein Charoit ist ein Edelstein«, sagte Kest ruhig.
»Was auch immer. Ich will auf Folgendes hinaus: Diese Edelsteine ohne jeden Hinweis auf ihren möglichen Aufenthaltsort zu finden ist ungefähr so wahrscheinlich, als würde Kest den Heiligen der Schwerter töten.«
»Aber ich werde den Heiligen der Schwerter töten, Brasti«, sagte Kest.
Brasti seufzte. »Ihr seid hoffnungslos, damit meine ich euch beide. Und selbst wenn wir die Steine finden, was hätten wir davon?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich. »Aber die Alternative besteht darin, dass die Herzöge die Greatcoats jagen, bis wir alle tot sind. Also finde ich Tremondis Angebot gut.«
»Nun dann«, sagte Brasti und hob ein imaginäres Glas, »schön für Euch, Lord Tremondi. Macht nur weiter, was auch immer Ihr darin so großartig treibt.«
Wie als Erwiderung auf seinen Trinkspruch ertönte hinter der Tür neues Stöhnen.
»Wisst ihr, ich glaube, Brasti könnte recht haben«, sagte Kest, stand auf und griff nach einem der Schwerter an seinem Gürtel.
»Wovon sprichst du?«, fragte ich.
»Zuerst klang das wie ein Liebesspiel, aber langsam glaube ich, dass ich wirklich keinen Unterschied mehr zwischen diesen Lauten und denen eines Folteropfers feststellen kann.«
Ich erhob mich vorsichtig, aber der alte Stuhl quietschte laut, als ich mich zur Tür vorbeugte und zu lauschen versuchte. »Anscheinend haben sie aufgehört«, murmelte ich.
Kests Schwert verursachte kaum ein Flüstern, als er es aus der Scheide zog.
Brasti legte das Ohr an die Tür und schüttelte dann den Kopf. »Nein, er hat aufgehört, aber sie ist noch immer dabei. Er muss schlafen. Aber warum sollte sie weitermachen, wenn er …«
»Brasti, weg von der Tür.« Ich warf mich mit der Schulter dagegen. Der erste Versuch scheiterte, aber beim zweiten zersplitterte der Riegel. Auf den ersten Blick schien alles in dem grell ausgestatteten Raum in Ordnung zu sein. Der Wirt hatte ihn so dekoriert, wie er sich in seinen Träumen das Schlafzimmer eines Herzogs vorstellte. Kleidung und Bücher lagen auf einem einstmals kostbaren Teppich, der nun mottenzerfressen und vermutlich eine Heimstatt für Ungeziefer war. Das Bett wies staubige Samtvorhänge auf, die von einem Eichenrahmen hingen.
Vorsichtig hatte ich den ersten Schritt in den Raum getan, als eine Frau hinter diesen Vorhängen hervortrat. Ihre nackte Haut war mit Blut beschmiert, und auch wenn die hauchzarte schwarze Maske vor ihrem Gesicht ihre Züge verhüllte, war mir klar, dass sie lächelte. In der rechten Hand hielt sie eine große Schere – eine Schere von der Art, wie sie Metzger benutzen, um Fleisch zu schneiden. Sie streckte die linke Hand in meine Richtung, die Faust geschlossen, die Handfläche in Richtung Decke gehalten. Dann hob sie sie an den Mund, und es sah so aus, als wollte sie uns eine Kusshand geben. Stattdessen stieß sie die angehaltene Luft aus. Blaues Pulver wogte durch die Luft.
»Nicht einatmen!«, rief ich Kest und Brasti zu, aber es war zu spät. Welche Magie auch immer in diesem Pulver lag, man brauchte es nicht einzuatmen, damit sie funktionierte. Plötzlich schien die Welt stehen zu bleiben; mir war, als wäre ich zwischen den bebenden Zeigern einer alten Uhr gefangen. Ich wusste, dass sich Brasti direkt hinter mir befand, aber ich konnte nicht den Kopf wenden, um ihn zu sehen. Kest sah ich aus dem rechten Augenwinkel, aber ich konnte ihn kaum ausmachen, während er wie ein Dämon darum kämpfte freizukommen.
Die Frau neigte den Kopf zur Seite und sah mich einen Augenblick lang an. »Großartig«, sagte sie leise und kam völlig unbefangen, fast schon schlendernd auf uns zu, und die Schere gab einen rhythmischen zuschnappenden Laut von sich. Ich spürte ihre Hand auf meiner Wange, dann strich sie mit den Fingern über meinen Mantel und schob das Leder zur Seite, bis sie die Hand darunterschieben konnte. Einen Augenblick lang legte sie die Handfläche auf meine Brust und liebkoste sie sanft, bevor sie sie nach unten führte und dann weiter an meinem Gürtel vorbei.
Schnipp-schnapp.
Sie stellte sich auf die Zehen und brachte das maskierte Gesicht an mein Ohr, während sich ihr nackter Körper an mich presste, als wollten wir uns umarmen. Schnipp-schnapp machte die Schere. »Man nennt den Staub ›Aeltheca‹«, flüsterte sie. »Er ist wirklich ausgesprochen teuer. Für den Karawanenlord brauchte ich nur eine Prise, aber wegen euch musste ich jetzt meinen ganzen Vorrat benutzen.« Ihre Stimme klang weder ärgerlich noch bedauernd, als würde sie bloß eine Feststellung treffen.
Schnipp-schnapp.
»Ich würde euch Lumpenmänteln ja die Kehle durchschneiden, aber ich habe jetzt eine bestimmte Verwendung für euch, und das Aeltheca wird verhindern, dass ihr euch an mich erinnert.« Sie trat zurück und machte eine theatralische Pirouette. »Sicher, ihr werdet euch an eine nackte Frau mit einer Maske erinnern – aber meine Größe, meine Stimme, die Rundungen meines Körpers, das werdet ihr alles vergessen.«
Sie beugte sich vor, drückte mir die Schere in die linke Hand und schloss die Finger darum. Ich wollte sie loslassen, aber meine Glieder gehorchten mir nicht. Mit aller Kraft versuchte ich mir ihren Körper einzuprägen, ihre Größe, die Gesichtszüge hinter der Maske, was auch immer mir dabei helfen konnte, sie wiederzuerkennen, sollte ich ihr noch einmal begegnen, aber das Bild verschwamm bereits während meiner Bemühungen. Ich versuchte, die für die Beschreibung nötigen Worte in Verse zu kleiden, damit ich mich daran erinnern konnte, aber auch sie verblassten sofort. Ich konnte sie anstarren, aber nach jedem Blinzeln war die Erinnerung verschwunden. Das Aeltheca war sehr wirkungsvoll.
Ich hasse Magie.
Die Frau begab sich kurz zu dem mit Vorhängen verhüllten Bett und kehrte mit einer kleinen Blutlache auf der Handfläche zurück. Sie ging zur gegenüberliegenden Wand, tauchte den Finger in das Blut und schrieb ein einziges Wort. Das tropfende Wort lautete Greatcoats.
Dann kam sie noch einmal zu mir zurück, und ich spürte einen Kuss durch den feinen Stoff der Maske.
»Es hat fast schon etwas Trauriges, die Greatcoats des Königs, seine legendären umherreisenden Magistrate, so gedemütigt zu sehen«, sagte sie leichthin. »Zusehen zu müssen, wie ihr euch einem fetten Karawanenlord anbiedert, den nur ein kleiner Schritt von einem gewöhnlichen Straßenhändler unterscheidet … Verrate mir doch, Lumpenmantel, wenn du schläfst, träumst du dann davon, wie du noch immer durch das Land reitest, das Schwert in der Hand und ein Lied auf den Lippen, während du den armen, erbarmungswürdigen, vom Joch eines launischen Herzogs unterdrückten Menschen Gerechtigkeit bringst?«
Ich wollte etwas erwidern, schaffte es aber trotz meiner Anstrengungen kaum, auch nur die Unterlippe beben zu lassen.
Die Frau hob den Finger und schmierte Blut auf die Wange, die sie eben noch geküsst hatte. »Leb wohl, mein hübscher Lumpenmantel. In wenigen Minuten bin ich nur noch eine verschwommene Erinnerung. Aber keine Sorge, ich erinnere mich an dich.«
Sie wandte sich ab, ging in aller Ruhe zur Kommode und nahm ihre Kleidung. Dann öffnete sie das Fenster und schlüpfte hinaus in die frühe Morgenluft, ohne sich vorher anzukleiden.
Wir standen noch vielleicht für eine Minute oder so wie Baumstümpfe da, bevor Brasti, der sich am weitesten von dem Pulver entfernt befunden hatte, die Lippen lange genug bewegen konnte, um »Scheiße!« sagen zu können.
Kest konnte sich als Nächster bewegen, dann war auch ich so weit. Ich rannte sofort zum Fenster, aber natürlich war die Frau schon lange verschwunden.
Ich ging zum Bett, um nach dem blutüberströmten Lord Tremondi zu sehen. Sie hatte ihn wie ein Chirurg behandelt und irgendwie lange am Leben gehalten – vielleicht eine weitere Wirkung des Aeltheca. Ihre Schere hatte für alle Ewigkeit einen Pfad der Verwüstung in seinen Körper geschnitten.
Das war nicht nur ein Mord. Das war eine Botschaft.
»Falcio, sieh doch«, sagte Kest und zeigte auf Tremondis Hände. An der rechten Hand waren noch drei Finger verblieben; alle anderen waren blutige Stümpfe. Die Karawanenlordringe waren verschwunden und mit ihnen unsere Hoffnung auf eine Zukunft.
Schritte dröhnten die Stufen hinauf, der gleichmäßige Rhythmus identifizierte sie als Stadtwächter.
»Brasti, versperr die Tür.«
»Die wird nicht lange halten, Falcio. Du hast sie irgendwie aufgebrochen, als wir reinkamen.«
»Mach es einfach.«
Brasti stieß die Tür zu, und Kest half ihm, die Kommode davorzuwuchten, bevor sie mir dabei halfen, nach einem Hinweis auf die Frau zu suchen, die Tremondi ermordet hatte.
»Glaubst du, wir finden sie?«, fragte Kest, während wir Tremondis geschlachtete Überreste betrachteten.
»Keine Chance«, erwiderte ich.
Kest legte die Hand auf meine Schulter. »Durch das Fenster?«
Ich seufzte. »Das Fenster.«
Fäuste hämmerten gegen die Tür. »Gute Nacht, Lord Tremondi«, sagte ich. »Ihr wart kein besonders guter Arbeitgeber. Ihr habt viel gelogen und uns nie den versprochenen Lohn gezahlt. Aber das geht wohl in Ordnung, denn am Ende waren wir ziemlich nutzlose Leibwächter.«
Kest kletterte bereits nach draußen, als die Konstabler anfingen, die Tür aufzubrechen.
»Warte mal«, sagte Brasti. »Sollten wir nicht … du weißt schon …«
»Was?«
»Du weißt schon, sein Geld nehmen?«
Das ließ sogar Kest noch einmal den Kopf wenden.
»Nein, wir nehmen sein Geld nicht«, erwiderte ich.
»Warum nicht? Schließlich braucht er es nicht mehr.«
Erneut seufzte ich. »Weil wir keine Diebe sind, Brasti, wir sind Greatcoats. Und das muss etwas bedeuten.«
Er schob ein Bein aus dem Fenster. »Ja, das bedeutet in der Tat etwas. Es bedeutet, dass uns die Menschen hassen. Es bedeutet, dass sie uns für Tremondis Tod verantwortlich machen werden. Es bedeutet, dass wir von einem Strick baumeln, während der Mob unsere Leichen mit faulem Obst bewerfen und ›Lumpenmantel, Lumpenmantel!‹ singen wird. Und – ach ja, und es bedeutet, dass wir kein Geld haben. Aber zumindest haben wir ja noch unsere Mäntel.«
Er verschwand aus dem Fenster, und ich stieg hinter ihm her. Die Konstabler hatten gerade die Tür aufgebrochen, und als mich ihr Hauptmann dort sah, wie der Holzrahmen noch immer in meine Brust drückte, lag der Hauch eines Lächelns auf seinem Gesicht. Ich wusste genau, was dieses Lächeln zu bedeuten hatte: Er hatte Männer abkommandiert, die unten auf der Straße auf uns warteten, und jetzt konnte er uns mit Pfeilen beschießen, während sie uns mit Piken in Schach hielten.
Mein Name ist Falcio val Mond, Erster Kantor der Greatcoats, und das war der erste von vielen schlimmen Tagen, die noch folgen sollten.
2
KINDHEITSERINNERUNGEN
Geboren wurde ich in dem Herzogtum namens Pertine. Das ist ein kleiner und schlichter Ort, der vom restlichen Tristia größtenteils ignoriert wird. Das Wort Pertine hat verschiedene Bedeutungen, aber sie alle entstammen der Blume, die auf den windabgewandten Hängen der die Region umgebenden Bergketten wächst. Ihr Blau ist seltsam; man würde es auf den ersten Blick als hell beschreiben, betrachtet man es aber länger, fügt man seiner Beschreibung unwillkürlich Worte wie »schmierig«, »wässrig« und schließlich »irgendwie verstörend« hinzu. Die Pertine hat keine bekannten medizinischen Wirkstoffe, isst man sie, verdirbt man sich den Magen. Und sie stinkt schrecklich, wenn man sie pflückt. Unnötig zu sagen, dass jemand schon ziemlich dumm sein muss, um sie zu dem einzigen Ding zu machen, an das andere Menschen denken, wenn es um seine Heimat geht. Aber irgendwann in ferner Vergangenheit pflückte irgendein Kriegsherr eine dieser Blumen, steckte sie sich an den Umhang und gab dem Land meiner Geburt den Namen Pertine. Ich nehme an, er wurde ohne Geruchssinn geboren.
Aber der Unsinn geht noch weiter. Die Wächter, die in der Stadt für Ordnung sorgen und in Kriegszeiten unsere Truppen stellen, tragen Wappenröcke von derselben Farbe wie die Blumen, die unsere Heimat schmücken, was unweigerlich dazu führt, dass man sie als die »Pertinen« bezeichnet – denn schließlich sind sie blau und schmierig, sehen wässrig aus und stinken letztlich.
In dieses noble Erbe wurde ich hineingeboren, da mein Vater nicht nur in Pertine lebte, sondern auch in der Garde von Pertine diente. Er war mir weder ein guter Vater noch meiner Mutter ein guter Ehemann, und ich glaube, das wurde ihm irgendwann klar, denn er entließ sich selbst, als ich sieben war. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er sich woanders eine neue Stellung als Ehemann und Vater gesucht hat, aber ich machte mir nie die Mühe, es herauszufinden.
Ich bezahlte dem Schicksalsschreiber im Kloster des heiligen Anlas, der sich an die Welt erinnert, eine stattliche Summe, um das hier aufzuschreiben, auch wenn ich es selbst niemals zu Gesicht bekommen werde. Ich habe keine Ahnung, wie sie die Geschehnisse im Leben eines Mannes aus der Ferne zu Papier bringen können. Es heißt, sie lesen die Schicksalsfäden oder verbinden sich mit dem Verstand eines Mannes und fangen seine Gedanken, um sie dann aufzuschreiben. Andere behaupten hingegen, sie würden alles nur erfinden, denn wenn man die Niederschrift endlich lesen kann, befindet sich die Person, um die es geht, so gut wie sicher nicht mehr unter den Lebenden. Was nun auch immer zutrifft, ich hoffe, dass sie zumindest das nun Folgende richtig hinbekommen, denn es handelt sich um zwei Geschichten, zwischen denen fünfundzwanzig Jahre liegen, und ich halte beide für wichtig, also aufgepasst, werter Leser.
Die erste spielte sich wie folgt ab. Ich war acht Jahre alt und lebte mit meiner Mutter am Außenrand eines Dorfes, der an den Außenrand des Nachbardorfes grenzte. Meine Mutter trug mir oft Botengänge auf, die im Nachhinein etwas verdächtig erscheinen. »Falcio, lauf in die Stadt und hole mir eine Möhre. Aber sieh zu, dass es eine gute Möhre ist.« Oder: »Falcio, lauf in die Stadt und bitte den Boten, er soll dir bestätigen, wie viel es uns kosten wird, einen Brief an deinen Großvater in Fraletta zu schicken.«
Nun weiß ich natürlich nicht, wie sich das in Deiner Heimat verhält, werter Leser, aber der Preis für einen auf den Hauptstraßen beförderten Brief hat sich in Pertine seit fünfzig Jahren nicht verändert, und ich bin mir noch immer nicht sicher, was man mit einer einzelnen Möhre anstellen soll. Aber es erfreute meine Mutter, wenn ich nicht da war, und so hatte ich Zeit, in die Schenke zu gehen und Bal Armidor zuzuhören. Bal war ein junger fahrender Geschichtenerzähler, der viel Zeit in unserer Stadt verbrachte. Er versorgte Männer mittleren Alters mit gutem Einkommen mit Neuigkeiten über die Dinge, die sich außerhalb von Pertine zutrugen, und unterhielt alte Männer mit gekrümmten Rücken mit rechtschaffenen Geschichten über die Heiligen. Jungen Mädchen sang er romantische Lieder vor, die sie erröten ließen und ihre Verehrer in Wallung brachten. Und mir erzählte er Geschichten über die Greatcoats.
»Ich verrate dir ein Geheimnis, Falcio«, sagte er eines Nachmittags zu mir. Die Schenke war so gut wie leer, und er stimmte seine Gitarre und bereitete sich auf die Abendunterhaltung vor. Der Wirt, der die Becher vom vergangenen Abend spülte, verdrehte bloß die Augen.
»Ich verspreche dir, es niemandem zu verraten, Bal, niemals«, sagte ich, als würde ich einen heiligen Eid leisten. Meine Stimme brach dabei irgendwie, und so hörte es sich in meinen Ohren gar nicht wie ein Eid an.
Bal kicherte. »Dazu besteht keine Notwendigkeit, mein vertrauenswürdiger Freund.«
Das war vermutlich auch besser so, da ich diesen Eid nun breche.
»Was ist das für ein Geheimnis, Bal?«
Er blickte von seiner Gitarre auf und sah sich im Raum um, bevor er mir bedeutete, näher heranzukommen. Dann sprach er mit diesem ganz besonderen Flüstern, das immer so klang, als könnte es auf dem Wind reisen und einen noch aus einer Entfernung von hundert Meilen erreichen.
»Du weißt doch noch, was ich dir von König Ugrid erzählte?«
»Der böse König, der die Greatcoats auflöste und schwor, sie würden den Menschen dieses Landes nie wieder mit Mantel und Schwert helfen?«
»Jetzt denke daran, Falcio«, fuhr Bal fort, »dass die Greatcoats nicht bloß ein Haufen Schwertkämpfer waren, die herumliefen und gegen Ungeheuer und Bösewichte kämpften. Sie waren die Reisenden Magister. Sie hörten sich die Klagen der Menschen an, die außerhalb der Reichweite der königlichen Konstabler lebten, und sie sorgten in seinem Namen für Gerechtigkeit.«
»Aber Ugrid hasste sie«, sagte ich und hasste das peinliche Winseln in meiner Stimme.
»König Ugrid stand den Herzögen sehr nahe«, sagte Bal nüchtern, »und sie waren der Ansicht, es sei ihr Recht, auf ihrem eigenen Land die Gesetze zu machen und zu vollstrecken. Nicht alle Könige waren mit dieser Idee einverstanden, aber Ugrid vertrat die Meinung, dass, solange die Herzöge ihre Steuern und Abgaben zahlten, es ihre Sache war, was sie auf ihren Besitztümern machten.«
»Aber es weiß doch jeder, dass Herzöge Tyrannen sind«, sagte ich.
Bals Hand kam aus dem Nichts geschossen und versetzte mir eine harte Ohrfeige, und als er sprach, klang seine Stimme eiskalt und todernst. »Sage so etwas nie wieder, Falcio. Hast du mich verstanden?«
Ich wollte etwas erwidern, aber ich konnte es nicht. Noch nie zuvor hatte Bal gegen mich die Hand erhoben, und das Entsetzen über seinen Verrat lähmte meine Zunge. Nach einem Augenblick stellte er seine Gitarre ab und legte mir die Hände auf die Schultern. Ich zuckte zusammen.
»Falcio«, seufzte er. »Hast du eine Vorstellung, was mit dir geschähe, würde dich einer der Männer des Herzogs dabei erwischen, wie du das Wort Tyrann in Zusammenhang mit seinem Herrn benutzt? Hast du eine Vorstellung, was mit mir geschähe? Es gibt zwei Wörter, bei denen du sehr vorsichtig sein musst, wenn du sie laut aussprichst: Tyrann und Verräter – denn sie werden oft in einem Atemzug genannt und für gewöhnlich mit schrecklichem Ergebnis.«
Ich versuchte ihn zu ignorieren, aber als er die Hände wegnahm, konnte ich mich nicht beherrschen. »Also was ist es nun?«
»Was ist was?«
»Das Geheimnis. Du hast mir versprochen, ein Geheimnis zu verraten, aber stattdessen hast du mich geschlagen.«
Bal ignorierte die Bemerkung. Er setzte wieder zu seiner verschwörerischen Art an und beugte sich nahe an mich heran, als wäre nichts geschehen. »Nun, als König Ugrid entschied, dass die Greatcoats nie wieder reiten würden, da sagte er, dies würde für alle Zeiten gelten, richtig?«
Ich nickte.
»Ugrid hatte einen Berater namens Caeolo. Man nannte ihn auch Caeolo das Geheimnis. So mancher hielt ihn für einen Zauberer von großem Können und großer Weisheit.«
»Ich habe noch nie von Caeolo gehört.« Aufregung siegte über die brennende Wange und den verletzten Stolz.
»Das haben auch nur wenige«, sagte Bal. »Caeolo verschwand auf mysteriöse Weise, bevor Ugrid starb, und er tauchte nie wieder auf.«
»Vielleicht hat er ja Ugrid getötet … Vielleicht hat er …«
Bal unterbrach mich. »Nun steigere dich da bloß nicht rein, Falcio. Sobald dein Verstand einmal damit anfängt, hört er nicht auf, bevor du vor Erschöpfung ohnmächtig wirst.« Der Geschichtenerzähler blickte sich wieder im Raum um, obwohl abgesehen vom Wirt, der am anderen Ende seine Becher spülte, niemand da war. Ich weiß nicht, ob er uns hören konnte, aber er hatte gute Ohren.
»Nun, man erzählt sich, dass Caeolo seinen König zur Seite nahm, nachdem man das Dekret vor Gericht verlesen hatte. ›Mein König‹, sagte er, ›auch wenn Ihr der Herr aller Dinge seid und ich bloß Euer demütiger Berater, solltet Ihr doch wissen, dass die Worte eines Königs ihn niemals länger als hundert Jahre überleben, ganz egal, wie mächtig er auch ist.‹ Ugrid sah ihn an, entsetzt über diese Impertinenz, und rief: ›Wisst Ihr überhaupt, was Ihr da redet, Caeolo?‹ Caeolo antwortete ungerührt. ›Ich weiß nur, dass die Greatcoats in hundert Jahren wieder reiten, mein König, und dass Eure mächtigen Worte aus der Erinnerung verblassen werden.‹«
Bal sah auf mich herab. Damals glaubte ich ein Funkeln in seinen Augen zu sehen, obwohl ich jetzt mit genügend Abstand eher glaube, dass es möglicherweise eine Träne war.
»Und weißt du, wie lange es her ist, dass König Ugrid starb?« Als ich den Kopf schüttelte, beugte sich Bal nahe an mich heran und flüsterte mir ins Ohr. »Beinahe hundert Jahre.«
Mein Herz tat einen Satz. Es war, als wäre mein Blut durch Blitze ersetzt worden. Ich könnte …
»Verdammt, Bal«, brüllte der Wirt quer durch den Raum. »Setz dem Jungen doch nicht solche Flausen in den Kopf!«
»Was meinst du?«, fragte ich. Einen Augenblick lang kam mir meine Stimme fremd vor.
Der Wirt trat hinter der Theke hervor. »Diese verdammten Greatcoats hat es nie gegeben. Das ist bloß eine Geschichte, mit der die Leute anfangen, wenn ihnen nicht gefällt, wie die Dinge laufen. Umherreisende Magister, die mit Ledermänteln gepanzert sind und mit Schwertern kämpfen und sich die Klagen von verfluchten Bauern und Dienern anhören? Das ist ein beschissenes Märchen, Junge. Das hat es nie gegeben.«
Etwas an der Weise, wie er die Greatcoats so mühelos und unwiderruflich abtat, gab mir das Gefühl, die Welt sei ein kleiner und leerer Ort. So klein und leer wie ein Haus, in dem es nur die müßigen Phantasien eines kleinen Jungen und die traurigen Sehnsüchte einer einsamen Frau gab, die an kalten Winterabenden noch immer aus dem Fenster schaute und darauf wartete, dass ihr seit Langem verschollener Ehemann zurückkehrte.
Bal wollte protestieren, aber ich unterbrach ihn. »Du irrst dich – du irrst dich! Es gab die Greatcoats, und sie haben alle diese Dinge vollbracht. Der dumme, vermoderte König Ugrid hat sie verbannt, aber Caeolo wusste Bescheid! Er hat gesagt, dass sie eines Tages zurückkehren, und sie kehren auch zurück!«
Ich lief zur Tür, bevor mich noch jemand schlagen konnte – aber dann blieb ich kurz stehen und drehte mich um. Ich legte die Faust ans Herz. »Und ich werde einer von ihnen sein!«, schwor ich. Und dieses Mal klang es wie ein richtiger Schwur.
Die zweite Geschichte, die ich erzählen muss, trug sich vor zwei Jahren zu, in Cheveran, einer der größeren Handelsstädte im Süden von Tristia, und sie begann mit dem Schrei einer Frau.
»Ungeheuer! Gib mir meine Tochter zurück!« Die Frau war ungefähr so alt wie ich, vielleicht so um die dreißig, und hatte schwarze Haare und blaue Augen wie das kleine Mädchen, das ich auf dem Arm trug. Vermutlich war sie ganz hübsch, wenn sie nicht gerade ein Messer hielt und herumbrüllte.
»Mami, was ist denn?«, fragte das Mädchen.
Ich hatte beobachtet, wie das Kind stürzte, als es über das Tischbein des Obstverkäufers stolperte, der seinen Stand am Rand der Gasse aufgebaut hatte, die anscheinend sein Ziel gewesen war. In seinen Augen hatte die Angst gefunkelt, als es mir erzählte, von einem Mann in einer Ritterrüstung verfolgt zu werden, aber als ich mich nach ihm umschaute, war er verschwunden. Ich hatte das Mädchen den ganzen Weg nach Hause getragen, was nicht sehr weit gewesen wäre, hätte es den richtigen Heimweg nicht durcheinandergebracht.
»Sie hat sich den Knöchel verstaucht«, sagte ich und versuchte das Wasser aus meinem Haar zu schütteln, damit es mir nicht in die Augen tropfte. In Cheveran regnete es immer.
Die Frau rannte zurück ins Haus – ich nahm an, sie wollte Handtücher holen, aber als sie zurückkehrte, fuchtelte sie mit einem langen Küchenmesser herum. »Gib mir meine Tochter, Trattari«, brüllte sie.
»Mami!«, schrie mir das Mädchen ins Ohr.
In dieser Geschichte wird viel geschrien. Gewöhn Dich besser dran.
»Ich sagte dir doch, ihr Knöchel ist verstaucht«, sagte ich. »Und jetzt lass mich freundlicherweise eintreten, damit ich sie absetzen kann. Du kannst danach auf mich einstechen.«
Falls die Frau mich für im Mindesten wortgewandt hielt, überspielte sie es gut, indem sie um Hilfe brüllte. »Trattari! So helft mir doch! Ein Lumpenmantel hat meine Tochter!«
»Beim heiligen Zaghev, der für Tränen singt, lass mich doch einfach das Mädchen absetzen!«
Da anscheinend keine Hilfe eintraf, musterte mich die Frau misstrauisch und wich dann rückwärts in das Haus zurück, das Messer noch immer vor den Körper gehalten. Um mich machte ich mir keine Sorgen – mein Mantel würde jeden Stich abfangen –, aber es bestand die reelle Möglichkeit, dass die Frau dabei ihre eigene Tochter verletzen würde.
Im Hauptraum des Hauses stand ein kleines Sofa. Ich legte das Mädchen dort ab, aber die Kleine setzte sich sofort auf und jammerte, als ihr Fuß den Boden berührte.
Die Frau rannte zu ihrer Tochter, schlang die Arme um sie und drückte sie fest, bevor sie ein Stück von ihr zurückwich und jeden Zoll von ihr einer genauen Musterung unterzog. »Was hast du ihr angetan?«
»Abgesehen davon, ihr zu helfen, als sie stürzte, sie herzutragen und mir anhören zu müssen, wie du mich anbrüllst? Nichts.«
Die Kleine blickte zu uns hoch. »Das stimmt, Mami. Mich hat ein Ritter verfolgt, und dann hat mir dieser Mann geholfen.«
Die Mutter behielt mich im Auge und das Messer zwischen uns. »Ach, süße Beatta, du dummes Kind, kein Ritter würde dir jemals etwas antun. Vermutlich wollte er dich bloß beschützen.«
Beatta zog eine Schnute. »Das ist albern. Ich wollte bloß einen Apfel von dem Obstmann kaufen.«
In diesem Augenblick stürzten zwei Männer und ein etwa zwölfjähriger Junge ins Haus. »Bei allen Heiligen, Merna, was ist los?«, fragte der größere der beiden Männer. Alle drei gehörten zur gleichen Sorte. Sandbraunes Haar und ein kantiges Kinn, gekleidet in die braunen Monturen von Arbeitern. Die beiden Männer hielten Hämmer, der Junge einen Stein.
»Dieser Trattari hatte meine Tochter!«, sagte Merna.
Ich hielt beide Hände zu einer Geste von – nun ja, bitte nicht angreifen – hoch. »Das ist ein Missverständnis. Ich …«
»Das ist in der Tat ein Missverständnis«, sagte einer der Männer und trat einen Schritt auf mich zu. »Du scheinst zu glauben, dass ein Lumpenmantel einfach herkommen und unsere Frauen angreifen kann.«
»Aye«, sagte der andere. »Diener des toten Tyrannen sind hier nicht willkommen, Trattari.«
Trotz meines Wunsches, die Situation zu entschärfen, hielt ich plötzlich das Rapier in der rechten Hand und richtete seine Spitze auf den Hals des Mannes. »Nenn den König noch einmal so, mein Freund, und wir haben ein Problem, das dein Hammer nicht lösen wird.«
Merna tat ihr Bestes, Beatta mit dem Körper zu schützen, aber das Kind schob den Kopf nach vorn. »Warum nennst du ihn so? Was ist ein Trattari?«
»Ein Trattari ist ein Lumpenmantel.« Merna spukte die Worte förmlich aus. »Einer der sogenannten ›Magistrate‹ des verdammten Königs Paelis.«
»Wohl eher Meuchelmörder«, sagte der größere Mann. »Wir sollten ihn festhalten und Ty nach den Konstablern schicken.«
»Hört mir zu«, sagte ich, »ich kam her, weil sich das Mädchen verletzte und Angst hatte. Es glaubte sich in Gefahr. Jetzt ist es bei euch in Sicherheit, also lasst mich in Frieden ziehen.«
Der Anblick meines Rapiers verlieh dem Vorschlag einen gewissen Nachdruck, also machten die Arbeiter Platz, um mich gehen zu lassen.
»Warte«, sagte das Mädchen.
»Was ist denn, Beatta?«, fragte die Frau.
»Ich habe ihm versprochen, ihm etwas von meinem Abendessen zu geben. Er ließ seinen Apfel fallen, als er mir half, und ich sagte, er könne etwas von meinem Essen haben.«
»Mach dir deshalb keine Sorgen«, erwiderte ich. »Ich bin nicht …«
Zu meiner Überraschung richtete sich die Mutter der Kleinen auf. »Wartet hier«, sagte sie.
Die beiden Männer und der Junge leisteten ganze Arbeit, so auszusehen, als würden sie mich in Schach halten, obwohl eigentlich gar nichts passierte.
»Warum nennt ihr ihn ›Trattari‹?«, wiederholte Beatta ihre Frage, diesmal nur an die beiden Männer gerichtet.
Es war der Junge, der antwortete. »Das bedeutet Lumpenmantel«, sagte er. »Sich selbst nannten sie Greatcoats, und ihre Mäntel sollten niemals verschleißen, solange ihre Ehre hielt.«
»Aber natürlich hatten sie keine Ehre«, sagte der kleinere der beiden Männer.
»Weil sie dem Tyrannen Paelis dienten?«, wollte Beatta wissen.
»Oh, aye, sie waren Bastarde, weil sie sich in die rechtmäßige Herrschaft der Herzöge einmischten. Aber nein, Kind, man nennt sie Lumpenmäntel, weil, als die Herzöge mit ihren Heeren kamen, um dem Tyrannen ein Ende zu bereiten, diese sogenannten Greatcoats zur Seite traten und ihren König im Stich ließen, um die eigene Haut zu retten.«
»Aber wenn der König böse war, war es denn dann nicht gut, dass sie zur Seite traten?«, fragte das Mädchen.
Seine Mutter kam mit einem Apfel und einem Stück Käse aus der Küche, die sie eilig in einen kleinen Sack stopfte. »Nein, Liebes. Weißt du, die Ritter lehren uns, dass jedermann über Ehre verfügt, solange er seinem Herrn treu dient. Aber diese Verräter haben nicht einmal das getan. Also nennen wir sie jetzt Trattari – Lumpenmäntel –, weil ihre Mäntel so kaputt wie ihre Ehre sind.«
»Behalte das Essen«, sagte ich. »Ich habe keinen Appetit mehr.«
»Nein.« Die Frau blieb zwischen mir und der Tür stehen und hielt mir den Sack entgegen. »Ich will, dass meine Tochter den Unterschied zwischen richtig und falsch lernt. Sie hat dir Essen versprochen, und das sollst du auch bekommen. Ich will einem Verräter nichts schulden.«
Ich sah sie an, dann die Männer. »Was ist mit dem Mann?«
»Welchem Mann?«
»Dem Ritter. Der sie verfolgt hat. Was ist, wenn er weiter nach ihr sucht?«
Merna lachte. Ein erstaunlich hässlicher Laut. »Als würde einer der herzoglichen Ritter auf die Idee kommen, einem Kind etwas anzutun! Falls es dort überhaupt einen Ritter gab, dann hat er vermutlich nur gesehen, wie du sie ansiehst, und geglaubt, er müsse sie beschützen.« Die Mutter betrachtete ihr Kind. »Beatta ist ein dummes Kind. Vermutlich hat sie nur etwas durcheinandergebracht.«
Die Situation war mir nicht geheuer. Ich hielt es nicht für sehr wahrscheinlich, dass ein Kind nicht wusste, ob es nun von einem Ritter verfolgt wurde oder nicht. Andererseits fiel mir kein vernünftiger Grund ein, warum jemand Beatta verfolgen sollte. Doch ich wollte kein Risiko eingehen. Ich wandte mich ihr zu. »Beatta, fürchtest du dich noch immer vor diesem Ritter? Möchtest du, dass ich heute Nacht draußen vor der Tür Wache halte, falls der Mann kommt?«
Einer der Männer wollte etwas einwenden, aber Merna hielt die Hand hoch. »Beatta, Liebes, sag dem Trattari, dass wir seine Hilfe nicht wollen.«
Beatta sah ihre Mutter an, dann mich. Und mit der unschuldigen Grausamkeit eines Kindes sagte sie: »Geh weg, schmutziger Lumpenmantel. Wir wollen dich hier nicht haben. Der böse König Paelis war ein dummes Schwein, und er ist tot, und ich hoffe, du stirbst auch.«
Vermutlich hatte das Kind König Paelis zu seinen Lebzeiten niemals zu Gesicht bekommen. Die Herzöge hatten gewonnen, und die Geschichte trug bereits die Spuren ihres Sieges. Und selbst wenn jemand hinter dem Mädchen her war, was konnte ich daran ändern? Die Greatcoats waren aufgelöst und entehrt, und es hatte den Anschein, als wollten die meisten Menschen ihr Kind lieber von der Hand eines Ritters sterben sehen, als dass es von einem Trattari gerettet würde.
Ich nahm der Mutter den kleinen Sack mit Essen ab, und auch nur, weil es die schnellste Möglichkeit war, sie aus dem Weg zu bekommen. Ich verließ ihr Haus.
Ein paar Tage später begab ich mich auf dem Weg aus der Stadt spät in der Nacht zu Beattas Haus. Falls man mich entdeckte, würde es viel Ärger geben, das war mir klar, aber ich verspürte einen seltsamen Zwang. Die Lichter waren gelöscht, und auf ein Fenster war mit roter Farbe ein Vogel gemalt, das Zeichen, das man in Cheveran benutzte, wenn man ein Kind verloren hatte.
3
IN SOLAT
Der Sprung aus dem Fenster im zweiten Stockwerk des Gasthauses unterstützte nicht gerade meine Stärken. Kest verfügt über eine unmenschliche Koordination; er hätte vermutlich sogar von einem Turm stürzen können, ohne sich dabei zu verletzen. Brasti hatte unglaubliches Glück und landete auf einer breiten Markise über dem Hintereingang. Er rutschte weiter auf den gepflasterten Hof. Ich war nicht anmutig und hatte auch kein Glück, also stürzte ich ganz einfach. Und landete hart.
Als ich auf die Füße kam, hatten sich acht mit Piken bewaffnete Männer vor uns aufgebaut. Ich hasse Piken beinahe so sehr, wie ich die Magie hasse. Zwölf Fuß lang, mit stabilen Holzschäften und einer bösartigen Eisenspitze versehen, konnte eine Pike einen heranstürmenden Ritter von seinem gepanzerten Schlachtross holen, wenn man sie richtig im Boden verankerte. Gleichzeitig war sie eine so simple Waffe, dass selbst ein ungeübter Mann in einer Schlacht damit viel Schaden anrichten konnte. Und je mehr Männer mit Piken man hatte, umso leichter war es, eine Gruppe von Schwertkämpfern zu überwältigen, ganz egal, wie geschickt sie auch sein mochten.
Aber nicht das bereitete mir Sorgen. Mich störte vielmehr, dass ich keine Glocken vernommen hatte. Wenn die Stadtkonstabler von Solat in ihren Straßen patrouillieren, tun sie das zu zweit. Sollten sie ein Verbrechen entdecken oder auf Ärger stoßen, kann einer von ihnen losrennen und eine der großen Glocken läuten, die überall in der Stadt verteilt sind. Damit rufen sie Verstärkung. Es gibt einen Code, jedem Distrikt ist eine ganz bestimmte Anzahl von Glockenschlägen zugeteilt, damit die Unterstützung weiß, wo sie hinmuss. Aber ich hatte keine Glocken gehört, also beschlich mich der Verdacht, dass diese Männer speziell nach uns Ausschau gehalten hatten.
»Acht Männer mit Piken und oben zwei mit Armbrüsten, Falcio«, meldete Kest und zog das Schwert aus der Scheide. »Ich glaube, das könnte eine Falle sein.«
»Versuch bitte, nicht ganz so enthusiastisch zu klingen, Kest«, sagte Brasti, während er sehnsuchtsvoll zum Rand des Hofes blickte, wo seine Bögen am Sattel seines Pferdes festgezurrt waren.
»Das schaffst du nicht«, sagte der Konstabler, der ihm gegenüberstand, und lächelte dabei so breit, dass sein Helm ein Stück in den Nacken rutschte.
Brasti murmelte etwas und zog widerstrebend das Schwert.
»Pike oder Armbrust, Trattari«, rief eine Stimme über uns. »Was ist euch lieber?«
Ich sah nach oben zu dem Mann, der sich aus dem Fenster von Tremondis Schlafzimmer beugte. Am Kragen seiner Lederrüstung funkelte ein goldener Kreis, was ihn zum Hauptmann der Konstabler machte. »Wenn ihr die Waffen streckt, kann ich euch einen relativ schmerzlosen Tod versprechen. Das ist mehr, als ihr dem Lord Tremondi gegönnt habt.«
»Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass wir Tremondi getötet haben, oder?«, rief ich zurück.
»Aber natürlich. Genau hier steht ›Greatcoats‹ an der Wand, geschrieben mit dem Blut des Karawanenlords.«
»Beim heiligen Felsan, der die Welt wiegt«, fluchte ich. »Warum bei allen Höllen sollten wir unseren Arbeitgeber umbringen?«
Der Konstablerhauptmann zuckte mit den Schultern. »Wer vermag das bei Typen wie euch schon zu sagen? Rächt ihr Trattari euch nicht gern wegen König Paelis’ Tod? Vielleicht hat Tremondi die Herzöge unterstützt, als sie euren König entfernten? Oder es ist ganz einfach: Er erwischte euch dabei, wie ihr ihn beklaut habt, und ihr habt ihn umgebracht, damit er nicht enthüllen kann, dass die ach so rechtschaffenen Greatcoats nicht besser als Straßenräuber und Diebe sind.«
»Aber sein Geld liegt noch genau neben ihm«, rief Brasti zurück und warf mir einen bösen Blick zu.
»Was? Ich weiß nicht, wovon du redest, Trattari«, sagte der Hauptmann lächelnd. »Hier ist kein Geld – nicht eine Münze.«
Die vor uns stehenden Männer lachten. Offensichtlich war Diebstahl in Solat nur dann ein Problem, wenn jemand anders als die Konstabler stahl.
»Du tust es schon wieder, Falcio«, sagte Kest leise.
»Was denn?«
»Reden, wenn du kämpfen solltest.«
Ich zog das Rapier und schlug den Kragen meines Mantels hoch in der Hoffnung, dass die eingenähten Knochenplatten meinen Hals schützen würden. Kest hatte recht; egal, was wir sagten, es würde uns nicht aus diesem Schlamassel holen.
»Wie würdest du unsere Chancen einschätzen?«, fragte ich ihn.
»Wir gewinnen«, erwiderte er, »aber ich werde verwundet, vermutlich am Rücken. Du wirst von einem Armbrustbolzen getroffen und vermutlich sterben. Brasti wird mit großer Wahrscheinlichkeit von einem der Pikenträger getötet, sobald sie an der schwachen Verteidigung seiner Klinge vorbei sind.«
»Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Kest, weißt du das?«, sagte Brasti und nahm eine andere Verteidigungsstellung an.
Kest rollte mit der rechten Schulter und bereitete sich auf den ersten Angriff vor. »Gib ihnen die Schuld – sie wollen dich töten.«
Brasti warf mir einen Blick zu, der deutlich besagte, dass er dafür keineswegs die Konstabler verantwortlich machte. »Du hast wohl keinen besseren Plan, als einfach zu sterben?«, fragte er, als er die Klinge auf den Bauch des ihm am nächsten stehenden Wächters richtete.
»Klar«, antwortete ich. »Wir bringen ihnen die Erste Fechtregel bei.«
Einer der Männer, der, der in Kests unmittelbarer Nähe stand, fasste in Erwartung eines Angriffs seine Pike fester. »Und was soll das sein, Lumpenmantel?«, sagte er hämisch. »Sich zu Boden werfen und wie die Verräter zu sterben, die ihr seid?«
Ein großer Mann und muskulös, seine breiten Schultern waren perfekt für den Einsatz einer Pike gemacht.
»Nein«, sagte Kest. »Die Erste Fechtregel lautet …«
Er wurde unterbrochen, als der Wächter mit der Schnelligkeit einer aus der Mündung einer Pistole kommenden Bleikugel mit seiner Pike zustach.
»… steche das spitze Ende in deinen Gegner«, vollendete Kest den Satz.
Niemand rührte sich oder sprach. Die Begegnung war so schnell gewesen, dass nur das Endresultat ersichtlich war. Kests linker Handrücken drückte nun gegen den Pikenschaft, und die Spitze war harmlos von ihm abgelenkt worden. Sein Körper nahm die Ausfallposition ein, und seine Schwertspitze steckte sechs Zoll tief im Leib des Konstablers.
Mit einer Sanftheit, die nicht zur Natur der Auseinandersetzung passte, zog Kest die Klinge aus dem Bauch des Mannes und sah zu, wie er zu Boden sackte.
Einen Moment – nur die Spanne eines Augenblicks – sahen die Konstabler vor uns so entsetzt aus, dass ich glaubte, sie würden den Weg frei geben. Aber dann hörte ich das metallische Schnappen einer Armbrust und fühlte den Treffer im Rücken. Während sich der Aufprall in meinem ganzen Körper ausbreitete, dankte ich dem heiligen Zaghev, der für Tränen singt, für die Knochenplatten, die verhinderten, dass sich der Bolzen in meinen Körper bohrte. Auch wenn es wie der rote Tod schmerzte.
»Verdammte Mäntel«, hörte ich den Hauptmann oben im ersten Stock murmeln.
»Unter die Markise«, rief ich, und wir nahmen Positionen unter dem breiten Stoffstück über der Hintertür des Gasthauses ein.
»Die hält keine Armbrustbolzen auf«, bemerkte Brasti.
»Ich weiß, aber sie können schwerer zielen.«
Die beiden Konstabler, die mir am nächsten standen, stachen mit ihren Piken auf mich ein. Der ganz links, der kleinere der beiden, hatte ein Gesicht wie ein wütendes Frettchen. Der zu meiner Rechten war größer und stämmig und erinnerte mich mehr an einen Bären als an einen Mann. Ich parierte die Pikenspitze des Frettchens und griff mit der freien Hand nach dem Schaft, während ich mit der Klinge eine halbe Sekunde später die Waffe des Bären abwehrte. Das Frettchen zerrte an seiner Pike, aber ich setzte mein größeres Gewicht ein, um ihn daran zu hindern, sie zurückzubekommen. Die Wut in seiner Miene wäre durchaus zufriedenstellend gewesen, wäre kein Armbrustbolzen an meinem Ohr vorbeigesaust, um genau zwischen uns zu landen.
Ich nutzte die kurze Verwirrung, um des Bären Pikenschaft mit dem Griffkorb des Rapiers nach unten zu schlagen, dann trat ich die Spitze mit dem Fuß in den Boden. Als das Frettchen wieder an seiner Waffe zerrte, machte ich einen Satz und nutzte den den Bemühungen des Frettchens innewohnenden Schwung aus, um die Distanz zwischen meiner Klingenspitze und dem Hals des Bären blitzschnell zu überbrücken. Als der große Mann zu Boden stürzte und sich so von meiner Waffe befreite, stieß ich dem Frettchen das Rapier in die Schulter, und es stürzte ebenfalls zu Boden, wenn auch mit beträchtlich mehr Gebrüll.
Ein weiterer Bolzen zwang mich zurück in den zweifelhaften Schutz der Markise, und ich nutzte die Gelegenheit zur Orientierung. Glücklicherweise waren die anderen Wächter, die nun auf mich zukamen, etwas vorsichtiger, also nahm ich mir die Zeit und sah kurz nach Brasti. Ich machte mir nie die Mühe, nach Kest zu sehen – ihm beim Kämpfen zuzuschauen vermittelte mir immer bloß das Gefühl, ein unbeholfener Junge bei seinem ersten fummelnden Kuss zu sein.
Brasti versuchte vor den Konstablern zurückzuweichen, aber er hatte nicht viel Platz, ohne die Deckung der Markise verlassen zu müssen und damit zum Ziel für die Armbrüste zu werden.
»Verflucht, Falcio, das ist alles nur deine Schuld«, murrte er.
»Wenn wir jetzt sterben, Brasti, dann befehle ich Kest, allen zu sagen, dass du arm, gehasst und von allen Frauen als lausiger Liebhaber verschrien gestorben bist.«
»Du weißt, dass ich mit diesem verdammten Ding nicht gegen Piken kämpfen kann«, brüllte Brasti zurück, während er mit dem Schwert vor dem Körper herumfuchtelte. Zog man in Betracht, dass er so gut wie nie übte, war er kein übler Fechter, aber gegen zwei oder drei Männer mit Piken zu kämpfen fällt jedem schwer. Hätte er natürlich seinen Bogen gehabt, wäre es eine ganz andere Sache gewesen …
»Kest!«, rief ich, »hilf Brasti dort wegzukommen.«
Kest warf mir einen kurzen Blick zu, während er den wilden Angriff eines Konstablers parierte, und ich wusste, dass er begriff. Dennoch. »Armbrüste, Falcio«, erinnerte er mich, während er den Angriff des Mannes unterlief, um an Brastis Seite zu kommen.
Verflucht, dachte ich, er hat recht. Falls Brasti zu den Pferden lief, würden die Männer im ersten Stock sofort auf ihn schießen. Sie brauchten ein besseres Ziel.
»Schön. Tun wir es – jetzt!« Und ich zog ein Wurfmesser aus dem Halfter in meinem Mantel, trat unter der Markise hervor und schleuderte es auf den Hauptmann im ersten Stock. Die Klinge bohrte sich keine sechs Zoll von seinem Gesicht entfernt in den Fensterrahmen, und ich verfluchte den Heiligen, der mich eigentlich beim Zielen hätte unterstützen sollen.
Der Konstabler war ein erfahrener Mann; er ignorierte das Messer und zielte. Ich sprang nach links, während sich der Bolzen zwischen meinen Füßen in den Boden bohrte. Ohne zu zögern, warf der Mann die Armbrust zur Seite und riss dem Wächter neben sich die bereits geladene Waffe aus der Hand. Aber etwas in der Hofmitte erregte seine Aufmerksamkeit – das konnte nur Brasti sein –, und er zielte neu. Ich schleuderte ein weiteres Messer in seine Richtung und machte klar, dass ich die dringendere Bedrohung war, und diese Klinge leistete ihren Dienst bedeutend besser als ihre Vorgängerin und bohrte sich in seine Schulter. Es war Pech für mich, dass er stolperte und abdrückte. Ich hatte den Mantel geöffnet, um an meine Messer zu kommen, und dank des Glücks, das mir Götter und Heilige zugestehen, traf mich der Bolzen in meinen entblößten Oberschenkel.
»Habe ich dich erwischt, Trattari-Bastard«, rief der Konstabler, bevor er rückwärts in Tremondis Zimmer stürzte.
Hinter mir ertönte ein Schrei, und ich fuhr herum, dabei den Schmerz verfluchend, der durch mein Bein zuckte. Genau mir gegenüber stand einer der verbliebenen Stadtwächter, der mit seiner Pike genau auf meine Brust zielte und zustieß. Ich schlug mit dem Rapier nach der Pike, obwohl mir völlig klar war, dass ich nicht schnell genug sein würde. Und sah, wie plötzlich ein Pfeilschaft aus seinem Hals ragte. Der Mann stürzte vor mir zu Boden, und ich blickte mich um, um nach dem nächsten Angriff Ausschau zu halten – aber es gab keinen nächsten Angriff. Neben den beiden Konstablern, die ich erledigt hatte, lagen zwei weitere Leichen von Pfeilen durchbohrt auf dem Boden, und die drei restlichen Männer waren durch Kests Klinge entweder verletzt oder getötet.
»Die Armbrüste schießen nicht mehr«, sagte er und trat unter der Markise hervor.
»Das bedeutet, dass sie nach unten kommen. Zeit zu gehen.«
»Das war eine gute Idee, Brasti Deckung zu geben, damit er an seinen Bogen kommt. Daran hatte ich nicht gedacht.«
Ich legte ihm die Hand auf die Schulter, um etwas Gewicht von meinem verletzten Bein zu nehmen. »Kest, wenn du das nächste Mal zu dem Schluss kommst, dass das bestmögliche Ende darin besteht, dass alle außer dir tot sind, streng deinen Grips etwas mehr an, ja?«
Wir eilten zu Brasti und den Pferden am anderen Ende des Hofes. Keines der Pferde war während des Kampfes verletzt worden. Dafür dankte ich dem heiligen Shiulla, der mit Bestien badet. Während Brasti sich seine Pfeile zurückholte, fragte ich mich, wer uns diese Falle gestellt hatte.
»Bei den Göttern, Kest, wann ist es so leicht geworden, nur das Schlechteste von uns zu denken?«
»Die Zeiten haben sich geändert, Falcio«, sagte er und zeigte hinter uns.
Ich drehte mich um und sah, wie Brasti in der einen Hand seine zurückgeholten Pfeile hielt und mit der anderen die Toten durchsuchte.
»Brasti, hör auf, die Konstabler zu beklauen«, rief ich.
Mürrisch verzog er das Gesicht, lief aber zu seinem Pferd. »Na schön«, murrte er. »Wir wollen ja nichts von den netten Männern nehmen, die uns gerade umbringen wollten.« Er sprang auf seine braune Stute. »Ich meine, das wäre nicht nur unehrenhaft. Es wäre – bei allen Göttern und Heiligen – auch unhöflich.«
»Interessant«, sagte Kest und nahm die Zügel.
»Was?«, fragte Brasti.
Kest zeigte auf mich. »Mir ist gerade klar geworden, dass er vor einem Kampf zu viel redet und du danach. Ich frage mich, was das bedeutet?«
Er stieß seinem Pferd die Fersen in die Flanken und galoppierte los, gefolgt von Brasti. Ich warf noch einen Blick zurück auf die Toten am Boden und fragte mich, wie lange die Greatcoats wohl durchhalten würden, bevor wir genau das wurden, als das uns die Leute bezeichneten: Trattari.
Das zweitschlimmste Gefühl auf der Welt sucht einen heim, wenn der Körper entdeckt, dass er schon wieder um sein Leben kämpfen muss. Muskeln verkrampfen sich, man fängt an zu schwitzen, man stinkt (was in so einem Augenblick glücklicherweise niemand bemerkt), und der Magen rutscht einem in die unteren Körperregionen.
Aber das schlimmste Gefühl auf der Welt kommt dann, wenn der Körper entdeckt, dass der Kampf vorbei ist. Die Muskeln werden schlaff, der ganze Kopf dröhnt, man schwitzt und – o ja, man bemerkt den Geruch. Und dann wird einem bewusst, dass einem ein Armbrustbolzen aus dem Oberschenkel ragt. Es war der Bolzen, der mich schließlich anhalten ließ.
»Der muss raus«, sagte Brasti weise und spähte weiter über den Dachrand, um nach Konstablern Ausschau zu halten.
Ich hätte ihn umbringen können, aber dazu hätte ich meinen Körper bitten müssen, den ganzen Kreislauf noch einmal durchzumachen, und ehrlich gesagt stank ich auch so schon schlimm genug. Wir hatten eine ordentliche Gasse mit zwei Ausgängen gefunden, in der wir verschnaufen konnten. Die Pferde galoppieren nicht gern auf Pflasterstraßen um Ecken, und wir mussten uns um mein Bein kümmern.
Kest blickte mich an. »Schlag-ziehen-klatsch?«
Ich seufzte. Das tat weh. »Wir haben wohl keine Zeit, einen Arzt zu finden, was?«
Brasti kletterte vom Dach herunter. »Sie durchsuchen die Häuser. Die Kerle sehen nicht so aus, als hätten sie es eilig, uns zu finden, aber der Hauptmann – der Konstabler, der dich erwischt hat – treibt sie energisch an. In ein paar Minuten sind sie hier.«
Verdammt. »Schlag-ziehen-klatsch«, sagte ich und fürchtete es bereits. »Aber mach es diesmal richtig, Brasti.«
Kest schüttete Wasser auf die Wunde, was mich durch die Zähne pfeifen ließ.
»Schrei dieses Mal nicht«, erwiderte Brasti. »Wir wollen ja nicht erwischt werden.«
Während ich den heiligen Zaghev, der für Tränen singt, anflehte, nur dieses eine Mal aus dem Himmel zu kommen und sich meinen guten Freund Brasti vorzuknöpfen, packte Kest den Bolzen mit festem Griff und nickte Brasti zu.
Wir drei hatten Schlag-ziehen-klatsch schon vor einiger Zeit erfunden. Wird man oft genug verwundet, macht man unter anderem die Entdeckung, dass sich der Körper immer nur auf eine Schmerzquelle gleichzeitig konzentriert. Wenn man also beispielsweise Zahnschmerzen hat und einen jemand in den Magen schlägt, vergisst der Körper kurz den Zahn.
Also das funktioniert so: Brasti schlägt mich ins Gesicht, Kest zieht den Bolzen aus meinem Bein, und Brasti klatscht so fest zu, dass mein Verstand einfach keine Zeit hat, den Bolzen zu registrieren, und ich darum nicht aus vollem Hals brülle.
Ich brüllte aus vollem Hals.
»Pst! Du musst still sein, Falcio«, sagte Brasti, beugte sich näher heran und drohte mit seinem Finger. »Das könnten sie gehört haben. Du musst einfach etwas härter werden.«
»Ich habe dir gesagt, du sollst hart zuschlagen«, sagte ich und sah den Sternchen nach, die durch mein Blickfeld flimmerten.
»Ich habe dich so hart geschlagen, wie das aus diesem Winkel möglich war. Kest war im Weg.«
»Du schlägst zu wie ein Mädchen.«
Kest hielt darin inne, mein Bein zu verbinden. »Fast ein Drittel von König Paelis’ Greatcoats waren Frauen. Du hast die meisten davon ausgebildet. Haben sie nicht hart genug zugeschlagen?«
Das war ein Argument, aber ich war nicht in der Stimmung für Semantik. »Sie schlugen zu wie rasende, verfluchte Heilige. Brasti schlägt zu wie ein Mädchen«, murrte ich und hielt das eine Ende des Verbandes fest, während Kest die Wunde ausstopfte.
»Also geht es jetzt nach Baern?«, fragte Brasti.
Ich schob mich auf die Füße. Das Bein fühlte sich mit dem festen Verband gleich viel besser an: Aus dem brennenden Schmerz war ein pulsierender geworden. »Entweder das oder hierbleiben und versuchen, dir beizubringen, nicht wie ein Mädchen zu schlagen.«
»Falcio, falls du das noch einmal sagst, schlage ich dich«, sagte Kest.
»Das ist doch bloß ein Ausdruck, ›du schlägst wie ein Mädchen‹. Das sagt jeder. Es ist witzig.«
Er gab mir mein Rapier zurück. »Nein«, sagte er. »Es ist absurd.«
»Es ist witzig, weil es absurd ist«, erwiderte ich.
Brasti versetzte mir einen Hieb auf den Rücken. »Hör nicht auf ihn, Falcio. Er hat seinen Sinn für Humor an dem Tag eingebüßt, an dem er lernte, eine Klinge zu schwingen.«
Es war merkwürdig, da Brasti es nicht wissen konnte, aber damit hatte er genau ins Schwarze getroffen.
4
DER KARAWANENMARKT
Wie ich bereits erwähnte, lebten meine Mutter und ich am Dorfrand, der an den Rand eines anderen Dorfes namens Luth grenzte. Dazwischen ragte ein Holzpfahl in die Höhe, und dort lernten Kest und ich uns kennen, als wir beide ungefähr acht Jahre alt waren. Ich war sehr arm, hatte keinen Vater und keine Aussichten, abgesehen vielleicht von einer möglichen Zukunft als Dorftrottel. Kest Murrowsohn war das Kind einer wunderbaren Mutter, die als Heilerin arbeitete, und eines Vaters, der der Dorfschmied war. Damals erzählte Kest ununterbrochen Witze – und stellte damit sogar mich selbst für die Rolle des Dorftrottels in den Schatten –, aber er machte sich niemals über mich lustig, weil ich arm war oder keinen Vater hatte, und das qualifizierte ihn sofort für die Rolle meines besten Freundes. Er war ein sanfter Junge, der nicht gern jagte oder fischte und auch nie mit Schwertern spielen wollte. Ich andererseits würde eines Tages ein Greatcoat werden, genau wie in Bals Geschichten.
Kests Vater schmiedete die besten Schwerter in der ganzen Gegend, und er hatte im Krieg gegen Avares kämpfen gelernt. Avares ist das Land im Westen, das von Barbaren bevölkert wird, die sich gelegentlich zusammenrotten, über die Berge ziehen und uns zu überfallen versuchen, wie es bei ihnen üblich ist. Sie verlieren jedes Mal, weil unsere Truppen diszipliniert in Einheiten kämpfen, wohingegen sie bloß brüllend auf einen zurennen und sich dabei selbst nass machen, während sie versuchen, einem den Schädel mit allem einzuschlagen, was gerade in Reichweite liegt.
Wie dem auch sei, Murrow, Kests Vater, war ein guter Fechter, und da Kest daran nicht das geringste Interesse zeigte, glaubte er, er könnte ihn eifersüchtig machen, indem er es mir beibrachte. Er zeigte mir, wie man mit einem Breitschwert kämpfte, das man in jenen Tagen oft als Kriegsschwert bezeichnete, weil Duelle mit leichteren Waffen ausgetragen werden. Aber das Schwert, das mir am besten gefiel, war das Rapier. Ganz gerade, mit scharfer Spitze, von geringem Gewicht – jedenfalls verglichen mit einem Kriegsschwert – und mit einem eleganten Stil, der sich anfühlte, als würde man mit dem Tod tanzen. Ich war ein gelehriger Schüler, und ich verbrachte so gern Zeit mit dieser Familie. Seltsamerweise entwickelte Kest nie die Eifersucht, die sein Vater provozieren wollte. Er sah mir zu, machte mir gelegentlich Komplimente, zeigte aber keinerlei Interesse, selbst ein Schwert in die Hand zu nehmen.
Als ich zehn war, nahm mich Murrow nach einer Übungsstunde zur Seite. »Falcio, mein Junge, eines Tages wirst du ein guter Fechter sein«, sagte er zu mir. »Ein guter Kämpfer. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand es so schnell begreift.«