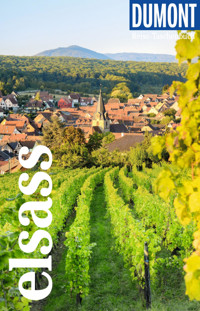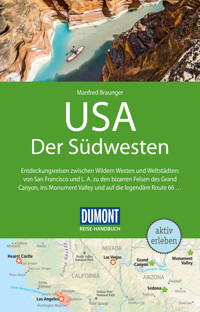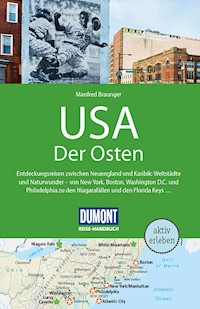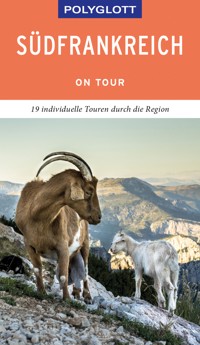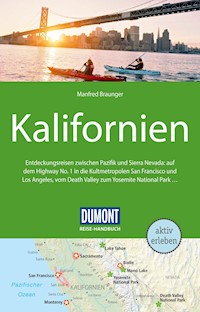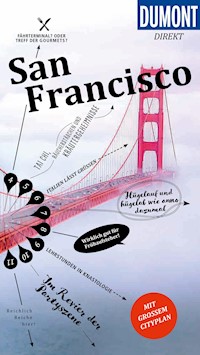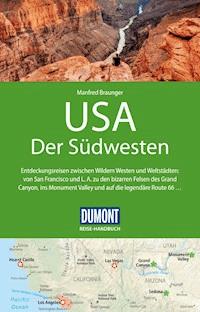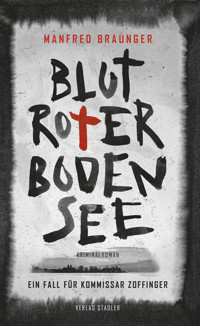
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Stadler
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei grausame Morde erschüttern die Urlaubsidylle am Bodensee. Zuerst geschieht ein groteskes Gewaltverbrechen im Strandbad Eriskirch und kurz darauf wird im klösterlichen Kräutergarten auf der Insel Reichenau ein toter Mönch entdeckt. Allen Anzeichen nach ebenfalls Opfer einer Gewalttat. Doch wer sollte das Inselparadies auf so brutale Weise stören? Der Konstanzer Kommissar Paul Zoffinger, ein badisches Urgestein vom Scheitel bis zur Sohle, nimmt seine Ermittlungen auf. Schnell fällt der Verdacht auf den Reichenauer Bodo Weihstock, der bereits mehrfach durch kirchenfeindliche Aktionen aufgefallen war, aber ist diesem auch ein Mord zuzutrauen? Zoffingers Bauchgefühl sagt ihm, dass hinter diesem Fall mehr steckt. Wenige Tage später wird bei Reinigungsarbeiten im Konstanzer Rheintrichter ein strangulierter junger Mann im Latexanzug aus dem Wasser gezogen wird. Drei Leichen und noch kein Tatmotiv! Treibt ein Serienmörder am Bodensee sein Unwesen? Für Kommissar Zoffinger verdichten sich nach und nach die Hinweise, dass die Fälle alle zusammenhängen und der tote Mönch zu Lebzeiten eine zentrale Rolle in diesem mörderischen Konstrukt gespielt haben muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MANFRED BRAUNGER
BLUTROTER BODENSEE
Grafik/Umschlag: Manuel Pollanka – Irgendwas mit Grafik, Deizisau
Satz: Satzteam Dieter Stöckler, Konstanz
Gesamtherstellung: Dardedze Holografija, Riga
Bildnachweis – Coverabbildung:
Foto © Stefan Arendt, Allensbach/Blick zur Insel Reichenau
Verlag und Vertrieb:
Stadler Verlagsgesellschaft mbH
Max-Stromeyer-Straße 172
78467 Konstanz
www.verlag-stadler.de
4. Auflage 2024
© Copyright by Verlag Friedr. Stadler GmbH & Co. KG, Konstanz
Die Wiedergabe oder die Veröffentlichung der Texte und Bilder des Buches, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herausgebers oder des Verlages gestattet. Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
isbn 978-3-7977-0751-2
eisbn 978-3-7977-5102-7
Inhalt
1 MORD IM SCHWIMMBAD
2 TATORT INSEL REICHENAU
3 EIN KOMPLIZIERTER FALL
4 ÜBERFALL
5 EINE MYSTERIÖSE ENTDECKUNG
6 KIDNAPPING
7 EIN TUNNEL AUF DEM HASCHISCH-HIGHWAY
8 STRIPSHOW AUF ASPHALT
9 LEICHE IN LATEX
10 KALTE SPUR
11 FEUER UNTERM DACH
12 GEFANGEN IN DER BUTZEWEGS-HÖHLE
13 MÖRDER IM BLÜMCHENHEMD
14 EXPLOSIVER FUND
15 DAS GESTÄNDNIS
16 VERMÄCHTNIS MIT KNALLEFFEKT
… und dann bat mich irgendwann der Verlag, eine Widmung für meinen Krimi zu schreiben. Ich würde es an dieser Stelle gern mit Charles Bukowski halten, der in einem seiner Bücher schrieb: »Dies ist ein Roman. Er ist niemandem gewidmet.«
Manfred Braunger
»Verbrecherjäger sind oft voller Selbstzweifel, Verbrecher voller Selbstvertrauen. Ich kann beides.«
Kommissar Paul Zoffinger
1MORD IM SCHWIMMBAD
»Leg einen Zahn zu, Alter. Endlich mal wieder ein Hammerereignis!«, brüllte Matty in sein Smartphone. »Bin gerade am Stadtrand von Friedrichshafen auf die B31 eingebogen. Bin gleich im Strandbad in Eriskirch.«
»Strandbad in Eriskirch? Brauchst du eine Abkühlung oder hast du dort deine Badehose vergessen? Was hat ein Konstanzer Polizeifotograf so weit von seinem Schreibtisch entfernt zu suchen?«, hakte Florian nach.
»Du bist wohl im Tal der Ahnungslosen aufgewachsen. Eriskirch liegt nicht auf dem Mars, sondern gehört noch zu unserem Dienstbereich. Übrigens: Erzähl bloß niemandem, dass du den Strandbad-Tipp von mir bekommen hast.«
»Bist du sicher, dass es sich um ein Gewaltverbrechen und keinen Pennälerstreich handelt?«
»Bist du heute eigentlich schwer von Begriff? Du redest mit Matty, Bullenprofi schon ein halbes Leben lang, falls du das vergessen hast. Ja, es handelt sich wahrscheinlich um ein Gewaltverbrechen, weniger wahrscheinlich um einen Selbstmord. Wer hängt sich schon am Fünf-Meter-Brett in einem Strandbad auf! Ich wüsste bequemere Methoden. Also sattle die Hühner, bevor der Markt verlaufen ist.«
Florian ließ in der Redaktion des »Seekuriers« alles stehen und liegen, bretterte nicht ganz regelkonform über die Rheinbrücke und schaffte es in letzter Minute in Staad bei Konstanz auf die Fähre nach Meersburg. Er blieb im Auto sitzen und nestelte an seinem Navi herum, bis er das Strandbad Eriskirch als Fahrtziel eingegeben hatte. 31 Kilometer. Aber nicht die Entfernung war das Problem, sondern die völlig überlastete Bundesstraße 31. Kolonnenverkehr bis zum Abkotzen. Und warum? Weil die Verkehrsstrategen der Ortschaft Hagnau ein 30er-Tempolimit verpasst hatten. Ein Nadelöhr vom Feinsten. Man hätte während der Ortsdurchquerung zum Friseur gehen können. In Eriskirch kam er deshalb erst an, als die Show schon fast gelaufen war.
»Stopp! Das Bad ist geschlossen.«
Breitbeinig wie ein Bootcampaufseher versperrte der Uniformierte den Eingang. Florian nestelte seinen Presseausweis aus der Brusttasche.
»O.k.«, nickte die breitschultrige Barriere. »Aber keinen Schritt weiter wie die Absperrbänder um das Becken.«
»Das Bad sieht aus, als sei es in dieser Saison noch gar nicht in Betrieb gewesen«, wunderte sich Florian.
»War es auch nicht. Die Wasseranalysen waren jämmerlich. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat deshalb den Stecker gezogen und ein Badeverbot verhängt.«
»Badeverbot?«
»Keimbelastung durch die stark verschmutzte Schussen oder so ähnlich. Wenn Sie Genaueres wissen wollen, reden Sie mit der Presseabteilung.«
Hinter dem Strandbadeingang standen sich mehrere Uniformierte teilnahmslos die Beine in den Bauch, als müssten sie dafür sorgen, dass niemand das Schwimmbecken klaut. Die Jungs von der Spurensicherung hatten es noch vor Florian nach Eriskirch geschafft. Mit Metallkoffern geisterten sie in weißen Einweg-Overalls wie Außerirdische in der Gegend herum. Einer war mit einem schwarzen Plastikeimer unterwegs und sammelte alles auf, was ihm verdächtig erschien. Auf dem Sprungturm lag bäuchlings einer der Schneemänner und bearbeitete mit einem Pinsel die Kante des Fünf-Meter-Brettes. Der Strick baumelte noch dran, von dem das Opfer schon abgeschnitten worden war. Zwei Kerle in Neoprenanzügen hockten wie bestellt und nicht abgeholt auf dem Beckenrand. Florian reimte sich zusammen, wie die Bergung vor sich gegangen war. Wahrscheinlich hatten die Typen vom THW oder der Feuerwehr die Leiche abgeschnitten und geborgen. Das Neoprenduo dürfte sich für den Fall bereitgehalten haben, dass sie ins Wasser gefallen wäre. Florian nickte. So musste es sich abgespielt haben.
Die tote Frau lag in einem kornblumenblauen Kleid rücklings auf einer Plastikunterlage. Ein Spurensicherer inspizierte die widerwärtigen blauroten Würgemale um ihren Hals.
»Wir müssen in unseren Bericht aufnehmen, dass sie mit dem Rücken auf einer feuchten Unterlage gelegen haben muss, bevor der Täter sie erhängte«, sagte er zu seinem Kollegen. »Könnte ein feuchter Holzboden gewesen sein.«
Der zweite Spurensicherer sah sich ihre Beine an, die an den Waden Kratzspuren aufwiesen.
»Der linke Schuh fehlt!«, bellte er. »Ist euch das nicht aufgefallen?«
Das Neoprenduo schaute sich unentschlossen an, bis sich einer entschied, nach der fehlenden Fußbekleidung zu suchen. Nach zwei Versuchen tauchte er auf und hielt den Schuh wie eine Trophäe in der ausgestreckten Hand. Zwei gelangweilte Typen in dunklen Anzügen aus der Kleiderspende klappten den Deckel des Sarges auf, in dem die Tote weggebracht werden sollte.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Schwimmbeckens wieselte Polizeipaparazzo Matty kamerabehängt durch das Gelände.
»Du hast das Beste verpasst«, raunte er Florian zu. »Das hättest du sehen sollen, wie die Typen die Leiche vom Strick holten. Selten so etwas Krasses vor die Linse bekommen.«
Florian sah sich um.
»Ich habe Zoffinger noch gar nicht gesehen.«
»James Bond 2.0 ist im Anmarsch. Wahrscheinlich hängt er auf der B31 im Stau fest. Oder er musste unterwegs noch einen Fleischkäsewecken einwerfen.«
Für Florian blieb im Eriskircher Strandbad nicht mehr viel zu tun. Die Details über die Tote würden ohnehin erst in ein paar Tagen ans Licht kommen. Zu sehen gab es im Augenblick auch nichts mehr. Die Hauptshow, wie Matty sie bezeichnete, hatte er verpasst. Blieb nur noch der geordnete Rückzug in sein Büro in Konstanz. Eilig hatte er es nicht mehr, jetzt an seinem letzten Arbeitstag beim »Seekurier«. Am nächsten Tag würde er ein neues Leben antreten, sein zwölfmonatiges Sabbatjahr. Er nahm sich Zeit, ließ sich auf der Rückfahrt im Kolonnenverkehr durch Friedrichshafen treiben, ärgerte sich nicht einmal mehr über den Stopp&Go-Verkehr in Hagnau, sondern freute sich diebisch, als ihn mitten im Ort ein rücksichtsloser Motorradfahrer kamikazehaft überholte und prompt von der Radarfalle geblitzt wurde.
Freitagnachmittag. In den Fluren des »Seekuriers« herrschte entspannte Wochenendstimmung. Kein Terroranschlag, kein Diesel-Gate und kein Ministerrücktritt brachte die Redakteure ins Rotieren. Für Florian war ohnehin Schicht im Schacht. Höchstens noch die letzten E-Mails checken. Matty hatte aus dem Strandbad in Eriskirch bereits ein paar Bilder von der Erhängten geschickt.
»Mit allen guten Wünschen zum bevorstehenden Sabbatjahr«, stand im mitgeschickten Text.
Florian druckte fünf Bilder aus und breitete sie auf seinen Schreibtisch aus. Quasi ein Zeichen der Amtsübergabe an den Kollegen, der sich weiter um den Fall kümmern würde. So richtig tot sah die Frau trotz der blonden, an der Stirn klebenden Pudelfrisur eigentlich nicht aus. Quicklebendig allerdings auch nicht. Wie ein enges Halsband zogen sich die hässlichen rotblauen Striemen um ihren Hals. Schade um ihr kornblumenblaues Kleid mit den weißen Punkten, dachte er. Kaum war ihm der Gedanke gekommen, schämte er sich. Wie konnte er in Anbetracht des gewaltsamen Todes der Frau überhaupt an ein ruiniertes Kleidungsstück denken! Er sah sich eines der Fotos genauer an. Aber was konnte man aus dem Gesicht einer erhängten Leiche schon herauslesen? Älter als Mitte 30 war sie bestimmt nicht, hatte ein schmales Gesicht, blondes Haar, das ihr wie ein Büschel nasses Stroh auf dem Kopf hing.
Er warf einen Blick durch das Fenster auf die Dächerlandschaft der Altstadt. Rote und braune Ziegel, Dachtraufen, hie und da ein betoniertes Flachdach, in der Entfernung der Konstanzer Münsterturm.
Über den Dachfirst direkt vor seinem Büro spazierte eine schwarze Katze. Von links nach rechts. Schon als Bub hatten sie ihm eingetrichtert: schwarze Katze von rechts: Glück und Schwein gehabt; schwarze Katze von links: Ärger, Unglück, Tod. Um im letzteren Fall einen Schlamassel abzuwenden, musste man drei Steine über den Weg der Katze werfen. Oder auf einen Stein spucken.
Die Mieze hatte sich hingesetzt, um sich zu putzen. Nach einer Weile drehte sie auf dem Dachfirst um und marschierte den Weg zurück, den sie gekommen war. Von rechts nach links.
»Na also«, dachte Florian. »Ums Verderben noch mal herumgekommen.«
Amüsiert über das Kokettieren mit dem schwachsinnigen Aberglauben schwang er seinen Rucksack auf die Schulter. Ein letzter Blick in sein Büro, das er ein Jahr lang nicht mehr betreten würde. Draußen vor dem Fenster flanierte immer noch der schwarze Haustiger auf dem Dachfirst. Er hatte wieder umgedreht und schlenderte jetzt von links nach rechts. Kein gutes Omen!
Als sich Florian auf seinen letzten Gang durch die Redaktion machte, fiel ihm seine ziemlich feuchte Abschiedsfete vor einer knappen Woche in der Kantine des Zeitungsgebäudes ein. Am nächsten Morgen hatte er zwei Reparaturseidel bemühen müssen, um halbwegs gerade aus der Wäsche schauen zu können. Einer war bei der Sause nicht dabei gewesen, dem er jetzt zum Abschied als Erstem die Hand schütteln würde. Im Kulturressort nebenan roch es nach einer Mischung aus Veilchenduft und Erkältungsbad. Aus einem Lautsprecher säuselte belangloses Gedudel wie im Supermarkt. Ignaz Schuler badete einen Teebeutel wie ein Jojo in einer Tasse mit heißem Wasser. Als einer der wenigen in der Redaktion pflegte Florian mit ihm ein ziemlich distanziertes Verhältnis, weil er ein richtiger Griffelspitzer war, überkorrekt, unnahbar, humorresistent; einer, der morgens erst einmal seine Schreibtischunterlage einnorden musste, standardmäßig Pullunder mit entsetzlichem Rautenmuster trug und immer aussah, als habe ihm seine Gouvernante die Fliege zu eng um den Hals gebunden.
»Ich wünsche dir eine geruhsame Auszeit«, flötete der Gestriegelte und streckte Florian das Patschhändchen hin, als fürchtete er, gebissen zu werden.
»Geruhsam? Alles, bloß das nicht«, entgegnete Florian, als er bereits nach der Türklinke griff.
Nächster auf der Abschiedstournee war der Chef vom Dienst, den jeder in der Redaktion nur unter dem Spitznamen Old Schweiß kannte. Hinter seinem Schreibtisch schwitzend, pflegte er vor sich hin zu dampfen. Glücklicherweise war er nicht da. Also kein feuchtklebriges Händeschütteln, keine Dunstwolke, die einem noch eine Stunde später in der Nase hing. Auch die Sportredaktion war verriegelt und verrammelt, weil die Typen vermutlich in gesponserten Sportklamotten auf einem Tennisplatz herumhingen.
Das Ende des Flurs teilten sich die Ressorts Wirtschaft und Politik, die selbst ernannten Think Tanks der Redaktion. Die Schreiberlinge hatten bereits pünktlich wie die Maurer das Wochenende eingeläutet und einen Kasten Bier aktiviert, um den Übergang von Arbeit zu Freizeit etwas geschmeidiger zu gestalten.
»Seht euch den an!«, tönte es aus der bereits auf Frohsinn eingestimmten Runde. »Wenn das nicht unser Burnout geschädigter Langzeiturlauber ist.«
»Headline: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung!«, trompetete einer hinter seinem Monitor.
»Nur keinen Neid, ihr Suffköpfe«, konterte Florian. »Hättet ihr eure Kohle nicht in Straßennutten angelegt und euer Hirn nicht in Pils und Weizenbier eingeweicht, könntet ihr euch so eine Auszeit auch leisten.«
Letzte Station auf der Abschiedstour: die Chefredaktion.
»Hand aufs Herz: Ich beneide dich«, gestand der Redaktionsleiter, der immer einen Leidenszug um die Mundwinkel hatte, als stünde er kurz vor der Kreuzigung. »Ein Sabbatjahr! Zwölf Monate in der Hängematte! Würde mir perfekt in den Kram passen. Aber ich müsste mich vermutlich in einer Billigabsteige einmieten oder mir in der Schweiz einen Ziegenstall mit Stromanschluss zulegen. Bei mir zu Hause? Keine ruhige Minute. Du kennst ja meine Frau und meine hyperaktiven drei Plagen. Also halte ich lieber hier die Stellung.«
»Zwölf Monate in der Hängematte? Definitiv mein Untergang«, vermutete Florian. »Wäre mir nicht nur zu langweilig, sondern auch zu geisttötend. Übrigens: Der aktuelle Fall mit der Strandbadfrau liegt auf meinem Schreibtisch. Die Sache hätte ich noch gerne recherchiert, weil sich dahinter eine fetzige Story verbergen könnte. Die Fotos der Toten, die ich von Matty bekommen habe, liegen auch auf meinem Schreibtisch.«
»Falls du von deinen Informanten etwas über den Fall zu hören bekommst, lass es uns wissen. Vom Journalisten wirst du hoffentlich nicht zum Schriftsteller verkommen. Da wird auch dein Sabbatjahr nichts dran ändern. Dein direkter Draht zur Polente wird uns fehlen.«
»Keine Sorge. Die Kollegen sind auch nicht auf den Kopf gefallen.«
»Willst du in deiner freien Zeit tatsächlich einen Krimi schreiben? Schon eine Idee, ein Thema?«
Florian signalisierte mit einer Grimasse Unschlüssigkeit.
»Interessante Fälle sind mir in den letzten Jahren ja genügend untergekommen. An Anschauungsunterricht hat es mir auch nicht gefehlt. Bleibt bloß noch die Frage, wie man das zu Papier bringt. Wahrscheinlich wird es um einen mysteriösen Entführungsfall gehen. Vielleicht fällt mir noch etwas Packenderes ein.«
Ende der Fahnenstange. Ende und aus.
Adieu Hamsterrad? Adieu grauer Alltag? Von wegen! Grau war sein Redakteursdasein mit den sich tagtäglich abspielenden Dramen zu keiner Sekunde gewesen. Und ausgelaugt fühlte er sich auch nicht. Im Gegenteil. Hinter ihm fiel das Hauptportal des Zeitungsgebäudes ins Schloss. Der Knall hörte sich an wie der Startschuss in einen neuen Lebensabschnitt. Ein Jahr Auszeit vom Zeitungsjob, den er zwar mochte, aber zwölf Monate lang vermutlich nur gelegentlich vermissen würde. Ein Jahr den Rücken frei, um das lang geplante Buch zu schreiben. Ein Jahr nach eigener Maßgabe leben. Als überzeugter Junggeselle keine familiären Verpflichtungen wie der Chefredakteur. Knapp über dreißig, kerngesund und finanziell ziemlich unabhängig: geradezu ideale Voraussetzungen für ein zwangloses Sabbatjahr.
Florian schwang sich in den Fahrradsattel und strampelte gemächlich Richtung Hafen, ein Fluchtziel immer dann, wenn er den graugrünen Bodensee als Projektionsfläche für Unentschlossenheit, Trost oder Fernweh brauchte. Wahrscheinlich würde es am späteren Abend noch Regen oder ein Gewitter geben. Der Wind zerrte bereits an den Baumkronen und ließ vor einem Baumarkt die Werbebanner knattern. An einem Zebrastreifen stand eine Frau mit Kinderwagen. Irritiert registrierte Florian, dass sie exakt das gleiche kornblumenblaue Kleid trug wie die erhängte Leiche im Eriskircher Strandbad.
Zufall? Gab es überhaupt Zufälle? Für manche existierten keine Zufälle, für sie lief alles nach bestimmten Regeln ab. Pillepalle! Florian glaubte an keinen großen Strippenzieher, der die Menschen auf dem Planeten wuseln ließ wie Tamagotchis. Quasi per Fernbedienung. Seltsam, dass ihm gerade jetzt eine Frau im exakt gleichen Kleid über den Weg lief.
Vielleicht würde die Kornblumenfrau in seinem geplanten Roman auftauchen. Ob er wohl erst über eine grobe Rahmenhandlung nachdenken müsste? Oder eine Liste mit Hauptcharakteren entwerfen? Auf jeden Fall müsste die vollbusige Edelkurtisane Imperia, das Wahrzeichen von Konstanz, eine Rolle spielen. Die im Hafen errichtete Riesenskulptur hielt auf angewinkelten Armen zwei zwergenhafte, nackte Tatterknirpse in Händen, der eine mit Krone und Reichsapfel als Insignien weltlicher Macht, der andere mit päpstlicher Tiara als Symbol kirchlicher Autorität. Manchmal bedauerte Florian, dass er 1993, als die tonnenschwere Hure aufgestellt wurde, noch nicht beim »Seekurier« gearbeitet hatte. In bürgerlichen wie kirchlichen Kreisen rumorte es damals gewaltig, regte sich giftiger Widerstand gegen die aus Beton gegossene Schönheit. Was wäre das für ein Vergnügen gewesen, den Griffel gegen Spießbürgertum und kleinkarierten Mief zu spitzen!
Unbewusst hatten ihn seine Gedankenspiele durch die Altstadt ans Seeufer geleitet. Am altehrwürdigen Konzilgebäude stellte er sein Rad ab, weil sich zwischen Stadtgarten und Klein-Venedig Menschenmassen über die Hafenstraße schoben und an Radeln nicht einmal zu denken war. Ein alter Spruch, den er von seinem Vater kannte, fiel ihm ein: »Im Winter kommen die Nebel, im Sommer die Schwaben.« Hinter Absperrungen manövrierten Arbeiter einer Eventorganisation Berge von Ausrüstung mit Gabelstaplern durch die Gegend. Vorboten des traditionellen Konstanzer Seenachtfestes. Ein paar Momente lang überlegte er sich, seine Clique zu alarmieren, um in einer Kneipe sein Sabbatjahr gebührend einzuläuten. Dann wischte er den Gedanken weg. Zu sehr war er mit den Plänen für den neuen Lebensabschnitt beschäftigt.
Zu Hause angekommen, schloss Florian seine Wohnung im dritten Stock eines Altstadthauses auf und sah sich um wie ein Fremder. Die nächsten Wochen und Monate würde er größtenteils in diesen Wänden verbringen, die er jetzt seltsamerweise mit ganz anderen Augen sah. Zuweilen hatte er für den »Seekurier« zu Hause gearbeitet und seine Texte per E-Mail an die Redaktion geschickt. Jetzt wurde der Schreibtisch in seinem Wohnzimmer zum Dauerarbeitsplatz, an den er sich erst gewöhnen musste.
Monatelang hatte er die Idee eines Sabbatjahres vor sich hergeschoben, in schlaflosen Nächten Szenarien durchgespielt, von einem Roman geträumt, den er schreiben könnte. Jetzt saß er an seinem PC und spürte, wie ihn die leere Seite auf seinem Monitor hämisch, kritisch, geradezu herausfordernd mit einer Spur Feindseligkeit anglotzte und ihm die gehässige Botschaft suggerierte: »Du solltest dir nicht zu sicher sein, das zu schaffen, was du dir vorgenommen hast!«
In einem Anflug von Entschlossenheit langte er in die Tasten, um der unrühmlichen Schreibblockade zumindest mit dem Namen des Autors und dem Arbeitstitel des Romans ein Ende zu bereiten:
FLORIAN FALLER
»FALSCHE ZEIT, FALSCHER ORT«
Er starrte auf die ersten zwei Zeilen. Sein Megaprojekt hatte sich innerhalb weniger Augenblicke verändert, war weniger bedrohlich geworden. Verschwunden war das ablehnende, widerspenstige Weiß der ersten Seite. Ein Hoffnungsschimmer? Er wäre kein erfahrener Schreiberling gewesen, wenn er nicht daran geglaubt hätte. Aber Zuversicht war am Anfang immer ein dünnes Rinnsal.
Weil ihm nach der Drei-Zeilen-Ouvertüre nichts mehr einfiel, griff er zum Smartphone und rief Zoffinger an. Rein äußerlich war der Kriminaler ein Gemütsmensch Marke gütiger Großvater. Wasserblaue Augen, dünner Haarkranz um eine polierte Glatze, Schmerbauch. Wenn er intensiv nachdachte, klemmte er die Daumen unter seine Hosenträger – für Kriminelle, die mit ihm zu tun bekamen, Grund genug, sich warm anzuziehen. Denn der Eindruck täuschte. Zoffinger war ein Pitbull im Schaffell, einer, der sich an seinen Fällen festbiss, bis er sie gelöst hatte. Keine Lichtgestalt à la James Bond, sondern einer, der statt seiner Fäuste das Gehirn die Hauptarbeit erledigen ließ; einer, den jeder gnadenlos unterschätzte. Sein langes Berufsleben hatte ihm beigebracht, wo die Grenzen der Polizeiarbeit lagen. Ob er diese Grenzen beachtete, lag manchmal an seiner Tagesform, meist aber an der Art des Falles. Am schwersten hatten es bei ihm Kindermörder. Vor über zehn Jahren hatte er bei einem Autounfall seine Frau verloren und war seit damals in zweiter Ehe mit seinem Job verheiratet, eine geradezu ideale Beziehung.
Florian hatte Zoffinger noch nie zu Hause besucht, ohne dass der Hausherr ihm gut gekühlten Apfelmost angeboten hätte – in einem Behältnis, aus dem schon sein Vater und vielleicht sogar sein Großvater das Kultgetränk zu sich genommen hatten. Tradition hatte eben Tradition am Bodensee.
»Ich bin ein Saurier«, gestand Zoffinger einmal. »Ich stamme aus einer Zeit, in der die Menschen glücklicherweise noch nicht einmal wussten, wie man politische Korrektheit schreibt. Ich hoffe, dass ich ein solches Urviech bleiben werde. Ich hätte nichts dagegen einzuwenden.«
»Gibt es schon neue Erkenntnisse?«, wollte Florian am Telefon wissen.
»Natürlich gibt es neue Erkenntnisse«, brummelte der Kommissar. »Ich sitze auf meinem Balkon und habe mir gerade ein kühles Mostschorle eingegossen. Mein Jogginganzug ist bei der letzten Wäsche um eine Nummer geschrumpft. Jedenfalls zwickt mich der Bund. Ich muss mir demnächst etwas anderes anziehen.«
»Pass bloß auf, dass dir dein geliebter Freizeitlook nicht unwiderruflich am Body festwächst.«
»Kapuzenpullis und Undercut-Frisuren machen nicht automatisch Rebellen und Freidenker. Jogginganzüge machen nicht automatisch Spießbürger.«
»Gütiger Himmel! Ich halte dich für keinen Spießer.«
»Bin auch keiner. Ich spare auf keine Reihenhaushälfte. Ich halte die Missionarsstellung für keinen seelsorgerischen Job und Leberknödel für kein krankhaftes Organ.«
»Sehr witzig«, kommentierte Florian. »Eigentlich dachte ich bei meiner Frage an die erhängte Frau im Eriskircher Strandbad.«
»Ach so! Die erhängte Frau im Schwimmbad. Die hat in Eriskirch ein gut bürgerliches Dasein geführt, hat vermutlich im Kirchenchor gesungen und die Kehrwoche so bitterernst genommen, wie das im schwäbischen Grundgesetz und im Katechismus festgelegt ist.«
»Mehr hast du nicht zu bieten?«
»Was hinter der Tat steckt: keine Ahnung! Selbstmord scheidet wahrscheinlich aus. Eine Beziehungstat? Eher nicht. Wäre sie erschossen, vergiftet, erwürgt oder erschlagen worden – o.k. Aber wer hängt seine untreue Ehefrau oder Freundin aus Eifersucht an einem Sprungturm auf? Das ist doch völlig gaga.«
»Komm schon, Paul«, moserte Florian. »Ihr Ermittlungsraketen habt doch bestimmt schon ein paar aufschlussreiche Details herausgefunden.«
»Ich dachte, du hättest heute dein Sabbatjahr angetreten. Warum hackst du immer noch auf mir herum? Deinen Job beim ›Seekurier‹ macht jetzt doch ein anderer.«
»Der Fall interessiert mich, ob ich darüber schreibe oder nicht«, antwortete Florian.
»Mach mal halblang«, bremste Zoffinger die Neugier seines Gesprächspartners. »Seit wir die Frau vom Sprungbrett abgeschnitten haben, sind gerade mal ein paar Stunden vergangen. Jetzt liegt sie gut gekühlt in einem Leichenplastikbehälter in der Rechtsmedizin und wird zumindest bis morgen oder sogar bis am Montag warten müssen, ehe sich jemand mit ihr beschäftigt. Das einzig Auffallende: Sie trug sündhaft teure Ohrringe und Unterwäsche derselben Preiskategorie. Aber eigentlich dürfte ich dir das gar nicht erzählen. Auch nicht, dass wir Spuren von Schokolade an ihren Händen feststellten.«
Florian gaggerte los.
»Habe ich gelegentlich auch. So wie Millionen meiner Zeitgenossen, die sich am Abend vor der Glotze noch ein süßes Leckerli reinschieben. Was soll daran so besonders sein?«
»Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie als letzte Tat ihres Lebens einen Schokoladenkuchen gebacken. Oder sie war Gast bei einem Kindergeburtstag, bevor sie von ihrem Mörder ins Eriskircher Strandbad geschleppt und gemeuchelt wurde. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich mich jetzt gern meinem Feierabend widmen.«
Typisch Zoffinger, seines Zeichens Ein-Mann-Ermittler der Konstanzer Kriminalpolizei mit Sonderstatus, der es hasste wie die Pest, wenn ihm jemand in seine Arbeit hineinredete. Nicht dass er keine Kritik an sich herangelassen hätte. War er aber von einer Ermittlungsrichtung überzeugt, blieb er dabei und ließ sich von nichts und niemandem davon abbringen. Kein unbeseelter Einzelgänger, sondern ein durch und durch umgänglicher, gutmütiger Kerl Ende 50, nicht unbedingt ein Teamplayer, wenn man einmal von der Zuarbeit seiner Wasserträger im Kommissariat absah. Er war ein nachdenklicher Kombinierer und ein echtes Konstanzer Urgewächs, badischer Dickschädel und unbeugsame Kompromisslosigkeit inklusive.
Bei Florian blieb es an diesem Abend bei seinem Drei-Zeilen-Debüt, eine zugegebenermaßen extrem dürftige Performance, die ihm aber immerhin signalisierte: Ein Anfang war gemacht. Er hatte keine Ahnung, wie viele Artikel, Kommentare, Features und Reportagen er in seinem Berufsleben schon geschrieben hatte. Aber ein Buch? Ein Zweihundert- oder Dreihundert-Seiten-Projekt über zwölf Monate verteilt? Eine Geschichte, die stimmig, spannend und gut lesbar sein sollte? Das war eine andere Hausnummer.
Er schlief unruhig in dieser Nacht, träumte von einer Miniausgabe der Imperia, die hintergründig lächelnd wie die Mona Lisa an einer Hausfassade hing und statt der zwei Zwerge zwei Bücherstapel auf den ausgestreckten Händen balancierte. Vor dem Haus standen Frauen in kornblumenblauen Kleidern in einem riesigen, kniehohen Wasserbecken. Er selbst beobachtete die seltsame Szene entrückt wie aus einem Heißluftballon, der sich immer weiter vom Geschehen entfernte, bis schließlich nur noch ein dunkler Punkt übrigblieb.
Als unten auf der Straße ein paar Besoffene mit einem Mülleimer herumkickten, schreckte er aus seinen Träumen hoch. Hundemüde schleppte er sich in die Küche, schenkte sich ein Glas Mineralwasser ein und schaltete das Radio an. Langweiliges Nachtprogramm von Radio Grenzland. Nach einem Bericht über die Nachtarbeit auf einer städtischen Sozialstation war Rolf Riedle zum Thema Heiraten am Mikrofon. Offenbar hatten die Programmmacher ein paar alte Tonkonserven ausgepackt, weil um diese Nachtzeit ohnehin kaum jemand vor dem Radio saß.
Florian fasste sich an die Stirn. Da hatten die Redakteure genau den Richtigen für dieses Thema ausgesucht. Riedle gehörte zu seinem erweiterten Freundeskreis und war Junggeselle wie er selbst. Zusammen mit einer Clique unbeirrbarer Spinner und rebellischer Feministinnen lebte er in einer ehemaligen abbruchreifen Metzgerei mit dem Namen Kommune X, die das Chaos zum Maß aller Dinge erhoben hatte. Obwohl erst Anfang 30, zierte ihn bereits eine Halbglatze, die er dadurch zu kaschieren versuchte, dass er sich schulterlange Strähnen von der linken Haarkranzseite quer über seine Platte legte. Ein geradezu kosmetisches Abenteuer. Aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Das merkte man auch an den erotischen Gemälden, mit denen der talentfreie Freizeitmaler Riedle sein Kommunenzimmer dekoriert hatte.
Ich bin Rolf Riedle und möchte zum Thema »Heiraten gestern und heute« einige Gedanken beisteuern. Im Mittelalter waren arrangierte Hochzeiten üblich und besonders in besseren Kreisen nicht von Gefühlen getrieben, sondern durch wirtschaftliche und politische Interessen motiviert. Adelsfamilien arrangierten Hochzeiten, die primär dazu dienten, sich Besitztümer unter den Nagel zu reißen, verfeindete Klans zu versöhnen und Kriege zu führen oder zu vermeiden.
»Das hat er garantiert von Wikipedia abgeschrieben«, dachte Florian und nahm einen Schluck.
Am Morgen nach der Hochzeitsnacht erhielt die Braut von ihrem Mann traditionell ein wertvolles Geschenk, die sogenannte Morgengabe (fuhr Riedle fort). Dabei handelte es sich etwa um eine Perlenkette, eine Käsereibe oder einen Gutschein für einen dreijährigen Volkshochschulkurs zum Thema »Wie parke ich meine Pferdekutsche rückwärts ein?« Im Gegensatz zu diesen alten Zeiten verlieben sich junge Leute heute spätestens zu dem Zeitpunkt, an dem sie den Schnuller gegen die Öffnung einer Alkopop-Flasche tauschen. Sie pflegen vergnüglich interaktive Turnübungen, die früher einzig und allein der Arterhaltung dienten. Häufig lebt die junge Generation ohne Trauschein in wilden Kommunen und geht den Bund der Ehe erst ein, nachdem die eigenen Sprösslinge die erste Rentenberechnung beantragt haben.
Statistisch betrachtet stieg das Heiratsalter in den letzten Jahren beständig an und liegt heute bei Männern bei 32,6 Jahren und bei Frauen bei 29,6 Jahren. Was lernen wir daraus? Gar nix! Aussagekräftiger ist die Tatsache, dass bei Töchtern die ersten Symptome von Torschlusspanik auftreten, lange bevor sie von ihren Müttern dazu gezwungen werden. Söhne schulden ihre Testosteronsteuerung nicht nur ihren vorprogrammierten Genen, sondern auch ihren vor Potenzgehabe strotzenden Vätern, die sich vor ihren verwunderten Nachkommen unterschwellig gerne als Beglücker ganzer Erdteile präsentieren. Übrigens: In der spanischen Sprache ist der Begriff für Ehefrauen und der Begriff für Handschellen identisch – las esposas …
Florian schaltete das Radio aus. Unverdauliche Kost für seine Ohren um diese Nachtzeit. Die restliche Heiratsaufklärung vom Beziehungsexperten Rolf Riedle bekam er nicht mehr mit. Er wankte zurück in sein Schlafzimmer und ließ sich hundemüde in die Kissen fallen.
Während die Rechtsmediziner mit der toten Kornblumenfrau beschäftigt waren, grasten Zoffingers Leute ganz Eriskirch samt Umgebung ab, um die Identität der Ermordeten herauszufinden. Vermisstenmeldungen hatten zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt. Den entscheidenden Treffer landeten die Spezialisten von der kriminaltechnischen Untersuchung. Ihnen waren die exquisiten Schuhe der Toten aufgefallen, handgefertigte Ballerinas eines italienischen Herstellers. Im Bodenseekreis wurden sie in nur zwei Läden verkauft, einem in Friedrichshafen und in einer Boutique in Ravensburg. Dort war die Frau mit dem Namen Judith Sommer Stammkundin und hatte sich Schuhe zum Anprobieren schon mehrfach nach Hause liefern lassen. In den Falkenrainweg 7 in Eriskirch.
Als Zoffinger an der Adresse in dem aufgeräumten Wohngebiet ankam, hatten sich seine Kollegen bereits Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Das Gebäude lag direkt an der Straße, der dahinterliegende Garten reichte bis an das Ufer der durch den Ort fließenden Schussen. Persönlichen Unterlagen zufolge war die 36 Jahre alte Wohnungsinhaberin von Beruf Modedesignerin und hatte jahrelang für ein Mailänder Unternehmen gearbeitet, aus dem sie vor zwei Jahren ausgeschieden war. Offensichtlich lebte sie alleine. Jedenfalls stand im Bad nur eine einsame Zahnbürste. Auch sonst gab es keine Hinweise auf eine zweite Person. Ein Festnetztelefon existierte nicht, ein Smartphone lag auch nirgends herum. Aber in einem Karton in einer Abstellkammer war ein offenbar ausgedientes Handy entsorgt. Zoffingers technische Hilfstruppen erweckten es zum Leben und konnten das Telefonverzeichnis auslesen. Weder Einbruchsspuren noch durchwühlte Schränke oder Schubladen. Keinerlei Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen; nichts, was auf eine Gewalttat hätte schließen lassen. Auf dem Wohnzimmertisch lag ein Kündigungsschreiben an ihren Vermieter mit dem Hinweis auf einen Umzug in eine Eigentumswohnung nach Konstanz. Die Beamten gingen in der Nachbarschaft Klinkenputzen und fanden heraus, dass man sie in der Gemeinde so gut wie nie gesehen hatte.
»Klar«, meinte eine Nachbarin, »wir haben uns gegrüßt, wenn wir uns auf der Straße zufällig begegnet sind. Häufig kam das allerdings nicht vor. Ich vermute, dass sie lieber zurückgezogen lebte. Wer's mag …«
Also keine Anhaltspunkte auf ein Verbrechen in der Eriskircher Wohnung – bis die Spürnasen im Keller auf eine Seilrolle stießen, von der ein Stück abgeschnitten worden war. Auf der Kellertreppe fanden sich Schleifspuren. Zoffinger erinnerte sich an die Kratzer an den Waden der Frau. Wahrscheinlich war sie im Keller erdrosselt und dann rücklings die Treppe hinaufgezogen worden. Aber wie war sie ins Strandbad gebracht worden? Über die durch Äcker und Felder führende Riedstraße bis zum Parkplatz beim Bad? In einer Wohngegend wie dieser eine Leiche in ein Auto zu verfrachten, wäre selbst bei Nacht und Nebel ein riskantes Unternehmen gewesen. Die Gefahr, von Spätheimkehrern, Schlafwandlern, Albtraumgeplagten und Rentnern, die mitten in der Nacht zum Pinkeln müssen, entdeckt zu werden, wäre zu groß gewesen.
Der Kommissar trottete von der Terrasse der Erdgeschosswohnung in den ungepflegten Garten hinaus. An manchen Stellen stand das Gras hüfthoch. Ein Sturm hatte von einem Baum einen mächtigen Ast abgerissen, der von Moos überwuchert wie eine seltsame Skulptur auf dem Boden lag. An der Böschung zum Flussufer machte das Terrain einen völlig verwilderten Eindruck, als hätte sich seit Jahren niemand mehr um die Bäume und Büsche gekümmert. An einer Stelle führte ein nicht mehr genutzter Trampelpfad direkt ans Wasser auf eine kleine, morsche Plattform. Eine bessere Möglichkeit, eine Leiche von dem Anwesen abzutransportieren, gab es nicht. Am Ufer der Schussen lagen mehrere alte Holzkähne vertäut. Die ermordete Frau auf diese Weise ins Strandbad zu bringen, bot sich geradezu an. Ein Seitenarm des Flüsschens machte in der Nähe des Schwimmbads eine große Schleife. Ein kräftiger Mann wäre durchaus in der Lage gewesen, die Leiche von dort bis ins Strandbad zu tragen. Oder man hätte sie durch die Flussmündung in den Bodensee bis ins Bad transportieren können, das nur etwa einen halben Kilometer entfernt lag.
Was Zoffinger aber noch mehr als der Transport interessierte, war die Frage, warum der oder die Täter sie nicht einfach im Keller ihres Hauses hatten liegen lassen. Sie am Sprungturm aufzuhängen, war aufwändig, von einem einzigen Täter kaum zu schaffen und barg außerdem das Risiko, dass jemand die bizarre Aktion mitbekam. Eines war klar: Es handelte sich um keinen normalen Mord, sondern um ein Gewaltverbrechen mit einer Botschaft, eine unmissverständliche Warnung, als hätten die Täter in die Öffentlichkeit trompeten wollen: »Seht alle her! So kann es jemandem gehen, der uns in die Quere kommt.« Die Lösung des Rätsels – darüber bestand bei Zoffinger kein Zweifel – lag im Umfeld der Frau, hatte mit ihren Kontakten zu tun. In dieser Dunkelzone würde er Antworten finden.
Am folgenden Tag raffte er sich trotz aller inneren Widerstände auf und stiefelte in die Rechtsmedizin, um sich nach eventuell ersten Ergebnissen der Obduktion zu erkundigen. Selbst nach Jahrzehnten im Polizeidienst hatte er sich an das Totenreich noch nicht gewöhnt, in der die Grünkittel ihre Arbeit verrichteten. Institutsleiter Dr. Ulrich Herrlinger hatte sich beim Segeln den Arm gebrochen und ließ sich durch einen Kollegen vertreten, der so blass und ausgezehrt aussah, dass er auf dem Seziertisch vermutlich eine bessere Figur gemacht hätte als aufrecht stehend daneben.
»Und? Irgendetwas Erhellendes?«
Der Forensiker schüttelte den Kopf.
»Nicht wirklich. Alles im grünen Bereich. Eigentlich keine Auffälligkeiten. Ein Drogenjunkie war sie jedenfalls nicht.«
Zoffinger war bereits auf der Flucht aus der gekachelten Schreckenskammer, als ihm die Halbleiche hinterherrief:
»Eines noch. In ihrem Nacken haben wir ein kleines Tattoo gefunden. Sieht aus wie eine Abbildung mit einer längeren und zwei kürzeren Spitzen. Wir haben nachforschen lassen. Mit Erfolg. Es handelt sich um einen stilisierten prähistorischen Haifischzahn. Diese durch Gezeitenströme und Brandungswellen ausgegrabenen Beißerchen von Urzeithaien findet man hauptsächlich am niederländischen Nordseestrand zwischen den Küstenorten Cadzand und Nieuwvliet. Man bezeichnet die Souvenirstücke auch als ›schwarzes Gold von Cadzand‹. Manche Leute tragen sie als Glücksbringer.«
»Hat ihr offenbar nicht viel genützt«, dachte der Kommissar, als er mit langen Schritten aus der Rechtsmedizin ins Freie stürmte, wo ihn ein sanfter Regenschauer im Diesseits begrüßte und daran erinnerte, dass es auch ein Leben vor dem Tod gab.
2TATORT INSEL REICHENAU
Das Gewaltverbrechen rüttelte die Insel Reichenau durch wie ein Erdbeben mittlerer Stärke. Fassungslosigkeit, wohin man schaute. Auf dem Münsterplatz standen Leute beieinander, die bereits von der scheußlichen Tat erfahren hatten, die sich wie ein Lauffeuer in Mittelzell verbreitete. Vor der Touristeninformation in der Pirminstraße wartete eine Gruppe französischer Besucher auf den Bus und konnte sich die seltsame Hektik nicht erklären, in die der sonst beschauliche Inselort über Nacht verfallen war. Normalerweise tratschten die Leute über die Wetterprognosen für die nächsten Tage, über die missratenen Kinder in der Nachbarschaft oder gaben mehr oder minder interessierten Gesprächspartnern die letzten persönlichen Gesundheitsbulletins bekannt. Aber an diesem Tag war alles anders. Was in der Nacht zuvor im Kräutergarten beim Münster St. Maria und Markus in Mittelzell passiert war, sprengte jede Vorstellungskraft.
Kriminalhauptkommissar Paul Zoffinger machte sich in seinem Büro eben über ein fingerdick mit Leberwurst bestrichenes Vesperbrot her, als sein Telefon bimmelte. Eine Entgleisung, fast schon ein Sakrileg, weil jeder im Amt wusste, dass Paul, wie er von seinen Kollegen genannt wurde, zwischen 9 Uhr und 9.10 Uhr die Welt anhielt, keine Kapitalverbrechen duldete und für solche Delikte auch zehn Minuten lang nicht zuständig war. Schließlich gab es für archaische, erdnahe und durch und durch bodenständige Menschen wie Zoffinger im Leben noch ein paar wichtigere Sachen als Mord und Totschlag.
»Wer stört?«
Drei, vier Atemzüge später.
»Entschuldigen Sie bitte! Ich dachte, dass mich einer meiner Kollegen nervt.«
Gespannt lauschte er in den Hörer seines Festnetztelefons. Mit einer geradezu zeremoniellen Bewegung legte er das Pausenbrot auf das Papier zurück, aus dem er es eben ausgewickelt hatte.
»Qualität hat einen Namen: Metzgerei Forster« stand darauf in einem symbolisierten Erntekranz aus dicken Würsten.
»Klostergarten beim Münster in Mittelzell? Habe ich das richtig verstanden? … Gut. Ich bin in einer halben Stunde da. Lassen Sie alles so, wie es ist. Rühren Sie nichts an.«
Ein toter Mönch im Klostergarten in Mittelzell auf der Insel Reichenau. Der Tag fing ja gut an. Allen Anzeichen nach Opfer einer Gewalttat. In Sekundenschnelle schoss dem Hauptkommissar der grauenhafte Mord im normannischen Städtchen Saint-Étienne-du-Rouvray im Jahr 2016 durch den Kopf, als zwei junge Männer einem Geistlichen während einer katholischen Messe die Kehle durchtrennten. Aber ein islamistischer Terroranschlag dort, wo Ökobauern und Tomatenzüchter die Tagesabläufe bestimmten? Ein Attentat in der idyllischen Bodenseeprovinz mitten zwischen Salatäckern, Gurkenplantagen, Rebgärten und Gewächshäusern? Undenkbar. Oder doch nicht?
Am Stadtrand von Konstanz bog er in den auf die Insel Reichenau führenden Damm ein – eine fast schnurgerade Pappelallee durch ein undurchdringliches Schilfgelände. Schwungvoll rutschte bei einem Bremsmanöver sein mitgebrachtes Vesperbrot vom Beifahrersitz. Er ließ es im Fußraum liegen, weil er die Fahrt nicht an einem der Alleebäume vorzeitig beenden wollte. Im Autoradio dudelte Diskomusik aus den 80er-Jahren. Er wollte das Geheule schon abdrehen, als die Moderatorin einen Bericht über einen aktuellen Einsatz der Verkehrspolizei ankündigte. Rolf Riedle berichtete aus dem Stadtzentrum in Konstanz.
Heute Vormittag gegen 22.30 Uhr ist es auf der Marktstätte zu einem polizeibekannten Vorfall gekommen. Ein in der örtlichen Vollzugsanstalt einsitzender Wärter konnte bei einem Freigang offenbar einen Häftling überlisten und mit einem als Geisel genommenen Fahrrad eines zufällig in der Nähe befindlichen Metzgereigehilfen fliehen. Wohin, sagte er nicht. Das Motorrad wurde später auf der Marktstätte aufgefunden. Am Chassis, am linken Vorderreifen und am Kofferraum wurden DNA-Spuren gefunden, die aber bislang nur unmenschlichen Ursprüngen zugeordnet werden konnten. Die Polizei war sehr schnell vor Ort, obwohl sie von ihrem Einsatz überhaupt nichts wusste. Und das trotz der Entfernung zum Tatort, der ja nicht in Helsinki oder Abu Dhabi liegt, sondern mitten in Deutschland. In einem uneinsichtigen Hinterhof machte die Polizei einen möglichen Komplizen dingfest. Nach dem Grund seines Daseins befragt, verneinte er. Der Täter wurde von den Sicherheitskräften weiträumig abgesperrt und der Tatort von den Beamten außer Gefecht gesetzt.
Himmelherrgott! Zoffinger bearbeitete sein Lenkrad mit der Faust. Muss man sich einen solchen Stuss gefallen lassen? Hat dieser Ignorant zu tief in einen Haschtopf gelangt oder will er seine Zuhörer auf den Arm nehmen? Florian hatte schon ein paar Mal von Riedle erzählt, der zum Teil bizarre Reportagen ablieferte, mit denen er sich bei offensichtlich minderbemittelten Hörern eine gewisse Reputation erarbeitet hatte. Der Kommissar holte tief Luft. Wieder einmal eine Nahidioterfahrung.
Er parkte beim Münster in Mittelzell und rätselte noch immer darüber, wer einen Mönch auf der Reichenau warum umbringen könnte. Ein Zufallsopfer? Irrsinnige, Verblendete, Unzurechnungsfähige und Bekloppte liefen in Mengen auf den Straßen herum. Rache? Aber für was? Zwischenmenschliche Spannungen? Die Reichenau war alles andere als ein sozialer Brennpunkt, kein Scherbenviertel, von einem Getto so weit entfernt wie der Vatikan. Kirchenhass? Aber warum würde sich ein Täter einen Kräutergarten aussuchen und keinen Schauplatz mit größerer Symbolkraft?
Zwei uniformierte Polizeibeamte waren damit beschäftigt, den innerhalb einer mannshohen Natursteinmauer liegenden Garten mit Plastikbändern abzusperren. Grüppchen von Einwohnern standen mit betretenen Gesichtern herum, tuschelten, entwarfen abstruse Verschwörungstheorien und bizarre Mordszenarien. Aber kein Katastrophentourismus, eher lähmendes Entsetzen über ein unbegreifliches Verbrechen. Quasi vor der eigenen Haustür.
»Der Bürgermeister kann Sie leider nicht begrüßen, weil er in Urlaub ist«, empfing ein Mann mittleren Alters Paul Zoffinger und drückte ihm die Hand wie jemand, der mit landwirtschaftlichem Gerät mindestens so gut umgehen kann wie mit einer PC-Tastatur. »Willy Leuthold, Gemeinderat der Gemeinde Reichenau.«
»Seit ewigen Zeiten wohne ich in Konstanz«, gestand Zoffinger. »Aber auf der Reichenau war ich seit Langem nicht mehr. Dennoch pflege ich innige Beziehungen mit der Insel. Auf dem Sankt-Stephans-Platz, nicht weit von meiner Stadtwohnung entfernt, versorge ich mich fast jeden Freitag mit Inseltomaten. Gelegentlich mit einem Fläschchen Kerner, auch von der Reichenau. Was mir auf der Fahrt hierher aufgefallen ist: Rebflächen sieht man wenig.«
»Die Zeiten ändern sich«, antwortete Leuthold. »Wie Sie vielleicht wissen, war die Reichenau früher in erster Linie ein Weinproduzent. Bis ein Frost den Rebstöcken Ende der 1920er-Jahre den Garaus machte. Die Bauern rissen alles aus und fingen mit dem Gemüseanbau an, um nicht mehr nur allein vom Wein abhängig zu sein. Heute werden wieder auf knapp 20 Hektar Fläche Sorten wie Gutedel, Müller-Thurgau, Blauer Spätburgunder, Muskateller und Kerner angebaut.«
Einer der Polizisten hob das Absperrband hoch, um die beiden Männer in den Kräutergarten zu lassen.
»Strabos Kräutergarten«, erklärte Leuthold und machte eine ausladende Handbewegung. »Kennen Sie die Geschichte?«
»Die kennt jeder Konstanzer, zumindest jeder Konstanzer Gartenfreund. Der vom Reichenauer Abt Walahfrid Strabo im 9. Jahrhundert verfasste ›Hortulus‹ war schließlich der erste Gartenratgeber Europas, ein botanisches Frühwerk über diesen Kräutergarten in Versform. Wenn ich mich recht erinnere, beschrieb er 23 Heilpflanzen und erläuterte, welchen Zwecken sie dienen können. Richtig?«
»Hoppla!«, staunte der Gemeinderat. »Offensichtlich haben Sie in der Schule gut aufgepasst.«
»Irrtum«, antwortete Zoffinger augenzwinkernd. »Vor ein paar Wochen fiel mir per Zufall ein Bodenseereiseführer in die Hände.«
Der kleine Klostergarten bestand aus einer akkuraten Anordnung von schmalen Beeten, getrennt durch eselgraue Kieswege. Nicht ganz Zoffingers Gartenfavorit, der eher üppige, ausufernde und leicht verwilderte Grundstücke mochte, in denen nicht Harke und Schaufel, sondern die Natur selbst Regie führte. Weiße Täfelchen benannten die jeweiligen Kräuter und ihre lateinischen Namen.
Mitten in einem der Beete erhob sich ein aus zwei groben Holzbalken gezimmertes Kreuz. Ausgebuddelte Erde lag verstreut auf dem Weg, Pflanzen waren zertrampelt. Allzu viel Zeit hatte sich der Täter für sein »Werk« ganz offensichtlich nicht genommen, weil das Kruzifix ziemlich schräg im Boden steckte. Auf die Balken war ein Bischofsgewand aus rotem, samtartigem Stoff mit goldenen Borten getackert, wahrscheinlich ein zweckentfremdetes Nikolauskostüm. Darüber eine von bunten batteriegespeisten LEDs umrandete Mitra, aus Karton gebastelt und mit rotem und goldfarbenem Stoff überzogen. Zwei Schritte entfernt lag der tote Mönch in brauner Kutte halb im Beet und halb auf dem Kiesweg, der die Salbei-, Liebstöckel-, Kerbel- und Rettichbeete voneinander trennte. So richtig tot sah er eigentlich nicht aus. Eher wie einer, der beim Unkrautjäten hingefallen und nicht mehr hochgekommen war. Die schräg einfallende Morgensonne beleuchtete sein stoppelbärtiges bleiches Gesicht wie ein Theaterspotlight. Beim Sturz war ihm der untere Saum seiner Kutte hochgerutscht und gab die mageren Unterschenkel und die Füße frei, die in schwarzen Socken und Gesundheitssandalen mit Klettverschlüssen steckten.
»Wir haben nichts angefasst«, stotterte einer der Polizisten, als ihm Zoffinger einen fragenden Blick zuwarf.
Er drehte den Toten auf die Seite. Unter seinem Rücken war eine Blutlache so groß wie zwei Handflächen bereits im Boden versickert. Den Rest hatte sein dicker Habit aufgesogen. Die Ursache der Stichverletzung war schnell klar. Einer der Polizisten fand unter einer Hecke ein Messer mit einer langen, schmalen Klinge.
»Ein Schuss wäre aufgefallen«, sagte Zoffinger mehr zu sich selbst. »Einen Messerstich kriegt niemand mit.«
»Mein Gott«, jammerte Leuthold. »Ein so widerwärtiges Verbrechen an einem Ort der Besinnung und Ruhe. Unfassbar! Einfach unfassbar!«
»Kennen Sie den Kuttenträger?«
»Natürlich kenne ich ihn. Jeder in Mittelzell kennt ihn. Das ist Bruder Aurelius von der Mönchsgemeinschaft Strabo-Haus.«
»Ich bin nicht bibelfest«, gestand Zoffinger. »Aber wenn ich mich nicht täusche, existiert das Kloster Reichenau schon seit über 100 Jahren nicht mehr. Warum gibt es hier überhaupt noch Mönche?«
»Das Kloster gibt es seit 250 Jahren nicht mehr«, korrigierte ihn Leuthold. »Es wurde 1757 aufgelöst. Vor knapp 20 Jahren gründete eine Gruppe von Mönchen im Auftrag ihres Mutterklosters eine neue Klostergemeinschaft auf der Reichenau. In Anknüpfung an die historische Tradition der Insel sollte sie für neue monastische Aktivitäten sorgen.«
»Also eine klösterliche Zweigstelle. Und was genau machen die Mönche hier?«
»Zwei von ihnen, Bruder Petrus und Bruder Sebastian, beschäftigen sich mit der Restaurierung wertvoller Bücher und Manuskripte aus der alten Klosterbibliothek. Zwei andere, mit denen wir von der Ortsverwaltung öfters zu tun haben, kümmern sich um administrative Fragen.«
»Und Bruder Aurelius?«
»Ich persönlich hatte eigentlich nie mit ihm zu tun«, meinte der Leuthold. »Man grüßte sich, wenn man sich auf der Straße begegnete … Wofür er im Strabo-Haus zuständig war, weiß ich offen gestanden nicht.«
»Kein Problem«, winkte Zoffinger ab. »Ich muss mich bei den Herren Mönchen ohnehin noch umsehen. Haben Sie je etwas von Streitigkeiten in diesem Strabo-Haus oder Problemen zwischen den Mönchen und den Einwohnern mitbekommen?«
»Die Strabo-Mönche gehören zur Inselfamilie, wenn man das so sagen darf«, meinte Leuthold. »Probleme gab es meines Wissens nie. Das sind freundliche, hilfsbereite Männer, die bestens in unsere Gemeinschaft integriert sind und die hier jeder schätzt. Fast jeder.«
»Können Sie mir das ›fast‹ näher erläutern?«
»Hier läuft ein Kerl herum, der schon einige Male mit sonderbaren Aktionen aufgefallen ist. Dass er alles Kirchliche hasst, kann und will er nicht leugnen.«
»Hat er auch einen Namen?«
»Bodo Weihstock. Ein junger Kerl, nicht einmal unsympathisch, aber irgendwie von einem anderen Stern.«
Der Kommissar drehte sich zu dem Holzkreuz um.
»Ich habe zwar schon davon gehört, dass antireligiöse Fanatiker Gipfelkreuze auf Bergen gefällt haben. Aber von so etwas wie dem hier habe ich noch nie etwas mitbekommen. Die welken Pflanzenbüschel an den Seitenarmen des Kreuzes sehen nicht aus, als seien sie zwecks Dekoration angebracht worden. Scheint dasselbe Kraut zu sein, das auch um den Toten herumdrapiert wurde.«
Leuthold wusste Bescheid.
»Christliche Symbolik spielte bei der Anlage solcher Kräutergärten immer eine große Rolle. Da haben wir auch großen Wert daraufgelegt, als wir den Garten 1991 nach dem historischen Vorbild von Walahfrid Strabo neugestalteten. Das Johanniskraut am Kreuz und um den Toten diente den Menschen früher zum Zweck, finstere Mächte abzuwehren und sich vor Dämonen und Zauberei zu schützen.«
»Bei Bruder Aurelius hat das Kraut eklatant versagt«, stellte Zoffinger fest. »Kommt mir vor, als sei diese Symbolik ad absurdum geführt oder geradezu verhöhnt worden. Allein schon durch diese beleuchtete Mitra!«
Der Kommissar erinnerte sich an einen alten Film des italienischen Regisseurs Federico Fellini. In einer aberwitzigen Szene führten Schauspielerinnen und Schauspieler auf Rollschuhen und Fahrrädern extravagante Mode für Nonnen, Messdiener, Priester, Bischöfe und Päpste vor, unter anderem mit beleuchteten Mitras und Tiaras. Auf eine gewisse Art und Weise belustigte ihn die am Holzkreuz befestigte Bischofsmütze, wenngleich er den Mord an dem Mönch für eine durch und durch verabscheuungswürdige Tat hielt. Zoffinger behielt das aber für sich, weil er nicht wusste, wie Leuthold religiös gepolt war.
»Die Menschen auf der Reichenau waren aufgrund der Geschichte schon immer stark mit dem Christentum verbunden«, meinte der Gemeinderat. »Einen Mord in einem Klostergarten und so ein Kreuz verstehen die Leute nicht nur als Vandalismus, sondern als einen Anschlag auf ihre christlichen Werte. Sie müssen den oder die Täter kriegen. Mit allen Mitteln. Sollten wir vielleicht eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausloben, wie es im Kino und im Fernsehen immer so schön heißt? Eine Geldprämie? Oder einen Gratisflug mit dem Zeppelin über den Bodensee?«
»Langsam, langsam«, beruhigte ihn Zoffinger. »So schnell wird an der Polizeifront nicht geschossen. Lassen Sie uns erst einmal unsere Arbeit machen. Ich kann Ihnen zwar nichts versprechen. Aber ich bin mir sicher, dass wir diese Bluttat aufklären und den oder die Täter zur Rechenschaft ziehen.«
Er wandte sich an die beiden Polizisten.
»Hat jemand vergangene Nacht im Dorf etwas Ungewöhnliches mitbekommen? Schreie, seltsame nächtliche Umtriebe, Personen, die zu später Stunde unterwegs waren?«
Die beiden Uniformträger zuckten mit den Schultern. Dann fiel dem Gemeinderat etwas ein. Ein Bauer hatte ihm erzählt, dass er gegen zwei Uhr auf dem Heimweg von einer Hochzeit war. Aus einiger Entfernung waren ihm die leuchtenden LEDs der Mitra aufgefallen. Weil er aber nach der feuchtfröhlichen Feier zu müde war, hatte er sich nicht um die seltsame Beleuchtung gekümmert. Entdeckt hatte den Toten gegen 7 Uhr morgens ein Pennäler. Auf dem Weg in die Schule hatte er sein Moped am Kräutergarten angehalten, um seiner Freundin aus einer neben dem Garten liegenden Blumenwiese eine Sonnenblume zu klauen.
»Gibt es auf der Insel einen Holzhandel? Irgendwo muss sich der Täter die zwei Balken für das Kreuz besorgt haben. Macht euch im Dorf schlau, ob jemand solche Hölzer vermisst.«
Zoffinger überließ den Kräutergarten seinen Kollegen von der Spurensicherung, die mittlerweile die Regie am Tatort übernommen hatten. Auf Tritt- oder Fahrspuren konnte man kaum hoffen, weil es seit Tagen nicht mehr geregnet hatte und der Boden steinhart verbacken war. Aber irgendetwas ließ sich immer finden. Er rief im Kommissariat bei seinen Schreibtischkollegen an und ordnete an, alles an Informationen über den toten Mönch zusammenzutragen. Wichtig war, einen ersten Anhaltspunkt, ein erstes Puzzleteilchen zu finden, um die Ermittlungen überhaupt in Gang zu bringen.
Die Mönchsgemeinschaft Strabo-Haus residierte in einem zweigeschossigen Gebäudetrakt des ehemaligen Klosters. Durch einen langen Gang, in dem es nach Weltabgeschiedenheit, Weihrauch und Parkettpflegemittel roch, erreichte Zoffinger einen Raum, durch dessen halb geöffnete Tür Gebetsgemurmel drang. Fünf Mönche knieten vor einem Wandaltar mit brennenden Kerzen und einem Bronzekreuz, um das ein Trauerflor gewunden war. Zoffinger räusperte sich, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Wir sind erschüttert und können uns diese frevelhafte Tat nicht erklären«, meinte Bruder Michael, dem Entsetzen und Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben standen. »Bruder Aurelius war zwar erst seit eineinhalb Jahren bei uns. Aber seine Tatkraft und Entschlossenheit, sein Engagement für unsere Sache wird uns fehlen.«
»Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen?«
»Um 19 Uhr haben wir die letzte gemeinsame Gebetszeit. Danach ist jeder von uns auf sein Zimmer gegangen. Aurelius auch.«
»Hat jemand von Ihnen mitbekommen, dass er gegen später das Haus verlassen oder Besuch bekommen hat? Eine Ahnung, was er mitten in der Nacht im Kräutergarten zu suchen hatte?«