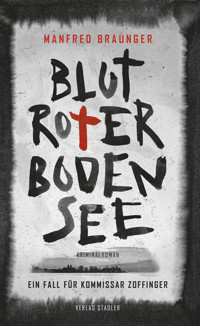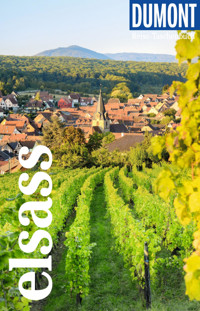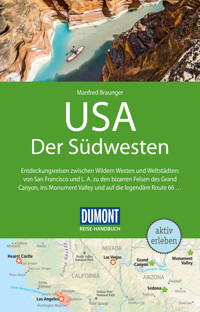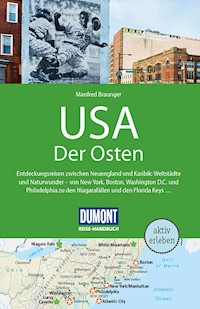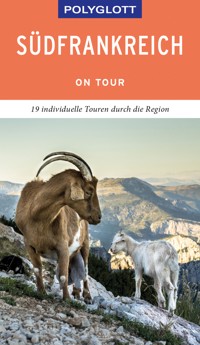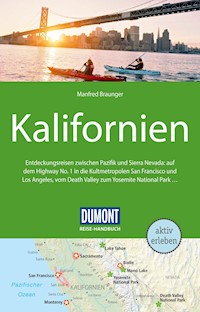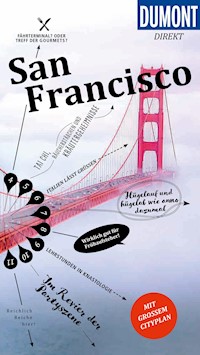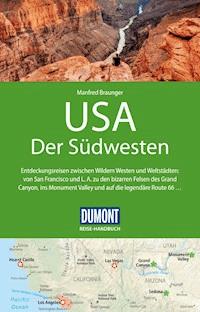Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Stadler
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mit rätselhaften Fällen hatte es der Konstanzer Kommissar Paul Zoffinger schon häufiger zu tun. Der Tod einer Urlauberin am Reichenauer Seeufer durch eine Riesenschlange hätte aber grotesker kaum sein können. Fast zeitgleich verschwindet der Fahrer eines Kleinlasters von der Fähre zwischen Meersburg und Konstanz. Bei der Durchsuchung der Ladung findet die Spurensicherung nicht nur mehrere Behälter mit lebenden, streng geschützten Fischarten. In gut getarnten, doppelten Böden versteckt sich in Plastik eingeschweißtes, getrocknetes Delfinfleisch. Eine streng verbotene, aber höchst profitable Delikatesse für den Schwarzmarkt, deren Zielort Zoffinger bei einem Undercover-Einsatz auf den Grund geht. Eine neue Wendung nehmen die Ermittlungen mit der Notlandung eines Kleinflugzeugs auf dem Bodensee. Drei der vier Passagiere sind verschwunden. Unter ihnen der eiskalte Geschäftsmann Balodis, der in einem alten Kieswerk am Seerhein illegalen Medikamentenhandel betreibt. Eine heiße Spur führt Zoffinger zu einem versteckten Anwesen auf der Höri. Gelingt es dem kauzigen Zoffinger mit seinen eigenwilligen Ermittlungsmethoden, all die Machenschaften zu stoppen und die skrupellosen Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MANFRED BRAUNGER
EISKALTER BODENSEE
Grafik/Umschlag: Manuel Pollanka – Irgendwas mit Grafik, Deizisau
Satz: Satzteam Dieter Stöckler, Konstanz
Gesamtherstellung: Dardedze Holografija, Riga
Bildnachweis Umschlag:
Foto © bodenseebilder.de, Konstanz/Fähre und Säntis
Verlag und Vertrieb:
Stadler Verlagsgesellschaft mbH
Max-Stromeyer-Straße 172
78467 Konstanz
www.verlag-stadler.de
3. Auflage 2024
© Copyright by
Verlag Friedr. Stadler GmbH & Co. KG, Konstanz
Die Wiedergabe oder die Veröffentlichung der Texte und Bilder des Buches ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herausgebers oder des Verlages gestattet. Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
isbn978-3-7977-0756-7
eisbn978-3-7977-5103-4
Inhalt
1 KEIN FALL WIE JEDER ANDERE
2 DINNER BIZARR
3 RISKANTE LANDUNG
4 EIN COLD CASE NAMENS MARIE
5 DIE SCHLINGE ZIEHT SICH ZU
6 POTENZPILLEN UND TIGERKNOCHEN
7 EINE DUBIOSE KOMMUNE
8 AMOURÖSES ABENTEUER MIT FOLGEN
9 TOD IM PARKHAUS
10 GIFTIGE SPUREN
11 RÄTSELHAFTER SCHWELIN-KASSIBER
12 VERSTECKTE ALCHEMISTENKÜCHE
13 SCHRÄGER FREISTAAT REICHENAU
14 ENDE EINER FLUCHT
»Mordermittlungen sind wie Abiprüfungen. Wenn es richtig beschissen läuft, hilft auch kein Spickzettel.«
Kommissar Paul Zoffinger
1KEIN FALL WIE JEDER ANDERE
Mit einer Mischung aus Abscheu und professionellem Interesse starrte er auf die Horrorfotos. Der Polizeifotograf hatte mal wieder richtig zugelangt. Ausgebreitet wie ein giftiges Pokerblatt lagen die widerwärtigen Bilder auf Zoffingers Schreibtisch. Erstochene, Erschossene, Erdrosselte, Erhängte und Vergiftete waren zwar nicht gerade sein tägliches Brot als Kriminalkommissar, aber ›Ingredienzien‹ seines Berufs, um die er hin und wieder nicht herumkam. Aber es gab auch Fälle, die bei ihm ans ›Eingemachte‹ gingen. So wie dieses neueste mysteriöse und nebulöse Verbrechen, dem eine zierliche junge Frau zum Opfer gefallen war. Die Informationen gaben bislang nicht allzu viel her. Zunächst hatte es nach einer Entführung ausgesehen. Doch dann wurde der Leichnam gefunden, und das Rätsel nahm seinen Lauf.
Zoffinger spürte, wie ihm die Widerwärtigkeit der Fotos die Kehle zudrückte und ihn trocken schlucken ließ. Als altes Schlachtross an der Kriminalistenfront hatte er schon häufig mit menschlichen Abgründen zu tun gehabt. Der neueste Fall hätte aber grotesker kaum sein können.
Kurzerhand fegte er die Fotos mit beiden Händen zusammen, warf sie in eine Schublade, fingerte seinen Autoschlüssel aus der Jackentasche und zog die Bürotür hinter sich ins Schloss. Er hätte die Angelegenheit telefonisch erledigen oder einen Kollegen schicken können. Aber er hatte das Bedürfnis, dem Fall nicht nur durch abstoßende Beweisfotos und dürftige Informationen, sondern auch persönlich näherzukommen.
Zoffinger überquerte die Rheinbrücke, auf der ein Straßenkünstler auf einem Podest stehend die Freiheitsstatue mimte, nahm die B33 nach Westen und bog ein paar Kilometer später auf die Pirminstraße Richtung Insel Reichenau ab.
Im Ortsteil Oberzell lotste ihn sein Navi zu einer Ferienwohnung, in der sich eine Urlauberin aus Hannover mit ihrer Zwillingsschwester für ein paar Tage einquartiert hatte. Zoffinger läutete. Niemand machte auf. Er ging um das Haus herum und fand die Frau im Garten zusammengesunken auf einer Bank sitzen. Sie sah übernächtigt aus, hatte dunkle Ringe unter den Augen und knetete ihre Hände, dass die Knöchel weiß hervortraten.
»Guten Tag, Frau Wernicke. Tut mir sehr leid, was passiert ist. Wirklich tragisch«, sagte Zoffinger. »Glauben Sie mir. Wir tun alles, um diesen Fall aufzuklären. Wären Sie vielleicht in der Lage, mir ein paar Fragen zu beantworten?«
Es dauerte ein paar Atemzüge lang, bis die Frau kaum merklich nickte.
»Natürlich! Ich will wissen, was Margarete passiert ist. Ihr mysteriöser Tod zerreißt mir das Herz.«
Im Kommissariat kannten Zoffinger alle als einen umgänglichen, sympathischen Menschen, der trotz seiner Prominenz sowohl in Ermittlerkreisen als auch im kriminellen Milieu bodenständig und unkompliziert geblieben war. Jeder, der jemals mit ihm gearbeitet hatte, wusste, dass er den Dingen auf den Grund ging, sich an seinen Fällen festbiss. Aber man schätzte ihn auch als empathischen Menschen, der die leisen Töne auf der Klaviatur des Mitgefühls beherrschte und nachempfinden konnte, wie es um die Frau bestellt war, die ihre Schwester verloren hatte. Mit der Tür ins Haus zu fallen, kam nicht infrage. Nur zu gut konnte er sich an seinen eigenen Zustand erinnern, nachdem er vor zehn Jahren seine Frau bei einem Autounfall verloren hatte. Damals war er in ein abgrundtiefes Loch gestürzt. Selbst in späteren Zeiten holte ihn die Erinnerung hin und wieder ein wie ein dämonischer Flashback. In solchen Situationen zog Zoffinger sich in seine eigenen vier Wände zurück und versorgte seine Wunden mit alterprobten, verlässlichen Heilmitteln aus Küche und Kühlschrank: mit badischen Seelentröstern und Most vom Obstbauern.
»Aus welchem Grund haben Sie eigentlich gerade die Insel Reichenau als Urlaubsort ausgesucht?«, nahm er das Gespräch auf.
Frau Wernicke verbarg ihr Gesicht in den Händen.
»Es hätte so schön sein können hier am Bodensee.«
Sie atmete tief ein, ehe sie fortfuhr.
»Ich wollte uns auf der Reichenau einquartieren, weil meine Schwester eine Stelle als Lehrerin an einem Konstanzer Gymnasium in Aussicht hatte. Sie war seit einem halben Jahr mit einem Schweizer liiert und wäre am liebsten sofort an den Bodensee umgezogen.«
Frau Wernicke ließ die Hände in den Schoß sinken und verharrte eine Minute lang. Zoffinger starrte in den Himmel, weil die qualvolle Situation auch an ihm nagte. Eine leichte Brise schob zerzupfte Wölkchen über den See. Er hielt inne, wollte ihr Zeit geben, sich zu sammeln. Dann bat er sie zu erzählen, was an dem verhängnisvollen Tag passiert war.
»Wir hatten schönes Wetter und beschlossen, nachmittags nicht nach Konstanz zu fahren, sondern ein paar entspannte Stunden am Seeufer auf der Reichenau zu verbringen.«
Zoffinger hörte aufmerksam zu und versuchte, sich jedes Detail einzuprägen, als die Frau den Ausflug schilderte.
Während sich Frau Wernicke auf einer Wiese gesonnt hatte war ihre Schwester am Seeufer entlangflaniert, hatte sich hier und da nach einem Blümchen gebückt, ihre Zehen ins Wasser getaucht und ihrer auf einer Decke sitzenden Schwester vergnügt zugewinkt. Als es Frau Wernicke zu warm geworden war, hatte sie aus ihrem geparkten Auto einen Sonnenschirm holen wollen. Auf dem Rückweg war ihr eingefallen, dass sie, einen Katzensprung entfernt, in einem Dorfladen zwei Becher Eis besorgen könnte.
»Wie lange waren Sie weg?«, erkundigte sich Zoffinger.
»Vielleicht eine Viertelstunde. Wahrscheinlich nicht mehr.«
»Und als Sie wieder zurück auf Ihre Wiese kamen?«
»Ich spannte den Sonnenschirm auf und drückte ihn so in den Boden, dass ich genügend Schatten bekam. Dann packte ich das Eis aus und wunderte mich, wo Margarete abgeblieben war.«
»War nichts von ihr zu sehen?«
»Nein! Ich rief nach ihr, bekam aber keine Antwort.«
»Kann es sein, dass Ihre Schwester schon nicht mehr da war, als Sie sich auf den Weg zu Ihrem Auto machten?«
Sie schüttelte energisch den Kopf.
»Ich habe sie zuletzt im knöcheltiefen Wasser stehen sehen, wie sie mit einem abgebrochenen Ast herumfuchtelte. Sie war definitiv noch da, als ich zum Auto ging. Ganz sicher!«
»Sind Ihnen andere Leute in der Umgebung aufgefallen oder ist Ihnen jemand auf dem Weg zum Auto begegnet? Parkte vielleicht ein anderes Fahrzeug in der Nähe?«
»Wir waren mutterseelenalleine! Da war niemand in der Nähe.«
»Was machten Sie, als Margarete nicht auf Ihre Rufe reagierte?«
»Ich ging ans Seeufer, um nach ihr zu schauen. Hätte ja sein können, dass sie sich versteckte, um mich zu necken. Aber ich sah und hörte nichts. Zuerst kam mir das komisch vor. Dann packte mich die Panik. Ich rannte am Seeufer entlang, erst auf die eine, dann auf die andere Seite unseres Liegeplatzes. Ich konnte mir einfach nicht erklären, wo sie geblieben war.«
»War sie vielleicht in den See hinausgeschwommen?«
»Dazu hätte sie sich ausziehen müssen. Einen Badeanzug hatte sie unter ihrer Kleidung nicht an. Am Ufer lagen auch nirgends Kleidungsstücke. Außerdem verabscheute sie kaltes Wasser. Eine ausgezeichnete Schwimmerin war sie übrigens auch. Ich war mir sicher, dass sie nicht ins Wasser gestiegen war. Sie können sich nicht vorstellen, welche Verzweiflung mich ergriff.«
Die Erinnerung überwältigte Frau Wernicke. Von Tränen geschüttelt saß sie da wie ein Häufchen Elend. Zoffinger beschloss, seine Befragung abzubrechen. Ohnehin wusste er von seinen Kollegen, dass noch am selben Spätnachmittag der örtliche Polizeiposten eine Suchaktion eingeleitet hatte, an der sich mehrere Personen aus der Gemeinde beteiligten – ohne Erfolg. Sogar mit zwei Booten und einem Taucher war im See gesucht worden.
Einen Tag später stellte sich bei einer Ortsbegehung heraus, dass sich Frau Wernicke in ihrer Liegewiese geirrt und den Nachmittag tatsächlich an einem anderen, jedoch ähnlich aussehenden Uferabschnitt verbracht hatte. Als die Polizei das richtige Gebiet gründlich in Augenschein nahm, fand sie die Zwillingsschwester an einer von Schilf dicht bewachsenen Stelle neben einem umgestürzten Baumstamm. Ihr Tod erschien rätselhaft, weil sie äußerlich keinerlei Verletzungen aufwies.
Der vorläufige medizinische Befund hätte mysteriöser kaum sein können. Neben zahlreichen Hämatomen hatte Margarete offenbar unerklärliche Knochenbrüche erlitten. Von einem Sturz konnten die Frakturen nicht herrühren, weil am fraglichen Ufer weder ein größerer Baum noch sonst etwas stand, wovon sie hätte herunterfallen können. Auch kamen die Knochenbrüche als Todesursache nicht infrage. Aber wie war die Urlauberin dann zu Tode gekommen?
Zoffinger wusste aus Erfahrung, dass Familien entgegen der weitverbreiteten Annahme nicht unbedingt Schutz, Sicherheit und Geborgenheit garantieren. Häusliche Gewalt und Missbrauch waren Phänomene, über die man tagtäglich in der Zeitung lesen konnte. Aber so, wie er Frau Wernicke kennengelernt hatte und einschätzte, schloss er kategorisch aus, dass sie irgendetwas mit dem Tod ihrer Schwester zu tun hatte. Auch die Situation am Seeufer sprach dagegen.
Auf dem Weg zurück ins Büro zermarterte er sich das Gehirn. Er hatte null Idee, wie er seinen jüngsten Fall lösen sollte. Hoffnung setzte er auf die Kollegen der Rechtsmedizin. Außer mehrfachen Blutergüssen und Knochenbrüchen machten sie an der Frauenleiche eine weitere Entdeckung, die für die Ursachenforschung von Bedeutung war.
»Die Sache wird immer rätselhafter.« Institutsleiter Dr. Ulrich Herrlinger klang längst nicht so hochnäsig wie sonst, als ihm der Kommissar einen Besuch abstattete. »Als wir die Kleidung des Opfers in eine Kiste packten, fiel einem meiner aufmerksamen Mitarbeiter ein seltsames Detail auf: ein etwa 25 cm langes Stück vertrocknete Schlangenhaut!«
»Schlangenhaut? Hat sich eine Klapperschlange in Ihre heiligen Hallen verirrt?«
Dr. Herrlinger warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
»Es besteht im Grunde genommen kein Zweifel: Die junge Frau muss mit einer Schlange in Kontakt gekommen sein.«
»Haben Sie Bisspuren gefunden? Vergiftungserscheinungen?«
»Selbst wenn sie von einer Giftschlange gebissen worden wäre – wo kommen dann die Knochenbrüche und Hämatome her? Der Schlangenhautfund an ihrer Kleidung lässt eigentlich nur ein Szenario zu: Die grazile Dame, 164 Zentimeter groß und nicht einmal 55 Kilo schwer, wurde von einer Riesenschlange zu Tode gequetscht.«
Zoffinger starrte seinen Gesprächspartner ungläubig an, als hätte der ihm gerade ein Angebot für einen gemeinsamen Besuch im Swingerclub gemacht.
»Margarete ist am Bodenseeufer auf der Reichenau zu Tode gekommen. Nicht am Amazonas!«
»Ist mir bekannt, Herr Kommissar!«
Der Herr der Unterwelt tat den Einwand mit einer wegwerfenden Handbewegung ab, mit der er seinem akademischen Dünkel gerne Ausdruck verlieh.
»Fast tagtäglich berichten die Medien, dass Leute ihre Haustiere aussetzen. Weil sie unbequem geworden sind, weil sie nicht mehr in die Wohnung passen, weil sie ein neuer Lebenspartner nicht akzeptiert. Meine Theorie: Ein verantwortungsloser Reptilienfan hat seine Würgeschlange am See ›entsorgt‹, und die junge Frau hatte das Riesenpech, ihr in die Quere zu kommen.«
Zoffinger wusste, was zu tun war. Im Kommissariat trommelte er ein paar Kollegen für einen beispiellosen Spezialauftrag zusammen: die Suche nach einem Riesenreptil. Unter seinen Männern herrschte teils Heiterkeit, teils Skepsis gegenüber der Diagnose von Dr. Herrlinger. Am Ende rückte eine schlagkräftige Schlangenfängertruppe auf die Reichenau aus, wo sich bereits örtliche Hilfskräfte in martialischer Schutzkleidung eingefunden hatten, als müsste ein Seemonster dingfest gemacht werden.
Zwei Tage lang krochen die Reptilienjäger durch jedes Buschwerk, untersuchten akribisch jedes Schlammloch und kontrollierten jeden Meter Uferlinie. Zoffinger war im Büro geblieben, um bei Bedarf organisatorisch eingreifen zu können. Nachmittags bekam er die sehnlichst erwartete Vollzugsmeldung.
»Ein ganz schöner Oschi, den wir gefunden haben«, jubelte der Anrufer. »Das Exemplar ist mindestens dreimeterfuffzig, wenn nicht sogar vier Meter lang. Am Kopf hat die Schlange eine Verletzung, aber sie zappelt noch. Was machen wir jetzt mit dem Riesenteil?«
Vorsorglich hatte Zoffinger mit der Konstanzer Tierklinik Kontakt aufgenommen. Karin Maiwald, die dort als Tierärztin arbeitete, gehörte zum engsten Freundeskreis des Kommissars. Sie wollte sich melden, sobald sie das eingelieferte Tier untersucht hatte.
»Es gibt Neuigkeiten von der Reptilienfront«, kündigte sie einen Tag später am Telefon an. »Das wird dich interessieren!«
»Zu meinen Lieblingstieren zählen Schlangen nicht. Mir sind Pelzträger lieber. Wie etwa dein Hauskater Bobby.«
Karin lachte, weil sie wusste, dass Zoffinger ihren vierbeinigen Hausfreund spontan ins Herz geschlossen hatte, als er ihm das erste Mal begegnet war.
»Dass die Schlange verletzt gefangen wurde, hast du ja vermutlich mitbekommen. Vielleicht hilft dir bei deinen Ermittlungen weiter, was ich jetzt herausgefunden habe. Erstens: Bei dem Tier handelt es sich ohne jeden Zweifel um eine Gelbe Anaconda, die auf der Reichenau entweder ausgesetzt wurde oder einem Schlangenhalter ausgebüxt ist. Zweitens: Die zwar schweren, aber nicht tödlichen Wunden am Kopf der Anaconda rühren von einem Hundebiss her. Ich habe mir die tiefen Schrammen genau angesehen. Es gibt keinen Zweifel: Hundebiss!«
»Als ich vom mysteriösen Tod der Frau erfahren habe, war mir sofort klar, dass das einer der rätselhaftesten Fälle sein würde, mit denen ich je zu tun hatte«, gab Zoffinger zu. »Deine Diagnose macht die Sache noch bizarrer.«
»Warum noch bizarrer?«
»Wenn ich die Fakten wie ein Puzzle zusammensetze, komme ich nur zu einem einzigen Schluss. Die vermutlich ausgehungerte Anaconda hat die am Wasser flanierende Frau angegriffen, umschlungen und getötet. Wie mir Dr. Herrlinger von der Rechtsmedizin bestätigte, war das Opfer relativ klein und ein Leichtgewicht, das gegen die Würgeschlange keine Chance hatte. Dass Margarete nicht im Magen der Riesenschlange endete, ist offenbar einem Hund zu verdanken, der das Tier angriff. Leider, leider etwas zu spät. Hätte das Reptil die Frau tatsächlich verschlingen können?«
»Würdest du regelmäßig die Boulevardpresse lesen, wüsstest du die Antwort. Sensationshungrige Schreiberlinge stürzen sich mit Wonne auf Horrorgeschichten, in denen große Würgeschlangen als Mörderreptilien stigmatisiert werden. Ich erinnere mich an Headlines nach dem Motto ›Je schauerlicher, desto besser!‹
Indonesischer Bauer von Anakonda verspeist.
Südafrikanischer Hirtenjunge von Felsenpython attackiert.
Grausige Schlangenmahlzeit im Dschungel einer Philippinen-Insel.«
Zoffinger gab ihr recht.
»Ähnliche News habe ich auch schon gelesen.«
»Im Guinnessbuch der Rekorde«, fuhr Karin fort, «ist von einem 10 m langen Netzpython die Rede, der 1912 auf der indonesischen Insel Sulawesi gefangen wurde. So einem Monster möchte man auch als professioneller Kampfsportler nicht begegnen.«
Zoffinger riss die Augen auf.
»Baaah, zehn Meter! Da frage ich mich, wie ein solcher Gigant mit seinem doch relativ kleinen Maul eine Mahlzeit wie einen Menschen überhaupt fressen kann. Abbeißen können Würgeschlangen meines Wissens ja nicht«.
Karin packte ihr Fachwissen aus.
»Solche Reptilien haben zwei flexible Unterkiefer. Die können sie aus dem Oberkiefer aushängen. Was dem Schlangenmaul eine unglaubliche Flexibilität verleiht und es sogar möglich macht, ganze Wildschweine am Stück zu verspeisen.«
Zoffinger schnitt ein anderes Thema an.
»Hast du eine Idee, warum in der Gerichtsmedizin an der Kleidung der Toten Teile von Schlangenhaut gefunden wurden?«
Karin druckste einen Moment herum.
»Ich will mich ja nicht als Schlangendompteuse präsentieren. Aber ich weiß, dass Schlangen ihr Leben lang wachsen. Die Haut macht dieses Wachstum allerdings nicht mit. Das ist der Grund, weshalb sich die Reptilien von Zeit zu Zeit häuten. Junge Exemplare wachsen schnell und wechseln ihr sogenanntes Schlangenhemd ziemlich häufig. Je älter sie werden, desto seltener wird dieses Prozedere.«
Zoffinger wusste jetzt genug. Auch wollte er auf dem Thema Anaconda nicht länger herumreiten, als unbedingt nötig war.
»Was passiert jetzt eigentlich mit der gebissenen Patientin?«
»Sie wird von uns aufgepäppelt. Sobald ihre Wunden verheilt sind, kommt sie in ein Tierheim. Darum wird sich aber jemand anders kümmern.«
Blieb Zoffinger am Ende noch die undankbare Aufgabe herauszufinden, wo die Riesenschlange überhaupt hergekommen war. Er hakte in zwei Zoohandlungen nach. Eine hielt gar keine Reptilien. Die andere verkaufte nur andere Arten. Am einfachsten war es wohl, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Hilfe versprach er sich von seinem Freund Florian Faller, dem Lebensgefährten von Karin Maiwald. Jahrelang hatte er beim Konstanzer ›Seekurier‹ gearbeitet, bevor er sich ein einjähriges Sabbatical leistete, um seinen Lebenstraum zu verwirklichen: einen Roman zu schreiben. Seit Monaten dokterte er an seinem Manuskript herum und war längst auf die tiefere Weisheit gestoßen, dass aktuelle Redaktionsarbeit mit einem schriftstellerischen Buchmarathon nicht viel zu tun hatte. Gestern noch brillante Ideen landeten einen Tag später im digitalen Nirwana. Ein Kriminalroman lag eigentlich nahe. In seinem Zeitungsjob hatte er oft genug mit den abgründigen Schattenseiten der Gesellschaft zu tun gehabt. Außerdem war es ihm schon mehr als einmal gelungen, seine schriftstellerische Einfallslosigkeit dadurch zu kaschieren, dass er sich bei Zoffingers Ermittlungen als Hiwi geschickt aufgedrängt hatte.
«Lass mich mit meinen ehemaligen Kollegen reden«, schlug Florian vor. »Über den Fall Anaconda wurde ohnehin schon einiges publiziert. Durch einen Aufruf an die Bevölkerung wird sich vielleicht doch noch das eine oder andere ergeben.«
Die Ausbeute der Kampagne war mager. Ein Leser erinnerte sich, dass vor einem halben Jahr ein kleiner Zirkus in Radolfzell gastiert hatte, aus dem eventuell die Riesenschlange entwichen sein könnte. Ein Telefonanruf Zoffingers ergab, dass die Rummelshow überhaupt keine Schlangen im Programm hatte. Ein Witzbold meinte, dass sich das Reptil eventuell vom Schwarzen Meer über die Donau bis in den Bodensee vorgearbeitet haben könnte. Aus Staad meldete sich eine glaubwürdigere Anwohnerin und erwähnte einen schrulligen Nachbarn, der zu ihrem Missvergnügen in Terrarien offenbar exotische Tiere hielt. Zoffinger rief diesen nur Rembrandt genannten Kerl an und erkundigte sich nach dessen Privatzoo.
»Schlangen? Sogar Riesenschlangen? Um Himmels willen!«
Rembrandt überschlug sich fast. Seine spontane Reaktion zeigte, dass er vor diesen Reptilien nicht nur gehörigen Respekt, sondern höllischen Bammel hatte.
»Wahrscheinlich hat sich mal wieder diese alte Kuh aus der Nachbarschaft über mich beschwert«, moserte er. »Sie kann mich nicht ausstehen, wahrscheinlich weil ich nicht ihren stinkbürgerlichen Vorstellungen entspreche. Wenn Sie die Kanaille wieder sprechen, sagen Sie ihr, dass …«
Zoffinger hatte keine Lust auf eine Diskussion mit einem Unbekannten über Verhaltensnormen und auch nicht über Klatschsucht.
»Entschuldigen Sie, aber mir geht es nur darum herauszufinden, ob Sie Schlangen halten oder nicht.«
Wieder plusterte sich Rembrandt auf, bis ihm der Kommissar das Wort abschnitt.
»Mittlerweile habe ich mitbekommen, dass Sie Schlangen weder mögen noch halten. Ich hake nur nach, weil ich gehört habe, dass Sie exotische Tiere besitzen.«
»Falls Sie von meinem Terrarium reden, in dem vier Skorpione herumkrabbeln – ja!«
Für Zoffinger war die Sache damit erledigt. Sollten sich andere die Köpfe darüber zerbrechen, wie und warum eine Anaconda auf der Reichenau ihr Unwesen treiben konnte. Der gewaltsame Tod der Margarete Wernicke war aufgeklärt, ganz abgeschlossen war der Fall aber noch nicht.
Zwei Wochen später erreichte Zoffinger ein aufgeregter Anruf aus dem Reptilienzoo in Unteruhldingen, in dem die Riesenschlange nach ihrer Genesung in der Konstanzer Tierklinik Asyl genoss. Der Kommissar ließ alles liegen und stehen und fuhr hin.
»Hammermäßig«, war das Einzige, was die Tierpflegerin über die Lippen brachte, als sie dem Kommissar die Hand schüttelte.
Mit hängenden Schultern trottete sie vorbei an kleiderschrankgroßen Terrarien, zwischen denen Landkarten mit Verbreitungsgebieten von krabbelnden und schlängelnden Insassen rot markiert waren. Unter einer Wärmelampe hockte ein grüner Leguan, der Zoffinger mit heraushängender Zunge ziemlich unverschämt anglotzte.
»Wo stammen die Tiere eigentlich her? Ich meine nicht, wo sie ursprünglich zu Hause sind, sondern woher der Zoo sie bezieht.«
Die Wärterin blieb vor einem Terrarium stehen, in dem sich eine Schlange zwischen Eierschalen kringelte. Auf einem Infotäfelchen stand ›Königspython‹.
»Ob Sie es glauben oder nicht: Unser Hauptlieferant ist der Zoll. Was die Leute aus dem Urlaub mit nach Hause bringen, ist geradezu unfassbar. Besonders Reptilien sind beliebte Urlaubsmitbringsel«, erklärte sie. »Aber auch vor Chamäleons, Geckos, Unken, Feuersalamandern und Schildkröten machen Sammler lebender Souvenirs keinen Halt. Man glaubt es nicht, was auf dem Frankfurter Flughafen von aufmerksamen Beamten beschlagnahmt wird und als illegale Einfuhr zunächst in der Tierstation Animal Lounge landet – von Touristen auf traditionellen Märkten in Asien oder Südamerika gekauft und in Reisetaschen und Koffern mit nach Hause geschleppt.«
Sie schüttelte angewidert den Kopf.
»Viele Tiere überleben den Transport nicht. Außerdem müsste sich herumgesprochen haben, dass der Import speziell von Arten, die vom Aussterben bedroht sind, nicht nur illegal ist, sondern auch verflucht teuer werden kann. Da drohen bis zu fünf Jahre Haft oder Geldbußen bis 50 000 Euro. Aber leider ist der Handel unter der Ladentheke auch eine sehr lukrative Sache …«
Sie blieb vor einer großen Box mit gläsernem Deckel stehen.
»Ich muss nicht aufmachen. Sie sehen auch so, was passiert ist!«
Im Innern lag die Gelbe Anaconda von der Reichenau in einer Blutlache. Das erste, was Zoffinger auffiel, war eine Art Buschmesser, das in einer Ecke der Box auf der Spitze der Schneide in einem kleinen Blutfleck lehnte. Der abgetrennte Kopf des Reptils lag zwei Handbreit vom restlichen Körper entfernt. Die Verletzung durch den Hundebiss war noch deutlich zu erkennen.
»Wahnsinn!«, stieß der Kommissar durch die Zähne. »Was ist denn hier passiert?«
Die Frage war eher rhetorischer Natur. Im selben Augenblick schoss ihm ein bizarres Szenario durch den Kopf. Hatte jemand die Schlange nach dem Motto ›Rübe ab für das Mörderreptil‹ für Margaretes Tod bestraft? Wenn ja, kam dafür nur eine Person infrage.
»Ist so etwas schon einmal passiert?«
»Nein, natürlich nicht«, entrüstete sich die Tierpflegerin. »Wir passen auf unsere Tiere auf und bringen sie nicht um. Einen Schuldigen unter unserem Personal zu suchen, können Sie vergessen. Das war jemand von außerhalb. Ein Kollege hat mir erzählt, dass auf der Rückseite des Hauses ein Fenster aufgehebelt wurde. Sollen wir uns jetzt auch noch gegen übergriffige Einbrecher schützen?«
Dass es sich um eine völlig sinnlose Bluttat handelte, stand außer Frage. Schließlich konnte man die Schlange für ihre natürlichen Reflexe nicht verantwortlich machen. Irgendwie erklärlich und nachvollziehbar war die widerwärtige Schlächterei aber schon. Denn die Anaconda hatte einer Frau auf brutale Weise ihre Zwillingsschwester genommen.
Zoffinger schwante, wer für den ›Mördermord‹ verantwortlich war. Aber darum sollten sich die für den Bodenseekreis zuständigen Kollegen vom Polizeipräsidium Ravensburg kümmern. Seine Angelegenheit war das nicht.
Ein Nachspiel hatte der Fall Anaconda aber nicht nur bei den Kollegen, die sich auf die Suche nach dem Schlangenkiller machten. Immerhin drohte dem oder derjenigen nach dem Tierschutzgesetz unter Umständen eine lange Freiheitsstrafe. Natürlich hatte der bizarre Tod der Frau einen gehörigen Wirbel in den Medien verursacht. Zu Zoffingers Freundeskreis gehörte Rolf Riedle, der als Moderator bei Radio Grenzland arbeitete und wegen seiner zum Teil schrägen Beiträge eine große Fangemeinde hinter sich wusste. Andererseits gab es viele Hörer, die den typischen Riedle-Humor für geistlos und seine abstrusen Themen für dümmlich hielten. Zoffingers engster Fanclub war zwischen beiden Einschätzungen hin- und hergerissen.
Einen neuen Beweis dafür bekam der Kommissar, als er mit der Fähre von seinem Besuch im Reptilienzoo in Unteruhldingen nach Konstanz zurückfuhr. Er war in seinem Wagen bei heruntergedrehten Seitenfenstern sitzengeblieben. Im Auto nebenan lümmelten sich zwei junge Kerle, die offenbar hochvergnügt im Autoradio einem Riedle-Bericht lauschten.
»Mein Thema heute: der Fall Anaconda«, begann Riedle seine Sendung. »In jüngster Zeit hatte es die Polizei mit einem skurrilen Mordfall zu tun, der in der Bodenseeregion, vielleicht sogar in ganz Europa seinesgleichen sucht. Eine junge, noch nicht einmal mittelalterliche Urlauberin aus Hannover wurde auf der Insel Reichenau von einer Riesenschlange attackiert und geradezu tödlich umgebracht. Das Monsterreptil muss nach Expertenmeinung mindestens so lange wie ein städtischer Gelenkbus gewesen sein. Das hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema Schlangen gelenkt. Nun, es gibt unterschiedliche Schlangen: Würgeschlangen, Riesenschlangen, Giftschlangen, Brillenschlangen, Klapperschlangen, große Schlangen, kleine Schlangen. Solche Reptilien spielen aber nicht nur im Biologieunterricht und in Asia-Imbissen, sondern auch in Kulturgeschichte, Mythologie sowie in Kunst und Literatur eine bedeutende Rolle. Bereits in der alttestamentlichen Schöpfungsgeschichte taucht die Viper als Verführerin des Ehepaares Adam und Eva auf. Selbst so bodenständige Bereiche wie Medizin und Pharmazie wollten auf das Reptil nicht verzichten und machten es zusammen mit dem Äskulapstab zu ihrem Symbol, wobei man statt einer Schlange vielleicht besser eine Schachtel Kopfwehtabletten abgebildet hätte.«
Die Jungs im Nachbarauto tobten vor Vergnügen.
»Zu den harmlosesten und gleichzeitig dekorativsten Spezies im Reptilienreich zählen Luftschlangen, die sich durch Haltbarkeit und Genügsamkeit auszeichnen. Man trifft sie weniger in freier Natur an, sondern eher in geschlossenen Räumen wie Partykellern, Kinderhorten, Bankentürmen und Chefetagen, wo exorbitante Boni und verbotene Kartellabsprachen bei Schampus und Kaviarschnittchen bejubelt werden. Geballt tauchen Luftschlangen auch bei Geburtstagen in Altersheimen, bei Silvesterfeiern, Einweihungen von Möbelzentren und Preisverleihungen an TV-Serienstars auf, die kein Schwein kennt.
Vorsicht ist bei Kontakt mit Autoschlangen geboten, eine extrem aggressionsgeladene und weit verbreitete Art. Sie lauert dem mobilen Menschen hauptsächlich zu Ferienanfang und am Ende der Urlaubssaison auf – in Baustellen, auf viel befahrenen Fernverbindungen und hauptsächlich an blutverschmierten Unfallstellen, wo minderbemittelte katastrophengeile Knipser mit Schrumpfgehirnen ihre Handys zwecks Postings in sozialen Netzwerken aus dem Fenster halten.
Sehr gefährlich ist auch die Warteschlange, die den explosionsartigen Ausstoß von Adrenalin, Depressionen, Aggressionen bis hin zu suizidalen Spontanaktionen auslösen kann. Ursprüngliche Heimat der Regen und Nebel liebenden Warteschlange ist das urbane Großbritannien. Kürzlich tauchte mitten in London ein geradezu monströses Exemplar auf. Auf dem Piccadilly Circus in London blieb ein Mann mit Hut und Regenschirm unvermittelt stehen, weil ihm einfiel, dass er seiner Frau noch einen Hüfthalter kaufen wollte. Innerhalb von Minuten bildete sich hinter ihm eine Warteschlange, die in den folgenden Tagen auf eine Länge von 6,37 km anschwoll und den innerstädtischen Verkehr fast zum Erliegen brachte. Notärzte und Krankenschwestern wurden aufgeboten, um chronisch kranke Wartende mit Medikamenten zu versorgen. Priester, Imame, Rabbiner, Schamanen und buddhistische Lamas spendeten Trost und feuchte Umschläge, während Psychologen den Warteschlänglern mit Brettspielen, Gute-Nacht-Geschichten und Krisentherapien den Leidensdruck zu mildern versuchten.«
Von Neuem lautes Gewieher aus dem Nachbarauto. Der Fahrer prügelte wie wild geworden auf das Lenkrad ein. Selbst Zoffinger verzog das Gesicht und musste eingestehen, dass Riedles Report diesmal ein gewisser Unterhaltungswert nicht abzusprechen war. Den Rest der Sendung bekam er nicht mehr mit, weil in Staad die Anlegestelle erreicht war und die Mitarbeiter die Fahrzeuge von der Fähre winkten.
2DINNER BIZARR
Niemand hatte Bescheid gesagt. Aus heiterem Himmel fielen am Vormittag zwei albanische Maler mit Pinsel und Dispersionsfarbe über Zoffingers Büro her. Einzige Alternative: Flucht. Kaum hatten die beiden Pinselexperten ihren Job angefangen, kippte einem von ihnen ein offener Farbeimer von der Leiter. Dickflüssiges Grönlandweiß verwandelte den Boden im Nu flächendeckend in eine arktische Landschaft. Allein das Saubermachen dauerte geschlagene zwei Stunden, weil der mit zwei linken Händen ausgestattete Schuldige zur Beruhigung seiner Nerven erst einmal zwei Bierchen und einen Kräuterschnaps zwitschern musste.
Typisch öffentlicher Dienst. Wenn irgendwo im Gebäude eine elektrische Birne ausgewechselt werden musste, kam der Hausmeister immer in Begleitung. Einer kletterte auf die Leiter, der andere sicherte ab. Wem oder was die Maßnahme diente, war unklar.
Der Kommissar fand temporär im Büro eines frisch verheirateten Kollegen Zuflucht. Alle halbe Stunde musste der entflammte Neuvermählte mit seiner Eroberung telefonieren. Dass er sich dabei in der Disziplin Süßholzraspeln offenbar um einen Spitzenplatz in der Rangliste menschlicher Höchstleistungen und Extremwerte bemühte, ging Zoffinger unsäglich auf den Zeiger. Ziemlich angesäuert machte er sich nach Dienstschluss auf den Nachhauseweg und träumte schon unterwegs von einer Solo-Happy-Hour auf Balkonien, von einer innigen Umarmung sämtlicher Trägheitsgesetze, um Laune und Nervenkostüm wieder in den Normalzustand zu versetzen. Dass daraus nichts werden würde, konnte er jedoch nicht ahnen.
Seine Wohnung lag am Rand einer Siedlung. Vom Balkon hatte er theoretisch ein Stückchen See im Blick, was seine Vermieterin dazu veranlasste, die Drei-Zimmer-Wohnung als ›Wohnung mit Seeblick‹ zu einem etwas erhöhten Mietzins zur Verfügung zu stellen. Dass er das Gewässer nur sehen konnte, wenn er sich am äußersten Rand des Balkons auf einen Stuhl stellte und sich in semisuizidaler Absicht über das Balkongeländer beugte, spielte keine Rolle. Jeder Mieter und Vermieter am Bodensee wusste: Das Prädikat ›Mit Seeblick‹ war ein geografischer Ritterschlag und ein umschwärmter Schlüssel zur Gewinnmaximierung.
Besser als auf den Bodensee konnte der Kommissar auf eine ehemalige Pferdekoppel sehen, die seit dem Abzug der Huftiere schon vor mehreren Jahren von jungen Kerlen gelegentlich als Bolzplatz benutzt wurde. An diesem Abend, als sich der vom Tagesgeschehen lädierte Zoffinger gerade mit einem gut gekühlten Getränk aus vergorenem Apfelsaft genüsslich auf seinem Liegestuhl ausgestreckt hatte, entschlossen sich zwei pubertierende Nachbarn zu einem Rennen auf der ehemaligen Koppel mit ratternden Rasenmähern. Bis dem Kommissar der Krach nicht nur die Ruhe, sondern auch den letzten Nerv raubte. Zwischen Balkon und Pferdekoppel flogen mehr oder weniger sinnreiche Argumente hin und her, bis sich einer der beiden Rennfahrer einsichtig zeigte und seinem Mäher den Saft abdrehte.
Zoffinger hatte schon mit ihm zu tun gehabt, weil der Nerd in einem Plausch über die Grundstückshecke hinweg angeboten hatte, auf dem Smartphone des Kommissars einen coolen Klingelton zu installieren. Als das Gerät nach der Aufrüstung zum ersten Mal ein eingehendes Telefonat meldete, hörte sich das an, als sei jemand versehentlich mit dem ganzen Körpergewicht einer Katze auf den Schwanz getreten. Der brutale Schrei hätte auch von einem Hobbykoch stammen können, der sich unvorsichtigerweise einen heißen Schokoladenpudding in die Hose gegossen hatte. Zoffinger knöpfte sich seinen Technikberater vor und verlangte einen neuen Klingelton, den er im Austausch gegen einen Zehn-Euro-Schein auch bekam. Der Hirni hatte diesmal keinen markerschütternden Schrei, sondern das gurgelnde Geräusch einer Klospülung aufgeladen.
Während der Nerd seinen Rasenmäher trotzig nach Hause chauffierte, drehte sein Freund stur unter dem lautstarken Hinweis ›Wir leben ja schließlich in einem freien Land‹ weitere Runden, bis ihm das Solorennen keinen Spaß mehr machte. Zoffinger hatte längst eine zünftige Vergeltung im Kopf. In der folgenden Nacht schlich er zu später Stunde in die Nachbarschaft, schraubte am Rasenmäher der halbstarken Nervensäge den Tankdeckel auf und kippte eine ordentliche Portion Zucker hinein. Dass die Aktion ihre Wirkung nicht verfehlte, war sowohl akustisch wie optisch nachverfolgbar, als der Ruhestörer in den folgenden Tagen sein Mähgerät laut fluchend in sämtliche Einzelteile zerlegen musste.
Als Zoffinger mit seinem Freund Florian telefonierte und von seinem Rachefeldzug erzählte, staunte der nicht schlecht.
»Mutet geradezu alttestamentarisch an!«, kommentierte Florian das Geständnis.
»Man muss sich schließlich nicht alles gefallen lassen. Schon gar nicht von so einem antiautoritär, also gar nicht erzogenen Jungspund«, verteidigte Zoffinger seine pädagogische Lektion. »Vielleicht habe ich dem Rasenmäherpiloten mit dem aufgezwungenen Boxenstopp auch einen Gefallen getan.«
»Der da wäre?«
»Ihm Gelegenheit gegeben, im Duden nachzuschlagen, wie man Rücksichtnahme schreibt und was darunter zu verstehen ist.«
»Glaubst du, dass der Kerl überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass sein Rennbolide sabotiert wurde?«
»Keine Sabotage, sondern ziviler Ungehorsam. Da lege ich äußersten Wert drauf. Ich hätte ihm ja schlecht die Fresse polieren können. Schließlich bin ich ein friedliebender Mensch, der gerne gutnachbarschaftliche Beziehungen pflegt.«
»Mag sein«, gab Florian zu bedenken. »Aber wenn dein Zuckerkomplott rauskommt, hat der Herr Kommissar ein kleines, vielleicht auch mittleres Problem.«
Zoffinger winkte ab.
»Was hätte ich denn deiner Meinung tun sollen? Einen Bettelbrief schreiben? Den Stadtpfarrer um Intervention bitten?«
Florian verstummte eine Weile. Dann kam sein Vorschlag.
»Nicht ein, sondern zwei Tütchen Zucker in den Tank!«
Gegen später gurgelte die telefonische Klospülung. Zoffinger dachte einen Augenblick daran, das Smartphone in den Garten zu werfen. Pflichtbewusst nahm er den Anruf entgegen. Ein Kollege war dran.
»Du warst doch im Reptilienzoo in Unteruhldingen, richtig?«
»Stimmt!«
»Erinnerst du dich, um welche Zeit du mit der Fähre von Meersburg zurückgefahren bist?«
Zoffinger dachte nach.
»Muss so gegen halb vier gewesen sein. Aber: Was soll die Frage? Habe ich meinen Fahrschein versehentlich neben den Papierkorb geworfen?«
Der Kollege räusperte sich.
»Auf deiner Fähre ist gestern ein Fahrgast spurlos verschwunden. Darauf ist die Crew erst aufmerksam geworden, als sein Kleintransporter nach der Ankunft in Staad nicht weggefahren wurde. Es gab ein ziemliches Durcheinander, weil die Karre abgeschleppt werden musste. Vom Fahrer fehlt bislang jede Spur.«
Zoffinger machte sich mit den Einzelheiten des Vermisstenfalls vertraut. Die Mitarbeiter der Stadtwerke hatten die betreffende Fähre bereits bis auf den letzten Winkel umgekrempelt, ohne auch nur den geringsten Hinweis auf den wie vom Erdboden verschluckten Fahrer zu entdecken. Die Spurensicherung nahm sich den Kleinlaster vor, weil von Fahrzeug und Ladung am ehesten Indizien zu erwarten waren. Auf der Ladefläche befanden sich eine Badewanne auf Löwenpfoten, eine Duschkabine und insgesamt fünf Aquarien, drei ziemlich große und zwei kleine. In den großen Behältern paddelten bunte Exemplare, von denen die meisten ca. 30 cm lang waren. In den kleinen Behältern wimmelte es von winzigen Zierfischen, die sich an Farben und Formen gegenseitig übertrafen.
Einer der Spurensicherer erkannte auf den ersten Blick, dass die drei großen Aquarien eine ganz besondere Fracht enthielten: Kois. Ein zurate gezogener Tierarzt bestätigte, dass es sich um noch junge Exemplare der Varianten Kohaku und Asagi handelte, die für Aquariumhaltung ungeeignet waren. Der Lieferschein im Handschuhfach des Transporters war auf eine Adresse nicht weit entfernt von der Anlegestelle der Fähre ausgestellt. Zoffinger kannte den Namen bereits. Die als „alte Kuh“ bezeichnete Nachbarin hatte den Empfänger wegen exotischer Tierhaltung angezeigt. Sogar sein Name war beim Kommissar hängen geblieben: Roman Weidner alias Rembrandt.
Als ihn der Kommissar kontaktierte, schwor er Stein und Bein, dass er zwar die Badezimmerausstattung bestellt, von einer Aquariumlieferung aber keine Ahnung hatte. Es dauerte einen halben Tag, bis für die Buntbarsche ein ›Exil‹ in einem artgerechten Gartenteich gefunden war, wo die Edelpaddler mit Futter, Sonnenlicht und ausreichend Sauerstoff versorgt wurden.
Für Zoffinger waren die Kois Nebensache. Er musste sich um das mysteriöse Verschwinden des Fahrers kümmern. Über das Kennzeichen des Kleinlasters war der Eigentümer, eine Münchner Sanitärspedition, herausgefunden worden. Zoffinger telefonierte mit dem Chef.
»Ihr Fahrer hat sich in Luft aufgelöst. Das Fahrzeug haben wir sichergestellt. Könnten Sie mit ein paar Infos zur Aufklärung beitragen?«
Der Spediteur schnaubte hörbar durch die Nase.
»Der Fahrer heißt Tobias Wegner. Er fährt seit vier Jahren für unsere Firma. Während der ganzen Zeit keine Probleme. Er hat sich noch nie etwas zuschulden kommen lassen. Ein absolut verlässlicher Mitarbeiter. Für den lege ich jederzeit die Hand ins Feuer. Wenn Sie wollen, auch alle beide.«
Der Kommissar bohrte weiter.
»Gibt es vielleicht einen triftigen Grund, warum er seinen Transporter auf der Fähre stehen ließ?«
«Nie und nimmer. Wie ich schon sagte: ein absolut verlässlicher Mitarbeiter.«
»Hatte er in letzter Zeit irgendwelche Probleme? Zweifelhafte Besuche in der Firma? Wissen Sie etwas über finanzielle Schwierigkeiten?«
Außer Lobeshymnen fiel dem Speditionschef nicht viel zu seinem Angestellten ein. Als Zoffinger die Kois in den Aquarien erwähnte, schnappte der Chef am anderen Ende der Telefonleitung nach Luft.
»Hallo? Sind Sie noch dran?«, hakte der Kommissar nach.
»Sie haben auf der Ladefläche waaaas gefunden? Kois? Das sind doch diese sündhaft teuren Fische aus Japan.«
»Genau! Können Sie sich einen Reim darauf machen, wie die auf Ihren Transporter gekommen sind?«
Besonders erfolgversprechend verlief das Telefonat nicht. Oberflächlich betrachtet handelte es sich bei diesem Wegner um einen tadellosen Mitarbeiter. Keine Macken, keine Pflichtverletzungen, kein wunder Punkt. Aber so richtig glauben wollte der misstrauische Zoffinger die Beinahe-Heiligsprechung nicht. Schließlich hatte kein Scotty vom Raumschiff Enterprise die Aquarien auf seinen Laster gebeamt. Er ließ Münchner Kollegen die Familie des Fahrers durchleuchten – auch nichts Auffälliges. Wegner war den Aussagen zufolge umgänglich und aufgeschlossen, ein freundlicher, höflicher Typ, der noch nie mit schrägen Geschäften zu tun gehabt hatte. Aber Zoffinger war Profiskeptiker. Er glaubte weder an den Osterhasen noch an die unbefleckte Empfängnis durch Pollenflug.
Die Auswertung des Fahrtenschreibers von Wegners Fahrzeug ließ eine Rekonstruktion seiner Fahrtstrecke inklusive Abfahrts- und Ankunftszeit auf der Fähre zu. Dabei stellte sich heraus, dass er laut Strecken- und Zeitberechnung in der Gegend um Meersburg eine zweieinhalbstündige Pause eingelegt haben musste, für die auch der Chef der Münchner Spedition keine Erklärung hatte. Aber die Vermutung drängte sich auf, dass er in dieser Zeit die Fische an Bord genommen hatte. War das für den Saubermann-Fahrer etwa ein lohnendes Extrageschäft? Hatte der Aquariumtransport irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun?
An den Anlegestellen in Staad und Meersburg gab es Webcams, auf die Fährpassagiere zugreifen konnten, um das Verkehrsaufkommen zu checken. Im Innenraum der Fähre waren zwar Videokameras installiert, allerdings dienten sie nur der Crew zur Überwachung ein- und ausfahrender Autos. Zoffingers Kollegen kontrollierten diese Aufzeichnungen, ohne jedoch fündig zu werden.
Der Fall des nicht auffindbaren Fahrers war auch im ›Seekurier‹ und anderen Medien breitgetreten worden. Dann meldete sich ein Passagier, der an besagtem Tag von Meersburg nach Konstanz übergesetzt hatte. Auf dem Autodeck waren ihm zwei Männer aufgefallen, die zunächst in eine angeregte Diskussion verstrickt waren, die dann aber fast zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung ausgeufert wäre. Mehr wusste der Zeuge nicht. Er konnte sich nicht einmal mehr daran erinnern, wie die beiden ausgesehen hatten – außer dass einer auf dem linken Unterarm ein auffälliges Tattoo trug: eine Schildkröte, die mit ihrem gepunkteten Panzer fast wie ein übergroßer Marienkäfer aussah.
Nachdem der Kleinlaster sichergestellt worden war, hatte die Spurensicherung die Aquarien nur oberflächlich in Augenschein genommen, weil sie so schnell wie möglich für eine artgerechte Unterbringung der Fische sorgen wollten. Später fiel einem Beamten auf, dass der ziemlich dicke Boden der drei großen Aquarien schwitzte, obwohl sie leer gepumpt worden waren. Dass es sich bei der transpirierenden Basis um einen doppelten, aufklappbaren Boden handelte, verblüffte die Leute von der kriminaltechnischen Front. Was sie aber richtig sprachlos machte, war der Inhalt des mit Trockeneis gekühlten und isolierten Verstecks: in Plastik eingeschweißtes dunkles, fast schwarzes Fleisch und gekrümmte, zum Teil fast runde Stücke mit nahezu schwarzer Haut um ein helleres Inneres, auf das sich niemand einen Reim machen konnte. Die Analyse ließ nicht lange auf sich warten. Teilweise handelte es sich um Frischfleisch des als bedroht eingestuften Gemeinen Delfins. Der Rest bestand ebenfalls aus einem Delfinprodukt – Delfinspeck mit schwarzer Haut, der durch Trocknung haltbar gemacht wurde und sich dabei sonderbar krümmte.
Als Zoffinger von der raffiniert versteckten Ware erfuhr, wusste er, was zu tun war. Er rief Karin Maiwald in der Tierklinik an und bat um ihre Expertise.
»Könntest du zur Abwechslung mal mit einem Problem ankommen, mit dem ich mich wirklich auskenne? Fische gehören genauso wenig wie Reptilien zu meinem Spezialgebiet. Aber ich kann mich informieren und habe auch einen Kollegen, der sich im Reich der Flossenträger bestens auskennt. Wie wäre es mit einem Treffen? Wir haben uns ohnehin seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Ich bringe Florian mit.«
Fisch stand am Abend im Biergarten kulinarisch aus gutem Grund nicht auf der Agenda. Was Karin an Informationen über Delfinfleisch mitbrachte, ließ Zoffinger gezielt nach unverfänglicheren Angeboten auf der Speisekarte suchen.
»Lässt sich eigentlich feststellen, wo die Ware herstammt?«, wollte Florian wissen.
»Durch akribische chemische Analysen vermutlich schon«, antwortete Karin. »Das Fleisch könnte beispielsweise aus der Gegend um den japanischen Küstenort Taiji stammen. Jahr für Jahr werden dort Hunderte Delfine sinnlos abgeschlachtet, um ihr Fleisch in den Handel zu bringen. In Europa sind Fang und Verkauf von Delfinfleisch seit der Verabschiedung der sogenannten Bonner Konvention untersagt. Aber nicht nur aus Gründen des Tierschutzes.«
»Mach es nicht so spannend. Was für einen anderen Grund gibt es noch?«, hakte Zoffinger nach.
»Man hat herausgefunden, dass das Fleisch extrem hoch mit Quecksilber und anderen Schwermetallen belastet ist und der Verzehr gesundheitliche Risiken birgt. Trotzdem meinen manche Konsumenten immer noch, es handele sich um einen Leckerbissen. Recherchen ergaben, dass die verbotene Ware auf süditalienischen Großmärkten zu Preisen von bis zu 1000 Euro pro Kilo an begüterte und ganz offensichtlich bescheuerte Kunden verhökert wird. Wegen des kürzeren Transportwegs würde ich darauf tippen, dass euer beschlagnahmtes Fleisch aus dem Mittelmeer stammt.«
»Trotz aller Verbote?«
Karin nickte.
»Die Weltmeere werden seit Jahren rücksichtslos leer gefischt. Fangflotten sind mit Echolot oder Radar auf der Hightechsuche nach Fischschwärmen. Es gibt hochseetüchtige Fischfabriken und Kutter, die auf einer einzigen Fahrt mit riesigen Schleppnetzen Tausende Tonnen Fisch ernten. Da Roter Thunfisch, Dorade & Co. immer stärker dezimiert werden, ersetzt man diese Arten häufig durch Delfine, die früher eigentlich nur störender Beifang waren.«
»Wenn da so viel Kohle im Spiel ist, wie du erwähnt hast, kann ich mir vorstellen, dass ein profitabler Schwarzmarkt existiert. Trotz aller Verbote«, vermutete Florian. »Wie viel Fleisch habt ihr in den Aquariumböden eigentlich gefunden?«
»Insgesamt fast 50 kg«, antwortete Zoffinger. »Nach Adam Riese handelt es sich also um eine Warenlieferung im Gesamtwert von zirka 50 000 Euro.«
»Und der in den Lieferpapieren genannte Empfänger will von den Aquarien nichts gewusst haben?« Karin verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
»Ich gehe auch davon aus, dass dieser Rembrandt gelogen hat. Mir wäre der ganze Delfinzauber ziemlich wurscht, bliebe nicht der Verdacht, dass dieser Kerl auch mit dem Verschwinden des Fahrers etwas zu tun hat. Also werde ich ihm morgen mal auf den Zahn fühlen«, kündigte Zoffinger an.
»Das würde mir gut passen!«, platzte es aus Florian heraus. »Ich könnte mal wieder Doktor Watson spielen.«
Zoffinger schaute ihn mit gespielter Verblüffung an.
»Schreibst du nicht gerade an einem Bestseller und müsstest eigentlich den heimischen Schreibtisch hüten?«
»Kreativität braucht Pausen!«
»Und Disziplin!«, fügte Karin hinzu und schlug ihrem Freund auf die Schulter.
Sherlock Holmes und Dr. Watson machten sich am nächsten Morgen auf den Weg nach Staad. Ziel: der ominöse Rembrandt, der eigentlich Roman Weidner hieß und in der Hoheneggstraße nicht weit vom Fährhafen wohnte. Zoffinger hatte recherchiert und wusste, dass der jetzige Besitzer das Gelände von seiner schon vor Jahren verstorbenen Mutter geerbt hatte. Sie hatte es mit Workshops und Seminaren ihrer Unternehmensberatung zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht. Auch ein unbebautes Ufergrundstück an der Hoheneggstraße, das sich hinter einer mannshohen Thujahecke versteckte, gehörte ihr. Einziger Zugang war ein massives Eisentor mit aufgeschweißter Metalltafel, die in seltsam eckigen Buchstaben einen Schriftzug trug: ›Provinz Constantia‹. Über das Tor hinweg war eine Flagge mit schwarz-weiß-roten Querstreifen und einem stilisierten Adler in der Mitte erkennbar, die an einem hohen Mast flatterte.
»Sagt dir die Flagge etwas?«, fragte der Kommissar seinen Begleiter.«
Florian schüttelte den Kopf, hatte aber einen guten Tipp parat.
»Mach ein Foto und schicke es ans Kommissariat. Die sollen Bescheid geben.«
Zehn Minuten später meldete sich Zoffingers Smartphone.
»Das ist die leicht abgewandelte Fahne der Reichswehr, gültig von 1933 bis 1935«, teilte er Florian mit. »Kommt mir vor, als seien wir einem meschuggenen Reichsbürger auf der Spur.«
»Wieso leicht abgewandelt?«
»Weil die richtige Reichswehrflagge von keinem Adler, sondern von einem Schwarzen Kreuz geschmückt wird. Behaupten die Strategen im Kommissariat.«
»Wie kommen wir in die Festung überhaupt hinein?« Florian tigerte an dem Portal entlang, konnte aber nirgends eine Klingel entdecken. »Sollen wir brüllen?«
»Nicht nötig!«
Zoffinger nahm ein Stahlseil in die Hand, das vom rechten Torpfosten hing und zerrte ein paar Mal daran. Entfernt war das Gebimmel einer Glocke zu hören. Der Kommissar erinnerte sich. Auf diese Weise hatte er sich vor vielen Jahren Zutritt zu einem griechischen Kloster verschafft.
Es dauerte und dauerte. Dann waren knirschende Schritte auf einem Kiesweg zu hören.
»Wer da?«
»Wir sind von der Polizei. Wir müssen mit Roman Weidner reden.«
»Hier gibt es keinen Roman Weidner!«
»Gut. Dann eben Rembrandt.«
Drinnen machte sich jemand am Tor zu schaffen. Quietschend ging ein Flügel auf.
»Ich hätte ein paar Tropfen Öl mitbringen sollen«, kommentierte Zoffinger das nervige Geräusch.
Ein fast unmerkliches Sekundengrinsen huschte über das Gesicht Rembrandts. War damit vielleicht das Eis gebrochen?
»Nur der Ordnung halber: Kann ich mal Ihren Personalausweis sehen? Damit ich definitiv weiß, mit wem ich es eigentlich zu tun habe?«, fragte Zoffinger.
»Erst zeigst du mir deinen Ausweis, damit ich definitiv weiß, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Das hier ist mein Herrschaftsgebiet. Hier sage ich, wo's lang geht.«
Breitbeinig stellte sich Rembrandt auf den schmalen Weg.
Zoffinger stutzte einen Moment, langte dann in die Tasche und hielt seinem Gegenüber den Dienstausweis unter die Nase. Aufmüpfige, Widerständler, Rebellen, Freigeister und Spinner zählten schon lange zu seiner Kundschaft. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass es sinnlos war, solchen Leuten fordernd oder sogar aggressiv entgegenzutreten. Besser man vermied, einen Konflikt hochzuschaukeln.
Rembrandt trat näher, beugte sich mit in die Hüften gestemmten Armen nach vorne und stierte auf das Dokument. Sein von Wind und Wetter gegerbtes, von Falten zerfurchtes und von einem wilden, grauen Bart umwuchertes Gesicht erinnerte den Kommissar an Wasserspeierfratzen an gotischen Kathedralen. Seine offenbar unkontrollierbaren buschigen Augenbrauen hätten als Ersatz für sein ausgedünntes Haupthaar herhalten können. Aber darüber war sich Zoffinger nicht sicher, weil der Herrscher über die ›Provinz Constantia‹ eine karierte Schiebermütze trug. Er roch, als sei er eben erst einem Knoblauchvollbad entstiegen, was seine Ursache nicht unbedingt in einer erst kürzlichen Mahlzeit haben musste, sondern vielleicht auch auf seine verlotterten, alten Klamotten zurückzuführen war. Als er den Mund öffnete, kam ein graubrauner dentaler Steinbruch zum Vorschein.
»Also, Paul Zoffinger, was hast du zusammen mit deinem Kollegen hier zu suchen?«
»Ich habe dir meinen Ausweis gezeigt. Jetzt will ich deinen sehen!«, insistierte der Kommissar, legte seiner Aufforderung aber einen leutseligen Ton zugrunde. »Wie du mir, so ich dir! Das kennst du doch!«
Rembrandt ließ ein paar Atemzüge verstreichen, die er anscheinend brauchte, um sich für eine Reaktion zu entscheiden. Erst drehte er sich weg, langte dann widerwillig in die Brusttasche seines Holzfällerhemds und zog eine Ausweiskarte heraus. Florian linste seinem Freund über die Schulter.
»Kein Personalausweis?«
»Personalausweis! Ich glaub, ich spinne! Ich bin freier Bürger der Provinz Constantia und kein Domestike. Vielleicht gehört ihr beiden ja zum Dienstpersonal der BRD GmbH. Ich jedenfalls nicht! Ich bin keinem Dienstherrn verpflichtet und muss vor niemandem kuschen!«
Zoffinger studierte den blassblauen Fantasie-Ausweis. Links ein Foto von Rembrandt mit Sonnenbrille, im größeren Feld rechts daneben unter der fetten Überschrift Personenausweis sein Name Rembrandt von Constantia und einige Lebensdaten. Als Ausstellungsort war ›Provinz Constantia‹ angeben. In der äußersten oberen Ecke war dieselbe Fahne abgebildet, wie sie hoch über dem Grundstück am Fahnenmast flatterte.
»Provinz Constantia?« Zoffinger zog eine Schnute. »Um was handelt es sich dabei eigentlich? Wie muss ich mir die Provinz vorstellen?«
»Meine Provinz ist ein basisdemokratisch organisierter souveräner Staat, nichts und niemandem unterworfen. Mein Ziel: Autonomie und Autarkie. Von deiner sogenannten Bundesrepublik will ich nichts, aber ich schulde ihr auch nichts.«
Das eiserne Tor war mittlerweile so weit aufgegangen, dass der Blick auf das Grundstück frei wurde. Ein schmaler Kiesweg mäanderte über eine eher naturbelassene Grünfläche. Links und rechts des Wegs standen mehrere lebensgroße weibliche Gipsskulpturen Spalier, die nicht nackt waren, sondern Klamotten trugen wie Vintage-Models.
»Hoppla!«, rutschte es Florian heraus. »Sind Sie Märchenfan?«
»Blödsinn!«, entgegnete Rembrandt. »Ich und Märchenfan! Schon mal was von Fida Pfister gehört, der Herbergsmutter, bei der Jan Hus während des Konstanzer Konzils Unterschlupf fand? Oder Barbara von Cilli, die damals König Sigismund begleitete? Wahrscheinlich hast du im Geschichtsunterricht wochenlang gefehlt, junger Mann, und auch nichts von den Kurtisanen mitbekommen, die sich während des vierjährigen Events in der Stadt aufhielten. Das dort drüben sind meine plastischen Erinnerungen an die Vergangenheit, keine Märchenfiguren. In der Stadt sollen sich während des Konzils Hunderte Damen des horizontalen Gewerbes aufgehalten haben. Am Rand des offiziellen Programms tobte das pralle Leben, sexuelle Dienstleistungen boomten. Schon damals wusste sich die Geistlichkeit Abwechslung zu verschaffen. Andere natürlich auch.«
Er schüttelte sich vor Lachen, tat so, als trainiere er Ehestandsbewegungen und stimmte mit sonorer Stimme ein Lied an.
Willst du im Leid erheitert sein
Und ungenetzt beschoren fein
Dann zieh nach Konstanz an den Rhein
Wenn sich die Reise füge.
Darinnen wohnen Fräulein zart
Die grasen einem um den Bart ...
»Bist du unter die Liedermacher gegangen?«, beendete Zoffinger die Vorstellung.
»Stammt nicht von mir«, räumte Rembrandt ein. »Oswald von Wolkenstein, seines Zeichens Minnesänger und spätmittelalterlicher Ritter, hat die Zeilen gedichtet, nachzulesen in seinem ›Konstanzer Lied‹.«
Halb im Wasser, halb auf Grund lag am Ufer des Bodensees ein Schiff, das mit seinen Aufbauten aussah wie ein ausgemustertes Einsatzfahrzeug der Wasserschutzpolizei. Das Heck war baulich so verändert worden, dass es wie eine Terrasse die Verbindung vom Garten in das Schiffsinnere herstellte. Links daneben befand sich eine Garage Marke Eigenbau, in der ein Fahrzeug zu sehen war. Daneben stand ein Wassereimer, über dessen Rand ein Putzlappen hing.
»Das glaube ich ja nicht!«, brach es plötzlich aus Zoffinger heraus, als er die Ausweiskarte zurückgab und den Blick auf das Wohnboot richtete. »Eine alte V20, von einer österreichischen Werft gebaut und 1976 für die Seepolizei Hardt in Dienst gestellt, angetrieben von zwei Volvo-Penta-6-Zylinder-Turbodieselmotoren mit jeweils 420 PS.«
Florian blieb die Spucke weg, weil er seinen Freund als einen Menschen kannte, der sich zwar über die Segnungen moderner Technik freuen konnte, aber alles andere als ein Freak war. Bei ihm reichte es gerade noch, eine vordere von einer hinteren Autostoßstange zu unterscheiden. Und jetzt präsentierte er sich als Kenner von Polizeibooten.
Noch perplexer war Rembrandt, der offenbar mit allem, aber garantiert nicht mit Zoffingers Know-how gerechnet hatte.
»Du kennst dich aus mit Polizeibooten?«, wollte der Bärtige wissen.
»Vor ein paar Jahren habe ich in Dornbirn auf einem Trödelmarkt einen Modellbausatz für eine V20 erstanden. Leider bin ich damit nie ganz fertig geworden. Aber ich weiß, dass das richtige Schiff vor geraumer Zeit bei einer Auktion versteigert wurde.«
Spätestens zu diesem Zeitpunkt ging Florian ein Kronleuchter auf. Zoffinger flunkerte, dass sich die Balken bogen. Er hatte sich vermutlich vorab über Rembrandts Wohnsituation informiert, aber keinen Mucks darüber verlauten lassen. Und die Behauptung, er habe an einem Modellbausatz des Schiffs gebastelt, war an Abwegigkeit nicht zu überbieten. Jeder, der den Kommissar kannte, wusste, dass er mit zwei linken Händen ausgestattet war, die bereits vom Mülleimerleeren überfordert waren. Bastelarbeit hasste er abgrundtief, seit er in früher Jugend von seinen Eltern angehalten worden war, mit der Laubsäge Krippenfiguren auszuschneiden. Vermutlich versuchte er mit seinem anbiedernden Getue nur, Rembrandts Vertrauen zu gewinnen. Zoffinger fachsimpelte noch eine Weile mit seinem Gesprächspartner, kam dann aber auf den Grund seines Besuchs zu sprechen.
»Wir hatten ja schon telefoniert. Der Fahrer des Kleinlasters, der dir eine Badezimmerausstattung liefern sollte, ist spurlos von der Fähre verschwunden. Hast du mittlerweile von ihm gehört?«
Rembrandt schüttelte den Kopf.
»Keinen Pieps! Auf meine Möbel warte ich immer noch. Bekomme ich die in absehbarer Zeit?«