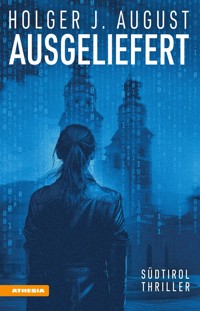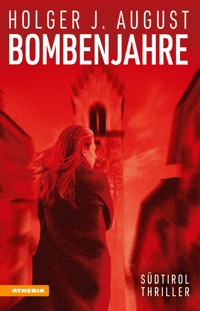
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Athesia Tappeiner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus einer Buchrecherche wird ein Spiel um Macht und Geld. Der Einsatz: das Leben Unschuldiger. Eine geheimnisvolle Botschaft, ein Mord im Pflerschtal, die Suche nach stillen Helfern der Südtiroler Freiheitskämpfer – das alles bricht über die junge Reporterin Marie Pichler herein. Sie sucht Hilfe bei dem deutschen Star-Journalisten Tom Bauer, der seinen Ruhestand in Sterzing genießt. Ohne es zu ahnen, geraten beide in die Mühlen einer Geheimorganisation, die in Italien die Fäden zieht. In einem Verwirrspiel aus Politik und Macht geht es für die beiden bald um Leben und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Auch Fiktion enthält manchmal ein Fünkchen Wahrheit.
Für Sarah
Inhaltsverzeichnis
1. Teil
Samstag, 16. März
Sonntag, 17. März
Montag, 18. März
Dienstag, 19. März
Mittwoch, 20. März
Donnerstag, 21. März
Freitag, 22. März
Samstag, 23. März
Sonntag, 24. März
2. Teil
Montag, 25. März
Dienstag, 26. März
Mittwoch, 27. März
Donnerstag, 28. März
Freitag, 29. März
Samstag, 30. März
Sonntag, 31. März
Montag, 1. April
Dienstag, 2. April
Mittwoch, 3. April
Donnerstag, 4. April
Freitag, 5. April
3. Teil
Samstag, 6. April
Sonntag, 7. April
Montag, 8. April
Dienstag, 9. April
Mittwoch, 10. April
Donnerstag, 11. April
Freitag, 12. April
Samstag, 13. April
Sonntag, 14. April
Mittwoch, 17. April
Montag, 22. April
Irgendwann im Mai
Dank
Glossar
Weitere Informationen
Samstag, 16. März
Um 19.20 Uhr durchbohrte ein 9-Millimeter-Geschoss aus einer Beretta 92 das Genick von Alfred Kerschbaumer aus Gossensass. Kerschbaumer wurde 83 Jahre alt. Gehirnmasse und Knochensplitter verteilten sich an der Wand und auf der Anrichte gegenüber dem alten Tisch, an dem er fast sechzig Jahre morgens, mittags und abends gesessen hatte. Immer seiner Frau Rosa gegenüber. Die letzten zweiundzwanzig Jahre davon war sie nur noch in Schwarz-Weiß bei ihm – als Bild. Jetzt war ihr Foto, aufgenommen bei der Heuernte, irgendwo an einem Berg, voller Blutspritzer. Das Jausenbrettl mit dem Käse, dem Speck und den Gurken war auf den Boden gefallen, eine Gurke unter die Anrichte gerollt.
Stolz war er gestorben. Stolz, denen das Leben schwer gemacht zu haben, die ihm jetzt das Leben genommen hatten. Stolz, ihnen nicht das gegeben zu haben, was sie von ihm wollten. Damals nicht, als sie ihn in der Kaserne in Eppan gefoltert hatten. Ihn tagelang mit einem starken Scheinwerfer wachgehalten hatten. Nicht, als sie Strom durch seinen Penis gejagt hatten. Auch nicht, als sie seine Erschießung arrangierten – die Pistole in seinem Nacken jedoch nur »Klick« gemacht hatte.
Jahrelang hatte er sie, die Walschen*, an der Nase herumgeführt. Hatte denen geholfen, die sich gegen sie aufgelehnt hatten. Er war geblieben, war nicht vor ihnen geflohen. Hatte getan, was in seiner Macht stand. Dabei konnte ein einziger Mann aus dem Pflerschtal kaum etwas ausrichten.
Seine Rosa hatte ihm bis zuletzt geholfen, alle Geheimnisse zu bewahren. Er, »der Alte«, wie man ihn hier in Gossensass nannte, hatte etwas in Gang gesetzt, das die Welt in Südtirol verändern sollte – in ganz Italien. Nach seinem Tod. Davon ahnte er nichts, als das Projektil seinen Schädel durchschlug, Knochen splittern ließ und wieder austrat.
Sonntag, 17. März
»Herby, für mich noch einen Roten, den letzten für heute«, rief Tom Bauer dem Wirt der kleinen Vinothek in Sterzing zu. Das Lokal lag mitten in der Altstadt, direkt am Marktplatz mit dem Zwölferturm, dem Wahrzeichen der Fuggerstadt.
»Was ist denn aus dieser Frau geworden, dieser …«
»Frag nicht, bring den Roten«, brummte Bauer.
»Sì Signore. Johanna macht sich so ihre Gedanken«, nahm Wirt Herbert einen neuen Anlauf.
»Deine Schwester ist nicht für mein Liebesleben verantwortlich.« Herberts Schwester kümmerte sich seit fast zwei Jahren um Toms Haushalt, seit er in Sterzing hängengeblieben war. Er hatte in den Süden gewollt, Toskana vielleicht. Kurz hinter dem Brenner war die »Flucht« vorbei, weil der alte Jaguar mal wieder eine Panne hatte. Sterzing hatte ihm auf Anhieb gefallen, also war er geblieben.
»Hast du weitergeschrieben?«, erkundigte sich Herbert.
»Bisschen was«, antwortete Bauer knapp, blätterte dabei weiter durch den Stapel Sonntagszeitungen.
»Noch immer dieses …«, er malte mit den Zeige- und Mittelfingern Anführungszeichen in die Luft, »… Projekt über den Erzabbau am Schneeberg?«
»Was ist mit dem Roten?« So beendete Tom die meisten Ausfragerunden mit Herbert. Der Wirt ging als Urgestein durch. Er kannte einfach jeden, notfalls über drei Ecken. Er wollte aber auch immer alles wissen.
»Siehst du die Kleine da?«, er deutete auf eine junge Frau, die neugierig zu ihnen hinübersah. Ihre Knie drückten sich durch die Löcher in der engen Jeans. »Sie schreibt auch.« Dabei machte er tippende Bewegungen in der Luft mit der freien Hand, denn in der anderen hielt er ein übervolles Glas Rotwein.
»Interessant.« Bauers Aufmerksamkeit galt weiterhin der Zeitung. So sah er auch nicht, wie der Wirt der Frau zunickte. Er sah auch nicht, wie sie zu ihm herüberkam.
»Hallo, ich heiße Marie. Sie sind also Tom Bauer, der große Journalist«, kam sie gleich auf den Punkt und kletterte umständlich auf den Hocker neben ihm. »Herbert meinte, ich sollte mich mal mit Ihnen unterhalten.« Dabei fuhr sie sich immer wieder mit den Händen durch die schulterlangen dunklen Haare. Ab und zu wischte sie sich Strähnen aus der Stirn, die sie kurz zuvor erst dorthin gewischt hatte.
»Aha, sagt er das?«, murmelte Bauer, ohne die junge Frau auch nur länger als kurz anzuschauen. Er bemerkte aber, dass Herbert hinter der Theke in Deckung ging und eifrig ein schon sauberes Weinglas erneut spülte.
»Ich bin da an einer Geschichte dran. Irgendwie stecke ich fest. Ich komme da zwar schon wieder raus, das weiß ich, aber mit Ihrer Hilfe, meint Herbert, würde es vielleicht schneller gehen.«
Bauers Blick traf den Wirt wie ein Pfeil, während er langsam die Zeitung zusammenlegte. Sie wischte derweil über den Bildschirm ihres Handys und las eine WhatsApp-Nachricht. Sie presste die Lippen aufeinander.
Tom beobachtete das kommentarlos. Er wollte gerade ansetzen, etwas zu sagen, als sie weitersprach.
»Mist. Muss leider wieder los«, sagte sie. »Oben in Gossensass ist ein Mord passiert. Ich muss für die Zeitung hin. Ein Informant hat gerade geschrieben.« Sie sagte nicht, dass es sich bei dem Informanten um einen jungen Carabiniere handelte. Eilig schlüpfte sie in ihre Jacke, fummelte Geld aus der zu engen Jeans und warf sich ihre Tasche über die Schulter. »Ich melde mich«, sagte sie noch, hielt sich dabei Daumen und kleinen Finger wie einen Telefonhörer an den Kopf. Weg war sie.
Tom sah erstaunt erst zur Tür, dann zu Herbert. »Was war das denn? Woher kennt die mich? Wobei soll ich ihr helfen? Vor allem, wie will sie sich bei mir melden?«
»Vier Fragen aus deinem Mund. Hol mal Luft, alter Grantler«, wischte Herbert das Fragenbombardement seines Stammgastes weg, als wäre es ein Rotweinrand auf dem Holz der Theke. »Ich habe ihr neulich von dir erzählt, kenne die Familie aus Brixen schon ewig. Die Kleine will sich unbedingt nach oben kämpfen. Die hat was auf dem Kasten. Die scheut auch kein Risiko. Von sich aus würde sie nie um Hilfe bitten. Kleiner Dickkopf ist sie. Ich musste sie ein bisschen überreden, damit sie dich anspricht. Diese Geschichte, an der sie arbeitet, könnte was werden.«
»Jetzt hol du mal Luft. Weißt du, wie viele junge Schreiber an Knallergeschichten dran sind? Wie viele davon in meinem Büro standen? Legen alle los wie die Feuerwehr. Platz da, hier komm ich. Schmutzen auf ihren Plattformen im Internet irgendetwas runter, ohne Hand und Fuß, eilen zur nächsten Story …«
»Verstanden. Du musst ihr nicht helfen. Deine Sache. Obwohl sie es verdient hätte. Zwingen kann ich dich nicht. Macht zweiundzwanzig Euro, nett gerundet, Kassenbon gibt’s nicht.«
»Los, es ist gleich Mitternacht. Du wolltest mir doch was sagen über den Toten«, bohrte Marie bei dem jungen Carabiniere nach, der dicht neben ihr stand. »Ich sollte sofort kommen. Carlo, spiel dich jetzt nicht so auf. Ich warte locker seit zwei Stunden hier in der Scheißkälte.« Dabei tippelte sie demonstrativ von einem Bein aufs andere.
»Viel weiß ich nicht. Die warten auf den Staatsanwalt aus Bozen«, dabei deutete er kurz zu dem Haus, das abgelegen auf einem riesigen Grundstück stand. Drumherum viel Wiese und noch mehr Wald. »Der Alte ist schlimm verprügelt worden – bevor sie ihn erschossen haben. Vermutlich gestern. Irgendwann abends.«
»Sie? Mehrere Täter? Eine Bande?«
»Hör auf! Wir wissen nichts«, antwortete der junge Carabiniere, blickte sich dabei unsicher um.
»Warum bist du überhaupt hier, reichen die Carabinieri aus Gossensass nicht?«
Er nickte. »Ich muss wieder rüber zum Haus.«
Im Hintergrund trugen Männer in weißer Schutzkleidung Kisten in das Haus. Die Nacht war tiefschwarz und regenfeucht. Gossensass und das Pflerschtal waren in Maries Augen die ungemütlichsten Orte, an denen man sich an einem unfreundlichen Märztag in Südtirol aufhalten konnte. Selbst an einem sonnigen Tag waren das enge Tal und der leicht angestaubte Ort an der Brennerstraße nicht gerade Hotspots in Maries Augen. Die Riesenpfeiler der Brennerautobahn empfand sie immer als bedrohlich. Nur die Pfarrkirche und die alten Knappenhäuser hatten was, fand sie. Der mächtige Tribulaun* über dem Talende war auch beeindruckend, wirkte aber gerade in der düsteren Jahreszeit doppelt mächtig und bedrohlich. Am Rande der Zufahrt, einem seit Langem nicht mehr gepflegten Kiesweg, beobachtete Marie eine ältere Frau. Sie stand dort wie angewurzelt, kaum zu erkennen in der Dunkelheit.
»Schlimm. Kannten Sie den Mann?« Marie sprach die Frage aus, kaum dass sie bei der Frau angekommen war. Die wendete ihren Blick nicht vom Haus ab, wo gerade ein Leichenwagen vorgefahren war. Die Frau trat einen Schritt zur Seite. Marie dachte schon, sie würde weggehen.
»Jetzt haben sie ihn doch gekriegt«, sprach sie mit leiser Stimme, schüttelte dabei den Kopf, »so musste es ja kommen.«
»Wer? Was meinen Sie?«, fragte Marie. »Hatte er Probleme?«
Die Frau sah Marie lange an. »Wissen Sie, der Kerschbaumer, der ist nur so alt geworden, weil er nie viel geredet hat. So mach ich das auch. Wir alle. Hoffentlich hält seine Frau dicht.« Sie ging den Kiesweg entlang und war weg. Ihr schwarzer Mantel ließ sie praktisch mit der Nacht verschmelzen. Marie blieb ratlos zurück.
Bauers Abend verlief deutlich angenehmer. Charlotte Schneiderhans, eine frühere Kollegin aus seiner Zeit als Chefredakteur eines privaten Fernsehsenders, war zu Besuch. Sie war mit kurzer Vorwarnzeit hereingeschneit – unterwegs zu einem Urlaub in der Toskana. Die Stelle hatte er damals angenommen, weil er nach vielen Jahren bei Zeitungen und Magazinen einen Tapetenwechsel brauchte. Neue Inhalte, neue Darstellungsformen. Das Fernsehen war finanziell die Insel der Glückseligen. Je länger er dort arbeitete, desto mehr hatte er jedoch das Gefühl, hinter seinem Schreibtisch zu verstauben. Die Mechanismen einer Fernsehproduktion unterschieden sich außerdem gewaltig von denen einer Zeitung. Selbst das Ego der Kollegen war grundlegend anders.
»Hast du noch ein Glas Wein?«, fragte Charlotte nicht mehr ganz so taufrisch, denn die erste Flasche hatte sie praktisch im Alleingang geleert. Dabei spielte sie mit ihren goldenen Ohrhängern, die wie immer perfekt zu ihrer Kette passten.
»Ich habe nur noch Roten.«
»Wein ist Wein. Wie hast du dich denn hier eingelebt?«, fragte sie, schaute sich dabei um. Ihr Blick glitt durch den Raum. Von einem übervollen Bücherregal über eine riesige Plattensammlung hin zu einer Bilderwand. Pressefotos in Schwarz-Weiß aus aller Welt von wichtigen Ereignissen: der Mauerfall, der Boxkampf Muhammad Ali gegen George Foreman, der Start des ersten Space Shuttles – eine Tapete zur Zeitgeschichte.
»Hier lebt es sich um Klassen entspannter als in Schickeria-München. Außerdem trifft man nicht dauernd Menschen, die man kennt.«
»Außer sie legen auf der Durchreise einen Stopp ein«, sagte sie lächelnd. »Von dir aus meldest du dich ja nicht. Man musste dich immer zu deinem Glück zwingen.«
»Dieses Glück bist du?«, antwortete Tom, der sich wieder auf dem Sessel niedergelassen hatte, der dem Sofa gegenüber stand. Mit Abstand zu seinem Gast.
Charlotte stand auf, drehte eine Runde im Wohnzimmer, bewunderte die große englische Standuhr, schaute kurz durchs Fenster auf die leere Gasse und landete wie durch Zufall auf der Armlehne von Toms Sessel.
Eine perfekte Choreografie.
»Du musst mehr unter Leute«, hauchte sie und berührte dabei seine Schulter. »Wir haben uns alle nach deinem Abgang beim Sender große Sorgen gemacht. So richtig verstanden hat dich auch keiner.«
»Ich habe es nicht mehr ertragen. Der Programmchef hat was mit dem blonden Püppchen und drei Tage später muss ich dem Team erklären, warum sie ab sofort die Primetime moderiert. Ich bin Journalist und kein Zuhälter oder Sklavenhändler«, sagte Tom, während er versuchte, seine Schulter aus Charlottes Reichweite zu bewegen. »Dieses ganze Multimediazeug … bringt Klicks, kostet Geld, mehr aber auch nicht. Ich darf gut ausgebildeten Journalisten sagen, dass wir kein Geld mehr für sie haben«, sprudelte es aus ihm heraus. »Da hock ich lieber hier, schreib ein Buch, gebe meine Abfindung aus und genieße das Leben.«
»Frauen?«
»Lotte, das geht dich nichts an. Warum interessieren sich immer alle für mein Liebesleben?« Toms Blick glitt von Charlotte in die Ferne.
»Der Gentleman genießt und schweigt«, ärgerte ihn Charlotte.
»Der Gentleman hält sich da raus. Gentlewoman sollte das genauso tun.«
»Du hast die Sache mit deiner Familie immer noch nicht verdaut, stimmt’s?« Krasse Themenwechsel waren Charlottes Spezialität.
Toms Hände verkrampften sich. In einem schlechten Film wäre das Weinglas zersprungen. Zum Glück war es aus Kristallglas, das hätte selbst Hollywood nicht geschafft.
Charlotte drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Ich mag deinen Dreitagebart«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Der neue Look des großen Tom Bauer, sehr sexy.« Sie nahm seinen Kopf in die Hände, ihre Lippen berührten sich.
»Lass gut sein, Charlotte.« Er drehte sich von ihr weg. »Ich bring dich schnell zum Hotel, es ist spät.«
»Keine Mühe, Herr Bauer, ist ja nur die Straße hoch«, sagte sie und kippte den Rest des Weins in einem Zug hinunter. »Übrigens ein schönes Hotel mit viel Holz.«
»Muss sowieso noch mal mit Luna raus«, sagte Tom, während er sich langsam erhob. Da war wieder die Last der Vergangenheit auf seinen Schultern. Luna stand schwanzwedelnd an der Tür.
Kurze Zeit später, Charlotte hatte er zum Hotel gebracht, sie leerte bestimmt gerade ein Fläschchen aus der Minibar, saß er an seinem Schreibtisch. In der Hand das Bild seiner Familie. Eine Träne bahnte sich ihren Weg durch die Bartstoppeln.
Montag, 18. März
»Luna, komm. Runde«, rief Tom der alten Beagle-Hündin zu, die ihn schon so viele Jahre begleitete. Seit kurz nach acht wirbelte seine Haushälterin Johanna durch die Wohnung. Zu früh in seinen Augen. »Damit sich der Tag lohnt, soll man früh aufstehen«, war ihr Credo. »Wenn Sie nachher putzen, bitte nicht im Arbeitszimmer«, rief Tom schnell in die Küche, wo Herberts Schwester mit dem Frühstücksgeschirr klapperte. »Nehmen Sie doch endlich die Spülmaschine.«
»Die braucht kein Mensch für Ihre zwei Teller und die eine Tasse«, echote es zurück. »Und die Weingläser«, schob sie mit einem verschmitzten Unterton nach.
»Ach, Johanna, und bitte verschonen Sie mich und andere künftig mit Mutmaßungen über mein Liebesleben, das geht Sie nichts an – Ihren Bruder mal gar nicht.«
»Ich kann Sie nicht hören, das Radio ist so laut«, kam als Antwort. Erst danach wurde die Musik aus dem Küchenradio lauter. Irgendetwas Volkstümliches hatte sie eingestellt.
Tom gab auf. »Wir gehen jetzt.« Umständlich zog er sich die alten Winterstiefel an. Das Futter war seit Jahren durchgelaufen – er mochte die Schuhe einfach. »Johanna, Finger weg vom Arbeitszimmer!« Das war sein Heiligtum. Zentral am Fenster stand ein großer alter Schreibtisch aus Kirschbaumholz, voll mit Büchern und Zeitungen. Der Ausblick: eher langweilig, ein typischer Sterzinger Innenhof, der von außen mit prächtigen Giebelfassaden die Touristen begeisterte. Dazu ein Computer aus den Anfangsjahren der Digitalisierung. In einer Ecke des Arbeitszimmers lagen sorgfältig aufgereiht einige alte Taschenuhren und zahllose Armbanduhren. Aus einer Zeit, in der man Uhren noch von Hand aufzog. Vor allem da konnte Johanna mit ihrem Staubwedel großen Schaden anrichten.
»Rrvqv Kmuflhr löeeg Ffie qu Qmkfe iür Oplffmv«, buchstabierte Marie in ihr Handy. Am anderen Ende: Mario, ein Freund aus Kindertagen, der nun in London arbeitete. Dort verdiente er sich mit irgendwelchen Banksachen dumm und dämlich. Zumindest zog ihn Marie damit immer auf. Beide telefonierten oft miteinander. In erster Linie hörte er Marie zu, wenn sie wieder ein Problem hatte – mit Geld, dem Chef oder mit Männern. Gerne mal alle Probleme gleichzeitig.
»Hä?! Warum bekommst du so was? Von wem?«
»Alter, ich habe keine Ahnung. Ist das gleiche Papier wie der Brief neulich.«
»Aber da standen normale Sätze drauf. Schick mir mal ein Bild davon. Ich schau mir das mal an. Zahlen sind zwar mehr meins …«
»Vielleicht zeig ich den Zettel mal diesem Journalisten. Gestern habe ich das nicht mehr geschafft. Dieser Mord in Gossensass ist dazwischengekommen. Vierzig Zeilen Print und Online. Bild kommt in einer Sekunde, bye.«
Blick auf die Uhr: wieder zu spät dran. Sie wollte sich in drei Minuten mit dem jungen Carabiniere treffen, der ihr gestern den Tipp gegeben hatte. Also wieder mal zu schnell fahren, wieder mal falsch parken. Was soll’s. So ist es nun mal. Sie eilte zu ihrem kleinen Fiat Uno.
»Nein, ich weiß nicht, wann ich fertig bin. Nein, ich will mich auch nicht festlegen. Ja, du bist mein Verleger. Ja, ich bin dein Freund«, rief Tom Bauer genervt in sein Handy, während sich Luna an ihrer Leine durch die Sterzinger Altstadt schnupperte. Die übliche Runde führte sie schnurstracks bis zum Deutschhaus bei der Marienpfarrkirche. Tom ärgerte sich jedes Mal, dass er seinem Verlegerfreund schon von seiner Romanidee erzählt hatte. Aus dem Feuer in der Arbeiterkaue* im Schneeberger Bergwerk 1967 wollte er eine schöne Geschichte stricken – voller Drama, Herz und Schmerz. Auf die Idee war er bei einer Führung im Bergbaumuseum im Ridnauntal gekommen. Herbert hatte ihn letzten Sommer dorthin mitgeschleppt. »Ich melde mich bei dir, dauert aber noch«, beendete Bauer das Gespräch. Er klappte das Handy zu.
Allein mit der Benutzung eines Klapphandys sorgte er immer wieder für Aufsehen. Sogar bei einem alten Mann, der hier auf einem wackeligen Schemel saß und malte. Den Rand seines abgewetzten Sitzkissens zierten Hunderte Farbkleckse. Der Maler richtete seinen Blick wieder auf den Zwölferturm. Kurz blieb Tom stehen. Die aufgestellten Bilder zeigten alle das gleiche Motiv: den Turm, das Wahrzeichen der Stadt.
»Interesse?«, murmelte der Mann durch seinen ungepflegten Vollbart.
»Echt schön, aber nicht mein Ding.« Tom war sicher, in seinem ganzen Leben keine hässlicheren Bilder gesehen zu haben. »Malen Sie immer nur den Turm?«
»Nicht nur.« Seine Augen blitzten kurz auf.
Der Beagle wollte weiter. »Wir müssen los, frohes Pinseln«, wünschte Tom und ging.
»Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder«, hörte er den alten Mann sagen, während Luna ihn Richtung Wurstbude zerrte, die am Rande des Platzes stand.
Marie erreichte das Carabinieri-Kommando an der Trattengasse in Brixen im Sprint. Genau vor dem Gittertor der Einfahrt, das gerade langsam aufglitt, wäre sie um ein Haar angefahren worden. Eine dunkle Alfa-Limousine war direkt an ihr vorbei durch das Tor gerauscht. Im Hof blieb der Wagen stehen, hinten rechts stieg ein Mann aus. »Hey, keine Augen im Kopf?«, rief Marie. Eine Antwort kam nicht. Der große schlanke Mann in einem, wie selbst Marie auffiel, teuren Anzug, verschwand sofort im Gebäude.
»Das war knapp«, sagte eine Stimme direkt hinter Marie.
Marie fuhr herum. »Mensch, musst du mich so erschrecken?«, begrüßte sie den Carabiniere, der ihr am Abend zuvor in Gossensass wenigstens ein paar knappe Infos über den Mord gegeben hatte. Küsschen links und rechts. »Carlo Pettone, mein Polizeiheld. Hast du was für mich?«, fragte sie ihn.
»Lass uns ein Stück gehen. Nicht hier.« Er zog sie vom Eingang weg, blickte sich dabei um. Er sah nicht, wie sich eine Gardine im zweiten Stock des alten Polizeigebäudes leicht bewegte. »Trinken wir einen Kaffee.«
Wenig später, in einem Café auf dem Domplatz, kam sie sofort wieder zur Sache. »Nun, was weißt du über den Mord?«
Der junge Carabiniere nippte an seinem Macchiato: »Also, das Opfer ist grausam zugerichtet worden, bevor es erschossen wurde. Gestohlen haben die nichts, der Geldbeutel lag auf der Anrichte.« Er hob die Hand: »Bevor du fragst, ich sage ›die‹, weil ich immer ›die‹ sage, egal wie viele es am Ende waren. Drinnen sah es aus wie auf einem Schlachtfeld. Die haben alles durchwühlt. Sogar Farbtöpfe haben sie ausgeschüttet, ganz schöne Sauerei.«
»Was noch?«
»Zeugen gibt es wohl keine. Der Alte war ein ziemlicher Eigenbrötler.«
»So einen erschießt man doch nicht einfach so. Vielleicht haben sie doch was gestohlen.«
»Woher sollen wir das wissen?« Dabei versuchte er, mit dem Kellner Blickkontakt aufzunehmen. »Der hatte niemanden mehr, aber die Spurensicherung ist noch da.« Er sah auf die Uhr.
»Willst du wieder los?«
»Wie du neulich«, antwortete er. »Wie an unserem ersten Abend. Da hast du mich praktisch aufgegabelt für ein schnelles Vergnügen und weg war die Reporterin.«
»So war das nicht.« Auch kein Vergnügen.
»Wahrscheinlich nur, damit ich dir Tipps gebe, wie beim Mord, oder?«
»Sag das nicht. Ich wusste gar nicht, dass du bei denen bist«, sie deutete in die grobe Richtung, wo die Carabinieri-Station lag. Carlo konnte ja nicht wissen, dass Marie ihn sehr wohl schon in Uniform gesehen hatte, bevor sie sich angeblich zufällig kennengelernt hatten. »Wer war eigentlich der Typ im Anzug, der mich fast über den Haufen gefahren hat, eben vor dem Kommando?«
»Keine Ahnung. Nummernschild aus Mailand, mit Fahrer – hohes Tier schätz ich.«
»Wegen des Mordes?«
»Nicht alles dreht sich um ›deinen‹ Mord. Was ist denn nun mit heute Abend mit dem Club?«
Marie sah nun ihrerseits auf die Uhr. Siedend heiß fiel ihr ein, dass sie ihm eigentlich versprochen hatte, als Dank für den Hinweis auf den Mord, mit ihm auszugehen. »Mir ist da was dazwischengekommen.« Jetzt winkte sie nach dem Kellner. »Ich zahle.«
»Was heißt, wir sollen den Mord nicht an die große Glocke hängen?« Der Ermittlungsleiter Guido Rossi war aufgebracht. Sein Kugelschreiber diente ihm als Ventil. Klick, klick. Seit mehr als zehn Jahren war er nun in Sterzing stationiert. Einige größere Fälle hatte er aufgeklärt, aber so einen Mord gab es selten. Wenn mal jemand ums Leben kam, war der Täter ein Betrunkener oder ein Verwandter oder ein betrunkener Verwandter. Eingemischt hatte sich in seine Arbeit eigentlich noch niemand. Vor zwei Stunden hatte ihn jedoch sein Vorgesetzter ins Kommando nach Brixen bestellt.
»Wir sollen bloß kein großes Fass deswegen aufmachen«, beschwichtigte dieser ihn. Major Mario Celloni war das Paradebeispiel eines Vorgesetzten in einer italienischen Amtsstube. Nicht auffallen, Arbeit abwälzen, Lorbeeren ernten. Freitags am besten früh gehen, montags spät kommen. Gerne war er aber auch mal militärisch streng.
»Sagt dieser Typ aus Mailand …« Klick, klick. Rossi hatte die Limousine nämlich wegfahren sehen.
»Sag ich! Reiß dich mal zusammen. Wenn die das nicht wollen, wollen wir das auch nicht«, fiel Celloni dem Ermittlungsleiter ins Wort. »Ist doch für uns alle am einfachsten.«
»Nenn mir einen Grund, warum der Typ hier auftaucht. Nur einen.« Klick. »Warum jemand aus Mailand, die haben nix mit uns am Hut.«
»Der war gar nicht deswegen da …«
Klick, klick. »Erzähl keinen Mist, ich glaub dir kein Wort.« Rossi hatte genug gehört, er sprang auf, knöpfte sein Sakko zu und ging zur Tür.
»Warte, warum lungert da draußen diese Pressetante rum? Ich habe sie eben vor der Station gesehen. Hör mit diesem nervigen Geklicke auf.« Das klang wie ein Befehl.
»Keine Ahnung, vielleicht steht sie auf Uniformen? Ich habe Besseres zu tun. Wenn du mich jetzt wieder an die Arbeit lässt …« Klick.
Mit einem Wink, wie ihn selbst ein Imperator nicht besser gekonnt hätte, erklärte Celloni das Gespräch für beendet.
Rossi war keine Sekunde später draußen. Den Kugelschreiber fest in der Hand. Klick, klick.
Celloni griff zum Telefon, wählte eine Mailänder Nummer.
Dienstag, 19. März
Marie bestellte ihren dritten Latte mit Hafermilch – von Tom Bauer noch keine Spur. »Herby, bist du sicher, dass er kommt?« Sie klang leicht genervt.
»So sicher, wie nach dem Winter der Frühling kommt.«
»Mal rausgeschaut? Nass, kalt und der Wind bläst durch Sterzing wie durch eine verdammte Düse.«
»Dienstags kommt er immer vormittags. Warts nur ab«, sagte Herbert, während er für einen anderen Gast einen Espresso machte. Mit Hingabe presste er das Kaffeepulver in den Siebträger. Kurz darauf startete die Höllenmaschine ihr zischendes und dampfendes Werk. Durch die leicht beschlagenen Fenster sah er, wie sich Tom Bauer seinen Weg Richtung Eingang bahnte. In der einen Hand die Hundeleine, in der anderen einen Regenschirm. »Wer sagt’s denn?«
»Luna, hierhin«, waren Bauers erste Worte, als er zu seinem Stammplatz kam. Gleich der Tisch links neben der Tür, weil der ein bisschen zurückgesetzt war. Dort bekam man im Winter nicht immer einen Schwall kalte Luft ab. »Entschuldigen Sie. Der Hund mag wohl Ihre Tasche.« Die Hündin hatte ihre Nase tief in Maries alter Militärtasche vergraben, ließ sich nur mit Mühe von ihrem Fundstück am Fuß des Tresens wegziehen. Jetzt erst erkannte Tom Marie wieder.
»Macht nix«, sagte Marie, »ich mag Hunde.« Noch während sie das sagte, war sie aufgestanden und rasch die paar Schritte von der Bar zu Bauers Platz gegangen. Sie setzte sich, ohne zu fragen.
»Sie lassen wohl nie locker? Wie war ihr Name?«
»Marie, Marie Pichler.«
»Ich gebe auf.« Er breitete die Arme aus, wie ein Gejagter, der sich seinen Verfolgern stellt. »Was haben Sie auf dem Herzen?« Ein wenig imponierte ihm die junge Frau – offen zugeben würde er das nie. »Bitte, wenn wir sprechen, lassen Sie Ihr Handy in der Tasche und fummeln nicht immer daran herum.«
»Smartphone.«
»Wie bitte?«
»Man nennt es eigentlich Smartphone. Nicht Handy«, korrigierte sie ihn und zeigte ihr bestes und oft erprobtes Lächeln. Sie deutete auf sein Handy. »Ihres nennt man Knochen.« Wieder dieses Lächeln, das die Augen funkeln ließ.
»Also, wo drückt der Schuh? Eins ist klar: Ich werde niemanden wegen eines Praktikums oder so anrufen.«
»Sehe ich so aus? Lesen Sie das.« Sie gab ihm einen Briefumschlag mit einem einfachen Zettel darin.
»Von wem ist der?«, fragte er, während er die beiden Sätze las:
Wer waren die Helfer?
Such sie, bevor es sie nicht mehr gibt.
»Keine Ahnung. Der lag in meinem Briefkasten. Nur einen Tag nach einer Story von mir über die Bombennacht und die Puschtra Buibm*. Da ging es um die Frage, ob die Männer begnadigt werden sollen. Print und Online.«
»Diese Jungs, die zu Bombenlegern wurden?« Tom hatte einiges darüber gelesen. Sogar ein Buch*, das einer der Männer selbst geschrieben hatte.
»Es waren einfache, ehrliche Jungs aus dem Pustertal, die für die Freiheit gekämpft haben«, erklärte sie. »Ich glaube, der Zettelschreiber meint, ich soll alle suchen, die damals den Freiheitskämpfern geholfen haben – sie versteckt oder mit Essen versorgt haben. Die, die bisher keiner kennt, die nicht aus der Deckung gekommen sind«, sagte sie. »Das ist eine geile Story, vielleicht für ein Buch.« Sie sprudelte vor Elan. »Das ist meine große Chance – raus aus Südtirol. Vielleicht zu einer Zeitung in Österreich oder sogar Deutschland.«
»Was erwarten Sie von mir?«, fragte Tom. »Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass sich jemand einen dummen Scherz erlaubt haben könnte?«
»Das ist kein Scherz, das spür ich. Herbert meint, sie könnten mir ein paar Tipps für die Recherche geben.«
»Was haben Sie denn alles?«
»Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen, ich habe in Archiven gesucht, sogar mit den Behörden hier hatte ich Kontakt, auch in Bozen, Meran und Rom.«
»Nichts gefunden?«
»Nur, was schon bekannt ist. Oben in Gries am Brenner«, sie bewegte kurz ihren Kopf, als würde sie in die Richtung zeigen, »habe ich einen Zeitzeugen gesprochen. Josef heißt er. Er hat damals, als sie die Strommasten gesprengt haben, hier in Sterzing gelebt. 1961 in der Herz-Jesu-Nacht war das. Mit seinem Chef, einem Schmied, ist er viel herumgekommen. Aus Innsbruck haben sie immer mal Koffer mit nach Südtirol gebracht.«
»Was war drin in diesen Koffern?«
Marie schlug nun ein Notizbüchlein auf, das sie aus ihrer Jackentasche gefischt hatte. »Geld, Pistolen, Ferngläser, Anziehsachen und Kleinkram wie Malerfarben.«
»Farben?«
»Ja, Malerfarben. Vielleicht Tarnung, wie auch die Klamotten. Gelagert wurde alles beim Schmied, abgeholt hat es ein Deutscher, der ab und zu in Sterzing übernachtet hat. Er hat mir versprochen, mir noch einen Kontakt zu besorgen.« Sie sah Bauer erwartungsvoll an.
»Aber neu ist das nicht«, sagte er langsam. Er dachte nach. »Vielleicht war dieser Zettel doch nur ein Spaß.«
Marie kramte in ihrer abgewetzten, olivgrünen Baumwoll-Militärtasche um ihren Laptop herum. »Was ist das?« Sie betonte jedes der drei Worte, dabei legte sie einen weiteren Zettel auf den Tisch.
Tom betrachtete den zweiten Zettel. Er buchstabierte: »Rrvqv Kmuflhr löeeg Ffie qu Qmkfe iür Oplffmv – was heißt das?«
»Keine Ahnung. Der gleiche Zettel aus dem gleichen Block gerissen.« Sie deutete auf die beiden Blätter. »Das ist doch kein Zufall.«
»Bitte, da will Sie jemand reinlegen. Zwei wirre Botschaften, eine zittrige Handschrift, ein paar Farbkleckse hinten drauf? Da nimmt Sie jemand hoch.«
Marie nahm die beiden Zettel vom Tisch und stand auf. Etwas lauter als beabsichtigt meinte sie: »Habe ich mir gleich gedacht, dass das alles nichts bringt.«
»Jetzt flippen Sie doch nicht gleich aus«, versuchte Tom sie zu beruhigen.
»Ich flippe nicht aus. Da draußen ist eine Story, die werde ich finden. Allein.« Demonstrativ nahm sie ihr Handy und wischte wild darauf umher. »Ich muss außerdem los.« Sie zog sich eilig die Jacke an. »Danke für nichts.«
Gut eine Stunde später, Tom hatte das Gespräch mit Marie fast wieder vergessen, zog ihn die Hündin zurück Richtung Wohnung durch die Altstadt. Oder eher zum Speckladen hin, der für die feine Nase eines Hundes so etwas wie das Paradies sein musste. Dabei trafen sie wieder den alten Maler, der gerade aus der Bäckerei auf die Straße trat.
»Sieh an, der Mann, der keine Turmbilder mag«, sagte er durch seinen Ötzi-Bart.
»Das habe ich so nicht gesagt.«
»Nette Begleitung eben, die junge Frau.« Er grinste verschwörerisch.
Hast du uns durchs Fenster beobachtet? »Sie müssen es ja wissen.«
»Manchmal öffnen uns die jungen Frauen die Augen«, murmelte der Alte und ging Richtung Zwölferturm.
Tom schaute ihm noch einen Moment hinterher, bis Lunas Leine die vollen acht Meter erreicht hatte. Zwei grimmig dreinblickende Urlauber in identischen Outdoorjacken wären fast darüber gestolpert.
»Der Tag ist fast vorüber und wir haben nichts in den Händen.« Ermittlungsleiter Guido Rossi pfefferte einen dünnen Aktenordner auf den Tisch des Besprechungszimmers in der Sterzinger Carabinieri-Station. Die beiden Carabinieri am Tisch sahen ihn mit großen Augen an. So hatten sie ihn noch nie erlebt. Aber sie hatten auch noch nie mit einem Mord ohne Motiv zu tun gehabt.
»Wir warten auf die Gerichtsmedizin und die Ergebnisse der Spurensicherung«, versuchte die junge Beamtin Chiara Bonverde ihren Chef zu beruhigen. Sie trug noch ihre betont sportlich geschnittene Primaloftjacke, weil sie recht spät zur Besprechung gekommen war. Die zog sie jetzt aus.
»Wir brauchen Verstärkung«, polterte Rossi weiter. »Die bekommen wir aber nicht.«
Franz Moser, der älteste Ermittler in der Runde, wenngleich eine Stufe unter Rossi in der Hierarchie, saß wie immer auf seinem Stammplatz im Besprechungsraum. »Die Nachbarin hat nichts gesehen, sie weiß nicht, ob der Tote Probleme oder Feinde hatte.« Er blätterte in seinen Notizen. »Sie glaubt, nicht.«
»Was ist mit der Pflegerin, die ihn gefunden hat?«, wollte Rossi wissen.
Wieder blättern. »Die haben wir zum zweiten Mal befragt. Der Kerschbaumer hatte keine Probleme oder Feinde, sagt sie. Sie denkt nicht, dass er irgendetwas Wertvolles besessen hat. Fehlt jedenfalls nichts.«
»Warum suchen wir nicht Zeugen über die Medien?«, fragte Chiara zögernd. Sie war erst seit einem knappen Jahr bei den »Gewaltverbrechen«. Eine so steile Karriere nahmen ihr einige übel. Nicht wenige lauerten deswegen auf Fehler des »Kükens«, wie sie hinter ihrem Rücken genannt wurde. Dazu kam eine Traumfigur – in den Augen vor allem der Kolleginnen ein Indiz, dass es bei ihrem Aufstieg nicht mit rechten Dingen zugegangen sein konnte. Sie taten ihr Unrecht. Mit Bestnoten war sie schnell aufgestiegen, ihre Figur verdankte sie vielen Mountainbike-Touren daheim in Brixen.
»Weil wir das nicht an die große Glocke hängen sollen.« Rossi hätte am liebsten mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Klick, klick. »Wenn ich denen jetzt mit Öffentlichkeit komme, schreib ich bald wieder Parktickets.«
Als hättest du jemals Falschparker gejagt. »Ja, aber …«
»Vergiss es, Chiara, gewöhn dich dran.« Klick, klick. »Das nennt man Hackordnung.«
Chiara sah zu Franz Moser rüber. Der immer etwas grummelige Ermittler mit Hang zu Süßigkeiten hatte weiter in seinen Notizen gelesen, wohl aber nichts Interessantes mehr gefunden. Zumindest machte er keine Anstalten, noch etwas zu sagen. Er kritzelte nur ab und zu Striche auf seinen Block. Hilfe war von ihm also nicht zu erwarten.
»Chiara, du rufst noch mal in Bozen bei der Kriminaltechnik an. Mach Druck. Franz, du hakst bei der Gerichtsmedizin nach. Mehr können wir eh nicht tun.« Klick, klick.
»Beruhige dich mal, wir schaffen das«, schmunzelte Moser, der wieder einmal froh war, dass nicht er solche Ermittlungen leiten musste. »Was machst du?«
»Ich spreche mal mit dem Staatsanwalt, ob wir nicht doch etwas Hilfe bekommen.« Daran glaubte er aber nicht. Klick, klick.
Nach einem langen Nachmittag in der Redaktion und einem schnellen Abendessen in einer kleinen Bar in der Brixner Altstadt kam Marie erschöpft heim. Jetzt schnell duschen und doch den süßen Carabiniere treffen. Immerhin kommt er sich dann nicht ausgenutzt vor. Als sie gerade Jeans und Pullover ausgezogen hatte, klingelte es an der Tür. Marie zog sich den Pulli wieder über, wickelte sich ein Handtuch um die Hüften und öffnete. Zwei Polizisten standen vor ihr.
»Frau Pichler? Polizia!«
»Was gibt’s?«, fragte Marie, bemüht, dass das Handtuch nicht verrutschte. Hätte sie doch besser die Jeans wieder angezogen. »Ist was passiert?«
»Der schwarze Uno vor dem Haus ist ihrer?«, fragte der ältere der beiden Polizisten.
Marie stöhnte genervt. »Ach, kommen Sie, ich stehe nur mit dem Hinterreifen ein klitzekleines Stück im Parkverbot. Und außerdem …«
Der Ältere fiel ihr ins Wort: »In ihren Wagen ist eingebrochen worden, die Scheibe ist kaputt.« Der Jüngere hatte nur Augen für Marie, vielmehr für ihr Handtuch.
»Bitte? Ich komme, zieh mir nur kurz was an«, sagte Marie, während sie die Tür hinter sich zuwarf.
Im nächsten Augenblick eilte sie schon mit den beiden Polizisten das Treppenhaus hinunter auf die Straße. Das Beifahrerfenster des Fiats war eingeschlagen, das Handschuhfach stand offen. Im Fußraum lagen Splitter, Unmengen Papiere, eine kleine Digitalkamera und jede Menge anderer Kram. Ein Zippbeutel mit Gras von einem früheren Freund war auch dabei. Marie versteckte ihn schnell.
»Fehlt was? Lag was auf dem Beifahrersitz oder hinten?«, fragte der Ältere.
»Da lag nichts. Sonst … glaub nicht.« Marie wischte die Scherben vom Beifahrersitz, sammelte alles aus dem Fußraum ein und legte es auf den Sitz. »Die kleine Kamera hat den Dieb wohl nicht interessiert?«
»Zu alt. Lohnt nicht. Meist wollen die Laptops, richtige Kameras oder Geld, wenn irgendwo eine Handtasche rumliegt«, sagte der jüngere Polizist, der noch immer mit mehr Interesse Marie ansah als den Schaden am Auto. »Nach Handtasche sehen Sie nicht aus«, schmunzelte er. Der Ältere kam mit einer Rolle Folie zurück, die er aus dem hellblauen Streifenwagen geholt hatte. Er machte sich daran, das Fenster abzukleben.
»Was passiert jetzt?«, wollte Marie wissen, »Muss ich mitkommen?«
»Nein, wenn nichts weg ist, das Fenster ist dicht. Kommen Sie morgen in die Station in der Alpinistraße, da nehmen die Kollegen eine Anzeige auf«, sagte der Ältere, während er den Rest Folie wieder ordentlich zusammenrollte. Der Abend war für Marie gelaufen. Noch einen Beamten wollte sie garantiert nicht treffen. Auch wenn Carlo recht süß und von der anderen Truppe, den Carabinieri, war – also zudem recht nützlich.
Mittwoch, 20. März
»Geht das nicht ein bisschen schneller? Ich habe keine Zeit«, sagte Marie, während der Polizist seine dicklichen Finger über die Tastatur kreisen ließ. Ab und zu fand einer sogar sein Ziel.
»Immer mit der Ruhe. Alles braucht seine Zeit«, war die Antwort. »Sie sagen, dass nichts aus Ihrem Auto gestohlen wurde. Lag denn irgendetwas sichtbar im Innenraum?«, wollte er zum zweiten Mal wissen.
»Nein und noch mal nein«, Marie war zusehends genervt. »Das habe ich alles gestern schon gesagt. Ihr findet die doch eh nicht, also kann ich mir das auch sparen.«
»Sagen Sie niemals nie«, kam die Antwort von der anderen Seite des Schreibtisches. Der stand am Fenster, durch dessen Gitter nur spärlich Licht hereinfiel. An der Wand hing ein Poster mit der italienischen Fußballnationalmannschaft. Ein älteres Bild, denn die Spieler hatten lange Haare, Koteletten und keine Tattoos. »Schnell drucken, damit alles seinen Weg geht.«
Schnell? »Ein Weg ins Nirgendwo«, unkte Marie.
»Vielleicht haben wir Glück und es meldet sich ein Zeuge.«
Die Tür ging auf und herein kam ein Mann im Anzug, die Krawatte gelockert, obwohl es erst halb zehn war. Marie erkannte den Ermittlungsleiter im Mordfall erst auf den zweiten Blick. Ihre Chance.
»Oberleutnant Rossi, was für ein Zufall: Sie hier in Brixen und bei der Staatspolizei. Ich wollte Sie heute noch anrufen«, log sie. »Marie Pichler vom ›Boten‹, es geht um den Mord …«
»Welchen?«, unterbrach er.
»Gibt es mehrere? Ich spreche von dem Mord an dem alten Mann in Gossensass. Gibt es da was Neues, Spuren oder so?«
»Nein, nichts, keine Zeugen, kein Motiv«, war die Antwort. »Viel Hoffnung habe ich nicht.«
»Darf ich das zitieren?«
»Nein, nichts dürfen Sie. Höchstens uns unsere Arbeit machen lassen«, patzte Rossi zurück.
Marie wagte einen Schuss ins Blaue: »War der Mann aus Mailand gestern deswegen hier in Brixen? Ich habe ihn nämlich beim Kommando gesehen.«
Klick, klick. »Keine Ahnung. Was sollte jemand aus Mailand mit den Ermittlungen zu tun haben?«
»Nur so. Der hätte mich fast über den Haufen gefahren, hatte es verdammt eilig. Da habe ich eins und eins zusammengezählt.«
»Und sich verrechnet.« Rossi legte einige Aktenordner auf eine Ablage, auf der »Posteingang« stand, nickte zum Abschied und ging.
Marie wollte hinter ihm her. Der rundliche Polizist bremste sie. »Sie müssen noch unterschreiben.«
Am Nachmittag hatte Tom es sich bei Herbert bequem gemacht. Er dachte an den Besuch seiner früheren Kollegin Charlotte. Sie sitzt bestimmt auch gerade in einer Vinothek, hat aber schon drei Gläser Chianti intus und einem x-beliebigen Miturlauber von der bezaubernden Landschaft vorgeschwärmt und ihm einen Kurzabriss über die Geschichte von San Gimignano verpasst. Tom musste grinsen.
Das bemerkte auch der Wirt Herbert. »An was denkst du?«
»Nichts. Zumindest nichts, das dich etwas angehen könnte.«
»Hast du unserer Marie helfen können?«
Unsere Marie? »Nein, habe ich nicht«, antwortete Tom. Er nippte an seinem Cappuccino. »Irgendwelche wirren Zettel hatte sie, keine Ahnung, vielleicht hat sich irgendjemand einen Scherz erlaubt.«
»Ich find es spannend. Überleg mal, wie wenige Menschen noch leben, die damals mitgeholfen haben. Viele sind es nicht mehr.«
»Ich glaube, da ist nichts dran. Außerdem, was sollten diese Menschen zu erzählen haben? Da ist doch längst alles gesagt, die Bombenleger von damals haben sogar im Fernsehen Interviews gegeben. Wen sollte es interessieren, wenn der heute 90-jährige Bauer sagt, dass er in grauer Vorzeit Waffen und Sprengstoff in der Schweinekacke versteckt hat?«
»Sagst du. Ich sage dir, die Menschen hier interessiert das immer noch. So lange hier Straßen- und Ortsnamen zweisprachig sind, so lange werden wir hier daran erinnert.« Herbert sah nachdenklich aus. »Weißt du überhaupt, wie es damals hier war? Wie der Staat versucht hat, aus den Südtirolern eine Minderheit zu machen?« Er war ernst geworden. »Die haben das Land überschwemmt mit welchen aus dem Süden. Tausende Sozialwohnungen hat Rom gebaut, schau dir doch die Blöcke in Bozen mal an, da hat kein Südtiroler eine Wohnung bekommen. Karriere in den großen Firmen oder Behörden, die haben nur die Italiener machen können. Wir nicht.«
»Klar, ich weiß das«, sagte Tom, der sich noch an Erzählungen seines Vaters erinnerte, wie gut bewacht in den 1960er-Jahren die Grenze war. »Trotzdem ist eine Geschichte irgendwann mal auserzählt.«
»Wenn du meinst. Ich helfe ihr, ich habe schon rumtelefoniert«, grinste Herbert geheimnisvoll und zog an seiner E-Zigarette. Er hatte sich ein wenig beruhigt.
»Rauchen verboten«, motzte Tom, der es sich schon vor 20 Jahren abgewöhnt hatte.
»Ist kein Rauch, sondern Dampf. Außerdem ist es mein Laden und außer dir ist kein Gast da.«
»Damit du von deinem rauchenden Dampf wegkommst, mach mir doch einen Speck-Toast.« Während er wartete, blätterte er die Tageszeitung durch und entdeckte einen Artikel von Marie. Er las aufmerksam. Schreiben kann sie, viele Infos gibt’s wohl nicht zu dem Mord. Vor dem Fenster stiefelte, gebückt gegen den Wind, der alte Maler vorbei. Diesmal ohne seine Utensilien. »Sag mal, kennst du diesen Typen, der da immer den Turm malt?«
»Keine Ahnung«, antwortete Herbert, der zusah, wie schnell Tom den Toast verdrückte. »Ich habe den vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen, ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit.« Er trat ans Fenster und sah dem Maler nach.
»Find ich auch. Sonst kleben diese Typen eher im Sommer auf der Straße«, grübelte Tom halblaut.
»Weißt du«, sagte Herbert, »mir kommt er bekannt vor, vielleicht spreche ich ihn mal an.«
»Immerhin ist er der erste Mensch, den ich hier getroffen und mit dem ich noch vor dir gesprochen habe.«
»Du? Gesprochen?«, lachte Herbert. »Unglaublich.«
»Glaub, was du willst. Pagare.«
»Deutsch bitte, wir sind in Südtirol.«
»Dann will ich aber eine Quittung«, schmunzelte Tom.