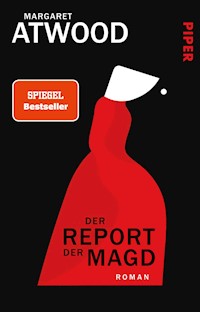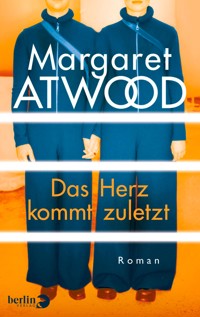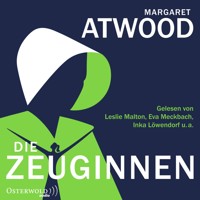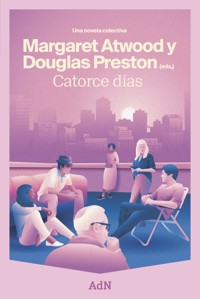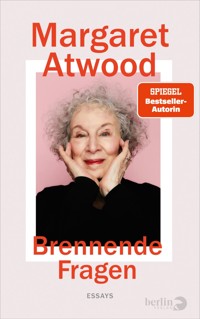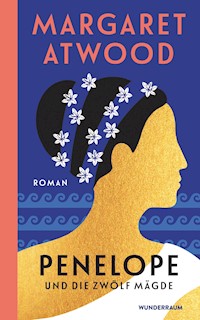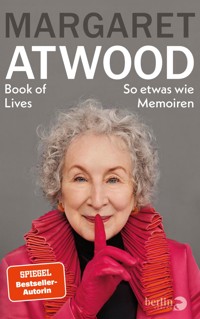
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich existiere dank einer riesigen grünen Raupe.« Als Tochter von Wissenschaftler:innen verbrachte Atwood den Großteil ihrer Kindheit in der kanadischen Wildnis – der Start in ein Ausnahme-Leben. Es folgen die Jahre, in denen sie erst Teil der literarischen Bohème und dann zu jener Autorin wurde, deren legendärer »Report der Magd« (geschrieben im Berlin der 1980er Jahre) unsere Welt bis heute prägen. Atwood erzählt, wie es weiterging, lässt uns teilhaben an ihren Freundschaften, am Leben mit ihrem Mann Graeme. Das Ergebnis ist ein farbenfrohes, hochamüsantes Buch voller überlebensgroßer Figuren: Dichter, Bären, Hollywood-Schaupieler ... Ein Einblick in ihr Schreiben, in die Verbindungen zwischen realem Leben und Kunst und in die Funktionsweise eines der kreativsten Köpfe unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv:
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Motto
EINFÜHRUNG
Book of Lives
Kapitel 1: ABSCHIED VON NOVA SCOTIA
Landmäuse und Stadtmäuse: Ein Exkurs
Kapitel 2: BUSCHBABY
Ab in den Wald
Kapitel 3: ASZENDENT ZWILLING
Und wieder: Ab in den Wald
Ottawa-Winter und ein fliegender Eisbrocken
Gutenachtgeschichten und Hasenkekse
Kapitel 4: SCHABERNACKLAND
An der Nordküste des Lake Superior
Meine Mutter hinterlässt mir eine Nachricht
Kapitel 5: KATZENAUGE. DIE VORGESCHICHTE
Klasse vier – die Unglückszahl
Nichts weiter als ein Spiel Karten
Kapitel 6: HALLOWE’EN-BABY
Meine Schwester wird geboren
Kapitel 7: SYNTHESIA
Gripsklasse
Altmodisches Dating und hexenhafte Englischlehrerinnen
Kapitel 8: »FIRST SNOW«
Der große Kraftakt
Kapitel 9: THE TRAGEDY OF MOONBLOSSOM SMITH
Ich lerne, Kaffee zu trinken
Kapitel 10: »SNAKE WOMAN«
Joe der Kommunist und andere White-Pine-Freunde
Kapitel 11: BOHEMIAN EMBASSY
Harold heiratet
Schreibland
Zwei Geschichten über das Erbrechen
Kapitel 12: DOUBLE PERSEPHONE
Leere Seiten
Kapitel 13: DER REPORT DER MAGD. DIE VORGESCHICHTE
Das aufgeklärte Zuhause der Demokratie
Mein Haustier, der Leguan
Kapitel 14: HOCH IN DIE LUFT SO BLAU
Mrs. Sims von Canadian Facts
Die Karten lesende Hellseherin
Kapitel 15: THE CIRCLE GAME. DIE VORGESCHICHTE
England und Frankreich zum Nulltarif
Kapitel 16: DIE ESSBARE FRAU
Kafka im Morgengrauen
Termiten im Gebälk
Kapitel 17: ALIAS GRACE. DIE VORGESCHICHTE
The Journals of Susanna Moodie
Die gigantische Zunge
Kapitel 18: THE ANIMALS IN THAT COUNTRY
Ist das jetzt der große Durchbruch?
Ein weiteres unerwartetes Ereignis
Jack the Mac
Kapitel 19: GRAEME. DIE VORGESCHICHTE: TEIL EINS
Wir hätten Graeme beinahe verloren
Der junge Graeme, Trickbetrüger
»Hey, Castro!«
Kapitel 20: DER LANGE TRAUM
Dornröschens Schloss
Blitzeinschlag
Eine Geistergeschichte
Ein seltsamer Anruf
Kapitel 21: GRAEME. DIE VORGESCHICHTE: TEIL ZWEI
Rent-a-Beatnik
Graeme betritt die Literaturszene
Und hier komme ich ins Spiel
Kapitel 22: DIE ESSBAREN
Auftritt Phoebe-die-Agentin
Auftritt Tony Richardson
Kapitel 23: GRAEME. DIE VORGESCHICHTE: TEIL DREI
Harold Wilson, der Papagei
Kapitel 24: SURVIVAL
Ich werde von Graeme fotografiert
Tür A, Tür B oder Tür C?
Kapitel 25: »MONOPOLY«
Weltberühmt in Kanada
Gefährliche Wegelagerer
Kapitel 26: LADY ORAKEL
Graemes Arche
Gemeinschaft der Träume
Kapitel 27: DAYS OF THE REBELS
Die Arbeiten des Herkules
Hoch oben im Baum
Beinahe hätten wir Graeme verloren – wieder einmal
Auftritt von O. W. Toad
Und schon wieder hätten wir Graeme beinahe verloren
Kapitel 28: DIE UNMÖGLICHKEIT DER NÄHE
Einmal um die Welt in ziemlich vielen Tagen
Ich schon wieder
Wir verlieren Graeme diesmal fast wirklich
Kapitel 29: VERLETZUNGEN
Ratten, Kakerlaken, Läuse und Kätzchen
Der Schriftsteller und die Menschenrechte
Scharlachsichler
Maria Stuart sabotiert meinen Roman
Kapitel 30: DER REPORT DER MAGD
Ursprungsgeschichte Nr. 1
Ursprungsgeschichte Nr. 2
Ursprungsgeschichte Nr. 3
Wir kaufen ein Sektenhaus
Kapitel 31: KATZENAUGE
Über den Ruhm: Ein Exkurs
Die Schlucht
Kapitel 32: DIE RÄUBERBRAUT
Carl vergisst Dinge
Carl verlässt uns
Kapitel 33: ALIAS GRACE
Die Rückkehr von Grace
Kapitel 34: DER BLINDE MÖRDER
Wie ich meine Figuren benenne
Kapitel 35: DIE MADDADDAM-TRILOGIE
Die Penelopiade
Ein weiteres Schreibversteck
Zombies, Run!
Graeme zeichnet eine Uhr
Kapitel 36: DIE ZEUGINNEN
Der Niedergang beginnt
Der Manuskriptdieb
Kapitel 37: INNIGST – DEARLY
Kapitel 38: HIER KOMMEN WIR NICHT LEBEND RAUS
Kapitel 39: PAPER BOAT
Danksagung
Helfer bei diesem Buch
Und bei früheren Büchern
Grafik
Oper, Lieder, Ballett, Theater
Film und Fernsehen
Technologie, Unternehmertum, Online-Plattformen
Naturschutz
ANHANG
Wie ich Entomologe wurde
Inhalt
Abbildungsnachweis
Übersetzernachweis
Chronologisches Werkverzeichnis
Bildteil
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für meine Familie, Freunde und Leser.
Und wie immer für Graeme.
Motto
Du warst so ein sensibles Kind!
— Meine Mutter
Aber inzwischen bin ich ziemlich hartherzig.
— Ich
Ja. Bist du.
— Meine Tochter
Eines Tages wird dir dein vorlautes Mundwerk noch zum Verhängnis.
— Mein Vater, als ich ein Teenager war
Sie wäre so eine großartige Victorianistin geworden.
— Jerry Buckley, mein Doktorvater
Auch ohne mich wäre deine Mutter eine erfolgreiche Autorin geworden, aber sie hätte nicht so viel Spaß gehabt.
— Graeme Gibson, mein Partner, zu unserer Tochter
Mach sie nicht stinksauer, oder du wirst ewig leben.
— Julian Porter, mein Freund
EINFÜHRUNG
Ich hatte fast erwartet, meinen Doppelgänger durch die Stadt rennen zu sehen, verfolgt von einem wütenden Mob – aber so lief das wohl nicht.
— Ransom Riggs, Die Insel der besonderen Kinder
Vor einigen Jahren wurde ich um einen Überraschungsauftritt in einer Comedyshow gebeten. Der Moderator, Rick Mercer, hatte eine Serie gestartet, in der Menschen, die für eine bestimmte Leistung bekannt waren – etwa fürs Schreiben –, die Zuschauer verblüfften, indem sie etwas völlig anderes taten, zum Beispiel einen Joint drehen. »Ich will, dass du Eishockey-Torwart bist«, sagte Rick.
»Oh, lieber nicht«, antwortete ich. »Könnte ich vielleicht einfach einen Kuchen backen oder so?«
»Nein. Du musst Torwart sein.«
»Warum?«
»Weil es lustig sein wird. Vertrau mir.«
Also war ich ein Torwart – komplett mit Beinschützern, Handschuhen und Schläger. Da bin ich, auf YouTube, immer noch als Torwart unterwegs; und ja, es ist tatsächlich irgendwie witzig.
Ich trug meine eigenen kleinen weißen Kunstlaufschlittschuhe mit schwarzen Socken drüber, damit sie wie Hockeyschuhe aussahen. Aber man kann sich mit Kunstlaufschlittschuhen nicht auf die Seite werfen, um den Puck zu blocken – diese Kunststücke übernahm ein Double: eine talentierte Eishockeyspielerin. Dank ihrer Gesichtsmaske merkt man nicht, dass nicht ich es bin. Die Aufgabe eines Doubles ist es, Risiken einzugehen, für die man selbst zu träge, zu ängstlich oder zu untalentiert ist.
Ich wünschte, ich hätte so ein Double auch in meinem echten Leben, dachte ich. Das wäre wirklich nützlich gewesen.
Natürlich habe ich eins. Jeder Schriftsteller hat eins. Der Doppelgänger taucht in dem Moment auf, in dem man zu schreiben beginnt. Wie könnte es auch anders sein? Da ist das alltägliche Ich – und dann ist da die andere Person, die das eigentliche Schreiben übernimmt. Diese beiden sind nicht identisch.
Aber in meinem Fall sind es mehr als zwei. Es sind viele.
Einige Monate nach der Veröffentlichung meines sechsten Romans, Der Report der Magd, trat ich bei einer Veranstaltung auf, um das Buch zu bewerben. Während der allgemeinen Fragerunde – mit Mikros, die viele Anwesende nutzten, um Predigten zu halten – äußerte ein Mann seine Meinung.
»Der Report der Magd ist also autobiografisch«, sagte er. Es war keine Frage.
»Nein, ist er nicht«, sagte ich.
»Doch, ist er.«
»Nein, ist er nicht. Er spielt in der Zukunft«, entgegnete ich.
»Das ist eine Ausrede«, sagte er.
Natürlich lag er falsch. In meinem eigenen gelebten Leben hatte ich weder ein rotes Gewand noch eine weiße Haube getragen, noch war ich gezwungen worden, für die oberste Riege einer theokratischen Gesellschaft Kinder zu gebären. Aber in einem sehr weiten Sinne hatte er recht. Alles, was ins Schreiben einfließt, hat in irgendeiner Form den eigenen Geist durchlaufen. Man kann mischen, kombinieren und neue Chimären erschaffen, aber das Ausgangsmaterial muss durch den eigenen Kopf gegangen sein. Ist »Autobiografie« nur die Abfolge von Ereignissen, die einem in der physischen Welt widerfahren sind, oder ist sie auch das Protokoll einer inneren Reise? Ist sie wie Defoes Robinson Crusoe (so habe ich meine Hütte gebaut) oder eher wie Newmans Apologia Pro Vita Sua (darum habe ich meinen Glauben geändert)?
Als zum ersten Mal die Idee aufkam, eine »literarische Autobiografie« zu schreiben (von wem? Mein Gedächtnis zuckt nur mit den Schultern, aber es war jemand aus dem Verlagswesen), antwortete ich ihm, ihr oder ihnen: »Das wäre doch öde. Kennen Sie den schlechten Witz über den alten Fischer von der Ostküste, der Fische zählt? ›Ein Fisch, zwei Fische, noch ein Fisch, noch ein Fisch, noch ein Fisch …‹ So wäre auch meine ›literarische Autobiografie‹: ›Ich schrieb ein Buch, ich schrieb ein zweites Buch, ich schrieb noch ein Buch, ich schrieb noch ein Buch …‹ Tödlich langweilig. Wer will denn etwas über jemanden lesen, der am Schreibtisch sitzt und leere Blätter Papier vollschmiert?«
»Oh, so meinten wir das nicht!«, sagten sie. »Wir meinten eine Autobiografie in, na ja, einem literarischen Stil!«
Das war noch verwirrender. Wie sollte das aussehen? Pseudo-heroische Reimpaare im Stil des 18. Jahrhunderts?
Wenn ich bei rosenfingrigem Dunsteile, zum Schreibtisch, zur Arbeit, zur Kunst
Oder etwas im überladenen Gothic-Stil, wie beispielsweise von Poe:
Tausend grell gefärbte Bilder wirbelten durch mein schwindliges Gehirn, und bedrohliche Phantome drängten sich in den schattigen Ecken meines mit Wandteppichen behängten Gemachs. Im Wahn ergriff ich meine verzauberte Feder, ignorierte den großen Tintenklecks, der nun dämonische Gestalt annahm auf dem blendend weißen Pergament vor mir …
Nein, das würde nicht funktionieren.
Eines der ersten Interviews, das ich mit einem Zeitungsreporter führte, fand 1967 statt. Ich hatte – sehr zu meiner eigenen Überraschung und der aller anderen – gerade den zu jener Zeit einzigen bedeutenden kanadischen Literaturpreis gewonnen: den Governor General’s Award für meinen ersten Gedichtband The Circle Game. Ich lebte damals in Cambridge, Massachusetts, und promovierte an der Harvard University. Eine kanadische Zeitung meinte wohl, die Preisverleihung müsse man würdigen, und schickte einen Kriegsreporter, der gerade auf dem Rückweg aus Vietnam war, vorbei, um ein Interview mit mir zu führen. Seine Freunde müssen sich endlos über ihn lustig gemacht haben. Noch mehr Poetessen interviewt in letzter Zeit?
Wir saßen in einem Café, ich im roten Minikleid und Netzstrümpfen, der Reporter zwar nicht in kugelsicherer Weste, aber er hätte genauso gut eine anhaben können. Er sah mich an. Ich sah ihn an. Wir waren beide ratlos.
Schließlich sagte er: »Sagen Sie etwas Interessantes. Sagen Sie, dass Sie all Ihre Gedichte auf Drogen schreiben.«
Ist es das, was man von mir in einer literarischen Autobiografie erwartet? Alkoholismus, ausschweifende Partys, Drogenkonsum, schamlose sexuelle Verfehlungen – und das Schreiben selbst nur als Nebenprodukt, das irgendwie aus dem Komposthaufen meines skandalösen Verhaltens herausgesickert oder ausgetrieben war? Aber so habe ich meine Zeit nicht verbracht – oder jedenfalls nicht die meiste.
»Ich glaube eher nicht«, sagte ich zu denen, die die Idee einer literarischen Autobiografie geäußert hatten. Oder sagte ich es zu mir selbst? Wie auch immer – das wesentliche Wort war: nicht.
Doch mit der Zeit bekam die Idee einer Autobiografie einen schillernden, phosphoreszierenden Glanz. War nicht irgendetwas Verlockendes daran?, flüsterte mein finsteres Alter Ego. Ich könnte mich selbst ins beste Licht rücken, einen sanften Schleier über meine dümmsten oder schlimmsten Taten legen und die Schuld dafür anderen zuschieben. Gleichzeitig könnte ich meine Wohltäter würdigen, meine Freunde belohnen, meine Feinde fertigmachen und alte Rechnungen begleichen, an die sich außer mir keiner mehr erinnerte. Ich könnte ein paar pikante Details ausplaudern, ein bisschen Klatsch servieren.
Nachdem er 1970 Der Fünfte im Spiel veröffentlicht hatte, im Alter von fast sechzig Jahren, wurde der Schriftsteller Robertson Davies gefragt, warum er nach seinen frühen Erfolgen so lange keinen Roman geschrieben habe. Seine Antwort bestand aus zwei Worten: »Leute … starben.«
Das stimmt. Menschen sterben, und nachdem sie tot sind, lässt sich über sie manches sagen, das man zuvor zurückgehalten hätte. Aber – sagte ich mir – ich müsste mich ja nicht auf diese Art von moralischer Abrechnung auf unterstem Niveau beschränken. Ich könnte eine Reise unternehmen – auf der Suche nach meinem eigenen, authentischen inneren Selbst, sofern es so etwas überhaupt gibt.
Zumindest könnte ich die vielen Bilder von mir untersuchen, die im Laufe der Jahre aufgetaucht und wieder verschwunden sind; einige von mir selbst erdacht, viele andere – weniger schmeichelhaft und mitunter geradezu furchteinflößend – von außen auf mich projiziert. Man hat mir sehr merkwürdige Fragen gestellt.
»Warum ist Ihr Mund so klein?«, wollte ein Briefschreiber wissen.
»Warum gibt es in Ihren Texten so viele Flaschen?«, wurde ich bei einer Lesung gefragt.
»Sind Ihre Haare wirklich so oder lassen Sie sie machen?« – eine meiner Lieblingsfragen, gestellt in einer Turnhalle nach einer Lesung in einer Kleinstadt im Ottawa Valley, wo nie zuvor ein lebender Schriftsteller gewesen war.
In manchen Varianten meiner selbst jage ich Interviewern Angst ein; in anderen bringe ich Politiker zum Winseln. Ein einziger Blick meiner unheilvollen Augen, und starke Männer weinen, halten die Hände vor die Leistengegend, aus Angst, ich könnte mit meinen Medusenaugen ihre Hoden versteinern lassen.
Meine Medusenaugen passen zu meinem Medusenhaar, auf das früher in Rezensionen Bezug genommen wurde – zu einer Zeit, als Schmähkritik noch ungehemmter war und Bodyshaming die Norm, besonders wenn Männer über Frauen schrieben. Lockiges und/oder krauses und/oder präraffaelitisches Haar galt als unheimlich. Wenn man es offen trug, musste man wohl unbändig und vielleicht sogar verrückt sein – eine Nachfahrin all jener literarischen Frauengestalten des 19. Jahrhunderts, die über die Felder irrten oder sich von Schlossdächern stürzten; oder noch früherer, wie Ophelia, die flussabwärts trieb, völlig verrückt geworden, mit wogenden Haarflechten. Kein Wunder, dass Schriftstellerinnen früherer Generationen zum strengen Dutt und später zur kunstvoll betonierten Dauerwelle griffen.
Hexen, ganz klar, ließen ihr Haar offen, um Zauber zu wirken, Stürme zu entfesseln und Männer zu verführen – vielleicht hielten sich solche Vorstellungen unter männlichen Kulturkommentatoren noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts und trugen zu meinem hexenhaften Ruf bei? Oder der Zusammenhang stammt aus den 1950er- und frühen 1960er-Jahren, als eine schreibende Frau, die sich mit etwas anderem als Frauenmagazinen befasste, als hexenhaft und latent wahnsinnig galt. Oder vielleicht aus den frühen 1970ern, als energische Sprache bei Frauen gleichgesetzt wurde mit BH-Verbrennung, Männerkastration und anderen »unweiblichen« Betätigungen. Die Romanautorin Margaret Laurence – aus einer früheren Generation – beklagte sich oft, dass man sie wegen ihrer Kinder nicht als ernsthafte Schriftstellerin, sondern als harmlose, Plätzchen backende Mutter betrachtete: »nur eine Hausfrau«. Ich hingegen musste mich eher in die andere Richtung verteidigen: Wenn ich gerade nicht in Fledermausgestalt durch die Luft flog, betonte ich, dass ich sehr wohl einen ordentlichen Weihnachtskuchen backen und dabei noch ein paar Pullover stricken konnte. Es ist eine sehr alte Dichotomie: hier die Frau, die Frauentätigkeiten verrichtet; dort die ernsthafte Autorin mit dem Messer im Ärmel.
»Sie schreibt wie ein Mann«, sagte ein Dichterkollege in den frühen 1970ern über mich und meinte es als Kompliment.
»Ich schreibe«, antwortete ich. »Wie man schreibt.«
Solche Konter waren damals äußerst nützlich.
Ich überlegte: Wenn ich dieses Memoiren-Projekt in Angriff nähme, könnte ich all diese unterschiedlichen Bilder betrachten – und ein paar andere, über die man sonst selten nachdenkt. Bin ich im Innersten das gelockte, steptanzende Püppchen von 1945? Die Petticoat-Rock-’n’-Rollerin mit Tanzschuhen von 1955? Die fleißige, aufstrebende Dichterin und Kurzgeschichtenschreiberin von 1965? Die furchteinflößende veröffentlichte Romanautorin und Teilzeit-Bäuerin von 1975? Oder die wohl bekannteste Variante: die schlechte Schreibmaschinen-Tipperin, die Der Report der Magd in Berlin begann, in Tuscaloosa, Alabama, beendete und 1985 mit gemischten Kritiken veröffentlichte?
Weitere Versionen von mir folgten. Mit den Jahren bin ich im Bild der Öffentlichkeit auf- und abgetaucht, wurde älter, ganz unvermeidlich. Ich bin erloschen, wieder aufgeflackert, habe gebrannt, Funken gesprüht, bekam Heiligenscheine und Teufelshörner aufgesetzt. Wer würde nicht all diese Zerrspiegel erkunden wollen?
Vielleicht bin ich ein Schwellenwesen, Angehörige zweier Naturen, Hüterin der Übergänge, Gestaltwandlerin fast nach Belieben; eine Art Baba Jaga, mal gütig, mal strafend, lebe in einer Waldhütte auf Hühnerbeinen, treibe im Mörser mit dem Stößel als Ruder voran, summe dabei ein fröhlich-bedrohliches Lied.
Dies ist in meinem Fall vermutlich der Hi-Ho-Marsch der Zwerge aus Disneys Schneewittchen, das mich als Kind traumatisiert hat. Aber das Trauma bestand nicht in dieser Hymne der kurzgewachsenen Workaholics (zu denen ich auch gehöre), sondern rührte von etwas anderem her: Mit sechs Jahren war ich entsetzt über die Verwandlung der attraktiven Königin, die durch einen Zaubertrank grün wird und sich in eine warzige alte Hexe verwandelt. Grauenhaft – und doch grundlegend! Schneewittchen, lieblich und musikalisch, ist Figur, nicht Akteur. Die böse Königin hingegen hat die besten Szenen. Jeder Autor weiß, dass das die Wahrheit ist. Er weiß auch: Ohne die böse Königin oder ihre Entsprechungen – die Alien-Invasion, den Hurrikan, die Ehebrecherin, den finsteren Auftragskiller, die Schlangen im Flugzeug, den Mörder im Landhaus – gibt es keine Handlung.
Jeder Schriftsteller ist mindestens zwei Wesen: das, das lebt, und das, das schreibt. Jede Fragerunde bei einer Buchveranstaltung ist eine Illusion; dort ist das Lebewesen anwesend, nicht das schreibende. Wie sollte das auch anwesend sein, wenn gerade nicht geschrieben wird? Wie bei Jekyll und Hyde teilen sich beide das Gedächtnis und sogar die Garderobe. Auch wenn alles Geschriebene durch ihren gemeinsamen Geist gegangen sein muss, sind sie nicht identisch.
Das schreibende Selbst hat Zugang zu allem im Erinnerungsspeicher. Das lebende hat vielleicht eine Ahnung davon, womit sich das schreibende gerade beschäftigt hat – aber weniger, als man denkt. Während man schreibt, beobachtet man sich nicht dabei. Denn sobald man beginnt, den eigenen »Prozess« zu analysieren, während man mittendrin ist, erstarrt man.
Ist Schreiben ein Trancezustand, wie die Geschichte über das Entstehen von Coleridges Gedicht »Kubla Khan« nahelegt? Nicht ganz: Man kann aufhören, Kaffee holen, telefonieren, ganz normal wirken. Zumindest ich kann das. Und doch lässt sich das Gefühl, dass »etwas anderes« übernimmt, nicht ignorieren; zu viele Autoren berichten davon. Flow-Zustand, Inspiration, Figuren, die den Autor überrumpeln, Traumvisionen, Außerkörpererfahrungen – solche Erlebnisse werden so oft geschildert, dass man sie nicht einfach abtun kann.
Dazu kommt vielleicht, dass es (mindestens) zwei Arten von Schriftstellern gibt: die Anhänger des leierzupfenden Apoll, struktur- und harmoniebewusst, begleitet von Musen; und jene, die stattdessen Hermes anrufen – Gott der Streiche und Botschaften, Enthüller und Verhüller von Geheimnissen, Schutzpatron von Reisenden und Dieben, Seelenführer in die Unterwelt. Wenn man ein Manuskript überarbeitet, braucht man Apoll; wenn man mitten in der Handlung feststeckt, hilft vielleicht Hermes, der Türöffner – auch wenn es keine Garantie dafür gibt, was sich hinter der Tür verbirgt. Dass beide Götter untrennbar verbunden sind, zeigt ihre mythologische Herkunft: Hermes war es, der Apolls Leier überhaupt erst erfand. Fast alle Kulturen kennen diese Dualität – denn jedes Kunstwerk braucht Form und Energie.
Man könnte auch Bacchus hinzunehmen, Gott des Weines, Vertreter göttlicher Trunkenheit, Auflöser von Hemmungen. Viele Autoren haben unter Einfluss von irgendetwas geschrieben. In meinem Fall war es Koffein.
Manche Autoren reden gern über ihr »Material«. Marian Engel, Autorin des Romanes Bär, erzählte mir einmal von ihren belastenden Kindheitserfahrungen, als sie und ihre Zwillingsschwester zur Adoption freigegeben wurden, weil die Schwester sie heftig attackierte. Dann sagte sie: »Darauf habe ich ein Urheberrecht.« Heißt: Das Material gehört ihr, nicht mir. Sie schrieb bis zu ihrem Tod über diese frühen Erlebnisse.
Aber woher kommt eigentlich all das »Material«? Aus dem, was man gemeinhin Leben und Zeit nennt. Dinge passieren einem oder werden einem erzählt. Große und kleine. Manche treffen einen, andere haften einfach. Niemand kann dem Raum-Zeit-Gefüge, in dem er lebt, entkommen. Niemand. Was man schreibt, entsteht darin und ist damit verknüpft – selbst wenn das Buch auf einem anderen Planeten oder in einem anderen Jahrhundert spielt. Es kann nicht anders sein.
Ich werde also zwangsläufig die Besonderheiten meiner eigenen Zeit und Räume beschreiben müssen, wenn ich irgendetwas am Schreiben erklären will. Bereitet euch auf Beschreibungen überholter Technologien vor – Eishäuser, Milchklappen – und auf veraltete soziale Rituale wie Tanzveranstaltungen in Turnhallen, wie die sock hops, bei denen man in Strümpfen tanzte, um den Boden zu schonen, und das Miteinander-Gehen. Auch auf Miniaturen damaliger Moden: Hosenanzüge, Miniröcke, A-Line-Kleider und den Ethno-Look.
Ich bewege mich durch die Zeit, und wenn ich schreibe, bewegt sich die Zeit durch mich. Das gilt für alle. Man kann die Zeit nicht anhalten, noch sie ergreifen – sie gleitet davon, wie der Liffey-Fluss in Joyce’ Finnegans Wake. Erinnerungen können lebhaft, aber unzuverlässig sein; Tagebücher trügen. Und dennoch hat jedes Leben seine eigenen Aromen und Texturen – ich werde versuchen, die meinen einzufangen.
Da Memoiren Fotos brauchen, habe ich mich durch die Halde gearbeitet: die Alben meiner Eltern aus dem frühen 20. Jahrhundert, mit Schwarz-Weiß-Schnappschüssen in kleinen Fotoecken – Großeltern, Großtanten, damals nagelneue Autos, Pferde, überdachte Brücken. Dann die 1930er und 1940er: Ich tauche auf, kugle über den Boden, stehe auf, bekomme Haare, bekomme Zähne. Mit acht Jahren bekomme ich eine Kodak Brownie und fotografiere meine Katze mit Haube, meinen Bruder mit Schneebällen und Grimassen, seltsame Bäume, unidentifizierbare Kinder. Andere Alben zeigen Abschlussbälle, Schulabschlüsse, Laientheater. Meine ersten Dichterlesungen.
Dann kommen Buchcover-Fotos. Mehr davon. Jetzt wird es literarisch. Es folgen Zeitungs- und Magazinfotos, teils körnig, teils glänzend; in letzteren trage ich oft nicht meine eigenen Kleider, denn mittlerweile hatte man Stylisten erfunden. Ich erinnere mich gern an ein Shooting, bei dem ich all meine schwarzen Klamotten ausziehen sollte – nur um andere schwarze Klamotten anzuziehen, in denen ich exakt genauso aussah. Dann war da der Finnland-Aufenthalt, als ich im Schminkraum eines TV-Studios landete. Blitzschnell steckte man mir heiße Lockenwickler ins Haar – offenbar wollte man meine Haarstruktur »zähmen«: Die Finnen waren derlei nicht gewohnt. Wahrscheinlich wollten sie mir ersparen, mich öffentlich zu blamieren. (Die Finnen waren nicht die Ersten – und nicht die Letzten. Erfolgreich war kaum jemand.) In den persönlichsten Bildebenen ist meine Familie zu sehen – in allen Alters- und Lebensphasen.
Es ist überwältigend, diese Bilderflut zu ordnen. Was soll man damit anfangen, mit diesem Schwall? Ich habe es immerhin geschafft, die versehentlichen Aufnahmen vom Boden, von meinen Füßen und dem Inneren meiner Handtasche auszusortieren. Aber die anderen … sie schweben noch in der Luft, verblassen, sind aber sichtbar – überall das Aufflackern gelebten Lebens. Wie kalt war es an jenem Tag? Was gab es zu essen? Waren wir glücklich?
Während ich meine Schreibvergangenheit durchstreife, habe ich seltsame Träume. Ich unterhalte mich mit den Toten, meist mit den wohlwollenden. Ich grabe meine frühen, zum Glück unveröffentlichten Texte aus – und schäme mich beim Lesen. Ich versuche, mich in meine damalige Geisteshaltung zurückzuversetzen. Falsche Abzweigungen, Reifröcke, aufgegebene Handlungsstränge, Nylonstrümpfe mit Naht, Kanus, verlorene Lieben – alles Material.
Was werde ich daraus machen?
Book of Lives
Kapitel 1: ABSCHIED VON NOVA SCOTIA
Was meine Mutter sagte:
Meine Mutter: Weil unser Vater Dr. Killam hieß, haben uns die Kinder in der Schule gehänselt. Sie sagten: ›Killam, Skin’em and Eat’em.‹ Tötetse, häutetse, fresstse!
Ich: Hat dich das gekränkt?
Meine Mutter: Pah. Die Genugtuung hätt’ ich ihnen nie gegeben.
Was mein Vater sagte:
»Wie lange würden zwei Fruchtfliegen, die sich ungehindert vermehren, brauchen, um die gesamte Erde mit ihrer Nachkommenschaft drei Kilometer hoch zu bedecken?«
(Ich erinnere mich nicht mehr an die Antwort, aber es war eine erstaunlich kurze Zeit.)
Meine Eltern stammen beide aus Nova Scotia. Mein Vater wurde 1906 geboren, meine Mutter 1909. Daraus lässt sich errechnen, dass sie gerade in den Arbeitsmarkt eintraten, als die Große Depression der 1930er-Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Dazu kam der allgemeine Niedergang der kanadischen Seeprovinzen: Halifax war im 19. Jahrhundert ein wohlhabender Seehafen gewesen, aber dann kam der Bau der Eisenbahnen und die Verlagerung des finanziellen Gravitationszentrums – zunächst nach Montréal dann nach Toronto. Die Stadt erlebte einen kurzen Aufschwung während des Ersten Weltkriegs; später, nachdem meine Eltern Nova Scotia verlassen hatten, wurde sie wegen ihres geschützten Hafens zum Ausgangspunkt für die Atlantik-Konvois. Manche in Nova Scotia profitierten in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren von der amerikanischen Prohibition. Der Schmuggel florierte: Fischerboote holten Alkohol aus Saint-Pierre und Miquelon – französischem Hoheitsgebiet – und verschoben ihn in die verzweigten Buchten und Flussmündungen von Maine. Wenn Onkel Bill plötzlich ein neues Dach auf seiner Scheune hatte, fragte man lieber nicht, wie er es bezahlt hatte. Aber um von diesem Handel was abzubekommen, musste man ein Boot besitzen. Wer kein Boot hatte, hatte Pech.
Ein Witz aus jener Zeit: »Was ist der wichtigste Exportartikel Nova Scotias?« – »Gehirne.«
In jenen Jahren zogen viele Menschen aus Nova Scotia nach Westen, um Arbeit zu finden. Meine Eltern waren Teil dieses Exodus.
Alle Menschen aus Nova Scotia, die ich je kennengelernt habe, litten an Heimweh. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es war so. Meine Eltern nannten Nova Scotia stets »Zuhause«, was mich als Kind verwirrte: Wenn Nova Scotia »Zuhause« war – wo lebte denn ich? In einem Nicht-Zuhause?
Unsere Familie ist eher ein Dickicht als ein Stammbaum. Wenn man Wurzeln in den Seeprovinzen hat und jemandem begegnet, der ähnliche Wurzeln hat, beginnt man sofort, sich durch das Gebüsch zu schlagen: Wer war dein Vater, wer deine Mutter, Großvater, Großmutter, woher stammten sie – und so weiter, bis man feststellt, dass man verwandt ist. Oder eben nicht. Das kann eine Weile dauern.
Also hier der Tiefseetauchgang:
Nova Scotia war, anders als der Name vermuten lässt, keineswegs durchweg schottischen Ursprungs, sondern bemerkenswert vielfältig. Die Mi’kmaq lebten dort – und tun es noch – und sind mit anderen indigenen Gruppen in New Brunswick und Maine verwandt. Im 17. und 18. Jahrhundert war Nova Scotia eine der ersten Regionen im heutigen Kanada, die einen Zustrom europäischer Siedler erlebte. Französische Entdecker; Siedler, die sich Acadians nannten – in Anlehnung an das vergleichsweise idyllische Land, in dem sie sich wiederfanden; dann Neuengländer, die durch günstiges Land angelockt wurden. Später kamen viele Menschen, die auf der Verliererseite der Amerikanischen Revolution gestanden hatten. Darunter auch freie Schwarze, die aufseiten der Briten gekämpft hatten. Diese Einwanderer aus den USA wurden zusammenfassend als United Empire Loyalists bezeichnet. Einige davon sind in unserem Familienbusch verästelt.
Kurz vor den Loyalisten kamen deutsche und französische Protestanten, die von den Briten während des Franzosen- und Indianerkriegs willkommen geheißen wurden. Das katholische Neu-Frankreich – einschließlich Vermont, New Brunswick und dem heutigen Québec – hatte mithilfe seiner indigenen Verbündeten die protestantischen Neuengland-Kolonien überfallen, und umgekehrt. Neuengland genoss die Unterstützung der britischen Armee, während die französischen Kolonien schlechter versorgt waren. Schließlich, 1759, eroberte General Wolfe Québec, und Neu-Frankreich fiel an Großbritannien. Die Kolonisten in Neuengland benötigten nun keine britische Armee mehr und sahen nicht ein, warum sie so stark besteuert werden sollten. Ergebnis: die Amerikanische Revolution, »Keine Besteuerung ohne Vertretung«, übermäßige Investitionen seitens der französischen Monarchie in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, französische Schulden – und schließlich die Französische Revolution.
Während der Kriege wollten die Briten möglichst viele Protestanten nach Nova Scotia bringen. Einer von denen wurde Teil unserer Ahnenlinie. Ebenso einige Schotten, die während der Highland Clearances im 18. und frühen 19. Jahrhundert aus ihren angestammten Dörfern vertrieben wurden – durch ihre eigenen Clan-Chefs. Das war nicht nur eine Folge der Niederlage der Schotten im Jakobitenaufstand von 1746, sondern auch dem Vormarsch der profitablen Schafzucht geschuldet. Ich scherzte früher gern, dass ich von einer langen Reihe von Leuten abstamme – bis zurück zu den Puritanern –, die aus anderen Ländern hinausgeworfen wurden, weil sie streitsüchtig, ketzerisch, mittellos oder auf andere Weise unliebsam waren.
Hier sind einige der Namen aus dem Familiengestrüpp: Atwoods, Killams, Websters, McGowans, Lewises (aus Wales), Nickersons, Moreaus, Robinsons, Chases. Das sind nur einige der Zweige. Wenn du dich ins Gebüsch begibst, verirr dich nicht – es ist ziemlich verworren.
Die Ersten aus der Familie meines Vaters, die die Südküste Nova Scotias erreichten, kamen von Cape Cod. Cape Cod wimmelt noch heute von Atwoods, Nachfahren jener, die im frühen 17. Jahrhundert dort ankamen – entweder mit der Mayflower oder kurz danach. Sie siedelten sich vor allem in der Gegend um Wellfleet, Massachusetts, an, später auch in Chatham. Mehrere Museen, darunter das Atwood Museum in Chatham, sind einen Besuch wert – schon wegen der Katzentür unter der Treppe, durch die jede Nacht eine Katze gestopft wurde, um unter dem Boden Mäuse zu fangen. (Ich frage mich, wie das Haus wohl gerochen hat?) Es gibt dort auch ein Porträt eines Zahnarzts namens Atwood, der sich in förmlicher Kleidung malen ließ – vor sich drei Zahnprothesen, auf die er offensichtlich stolz war.
Es war der jüngere Bruder dieses Atwood, dem das Museum einmal gehört hatte, der 1758 nach Nova Scotia ging und in Shelburne landete, einem kleinen Hafen an der Südküste. Von Shelburne aus breiteten sich die Atwoods aus – es entstanden mehrere Freibeuter, die von Liverpool aus operierten, eine Reihe von Seeleuten sowie einige Holzfäller und Bauern.
Als mein Vater geboren wurde, lebte seine Familie in Upper Clyde, ziemlich weit entfernt von der Küste, flussaufwärts am Clyde River. Mein Großvater betrieb ein kleines Sägewerk, das Schindeln aus Weymouthkiefer herstellte – Rotzedernholz war in Nova Scotia kaum zu finden. Mit sechs Jahren begann mein Vater, diese Schindeln zu stapeln. Das war der erste von vielen Jobs, die er noch haben sollte. Er habe diese Arbeit sehr gern gemacht, sagte er später; Kinder trugen damals, sobald sie konnten, ganz selbstverständlich ihr Teil zum Familieneinkommen bei.
Die Familie hätte sich selbst nicht als arm bezeichnet – sie hatten ein Haus, eine Kuh, ein Harmonium im Salon. Mein Großvater war Freimaurer, was für zumindest ein gewisses Maß an gesellschaftlichem Ansehen sprach. Doch Geld wurde damals nicht für so viele Dinge benötigt wie heute. Wenn man etwas brauchte, das man selbst herstellen konnte – aus Holz, wie Tische oder Stühle, oder aus Stoff oder Garn, wie Kleider, Quilts oder Fäustlinge –, dann machte man es eben selbst. Die Leute heirateten – fast ausnahmslos. Es gab kaum Arbeitsmöglichkeiten für ledige Frauen, und jeder wusste, dass es für einen Mann nahezu unmöglich war, einen kleinen Hof allein zu bewirtschaften: Eine Ehefrau war notwendig.
Meine Großmutter, die zweite Frau meines Großvaters, hielt Hühner und bewirtschaftete einen Gemüsegarten. Sie besaß den Rolls-Royce unter den holzbefeuerten Küchenherden – mit Backofen, Warmhalteofen, Boiler und Chromverzierungen. Sie räucherte ihren Fisch selbst und stampfte Butter in einem Fass; als Kind half ich ihr manchmal dabei.
Diese Lebensweise zu kennen – im Grunde unverändert seit dem 19. Jahrhundert – war für mich sehr hilfreich, als ich Alias Grace schrieb. Der Herd meiner Großmutter war weitaus luxuriöser als alles, was Grace Marks je zur Verfügung hatte, aber der Rhythmus der Arbeit und der Tagesablauf waren ganz ähnlich. Mein Vater Carl war das älteste von fünf Kindern – wenn man Onkel Freddy nicht mitzählt, den Sohn aus erster Ehe. Der war schon erwachsen, eine geheimnisvolle Gestalt, die um die Scheune herumschlich und nicht viel sagte. Es hieß, er sei nicht ganz richtig im Kopf. Die Geschichte, die man uns erzählte, war, dass er im Ersten Weltkrieg Gas abbekommen habe. Ein anderer Informant behauptete allerdings, er sei schon vorher so gewesen. Wie bei so vielen Familiengeschichten denkt man nicht daran, sie zu überprüfen, bis niemand mehr da ist, den man fragen könnte.
Carl lernte lesen und schreiben in einer Dorfschule mit einem einzigen Klassenzimmer. Da es keine weiterführende Schule in der Nähe gab, absolvierte er seine High-School-Kurse schriftlich per Fernunterricht – ermutigt von meiner Großmutter, die früher selbst Lehrerin gewesen war. Er lernte neben seinen Aufgaben auf dem Hof und neben den winterlichen Holzfällercamps, in denen er als Jugendlicher arbeitete, wie es schon mein Großvater getan hatte. In diesen Camps eignete er sich, laut meiner Mutter, ein beträchtliches Repertoire an Flüchen an. Sie hörte ihn nur einmal fluchen – als er sich mit einem Vorschlaghammer auf den Daumen schlug, während er die Spitze für eine Handpumpe einschlug. »Die Luft errötete«, sagte sie anerkennend: Das war ein Talent, von dem sie bis dahin nichts gewusst hatte.
Carl war sehr musikalisch. Ich weiß nicht, wie er das Fiedelspiel gelernt hat, aber er konnte es. Sein jüngerer Bruder, Onkel Elmer, spielte Banjo, und gemeinsam sorgten sie für die Musik bei den örtlichen Square Dances am Samstagabend, die mitunter recht rau verliefen; Alkohol floss, es kam zu Schlägereien. Als Musiker konnten sie sich aus alldem heraushalten. Carl sang damals auch – es hieß, er habe eine wunderschöne Baritonstimme gehabt. Doch nachdem er als junger Erwachsener zum ersten Mal professionelle Konzerte gehört hatte – während er bereits ernsthaft auf dem Weg war, Wissenschaftler zu werden –, sang er nicht mehr, spielte auch nie wieder Geige. Vermutlich stufte er sich selbst als Amateur ein. Das Äußerste, was er noch tat, war pfeifen – er hatte eine Vorliebe für Beethoven.
Als barfüßiges Kind auf dem Heimweg von der Schule faszinierte eine riesige grüne Raupe meinen Vater. Dieses Tier – die Larvenform des Cecropia-Pfauenspinners – lenkte zum ersten Mal seine Aufmerksamkeit auf die Welt der Insekten. Er nahm die Raupe mit nach Hause, baute ihr einen kleinen Käfig, fütterte sie und beobachtete, wie sie sich erst in eine Puppe verwandelte und dann in einen riesigen, farbenprächtigen Falter. Das war die Initialzündung zu seiner Karriere als Entomologe. Hätte er diesen Weg nicht eingeschlagen, hätte er nie meine Mutter kennengelernt – und ich wäre nie geboren worden. Ich verdanke demnach meine Existenz einer großen grünen Raupe.
Ein Schritt auf Carls Weg war ein Aufenthalt an der »Normal School« in Truro, wo man lernte, Lehrkraft zu werden. (Ich dachte als Kind immer, dort würde man lernen, normal zu sein – aber das war nicht der Fall.) Er wollte zunächst als Lehrer arbeiten, um genug Geld für ein Universitätsstudium zu sparen, doch dank Sommerjobs in der Entomologie und einem Stipendium für die Acadia University in Wolfville konnte er abkürzen. Dann wechselte er mit einem weiteren Stipendium an das Macdonald College – die landwirtschaftliche Fakultät der McGill University in Montréal. Dort mistete er Kaninchenställe aus, lebte und kochte in den warmen Monaten in einem Zelt und sparte so genug, um etwas Geld nach Hause zu schicken, damit seine drei Schwestern weiter zur Schule gehen konnten.
An der »Normal School« in Truro sah mein Vater meine Mutter zum ersten Mal: Sie rutschte gerade das Hauptgeländer hinunter. Er beschloss in diesem Moment, dass sie die Frau war, die er heiraten würde. Es brauchte zwei Anläufe – beim ersten Antrag lehnte sie ab, weil sie, wie sie sagte, »gerade zu viel Spaß hatte« – aber er schaffte es. Er hatte bis dahin so viele Hürden überwunden, dass er ein erstes »Nein« nicht als endgültig ansah.
»Er hat mich überrascht. Ich dachte, er sei einfach nur ein Freund«, sagte meine Mutter über seinen ersten Antrag. Sie hatte eine Schar von Verehrern und Bewunderern um sich, aber mein Vater war der einzige, den ihr Vater nicht als »Volltrottel« bezeichnete. Dieser hatte sich aus einfachsten Verhältnissen hochgearbeitet und war Arzt geworden. Vielleicht erkannte er in Carl – einem äußerst entschlossenen Selfmademan – etwas von sich selbst wieder.
Meine Mutter, Margaret Killam, war ein Wildfang und äußerst sportlich – daher das Rutschen über das Treppengeländer. Ihr Hintergrund war ganz anders als der meines Vaters: eher »vornehm ländlich« als »hinterwäldlerisch ländlich«, aus einem winzigen Dorf namens Woodville im Kings County. Das liegt im Annapolis Valley, einer Gegend, die stark vom Apfelanbau geprägt ist.
Mein Großvater, Dr. Harold Killam, war der hochgeschätzte Landarzt der Region. Er war Mitbegründer des Krankenhauses in Berwick (mittlerweile geschlossen) und half beim Bau der örtlichen methodistischen Kirche (inzwischen ein Wohnhaus). Er war Armeearzt im Ersten Weltkrieg und wurde 1917 nach Halifax gerufen – gerade als die Halifax-Explosion passierte (fast zweitausend Tote, neuntausend Verletzte). Unser Großonkel Fred wurde bei der Explosion aus dem Fenster geschleudert und landete, unverletzt, auf dem Gehsteig – noch immer in seinem Bett. Großtante Rose hatte weniger Glück: Sie stürzte durch den zerborstenen Fußboden in den Keller und erlitt dadurch eine Fehlgeburt.
Solche Geschichten bevölkerten früh meinen Kopf – Geschichten über Menschen, die ich nicht kannte. Sie hatten den Status halb-imaginärer Gestalten, mit überlebensgroßen Geschichten, wie Beowulf. Jede Woche kamen neue Nachrichten über solche Wesen: Meine Mutter und ihre beiden Schwestern schrieben sich getreulich ihr Leben lang, und meine Mutter las die Briefe meinem Vater laut vor. Sie wurde als Älteste von fünf Kindern geboren. Die anderen waren ihre »Zwillingsschwester« Kathleen, genannt Kae, die kaum ein Jahr nach ihr zur Welt kam, ihre Schwester Joyce – vier Jahre jünger –, und zwei jüngere Brüder, Fred und Harold. Viele ihrer Geschichten rankten sich um diese Gruppe. Man wusste nie, was die Halbgötter in Nova Scotia als Nächstes anstellen würden.
Es gab viele Geschichten über meinen Großvater, Dr. Killam: wie er mitten in der Nacht mit dem Pferdeschlitten durch den Schnee fuhr, um Babys auf Küchentischen zur Welt zu bringen; wie er in seiner Praxis – die sich im vorderen Teil ihres Hauses befand – einen armen Mann operierte, der sich mit einer Axt verletzt hatte. »Werd bloß nicht krank«, pflegte meine Mutter zu sagen. Sie hatte zu oft gesehen und gehört, was mit kranken Menschen geschah, bevor es Impfstoffe, Penicillin und moderne Diagnosemöglichkeiten gab.
Dr. Killam genoss beachtliches Ansehen in der Region. Als angesehene Persönlichkeit durfte man nicht trinken, nicht rauchen, nicht fluchen – nicht, dass mein Großvater je die Neigung dazu gehabt hätte. Zigaretten nannte er »Sargnägel«, lange bevor die Forschung ihm recht gab.
Als Tochter des Arztes wurde von Margaret erwartet, dass sie sowohl gesellschaftlich als auch intellektuell den Ansprüchen genügte – doch sie war ein wenig rebellisch. Sie und ihr Vater gerieten oft aneinander; beide wollten sie ihren Willen durchsetzen, und beide hatten ein hitziges Temperament. »Wir waren uns zu ähnlich«, sagte sie. In ihrer Jugend war Margaret eine begeisterte Eisschnellläuferin. Außerdem war sie pferdeverrückt und galoppierte auf den Landstraßen herum – auf einem ihrer zwei Pferde, die sie im Stall halten durfte, darunter ein gerettetes Pferd, das sie aus »Haut und Knochen« hochgepäppelt hatte.
Margaret wollte unbedingt ihr störendes langes Haar loswerden, aber ihr autoritärer Vater erlaubte es nicht. (»Er war streng, aber hochrespektiert«, pflegte sie zu sagen). Endlich konnte sie einen 20er-Jahre-Bob tragen, weil sie die Gelegenheit nutzte, ihren sich im Zahnarztstuhl vor Schmerzen windenden Vater – damals gab es noch keine Betäubung – zum x-ten Mal um Erlaubnis zu fragen. Er sagte etwas wie: »Egal, egal was, lass mich einfach nur in Ruhe.« Und schon war’s passiert.
Ihre »Zwillingsschwester« Kae war fleißig und strebsam, und mein Großvater schickte sie an die University of Toronto, wo sie als erste Frau einen Masterabschluss in Geschichte machte. Aber meine Mutter wurde als flatterhaft angesehen; ihr Gehirn, sagte mein Großvater, sei nur ein kleiner Knopf, der ihre Wirbelsäule aufrecht halte. Für sie kam ein Universitätsstudium nicht infrage – das wäre Geldverschwendung, fand er.
Margaret nahm das als Herausforderung. Sie ging an die »Normal School« in Truro, wo sie meinen Vater beeindruckte. Zwei Jahre lang unterrichtete sie in einer winzigen Dorfschule, ritt morgens mit dem Pferd dorthin und wieder zurück, sparte das Geld zusammen, um sich schließlich ein Studium am Mount Allison Ladies’ College in Sackville, New Brunswick zu ermöglichen. »Warum bist du an die Mount A. gegangen und nicht an die Acadia University in Nova Scotia?«, fragte ich sie einmal. »Es war weiter weg«, sagte sie. Ich fragte sie – nach einer Reihe nostalgischer Anekdoten über »Zuhause« –, warum sie nie dorthin zurückgezogen sei. »Jeder weiß dort alles über dich«, sagte sie. Da hat sie nicht unrecht. An der Mount A. studierte sie Hauswirtschaft. Nicht, weil sie es mochte, sondern weil es für eine Frau der naheliegendste Weg zu einer Anstellung war. Im Hintergrund stand eine ledige Tante, die sie unterstützte. Margaret errang ein Stipendium an der Mount A. – Nimm das, verehrter Vater! Sie hatte »Mumm« bewiesen – eine wünschenswerte Eigenschaft –, Selbstständigkeit gezeigt – ebenfalls wünschenswert – und die These widerlegt, bloß ein Dummchen zu sein. (Sie kletterte auch regelmäßig nachts aus den Fenstern ihres Wohnheims – aber offenbar wurde sie nie erwischt.)
Der große Börsencrash ereignete sich 1929, als Margaret zwanzig war, und die Depression begann. Arbeitsplätze waren rar. Irgendwann unterrichtete meine Mutter Kochen in einer Besserungsanstalt für Mädchen (»Sie tranken immer den Vanilleextrakt«), später arbeitete sie als Diätassistentin am Toronto General Hospital, wo sie an Gewicht zulegte (»Wir aßen immer das übrig gebliebene Eis«). Mein Vater studierte zu dieser Zeit an der University of Toronto; er machte ihr erneut einen Antrag – und diesmal nahm sie an. Es folgte eine Zwischenphase, in der meine Mutter »nach Hause« musste, um zu helfen, denn ihr Vater hatte einen »Herzinfarkt« erlitten. Ein weiteres rätselhaftes Wort meiner Kindheit: Was genau war das? Die »Behandlung« bestand aus Ruhe – nicht, dass Ruhe viel geholfen hätte. Es gab damals weder Stents noch Herztransplantationen. Wenn wir Kinder zu Besuch waren, bewegten wir uns stets auf Zehenspitzen.
1935 heirateten meine Eltern schließlich – in einer Doppelhochzeit. Meine Tante Kae ehelichte einen örtlichen Arzt, nachdem sie abgelehnt hatte, nach Oxford geschickt zu werden. Sie wollte nicht enden wie die legendäre Tante Win, eine alte Jungfer – das unausweichliche Schicksal jeder Frau, die sich für eine so kopflastige Laufbahn entschied. Meine Eltern verbrachten ihre Hochzeitsreise in einem Kanu auf dem Saint John River in New Brunswick, der damals noch nicht von Staudämmen beeinträchtigt war. Carl brachte Margaret das Paddeln bei – sie hatte es zuvor nie gemacht – und wie man in einem Zelt schläft. Zelten gehörte nicht zu ihrer Kindheit – zu anrüchig, es hätte Gerede verursachen können. Doch vor der Hochzeit hatte sie zum Üben mit einer Schwester im Zelt übernachtet. Sie gewöhnte sich ans Leben im Freien wie eine Ente ans Wasser.
Viel später erzählte sie meiner jüngeren Schwester, das erste Ehejahr sei »wie ein Urlaub« gewesen – im Vergleich zu dem anstrengenden Arbeitsleben, das sie vorher geführt hatte. Während der Depression behielten verheiratete Frauen ihre Arbeitsstellen nicht. Zwei Einkommen in einer Familie galten als egoistisch, also kündigte man automatisch oder wurde »freigestellt«, sobald man heiratete – es sei denn, man stand ganz oben oder ganz unten auf der Gehaltsleiter. In dieser ersten Ehezeit brachte sich Margaret das Maschinenschreiben bei, um Carls Dissertation tippen zu können. Das tat sie auf derselben tragbaren Remington – weiße Buchstaben auf schwarzen Tasten, von weißen Ringen umrahmt –, auf der ich später meine ersten Gedichte schrieb. Viel Haushalt gab es nicht zu erledigen, da sie kein eigenes Haus hatten, also hatte sie Zeit, ihren sportlichen Neigungen nachzugehen – sie lief auf jedem verfügbaren Eis Schlittschuh und marschierte durch Parks.
Landmäuse und Stadtmäuse: Ein Exkurs
Im Herzen waren beide meiner Eltern Landmäuse, auch wenn sie bei Bedarf Stadtmäuse spielen konnten. Die Metapher, die sich in ganz Europa verbreiten sollte, stammt aus einer Fabel von Äsop. Sie wurde zum Thema eines illustrierten Kinderbuchs von Beatrix Potter und wird bis heute immer wieder neu erzählt.
Weder die Landmaus noch die Stadtmaus schätzt den Lebensstil der jeweils anderen. Die Landmaus isst einfache Kost, die Stadtmaus lebt im Luxus. Sie besuchen sich gegenseitig, doch die Landmaus hat Angst vor den wilden Katzen und Hunden, die es in der Stadt in Hülle und Fülle gibt, und zieht die Ruhe und den Frieden des Landes vor.
Die Ruhe und der Frieden des Landes sind natürlich selbst ein Märchen. Das Land kann – wenn man zum Beispiel Landwirt ist – ein sehr gefährlicher Ort sein und war es im frühen 20. Jahrhundert noch viel mehr. Kühe konnten einem einen Tritt verpassen, Pferde buckeln und einen gegen den oberen Balken der Scheunentür schleudern, ein Schwein konnte einen fressen, wenn man unvorsichtigerweise in seinen Koben fiel. Hausbrände, ausgelöst durch Holzöfen, Petroleumlampen oder Kerzen, waren jederzeit möglich. Ein Traktor konnte sich überschlagen und einen zerquetschen wie eine Weintraube. Der Hof und die Nebengebäude waren gespickt mit scharfen und potenziell tödlichen Werkzeugen: Sägen, Äxte, Spitzhacken, Vorschlaghämmer und Gewehre verschiedenster Art. Wenn man eine Mordwaffe brauchte, musste man nicht lange danach suchen. Im Wald konnte man von einem umstürzenden Baum erschlagen, von Bären zerfleischt, von einem brunftigen Elchbullen niedergetrampelt werden oder in einen Waldbrand geraten. Man konnte in einem Schneesturm erfrieren, in einem See ertrinken oder vom Blitz getroffen werden – eine der Hauptängste meiner Kindheit. Geht nie schwimmen, wenn ein Gewitter aufzieht. Ich sage das nur zu Eurem eigenen Wohl.
Wie konnte die Stadt da mithalten, wenn es um Gefahren ging? Doch sie konnte: mit Autounfällen, die einen zerfetzen, und mit lauernden Halunken und Betrunkenen, die einen aus dem Gebüsch anspringen mochten; mit dem Grauen, sich für feierliche Anlässe anziehen zu müssen – was soll man bloß tragen? – und zu Partys zu gehen – was soll man bloß sagen? Auf dem Land zeigte sich die Hölle meist in Gestalt eines Tieres oder eines Schneesturms. In der Stadt bestand die Hölle aus den anderen Menschen. Obwohl die Hölle in den Geschichten meiner Mutter auch auf dem Land in Menschengestalt auftreten konnte; gemeine Leute gab es überall.
Es gab damals zwei klar voneinander getrennte Denkweisen: städtisch und ländlich. In der Stadt erwartete man, dass man aufgeschlossen war, jedem freundlich die Hand schüttelte und leicht Kontakte knüpfte. Man interessierte sich für Neuheiten wie neue Filme, Moden, Geräte oder Technologien. Gleichzeitig neigte man eher dazu, sich über die Eigenheiten anderer Leute lustig zu machen, einer sozialen Hierarchie anzugehören, die auf diejenigen unter einem herabsah. Man kannte seine Nachbarn kaum und war auch wenig daran interessiert. Geld spielte eine große Rolle – eine sehr große. Landbewohner galten als Tölpel oder Hinterwäldler, als abergläubisch und unwissenschaftlich, rückständig im Denken.
Auf dem Land war man zurückhaltend bei Begegnungen mit Fremden und misstrauisch gegenüber Prahlerei und zur Schau gestelltem Reichtum. Es war wichtiger, als ehrlich, solide, tüchtig und praktisch veranlagt zu gelten, denn als reich oder besserwisserisch. Wer sich für etwas Besseres hielt, wurde meist durch Spott auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Selbstständigkeit war wichtig: Wenn die Toilette verstopft war – vorausgesetzt, man hatte eine und nicht nur ein Plumpsklo –, konnte man nicht einfach einen Klempner rufen, denn es gab keinen. Man holte seinen Schraubenschlüssel. Natürlich hatte man einen, und viele andere Werkzeuge. Man half den Nachbarn bei Problemen wie Krankheit oder wenn es brannte, und sie halfen einem ebenso. Es galt als unhöflich, anzugeben, zu jammern und sich zu beklagen oder übermäßige Gefühle zu zeigen – ja, überhaupt welche zu zeigen. Ein bisschen Spaß war erlaubt, aber zu viel Spaß galt als leichtsinnig. Man wusste, wie man Holz spaltet, Möbel baut, Bäume fällt oder – wenn man eine Frau war – ein Huhn brüht und rupft, eigene Hühner hält, Butter stampft, den Küchengarten bestellt, Marmelade kocht, Fäustlinge strickt, Teppiche knüpft, Quilts näht und Essensreste verwertet. Man hegte eine stille Verachtung für Stadtmenschen, die all das nicht konnten: Die wussten nicht, wo vorne und hinten ist, und traten in Kuhfladen, weil sie nicht aufpassten, wo sie hinliefen. Exzentriker akzeptierte man – solange man sie persönlich kannte und sie harmlos waren. Und wenn es darum ging, etwas auszunehmen – wie Fische –, krempelte man einfach die Ärmel hoch und legte los.
Auf dem Land wechselte man mit jedem ein paar Worte, dem man begegnete. Es war die Gelegenheit zu erfahren, was gerade vor sich ging. Unser Vater hatte sich diese Gewohnheit bewahrt, sehr zum Leidwesen seiner Kinder, manchmal zur Verzweiflung. Er ging in die Tankstelle, um zu bezahlen, während wir im Auto warteten – und warteten – und warteten. Er verwickelte die verschiedensten Leute in Gespräche, während er mit dem Kleingeld in seiner Hosentasche klimperte. Wenn er nicht glaubte, was man ihm erzählte, sagte er: »Ach nee?« oder »So was!« Es wäre gegen die ländlichen Manieren gewesen, jemandem direkt zu widersprechen. Ich erinnere mich, wie ich ihn dabei beobachtete, als ein Mann ihm weismachen wollte, Biber würden die Luft aus Baumstämmen saugen, und deshalb gingen diese unter. »Ach nee?« »So was!« (Klimper, klimper.)
Meine Eltern kannten die Verhaltensmuster der Landmäuse, sie waren schließlich damit aufgewachsen. Unter den Dinnerjackets und den eleganten Abendkleidern, die sie nach Belieben anlegen konnten, bewahrten sie sich die Zurückhaltung und den Skeptizismus der Landmäuse; zugleich besaßen sie auch die Wissbegier der Stadtmäuse. Sie konnten scheinbar mühelos zwischen Stadt und Land hin- und herwechseln – zumindest wirkte es von außen so.
Mein älterer Bruder und ich waren ähnliche Mischwesen.
Kapitel 2: BUSCHBABY
Im Herbst 1936 lebten meine Eltern in Montréal, wo Carl einen ersten Lehrauftrag als Dozent am Macdonald College hatte. Sie erwarteten im Februar ein Baby. Reich waren sie keineswegs: Sie »besaßen keinen roten Heller«, wie meine Mutter sagte. Sie pflegte den Gehaltsscheck meines Vaters in vier Umschläge aufzuteilen: Miete, Nebenkosten, Lebensmittel – und, wenn noch etwas übrig war, Unterhaltung. Unterhaltung konnte ein Kinobesuch sein oder auch eine kleine Schachtel Laura-Secord-Pralinen. Jede Praline wurde halbiert, damit beide alle Sorten probieren konnten.
Ohne es zu wissen, wohnten sie im Rotlichtviertel von Montréal. (Kein Wunder, dass die Miete günstig war.) Meine schwangere Mutter muss dort für die örtlichen Fachkräfte eine gewisse Kuriosität dargestellt haben, wie sie zügig die Straßen entlanglief – sie war eine leidenschaftliche Spaziergängerin, ob schwanger oder nicht –, aber wie sie selbst sagte, hat sie dort »nie jemand belästigt«. (Wäre es passiert, hätte sie demjenigen »was erzählt«. Was genau dieses »was« war, blieb unklar – aber man hätte es sicher nicht erleben wollen.)
Mein Bruder Harold wurde am Tag nach dem Valentinstag im Montreal General Hospital geboren – ideal für künftige Geburtstagstorten-Verzierungen. Das war noch vor der Zeit staatlich geförderter Gesundheitsversorgung, und man wurde erst aus dem Krankenhaus entlassen, wenn die Rechnung bezahlt war. Mein Vater versetzte seinen Füllfederhalter, um meine Mutter auszulösen. Dieser Füller selbst bleibt ein Rätsel: Er muss wertvoll genug gewesen sein, um als Pfand zu taugen; vermutlich war er ein Geschenk gewesen, denn mein Vater hätte selbst kaum genug rote Heller gehabt, um sich so etwas zu leisten.
Ein Baby in einer kleinen Stadtwohnung zu versorgen – das muss eine besondere Erfahrung gewesen sein. Wegwerfwindeln gab es noch nicht; unsere Mutter weichte die Windeln im Klo ein. Einmal führte zu frühes Spülen zur Katastrophe: Der Diamant aus Margarets Verlobungsring löste sich und wurde fortgespült. Wie sie den Rest der Wäsche bewältigte? Wahrscheinlich mit einer Bottichwaschmaschine. Ein Eisschrank stand ihr vermutlich zur Verfügung, ebenso ein elektrisches Bügeleisen. Ich weiß sicher, dass es einen Toaster und ein Waffeleisen gab – beides Hochzeitsgeschenke. Sie funktionierten noch in meiner Kindheit.
Dann nahm unser Vater plötzlich eine Stelle beim Landwirtschaftsministerium der Bundesregierung an – als Feldforscher auf dem Gebiet der Entomologie. Sieben Monate sollte er in einem abgelegenen Teil der nordwestlichen Québecer Wälder verbringen. Mit einem Baby, das kaum ein paar Monate alt war – würde Margaret sich darauf einlassen? Ja! Gerade die Aussicht auf derlei Abenteuer hatte sie überhaupt erst für ihn eingenommen.
Jede Ära hat ihr eigenes Idealbild der Ehefrau. Die viktorianische Version war der »Engel im Haus«, die während des Zweiten Weltkriegs: »Die das Herdfeuer Bewahrende« trifft »Rosie the Riveter« (eine Figur aus einem Propagandafilm der Rüstungsindustrie). In den 1950ern: Frauchen im Hemdblusenkleid mit vier Kindern, Kreuzung aus Kombi fahrender Supermarkteinkäuferin und Haushaltsgerätebedienerin. Die 1930er-Version nenne ich das Amelia-Earhart-Modell: Sportlichkeit und Wagemut galten nicht als unweiblich, Erfindungsreichtum war eine Tugend, Hosen zu tragen war in Ordnung, auf dem Sofa im Negligé Pralinen zu futtern war out und Kameradschaft wurde geschätzt. (Nancy Drew, die jugendliche Detektivin mit eigenem Auto, erschien 1930 erstmals auf der Bildfläche.)
Unsere Eltern verstanden ihre Ehe als Partnerschaft. Margaret traf jede grundlegende Entscheidung mit. Vor dem Umzug in den Busch schlossen sie einen Pakt: In den oft frostigen Wäldern würde er zuerst aufstehen und Frühstück machen; in der Stadt würde sie das tun. In den ersten Jahren war das klar zu ihrem Vorteil – denn sie verbrachten mindestens zwei Drittel des Jahres im Wald.
Für die neue Stelle beim Landwirtschaftsministerium zogen sie mit ihrem winzigen Baby nach Ottawa. Ottawa, Hauptstadt Kanadas, war damals ein kleines Provinznest. Immerhin gab es ein Museum, in dem mein Bruder – einige Jahre später – seine erste Dinosaurierausstellung sah. Tief beeindruckt bastelte Harold zu Hause einen Dinosaurier aus Plastilin. Dieser hatte ein Euter – sehr zum Entzücken meiner Mutter, die diese Neuigkeit umgehend in ihrem wöchentlichen Brief an ihre Schwestern weitergab. Ottawa war sicher nicht wegen seines Klimas zur Hauptstadt gewählt worden – es ist die zweitkälteste Hauptstadt der Welt, nach Ulan Bator. Aber es liegt strategisch am Ottawa River, der Ontario (vorwiegend englischsprachig) von Québec (wo das Französische dominiert) trennt. Für ein zweisprachiges Land wie Kanada eine sinnvolle Wahl. Die Forschungsstation, an der unser Vater seine Studien betreiben sollte, lag ebenfalls im Grenzgebiet, allerdings auf der Québec-Seite – gut fünfhundert Kilometer nördlich. Die Menschen dort verständigten sich auf »Franglais«, einer Mischung aus Französisch und Englisch. Mein Vater eignete sich diese Sprache an – ein nützliches Werkzeug auf seinen wissenschaftlichen Reisen durch den Norden Québecs. Alles, wofür man kein passendes Wort wusste, hieß einfach la machine – hilfreich beim Bekämpfen von Waldbränden, was dort als Pflicht aller männlichen Anwohner galt. Wenn einem ein brennender Baum auf den Kopf zu fallen droht, ist Grammatik herzlich egal.
Ab in den Wald
Für ihren ersten Aufenthalt im nördlichen Wald – ab Mai 1937 – reisten meine Eltern mit dem drei Monate alten Baby per Schmalspurbahn an, denn Straßen gab es noch keine. Der Ort, an dem Carls Labor entstehen sollte, lag etwas abseits einer winzigen Ansammlung von Behausungen rund um die Bahnstation. In jenem ersten Sommer lebte die kleine Familie in Zelten, während mein Vater und sein Kumpel aus dem Dorf, Adrien Denis, mit dem Bau des Laborgebäudes begannen. Es bestand größtenteils aus Holzstämmen und besaß eine von Insektennetzen geschützte Veranda.
Ein Foto zeigt die drei – Carl, Margaret und Harold – inmitten dieser Waldkulisse. Sie sehen zufrieden aus. Zumindest die beiden Erwachsenen tun es. Vom Gesichtsausdruck des Babys ist nichts zu erkennen; nur seine Hände und Füße ragen aus etwas hervor, das wie eine Transportkiste aussieht. Unsere Eltern spannten ein Käseleinen darüber, um Moskitos und Kriebelmücken fernzuhalten.
Margaret sitzt in einem Liegestuhl aus Birkenstämmen – ein Eigenbau von Carl –, während Carl selbst auf einem Hocker Platz genommen hat, gezimmert aus einer weiteren Transportkiste mit einem quer darübergenagelten Brett. Darüber eine Art Vordach oder Plane, um diesen »Speisebereich« vor dem häufigen Regen zu schützen – immerhin befanden sie sich in einem borealen Regenwald. Egal, wie das Wetter war, gegessen wurde nie im Zelt. Man wollte dort keine Insekten oder andere Tiere, die sich für die Krümel interessierten, und auch keine Suppe auf dem Bettzeug.
Es gibt auch ein Foto von Carl, wie er eine aufblasbare Gummimatratze aufrollt. Vielleicht schliefen sie darauf, vielleicht auch auf einem Matratzenersatz aus Fichtenzweigen – ganz sicher aber in Schlafsäcken, die damals, vor der Ära der synthetischen Stoffe, mit Kapokfasern gefüllt und schwer waren. Innen drin Flanellbettlaken, obendrauf rot-schwarz gestreifte Hudson’s-Bay-Wolldecken.
Das kleine Wesen in der Transportkiste war im Busch ganz in seinem Element. Ein echtes Buschbaby, könnte man sagen. Noch bevor er krabbeln konnte, wurde Harold während einer Insektenplage dabei erwischt, wie er gerade ein Fäustchen voll Ringelspinner-Raupen verspeisen wollte. Später wurde er Biologe: Das war wohl unvermeidlich.
Wenn es kalt wurde und die Insekten tot oder im Winterschlaf waren, kehrte die Familie zurück nach Ottawa. Doch wie funktionierte dieser halbnomadische Lebensstil in der Praxis? Brachten unsere Eltern jedes Jahr ihre Möbel in ein Lagerhaus und mieteten dann für die andere Jahreshälfte eine Wohnung auf Zeit? Sie hätten sich kaum eine Wohnung leisten können, die sie nur ein halbes Jahr bewohnten. Oder untervermieteten sie sie vielleicht? Im Frühling, Sommer und Herbst 1938 waren sie jedenfalls auch wieder im Québecer Busch. Das Insektenlabor war fertiggestellt, weiter unten am See war ein kleines Blockhaus hinzugekommen. Unsere Eltern zogen dort ein, während Carl den Bau eines größeren Hauses plante und ein Plumpsklo, einen Holzschuppen und ein Eishaus errichtete. Das Grundstück hatten sie wohl durch einen günstigen Pachtvertrag auf neunundneunzig Jahre erhalten – der Staat Québec verkaufte damals kein Land.
Im Sommer 1939 trat der Große Fichtenwickler in Massen auf und beanspruchte einen Großteil der Aufmerksamkeit meines Vaters. Es war auch jener Sommer, in dem sie Harold beinahe verloren hätten. Mit zweieinhalb entwischte er aus dem Hühnerdrahtgehege, das um den Sandkasten errichtet worden war – unsere Mutter war eine glühende Verfechterin des Sich-selbst-Beschäftigens –, und fiel vom Steg ins Wasser. Zum Glück warf sie einen Blick aus dem Fenster, sah, dass Harold weg war, rannte los, hörte ein Blubbern, blickte ins Wasser, sah ihn sinken – und zog ihn an den Haaren heraus. Knapp davongekommen! (Die Geschichten unserer Mutter enthielten viele solche haarscharfe Davongekommnisse. Wir hingen buchstäblich am seidenen Faden.)
Währenddessen wurde die Weltlage von Woche zu Woche angespannter. Hinterm Horizont – genauer gesagt jenseits des Atlantiks – zogen Kriegswolken auf. Der kommende Sturm würde alles und jeden verändern.
Und ich war im Anmarsch.
(Dramatische Musik. Jeder darf selbst entscheiden, ob das auf den Zweiten Weltkrieg oder meine Geburt gemünzt ist.)
Kapitel 3: ASZENDENT ZWILLING
Ich kam am 18. November 1939 im Ottawa General Hospital zur Welt. Auf den ersten Blick kein besonders günstiges Datum. Der Zweite Weltkrieg war seit zweieinhalb Monaten im Gange, und meine Mutter dürfte vor meiner Geburt reichlich mit Angsthormonen durchflutet gewesen sein. Außerdem war es der tristeste Monat des Jahres: tote Blätter, aber noch kein Schnee; schwindendes Tageslicht, doch Weihnachten noch in weiter Ferne. Laut Astrologen ist es der Monat des Todes, des Sexus und der Erneuerung. Letzteres wohl eine Dreingabe, um das Ganze erträglicher zu machen. Die Feste des Novembers sind der Día de los Muertos und der Remembrance Day – auch eine Art Totengedenktag. Trübsinn allerorten.
Angesichts dieser Vorzeichen – wie konnte ich ein fröhliches Baby werden? Denn das war ich. Es gibt Zeugen. Oder gab.
Ein Blick auf mein Geburtshoroskop, und mein Charakter und Schicksal liegen klar und deutlich vor Ihnen. (Wenn Sie Horoskope doof finden, überspringen Sie das einfach, genau wie das Diagramm auf der nächsten Seite.)
Na bitte! Ein Großer Trigon (dieses Dreieck in der Mitte) mit Sonne, Jupiter (großes Glück) und Pluto (Unterwelt) an den Ecken. Jupiter steht ganz oben, aber in den Fischen – ich hätte also unbedingt meinen Hang zum Eskapismus und zum Träumen und meine esoterischen Neigungen zügeln sollen. (Das habe ich nicht.) Mars und Mond im zehnten Haus – das erklärt die Lyrikbände und auch die ein oder andere künstlerische Auseinandersetzung. Ja, die Sonne steht im Skorpion, was für andere nichts Gutes bedeuten muss: Einmal richtig verärgert, wird ein Skorpion zum erbarmungslosen Feind.
Die Herrscher des Skorpions sind Ares (Mars), der Kriegsgott, und Hades (Pluto), der Gott der Toten und der Unterwelt. Militärgeschichte, Abwassersysteme, Bestattungen, Krimis, Reizwäsche, verborgene Schätze, schmutzige Geheimnisse – all das fasziniert Skorpione. Uns wird nachgesagt, wir seien gute Detektive, Spione und kriminelle Superhirne. Und Totengräber.
Aber atmen Sie ruhig auf: Der Aszendent ist Zwilling. Das ideale Zeichen für eine Schriftstellerin. Der gute Zwilling und der böse, oder der äußere Zwilling und der innere. Der lächelnde Dr.-Jekyll-Zwilling, der seinen wohltätigen und respektablen Geschäften nachgeht, und der Hyde-Zwilling aus dem Schattenreich, tief verstrickt in Verbrechen und/oder ins Schreiben von Büchern.
Der planetarische Herrscher der Zwillinge ist Merkur bzw. Hermes, Götterbote, Erfinder des Witzes, Hüter und Offenbarer von Geheimnissen (daher das Wort hermetisch), Schutzheiliger der Reisenden und Diebe, Meister der Kommunikation und Seelenführer in die Unterwelt. Wie luftig und leicht! Wie geheimniskrämerisch! Wie geneigt zum Schabernack! Wie unbeeindruckt von jeglichem Schrecken! Wie heimisch in der Unterwelt! Wie … doppelbödig!
(Da ich Skorpion bin, bin ich grundsätzlich skeptisch – auch gegenüber Horoskopen. Genießen Sie das also mit gehöriger Vorsicht.)
Aber ist Zwilling wirklich mein Aszendent? Kleiner Haken: Meine Mutter konnte sich nicht genau erinnern, wann ich geboren wurde. Damals bekam man bei der Geburt nämlich Äther verpasst, und so war sie bei meinem ersten Atemzug bewusstlos. Der beste Hinweis kommt von den Ärzten – ausschließlich Männer natürlich, denn heilkundige Frauen und Ärztinnen waren ja über Jahrhunderte gründlich auf Scheiterhaufen entsorgt und später von medizinischen Fakultäten ferngehalten worden –, die meiner Mutter dankten, dass sie mit der Geburt bis nach dem Halbfinale des Grey-Cup-Footballspiels gewartet hatte. Daraus schließe ich, dass meine Geburt kurz nach 17 Uhr stattgefunden haben muss. Mein Bruder war nach seinen beiden Großvätern benannt worden, Harold und Leslie. Mutter hatte mit ihrer besten Freundin Eleanor vereinbart, ihre ersten Töchter nach der jeweils anderen zu benennen. Aber mein Vater war Romantiker und wollte – da er meine Mutter vergötterte –, dass ich ihren Namen erhielt. Und so geschah es. Eleanor wurde immerhin mein zweiter Vorname.