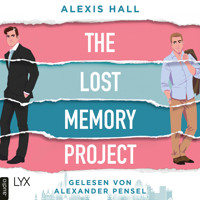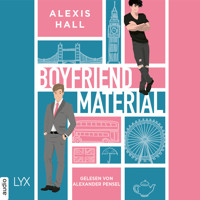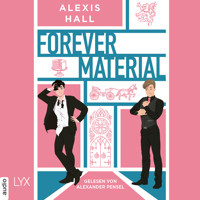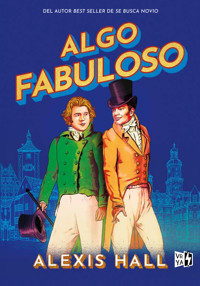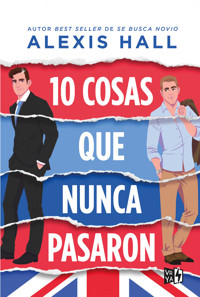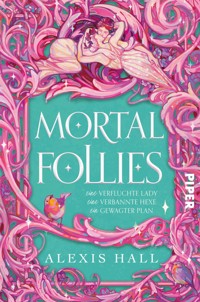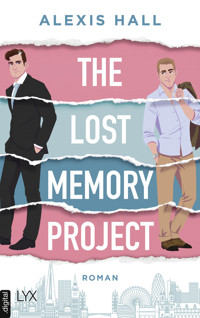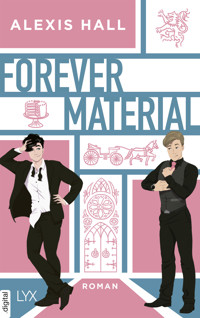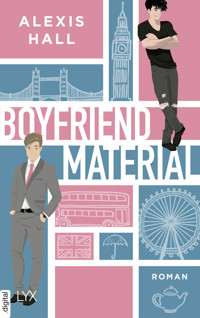
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Boyfriend Material
- Sprache: Deutsch
Gesucht: Fake-Boyfriend. Möglichst perfekt und skandalfrei
Mit einem berühmten Vater, der mit seinen Eskapaden immer wieder für Schlagzeilen sorgt, steht auch Luc O’Donnell im Licht der Öffentlichkeit. Als die Klatschpresse wieder mal negativ über ihn berichtet, droht er seinen Job bei einer Wohltätigkeitsorganisation zu verlieren. Um sein Image aufzupolieren, macht Luc sich auf die Suche nach einem respektablen Fake-Freund und findet schnell die ideale Besetzung für die Rolle: Oliver Blackwood - Anwalt, Vegetarier und so skandalfrei, wie es nur geht. Die beiden beschließen, der Welt das perfekte Paar vorzuspielen, und obwohl sie nicht unterschiedlicher sein könnten, merken sie bald, dass nicht alles bloß vorgetäuscht ist ...
"Diese Geschichte ist etwas Besonderes. Phänomenal!" PUBLISHERS WEEKLY
Auftakt der romantischen Liebesgeschichte rund um Luc und Oliver
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Anmerkung des Autors
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Der Autor
Die Romane von Alexis Hall bei LYX
Impressum
Alexis Hall
Boyfriend Material
Roman
Ins Deutsche übertragen von Carina Schnell
ZU DIESEM BUCH
Luc O’Donnell ist ein bisschen berühmt. Als Sohn eines bekannten Rockstars, der gerade sein Comeback wagt, steht er im Licht der Öffentlichkeit. Obwohl Luc seinen Vater seit seiner Kindheit nicht gesehen hat, färbt der Ruf des ehemaligen Promis negativ auf ihn ab. Schon ein harmloser Skandal oder ein falsches Foto könnte alles ruinieren und ihn seinen Job bei einer Stiftung kosten. Als genau das passiert und Sponsoren damit drohen, ihr Geld anderweitig zu spenden, muss Luc handeln. Um seinen Ruf zu retten und die Gunst der Unterstützer zurückzugewinnen, beschließt er, sich einen netten und respektablen Freund zu suchen – und findet Oliver Blackwood. Dieser ist so skandalfrei, wie es nur geht: Anwalt, Vegetarier und ebenfalls auf der Suche nach einem Date für ein großes Event. Die beiden vereinbaren, sich zusammenzutun und der Welt das perfekte Paar vorzuspielen. Ihr erstes Date ist ein absolutes Desaster, und sie merken schnell, dass sie unterschiedlicher nicht sein könnten und so gar nichts gemeinsam haben. Und doch verbindet sie viel mehr, als sie zu Beginn dachten.
Anmerkung des Autors
Ich habe dieses Buch zu schreiben begonnen, bevor J. K. Rowling ihre Plattform dafür nutzte, die Rechte von trans Personen anzugreifen. In diesem Text finden sich einige Referenzen zu ihren Werken. Dabei handelt es sich in keiner Weise um eine Befürwortung der Werke oder der Autorin.
Für CMC
Der Sinn ausgefallener Kostümpartys hatte sich mir noch nie erschlossen. Es lief auf zwei Möglichkeiten hinaus: Entweder gab ich mir richtig viel Mühe mit dem Outfit und sah aus wie ein Arsch oder ich gab mir überhaupt keine Mühe und sah aus wie ein Arsch. Und wie immer lag mein Problem darin, dass ich nicht wusste, welche Art von Arsch ich sein wollte.
Ich hatte mich der Keine-Mühe-Strategie verschrieben. Dann hatte ich in einem Anflug von Panik kurz vorher nach einem Kostümgeschäft gesucht und mich plötzlich in einem dieser merkwürdig konventionellen Sexshops wiedergefunden, die rote Dessous und pinke Dildos an Leute verkauften, die sich für keins von beidem interessierten.
Aus diesem Grund tauchte ich schließlich mit einem Paar dieser sexualisierten Hasenohren aus schwarzer Spitze auf der Party auf, die sich bereits in der zu heißen, zu lauten, zu vollen Phase befand. Früher war ich mal gut in so was gewesen. Aber ich war aus der Übung gekommen, und die Tatsache, dass ich in meinem Outfit wie ein billiger Stricher mit leichter Fetischnote aussah, trug nicht gerade zu einer triumphalen Rückkehr in die Partyszene bei. Schlimmer noch, ich war so spät dran, dass all die anderen einsamen Loser bereits aufgegeben hatten und nach Hause gegangen waren.
Die anderen befanden sich irgendwo in dem düsteren Schlund aus grellen Lichtern, dröhnender Musik und Schweiß. Das wusste ich, da sich unsere WhatsApp-Gruppe – die gegenwärtig QueerComesTheSun hieß – in hundert verschiedene Versionen der Titelmusik von WozurHölleistLuc verwandelt hatte.
Doch ich konnte nur Leute ausmachen, die mir vage so vorkamen, als könnten sie vielleicht Leute kennen, denen ich vage bekannt vorkam. Ich schlängelte mich zur Bar durch, kniff die Augen zusammen, um die Tafel mit den Drinks des Abends zu lesen, und bestellte einen namens Ginvolles Gespräch über Pronomen mit dem Rücken zur Wand. Das klang nicht nur lecker, sondern fasste auch meine Chancen, an diesem Abend – oder jemals – flachgelegt zu werden, perfekt zusammen.
Wahrscheinlich sollte ich erklären, warum ich in einem Keller in Shoreditch an einem nichtbinären Getränk nippte, während ich das spießigste Fetisch-Outfit der Welt trug. Ehrlich gesagt stellte ich mir diese Frage selbst. Die Kurzversion: Ich war hier, weil ich einen Typen namens Malcolm kannte, den jeder kannte. Ich war mir ziemlich sicher, dass er Börsenmakler oder Banker war, aber bei Nacht – womit ich manche Nächte meinte, womit ich ungefähr eine Nacht pro Woche meinte – legte er in einem Transgender-/Gender-Fluid-Club namens Surf ’n’ Turf @ The Cellar auf. Und heute war seine T-Party. Also, T wie Tee. Wie die Teeparty des Verrückten Hutmachers. Typisch Malcolm eben.
In diesem Moment stand er – mit lilafarbenem Zylinder, gestreiftem Frack, Lederhose und nicht viel mehr – am anderen Ende des Raums, während er etwas auflegte, was allgemein als »heiße Beats« betitelt wurde. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hatte das noch nie jemand gesagt. Während meiner Club-Phase hatte ich mir nicht mal die Mühe gemacht, nach den Namen meiner Eroberungen zu fragen, ganz zu schweigen von dem damaligen Slang.
Ich seufzte und wandte mich wieder meinem »ginvollen« Getränk zu. Es sollte ein Wort für das Gefühl geben, auf etwas eigentlich keine Lust zu haben, es aber einer anderen Person zuliebe zu tun, bis sich am Ende herausstellte, dass diese Person gar nicht auf die Unterstützung angewiesen war und es aufs Gleiche hinausgelaufen wäre, den Abend im Schlafanzug mit dem Auslöffeln eines Nutellaglases zu verbringen. So fühlte ich mich. Vermutlich hätte ich einfach verschwinden sollen, aber dann wäre ich das Arschloch gewesen, das zu Malcolms T-Party aufgetaucht war, sich keine Mühe mit seinem Outfit gegeben hatte, ein Achtel eines Cocktails getrunken und sich dann wieder verpisst hatte, ohne sich zu unterhalten.
Ich zückte mein Handy und schickte ein einsames »Bin da, wo seid ihr?« an die Gruppe, doch neben der Nachricht tauchte die Uhr des Grauens auf. Wer hätte schon ahnen können, dass es auf einer Party, die unter der Erde, umgeben von Betonwänden, stattfand, keinen Empfang gab?
»Dir ist bewusst«, warmer Atem streifte meine Wange, »dass deine Ohren nicht mal weiß sind, oder?«
Ich drehte mich zu dem fremden Typen neben mir um. Ein ziemlich süßer Fremder, mit diesen spitzen, fuchsähnlichen Gesichtszügen, die ich schon immer seltsam entzückend gefunden hatte. »Ja, aber ich war spät dran. Und du trägst gar kein Kostüm.«
Er grinste, was sein Gesicht noch spitzer und fuchsähnlicher und entzückender machte. Dann schlug er das Revers seines Blazers um. Darunter kam ein Aufkleber zum Vorschein, auf dem Niemand stand.
»Ich nehme an, dass es sich dabei um irgendeine nervige Anspielung handelt.«
»›Ich wünschte, ich hätte solche Augen‹, sagte der König. ›Niemand sehen zu können.‹«
»Du selbstgefälliger Streber.«
Er lachte. »Auf schicken Kostümpartys zeige ich mich immer von meiner schlechtesten Seite.«
In der Vergangenheit hatte ich schon länger mit Männern gesprochen, ohne es zu vergeigen, aber ich näherte mich meiner persönlichen Bestzeit. Jetzt galt es, nicht in Panik zu verfallen und auf keinen Fall meinen Selbstschutzmechanismus zu aktivieren, durch den ich mich wahlweise in einen unausstehlichen Wichser oder eine männliche Hure verwandelte. »Ich frage mich, wer sich auf Kostümpartys je von seiner besten Seite zeigt.«
»Das wäre dann wohl Malcolm.« Wieder grinste er, zeigte dabei seine Zähne.
»Malcolm präsentiert sich immer von seiner besten Seite. Er könnte die Leute sogar dazu bringen, zu feiern, dass wir jetzt 10 Pence für Plastiktüten bezahlen müssen.«
»Bitte bring ihn nicht auf solche Gedanken. Übrigens …« Er beugte sich dichter zu mir. »Ich heiße Cam. Aber da du mich wahrscheinlich sowieso nicht verstanden hast, werde ich auf sämtliche einsilbige Namen mit einem Vokal in der Mitte reagieren.«
»Schön, deine Bekanntschaft zu machen, Bob.«
»Du selbstgefälliger Streber.« Trotz des pulsierenden Lichts erkannte ich das Funkeln in seinen Augen. Und ich ertappte mich dabei, wie ich mich fragte, welche Farbe sie wohl weit weg von den Schatten und künstlichen Regenbogenlichtern der Tanzfläche hatten. Das war ein schlechtes Zeichen. Dadurch steuerte ich gefährlich nah darauf zu, ihn zu mögen. Und wohin hatte mich das in der Vergangenheit geführt?
»Du bist Luc Fleming, oder?«, fragte er.
Hallo! Ich hatte schon auf den Haken an der Sache gewartet. Fuck my life.
»Korrekt ist Luc O’Donnell.« Meine Standarderwiderung.
»Aber du bist Jon Flemings Sohn?«
»Was geht dich das an?«
Er blinzelte. »Na ja, gar nichts. Aber als ich Angie« – Malcolms Freundin, die sich natürlich als Alice verkleidet hatte – »gefragt habe, wer der heiße, mürrisch dreinschauende Typ ist, hat sie gesagt: ›Oh, das ist Luc. Jon Flemings Sohn.‹«
Es gefiel mir nicht, dass es das war, was sich die Leute über mich erzählten. Aber was sollten sie sonst sagen? Das ist Luc, seine Karriere ist am Ende? Das ist Luc, er hatte seit fünf Jahren keine feste Beziehung mehr? Das ist Luc, wo ist er nur falsch abgebogen? »Jap, das bin ich.«
Cam stützte die Ellbogen auf der Bar ab. »Das ist aufregend. Ich habe noch nie eine Berühmtheit getroffen. Soll ich so tun, als wäre ich ein großer Fan von deinem Dad oder als würde ich ihn hassen?«
»Ich habe ihn nie wirklich kennengelernt.« Das war keine große Offenbarung, er hätte es mit einer schnellen Google-Suche herausfinden können. »Also ist es mir ziemlich egal.«
»Ist wahrscheinlich besser so. Ich erinnere mich nämlich nur an ungefähr einen seiner Songs. Ich glaube, es geht darum, dass er ein grünes Band an seinem Hut trägt.«
»Nein, das ist von Steeleye Span.«
»Ah, Moment, Jon Fleming ist von den Rights of Man.«
»Ja, aber ich verstehe, warum du die beiden verwechselt hast.«
Er sah mich scharf an. »Die machen ganz andere Musik, oder?«
»Na ja, es gibt ein paar kleine Unterschiede. Steeleye machen eher Folk Rock und RoM eher Progressive Rock. Steeleye benutzen viele Geigen, Dad spielt Flöte. Außerdem singt bei Steeleye eine Frau.«
»Okay.« Er lächelte mich erneut an, viel weniger verlegen, als ich es an seiner Stelle gewesen wäre. »Ich habe keine Ahnung. Aber mein Dad ist ein großer Fan. Er bewahrt alle Platten oben auf dem Dachboden auf, gemeinsam mit der Schlaghose, in die er seit 1979 nicht mehr reinpasst.«
Langsam sickerte es zu mir durch, dass Cam mich vor circa acht Millionen Jahren als heiß und mürrisch beschrieben hatte. Im Moment dürfte es allerdings 80:20 für mürrisch stehen. »Alle Väter sind Fans von meinem Dad.«
»Das muss komisch für dich sein.«
»Ein bisschen.«
»Und noch komischer, seit er im Fernsehen ist.«
»Schon irgendwie.« Lustlos stupste ich meinen Drink an. »Seitdem werde ich öfter erkannt, aber ›Hey, dein Dad ist doch der Typ von dieser blöden Talentshow‹ ist geringfügig besser als ›Hey, dein Dad ist doch der Typ, der letzte Woche in den Nachrichten war, weil er einem Polizisten eine Kopfnuss verpasst und dann eine Richterin vollgekotzt hat, während er auf Heroin und WC-Reiniger war‹.«
»Wenigstens ist es interessant. Das Skandalöseste, was mein Dad je gemacht hat, war, eine Ketchupflasche zu schütteln, ohne zu bemerken, dass der Deckel fehlte.«
Ich lachte, obwohl ich es nicht wollte.
»Ich kann nicht glauben, dass du dich über mein Kindheitstrauma lustig machst. Die Küche sah aus wie das Set von Hannibal. Mum erwähnt es jedes Mal, wenn sie genervt ist, selbst wenn sie gar nicht von Dad genervt ist.«
»Ja, meine Mum kommt auch immer auf meinen Dad zu sprechen, wenn ich sie nerve. Nur ist es weniger ›Das ist genau wie damals, als dein Vater Ketchup in der ganzen Küche verteilte‹, sondern eher ›Das ist genau wie damals, als dein Vater sagte, er würde zu meinem Geburtstag kommen, aber stattdessen in L. A. Kokain von den Brüsten einer Prostituierten geschnupft hat‹.«
Cam blinzelte. »Uff.«
Scheiße. Es brauchte nicht mehr als einen halben Cocktail und ein hübsches Lächeln, und ich ließ alle Hüllen fallen und sang lautstark wie ein gewisses herzallerliebstes Waisenkind auf einer Barrikade in Frankreich. Das war genau das Zeug, was in den Klatschblättern landete. Jon Flemings geheime Kokain-Schande. Oder: Wie der Vater, so der Sohn: Der Vergleich zwischen Jon Fleming Juniors Kindheit und den Drogenabstürzen seines Vaters. Oder am schlimmsten: Nach all den Jahren immer noch verrückt:Odile O’Donnell lässt ihre Wut über Flemings Eskapaden der 80er an ihrem Sohn aus.
Aus diesem Grund dürfte ich meine Wohnung eigentlich niemals verlassen. Oder mich jemals mit Leuten unterhalten. Vor allem nicht mit Leuten, von denen ich wollte, dass sie mich mochten.
»Hör mal«, sagte ich mit einem nicht vorhandenen Pokerface, obwohl ich wusste, dass das hier total schiefgehen konnte. »Meine Mum ist ein guter Mensch, und sie hat mich allein großgezogen und viel durchgemacht, also könntest du, äh, vergessen, was ich gerade gesagt habe?«
Er sah mich mit dem Gesichtsausdruck an, den viele machen, wenn sie eine Person in Gedanken aus der Schublade nehmen, auf der »attraktiv« steht, und sie in die Schublade stecken, auf der »seltsam« steht.
»Ich werde es ihr nicht sagen. Ich kenne sie ja gar nicht. Und ja, womöglich bin ich hergekommen, weil ich mit dir flirten wollte, aber wir sind sehr weit davon entfernt, einander unsere Eltern vorzustellen.«
»Sorry. Sorry. Ich … Ich habe einfach einen starken Beschützerinstinkt, was sie angeht.«
»Und du glaubst, sie muss vor irgendwelchen Typen beschützt werden, die du in Bars triffst?«
Tja, ich hatte es versaut. Denn die Antwort war im Grunde: »Ja, für den Fall, dass du zu den Klatschblättern gehst, weil das etwas ist, was mir tatsächlich passiert.« Aber das konnte ich ihm nicht sagen, ohne ihn auf diesen Gedanken zu bringen. Angenommen, dass er das nicht sowieso vorhatte und mich so mühelos gegen mich selbst ausspielte, wie die Bands der Siebziger ihre Flöten oder wahlweise Geigen spielten. So blieb mir nur Option B: diesen lustigen, sexy Mann, mit dem ich mir mindestens einen One-Night-Stand vorstellen konnte, glauben zu lassen, dass ich ein paranoider Creep war, der viel zu viel Zeit damit verbrachte, an seine Mutter zu denken.
»Ähm.« Ich schluckte und fühlte mich etwa so begehrenswert wie die Überreste eines angefahrenen Tiers am Straßenrand. »Können wir zu dem Punkt zurückkehren, an dem du rüberkamst, um mit mir zu flirten?«
Die Stille hielt länger an, als mir lieb war. Dann lächelte Cam, wenn auch leicht misstrauisch. »Klar.«
Noch mehr Stille.
»Also«, sagte ich, »dieses Mit-mir-Flirten, das du gerade tust … Ich muss sagen, es ist wirklich minimalistisch.«
»Mein ursprünglicher Plan war, du weißt schon, ein bisschen zu quatschen und zu schauen, wie es so läuft, und dann hätte ich vielleicht versucht, dich zu küssen oder so. Aber diesen Plan hast du vereitelt, und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll.«
Ich ließ den Kopf hängen. »Tut mir leid. Du hast nichts falsch gemacht. Ich bin nur ziemlich schlecht in …«, ich versuchte, ein Wort zu finden, das mein aktuelles Dating-Leben am besten beschrieb, »… allem.«
Vielleicht kam es mir nur so vor, aber ich konnte Cam beinahe ansehen, wie er darüber nachdachte, ob ich die Mühe wert war. Überraschenderweise schien er zu dem Schluss zu kommen, dass ich es war. »Allem?«, fragte er und zupfte an einem meiner Hasenohren. Ich entschied mich, diese Geste als Ermutigung zu sehen.
Das war ein gutes Zeichen, oder nicht? Es musste ein gutes Zeichen sein. Oder war es ein furchtbares? Was stimmte nicht mit ihm? Warum war er noch nicht schreiend davongelaufen? Okay. Nein. Ich befand mich mal wieder in meinem Kopf, und das war der schlimmste Ort, an dem sich irgendjemand aufhalten konnte, vor allem ich selbst. Ich musste etwas Leichtes, Kokettes sagen, und zwar verdammt noch mal sofort. »Küssen. Darin bin ich ganz in Ordnung.«
»Hmm.« Cam beugte sich noch näher. Heilige Scheiße, würde er es wirklich tun? »Ich bin nicht sicher, ob ich deinem Urteil vertrauen kann. Ich sollte mich lieber selbst davon überzeugen.«
»Äh, okay?«
Also überzeugte er sich. Und ich war in Ordnung, was das Küssen anging. Ich meine, ich glaubte, ich war in Ordnung. Gott, ich hoffte, dass ich in Ordnung war.
»Und?«, fragte ich kurz darauf, wobei ich entspannt und spielerisch klang, ganz und gar nicht verzweifelt und unsicher.
Sein Gesicht war mir so nah, dass ich all die verlockenden Details erkennen konnte, wie die Dichte seiner Wimpern, die leichten Stoppeln am Kinn und die Fältchen um die Mundwinkel. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach nur einem einzigen Datenvergleich eine akkurate Schlussfolgerung ziehen kann.«
»Oooh. Wie wissenschaftlich von dir.«
Wir vertieften die Datenaufnahme. Und als wir fertig waren, hatte er mich gegen den Rand der Bar gepresst, und ich hatte meine Hände in den hinteren Taschen seiner Jeans vergraben, um ihn nicht allzu offensichtlich zu begrapschen. Da fiel mir wieder ein, dass er meinen Namen kannte und den meines Dads und vermutlich auch den meiner Mum, und dass er womöglich sogar über alles Bescheid wusste, was je über mich geschrieben worden war, und ich im Gegenzug lediglich wusste, dass er Cam hieß und gut schmeckte.
»Bist du das denn?«, fragte ich atemlos. Er sah mich verwirrt an. »Ich meine, bist du wissenschaftlich drauf? Du siehst gar nicht so aus.«
»Oh. Nein.« Er grinste, fuchsähnlich und köstlich. »Das war bloß eine Ausrede, um dich weiter zu küssen.«
»Was machst du denn beruflich?«
»Ich bin Freelancer, arbeite hauptsächlich für Seiten, die wünschten, sie wären BuzzFeed.«
Ich hatte es gewusst. Ich hatte es verdammt noch mal gewusst. Er hatte viel zu bereitwillig über all meine Fehler hinweggesehen. »Du bist Journalist.«
»Das ist eine ziemlich großzügige Berufsbezeichnung für das, was ich mache. Ich schreibe diese Listen, du weißt schon, X Dinge über Y und warum du Z nicht glauben wirst, die alle hassen, aber trotzdem lesen.«
Zwölf Dinge, die du nicht über Luc O’Donnell wusstest. Nummer acht wird dich schockieren.
»Und manchmal mache ich diese Quizze: Wähle acht Kätzchenfotos, und wir sagen dir, welcher John-Hughes-Charakter du bist.«
Die rationale Version von Luc, die aus dem Paralleluniversum, in dem mein Dad kein berühmter Scheißkerl war und mein Exfreund nicht alle meine Geheimnisse an Piers Morgan verkauft hatte, versuchte mir zu sagen, dass ich überreagierte. Leider hörte ich nicht zu.
Fragend legte Cam den Kopf schief. »Was ist denn los? Ich weiß, dass der Job nicht besonders sexy ist, und ich kann nicht mal sagen ›Jemand muss es tun‹, weil das nicht stimmt, aber du bist auf einmal wieder komisch.«
»Sorry. Es ist … kompliziert.«
»Kompliziert kann interessant sein.« Er stellte sich auf die Zehenspitzen, um mir eine Strähne hinters Ohr zu schieben. »Und das Küssen läuft doch gut. Jetzt müssen wir nur noch am Reden arbeiten.«
Ich schenkte ihm etwas, von dem ich hoffte, dass es kein rührseliges Lächeln war. »Ich bleibe lieber bei Dingen, die ich gut kann.«
»Wie wäre es, wenn ich dir eine Frage stelle, und wenn mir die Antwort gefällt, darfst du mich wieder küssen?«
»Hm, ich weiß nicht –«
»Fangen wir klein an. Du weißt, was ich beruflich mache. Was ist mit dir?«
Mein Herz raste. Und nicht auf die spaßige Art. Doch das war eine harmlose Frage, oder nicht? Ich würde ihm eine Information geben, die mindestens zweihundert Spambots bereits besaßen. »Ich arbeite für eine Wohltätigkeitsorganisation.«
»Wow. Wie nobel von dir. Ich würde ja sagen, dass ich so was schon immer tun wollte, aber dafür bin ich viel zu oberflächlich.« Er hob mir sein Gesicht entgegen und ich küsste ihn nervös.
»Was ist deine Lieblingseissorte?«
»Minze mit Schokostückchen.«
Ein weiterer Kuss. »Welches Buch haben so gut wie alle gelesen, aber du nicht?«
»Alle.«
Er wich zurück. »Für so ein Ausweichmanöver kriegst du keinen Kuss.«
»Nein, ich meine es ernst. Ich kenne keins. Wer die Nachtigall stört, Der Fänger im Roggen, Im Westen nichts Neues, nichts von Dickens, die eine Geschichte über die Frau eines Zeitreisenden, Harry Potter …«
»Du bildest dir ganz schön was ein auf deine Unbelesenheit, was?«
»Ja, ich denke, ich werde nach Amerika ziehen und mich um ein öffentliches Amt bewerben.«
Er lachte und küsste mich, blieb diesmal dicht bei mir, presste seinen Körper an meinen, sein Atem fuhr über meine Haut. »Okay. Der seltsamste Ort, an dem du bisher Sex hattest?«
»Ist das Nummer acht?«, fragte ich laut lachend, womit ich zeigen wollte, wie unglaublich cool und unbesorgt ich war.
»Nummer acht wovon?«
»Du weißt schon, Zwölf Kinder von Prominenten, die es gerne an seltsamen Orten treiben. Nummer acht wird dich schockieren.«
»Moment mal.« Er erstarrte. »Glaubst du wirklich, dass ich dich für einen Artikel küsse?«
»Nein. Ich meine … nein. Nein.«
Er starrte mich einen langen, schrecklichen Moment an. »Doch, das tust du, nicht wahr?«
»Ich sagte ja bereits, dass es kompliziert ist.«
»Das ist nicht kompliziert, sondern beleidigend.«
»Ich … es ist …« Ich hatte das Gespräch schon einmal gerettet, es konnte mir wieder gelingen. »So war das nicht gemeint. Es hat nichts mit dir zu tun.«
Diesmal zupfte er mir nicht am Hasenohr. »Wie soll es dabei nicht um mich gehen, wenn du dir Sorgen um mein mögliches Verhalten machst?«
»Ich muss einfach vorsichtig sein.« Nur fürs Protokoll: Während ich das sagte, klang ich extrem würdevoll und überhaupt nicht lächerlich.
»Was sollte ich überhaupt schreiben? Ich habe den Sohn eines ehemaligen Prominenten auf einer Party getroffen?Was für ein Schock: Der schwule Sohn eines Prominenten ist schwul?«
»Na, das hört sich jedenfalls nach einem höheren Niveau an als deine üblichen Listen.«
Seine Kinnlade fiel herab, und ich bemerkte, dass ich ein winziges bisschen zu weit gegangen war. »Wow. Ich wollte gerade sagen, dass ich nicht sicher bin, wer von uns das Arschloch ist. Danke, dass du mich aufgeklärt hast.«
»Nein, nein«, sagte ich hastig. »Es war immer ich. Glaub mir, ich weiß es.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Ich meine, ich weiß nicht, was schlimmer ist: dass du glaubst, ich würde mit einem D-Promi ins Bett springen, um im Job weiterzukommen. Oder dass du davon ausgehst, ich würde dich wählen, sollte ich jemals so eine demütigende Entscheidung für meine Karriere treffen.«
Ich schluckte. »Das sind alles gute Argumente. Sehr gut gemacht.«
»Scheiß die Wand an, ich hätte auf Angie hören sollen. Du bist es so was von nicht wert.«
Er stürmte durch die Menge davon, wahrscheinlich um jemanden zu finden, der nicht so abgefuckt war wie ich, und ließ mich allein zurück – mit hängenden Hasenohren und dem tiefschürfenden Gefühl, versagt zu haben. Allerdings hatte ich heute Abend zwei Dinge geschafft: Ich war zur Unterstützung eines Mannes hier, der in keiner Weise auf sie angewiesen war, und ich hatte endlich entgegen jeglichem Zweifel bewiesen, dass mich niemand daten würde, der bei Verstand war. Ich war ein zugeknöpftes, mürrisches, paranoides Wrack, das es schaffte, selbst die normalste menschliche Interaktion zu sabotieren.
Ich lehnte mich an die Bar und starrte in den Keller voller fremder Leute, die alle viel mehr Spaß hatten als ich und von denen mindestens zwei vermutlich gerade darüber sprachen, was für ein schrecklicher Mensch ich war. Mir blieben nur zwei Möglichkeiten: Ich konnte mich zusammenreißen, mich wie ein Erwachsener benehmen, meine Leute finden und versuchen, das Beste aus dem Abend zu machen. Oder ich konnte nach Hause flüchten, allein trinken und dieses Desaster auf die Liste der Dinge setzen, die ich vergeblich aus meiner Erinnerung zu streichen versuchte.
Zwei Sekunden später lief ich die Treppe hinauf. Acht Sekunden später fand ich mich auf der Straße wieder.
Neunzehn Sekunden später stolperte ich über meine eigenen Füße und landete mit dem Gesicht voran im Rinnstein.
War das nicht das salmonellenvergiftete Sahnehäubchen auf meinem bereits gefährlich schiefen Kuchen? Auf gar keinen Fall würde mich diese peinliche Aktion in Zukunft heimsuchen.
Die peinliche Aktion suchte mich heim.
Und zwar in Form eines Google-Alerts, durch deren Vibration mein Handy beinahe vom Nachttisch gefallen wäre. Und ja, mir war bewusst, dass nur Wichser, narzisstische Menschen oder narzisstische Wichser verfolgten, was andere Leute im Internet über sie sagten. Aber ich hatte auf die harte Tour lernen müssen, dass es besser war zu wissen, was da draußen für Gerüchte über mich herumgeisterten. Ich schlug wild um mich, wobei ich ein anderes Gerät mit Vibrationsfunktion – eins für Gentlemen, die auf anspruchsvolle Art ihre Lust genießen wollen – zu Boden stieß. Schließlich gelang es mir, mein Handy zu ertasten, etwa so feinfühlig wie ein Teenager beim ersten Pettingversuch.
Ich wollte nicht nachsehen. Aber wenn ich es nicht tat, würde ich die klebrige Masse aus Furcht, Hoffnung und Unsicherheit rauskotzen, die mein Inneres in Babybrei verwandelt hatte. Wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm wie befürchtet. Gewöhnlich war es nicht so schlimm wie befürchtet. Nur manchmal war es … das eben doch. Ich spähte durch meine Wimpern auf den Bildschirm, wie ein kleines Kind, das bei einer Folge Doctor Who hinter dem Sofakissen hervorlugte.
Und plötzlich konnte ich wieder atmen. Es war okay. Obwohl in einer perfekten Welt natürlich keine Fotos von mir mit Hasenohren im Rinnstein vor dem The Cellar auf jeder drittklassigen Gerüchtewebsite von Celebitchy bis Yeeeah kursierten. Und in einer wirklich perfekten Welt wäre meine Definition von okay nicht ganz so tief gesunken. Doch da mein Leben eine endlose Jauchegrube war, brauchte es mittlerweile mehr, um mich zu schockieren. Ich meine, wenigstens war ich auf diesem Foto vollständig bekleidet und hatte keinen Schwanz im Mund. Also, na ja, es war ein kleiner Sieg.
Der heutige Nagel im Sarg meines digitalen Rufs hatte einen starken Wie-der-Vater-so-der-Sohn-Vibe, weil man ein Fass ohne Boden mit Aufnahmen von Jon Fleming füllen könnte, wie er sich in aller Öffentlichkeit königlich blamierte. Und ich nehme an, Bad Boy Jonnys wilder Sohn bricht nach Drogen-Sex-Skandal zusammen ist eine bessere Schlagzeile als Mann rutscht auf der Straße aus und landet auf der Nase.
Seufzend ließ ich mein Handy zu Boden fallen. Wie sich herausstellte, gab es eine Sache, die noch schlimmer war, als einen berühmten Vater zu haben, der seine Karriere wie einen Champagnerkorken abgeschossen hatte. Und zwar, einen berühmten Vater zu haben, der ein verdammtes Comeback hinlegte.
Gerade erst hatte ich einigermaßen gelernt, damit umzugehen, dass ich ständig mit meinem rücksichtslosen, selbstzerstörerischen, ewig abwesenden Vater verglichen wurde. Aber jetzt, da er sich zusammenriss und jeden Sonntag den weisen alten Mentor auf ITV mimte, zog ich plötzlich den Kürzeren, wenn ich mit meinem rücksichtslosen, selbstzerstörerischen, ewig abwesenden Vater verglichen wurde. Und das war ein ganz neues Bullshit-Level, auf das ich emotional nicht vorbereitet war. Ich hätte die Kommentare nicht lesen dürfen, doch mein Blick landete versehentlich auf wellactually69. Diese Person hatte viel Zuspruch für die Idee einer Reality-TV-Show bekommen, in der Jon Fleming versuchen sollte, seinen Junkie-Sohn zurück auf den richtigen Pfad zu bringen. Theotherjillfrompeckham hatte sogar kommentiert, eine solche Show »exzessiv binge-watchen« zu wollen.
Ich wusste, dass nichts davon wirklich etwas zu bedeuten hatte. Das Internet war zwar ewig und ich konnte ihm nicht entkommen, aber spätestens übermorgen wäre ich bereits wieder vergessen. Zumindest so lange, bis jemand Lust auf einen Twist der Jon-Fleming-Story bekam. Trotz allem fühlte ich mich verdammt elend, und je länger ich hier lag, desto schlimmer wurde es.
Ich versuchte mich mit der Tatsache zu trösten, dass Cam wenigstens keine Liste nach dem Motto Zwölf Ärsche, die dir in einem Club über den Weg laufen veröffentlicht hatte. Aber das war nicht besonders tröstlich. Um ehrlich zu sein, war ich noch nie gut darin gewesen, auf mich selbst zu achten. Self-Care war ein Fremdwort für mich, dafür war ich besonders gut in Schuldzuweisung, wobei ich mich insbesondere auf Selbsthass spezialisiert hatte. Da lag ich also, ein achtundzwanzigjähriger Mann, den in einem Anfall von Traurigkeit plötzlich der starke Drang überkam, seine Mutter anzurufen.
Denn das einzig Gute daran, meinen Dad zum Dad zu haben, war, dass meine Mum meine Mum war. Das könnte man auf Wikipedia nachlesen, aber die Kurzversion war, dass meine Mum in den Achtzigern eine französisch-irische Adele mit noch voluminöserer Frisur gewesen war. Und etwa zu der Zeit, als Bros sich fragten, wann sie berühmt sein würden, und Cliff Richard Mistletoe and Wine auf alle nichtsahnenden zukünftigen Weihnachtsfeste losließ, verstrickten sie und Dad sich in diesem Ich-liebe-dich-ich-hasse-dich-ich-kann-nicht-ohne-dich-leben-Ding, woraus zwei Gemeinschafts-, ein Soloalbum und ich hervorgegangen waren. Also, streng genommen kam ich vor dem Soloalbum, das entstanden war, als Dad erkannt hatte, dass er lieber berühmt und betrunken wäre als Teil unseres Lebens. Welcome Ghosts war das Letzte, was Mum je geschrieben hatte, und auch das Letzte, was sie je schreiben musste. Denn fast jedes Jahr benutzten die BBC oder ITV oder irgendwelche Filmstudios einen Song von dem Album für eine traurige oder wütende Szene oder eine, die nicht in das Spektrum passte. Den Scheck lösten wir trotzdem ein.
Ich stolperte aus dem Bett und nahm automatisch die Quasimodo-Pose ein, die für jede Person über 1,68 Meter notwendig war, um sich in meiner Wohnung fortzubewegen, ohne sich an der niedrigen Decke zu stoßen. Mit meinen 1,93 Metern war meine Wohnung etwa so passend, als hätte ich mir als Auto einen Mini Cooper ausgesucht. Ich hatte das Apartment mit Miles, meinem Ex, gemietet, als es noch eine romantische Vorstellung gewesen war, in der modernen Version einer Mansarde in Shepherd’s Bush zu wohnen. Mittlerweile wurde es allerdings lächerlich: Ich war allein, steckte in einem sackgassenartigen Job fest und war finanziell immer noch nicht in der Lage, mir eine Bleibe zu leisten, die mehr war als die Unterseite eines Dachs. Natürlich würde es auch helfen, wenn ich putzen würde. Überhaupt jemals.
Ich schob einen Haufen Socken vom Sofa, rollte mich darauf zusammen und öffnete FaceTime. »Allô, Luc, mon caneton«, sagte Mum. »Hast du das ganz große Ding von deinem Vater gestern Abend gesehen?«
Ich keuchte entsetzt, bevor ich mich daran erinnerte, dass Das ganz große Ding der Name seiner blöden Fernsehshow war. »Nein. Ich war unterwegs.«
»Du solltest es dir anschauen. Die Folge wird bestimmt wiederholt.«
»Ich will es nicht sehen.«
Sie zuckte auf typisch französische Art mit den Schultern. Ich war davon überzeugt, dass sie es mit dem französischen Getue übertrieb, aber das konnte ich ihr nicht vorwerfen, da sie von ihrem Vater nichts als seinen Namen bekommen hatte. Ach ja, und eine natürliche Blässe, auf die Siouxsie Sioux neidisch wäre. Auch wenn es keine genetische Veranlagung war, einen Vater zu haben, der die Familie verließ, war es bei uns eindeutig erblich. »Dein Vater ist nicht gut gealtert«, sagte sie.
»Gut zu wissen.«
»Sein Kopf ist so haarlos wie ein Ei und hat eine lustige Form. Er sieht aus wie dieser Chemielehrer, der Krebs hat.«
Das war mir neu. Doch ich hatte mir nie die Mühe gemacht, über meine alte Schule informiert zu bleiben. Um ehrlich zu sein, hatte ich mir nicht die Mühe gemacht, mit irgendeiner Person von der falschen Seite Londons in Kontakt zu bleiben. »Mr Beezle hat Krebs?«
»Nicht er. Der andere.«
Noch etwas Wissenswertes über meine Mum: Ihre Beziehung zur Realität war bestenfalls fragwürdig. »Meinst du Walter White?«
»Oui, oui. Und, weißt du, ich finde, er ist zu alt, um noch mit einer Flöte herumzuspringen.«
»Jetzt sprechen wir wieder über Dad, oder? Wenn nicht, ist Breaking Bad in den letzten Staffeln echt abgedreht geworden.«
»Natürlich geht es um deinen Vater. Er wird sich bestimmt eine Hüfte brechen.«
»Tja.« Ich grinste. »Hoffen wir es.«
»Er wollte eine junge Frau mit einer Harmonika in seinem Team haben. Ich glaube, sie war eine gute Wahl, weil sie mit am meisten Talent hatte, aber dann hat sie sich für einen der Jungs von Blue entschieden. Das hat mir sehr gefallen.«
Wenn man sie ließ, konnte Mum ewig über Reality-TV reden. Leider beschränkte sich mein Versuch, sie von diesem Thema abzubringen, auf »Die Paparazzi haben mich gestern wieder erwischt«. Zu meiner Verteidigung: Die Kommentare von wellactually69 & Co summten wie Internethornissen ununterbrochen in meinem Kopf herum.
»Oh, Baby. Schon wieder? Das tut mir leid.«
Mein Schulterzucken war nicht besonders französisch.
»Du weißt doch, wie es sich mit solchen Dingen verhält.« Ihr Tonfall wurde weicher, beruhigend. »Es ist bloß wie ein Gewitter in einem … einem … Schnapsglas.«
Das brachte mich zum Lächeln. Mum schaffte es immer. »Ich weiß. Es ist nur, jedes Mal, wenn es passiert, erinnert es mich daran, selbst wenn es total banal ist.«
»Du weißt doch, dass es nicht deine Schuld war, was passiert ist. Was Miles getan hat … Dabei ging es nicht mal wirklich um dich.«
Ich schnaubte. »Es ging ganz bestimmt ausschließlich um mich.«
»Die Taten einer anderen Person können sich zwar auf dich auswirken, aber bei den Entscheidungen anderer geht es immer um sie selbst.«
Wir schwiegen beide einen Moment. »Wird es … Wird es je aufhören wehzutun?«
»Non.« Mum schüttelte den Kopf. »Aber es wird irgendwann an Bedeutung verlieren.«
Ich wollte ihr glauben, wirklich. Schließlich war sie der lebende Beweis für ihre Worte.
»Möchtest du vorbeikommen, mon caneton?«
Sie lebte nur etwa eine Stunde entfernt, wenn ich eine Mitfahrgelegenheit von Epsom Station (1,6 Sterne auf Google) bekam. Doch während ich es gerade noch vor mir selbst rechtfertigen konnte, meine Mum jedes Mal anzurufen, wenn mir etwas Schlimmes widerfuhr, würde mein ohnehin schon tiefes Selbstachtungslevel nur noch weiter abrutschen, wenn ich jedes Mal tatsächlich zu ihr rennen würde.
»Judy und ich haben eine neue Serie angefangen«, fuhr Mum in einem Tonfall fort, der wohl ermutigend sein sollte.
»Ach ja?«
»Ja, sehr spannend. Sie heißt RuPaul’s Drag Race – hast du davon gehört? Zuerst waren wir nicht sicher, ob sie uns gefallen würde, weil wir dachten, es ginge um Monster Trucks. Kannst du dir vorstellen, wie erleichtert wir waren, als wir herausfanden, dass es um Männer geht, die sich gern wie Frauen anziehen? Warum lachst du?«
»Weil ich dich liebe. Sehr sogar.«
»Darüber solltest du nicht lachen, Luc. Du wärst beeindruckt. Uns fallen angesichts ihrer Eleganza meistens die Augen aus dem Kopf. Eleganza bedeutet –«
»Ich kenne Drag Race. Wahrscheinlich sogar besser als du.« So etwas passierte eben, wenn eine Show einen Emmy gewann. Dann wurden aus den Zuschauenden ganz schnell die Mütter der Zuschauenden.
»Dann solltest du vorbeikommen, mon cher.«
Mum wohnte in Pucklethroop-in-the-Wold, in der kleinen Pralinenschachtel von einem Dorf, wo ich aufgewachsen war, und verbrachte ihre Zeit damit, sich mit ihrer besten Freundin Judith Cholmondely-Pfaffle in Schwierigkeiten zu bringen.
»Ich …« Blieb ich zu Hause, könnte ich Erwachsenendinge erledigen, wie Geschirrspülen und Wäschewaschen. In Wahrheit würde ich allerdings meine Google-Benachrichtigungen auseinandernehmen, bis sie bluteten.
»Ich koche mein besonderes Curry.«
Okay, so war es also entschieden. »Auf gar keinen Fall.«
»Luc, ich finde, dass du sehr unhöflich bist, was mein besonderes Curry angeht.«
»Ja, weil ich es vorziehen würde, mein Arschloch nicht in Brand zu setzen.«
Mum zog einen Schmollmund. »Für einen Schwulen bist du viel zu sensibel, was dein Arschloch angeht.«
»Wie wäre es, wenn wir aufhören, über mein Arschloch zu reden?«
»Du hast damit angefangen. Wie dem auch sei, Judy liebt meine Currys.«
Manchmal glaubte ich, dass Judy meine Mum lieben musste. Warum sollte sie sonst essen, was Mum zubereitete? »Wahrscheinlich, weil du die letzten fünfundzwanzig Jahre damit zugebracht hast, ihre Geschmacksknospen systematisch abzutöten.«
»Du weißt ja, wo du uns findest, wenn du es dir anders überlegst.«
»Danke, Mum. Bis bald.«
»Allez, Darling. Bisous.«
Ohne Mum, die ununterbrochen über Reality-TV plapperte, war mein Zuhause plötzlich sehr still und mein Tag schien sehr lang. Zwischen meiner Arbeit, Freundschaften, Bekanntschaften und den sporadischen Versuchen zu vögeln benutzte ich meine Wohnung wie ein überteuertes, schlecht in Stand gehaltenes Hotel. Ich kam nur nach Hause, um zu schlafen und am nächsten Morgen wieder abzuhauen.
Außer an Sonntagen. Sonntage waren schwierig. Oder sie waren es in den letzten Jahren geworden. Als Student hatte ich sie dazu genutzt, zu brunchen, zu schlafen oder zu bereuen, was ich am Abend zuvor getan hatte. Nach und nach hatte ich dann meinen Freundeskreis an Abendessen mit den Schwiegereltern, Deko-Shopping fürs Kinderzimmer oder die Freuden eines ruhigen Tags zu Hause verloren. Es war nicht so, dass ich meinen Bekannten böse gewesen wäre, weil sich ihr Leben verändert hatte. Und ich wollte nicht, was sie hatten. Dafür war ich nicht gemacht. Soweit ich mich erinnern konnte, hatten sich Sonntage mit Miles ziemlich schnell von Sexpartys zu Hassmarathons entwickelt. Doch manchmal, in Momenten wie diesem, schien meine Welt lediglich aus den Benachrichtigungen auf meinem Handybildschirm zu bestehen.
Benachrichtigungen, die ich verbissen zu ignorieren versuchte. Denn ich wusste, dass Mum recht hatte: Wenn ich den heutigen Tag hinter mich brachte, wären sie morgen bereits belanglos geworden.
Doch wie sich herausstellte, lagen wir beide falsch. Sehr, sehr falsch.
Der Montag begann wie gewohnt – ich war zu spät dran und es interessierte niemanden. Ja, in so einem Büro arbeitete ich. Obwohl das Wort Büro vielleicht übertrieben war. Es handelte sich um ein Haus in Southwark, das halbherzig zum Hauptsitz der Wohltätigkeitsorganisation umfunktioniert worden war, für die ich arbeitete. Und dabei handelte es sich um die einzige Wohltätigkeitsorganisation oder das einzige Unternehmen überhaupt, das mich anstellen würde.
Sie bestand aus dem rothaarigen Stiefkind eines betagten Earls, der auf Landwirtschaft abfuhr, und einer Entomologin mit Cambridge-Abschluss, die meiner Meinung nach eine KI aus der Zukunft war. Die Mission der beiden? Mistkäfer retten. Und als Spendensammler der Organisation war es meine Aufgabe, Leute davon zu überzeugen, ihr Geld für Käfer auszugeben, die sich von Kacke ernährten, und nicht für die Rettung von Pandas, Waisenkindern oder – Gott bewahre – Comic Relief. Ich würde gerne behaupten, gut darin zu sein, aber so etwas war schwer zu messen. Zumindest waren wir bisher nicht pleitegegangen. In Bewerbungsgesprächen für andere Stellen, die ich nicht kriegte, sagte ich meistens, dass es keine andere Benefizorganisation mit Fokus auf Fäkalien gab, die mehr Geld beschaffte als wir.
Außerdem hießen wir Coleoptera Research and Protection Project. Die Abkürzung dafür sprach sich CEE – AR – AY – PEE – PEE und auf gar keinen Fall CRAPP.
Mein Job bei CRAPP hatte ein paar Haken: die Zentralheizung, die den ganzen Sommer auf Hochtouren lief und im Winter den Geist aufgab, die Büroleiterin, die niemandem je erlaubte, Geld für irgendetwas auszugeben, die Computer, die so alt waren, dass darauf noch eine nach einem Jahr benannte Version von Windows installiert war, und natürlich die tägliche Erinnerung daran, dass dies mein Leben war. Aber es gab auch ein paar Pluspunkte. Der Kaffee war gar nicht so übel, denn Dr. Fairclough lagen zwei Dinge am Herzen: Koffein und wirbellose Tiere. Und jeden Morgen, während ich darauf wartete, dass mein PC aus der Renaissancezeit hochfuhr, durfte ich Alex Twaddle Witze erzählen. Na ja, vielmehr riss ich jeden Morgen einen Witz, während Alex Twaddle mich verwirrt anblinzelte.
Ich wusste nicht viel über ihn, und schon gar nicht, wie er an seine Stelle gekommen war. Theoretisch war er Dr. Faircloughs Assistent. Jemand hatte mir mal erzählt, er hätte einen erstklassigen Abschluss, aber nicht worin oder woher.
»Also«, sagte ich. »Gehen zwei Stifte in den Wald …«
Alex blinzelte. »Zwei Stifte?«
»Ja.«
»Bist du dir sicher? Das ergibt nämlich keinen Sinn.«
»Lass dich einfach drauf ein. Also, zwei Stifte sind im Wald und ein dritter kommt dazu. Da sagt der eine Stift zum anderen: ›Ich gehe jetzt. Mir wird es hier zu bunt‹.«
Eine lange Stille setzte ein.
Alex blinzelte erneut. »Warum will er plötzlich nicht mehr im Wald sein? Kann er die anderen nicht leiden?«
»Nein, es sind Buntstifte. Und es kommt noch eine Farbe hinzu, also … wird es noch bunter.«
»Ja, aber warum sollte ihn das stören?«
Manchmal fragte ich mich, ob das hier wirklich mein Hobby war oder eine Strafe, die ich mir selbst auferlegte. »Es ist bloß ein Wortspiel, Alex. Du kennst doch sicher die Redewendung, dass es einer Person zu bunt wird. Aber die drei Stifte zusammen sind wirklich bunt. Es soll witzig sein.«
»Oh.« Er dachte eine Weile darüber nach. »Ich finde nicht, dass es witzig ist.«
»Du hast recht, Alex. Nächstes Mal gebe ich mir mehr Mühe.«
»Übrigens, um halb elf hast du ein Meeting mit Dr. Fairclough.«
Das war ein schlechtes Zeichen. »Ich vermute«, begann ich, obwohl ich wusste, dass es hoffnungslos war, »dass du nicht weißt, worum es geht?«
Er strahlte mich an. »Keinen blassen Schimmer.«
»Du machst das super, nur weiter so.«
Ich trottete die Treppe hinunter in mein Büro. Die Aussicht auf ein Gespräch mit Dr. Fairclough hing über mir wie eine Regenwolke in einem Cartoon. Ich brachte ihr zwar viel Respekt entgegen – sollte ich je eine Käferkrise haben, würde ich sie sofort anrufen –, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mit meiner Chefin interagieren sollte. Fairerweise musste ich zugeben, dass sie ebenfalls keine Ahnung hatte, wie sie mit mir umgehen sollte. Oder mit irgendjemandem sonst. Der Unterschied zwischen uns war, dass es sie nicht kümmerte.
Als ich über den Flur lief und die Dielen bei jedem Schritt fröhlich knarzten, rief jemand: »Bist du das, Luc?«
Leider konnte ich es nicht bestreiten. »Ja, ich bin’s.«
»Könntest du kurz reinkommen? Es gibt da ein kleines Problemchen mit dem Twitter.«
Team-Player, der ich war, ging ich rein. Rhys Jones Bowen, Koordinator der ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Social Media Manager von CEEARAYPEEPEE, saß zusammengesunken vor seinem Computer und tippte mit einem Finger auf den Bildschirm.
»Also, es ist so, weißt du noch, dass du mir aufgetragen hast, allen vom Beetle Drive zu erzählen?«
Im Büro nannten wir unsere alljährliche Benefizgala mit Abendessen und Tanz den Beetle Drive. Ich hatte ihn die letzten drei Jahre organisiert. Die Tatsache, dass diese Veranstaltung der größte Punkt auf meiner To-Do-Liste war, verriet alles, was man darüber und über meinen Job wissen musste.
Ich bemühte mich sehr, meinen Tonfall neutral zu halten. »Ja, ich erinnere mich, dich irgendwann letzten Monat darum gebeten zu haben.«
»Tja, also, ich habe das Passwort vergessen und wollte, dass sie mir ein neues an die E-Mail-Adresse senden, mit der ich das Twitter-Konto eröffnet habe. Aber wie sich herausstellte, habe ich auch dieses Passwort vergessen.«
»Ich verstehe, dass das zu Problemen führen könnte.«
»Ich wusste, dass ich es auf ein Post-it geschrieben hatte. Und ich wusste, dass ich das Post-it in ein Buch gelegt hatte, um es sicher aufzubewahren. Und ich wusste, dass das Buch ein blaues Cover hat, aber ich konnte mich nicht an den Titel erinnern oder daran, wer es geschrieben hat oder worum es geht.«
»Hättest du nicht auch das Passwort des E-Mail-Kontos zurücksetzen lassen können?«, fragte ich vorsichtig.
»Hätte ich, aber als ich an diesen Punkt kam, war ich zu verängstigt, um mich weiter in das Kaninchenloch vorzuwagen.«
Um ehrlich zu sein, passierte das ständig. Nicht genau dieselbe Situation, aber etwas Ähnliches. Und ich würde mir größere Sorgen machen, hätte unser Twitter-Profil mehr als 137 Follower. »Ist nicht weiter schlimm.«
Er streckte eine Hand aus, um mich zu beruhigen. »Nein, es ist in Ordnung. Ich war nämlich auf der Toilette, und, weißt du, ich nehme immer ein Buch mit, also lasse ich ein paar dort liegen, falls ich es mal vergesse. Und da sah ich eins mit einem blauen Cover auf dem Fensterbrett und fand das Post-it darin. Und gut, dass ich mich schon hingesetzt hatte, sonst hätte ich vor lauter Freude einen fahren lassen.«
»Doppeltes Glück.« Ich wollte unbedingt von dem Toilettenthema weg, also fuhr ich fort. »Und was ist das Problem, jetzt, da du das Passwort gefunden hast?«
»Na ja, ich habe nicht genug Zeichen für den Tweet.«
»Ich hatte dir doch in der E-Mail geschickt, was du schreiben sollst. Es müsste passen.«
»Aber dann hörte ich von diesen Dingern namens Hashtags. Anscheinend ist es sehr wichtig, Hashtags zu benutzen, damit die Leute deine Twitters auf dem Twitter finden.«
Ich musste ihm lassen, dass er damit nicht falschlag. Andererseits hatte ich keine besonders hohe Meinung von Rhys Jones Bowens Social-Media-Optimierungsinstinkten. »Okay?«
»Ich habe lange gebrainstormt und viele Ideen gehabt, und ich glaube, das ist der Hashtag, der am besten beschreibt, was wir mit dem Beetle Drive erreichen wollen.«
Mit einer unberechtigt triumphierenden Miene schob er mir einen Zettel zu, auf den er sorgfältig geschrieben hatte:
#ColeopteraResearchAndProtectionProjectJährlicheBenefizgalaMitTanzUndStillerAuktionAuchBekanntUnterDemNamenBeetleDriveImRoyalAmbassadorsHotelMaryleboneAberNichtDasInEdinburghTicketsAbSofortUeberUnsereWebsiteBestellbar
»Und jetzt habe ich nur noch dreiundsechzig Zeichen frei.«
Früher hatte ich mal eine wirklich vielversprechende Karriere. Schließlich hatte ich einen verdammten Master of Business Administration und bereits für einige der größten PR-Firmen der Stadt gearbeitet. Und jetzt verbrachte ich meine Zeit damit, einer keltischen Schnarchnase Hashtags zu erklären.
Oder auch nicht.
»Ich erstelle eine Grafik.«
Das heiterte ihn auf. »Oh, ich kann also auch Bilder twittern? Ich habe gelesen, dass Leute sehr gut auf Bilder reagieren. Das hat mit visuellem Lernen zu tun.«
»Ich schicke sie dir bis zur Mittagspause.«
Und damit ging ich zurück in mein Büro, wo mein Computer endlich hochgefahren war und wie ein asthmatischer T-Rex vor sich hin schnaufte. Während ich meine E-Mails durchging, musste ich feststellen, dass einige unserer wichtigsten Geldgebenden für den Beetle Drive abgesagt hatten. Natürlich waren die meisten Leute nicht verlässlich, und noch weniger, wenn es um Geld ging, vor allem wenn es sich um Geld für Mistkäfer handelte. Doch aus irgendeinem Grund stellten sich mir die Nackenhaare auf. Wahrscheinlich war es nur ein dummer Zufall. Doch es fühlte sich nicht so an.
Ich öffnete unsere Website, für den Fall, dass sie wieder gehackt worden und über Nacht zu einer Amateur-Pornoplattform geworden war. Doch als ich dort nichts Ungewöhnliches (oder Interessantes) fand, ging ich dazu über, die Ausgestiegenen zu stalken, um herauszufinden, ob es eine Verbindung zwischen den Personen gab – als wäre ich der Typ aus A Beautiful Mind. Soweit ich es erkennen konnte, gab es keine. Na ja, sie waren alle reich, weiß, konservativ. Wie die meisten unserer Geldgebenden.
Natürlich würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass Mistkäfer unwichtig waren – Dr. Fairclough hatte mich bereits mehrmals lang und breit darüber aufgeklärt, warum sie wichtig waren, wobei es um Bodenbelüftung und organische Stoffe ging –, aber es bedurfte schon einer gewissen Privilegiertheit, sich mehr für die Rettung von Käfern zu interessieren als zum Beispiel für Landminen oder Obdachlosenheime. Natürlich würden die meisten Leute sagen, dass obdachlose Personen Menschen waren und sie es deshalb verdienten, dass sich um sie gekümmert wurde. Dr. Fairclough würde allerdings dagegenhalten, dass obdachlose Personen Menschen waren, es deshalb zu viele von ihnen gab und sie sich von einem ökologischen Standpunkt aus betrachtet irgendwo zwischen unwichtig und schädlich befanden. Im Gegensatz zu uns waren Mistkäfer ihrer Meinung nach unersetzlich. Und aus diesem Grund war sie für die Daten und ich für die Pressearbeit verantwortlich.
Um halb elf erschien ich pflichtbewusst vor Dr. Faircloughs Büro. Alex machte eine Show daraus, mich reinzulassen, obwohl die Tür bereits offen stand. Das Zimmer – ein wildes Sammelsurium aus Büchern, losen Blättern und entomologischen Proben – war wie immer auf so unheimliche Weise organisiert, als wäre es das Nest von akademisch veranlagten Wespen.
»Setzen Sie sich, O’Donnell.«
Jap. Das war meine Chefin. Dr. Amelia Fairclough sah aus wie Kate Moss, kleidete sich wie Simon Schama und redete, als würde man ihr jedes Wort in Rechnung stellen. In vielerlei Hinsicht war sie die ideale Chefin, weil sie uns nur dann Aufmerksamkeit schenkte, wenn jemand wortwörtlich etwas in Brand gesetzt hatte. Alex hatte das übrigens bereits zweimal getan.
Ich nahm Platz.
»Twaddle.« Sie warf Alex einen scharfen Blick zu. »Protokoll.«
Er zuckte zusammen. »Oh. Äh, ja. Natürlich. Hat jemand einen Stift?«
»Da drüben. Unter dem Chrysochroa fulminans.«
»Wunderbar.« Alex sah aus wie Bambis Mutter. Nachdem sie angeschossen worden war. »Unter dem was?«
In Dr. Faircloughs Kiefer zuckte ein Muskel. »Der grüne Käfer.«
Zehn Minuten später hatte Alex endlich einen Stift, ein Blatt Papier, ein zweites Blatt Papier, weil er seinen Kugelschreiber durch das erste gestochen hatte, und eine Ausgabe von Ökologie und Evolution der Mistkäfer (Simmons und Ridsdill-Smith, Wiley-Blackwell 2011) als Ablage aufgetrieben. »Okay«, sagte er. »Bereit.«
Dr. Fairclough verschränkte die Hände vor sich auf dem Schreibtisch. »Es tut mir sehr leid, O’Donnell …«
Ich wusste nicht, ob es ihr leidtat, dass sie mit mir sprechen musste, oder ob sie sich für das entschuldigte, was sie im Begriff war, zu sagen. Beides verhieß nichts Gutes. »Scheiße, wollen Sie mich feuern?«
»Noch nicht, aber allein heute Morgen musste ich bereits drei E-Mails beantworten, in denen es um Sie ging. Das sind drei mehr, als ich gerne beantworten würde.«
»E-Mails über mich?« Ich wusste, worauf sie hinauswollte. Wahrscheinlich hatte ich es schon die ganze Zeit gewusst. »Geht es um die Fotos?«
Sie nickte knapp. »Ja. Als wir Sie angestellt haben, versicherten Sie uns, dass solche Aktionen der Vergangenheit angehören.«
»So war es auch. Ich meine, so ist es. Ich habe bloß den Fehler gemacht, am selben Abend auf eine Party zu gehen, an dem mein Dad auf ITV lief.«
»Die Presse scheint sich einig zu sein, dass Sie im Drogenrausch in der Gosse lagen. Und dabei Fetischkleidung trugen.«
»Ich bin hingefallen«, sagte ich ausdruckslos. »Und dabei hatte ich lustige Hasenohren auf dem Kopf.«
»In den Augen gewisser Personen macht dieses Detail die ganze Sache besonders verderblich.«
Irgendwie war es beinahe eine Erleichterung, als ich wütend wurde. Es war besser, als Panik darüber zu schieben, dass ich gleich meinen Job verlieren würde. »Brauche ich einen Anwalt? Ich bekomme nämlich langsam das Gefühl, dass es hier eher um meine Sexualität geht als darum, ob ich auf Drogen war.«
»Natürlich hat es damit zu tun.« Dr. Fairclough wedelte ungeduldig mit der Hand. »Dadurch wirken Sie wie die falsche Sorte eines Homosexuellen.«
Alex hatte das Gespräch verfolgt, als befände er sich in Wimbledon. Nun hörte ich, wie er »die falsche Sorte eines Homosexuellen« vor sich hinmurmelte, während er schrieb.
Ich gab mein Bestes, um meine Antwort so vernünftig wie möglich klingen zu lassen. »Wissen Sie, dafür könnte ich Sie so richtig krass verklagen.«
»Das könnten Sie«, erwiderte Dr. Fairclough, »aber dann würden Sie nie wieder einen Job finden, und wir feuern Sie ja streng genommen nicht. Außerdem sollte Ihnen als unser Spendenbeschaffer klar sein, dass wir kein Geld haben, weshalb Sie auch vor Gericht keinen Schadenersatz von uns erwarten können.«
»Also haben Sie mich nur herbestellt, um mir den Tag mit ein bisschen beiläufiger Homofeindlichkeit zu versüßen?«
»Ach, kommen Sie schon, O’Donnell.« Sie seufzte. »Ihnen muss doch bewusst sein, dass es mich in keiner Weise interessiert, dass Sie homosexuell sind – wo wir gerade davon sprechen, wussten Sie, dass Blattläuse parthenogenetisch sind? –, aber viele der Spendenden interessiert es. Natürlich sind sie nicht alle homofeindlich, und ich glaube, es gefiel ihnen sehr, auf den Benefizveranstaltungen von einem charmanten jungen Schwulen unterhalten zu werden. Allerdings nur, solange Sie nicht bedrohlich auf sie wirken.«
Wie die Männer in meinem Leben schien auch meine Wut nicht bleiben zu wollen. Sie ließ mich müde und lustlos zurück. »Das ist aber immer noch homofeindlich.«
»Und Sie können diese Leute gern anrufen und ihnen das erklären, aber irgendwie bezweifle ich, dass es sie dazu bringen wird, uns ihr Geld zu geben. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, Leute dazu zu bewegen, uns ihr Geld zu spenden, ist Ihr Nutzen für unsere Organisation sehr beschränkt.«
Da war die Angst wieder. »Ich dachte, Sie wollten mich nicht feuern.«
»Solange der Beetle Drive erfolgreich über die Bühne geht, können Sie in sämtliche Bars gehen und jegliche Gliedmaßen von Säugetieren tragen, die Sie möchten.«
»Yay.«
»Aber gegenwärtig«, sie bedachte mich mit einem kalten Blick, »hat Ihr öffentliches Image eines ungezügelten, Kokain schnupfenden, Hosen ohne Hinterteil tragenden Perversen unsere drei größten Spendenden vertrieben, und ich muss Sie sicher nicht daran erinnern, dass unsere Liste von spendenwilligen Personen nah daran ist, einstellig zu werden.«
Wahrscheinlich war dies nicht der beste Zeitpunkt, um ihr von den E-Mails zu berichten, die mich heute Morgen erreicht hatten. »Was soll ich also tun?«
»Polieren Sie Ihr Image auf. Und zwar schnell. Sie müssen wieder zu dem harmlosen Schwulen werden, den die gut betuchte Mittelklasse gern ihrem politisch links orientierten Freundeskreis vorstellt und auf den sie sich vor ihrem politisch rechts orientierten Freundeskreis etwas einbildet.«
»Nur um das noch mal festzuhalten: Ich fühle mich aufs Gröbste beleidigt von allem, was Sie gerade gesagt haben.«
Sie zuckte mit den Achseln. »Darwin nahm Anstoß an den Ichneumonidae. Zu seinem Leidwesen existierten sie trotzdem weiter.«
Wenn mein Selbstwertgefühl auch nur die Größe der Hoden einer Stechmücke besessen hätte, wäre ich an dieser Stelle aus dem Büro gestürmt. Aber ich tat es nicht. »Ich kann nicht kontrollieren, was die Klatschpresse über mich berichtet.«
»Natürlich kannst du«, warf Alex ein. »Das ist ganz leicht.« Wir starrten ihn beide an.
»Ein Freund von mir aus Eton, Mulholland Tarquin Jjones, wurde vor ein paar Jahren in einen schrecklichen Skandal verwickelt. Es ging um ein Missverständnis, bei dem ein gestohlenes Auto, drei Prostituierte und ein Kilo Heroin involviert waren. Die Presse hat ihn deswegen furchtbar angegangen, aber dann verlobte er sich mit einer herzallerliebsten kleinen Erbin aus Devonshire, und von da an ging es nur noch um Gartenpartys und Artikel in der Hello.«
»Alex«, sagte ich langsam, »du weißt aber schon, dass ich schwul bin und dass es in diesem Gespräch von Anfang an darum ging, dass ich schwul bin?«
»Natürlich reden wir in deinem Fall von einem Erben, nicht von einer Erbin.«
»Ich kenne aber weder reiche Erbinnen noch reiche Erben.«
»Nicht?« Er sah ehrlich verblüfft aus. »Mit wem gehst du dann zur Pferderennbahn in Ascot?«
Ich vergrub das Gesicht in den Händen. Kurz glaubte ich wirklich, weinen zu müssen. Doch da übernahm Dr. Fairclough wieder das Ruder. »Twaddle hat ein gutes Argument vorgebracht. Mit einem angemessenen festen Freund würden Sie sich schnell wieder beliebt machen.«
Ich hatte mich bemüht, nicht an die katastrophale Pleite mit Cam im TheCellar zu denken, doch in diesem Moment überkam mich die Scham aufgrund seiner Abfuhr erneut. »Ich kann ja nicht mal einen unangemessenen festen Freund finden.«
»Das ist nicht mein Problem, O’Donnell. Bitte gehen Sie jetzt. Mit all den E-Mails und diesem Gespräch haben Sie bereits viel zu viel meiner Zeit in Anspruch genommen.«
Sie starrte so eindringlich auf ihren Computerbildschirm, dass ich schon glaubte, ich hätte zu existieren aufgehört. In diesem Augenblick wäre es mir sowieso egal gewesen.
Alles drehte sich, als ich aus dem Büro ging. Ich hob eine Hand an mein Gesicht und bemerkte, dass meine Augen feucht waren.
»Mein Gott«, sagte Alex. »Weinst du etwa?«
»Nein.«
»Brauchst du eine Umarmung?«
»Nein.«
Aber irgendwie fand ich mich trotzdem in seinen Armen wieder, während er mir unbeholfen den Kopf tätschelte. Alex war in der Schule oder an der Uni angeblich ein Profi-Kricketspieler gewesen – was auch immer das bei einer Sportart bedeutete, die größtenteils daraus bestand, fünf Tage lang Erdbeeren zu essen und herumzuspazieren –, und mir fiel auf, dass sein Körper immer noch groß, schlank und fest war. Außerdem roch er unglaublich wohltuend, wie frisch geschnittenes Gras im Sommer. Ich drückte mein Gesicht in seinen Kaschmir-Designer-Cardigan, und mir entfuhr ein Laut, der eindeutig kein Schluchzen war.
Ich musste Alex zugutehalten, dass es ihn überhaupt nicht zu stören schien. »Ist ja gut. Ich weiß, dass Dr. Fairclough gemein sein kann, aber davon geht die Welt nicht unter.«
»Alex.« Ich schniefte und versuchte, mir verstohlen über die Nase zu wischen. »Seit 1872 hat niemand mehr ›davon geht die Welt nicht unter‹ gesagt.«
»Aber ich habe es doch gerade gesagt. Hast du nicht zugehört?«
»Du hast recht, wie unbedacht von mir.«
»Keine Sorge, ich sehe ja, dass es dir nicht gut geht.«
Ich war am Boden. Alex’ Umarmung hatte mich vielleicht zwei Zoll hochgehievt, aber nun wurde mir bewusst, dass ich mich gerade an der Schulter der Witzfigur unseres Büros ausheulte. »Es geht schon. Ich versuche noch zu verarbeiten, dass ich, der ich seit einem verschissenen halben Jahrzehnt Single bin, mir über Nacht einen Freund suchen muss, da ich andernfalls den einzigen Job verliere, den ich in dieser Stadt kriegen konnte – bei einer Organisation, deren Standards so niedrig sind, dass sie dich und Rhys eingestellt haben.«
Alex dachte kurz darüber nach. »Du hast recht. Das ist wirklich schrecklich. Ich meine, wir sind absolute Versager.«
»Ach, komm schon«, knurrte ich. »Kannst du nicht wenigstens beleidigt sein? Jetzt fühle ich mich wie ein totaler Arsch.«
»Entschuldige. Das wollte ich nicht.«
Manchmal fragte ich mich fast, ob Alex nicht in Wahrheit ein Genie war und wir alle nur Spielfiguren in seinem großen Masterplan waren. »Du machst das absichtlich, oder?«
Sein Lächeln war entweder geheimnisvoll oder einfach nur ausdruckslos. »Jedenfalls bin ich sicher, dass du keine Schwierigkeiten haben wirst, einen Freund zu finden. Du siehst gut aus. Du hast einen guten Job. Und du warst letztens sogar in der Zeitung.«
»Könnte ich einen Freund finden, dann hätte ich einen.«
Alex lehnte sich mit der Hüfte an seinen Schreibtisch. »Kopf hoch, altes Haus. Wir schaffen das. Kennen deine Eltern jemand Passendes?«
»Erinnerst du dich, dass mein Dad ein ehemaliger Drogi ist, der gerade sein Comeback im Reality-TV feiert, und meine Mum eine Einsiedlerin aus den Achtzigern, die gerade mal eine einzige Freundin hat?«
»Ja, aber ich dachte, sie wären trotzdem noch in einem Club.«
»Sind sie nicht.«
»Keine Sorge, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten.« Er schwieg. »Gib mir einen Moment, um darüber nachzudenken, welche es sind.«
Oh, hallo. Ich war erneut ganz unten angekommen. Schön, wieder hier zu sein. Soll ich einfach für immer bleiben?
Nach einer langen Weile riss Alex den Kopf in die Höhe wie ein Beagle, der einen Hasen witterte. »Was ist denn mit den Jungs, mit denen du zur Schule gegangen bist? Ruf sie doch mal an und frag, ob einer eine nette Schwester hat. Ich meine, einen Bruder. Ich meine, einen schwulen Bruder.«
»Ich bin in einem winzigen Dorf zur Schule gegangen. Es gab drei Leute in meinem Jahrgang. Mit keinem von denen bin ich noch in Kontakt.«
»Wie merkwürdig.« Verblüfft legte er den Kopf schief. »Ich hatte angenommen, du wärst nach Harrow gegangen.«
»Du weißt aber schon, dass es Leute gibt, die weder nach Eton noch nach Harrow gegangen sind?«
»Ja, natürlich gibt es die. Frauen.«
Ich befand mich nicht in der Verfassung, einem Mann die sozioökonomischen Muster des modernen Großbritanniens zu erläutern, der so etepetete war, dass er es nicht mal seltsam fand, dass man das t in Moët, aber nicht das in Merlot aussprach. »Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich sage, aber können wir an den Punkt zurückkehren, an dem du versucht hast, mein Liebesleben in Ordnung zu bringen?«
»Ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen verwirrt bin.« Er schwieg einen Moment, runzelte die Stirn und spielte an seinen Manschetten herum. Dann strahlte er mich plötzlich aus dem Nichts an. »Mir ist eine Idee gekommen.«
Unter normalen Umständen hätte ich mit der angemessenen Skepsis darauf reagiert, aber ich war verzweifelt. »Was?«
»Warum sagst du nicht einfach, dass wir beide zusammen sind?«
»Du bist nicht schwul. Und alle wissen, dass du nicht schwul bist.«
Er zuckte mit den Achseln. »Dann sage ich eben, ich hätte es mir anders überlegt.«
»So funktioniert das nicht.«
»Ich dachte, heutzutage ändert sich so etwas ständig. Wir sind schließlich im zwanzigsten Jahrhundert und so.«
Dies war nicht der Zeitpunkt, um Alex daran zu erinnern, in welchem Jahrhundert wir uns befanden. »Hast du nicht eine Freundin?«, fragte ich.
»Oh, doch, Miffy. Hatte ich ganz vergessen. Aber sie ist wirklich klasse. Ihr wird es nichts ausmachen.«
»Mir an ihrer Stelle würde es etwas ausmachen. Sogar sehr viel.«
»Tja, vielleicht hast du deswegen keinen Freund.« Er strafte mich mit einem leicht pikierten Blick. »Du klingst sehr anspruchsvoll.«
»Ich weiß dein Angebot wirklich zu schätzen, aber glaubst du nicht, du könntest vergessen, dass du einen Fake-Freund hast, wenn du sogar vergisst, dass du eine echte Freundin hast?«
»Nein, das ist doch das Gute daran. Ich kann so tun, als wärst du mein Freund, und niemand würde sich darüber wundern, dass ich dich vorher nie erwähnt habe, weil ich so verpeilt bin, dass es mir ganz einfach entfallen sein könnte.«
Erschreckenderweise ergab das Sinn. »Weißt du was? Ich werde es in Erwägung ziehen.«
»Was?«
»Danke, Alex. Du warst mir eine große Hilfe.«