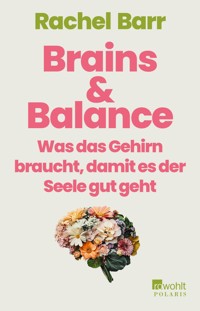
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
5-Uhr-Club, Intervall-Fasten, HIT-Training, Eisbaden, Online-Dating, Meditation, Repeat? Scheiß auf Selbstoptimierung, gib mir Neurowissenschaften! Heute gilt es offenbar, sich jede wache Sekunde selbst zu optimieren und das Maximum aus Körper und Geist herauszuholen. Doch wer kann schon mit diesen unrealistischen Ansprüchen mithalten? Für die meisten Menschen hält ein solches Leben vor allem eines bereit: Erschöpfung. Die Neurowissenschaftlerin Dr. Rachel Barr stellt den Status quo infrage. Was macht es mit unserem Gehirn, wenn der (Selbst)wert und das Glück eines Menschen von seiner Produktivität abhängt? Und was brauchen unser Körper und unser Geist wirklich, damit wir uns nachhaltig mit dem Leben verbunden und in Balance fühlen? Dieses Buch inspiriert dazu, die unaufhörliche Selbstoptimierung, die in den sozialen Medien gepredigt wird, zu hinterfragen und mithilfe neuer Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften den eigenen Lebensrhythmus zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dr. Rachel Barr
Brains & Balance
Was das Gehirn braucht, damit es der Seele gut geht
Über dieses Buch
5-Uhr-Club, Intervallfasten, HIT-Training, Eisbaden, Onlinedating, Meditation, Repeat? Scheiß auf Selbstoptimierung, gib mir Neurowissenschaften!
Heute gilt es offenbar, sich jede wache Sekunde selbst zu optimieren und das Maximum aus Körper und Geist herauszuholen. Doch wer kann schon mit diesen unrealistischen Ansprüchen mithalten? Für die meisten Menschen hält ein solches Leben vor allem eines bereit: Erschöpfung. Die Neurowissenschaftlerin Dr. Rachel Barr stellt den Status quo infrage. Was macht es mit unserem Gehirn, wenn der (Selbst-)Wert und das Glück eines Menschen von seiner Produktivität abhängen? Und was brauchen unser Körper und unser Geist wirklich, damit wir uns nachhaltig mit dem Leben verbunden und in Balance fühlen?
Dieses Buch inspiriert dazu, die unaufhörliche Selbstoptimierung, die in den sozialen Medien gepredigt wird, zu hinterfragen und mithilfe neuer Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften den eigenen Lebensrhythmus zu finden.
Vita
Dr. Rachel Barr ist Neurowissenschaftlerin und promoviert derzeit im Fachbereich Molecular Neuroscience über die Beziehung zwischen Schlaf und Gedächtnis. Sie setzt sich leidenschaftlich dafür ein, die Kluft zwischen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und Alltagserfahrungen zu überbrücken, und nutzt dafür u.a. die sozialen Medien, wo ihr insgesamt über eine Million Menschen folgen.
Anja Schünemann studierte Literaturwissenschaft und Anglistik in Wuppertal. Seit 2000 arbeitet sie als freiberufliche Übersetzerin der verschiedensten Genres und hat seitdem große Romanprojekte und Serien von namhaften Autorinnen und Autoren wie Philippa Gregory, David Gilman sowie Robert Fabbri aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Historische Romane sind eines ihrer Spezialgebiete: Von der Antike bis zum Mittelalter, in die frühe Neuzeit sowie bis ins 20. Jahrhundert verfügt sie über einen reichen Wissensschatz, der ihre Übersetzungen zu einem gelungenen Leseerlebnis macht.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel «How to Make Your Brain Your Best Friend. Simple Steps to a Kinder Mind» bei Dorling Kindersley Limited, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«How to Make Your Brain Your Best Friend. Simple Steps to a Kinder Mind» Copyright © 2025 by Dorling Kindersley Limited
«How to Make Your Brain Your Best Friend. Simple Steps to a Kinder Mind» Text Copyright © 2025 by Rachel Barr
Gedicht S. 293/295: Maggie Smith, Auszug aus «Good Bones», in: «Good Bones: Poems» Copyright © 2017 by Maggie Smith, hier in Übersetzung von Anja Schünemann
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Motivs von Midjourney
ISBN 978-3-644-02198-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Mutter, die aufopfernd für andere sorgte, sogar als es ihr schwerfiel, für sich selbst zu sorgen.
Vorwort
Stell dir vor, wie ich in meinem Arbeitszimmer sitze. Es herrscht friedvolles Chaos, alles ist mit Papieren und zerknüllten Notizzetteln bedeckt. Mein Kater Gnocchi macht seine Revieransprüche auf meinem (seinem) Schreibtisch geltend. Wir verhandeln eine Weile um die Hoheit über die Tastatur, bis er wie immer den Sieg davonträgt. So sieht’s bei mir aus, während ich diese Worte tippe.
Ich stelle mir umgekehrt vor, wie du es dir in einer Ecke gemütlich gemacht hast und liest, was ich hier gerade schreibe. Wir beide sind uns nie begegnet, und doch entsteht jetzt für kurze Zeit eine geistige Brücke zwischen uns. Ich sitze hier und tippe, du sitzt da und liest. Es ist, als führten wir ein Zwiegespräch, nur zeitversetzt und räumlich getrennt.
Die Vorstellung hat fast etwas Magisches. Dabei ist das Ganze in Wirklichkeit nichts weiter als eine Funktion des menschlichen Gehirns, dieses Wunderdings, das im gesamten uns bekannten Universum einzigartig ist. Okay, was das betrifft, bin ich vielleicht ein kleines bisschen voreingenommen, immerhin habe ich mein Leben der Neurowissenschaft gewidmet. Aber ich bin überzeugt, auch Astronomen, Astrophysikerinnen und sonstige Sterngucker würden zugeben, dass sie noch nie etwas so Rätselhaftes und Faszinierendes beobachtet haben wie das Organ, das du jetzt gerade nutzt, um diesen Satz zu lesen. Wir haben da im Prinzip einen Fettklumpen, der irgendwie Bewusstsein aus dem Nichts erzeugt und dann seine Tage damit zubringt, über seine eigene Existenz zu grübeln. Es ist ein bisschen so, als würdest du entdecken, dass dein Küchenschwamm nachts, während du schläfst, heimlich Sonette schreibt.
In einem riesigen, gleichgültigen Universum ist das menschliche Gehirn eine rebellische Anomalie. Und hier sitzen wir nun also inmitten eines unendlich weiten, kalten Nichts und denken und fühlen. Ganz schön frech! Wir haben sämtliche Regeln des Kosmos missachtet und uns eine Nische geschaffen, wo wir Sinn erzeugen, der eigentlich nie hätte existieren sollen. Nachdem wir so voller Überzeugung unser Recht auf Sinn beansprucht haben, stehen wir jetzt natürlich vor der Aufgabe, ihn auch wirklich zu kultivieren. Da haben wir uns ganz schön was vorgenommen, oder? Das Dasein fühlt sich nicht immer besonders wunderbar und aufregend an. Manchmal ist es einfach nur mühsam, und die dauernde Anstrengung führt dazu, dass wir uns erschöpft, überfordert oder sogar schmerzlich einsam fühlen.
Man erzählt uns, Perfektion sei der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Es ist ein profitables Geschäft, uns einzureden, unser Leiden rühre daher, dass wir nicht jeden Bereich unseres Lebens optimiert hätten. Dieses Narrativ ist so allgegenwärtig und hat sich so tief in unsere kollektive Psyche eingegraben, dass wir es meist gar nicht mehr hinterfragen. Wir nehmen es einfach als gegeben hin: Wenn wir uns im Leben schwertun, liegt das eben daran, dass wir uns nicht genug anstrengen, uns die Zeit nicht akribisch genug eingeteilt haben, nicht genug Positivität manifestieren. Oder noch schlimmer, dass wir selbst einfach nicht gut genug sind. Wir werden dazu verführt zu glauben, wenn wir uns nur mehr bemühen und die richtigen Produkte kaufen würden, könnten wir uns so weit optimieren, dass wir einen Zustand dauernder Glückseligkeit erlangen.
Aber während wir diesem unerreichbaren Ideal nachjagen, entfernen wir uns immer weiter von dem, was ein sinnerfülltes Leben eigentlich ausmacht. Wir sind soziale Wesen, auf Zugehörigkeit und Sinn ausgerichtet. Wir sehnen uns danach, von anderen gesehen, gehört und wertgeschätzt zu werden. Wir brauchen die Überzeugung, dass unser Leben einen Sinn hat, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Es ist erstaunlich einfach. Aber unsere moderne Welt mit ihrem gnadenlosen Produktivitätsdruck und ihren Konsumzwängen lenkt uns oft von diesen tiefen inneren Sehnsüchten ab. Wir sind so verliebt in die Vorstellung, das Beste aus unserem Leben zu machen, dass wir vergessen haben, einfach … zu leben.
In einer Welt, die ständig nach mehr schreit, möchte ich dir eine schlichte Wahrheit zuflüstern: Psst, du bist schon «gut genug», so wie du bist, versprochen. Das soll nicht heißen, dass du nicht noch wachsen könntest. Natürlich kannst du das. Ja, der Drang, sich weiterzuentwickeln, gehört so fundamental zum Menschsein dazu wie das Atmen. Aber die Veränderungen, die unser Leben bereichern, haben nichts mit glamourösen Upgrades oder einem spektakulären Makeover zu tun. Sie sind von der Sorte, die sich ganz undramatisch auf Zehenspitzen in unser Leben schleicht. Sanft und allmählich bewirken sie einen Wandel in unserer Haltung zu uns selbst, zu anderen und zu der Welt, in der wir leben. Es geht nicht darum, ein brandneues Du zu erschaffen, sondern darum, ein ganz klein wenig mehr zu dir selbst zu finden. That’s where the real magic happens: wenn wir uns in unserer Haut ein bisschen wohler fühlen, etwas mehr im Einklang mit unseren eigenen Bedürfnissen leben, ein wenig mehr Frieden finden.
Und genau darum dreht sich dieses Buch. Es ist keine Anleitung für ein perfektes Leben – so etwas gibt es gar nicht. Es liefert weder eine Patentlösung für all deine Probleme noch eine definitive Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. (Auch wenn ich in diesem Punkt einen kühnen Vorstoß wage, nämlich im letzten Kapitel unter der hochtrabenden Überschrift «Der Sinn des Lebens».) Was ich hier vermitteln will, ist eine neue Perspektive. Ich möchte dich dazu einladen, das anzunehmen, worauf der menschliche Geist von Natur aus ausgerichtet ist. Ich kann dir nicht helfen, deinen Weg zum ewigen Glück zu ebnen. Aber ich kann dir Möglichkeiten aufzeigen, gut für dein Gehirn zu sorgen, damit es im Gegenzug vielleicht besser für dich sorgt.
Es mag dir nicht so vorkommen, aber dein Gehirn ist immer auf deiner Seite. Es versucht, dich zu schützen – nur dass diese Versuche manchmal gründlich schiefgehen. Du kannst dir das in etwa so vorstellen wie das Zusammenleben mit einer wunderbar fürsorglichen Mitbewohnerin, die leider hin und wieder die Küche abfackelt. Aber während unser Gehirn sich nach Kräften bemüht, uns zu helfen, verkomplizieren wir die Angelegenheit, indem wir von ihm verlangen, mit einer Welt Schritt zu halten, für die es nicht geschaffen ist. Das Gehirn ist brillant, ja, aber es ist nicht unfehlbar. Es hat seine Schwachstellen, und wenn wir ihm zu viel abverlangen, wehrt es sich. In seinem Bemühen, irgendwie mitzuhalten, versucht dein Gehirn vielleicht, dir einzureden, du seist nichts wert, das Leben werde nie einfacher werden und es habe keinen Sinn, sich überhaupt noch anzustrengen. Und in deinen düstersten Zeiten lässt du dich womöglich dazu hinreißen, das zu glauben. Dein Gehirn kann dein stärkster Verbündeter sein, aber auch dein furchtbarster Gegner.
Während ich das hier schreibe, denke ich an meine Mum und wie ihr Gehirn sich allem Anschein nach gegen sie verschworen hatte. In den Tagen nach ihrem Tod bekam ich eine Textnachricht von meinem Bruder mit derselben Frage, die ich mir selbst immer wieder stellte: Warum konnte ich sie nicht retten? Oder eher: Warum habe ich es nicht getan? Ich hätte sie vom Rand des Abgrunds zurückzerren müssen, notfalls auch gegen ihren erbitterten Widerstand. Wenigstens habe ich mir das damals eingeredet. Aber die Wahrheit ist: Ich habe es versucht. Ich habe mich verzweifelt bemüht, sie davon zu überzeugen, dass das Leben lebenswert ist, doch leider ist sie gegangen, ehe ich die richtigen Worte fand. Und nun sitze ich hier und schreibe dieses Buch in der Hoffnung, wenigstens jetzt die richtigen Worte zu finden. Nicht nur für sie, sondern auch für dich.
Der Kampf meiner Mutter war kein seltener Einzelfall. So viele Menschen liegen in ständigem Kriegszustand mit dem eigenen Geist, erschöpft von genau den Anstrengungen, von denen man uns verspricht, sie würden das Leben leichter machen. Das Gehirn wird oft als eine Maschine beschrieben, die wir feintunen können wie einen Motor oder eine Software. Aber in Wirklichkeit ist das Gehirn ein lebendiges, atmendes Wesen; es ist ein eigener Charakter. Unser Ziel sollte nicht sein, es unserem Willen zu unterwerfen und es zu beherrschen, sondern es zu verstehen. Ja, es uns zum Freund zu machen. Sogar zu unserem besten Freund, wenn wir wirklich im Einklang leben und unser Potenzial voll ausschöpfen wollen.
Es ist ein unvollkommenes kleines Ding, dieses Gehirn, laufend damit beschäftigt, sich selbst zu reparieren und zu verbessern. Es ist ständig im Wandel, muss sich anpassen, sich umkonfigurieren, neue Verknüpfungen bilden, und dieser dauernde Tanz eröffnet erstaunliche Möglichkeiten zur Heilung. Aber das Gehirn kann nicht alles allein schaffen, wir müssen ihm auch entgegenkommen. Und ich hoffe, dir auf den folgenden Seiten ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wie das geht. Wir haben uns unser Gehirn nicht ausgesucht, aber wir können erreichen, dass wir uns darin etwas heimischer und in Balance fühlen.
Also: Wo und wann auch immer du das hier liest – ich freue mich, dass du da bist, und es ist mir eine Ehre, diesen Moment mit dir zu teilen. Zieh die Schuhe aus, mach es dir bequem und lass uns reden. Aber vorher übergebe ich die Tastatur noch an Gnocchi, damit er das Schlusswort zu diesem Prolog schreibt, so elegant und auf den Punkt, wie nur er es fertigbringt: gabdhsjshdgdbdjdigkfnan.
Kapitel 1Erkenne dich selbst: Wie wir im Zeitalter der Optimierung unsere Identität neu behaupten
Ich bin in den Neunzigern aufgewachsen. Damals konnte die Frage «Was glaubst du, wer du bist?» mich aufbauen oder fertigmachen, je nachdem, wer den Satz sagte (oder sang).
Mit der Strenge eines Elternteils oder einer Lehrkraft ausgesprochen, hatte diese Frage die Macht, mich auf die Größe einer Ameise zusammenschrumpfen zu lassen. Auch wenn mir das damals noch nicht richtig bewusst war, lautete die implizite Botschaft, nur Erwachsene könnten jemand sein – ich müsse mir das Recht, meine Identität zu behaupten, erst verdienen. Wenn der Ausspruch von meinem Vater kam, warf er mich sofort aus der Bahn. Er hatte die Angewohnheit, diese (ganz offensichtlich rhetorische) Frage zu stellen und anschließend mit strenger Miene zu schweigen, als ob er eine tiefgründige Antwort erwartete. Ich stand dann nur mit offenem Mund da und dachte im Stillen: «Ich habe keine Ahnung, was ich glaube, wer ich bin.»
Wenn dagegen die Spice Girls den Refrain ihres Hits Who Do You Think You Are sangen, fühlte sich das völlig anders an. Sie verwandelten die existenzielle Herausforderung in eine Einladung, einen Aufruf, sich von seinen Fesseln zu befreien, Grenzen zu sprengen und mit dem Selbstbewusstsein eines frechen Popstars in die Welt hinauszutreten. Girlpower, Pailletten und Plateauschuhe – was brauchte ein achtjähriges Mädchen mehr, um sich ganz und gar unbesiegbar zu fühlen?
Diese zwei Interpretationen desselben Satzes – die strenge elterliche Ermahnung auf der einen Seite, eine Pophymne des Empowerments auf der anderen – veranschaulichen die zwei Pole, zwischen denen unser Identitätsgefühl schwanken kann: Mal stolzieren wir umher, als wären wir die Größten, strotzend vor lauter Selbstbewusstsein und einem Gefühl der Bestimmung. Im nächsten Moment hocken wir in der Ecke wie ein Häufchen Elend und stellen alles infrage, was wir über uns selbst zu wissen glaubten.
Es wäre ein Leichtes, das Ringen um die eigene Identität als triviales Problem abzutun, entsprungen aus Eitelkeit oder Narzissmus. Aber unsere Überzeugungen über uns selbst bilden die Grundlage für unsere mentale Landschaft. All unsere Erfahrungen werden durch die Brille der Identität gefiltert, und wenn diese Brille ein verzerrtes Bild liefert, wirkt sich das auf unser ganzes Leben aus. Ein negatives Selbstverständnis ist ein fruchtbarer Boden, auf dem Angststörungen, Depressionen und andere tückische Krankheiten gedeihen können.[1],[2],[3] Eine angeknackste oder gebrochene Identität ist alles andere als eine Lappalie – sie kann unserer psychischen Gesundheit erheblich im Wege stehen.
Wir leben in einer Zeit, in der jeder Aspekt unseres Daseins berechnet und beziffert werden kann, und zugleich liegt die Latte, an der wir uns messen, in immer schwindelerregenderen Höhen. Es mangelt nicht an Personen und Produkten, die versprechen, uns für Geld das Geheimnis zu mehr Selbstbewusstsein zu erschließen. Ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen, war noch nie eine so große Herausforderung: Es geht nicht mehr darum, gut zu sein oder auch besser – heute geht es darum, unanfechtbar der oder die Beste zu sein, auf jede erdenkliche Weise und ständig. Unser Verständnis von Selbstverbesserung hat sich vom einfachen Bemühen um persönliches Wachstum zu einem geradezu manischen Streben nach Produktivität und Perfektion gewandelt.
Doch zugleich regt sich im Zeitalter der Optimierung eine stille Rebellion – eine Bewegung, die uns flüsternd dazu anstiftet, frech und mutig Tabus zu brechen und zu den Wurzeln unseres wahren Selbst zurückzukehren. Vielleicht ist es an der Zeit, die Fesseln gesellschaftlicher Erwartungen abzuwerfen und den Kern der menschlichen Identität wiederzuentdecken.
Was, wenn die Lösung des großen Rätsels ums Selbstbewusstsein in ebendem Organ zu finden ist, das unsere Suche nach Persönlichkeit und Individualität antreibt?
Identitätskrise: Jetzt mit der Extraportion Krise
Als Teenager beginnen wir den seltsamen Prozess herauszufinden, wer wir sind – wir schlüpfen in unterschiedliche Rollen und Identitäten, bis wir eine passende finden.[1] Mal bist du eine Punkrockerin, am nächsten Tag ein lyrischer Freigeist, und jede neue Entscheidung wird durch eine entsprechende Frisur markiert, die du später bereust. Wenn wir älter werden, verfestigen sich die Grenzen unserer Persönlichkeit und unsere Werte, sodass unsere Identität mit der Zeit weniger flexibel wird. Dennoch entdecken wir uns fortlaufend weiter selbst, unsere Reise ist nie wirklich zu Ende.
Wir neigen zu der Erwartung, das Erwachsenwerden müsse irgendwie die Auflösung bringen – eine Art Identitätsendspiel, in dem wir schließlich das wahre Ich enthüllen. Aber stattdessen finden wir immer neue Wege, uns selbst infrage zu stellen und neu zu definieren, oft angestoßen durch Meilensteine wie berufliche Veränderungen, das Ende einer Partnerschaft oder die gelegentliche Krise vor dem Badezimmerspiegel. Es ist chaotisch und verwirrend, und auch das macht die Fachrichtungen der angewandten Neurowissenschaften und der Psychologie so besonders reizvoll. Mit der Wissenschaft im Rücken wird es erträglicher, selbst solche schweren Entscheidungen treffen zu müssen.
Die Wissenschaft stützt sich gern auf Mehrheiten und Durchschnittswerte, um in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe allgemeine Muster zu identifizieren. Das ist ein sinnvoller Ansatz, da wir Menschen einander tatsächlich bemerkenswert ähnlich sind. Wir alle funktionieren nach denselben grundlegenden physiologischen Prozessen wie Temperaturregulation, Hunger und Schlaf. Unsere Gehirne sind typischerweise aus den gleichen Grundstrukturen aufgebaut – Großhirn, Kleinhirn, Hirnstamm und limbisches System –, wobei jede Hirnregion erfreulich konsistent ihre Rolle spielt. Uns allen können die gleichen tödlichen Gefahren zum Verhängnis werden, ein Thema, das Stoff für herrlich reißerische Schlagzeilen bietet, ohne dass dabei die sachliche Korrektheit auf der Strecke bleiben muss: «Zehn Gifte, die du für ein langes Leben strikt meiden solltest!» Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, wie so mancher Toxikologe dabei mit überlegenem Grinsen denkt: «In welcher Dosis?»
Der Grund für diese weitgehende Ähnlichkeit liegt in unseren gemeinsamen Genen: Unsere DNA stimmt zu 99,9 Prozent überein. Trotzdem – selbst bei eineiigen Zwillingen, deren genetische Blaupause eigentlich identisch ist, schafft es immer noch jedes Individuum, einzigartig zu sein. Unsere DNA bildet zwar die Basis, aber Erfahrungen, Umwelteinflüsse und Interaktionen tragen dazu bei, wie wir heranwachsen und uns entwickeln – sowohl körperlich als auch geistig und psychisch.
Schau dir zum Beispiel deinen Fingerabdruck an, das unverwechselbare Merkmal deiner Individualität: Das Grundmuster aus Bögen, Schleifen und Wirbeln ist im Wesentlichen durch genetische Faktoren bestimmt, aber die genauen Details erzählen die Geschichte deiner Zeit im Mutterleib.[2] Jedes Zucken, jeder Tritt und jede Drehung, jeder nächtliche Snack, von dem du durch die Plazenta deinen Teil abbekommen hast – all das ist in die einzigartige Form deines Fingerabdrucks eingeflossen. Du trägst da praktisch eine Landkarte deiner vorgeburtlichen Abenteuer mit dir herum.
Das Gehirn arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip: Aufgrund deiner Erfahrungen baut es sich ständig um und bildet neue Verknüpfungen. Nur dass die Metamorphose in diesem Fall lebenslang andauert. Die Fürsorge, die du als Kind erlebt hast, das Bingewatching vom vorigen Wochenende, der Burrito am Flughafen, der einen siebenstündigen Flug in ein Verdauungs-Armageddon verwandelt hat – all diese Erfahrungen haben dich verändert. Jede einzelne, wie unbedeutend sie auch erscheinen mag, wird mit in den Schmelztiegel deiner Existenz geworfen, und das Gebräu, das daraus entsteht, ist ganz und gar einzigartig. Gene können repliziert werden, deine Erfahrungen hingegen nicht. Darum liefert die Wissenschaft oft nur unvollständige Erklärungen und nicht die klaren, eindeutigen Lösungen, nach denen wir uns so sehnen. Nach evidenzbasierter Anleitung zu persönlichem Wachstum zu suchen, ist dennoch ein fantastischer Ansatz – man muss sich dabei nur der Beschränkungen bewusst sein.
Bücher wirken einen einzigartigen Zauber, indem sie eine persönliche Verbindung zwischen Leserin und Autorin schmieden. Ich hoffe, du gewinnst bei der Lektüre den Eindruck, dass diese Zeilen eigens für dich geschrieben wurden. Gestatte aber, dass ich den Zauber mal kurz durchbreche – in Wirklichkeit ist es nicht so. Ich konnte beim Schreiben unmöglich deine spezifischen Bedürfnisse oder Umstände kennen. Wissenschaft und wissenschaftsbasierte Erkenntnisse können dir einen Weg weisen, aber deine einzigartigen Lebenserfahrungen erzeugen blinde Flecken, die nur du selbst sehen kannst.
Die Neurowissenschaften auf persönliches Wachstum anzuwenden bedeutet, dass man experimentiert, Ansätze erprobt und sie anpasst oder verwirft, wenn sie sich für die eigenen Bedürfnisse als untauglich erweisen. Dieses Trial-and-Error-Verfahren ist nicht nur akzeptabel, sondern sogar wünschenswert.[3] Du kannst dir das Ganze wie eine Studie vorstellen, in der du zugleich Wissenschaftlerin und Laborratte bist. Beobachte und dokumentiere währenddessen deine Erfahrungen, um festzustellen, was funktioniert und was nicht. Auf diese Weise kannst du Schritt für Schritt deinen Ansatz immer weiter verfeinern, basierend auf Real-Life-Feedback. So schlägst du eine Brücke zwischen allgemeinen wissenschaftlichen Prinzipien und deinen individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt: Selbst fundierte Forschungsergebnisse sind nicht immer universell anwendbar. Zum Beispiel gilt allgemein als recht gut belegt, dass Meditation helfen kann, Stress zu reduzieren.[4] In seltenen Fällen kann sie allerdings auch Panik auslösen und zu einer Verschlechterung des psychischen Zustands führen.[5] Was bei vielen Menschen Wunder wirkt, ist also für dich vielleicht gerade nicht das Richtige. Das zeigt wieder einmal, dass allgemeine Ratschläge immer mit Vorsicht zu genießen sind.
Dass die Wissenschaft in diesen Dingen grundsätzlich nicht eindeutig ist, eröffnet reichlich Raum für Scharlatanerie und Quacksalberei. Unseriöse Anbieter werben mit spektakulären Heilsversprechen, die jeder Grundlage entbehren: «Wende diesen geheimen Trick an und verabschiede dich für immer von negativen Gedanken!», «Dieses Nahrungsergänzungsmittel verschafft dir den ultimativen Serotonin-Boost!», «Erlebe eine unglaubliche Leistungssteigerung dank dieses bahnbrechenden Neurohacks, den Ärzte dir verschweigen!». Mit anderen Worten: Werde der Mensch, der du schon immer sein wolltest, mühelos und mit Erfolgsgarantie. Oft werden uns diese angeblichen Wundermittel mit einem wissenschaftlichen Anstrich präsentiert, besonders online. Wenn du auf so etwas hereinfällst, heißt das nicht, dass du naiv bist – es zeigt einfach, dass du ein normal funktionierendes menschliches Gehirn hast, das darauf ausgerichtet ist, mittels Verkürzungen und Assoziationen der Welt einen Sinn abzugewinnen.
Sich ein Leben und eine Identität aufzubauen, ist ein verwirrendes und chaotisches Unterfangen. Entsprechend groß ist die Versuchung, sich an alles zu klammern, was irgendwie Klarheit verspricht. Wir neigen dazu, uns Hals über Kopf auf vermeintlich einfache Lösungen einzulassen, im Ringen um unsere Identität alles auf eine Karte zu setzen in der Hoffnung, unsere leidigen existenziellen Probleme ein für alle Mal zu lösen. Der Haken daran ist, dass solche Verstrickungen Veränderung und Wachstum unglaublich erschweren. Wenn ein Lifestyle, eine Ideologie oder ein Trend erst einmal fest mit unserer Identität verknüpft ist, sträuben wir uns gegen Veränderung, selbst wo sie dringend nötig wäre. Wir klammern uns an überholte Ansichten oder schädliche Gewohnheiten, denn sie loszulassen fühlt sich an, als würden wir einen Teil von uns selbst aufgeben.
Wenn unsere Identität so fest und starr an bestimmte Überzeugungen oder Praktiken gekoppelt ist, betrachten wir andere Perspektiven nicht mehr als Chance zu lernen, sondern als existenzielle Bedrohung. Ich selbst habe gelernt, gewisse absurde, wissenschaftsferne Wellnesstrends im Netz niemals infrage zu stellen, weil ich damit nur einen Shitstorm auslösen würde – dann posten sofort tausend Leute ihre angeblichen Erfolgsgeschichten und verteidigen den von ihnen gewählten Weg mit Zähnen und Klauen. Das zeigt, wie emotional aufgeladen die Reise der Selbst- und Identitätsfindung sein kann. Gegensätzliche Perspektiven können sich buchstäblich wie ein persönlicher Angriff anfühlen.
Wir alle bilden uns gern ein, wir seien schlau genug zu erkennen, wenn uns jemand auf eine falsche Fährte locken will. Aber das liegt nicht in unserer Natur. Selbst die intelligentesten menschlichen Gehirne der Welt sind anfällig für Luftschlösser und Fehleinschätzungen. Ironischerweise sind wir den Patzern und Stümpereien unseres Gehirns umso schutzloser ausgeliefert, je stärker wir an unser eigenes Urteilsvermögen glauben.
In der Regel werfen wir unsere Skepsis über Bord, sobald wir eine Entscheidung getroffen haben. Darum bietet der Trial-and-Error-Ansatz einen wirksamen Schutz davor, auf falsche Versprechen hereinzufallen. Stelle jedes neue Konzept gründlich auf die Probe, ganz gleich, wie überzeugend es dir im ersten Moment erscheint. Das Schöne an dieser Methode ist, dass sie dir zugleich hilft, echte, evidenzbasierte Erkenntnisse bestmöglich zu nutzen, indem sie dir erlaubt, alles über Bord zu werfen, was für dich und deine persönlichen Bedürfnisse nicht funktioniert.
Selbst im Hinblick auf die wissenschaftlichen Gewissheiten, auf die wir uns wirklich verlassen können – wie etwa den Nutzen regelmäßiger Bewegung und die Notwendigkeit, ausreichend zu schlafen –, kann die beste Methode, diese Prinzipien in dein Alltagsleben zu integrieren, individuell so unterschiedlich sein wie die Bedürfnisse und Eigenschaften eines jeden wunderbar einzigartigen Menschen. Es gibt nicht die eine universell optimierte Trainingsroutine und nicht die eine ultimative Anleitung zu erholsamem Schlaf. Diese Uneindeutigkeit betrifft praktisch jede komplexe Frage darüber, was ein glückliches, gesundes Menschenleben ausmacht. Du kannst einen beliebigen angesehenen Experten fragen, und in den meisten Fällen wird die Antwort ungefähr lauten: Kommt ganz drauf an. Ja, ich weiß, das ist unbefriedigend. Aber bevor du jetzt die Augen verdrehst und dieses Buch im nächsten Papierkorb versenkst, lass mich wenigstens noch aufklären, worauf genau «es ankommt». Wenn du diese Grundbausteine verstehst, bist du weniger aufs Raten angewiesen, sondern verfügst stattdessen über eine solide, wissenschaftsbasierte Basis, mit der du arbeiten kannst.
Neurowissenschaft und Psychologie können uns durchaus den Weg zu Gesundheit und Glück weisen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine präzise, GPS-gestützte Navigation, sondern eher um die faszinierend verwirrende Schatzkarte eines Piraten. Das Ziel mag mit einem X markiert sein, aber auf welcher Route wir dorthin gelangen? Tja, hier beginnt das Abenteuer.
Der größte Zaubertrick deines Gehirns
Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und schlurfst noch im Halbschlaf ins Bad. Du knipst das Licht an, schaust in den Spiegel, aber du kannst das, was du siehst, nicht einordnen. Du wartest ab in der Hoffnung, dass sich ein Funke des Wiedererkennens regt, doch da ist nichts. Verwirrung setzt ein, als dir klar wird, dass dir aus dem Spiegel eine fremde Person entgegenblickt.
«Wer in aller Welt ist das?», fragst du und siehst, wie das unbekannte Gesicht die Lippen zu deinen Worten bewegt. Träumst du? Hast du geschlafwandelt und bist irgendwie in einer fremden Wohnung gelandet? Bestimmt ist das alles nur ein raffinierter Prank! Aber nein, das bist wirklich du … Oder wenigstens solltest du es sein.
Je länger du dastehst, umso unwirklicher fühlst du dich. Dass du dein Bild im Spiegel nicht wiedererkennst, ist noch nicht alles – dir fehlt überhaupt jedes «Du»-Konzept. Nicht dass du etwa deinen Namen oder deine Vergangenheit vergessen hättest – die Erinnerungen sind da, aber es kommt dir vor, als gehörten diese Fakten zu einer anderen Person. Deine Hand greift nach einer Zahnbürste über dem Waschbecken, doch es ist, als würde jemand anders die Fäden ziehen. Wie konnte das passieren?
Wir neigen dazu, unser Selbstgefühl einfach als gegeben anzunehmen, weil es uns als so fundamentaler Bestandteil unseres bewussten Erlebens erscheint. Aber in Wirklichkeit muss das Gehirn hart arbeiten, um es dauernd aufrechtzuerhalten. Seit du auf der Welt bist, ist dein Gehirn laufend damit beschäftigt, eine Flut von Sinneseindrücken, Emotionen und Erinnerungen zu verarbeiten, um diese Illusion zu erzeugen. Ich sage «Illusion», nicht weil ich etwa deine Existenz infrage stelle, sondern weil bewusste Erfahrung Stück für Stück konstruiert werden muss. So real und wunderbar du zweifellos bist – real zu sein, garantiert noch keinen Zugang zu Wahrnehmung oder Bewusstsein.
Schauen wir uns zum Beispiel die magnetischen Kräfte an: Sie sind völlig real, und doch können wir sie nicht bewusst wahrnehmen. Ich ahne, was du jetzt denkst: «Natürlich können wir magnetische Kräfte nicht fühlen. Das ist doch albern!» Aber so absurd ist die Vorstellung gar nicht – Zugvögel besitzen diese Fähigkeit, die sogenannte Magnetorezeption. Sie ermöglicht ihnen, mit einer Präzision über den Globus zu navigieren, angesichts derer Google Maps vor Neid erblassen müsste. Das wäre auch für Menschen ganz nützlich gewesen, aber durch irgendeine Laune der Evolution hat diese spezielle Fähigkeit nicht den Weg in unseren Zweig des phylogenetischen Stammbaums gefunden. Ich nehme an, unsere Vorfahren sind auch so ganz gut zurechtgekommen, indem sie sich an den Sternen und sichtbaren Landmarken orientierten, und deshalb haben die natürlichen Selektionsprozesse sich mehr auf andere Dinge konzentriert – zum Beispiel auf Selbstbewusstheit und Identitätsgefühl!
Normalerweise stören wir uns nicht weiter an unserer fehlenden Magnetorezeption, und wir machen uns auch selten Gedanken darüber, wie das Gehirn unser Selbstgefühl erzeugt. Wir erwarten einfach, dass wir das Gesicht im Spiegel erkennen, weil … nun, einfach weil es schon immer so war. Es ist fast unmöglich, sich Bewusstsein ohne ein Selbstgefühl vorzustellen, und doch schließt das eine das andere nicht notwendig mit ein. Die Wirklichkeit ist die eine Sache, die Art und Weise, wie dein Gehirn sie interpretiert, eine andere. Dein Gehirn hat nur einen einzigen Job, und der besteht darin, grobe Einschätzungen der Welt zu liefern. Es ist nicht verpflichtet, dir ein Selbstgefühl zu verschaffen, auch wenn es das netterweise die meiste Zeit tut. Darum kommt es eher selten vor, dass dir morgens nach dem Aufstehen eine fremde Person aus dem Spiegel entgegenblickt.
Um das möglich zu machen, arbeiten viele verschiedene Hirnregionen zusammen. Die vielleicht wichtigste davon ist der mediale präfrontale Kortex, kurz mPFC. Er befindet sich an der Stirnseite des Gehirns und ist so etwas wie der Chefredakteur, der die Bearbeitung und Herausgabe deiner Lebensgeschichte verantwortet. Stell dir vor, wie er stapelweise Sinneseindrücke, Erinnerungen und Gefühlsausbrüche sichtet und entscheidet, was davon am Ende einen Platz in der neuesten Ausgabe von You Quarterly bekommt. All dieses Material wird fleißig von den unermüdlichen Praktikanten und Mitarbeiterinnen in anderen Regionen des Gehirns geliefert, zum Beispiel aus dem Hippocampus, der zentralen Schaltstelle für Erinnerungen. Aber der Chefredakteur mPFC mit seinem scharfen Blick ist derjenige, der dafür sorgt, dass dein Selbstgefühl sich kohärent anfühlt und keine spürbaren Brüche aufweist; hier werden all die unterschiedlichen Fäden deines Ich miteinander verwoben.
Der anteriore cinguläre Kortex, kurz ACC, ist sozusagen die rechte Hand deines mPFC – ein aufmerksamer Faktenchecker, der mit scharfem Blick Unstimmigkeiten in deinen Überzeugungen und deinem Verhalten aufspürt und beseitigt. Es ist, als hätten wir einen inneren Lügendetektor, nur dass er nicht auf die Flunkereien anderer anspringt, sondern Alarm schlägt, wenn wir uns selbst in die Tasche lügen. Denk einmal an den Moment, in dem du beschlossen hast, in einer Situationship der desinteressierten anderen Partei eine Textnachricht zu schicken, in der du dich selbst erniedrigst. Und das, nachdem du wochenlang allen, die es hören wollten, erzählt hast, du hättest einen neuen Abschnitt in deinem Leben erreicht und seist von einem unbändigen Gefühl der Unabhängigkeit und tiefen Selbstachtung erfüllt. Sofort tritt der ACC auf den Plan und sendet Warnsignale. Er ruft sogar die Teile deines Gehirns zu Hilfe, die für Schmerz zuständig sind, um dir diesen mentalen Bruch – wir sprechen von kognitiver Dissonanz – mit einem plötzlichen, intensiven Gefühl lähmenden Unwohlseins zu signalisieren. Oh, wow … äh, danke, ACC. Wirklich sehr … hilfreich *räusper*.
Der anteriore insuläre Kortex, kurz AIC (ein Teil der sogenannten Inselrinde), ist einer der Rekruten, die dein ACC mobilisiert, um netterweise dieses ungemein hilfreiche grässliche Gefühl der kognitiven Dissonanz zu erzeugen. Du kannst dir dieses Hirnareal als eine Art Redakteur für innere Angelegenheiten vorstellen, der dafür sorgt, dass jede innerliche Wahrnehmung und jede kleine emotionale Regung gemeldet wird. Er sichtet einen unablässigen Strom eingehender Memos mit den jeweils neuesten Meldungen über die physiologischen Zustände in deinem Körper. Rast das Herz vor Begeisterung oder vor Angst? Signalisiert dieses Gefühl in deinem Bauch Hunger oder Stress? Der AIC weiß es und passt den redaktionellen Ton entsprechend dem wahren Stand der Dinge an. Vergiss nicht, deine Emotionen bestimmen zu einem Großteil mit, wer du bist und welche Entscheidungen du triffst. Genau wie der Körper, in dem du lebst.
Dein Körper fällt in den Zuständigkeitsbereich des temporoparietalen Übergangs (oder kurz TPJ). Die TPJ-Hirnstruktur ist wie eine Klatschkolumnistin mit unfassbar guten Connections, die irgendwie jeden kennt und von allem Wind bekommt, was in der Stadt vor sich geht. Er empfängt immer die neuesten Nachrichten, bei ihm laufen Informationen aus dem sensorischen, motorischen, visuellen und auditiven Kortex zusammen. Selbst deine Muskeln steuern etwas bei, indem sie regelmäßig Updates über die Lage und Stellung jedes einzelnen Körperteils senden, eine Funktion deines «sechsten Sinnes»: der Propriozeption. Nicht zu verwechseln mit dem Film The Sixth Sense aus den späten Neunzigern, der, wie man sich wohl denken kann, ein absoluter PR-Albtraum für die Propriozeption war. Dank all diesem Insiderwissen mangelt es deiner inneren Kolumnistin nie an Inspiration, und sie liefert ständig Updates zu deiner Story, um alle Details über den Körper, in dem du lebst, einzubeziehen.
Die soziale Kompetenz der TPJ-Hirnstruktur beschränkt sich allerdings längst nicht nur auf sensorischen Klatsch. Sie ist außerdem eine Meisterin der Etikette und hilft dir, dich in der komplexen Welt sozialer Interaktionen zurechtzufinden.[1] Wenn du auf einer Dinnerparty bist und dich fragst, ob es wohl okay wäre, das letzte Schnittchen zu nehmen, blättert deine TPJ-Kolumnistin sofort eifrig in ihrem mentalen Handbuch gesellschaftlicher Normen, um dir bei der Entscheidung zu helfen.
Sehr wahrscheinlich wird keine dieser Hirnregionen dich jemals so gründlich im Stich lassen, dass dein Selbstgefühl komplett ausfällt. Allerdings kommt es vor, dass Bedrohungen auftreten, die es ihnen schwerer machen, ein glückliches, gesundes Selbstkonzept aufrechtzuerhalten. Wir können das nicht so gut kontrollieren, wie wir vielleicht glauben wollen, und ich habe auch keine «Neurohacks» im Angebot, die dir ermöglichen würden, direkt auf diese Hirnregionen zuzugreifen und ihre Funktionen zu beeinflussen.
Wenn ich dir an diesem Punkt eine Perle der Weisheit mitgeben kann, dann diese: Dein Gehirn hat seine ganz eigene Persönlichkeit. Wir bilden uns gern ein, selbst alle Fäden in der Hand zu halten, aber in Wirklichkeit ist das Gehirn dauernd heimlich hinter den Kulissen aktiv und baut das Szenenbild deiner Gedanken und Gewohnheiten um, ohne dass du es überhaupt merkst. Es folgt seinen eigenen Launen und lenkt mit sanftem Nachdruck unser Verhalten in einer Weise, die uns nur selten bewusst ist. Diese Geheimoperationen haben weit größeren Einfluss auf unser Leben, als wir uns eingestehen mögen, und wir können dem nicht viel entgegensetzen. Aber: Du kannst kontrollieren, womit du die Bestie fütterst.
Du kannst nämlich Einfluss auf dein Gehirn nehmen, indem du deine Aufmerksamkeit klug steuerst, dir dein Umfeld sorgfältig aussuchst und bewusst entscheidest, welchen Informationen du es aussetzt. Du glaubst vielleicht, es ginge spurlos an dir vorbei, wenn du dich zwei Stunden lang hemmungslosem Doomscrolling hingibst und einen Rage-Bait-Beitrag nach dem anderen anklickst, aber das Gehirn vergisst nicht so leicht. Es saugt unterschiedslos jedes Detail auf und sammelt Material für eine nächste Runde spontaner Launen und Impulse. Wenn wir steuern, was wir unserem Gehirn zumuten, wird es sich viel eher so verhalten, wie es uns, unseren Werten und unserem Anspruch an uns selbst entspricht.
In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels wirst du dem mPFC, dem Hippocampus, dem ACC, dem AIC und dem TPJ noch öfter begegnen. Du wirst erfahren, wie ihre Funktionen unter den Bedingungen unserer modernen Welt aus dem Ruder laufen können und wie du steuern kannst, welche Einflüsse auf sie einwirken, damit sie sich zum Dank etwas kooperativer verhalten. Vorerst kannst du dir die Sache einfach so vorstellen wie ein Theaterstück von Tschechow mit dem Titel «Anatomie des Gehirns» – sämtliche Neuronen sind in Stellung, um im zweiten Akt loszufeuern.
Des Kaisers neue Kleider: Link in Bio!
Unsere kollektive Beschäftigung mit Identität ist kein neues Phänomen – sie ist ein Urinstinkt und lässt sich bis zu unseren Vorfahren zurückverfolgen, die durch die Savanne streiften. Diese frühen Vertreter des Homo sapiens suchten bereits nach Möglichkeiten, ihre Identität zu etablieren und zu bewahren. Archäologische Funde haben Einblicke in die überraschend stylishe Welt unserer Vorfahren ermöglicht. Bei Ausgrabungen wurden nämlich Schmuckstücke in beachtlicher Vielfalt entdeckt, die wahrscheinlich dazu dienten, die Identität und den sozialen Status ihrer Trägerinnen kenntlich zu machen.[1] Stell dir zum Beispiel einen Jäger vor, der einen Halsschmuck aus den Zähnen seiner Beutetiere trägt. Das ist mehr als nur ein modisches Statement, denn es vermittelt die Botschaft: «Sieh dir meinen Schmuck an und erkenne, dass ich nützlich bin – ich besitze den Mut und das Geschick, dich mit köstlichem Mammut-Eintopf zu versorgen!»
Die Menschen in diesen frühen Gesellschaften trugen ihre Identität offen zur Schau – am Hals, auf dem Kopf oder auch in die Haut eingeritzt –, wahrscheinlich weil es einem sozialen Zweck diente. Der Schmuck vermittelte in einer Art verkürzter Bildsprache komplexe soziale Signale so, dass sie auf den ersten Blick erkennbar waren. Wer in der damaligen Zeit von seinem Stamm nicht anerkannt und akzeptiert wurde, war aufgeschmissen. Teil eines Stammes zu sein, bedeutete Schutz, Zugang zu Ressourcen und ein etwas geringeres Risiko, von einer Bisonherde niedergetrampelt zu werden. Bei der Identitätsfrage ging es nicht so sehr darum, sich besonders hervorzutun und von den anderen abzuheben, sondern vielmehr darum, dazuzugehören, erkannt und anerkannt und, ja, vielleicht auch gemocht zu werden. In einer Welt, in der Ausschluss aus der Gemeinschaft den Tod bedeuten konnte, entwickelten unsere Vorfahren ein starkes Gefühl für sich selbst und, was noch wichtiger war, für andere.
Im heutigen digitalen Zeitalter steht natürlich viel weniger auf dem Spiel. Heutzutage wird man nur noch erfreulich selten von Bisons niedergetrampelt. Dennoch werden wir modernen Menschen noch immer von denselben Impulsen getrieben: anerkannt zu werden, dazuzugehören und ein Selbstgefühl auszustrahlen. Allerdings sind wir inzwischen mit Smartphones statt mit Speeren bewaffnet, und so erreichen unsere Identitätssignale nicht mehr nur unseren heimischen Stamm – wir schicken sie in die ganze Welt hinaus. Dieser veränderte Kontext macht einen ganz wesentlichen Unterschied: Er hat drastische Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Identität wahrnehmen und signalisieren.
Wir Menschen sind von Natur aus zutiefst soziale Wesen. Kaum sind wir aus dem Mutterleib heraus, fangen wir auch schon an, nach Hinweisen Ausschau zu halten, wie wir uns verhalten sollten. Laufen, sprechen, mit Besteck essen – all das lernen wir, indem wir die größeren Menschen um uns herum beobachten und nachahmen. Selbst im Erwachsenenalter ist soziales Lernen das A und O menschlicher Interaktion – wir können gar nicht anders, als wahrzunehmen, was alle anderen sagen und tun, und uns davon beeinflussen zu lassen. Dabei ist uns dieser Prozess nur selten bewusst;[2] wir passen uns einfach an, um uns in unser soziales Umfeld einzufügen, wie ein Chamäleon unwillkürlich die Farbe wechselt, um sich nicht von seiner Umgebung abzuheben.
Jeder soziale Raum – ob physisch oder digital – ist wie ein Spiegelkabinett, in dem Verhaltensweisen bis ins Unendliche zurückgeworfen und verstärkt werden. So etablieren, erlernen und verhandeln wir die ungeschriebenen Regeln, die unser Verhalten in der Gesellschaft bestimmen und die wir in ihrer Gesamtheit als soziale Normen bezeichnen. Den meisten von uns ist beispielsweise klar, dass es völlig in Ordnung ist, eine fremde Person nach dem Weg zu fragen, aber eben nicht danach, ob wir mal an ihrem Eis lecken dürfen. Das wurde uns nie explizit so gesagt; dank unserer TPJ-Kolumnistin erlernen und befolgen wir diese ungeschriebenen Regeln einfach intuitiv. Sie erkennt Muster in sozialen Interaktionen und prägt unser Verhalten und unser Selbstgefühl entsprechend, um sie mit den gesellschaftlichen Erwartungen in Einklang zu bringen.
Dieser angeborene Impuls, Verhalten nachzuahmen, ist durchaus nützlich, wenn es darum geht, grundlegende Fähigkeiten zu erwerben. Wird es aber komplexer, kann er zum Problem werden. Online sind wir einer Welt ausgesetzt, die im Grunde ein Marktplatz ist, getarnt als sozialer Raum. Wir verbringen einen erheblichen Teil unserer Zeit damit, durch eine Landschaft zu navigieren, in der die Grenzen zwischen sozialer Interaktion und gezieltem Marketing verschwimmen. Während unser Grundbedürfnis, unser Selbstgefühl zu definieren, unverändert bleibt, werden die Signale, die wir dafür nutzen, von Plattformen vereinnahmt, die uns nur allzu gern dazu verleiten wollen, unser mühsam verdientes Geld auszugeben. Und eine unglaublich effektive Methode hierzu besteht darin, Produkte an soziale Interaktionen zu koppeln.
Kehren wir noch einmal zu unserem steinzeitlichen Jäger zurück, der stolz seine Identität zur Schau trägt, indem er sich einen Halsschmuck aus den Zähnen erlegter Beutetiere umhängt. Die anderen Mitglieder seines Stammes sehen seinen Erfolg und bringen den Halsschmuck aus Tierzähnen mit herausragenden Jagdkünsten in Verbindung. Mit der Zeit verfestigt sich diese Assoziation: Wieder und wieder sehen sie die besten Jäger solche Trophäen tragen. Wenn nun junge Jäger das Mannesalter erreichen, fangen sie an, sich ebenfalls solchen Halsschmuck umzuhängen. Warum? Weil Jäger das in ihrer Vorstellung eben tun. Es ist keine bewusste Entscheidung – sie ordnen das, was sie sehen, instinktiv als wesentliches Kennzeichen einer Rolle ein, die sie anstreben.
Der gleiche Prozess läuft auch heute ab, wenn wir einzelne Produkte oder Marken mit einer bestimmten Identität assoziieren. Wenn jede Wellnessinfluencerin, der du folgst, mit der gleichen Trinkflasche posiert, fängst du mit der Zeit vielleicht an, Trinkflaschen der betreffenden Marke mit dem Konzept von Wellness in Verbindung zu bringen. Es geht nicht um die ursprüngliche Bedeutung des Symbols, sondern um die Bedeutung, die wir ihm kollektiv zuschreiben. Und wenn dir Wellness wichtig ist, kommt dir die Entscheidung, eine angesagte Trinkflasche zu kaufen, vielleicht irgendwann ganz natürlich vor.
Der Schlüssel liegt hier in Verbreitung und Wiederholung – dadurch entsteht die Illusion einer allgemein akzeptieren sozialen Norm. Wenn wir ein bestimmtes Produkt ständig im Zusammenhang mit speziellen Menschen oder einem bestimmten Lebensstil sehen, stellt das Gehirn Verknüpfungen her und assoziiert automatisch kommerzielle Signale mit den Werten, für die sie vermeintlich stehen. Und da sich das Ganze in einem sozialen Raum abspielt, beobachten und verinnerlichen wir nicht nur, sondern ahmen auch nach – oft ohne zu hinterfragen, warum wir das eigentlich tun. Marken schlagen Kapital aus diesem Mechanismus des menschlichen Geistes, indem sie passend zu bestimmten Identitäten ganze Produkt-Ökosysteme entwickeln. Sie verkaufen nicht einfach nur Produkte – sie verkaufen einen Lifestyle, einen Stamm, eine Rolle, mit der man sich identifizieren kann. Dieses System ist so genial, dass es uns oft völlig organisch vorkommt, wie ein ganz leises Summen, das knapp unterhalb der Schwelle zur bewussten Wahrnehmung liegt. Allmählich, unmerklich wurde unser Verständnis von Identität durch die unsichtbare Hand des Marktes subtil umgeschrieben.
Jedes Scrollen, jeder Klick ist eine Lektion in dieser neuen Sprache der Identität, in der Sein durch Kaufen ersetzt wurde. Die harmloseste Folge wäre, dass du einen Haufen Schrott kaufst, den du eigentlich gar nicht brauchst. Aber die Effekte dieser neuen, marktgetriebenen sozialen Normen können nicht nur deinen Geldbeutel betreffen, sondern sich auch tief in dein Selbstgefühl eingraben.
Früher wurde eine Identität im Feuer der Erfahrung geschmiedet. Sie wurde in stundenlanger Übung aufgebaut, durch eine endlose Aneinanderreihung von Erfolgen und Fehlschlägen, von denen jeder dazu beitrug, die Erfahrung zu erweitern. Das Selbstgefühl war eng daran geknüpft, wie wir unsere Zeit verbrachten und worin wir besondere Fähigkeiten entwickelten. Der Jäger trug nicht einfach nur den Halsschmuck; er führte das Leben, das diesen Halsschmuck möglich machte. Jeder Zahn stand für eine erfolgreiche Jagd, zugleich aber auch für die vielen Stunden, in denen der Träger Fährten verfolgt, der Beute nachgestellt und es geschafft hatte, nicht als Mahlzeit dessen zu enden, was er selbst verspeisen wollte. Es war ein mühsamer Prozess, der nicht selten tödlich ausging, aber durch ihn wurde der Jäger zu einem guten Jäger. Und was noch wichtiger ist: Diese Erfahrungen führten dazu, dass der Jäger sich wie ein Jäger fühlte. Der Hippocampus legt diese Jagderinnerungen nicht bloß in irgendeinem verstaubten neuronalen Aktenschrank ab. Er schickt sie sofort per Express rüber an den mPFC, versehen mit einer kleinen Notiz: «Wichtiges Identitäts-Update, bitte asap einarbeiten.» Der mPFC, Chefredakteur für Identität, nimmt die neue Erinnerung und integriert sie in das Gesamtgefüge des Selbstgefühls. «Ah», sagt er, «noch ein weiterer Beweis dafür, dass wir tatsächlich ein tüchtiger Jäger sind.» Wenn wir unsere Werte leben, erzeugen unsere Erfahrungen starke, klare Signale, mit denen der mPFC arbeiten kann.
Heutzutage können wir uns den Halsschmuck mit Tierzähnen einfach kaufen. Oder besser gesagt, wir kaufen, was immer die moderne Entsprechung dazu ist, sei es eine teure Trinkflasche oder eine High-End-Armbanduhr. Natürlich tragen diese Produkte, die als Identitätssignale dienen, meist wenig zu den Werten bei, die wir abbilden wollen. Wenn der Zusammenhang zwischen projizierter Identität und tatsächlichem Verhalten fehlt, kann das einen existenziellen Schwindel erzeugen, einen Zustand, in dem dein innerer Chefredakteur, der mPFC, sich schwertut, dir eine kohärente, in sich stimmige Story zu liefern. Hier tritt der ACC auf den Plan. Ihm obliegt es, Unstimmigkeiten aufzuspüren und zu helfen, Widersprüche im Narrativ zu beheben. Und da hat er wahrhaftig einiges zu leisten. Wenn dieser Faktenchecker anfängt, Erinnerungen an gelebte Erfahrungen mit diesen äußeren Signalen abzugleichen, schrillen die Alarmglocken. «Moment mal», sagt er dann und nippt stirnrunzelnd an seinem Kaffee. «Diese beiden Narrative passen überhaupt nicht zusammen. Hier liegt ein Fall von kognitiver Dissonanz vor!»
Manchmal sind wir so darauf fokussiert, unsere Rolle zur Schau zu tragen, dass wir ganz vergessen, sie auch wirklich zu spielen. Das passiert schnell, und es ist nicht allein unsere Schuld. Das Gehirn bemüht sich nach Kräften, diesem vermeintlich sozialen Raum einen Sinn abzugewinnen und dem «Stamm» unsere Identität zu signalisieren, um uns zu schützen. Aber das Ergebnis ist ein quälendes Gefühl der Leere, eine vage Empfindung, dass da etwas fehlt, das wir nicht genau benennen können. Es ist das psychologische Äquivalent zu einem Phantomschmerz, nur dass wir statt einer fehlenden Gliedmaße den Mangel an echter Identität spüren.
Diese Tragödie hat zwei Aspekte. Erstens berauben wir uns der Selbstsicherheit, die aus dem Erwerb von Fähigkeiten und gelebter Erfahrung entsteht. Und zweitens entgeht uns die Chance zu echter Selbstfindung. Wenn wir uns die Reise sparen und gleich zum gewählten Endpunkt springen, verpassen wir die unverhofften Umwege und Entdeckungen. Dabei sind es gerade diese Umwege, die der Identität Tiefe und Nuanciertheit verleihen. Zum Beispiel hatte unser Jäger es vielleicht ursprünglich auf Mammuts abgesehen, erkannte aber mit der Zeit, dass er besonders geschickt darin ist, kleinere, flinkere Beute aufzuspüren und zur Strecke zu bringen. Oder vielleicht ist er den Fährten einer Herde gefolgt, dabei zufällig auf einen bislang unbekannten Obstbaum gestoßen und so zum ersten Pflanzenkundler seines Stammes geworden. Wenn wir uns nicht tief auf unsere gewählte Identität einlassen, geben wir uns selbst keine Chance, darin zu wachsen und uns zu entwickeln.
Es gibt auch das umgekehrte Problem: dass wir die gelebte Erfahrung haben, aber nicht die entsprechenden Produkte. Ich vermute, das ist sogar das häufigste aller Probleme mit der Konsumenten-Identität. Stell dir eine Welt vor, in der jägerisches Können nicht mehr durch einen Halsschmuck mit Tierzähnen signalisiert wird, sondern durch den Besitz eines bestimmten Kristalls. Das ist eine völlig willkürliche Verknüpfung – der Kristall hat nichts mit den Fähigkeiten zu tun, die man zur Jagd benötigt. Du könntest der großartigste Jäger der Geschichte sein, fähig, allein mit einem durchdringenden Blick die Beute zur Strecke zu bringen, aber solange du nicht den richtigen Kristall besitzt, wird die Gesellschaft dich dennoch als Anfänger einstufen. Nachdem der TPJ diese neue soziale Norm codiert hat, wäre der ACC gezwungen, einen Konflikt zwischen erfahrungsbasierter Identität und diesem neuen, gesellschaftlich auferlegten Standard des fehlenden Kristalls zu signalisieren. Plötzlich fühlt sich deine Identität an wie eine Frage, auf die du immer wieder zurückgeworfen wirst, sobald du einem kristalltragenden Jäger über den Weg läufst.
Das klingt vielleicht weit hergeholt, aber um uns herum wimmelt es von kommerziell gekapertem Identity Signalling, das im Grunde die gleiche Funktion erfüllt. Nimm dir mal einen Moment Zeit und stell dir eine fitnessbegeisterte Frau vor – was siehst du? Lass mich raten: teure Leggings, Schönheit, die offenbar von einer Focus-Gruppe pubertierender Jungs und griechischer Göttinnen ausgeklügelt wurde, und ein Gesäß von so beeindruckenden Proportionen, dass es eigene Gravitationskräfte entwickelt. Na, war ich nah dran? Fitnessinfluencerinnen sehen unbestritten umwerfend aus, und sie arbeiten bestimmt hart daran, in Form zu bleiben. Aber es gibt auch jede Menge Sportlerinnen, die sich regelmäßig verausgaben und nicht so aussehen. Diese Influencerinnen-Ästhetik dauerhaft zu erhalten, ist in den meisten Fällen ein Vollzeitjob. Fitnessinfluencerinnen können das leisten, weil sie über die Zeit, das Geld und die Ressourcen verfügen, aber was noch wichtiger ist: Bodybuilding ist ihr Sport und Content-Creation ihr Hauptberuf. Wenn ich dagegen Turnerin oder Rugbyspielerin bin und für meinen Lebensunterhalt vierzig oder mehr Stunden pro Woche am Schreibtisch sitzen muss, dann arbeite ich auf völlig andere Ziele hin. Wenn ich sie erreiche, habe ich mir meinen Halsschmuck mit Tierzähnen verdient, aber ohne extrem ausgeprägte Gesäßmuskeln, Designerleggings und makellos straffe Haut fühlt es sich dennoch an, als ob etwas fehlt. «Denk an die Trainingseinheit, die du heute Morgen durchgezogen hast», argumentiert der mPFC tapfer. «Denk daran, wie viel Kraft du mit der Zeit aufgebaut hast.» Aber dann mischt sich die TPJ-Kolumnistin ein, die immer ein Auge auf die gesellschaftlichen Erwartungen hat. «Ich sag’s ja nur ungern», meldet sie sich zu Wort, «aber nach den heutigen sozialen Standards zählt das alles nicht wirklich, wenn du dich nicht mit Sixpack präsentierst und dabei strahlend in die Kamera lächelst.» Wir haben eine Welt erschaffen, in der der äußere Anschein, einem Wert zu folgen, wichtiger ist als die Frage, ob man diesen Wert auch wirklich lebt. Das Ergebnis ist ein Identitätskurzschluss.
Denk daran, du selbst kontrollierst, womit du die Bestie fütterst. Stell dir dein digitales Umfeld also mit Sorgfalt zusammen, um dich möglichst wenig marktgetriebenem Signalling auszusetzen. Je weniger du davon aufnimmst, umso weniger Einfluss kann es darauf haben, welche Vorstellungen von sozialen Normen dein Gehirn entwickelt. Wenn du dich gar nicht davon losreißen kannst, versuch wenigstens, nicht aktiv durch Likes, Kommentare oder Teilen auf kommerziell getriebenen Content einzugehen – man spricht hier von Selective Engagement. Du sendest damit eine starke Botschaft nicht nur an dein Gehirn, sondern auch an deinen persönlichen Algorithmus: Er lernt, dass er deine Aufmerksamkeit mit authentischen Verbindungen besser gewinnt als mit Windowshopping.
Du könntest überlegen, dir einen zweiten Instagram-Account einzurichten, auf dem du ausschließlich deinem Freundeskreis, Familienmitgliedern und anderen Accounts ohne kommerziellen Hintergrund folgst. Natürlich sind deine Freundinnen und Verwandten Teile desselben Ökosystems, und du wirst vielleicht feststellen, dass ein paar von ihnen das Problem unbewusst befeuern. Die einfachste Möglichkeit, ihnen zu helfen, besteht darin, auf ihre authentischeren Posts mit besonderer Begeisterung einzugehen. Wenn du auf Menschen triffst, die wirklich ihre Werte leben, bestärke sie. Jeder Like oder Kommentar, jeder Smiley, jedes «Weiter so» ist eine Stimme für eine echtere, ehrlichere Welt.
In einer Zeit, in der alles immer gleich ein Statement zu sein scheint, ist manchmal das Wirksamste, was du tun kannst, eine Pause einzulegen und dir darüber klar zu werden, was du eigentlich sagen willst. Frag dich, was dir wirklich wichtig ist, und fokussiere dann deine Energie gezielt darauf, diese Werte zu leben.[3] Wenn du Fälle von Identity Signalling siehst, die dich veranlassen, deinen Selbstwert anzuzweifeln oder deine Kreditkarte zu zücken, halt inne und frag dich: «Steht das im Einklang mit meinen Werten? Welche Absicht steckt wirklich hinter dieser Botschaft?» Es geht hier nicht darum zu urteilen; es geht darum, eine Barriere aufzubauen, um dein Gehirn davor zu schützen, diese Signale zu verinnerlichen.





























