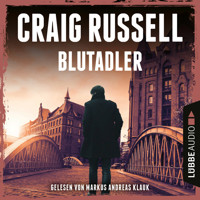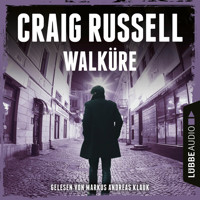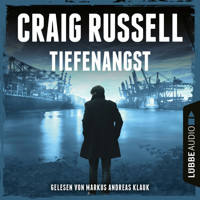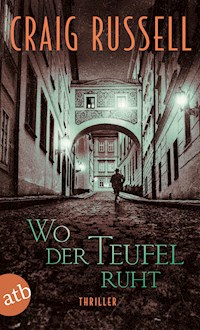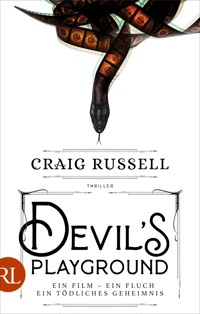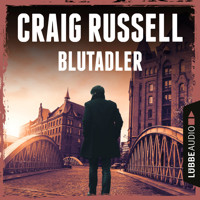8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jan-Fabel-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein Bahnhof in Deutschland, irgendwann in den Siebzigerjahren. Ein Paar wartet auf den Zug. Der Mann, auffallend durch seine pechschwarzen Haare und sein blasses Gesicht, ist nervös. Dann macht einer eine falsche Bewegung. In dem darauf folgenden Feuergefecht sterben zwei Menschen, und ein kleiner Junge sieht dabei zu.
Hamburg, Gegenwart. In der Stadt geht ein Serienkiller um. Seine Signatur besteht darin, dass er seinen Opfern die Haare rot färbt. Kommissar Jan Fabel wird auf den Fall angesetzt. Bald kommt ihm der Verdacht, dass die Morde etwas mit der RAF-Szene von früher zu tun haben müssen. Damals gab es einen Terroristen, den man den "Roten Franz" nannte und der unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Wer war der Junge, der damals überlebt hat, und was ist aus ihm geworden? Ist jemand auf einem Rachefeldzug - und wenn ja, gegen wen? Oder liegen die Gründe, wie der Mörder den Kommissar glauben machen will, weit tiefer, in dunkelster Vergangenheit? Und wird die Gewalt niemals enden?
"Ein russell-rassiger Thriller! Sorgt für erhöhten Pulsschlag." Bild am Sonntag. "Fabelhafter Lesestoff." Münchner Merkur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Ähnliche
Über Craig Russel
Craig Russell, Jahrgang 1956, wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, seine Bücher wurden in 23 Sprachen übersetzt. Er hat sich schon als Student für deutsche Kultur interessiert und lebt in der Nähe von Edinburgh.
Drei Romane um den Hamburger Polizisten Jan Fabel sind mit Peter Lohmeyer in der Hauptrolle für das deutsche Fernsehen verfilmt worden.
Der neue Roman „Auferstehung“ erscheint bei Rütten & Loening.
Informationen zum Buch
Kann ein Mensch nach Jahrhunderten wiedergeboren werden - als Mörder?
Bevor der Mann aus dem Moor erneut das Tageslicht erblickte, würden mehr als sechzehnhundert Jahre vergehen, und das Gold seiner Haare würde sich ein in brennendes Rot verwandeln.
Ein Bahnhof in Deutschland, irgendwann in den Siebzigerjahren. Ein Paar wartet auf den Zug. Der Mann, auffallend durch seine pechschwarzen Haare und sein blasses Gesicht, ist nervös. Dann macht einer eine falsche Bewegung. In dem Feuergefecht sterben zwei Menschen, und ein kleiner Junge sieht dabei zu.
Hamburg, Gegenwart. In der Stadt geht ein Serienkiller um. Seine Signatur besteht darin, dass er seinen Opfern die Haare rot färbt. Kommissar Jan Fabel wird auf den Fall angesetzt. Bald kommt ihm der Verdacht, dass die Morde etwas mit der RAF-Szene von früher zu tun haben müssen. Damals gab es einen Terroristen, den man den Roten Franz nannte und der unter mysteriösen Umständen ums Leben kam.
Wer war der Junge, der damals überlebt hat, und was ist aus ihm geworden? Ist da jemand auf einem Rachefeldzug - und gegen wen? Oder liegen die Gründe, wie der Mörder den Kommissar glauben machen will, weit tiefer, in der dunkelsten Vergangenheit. Und wird die Gewalt niemals enden?
"Ein russell-rassiger Thriller! Sorgt für erhöhten Pulsschlag." Bild am Sonntag.
"Fabelhafter Lesestoff." Münchner Merkur.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Craig Russell
Brandmal
Thriller
Aus dem Englischen vonBernd Rullkötter
Inhaltsübersicht
Über Craig Russel
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Zweiter Teil. Karneval
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Epilog
Danksagung
Impressum
Dem Gedenkenan Gabriel Brown gewidmet
»Wir existieren ewig.
Die Buddhisten glauben, dass jedes Leben, jedes Bewusstsein einer einzelnen Kerzenflamme gleicht, doch dass es einen inneren Zusammenhang zwischen sämtlichen Flammen gibt. Stell dir vor, man würde eine Kerze an der Flamme einer anderen anstecken, dann damit die nächste und die nächste und immer so weiter. Tausend Flammen, die über die Generationen hinweg weitergegeben werden. Jede ist anders, jede brennt auf ganz unterschiedliche Weise. Aber trotzdem ist es immer die gleiche Flamme.
Nun wird es leider Zeit, deine Flamme auszulöschen. Aber keine Sorge – der Schmerz, den ich dir bereite, sorgt dafür, dass du am Ende besonders hell brennen wirst.«
Prolog
Donnerstag, den 15. September 2005, achtundzwanzig Tage nach dem ersten Mord
Bahnhof Nordenham, 125 Kilometer westlich von Hamburg
Fabel konnte sich des ironischen Gedankens, dass Nordenham im doppelten Sinne eine Endstation war, nicht erwehren. Hier also endete die Reise. Nun ging es nicht mehr weiter.
Die Scheinwerfer der Streifenwagen auf der anderen Seite der Gleise erhellten den Bahnsteig wie eine Bühne. Es war ein kristallener Moment: scharf und klar und hart wie ein Diamant. Sogar die rotbraune Fassade des über hundertdreißig Jahre alten Bahnhofs schien ihre Farbe eingebüßt zu haben. Ihre Ränder stachen mit künstlicher Deutlichkeit hervor wie auf einer Architekturzeichnung oder auf einer Kulisse, von der sich die Riesenschatten der beiden Gestalten auf dem Bahnsteig abhoben. Die eine stand, die andere war auf die Knie gezwungen. Und nichts war schärfer und klarer als das gierige Glänzen der Klinge in der Hand der beleuchteten Gestalt, die hinter dem knienden Mann aufragte.
In Fabels Geist jagten sich tausend Möglichkeiten, wie alles enden konnte. Seine nächsten Worte, seine nächste Handlung würden Konsequenzen haben, eine Folge von Ereignissen auslösen. Und eine nur zu gut vorstellbare Konsequenz war der Tod mehrerer Personen.
Ihm tat der Kopf weh. Trotz der Jahreszeit fühlte sich die Nachtluft in seinem Mund trocken und steril an. Aus seinem Atem bildeten sich graue Schemen, als könnten sie in diesem Moment, in dieser niedrigen Landschaft, eine große Höhe erreichen.
Die Luft schien so dünn zu sein, dass sie keinen anderen Laut als das verzweifelte, halb schluchzende Keuchen des knienden Mannes weiter trug. Fabel warf einen Blick auf seine Beamten. Sie standen, ihre Waffen im Anschlag, mit gespannten Muskeln in der Haltung derjenigen da, die darauf vorbereitet sind, in Sekundenschnelle zu töten. Maria nahm er am aufmerksamsten wahr. Ihr Gesicht war blutleer, ihre Augen glitzerten eisblau, die Knochen und Sehnen ihrer Hände traten deutlich unter der straffen Haut hervor, während sie ihre Sig-Sauer-Automatik gepackt hielt.
Fabel machte eine fast unmerkliche Kopfbewegung und hoffte, dass sein Team das Signal, sich zurückzuhalten, verstand.
Er musterte den Mann in der Mitte des grellen Lichtes. Fabel und sein Team hatten sich seit Monaten bemüht, den Namen, die Identität des von ihnen gejagten Mörders festzustellen. Er hatte sich als Mann mit vielen Namen erwiesen: Sich selbst bezeichnete er in seinem pervertierten Gerechtigkeitsgefühl als Roten Franz, während die Medien ihn in ihrer enthusiastischen Entschlossenheit, Furcht und Angst zu verbreiten, den »Hamburger Haarschneider« getauft hatten. Doch nun kannte Fabel seinen wirklichen Namen.
Vor dem Roten Franz, in dieselbe Richtung blickend, kniete ein Mann mittleren Alters, den der Mörder niedergezwungen hatte. Der Rote Franz hielt ihn an einem Schöpf grauer Haare fest und hatte seinen Kopf zurückgezerrt, sodass die weiße Kehle entblößt war. Über der Kehle und über dem schreckerfüllten Gesicht war das Fleisch knapp unter dem Haaransatz in gerader Linie durchschnitten worden. Die Wunde öffnete sich, als der Rote Franz den Kopf am Haar zurückriss. Blut ergoss sich über das Gesicht des knienden Mannes, der einen hohen, tierischen Schrei ausstieß.
Und unablässig funkelte und glänzte die Klinge an der Seite des Roten Franz boshaft in der Nacht.
»Um Himmels willen, Herr Fabel!« Die Stimme des knienden Mannes war vor Furcht angespannt und schrill. »Helfen Sie mir … Bitte … Helfen Sie mir …«
Fabel ignorierte das Flehen und wandte den Blick nicht vom Roten Franz ab. Er streckte die Hand in die leere Luft, als würde er den Verkehr stoppen. »Ruhig … ganz ruhig. Ich spiele nicht mit. Keiner von uns tut das. Wir werden nicht die Rollen übernehmen, die Sie uns zugedacht haben. Heute Nacht wird sich die Geschichte nicht wiederholen.«
Der Rote Franz lachte bitter. Die Hand, die das Messer hielt, zuckte, und wieder funkelte die Klinge hell und intensiv.
»Glauben Sie allen Ernstes, dass ich einfach aufgeben werde? Dieser Dreckskerl …« Wieder riss er an dem Haar, und der kniende Mann heulte erneut durch den Schleier seines eigenen Blutes hindurch. »Dieser Dreckskerl hat mich und alles verraten, was uns teuer war. Er hat gemeint, sich mit meinem Tod ein neues Leben erkaufen zu können. Genau wie die anderen.«
»Das ist ein Hirngespinst«, sagte Fabel. »Das war nicht Ihr Tod.«
»Wirklich nicht? Warum haben Sie dann an Ihrer Überzeugung gezweifelt, als Sie nach mir suchten? Es gibt keinen Tod, nur Erinnerung. Der einzige Unterschied zwischen mir und allen anderen ist der, dass ich mich erinnern darf, als wenn ich in einem Spiegelsaal stünde. Ich erinnere mich an alles.« Er verhielt, und das kurze Schweigen wurde nur durch das ferne Geräusch eines Autos durchbrochen, das zu später Stunde durch den Ort Nordenham fuhr – hinter dem Bahnhof und ein Universum entfernt. »Natürlich wiederholt sich die Geschichte. Das ist ihre Aufgabe. Sie hat mich wiederholt … Sie sind stolz darauf, in Ihrer Jugend Geschichte studiert zu haben, aber verstehen Sie sie wirklich? Wir alle sind nur Variationen desselben Themas … alle von uns. Was war, wird wieder sein. Wer früher war, kommt zurück. Immer wieder. Geschichte hat mit Anfängen zu tun. Sie wird erzeugt, nicht zerstört.«
»Dann erzeugen Sie Ihre eigene Geschichte«, sagte Fabel. »Ändern Sie die Dinge. Hören Sie auf, Mann. Heute Nacht wird sich die Geschichte nicht wiederholen. Heute Nacht stirbt niemand.«
Der Rote Franz lächelte. Sein Lächeln war so hell und hart und kalt wie das Messer in seiner Hand. »Tatsächlich? Das bleibt abzuwarten, Herr Hauptkommissar.« Die Klinge fuhr zu der Kehle des knienden Mannes.
Ein Schrei. Und das Knallen einer Pistole.
Frühlingstagundnachtgleiche, 324 n. Chr., eintausendsechshunderteinundachtzig Jahre vor dem ersten Mord
Bourtanger Moor, Ostfriesland
Der Himmel war bleich und leer und schaute wolkenlos auf das flache, eintönige Moor hinunter.
Er schritt voller Stolz und Würde dahin. Seine Nacktheit machte ihn nicht verlegen und war nicht demütigend. Die Luft und die Sonne legten sich wie königliche Gewänder auf seine Haut. Sein dichtes, frisch gewaschenes und parfümiertes Haar glänzte golden im hellen Tageslicht. Gesichter, die er sein Leben lang gekannt hatte, säumten am Rand des Holzdamms seinen Weg, der über den sumpfigen Boden führte, und die Menschen jubelten seiner nackten Gestalt zu. Seine Begleiter gingen neben und hinter ihm: der Priester, der Häuptling, die Priesterin und die Ehrenwachen. Während er seinen Weg zurücklegte, erhoben sich überall bewundernde Stimmen. Unter den Gesichtern und Stimmen waren jene der Frauen, die, teils von nobler Geburt, sich in den vorangegangenen Tagen mit ihm vermählt hatten. Auch er war nun von hohem Rang, und man hatte seine niedrige Herkunft vergessen. Dieser Tag, dieser Akt erhöhten ihn über einen Häuptling oder König. Fast war er ein Gott.
Während er vorbeiging, begannen sie zu singen. Sie sangen von Anfang und Ende, von Wiedergeburt, von Sonnen und Monden und sich erneuernden Jahreszeiten. Von dem großen, wundersamen, geheimnisvollen Zyklus. Die Wiedergeburt, von der sie am häufigsten sangen, sollte die seine werden. Eine glorreiche Wiedergeburt. Er würde erneuert werden und zu einem besseren, reineren Leben zurückkehren. Seine Begleiter und er näherten sich dem Ende des Holzdamms, und an der Seite sah er die Haselnussäste, die man über ihn legen und mit Steinen beschweren würde, damit er nicht vor dem richtigen Zeitpunkt wieder auferstand. Sie erreichten das Ende des Dammes. Die glatte, glasartige Fläche des kleinen Bergsees öffnete sich vor ihnen und bot ein dunkles Spiegelbild des hellen Himmels dar.
Der Zeitpunkt war gekommen.
Der Mann spürte, wie das Herz in seiner Brust hämmerte. Er trat von dem Holzdamm hinunter und sah die Welt um sich herum in lebhafter Schärfe: den feuchten, nachgiebigen Mulch und das harte Sumpfgras unter seinen nackten Füßen; die Luft und die Sonne auf seiner Haut; die kräftigen Hände seiner beiden Ehrenwachen, die seine Oberarme packten. Gemeinsam wateten die drei Männer in den See hinein. Sie versanken bis zur Hüfte, und das kalte Wasser kribbelte an seinen Beinen und Genitalien. Er atmete schwer. Sein Herz pochte noch schneller, als wisse es, dass es bald still sein würde, und als versuche es, in diesen wenigen, letzten Sekunden noch so viele Schläge wie möglich zu vollziehen.
Er musste glauben. Dazu zwang er sich. Es war die einzige Möglichkeit, sich der Panik zu entziehen, die kreischend, doch ungehört und ungesehen von den Zuschauern, über den Holzdamm auf ihn zu raste.
Die Priesterin streifte ihre Gewänder ab und trat nackt in den See. Sie umklammerte das Opfermesser mit der Faust, die an ihre Brust gedrückt war. Die Klinge funkelte in der Sonne. Solch ein kleines Messer – als Krieger konnte er dieses Schmuckstück nicht mit seinem Lebensende in Verbindung bringen. Die Priesterin stand vor ihm, und das Wasser, dunkel auf ihrer blassen Haut, umgab ihre straffe Taille. Sie hob die Hand, legte sie auf seine Stirn und sang die Worte des Rituals.
Er fügte sich dem sanften Druck ihrer Hand, weil es seine Pflicht war, und legte sich zurück ins Wasser. Sein Kopf ging langsam unter, und das Wasser ließ einen trüben, torffarbigen Vorhang über das Tageslicht gleiten. Die beiden Ehrenwachen hielten immer noch seine Oberarme fest, und nun spürte er andere Hände an seinem Körper, an seinen Beinen. Seine Augen waren offen. Der dunkle, dichte Sumpf schien zu wirbeln, als könne er nicht entscheiden, welchem Element er wirklich angehörte: der Erde oder dem Wasser. Das goldene Haar des Mannes züngelte um seinen Kopf, doch der Glanz wurde durch das Torfwasser getrübt.
Er hielt den Atem an. Er wusste, dass er das nicht hätte tun sollen, doch sein Instinkt befahl ihm, die Luft in seiner Lunge, das Leben in seinem Körper zurückzuhalten. Seine Lunge ächzte nach mehr Luft, und zum ersten Mal widersetzte er sich der Hand der Priesterin. Sie gab den Druck nur sanft zurück, aber die Hände an seinen Armen und Beinen griffen noch fester zu, und er wurde tiefer unter die Wasseroberfläche gezwungen, bis die Farne und Steine am Grund des Bergsees über seinen Rücken schabten. Die Panik, die ihm entgegengerast war, erreichte ihn nun und verkündete, dass es keine Wiedergeburt, keinen Neubeginn geben werde. Nichts als den Tod. Sein Antwortschrei ließ eine Menge geballter Blasen entstehen, die durch die Dunkelheit schäumten, hinauf zu dem Tag, den er nie wieder sehen würde. Das kalte, brackige Wasser füllte seinen Mund und seine Kehle. Es schmeckte nach Erde und Würmern, nach Wurzeln und verwesenden Pflanzen. Nach Tod. Es drängte sich in seine protestierende Lunge. Er zuckte und krümmte sich, doch nun hielten ihn weitere Hände nieder und verbanden ihn mit seinem Tod.
Dann fühlte er den Kuss des Messers an seiner Kehle, und das wirbelnde Wasser wurde noch dunkler. Röter.
Doch er hatte sich geirrt. Es würde eine Wiedergeburt geben. Aber bevor er erneut das Tageslicht erblickte, würden mehr als sechzehn Jahrhunderte vergehen, und das Gold seiner Haare würde sich ein in brennendes Rot verwandeln.
Dann erst würde er wiedergeboren werden. Als der Rote Franz.
Oktober 1985, zwanzig Jahre vor dem ersten Mord
Bahnhof Nordenham, 125 Kilometer westlich von Hamburg
Der Bahnhof von Nordenham erhebt sich auf einem Deich über die Weser. An einem Oktobernachmittag wartete dort eine Familie auf einen Zug. Das große Bahnhofsgebäude, der Bahnsteig und die Eisengitter wurden von einer hellen, doch jeglicher Wärme entbehrenden Spätherbstsonne scharf umrissen.
Der Vater, die Mutter und das Kind standen am fernen Ende des Bahnsteigs. Der Mann war hochgewachsen, schlank und um Mitte dreißig. Sein recht langes, dichtes, fast zu dunkles Haar war streng aus einer breiten, blassen Stirn zurückgestrichen, doch ein paar Locken kräuselten sich rebellisch auf seinem Mantelkragen. Die langen schwarzen Koteletten, der Schnurrbart und der Spitzbart betonten die Blässe seiner Haut und das tiefe Rot seines Mundes. Die Mutter war nur ein paar Zentimeter kleiner als der Mann. Sie hatte graublaue Augen und langes, elfenbeinblondes Haar, das unter einer gestrickten Wollmütze glatt hinunterhing. Sie trug einen braunen, knöchellangen Mantel, und an ihrer Schulter hing eine mächtige, bunte Makrameetasche an einem langen Riemen. Der Junge war vielleicht zehn Jahre alt und schien den hohen Wuchs seiner Eltern geerbt zu haben. Wie sein Vater hatte er ein blasses, trauriges Gesicht unter einem lockigen, widerspenstigen schwarzen Haarschopf.
»Warte hier mit dem Jungen«, sagte der Vater entschieden, doch freundlich. Er schob eine aschblonde Strähne zurück, die der Mutter in die Stirn gefallen war. »Ich gehe allein auf Piet zu, wenn er eintrifft. Sobald es Schwierigkeiten gibt, verschwinde mit dem Jungen aus dem Bahnhof.«
Die Frau nickte entschlossen, doch in ihren Augen glänzte kalte Furcht. Der Mann lächelte ihr zu und drückte ihren Arm, bevor er sich von ihr und dem Jungen entfernte und zur Mitte des Bahnsteigs ging. Ein Angestellter der Deutschen Bundesbahn kam aus dem Instandhaltungsbüro, ließ sich vom Bahnsteig auf das Gleis nieder und schlenderte in selbstgefälliger Haltung diagonal über die Schienen. Eine Frau noch nicht ganz mittleren Alters, bekleidet mit der teuren Geschmacklosigkeit der westdeutschen Bourgeoisie, verließ das Fahrkartenbüro und blieb etwa zehn Meter zur Rechten des Mannes stehen. Dieser schien das Treiben nicht zu beachten, aber in Wirklichkeit folgten seine Augen jeder Bewegung auf dem Provinzbahnhof.
Eine weitere Gestalt trat aus dem Fahrkartenbüro auf den Bahnsteig. Auch dieser Mann war hochgewachsen und schlank. Er hatte sein langes blondes Haar zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, und sein schmales, eckiges Gesicht war mit alten Aknenarben übersät. Er versuchte, einen lässigen, gleichgültigen Eindruck zu erwecken, doch im Unterschied zu dem dunkelhaarigen Mann ließen seine Augen eine nervöse Intensität und jeder seiner Schritte eine elektrische Spannung erkennen.
Nun waren sie nur noch einen Meter voneinander entfernt. Ein breites Lächeln lockerte das Gesicht des dunkelhaarigen Mannes. »Piet!«, sagte er freudig, doch leise.
Der Blonde lächelte nicht. »Ich habe dir doch abgeraten.« Sein Deutsch war durch einen zischenden niederländischen Akzent gekennzeichnet. »Ich habe dich gebeten, nicht zu kommen. Das war ein wirklich schlechter Einfall.«
Das Lächeln des Dunkelhaarigen blieb unverändert, und er hob gleichmütig die Schultern. »Unsere ganze Lebensweise ist nicht ratsam, mein Freund, aber absolut notwendig. Genau wie dieses Treffen. Mein Gott, Piet… Es ist schön, dich wiederzusehen. Hast du das Geld mitgebracht?«
»Es gibt ein Problem«, erwiderte der Holländer.
Der Dunkelhaarige blickte über den Bahnsteig zu der Frau und dem Jungen hinüber. Als er sich dem Holländer wieder zuwandte, lächelte er nicht mehr. »Was für ein Problem? Wir brauchen das Geld zum Reisen. Damit wir einen neuen Unterschlupf finden und einrichten können.«
»Es ist vorbei, Franz«, sagte der Holländer. »Seit langem schon, und wir hätten es akzeptieren sollen. Die anderen … sind der gleichen Meinung.«
»Die anderen?«, schnaubte der Dunkelhaarige. »Von denen erwarte ich nichts. Das sind bloß ein paar spießige Arschlöcher, die sich als Aktivisten ausgeben. Halb engagiert und halb ängstlich. Schwächlinge, die so tun, als wären sie stark. Aber du, Piet … von dir erwarte ich mehr.« Er lächelte erneut. »Komm schon, Piet. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Ich … wir brauchen dich.«
»Es ist vorbei. Begreifst du das nicht, Franz? Es wird Zeit, dass wir dieses Leben hinter uns lassen. Ich kann es einfach nicht mehr, Franz. Mein Glaube ist weg.« Der Holländer machte ein paar Schritte zurück. »Wir haben verloren, Franz. Wir haben verloren.« Er wich weiter zurück, sodass sich die Distanz zwischen ihnen vergrößerte. Dann schaute er besorgt von rechts nach links. Der dunkelhaarige Mann folgte seinen Blicken, konnte jedoch nichts entdecken. Trotzdem merkte er, wie sich seine Brust zusammenschnürte. Seine Hand schloss sich um die 9 mm Makarow in seiner Manteltasche. Die Augen des Holländers flackerten, als er fortfuhr: »Es tut mir leid, Franz … Es tut mir so leid …« Er drehte sich um und lief davon.
All das geschah innerhalb von Sekunden, doch die Zeit schien sich zu dehnen.
Der Holländer rief einem Unsichtbaren etwas zu. Der Bahnarbeiter, eine glänzende schwarze Automatik in den ausgestreckten Händen, kam auf die Mutter und den Sohn zu. Gleichzeitig ließ sich die bourgeoise Hausfrau erstaunlich behände auf ein Knie fallen und zog eine Pistole aus ihrem Mantel. Sie zielte auf den hochgewachsenen, dunkelhaarigen Mann und schrie, er solle die Hände auf den Kopf legen. Der wandte sich jäh zu der Mutter und dem Jungen um. Ihre Hand steckte tief in ihrer Schultertasche, die vorn aufplatzte und Feuer fing, als sie den Abzug der darin verborgenen Heckler-&-Koch-Maschinenpistole durchdrückte. Gleichzeitig stieß sie den Jungen mit einer heftigen Bewegung zur Seite und zu Boden. Die Salve aus der Maschinenpistole zerriss den Overall des angeblichen Eisenbahnangestellten auf der Brust und zerfleischte sein Gesicht. Dann wirbelte die Mutter herum und richtete die Maschinenpistole, immer noch in der aufgeplatzten und rauchenden Makrameetasche, auf die als Hausfrau verkleidete Polizistin. Diese zielte nun nicht mehr auf den Mann, sondern auf die Frau und feuerte zweimal und dann noch zweimal. Ihre Kugeln trafen die Mutter in Brust, Gesicht und Stirn, und sie war tot, bevor ihr Körper auf den Bahnsteig stürzte.
Der Dunkelhaarige sah die Frau sterben, aber er hatte keine Zeit, um sie zu trauern. Er hörte das Brüllen eines Dutzends GSG9-Beamter mit Helmen und kugelsicheren Westen, die aus dem Bahnhofsgebäude und von den Seiten her auf den Bahnsteig rannten. Einige winkten dem Holländer wütend zu, damit er aufhörte zu laufen und sich aus ihrer Schusslinie entfernte. Die Polizistin richtete ihre Pistole nun wieder auf den dunkelhaarigen Mann. Er riss seine schwere russische Makarow aus der Manteltasche, zielte jedoch nicht auf die Polizistin oder einen der GSG9-Beamten.
Die Kugel der Polizistin grub sich im selben Moment in seine Brust, als seine eigene in den Hinterkopf des Holländers eindrang.
Franz Mühlhaus – der Rote Franz, der berüchtigte Anarchist und Terrorist, dessen bleiches Gesicht erschrockene Westdeutsche von Fahndungsplakaten zwischen Kiel und München angestarrt hatte – sank auf die Knie. Seine Arme hingen an seinen Seiten, die Makarow-Automatik lag in seiner schlaffen, halb geöffneten Hand, und sein Kinn ruhte auf seiner blutbefleckten Brust.
Im Sterben konnte er gerade noch das blasse Gesicht seines Sohnes erkennen, der die Augen und den Mund weit aufgerissen hatte und einen stummen Schrei ausstieß. Irgendwie fand der Rote Franz Mühlhaus die Kraft, mit seinem letzten Atemzug ein einziges Wort auszustoßen.
»Verräter.«
Erster Teil
1.
Montag, den 15. August 2005, drei Tage vor dem ersten Mord
List, Insel Sylt, 200 Kilometer nordwestlich von Hamburg
Es war ein Moment, an den er sich klammern wollte. Seine Sinne drangen in jeden Winkel des Landes, des Meeres und des Himmels vor. Er stand barfüßig da und fühlte die Beschaffenheit des trockenen Sandes, der unter seinen Sohlen scheuerte und sich zwischen seine Zehen presste. Es war, als könne er sich nur an diesen Ort, an diese Zeit erinnern. Hier gab es keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur diesen perfekten Moment. Sylt lag lang, schmal und niedrig in der Nordsee und bildete kein Hindernis für den hastenden Wind, der über den riesigen Himmel zog und sich der solideren Flanke Dänemarks näherte. Der Wind protestierte über seine Anwesenheit und zerrte wütend am Stoff seiner Jeans, packte die lockeren Schöße und den Kragen seines Hemdes und ließ die blonde Haarsträhne über seiner Stirn flattern. Er fegte über sein Gesicht und schob sich in seine Falten, und der Mann sah zu, wie die Wolken über dem mächtigen, hellblauen Schild des Himmels dahineilten.
Jan Fabel war etwas über mittelgroß und Anfang vierzig, aber eine gewisse Jungenhaftigkeit verharrte, als wolle sie sich nicht vertreiben lassen, in seiner Erscheinung, seiner schlanken, eckigen Gestalt und seinem wehenden blonden Haar. Seine Augen waren hellblau und glänzten vor Intelligenz und Witz, doch nun waren sie in dem zerknitterten Gesicht, das er dem wütenden Wind darbot, zu schmalen Schlitzen geworden. Er war gebräunt und unrasiert, und so, wie die Spuren seiner Jungenhaftigkeit auf seine früheren Jahre hindeuteten, kündigte das Silber in seinem goldenen Dreitagebart den älteren Mann künftiger Jahre an.
Eine Frau kam aus den Dünen hinter Fabel auf ihn zu. Sie war so groß wie er und trug ein Hemd und eine Hose aus weißem Leinen. Auch sie war barfuß, doch sie trag ein Paar Sandalen mit niedrigen Absätzen in der Hand. Der Wind umhüllte sie ebenfalls, glättete das weiße Leinen an den Kurven ihres Körpers und machte ihr langes, dunkles Haar zu wilden Seilen. Fabel bemerkte Susanne nicht. Sie stellte sich hinter ihn, ließ die Schuhe in den Sand fallen und schob die Arme durch die seinen und um seinen Körper. Er küsste sie lange, bevor sie sich beide wieder dem Meer zuwandten.
»Ich habe gerade gedacht«, sagte er schließlich, »dass man, wenn man hier steht, fast vergessen könnte, wer man ist.« Er betrachtete seine nackten Füße und ließ den Zeh über den Sand gleiten. »Es war herrlich. Ich bin so froh, dass du mitgekommen bist. Wenn wir bloß nicht schon morgen abreisen müssten.«
»Es war großartig. Wirklich. Aber leider müssen wir zu unserem Leben zurückkehren …« Susanne lächelte tröstend, ihre Stimme hatte einen leicht bayerischen Klang. »Es sei denn, du fragst deinen Bruder, ob er noch einen Kellner benötigt.«
Fabel atmete tief ein und hielt die Luft an. »Wäre das denn so schlimm? Nichts mit all dem Blödsinn und dem Stress zu tun zu haben?«
Sie lachte. »Du hast offensichtlich noch nie als Kellner gearbeitet.«
»Ich könnte etwas anderes machen. Irgendetwas anderes.«
»Nein, das könntest du nicht«, widersprach sie. »Ich kenne dich. Du würdest deinen Beruf innerhalb eines Monats vermissen.«
Er zuckte die Achseln. »Vielleicht hast du recht. Aber hier scheine ich ein anderer Mensch zu sein. Jemand, der ich lieber bin.«
»Das hat nur mit dem Urlaub zu tun …« Der Wind blies einen Haarschleier über ihr Gesicht, und sie zerrte ihn zur Seite.
»Nein, es hat damit zu tun, dass ich hier bin. Das ist nicht das Gleiche. Sylt ist für mich immer etwas Besonderes gewesen. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hierhergekommen bin. Ich hatte das Gefühl, die Insel mein ganzes Leben lang zu kennen. Hier habe ich mich von meiner Schusswunde erholt.« Seine Hand strich unwillkürlich über seine linke Seite, als wolle er sich vergewissern, dass die zwei Jahrzehnte alte Verletzung wirklich geheilt war. »Ich werde diesen Ort wohl immer mit meiner Genesung verknüpfen. Damit, mich sicher und ungestört zu fühlen.« Er lachte. »Manchmal, wenn ich an die Welt da draußen denke …« Er nickte über das Meer hinweg zur unsichtbaren Masse des europäischen Kontinents. »… an die Welt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, habe ich Angst. Du nicht?«
Sie nickte. »Manchmal ja.« Susanne legte den Arm um ihn und ließ ihre Hand auf seiner ruhen – dort, wo die Wunde gewesen war. Sie küsste ihn auf die Wange. »Mir wird kalt. Komm, lass uns essen gehen.«
Fabel erlaubte dem Wind der Nordsee noch ein paar Sekunden, über sein Gesicht zu streichen, und beobachtete die Wellen, die schäumend auf den breiten Strand krachten, und die wenigen Wolken, die über den gewaltigen Himmel getrieben wurden. Er lauschte dem Schreien der Meeresvögel und dem Brüllen des Ozeans und wünschte sich verzweifelt, eine Alternative zum Kellnerberuf zu finden. Oder eine Alternative dazu, wieder ein Ermittler des Todes zu werden.
Er drehte sich um und folgte Susanne zu den Dünen und zum dahinter liegenden Hotel und Restaurant seines Bruders.
Die nordfriesische Insel Sylt befindet sich fast genau auf der Höhe der Küstenlinie, wo Deutschland in Dänemark übergeht. Sie ist mit dem Festland durch den schmalen Hindenburgdamm verbunden, über den eine Eisenbahnlinie die Reichen und Berühmten Deutschlands zu ihrem beliebtesten inländischen Urlaubsort bringt. Die Insel besitzt einen Flughafen und einen Fährendienst zum Festland, und im Sommer sind die engen Straßen und die idyllischen Dörfer voll von glänzenden Mercedessen und Porsches.
Fabels älterer Bruder Lex spielte auch darauf an, dass sein Hotel ursprünglich ein Bauernhaus gewesen war, wenn er diese vermögenden saisonalen Zuwanderer als seine »Sommerherde« bezeichnete. Seit fünfundzwanzig Jahren betrieb Lex sein kleines Hotel und Restaurant in List an der Nordspitze von Sylt. Sein unbestreitbares Talent als Koch sowie der unverstellte Ausblick auf eine Sichel goldenen Sandes und das Meer dahinter garantierten während der Saison einen stetigen Strom von Hotel- und Restaurantgästen.
Das Hotel besaß noch seine ursprüngliche Fachwerkfassade aus Eichenbalken und bot den Nordseewinden mit seinem breiten Dach und seinen soliden Mauern energischen Widerstand. Lex hatte dem Bauernhof einen modernen Restaurantanbau, der sich an zwei Seiten des ursprünglichen Hauses schmiegte, hinzugefügt. Das Hotel hatte nur sieben Gästezimmer, die alle monatelang im Voraus ausgebucht waren. Außerdem verfügte Lex über eine kleine Suite mit niedriger Decke und breiten Balken unter den Dachsparren des alten Hauses. Diese Zimmer vermietete er nie, sondern stellte sie Verwandten und Freunden zur Verfugung – vor allem seinem Bruder.
Fabel und Susanne gingen gegen 20 Uhr zum Essen hinunter. Das Restaurant war bereits mit eleganten, vermögend wirkenden Besuchern gefüllt, aber wie immer während ihres Aufenthalts hatte Lex am Panoramafenster einen der besten Tische für Fabel und Susanne reserviert. Susanne trug nun ein schwarzes, ärmelloses Kleid. Sie hatte ihr langes, rabenschwarzes Haar hochgebunden, sodass ihr schlanker Hals entblößt war. Das Kleid lag eng an ihrem Körper an, und der Saum endete hoch genug über ihren Knien, um ihre wohlgeformten Beine erkennen zu lassen, doch niedrig genug, um zurückhaltend und geschmackvoll zu erscheinen. Fabel war sich Susannes Schönheit durchaus bewusst, genau wie der Reaktion der Männer, deren Köpfe sich in ihre Richtung drehten. Die Beziehung der beiden war mehr als ein Jahr alt, und sie hatten die unbequemen Stadien der gegenseitigen Entdeckung hinter sich gelassen. Sie waren nun ein festes Paar, und Fabel fühlte sich sicher und behaglich. Und wenn seine Tochter Gabi Susanne und ihn besuchte, hatte er zum ersten Mal seit seiner Scheidung von Renate das Gefühl, Teil einer Familie zu sein.
Boris, der tschechische Oberkellner, führte sie zu ihrem Tisch. Die niedrig stehende Sonne hatte die Streifen Sand, Meer und Himmel, die das Panoramafenster ausfüllten, in goldenere Farbtöne getaucht. Nachdem sie Platz genommen hatten, fragte Boris sie in seinem liebenswert akzentuierten Deutsch, ob sie vor der Mahlzeit etwas trinken wollten. Sie bestellten Weißwein, und Susanne gab sich dem üblichen Restaurantritual hin, indem sie es sich auf ihrem Stuhl bequem machte und die anderen Gäste musterte. Jemand hinter Fabels Schulter schien ihre Aufmerksamkeit zu wecken.
»Ist das nicht Berthold Müller-Voigt, der Hamburger Senator?«
Fabel wollte sich umdrehen, doch Susanne legte ihm die Hand auf den Unterarm und drückte zu. »Um Himmels willen, Jan, mach’s nicht so offensichtlich. Für einen Polizisten hast du eine ziemliche plumpe Art, andere zu observieren.«
Er lächelte. »Das würde meine kümmerliche Verurteilungsquote erklären …« Nun machte er einen bewusst ungeschickten Versuch, den Blick durch das gesamte Restaurant schweifen zu lassen. Links hinter ihm saß ein kräftig aussehender Mann von Anfang fünfzig. Er trug ein dunkles Jackett und einen Rollkragenpullover; beide ließen die künstliche Lässigkeit einer überaus teuren Designer-Marke erkennen. Das Haar des Mannes, das Geheimratsecken aufwies, war straff zurückgekämmt, und etwas Grau sprenkelte seinen säuberlich gestutzten Bart. Er hatte das bemüht künstlerische Äußere eines erfolgreichen Filmregisseurs, Musikers, Schriftstellers oder Bildhauers. Fabel kannte ihn jedoch als jemanden, dessen Kunst aus streitlustiger Politik bestand. Die schlanke, blonde Frau an seinem Tisch war mindestens zwanzig Jahre jünger als er. Sie balancierte auf ihrem Stuhl und strahlte eine ungehemmte Sinnlichkeit aus. Ihre Augen verschränkten sich eine Sekunde lang mit denen Fabels. Der wandte sich daraufhin wieder Susanne zu.
»Du hast recht. Es ist Müller-Voigt. Ich bin sicher, Lex wird sich darüber freuen, dass sein Restaurant cool genug ist, um die Lieblinge der linken Umweltschützer anzuziehen.«
»Wer ist seine Begleiterin?«
Fabel grinste vergnügt. »Weiß ich nicht, aber sie ist ganz bestimmt umweltfreundlich.«
Susanne neigte den Kopf ein wenig zur Seite – ein für sie typisches Zeichen von Konzentration. »Ich bin mir sicher, dass ich sie schon mal gesehen habe. Es ist schwer, über seine sexuellen Abenteuer auf dem Laufenden zu bleiben. Er scheint die Schlagzeilen in der Boulevardpresse zu genießen.«
»Aber nicht die Schlagzeilen, die Ingrid Fischmanns Artikel über ihn ausgelöst hat.« Fabel sprach von einer Journalistin, die es sich zum Anliegen gemacht hatte, Personen des öffentlichen Lebens, die in den Siebzigern und Achtzigern mit dem linken Extremismus oder gar dem Terrorismus geflirtet hatten, zu »outen«.
»Glaubst du, dass es stimmt, Jan?« Susanne beugte sich geradezu verschwörerisch vor. »Ich meine, dass er was mit dem Fall Wiedler zu tun hatte?«
»Das weiß ich nicht … Es gibt eine Menge Spekulationen und Indizien. Allerdings nichts, was der Polizei Hamburg konkrete Hinweise liefern könnte.«
»Aber?«
Fabel verzog das Gesicht, als dächte er über Unwägbares nach. »Aber wer weiß, was das Bundeskriminalamt über ihn gesammelt hat.« Fabel hatte Ingrid Fischmanns Artikel über Müller-Voigt gelesen, in dem sie auf die Entführung und spätere Ermordung des reichen Hamburger Industriellen Thorsten Wiedler im Jahr 1977 einging. Wiedler hatte seinem Chauffeur befohlen, am Schauplatz eines scheinbar schweren Verkehrsunfalls anzuhalten. Der Unfall war durch Mitglieder von Franz Mühlhaus’ berüchtigter Terroristenbande vorgetäuscht worden. Mühlhaus hatte in der Öffentlichkeit den Spitznamen Roter Franz erhalten. Die von ihm angeführte Terroristengruppe war so nebulös gewesen wie ihre Politik, und man hatte Mühlhaus als Einzigen aufgespürt.
Die Roter-Franz-Bande hatte Wiedlers Chauffeur angeschossen, den Industriellen auf die Ladefläche eines Lieferwagens gestoßen und war davongefahren. Der Chauffeur hatte seine Verletzungen knapp überlebt. Wiedler sollte seine Gefangenschaft jedoch nicht überstehen. Was genau ihm zugestoßen war, blieb ein Rätsel. Das letzte bekannte Bild Wiedlers zeigte sein lädiertes und von einem Blitzlicht grell ausgeleuchtetes Gesicht über einer Zeitung mit Datum. Er schaute traurig aus einem Foto hervor, das die Entführer seiner Familie und den Medien geschickt hatten. Sie verkündeten, der Industrielle sei »hingerichtet« worden, doch sie hatten seine Leiche, anders als bei anderen Terroropfern, nicht an einem zugänglichen Ort zurückgelassen. Dadurch wurde das Datum von Wiedlers Tod verschleiert, und es gab keine Möglichkeit, seine Leiche nach forensischen Spuren abzusuchen. Trotz Hunderter von Verhaftungen und der Tatsache, dass man die Schuld von Mühlhaus’ Grupp’e an der Entführung kannte, war niemand wegen des Mordes verurteilt worden.
In ihrem Artikel hatte die Journalistin Ingrid Fischmann auf die Tatsache verwiesen, dass Berthold Müller-Voigt, damals eine viel radikalere politische Gestalt, festgenommen und 48 Stunden lang von der Polizei verhört worden war. Damals hatte man sich im Rahmen der verzweifelten Suche nach Wiedler fast jeden politischen Aktivisten vorgenommen. Aber Ingrid Fischmann hatte mit dem Hinweis geschlossen, dass zwar nichts über die anderen Mitglieder der Terroristengruppe bekannt sei, doch dass der Fahrer des Lieferwagens, mit dem man Wiedler entführt hatte, inzwischen zur Prominenz zählte. Sie überließ es ihren Lesern zu vermuten, dass es sich bei dem Fahrer um Müller-Voigt gehandelt hatte, ohne eine direkte Beschuldigung auszusprechen, auf deren Grundlage er sie hätte verklagen können.
Fabel blickte sich erneut nach dem kleinen, künstlerhaft aussehenden Mann mit der sexy blonden Gefährtin um. Sie führten ein Gespräch, ohne einander anzuschauen. Ihre Mienen waren leer, als füllten sie mit ihren Worten lediglich das Schweigen zwischen den Bissen. Müller-Voigt schien kaum als Terrorismusverdächtiger in Frage zu kommen, aber früher hatte er eine radikale politische Einstellung vertreten. In den Siebzigern und Achtzigern war er mit Daniel Cohn-Bendit, Joschka Fischer und anderen linken und grünen Prominenten umgegangen. Nun stand er für eine schwer festzumachende Politik. Doch trotz seiner verworrenen Haltung hatte er es geschafft, in die Hamburger Bürgerschaft gewählt und zum Umweltsenator im Hamburger Senat des Ersten Bürgermeisters Hans Schreiber ernannt zu werden.
»Wie auch immer«, schloss Fabel, »wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wie stark er beteiligt war.«
Boris kehrte zurück und nahm ihre Bestellungen auf. Während ihrer Mahlzeit widmeten sie sich der müßigen, etwas melancholischen Unterhaltung eines Paares, welches das Ende eines sehr erfreulichen Urlaubs erreicht hat. Mittlerweile verschmolz die Sonne langsam mit dem Meer und verlieh dem Wasser ihre Farbe. Susanne und Fabel ließen sich Zeit, bis nur noch ein paar Tische besetzt waren und das Summen der Gespräche leiser wurde. Als der Kaffee eintraf, kam Fabels Bruder Lex aus der Küche an ihren Tisch. Er war deutlich kleiner als Fabel und hatte dichte, dunkle Haare. Sein zerknittertes Gesicht machte den Eindruck, als habe es ein Leben lang gelächelt. Fabels Mutter war Schottin, doch alle keltischen Gene schienen sich auf seinen Bruder konzentriert zu haben. Lex, obwohl älter als Fabel, hatte innerlich stets jünger gewirkt. Während ihrer Kindheit in Norddeich war es immer der vernünftigere Fabel gewesen, der seinen älteren Bruder aus allerlei Klemmen befreit hatte. Damals war Fabel durch Lex’ Unreife gereizt worden, doch nun beneidete er seinen Bruder um dessen jugendliche Unbeschwertheit.
Lex trug noch seinen Küchenkittel und seine karierte Hose. Obwohl seine gutmütigen Züge ihr gewohntes Lächeln aufsetzten, verrieten seine Bewegungen eine gewisse Ermüdung.
»Ein langer Abend?«, fragte Fabel.
»Jeder Abend ist ein langer Abend«, erwiderte Lex und zog einen Stuhl heran. »Und wir sind erst am Anfang der Saison.«
»Das war wirklich eine wunderbare Mahlzeit, Lex«, sagte Susanne. »Wie immer.«
Lex beugte sich vor, hob Susannes Hand an seine Lippen und küsste sie. »Du bist sehr intelligent und wahrnehmungsfähig, Susanne. Weshalb ich umso schwerer verstehen kann, wieso du den falschen Bruder erwischt hast.«
Susanne lächelte breit und wollte etwas sagen, als der Lärm erhobener Stimmen die Aufmerksamkeit aller Anwesenden zum Ecktisch lenkte. Müller-Voigts Gefährtin sprang plötzlich auf, schob ihren Stuhl mit einem Scharren zurück und schleuderte ihre Serviette auf den Dessertteller. Sie zischte dem immer noch sitzenden Müller-Voigt etwas zu und marschierte aus dem Restaurant. Müller-Voigt starrte auf seinen Teller, als wolle er dort ablesen, was zu tun sei. Dann winkte er Boris mit seiner Kreditkarte zu sich, bezahlte, ohne die Rechnung zu prüfen, und verließ das Restaurant, wobei er keinen Blick auf die anderen Gäste warf.
»Vielleicht hatte es etwas mit seiner Treibhausgaspolitik zu tun«, meinte Fabel grinsend.
»Er ist in diesem Monat ein paar Mal hier gewesen«, sagte Lex. »Anscheinend hat er ein Haus auf der Insel. Ich weiß nicht, wer die Frau ist, aber sie begleitet ihn nicht immer. Vermutlich wird sie nun auch nicht wiederkommen.«
Susanne musterte die Tür, durch die Müller-Voigt und die Frau verschwunden waren, und schüttelte den Kopf, als wolle sie ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. »Ich bin sicher, dass ich ihr schon einmal begegnet bin.« Sie nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. »Aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wo.«
2.
Donnerstag, den 18. August 2005, der Abend des ersten Mordes
Schanzenviertel, Hamburg, 22.15 Uhr
Die Kunst bestand darin, unbemerkt zu bleiben. Er wusste, wie die Dinge funktionierten und dass der bedeutungslose Blick eines Passanten ins Auto, scheinbar innerhalb von Sekunden vergessen, doch nach einer Woche oder einem Monat durch einen Ermittler mit einem Dutzend anderer Belanglosigkeiten zu einer Einheit zusammengefügt, die Polizei direkt zu ihm führen konnte. Er musste seine Anwesenheit am Tatort, in der unmittelbaren Umgebung, in der Gegend so unauffällig wie möglich gestalten.
Also blieb er ohne eine Bewegung in der Dunkelheit und der Stille sitzen. Er wartete auf den Moment der Konvergenz.
Das Hamburger Schanzenviertel ist bekannt für seine Lebendigkeit, und sogar derart spät an einem Donnerstagabend herrschte noch ein reges Treiben. Aber diese schmale Seitenstraße war von Autos gesäumt und ruhig. Dadurch, dass er seinen eigenen Wagen benutzte, nahm er ein kalkuliertes Risiko auf sich. Es war jedoch ein dunkler VW Polo, der unter all den anderen geparkten Autos nicht auffiel. Niemand würde ihn bemerken, doch vielleicht würde jemand auf den darin sitzenden Mann aufmerksam werden. Auf den wartenden Mann.
Zuvor hatte er das Autoradio angestellt und sich von dem leisen Geplauder einhüllen lassen. Er war allerdings zu vertieft gewesen, um zuzuhören. Sein Geist, von unverfälschter Vorfreude erfüllt, hatte sich nicht einmal zu der Verachtung aufgeschwungen, welche die Berichte über den Wahlkampf der verschiedenen Bewerber um die Kanzlerschaft gewöhnlich in ihm auslösten. Dann, als sich der Zeitpunkt näherte, als sein Mund trocken wurde und sein Puls sich beschleunigte, hatte er das Radio abgestellt.
Nun saß er in der Dunkelheit und Stille da und kämpfte gegen die Emotionen an, die in seinem tiefsten Innern aufwallten. Er musste ganz in dem Moment aufgehen, alles ausschalten und sich konzentrieren. Disziplin war gefordert. Die Japaner hatten ein Wort dafür: sanshin. Er musste sanshin erreichen, den Zustand des Friedens und der Gelassenheit, der völligen Furchtlosigkeit im Angesicht von Gefahr oder Herausforderung, der es Geist und Körper ermöglicht, mit tödlicher Genauigkeit und höchster Leistungskraft zu funktionieren. Jedoch konnte er das Gefühl, dass sich ein denkwürdiges Geschick erfüllen würde, nicht unterdrücken. Nicht nur er selbst hatte sich seit vielen Jahren auf diesen Moment vorbereitet; mehr als ein einziges Leben war dem Ziel gewidmet worden, ihn an diesen Ort und in diese Zeit zu bringen. Der Konvergenzpunkt war nahe. Nur noch Sekunden entfernt.
Behutsam legte er den samtenen Faltbeutel auf den Beifahrersitz. Er ließ seinen Blick die Straße hinauf und hinab schweifen, bevor er das Schleifenband öffnete und den Beutel flach aufrollte. Die Klinge funkelte hell, scharf und schön in der Straßenbeleuchtung. Er stellte sich vor, wie ihre Schneide das Fleisch durchtrennte. Es vom Knochen abschnitt. Mit diesem Instrument würde er ihre verräterischen Stimmen verstummen lassen. Er würde die Klinge benutzen, um eine glänzende Stille zu erzeugen.
Eine Bewegung.
Er schlug den dunkelblauen Samtstoff um, damit die herrliche Klinge zugedeckt war. Dann legte er die Hände aufs Lenkrad und schaute geradeaus, als das Fahrrad an dem Auto vorbeirollte. Er beobachtete den Fahrer, der, während das Rad sich noch bewegte, ein Bein nach hinten schwang, bevor er im Laufen abstieg. Der Fahrer holte ein Kabelschloss aus einer Gepäcktasche hervor und schob das Rad in den Gang neben dem Gebäude. Der Mann lachte leise, als er dem kleinen Sicherheitsritual des Radfahrers zusah. Es ist nicht mehr nötig, dachte er. Lass es ruhig von jemandem stehlen. Du wirst es in diesem Leben nicht mehr brauchen.
Der Radfahrer kam aus dem Gang hervor, zog seine Schlüssel aus der Tasche und öffnete die Wohnungstür.
In der Dunkelheit des Autos zog der Mann ein Paar Operationshandschuhe aus Latex über die Hände. Er griff nach hinten, nahm eine Kosmetiktasche vom Rücksitz und legte sie neben den Faltbeutel.
Konvergenz.
Eine große Ruhe überkam ihn. Sanshin. Nun wurde der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Nun würde das Töten beginnen.
3.
Freitag, den 19. August 2005, der Tag nach dem ersten Mord
Schanzenviertel, Hamburg, 8.57 Uhr
Sie blieb eine Sekunde lang stehen, schaute zum Himmel und kniff die Augen zusammen, um sich vor der Morgensonne zu schützen, die so optimistisch auf das Schanzenviertel schien. Es war ihr erster Termin an diesem Tag. Sie warf einen Blick auf die Uhr und gestattete sich ein kleines, straffes Lächeln der Genugtuung. 8.57 Uhr, drei Minuten vor der Zeit.
Auf nichts war Kristina Dreyer stolzer als darauf, sich nie zu verspäten. Wie in vielen anderen Bereichen ihres Lebens hatte Kristina Zwangsvorstellungen, was Pünktlichkeit anging. Es war ein Teil ihrer Umwandlung, ihrer Vorstellung von der Person, die sie geworden war. Kristina Dreyer hatte das Chaos kennengelernt, und zwar auf eine Weise, die sich kaum jemand ausmalen konnte. Es hatte sie verschlungen, ihrer Würde, ihrer Jugend beraubt, und, was am wichtigsten war, ihr jegliches Gefühl der Kontrolle über ihr Leben genommen.
Aber nun hatte sich Kristina gefangen. Während ihr Leben früher aus Anarchie und undurchdringlichem Durcheinander bestanden hatte, war es jetzt durch die genaue Regelung jedes Tages gekennzeichnet. Kristina Dreyer hing einer kompromisslosen Präzision an. Alles an ihr war einfach, sauber und ordentlich: ihre Kleidung, ihre Arbeitssachen, ihre kleine, makellose Wohnung, ihr VW Golf mit der Beschriftung »Reinigungsdienst Dreyer« an den Türen – und ihr Leben, das sie, wie ihre Wohnung, mit niemandem teilte.
Kristinas kompromisslose Präzision war für ihre Arbeit von entscheidender Bedeutung. In Eimsbüttel hatte sie sich einen großen Kundenstamm aufgebaut, der ihre ganze Woche in Anspruch nahm. Alle vertrauten ihrer Gründlichkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.
Kristina leistete vorzügliche Arbeit. Sie reinigte Wohnungen und Villen, große und kleine Häuser für junge und alte, deutsche und ausländische Kunden. Jedem Heim und jeder Aufgabe näherte sie sich mit der gleichen Gewissenhaftigkeit. Kein Detail wurde ausgelassen, keine Mühe gescheut.
Sie war eine kleine, recht dünne Frau von sechsunddreißig Jahren, sah jedoch viel älter aus. Weniger als ein Dutzend Jahre zuvor, doch eine Ewigkeit entfernt, hatte sie feine, zarte Gesichtszüge gehabt. Nun jedoch schien ihre Haut zu straff an ihrem eckigen Schädel anzuliegen. Ihre hohen, scharfen Wangenknochen stießen aggressiv aus ihrem Gesicht hervor, und die sich darüber spannende Haut war ein wenig gerötet und rau. Ihre Nase war klein, doch Knochen und Knorpel auf dem Nasenrücken schienen gegen die Einengung zu protestieren und wiesen auf einen lange zurückliegenden Bruch hin.
Drei Minuten zu früh. Ihr Lächeln verflüchtigte sich. Ein frühzeitiges Erscheinen war fast so schlimm wie eine Verspätung. Nicht, dass der Kunde etwas davon erfahren würde – Herr Hauser musste bereits an seinem Arbeitsplatz sein. Aber Kristinas Pünktlichkeit war erforderlich, damit die Ordnung ihres Universums erhalten blieb und sich darin keine Zufälligkeit verbreitete, die krebsartig in ein gesundheits- und lebensbedrohendes Chaos überging. So wie früher.
Sie drehte den Schlüssel um, öffnete die Tür und drückte mit dem Rücken dagegen, um ihren Staubsauger in den Flur zu bugsieren.
Kristina sah es so, dass sie sich selbst zur Welt gebracht hatte. Zwar war sie kinderlos, und es gab keinen Mann, der als Erzeuger ihrer Kinder in Frage gekommen wäre, aber sie hatte sich selbst neu erschaffen und die Vergangenheit überwunden. »Lass nicht zu, dass die Geschehnisse bestimmen, wer du bist und was aus dir wird«, hatte ihr jemand geraten, als sie ihren Tiefpunkt erreicht hatte. Das war die Wende gewesen, und alles hatte sich geändert. Sie hatte ihr altes Leben, ihr finsteres Leben aufgegeben. Weggeworfen. Vergessen.
Aber nun, als Kristina Dreyer auf der Schwelle der Wohnung stand, die sie an jenem hellen Freitagmorgen reinigen sollte, griff ihr altes Leben nach ihr und umfasste ihre Kehle mit unerbittlicher Kraft.
Der Geruch. Der üppige, ekelerregende, kupferartige Gestank von schalem Blut hing in der Luft. Sie erkannte ihn sofort und begann zu zittern.
Der Tod war hier.
Hamburg-Eppendorf, 9 Uhr
Die Angst war ganz tief verborgen. Der flüchtige Beobachter hätte nichts an ihrem Verhalten bemerkt, das nicht auf Zuversicht und absolutes Selbstbewusstsein hindeutete. Aber Dr. Minks war kein flüchtiger Beobachter.
Seine erste Patientin an diesem Tage war Maria Klee, eine elegante Frau von Anfang dreißig. Mit ihrem blonden Haar, das aus der breiten, blassen Stirn zurückgebürstet war, wirkte sie sehr attraktiv. Ihr Gesicht war jedoch ein wenig lang, und ihre Nase schien etwas zu schmal zu sein und den Bruchteil eines Zentimeters zu weit vorzustehen, was den Eindruck wahrer Schönheit nicht aufkommen ließ.
Maria saß Dr. Minks gegenüber. Ihre in einer teuren Hose steckenden Beine hatte sie übereinandergeschlagen, und ihre manikürten Hände ruhten auf den Knien. Sie saß aufrecht da wachsam, doch entspannt. Ihre graublauen Augen fixierten die des Psychologen mit einem stetigen, doch nicht herausfordern den Blick. Ihrer Haltung nach schien sie damit zu rechnen, dass ihr eine Frage gestellt oder eine These dargelegt wurde, und nun wartete sie geduldig und höflich darauf, dass der Arzt das Wort ergriff.
Aber der schwieg zunächst. Dr. Friedrich Minks nahm sich Zeit, während er sich in die Akte seiner Patientin vertiefte. Minks war unbestimmbaren mittleren Alters; ein kleiner, untersetzter Mann mit matter Haut und sich lichtendem schwarzen Haar. Seine Augen waren dunkel und wirkten sanft hinter den Brillengläsern. Im Gegensatz zu seiner ausgeglichen wirkenden Patientin schien er so schwer in seinen Sessel gefallen zu sein, dass der Aufprall ihn noch tiefer in seinen zerknitterten Anzug gedrückt hatte. Er blickte von seinen Notizen auf und betrachtete das sorgfältig konstruierte Gebäude der Selbstsicherheit, das sie durch ihre Körpersprache vermitteln wollte. Fast dreißig Jahre Erfahrung als Psychologe gestatteten ihm, den Schwindel sofort zu durchschauen.
»Sie sind sehr hart gegen sich selbst.« Minks schwäbische Kindheit zerrte immer noch an seinen Vokalen. »Und das ist ein Teil des Problems. Aber das wissen Sie bestimmt, nicht wahr?«
Maria Klees kühle graue Augen flackerten nicht; sie hob nur schwach die Schultern. »Was meinen Sie damit, Herr Doktor?«
»Sie wissen genau, was ich meine. Sie gestatten sich nicht, Angst zu haben. Das ist ein Teil des Schutzwalls, den Sie um sich errichtet haben.« Er beugte sich vor. »Furcht ist etwas Natürliches. Nach allem, was Sie hinter sich haben, ist es sogar mehr als natürlich, Angst zu haben … Es ist ein wesentlicher Teil des Heilungsprozesses. Genau, wie Sie Schmerzen hatten, als Ihr Körper heilte, müssen Sie Furcht verspüren, damit Ihr Geist heilen kann.«
»Ich möchte einfach mein Leben weiterführen, Herr Dr. Minks, ohne mit all dem Unsinn belastet zu werden.«
»Das ist kein Unsinn, sondern ein Stadium posttraumatischer Genesung, das Sie durchstehen müssen. Aber weil Sie es für ein Versagen halten, Angst zu empfinden, und weil Sie gegen Ihre natürlichen Reaktionen ankämpfen, ziehen Sie dieses Stadium in die Länge. … Und ich mache mir Sorgen, dass Sie es endlos in die Länge ziehen könnten. Ebendarum leiden Sie unter Panikanfällen. Sie haben Ihre natürliche Furcht und Ihr Grauen sublimiert und unterdrückt, bis beide in dieser verzerrten Form an die Oberfläche gedrangen sind.«
»Sie irren sich«, widersprach Maria. »Ich habe nie versucht, die Geschehnisse zu leugnen. Das, was er … was er mir angetan hat.«
»Das habe ich nicht gesagt. Sie leugnen nicht das Ereignis, sondern Ihr Recht, Furcht, Grauen oder auch nur Empörung über das, was der Mann Ihnen angetan hat, zu verspüren. Oder darüber, dass er noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden ist.«
»Ich habe keine Zeit für Selbstmitleid.«
Minks schüttelte den Kopf. »Dies hat nichts mit Selbstmitleid zu tun, sondern mit posttraumatischem Stress und natürlicher Heilung. Mit der Lösung. Bevor Sie diesen inneren Widerspruch nicht überwinden, werden Sie keine richtige Verbindung zu Ihrer Umwelt aufnehmen können. Zu anderen Menschen.«
»Ich gehe jeden Tag mit Menschen um.« Nun glänzten die graublauen Augen der Patientin trotzig. »Behaupten Sie etwa, dass ich meine Funktionsfähigkeit gefährde?«
»Vielleicht noch nicht … aber wenn wir die Geister nicht bald bannen können, werden sie sich irgendwann auf die Art Ihrer Berufsausübung auswirken.« Minks machte eine Pause. »Nach dem zu schließen, was Sie mir erzählt haben, weisen Sie zunehmend Zeichen von Aphenphosmphobie auf. Das könnte bei Ihrer Arbeit erhebliche Probleme aufwerfen. Haben Sie mit Ihren Vorgesetzten darüber gesprochen?«
»Wie Sie wissen, haben meine Vorgesetzten angeordnet, dass ich mich einer physischen und psychologischen Therapie unterziehe.« Sie legte den Kopf ein wenig zurück, und ihre Stimme bekam etwas Defensives. »Aber diese aktuellen … Probleme habe ich nicht mit ihnen besprochen.«
»Tja«, sagte Dr. Minks. »Sie kennen meine Meinung. Ich finde, Ihre Vorgesetzten sollten über Ihre Schwierigkeiten Bescheid wissen.« Er machte eine Pause. »Sie haben erwähnt, dass Sie eine Beziehung mit einem Mann begonnen haben. Wie entwickelt sie sich?«
»Nicht schlecht …« Marias Stimme klang nicht mehr trotzig, und ein Teil der nervösen Energie schien aus ihren Schultern gewichen zu sein. »Ich mag ihn sehr gern. Und er mich auch. Aber wir sind bisher nicht … wir sind nicht in der Lage gewesen, intim zu werden.«
»Meinen Sie, dass es keinen physischen Kontakt gibt … keine Umarmungen oder Küsse? Oder meinen Sie Sex?«
»Ich meine Sex. Oder etwas, das dem nahekommt. Wir berühren einander. Wir küssen uns … aber dann fühle ich mich …« Sie zog die Schultern hoch, als werde ihr Körper in einen kleinen Behälter gepresst. »Dann bekomme ich die Panikanfälle.«
»Begreift er, weshalb Sie sich von ihm zurückziehen?«
»Zum Teil. Es ist nicht leicht für einen Mann – für jeden –, das Gefühl zu haben, dass seine Berührung, seine Nähe abstoßend sind. Ich habe ihm einiges von alledem erklärt, und er hat versprochen, es für sich zu behalten. Das würde er ohnehin tun. Er hat Verständnis. Er weiß, dass ich zu Ihnen gehe … Na ja, nicht zu Ihnen persönlich … Er weiß, dass ich jemanden wegen meines Problems aufsuche.«
»Gut …« Minks lächelte. »Was ist mit den Träumen? Haben Sie weitere gehabt?«
Sie nickte. Ihre Schutzwälle zerbröckelten, und sie sackte ein wenig in sich zusammen. Ihre Hände ruhten noch auf ihren Knien, doch die manikürten Finger rafften nun eine kleine Fläche des teuren Stoffes zusammen.
»Den gleichen?«, fragte Minks.
»Ja.«
Dr. Minks lehnte sich vor. »Wir müssen dorthin zurückkehren. Ich muss Ihren Traum mit Ihnen durchleben. Das sehen Sie doch ein?«
»Noch einmal?«
»Ja«, sagte Minks. »Noch einmal.« Er bedeutete ihr, sich zu entspannen. »Wir kehren zu Ihrem Traum zurück. Dorthin, wo Sie Ihren Angreifer Wiedersehen. Ich fange nun an zu zählen. Wir kehren zurück, Maria … eins … zwei… drei …«
Schanzenviertel, Hamburg, 9 Uhr
Kristina ließ die Haustür offen stehen und stellte den Staubsauger und den Kasten mit den Reinigungsmitteln in den Türspalt, um sich den Fluchtweg zu sichern. Tief in ihrem Inneren rührten sich all ihre Instinkte, geweckt durch den Geruch frischen Todes in der Luft. Sie begann, das rhythmische Pulsieren ihres Blutes zu hören. Sie bückte sich, nahm eine Spülflasche mit Reinigungsflüssigkeit aus ihrem Kasten und hielt sie wie eine Pistole mit zitternder Hand fest.
»Herr Hauser?«, rief sie in den Flur hinein und in Richtung der stillen Zimmer dahinter. Ihre Sinne waren angespannt, damit ihr kein Geräusch, keine Bewegung entging. Kein Lebenszeichen innerhalb der Wohnung. Sie zuckte zusammen, als draußen auf der Straße ein Auto vorbeifuhr. Der dröhnende Bass wilder amerikanischer Musik mischte sich mit dem pulsierenden Rauschen des Blutes in ihren Ohren. In der Wohnung blieb es still.
Kristina ging langsam durch den Flur auf das Wohnzimmer zu. Die Hand mit der Reinigungsflüssigkeit war zögernd ausgestreckt, während die andere einen unsicheren Halt bot, als sie sich an den im Flur stehenden Bücherregalen entlangtastete. Reflexhaft strich sie mit ihren bebenden Fingern über eine dünne Staubschicht im Regal, die besonderer Aufmerksamkeit bedurfte.
Ihre Unruhe ließ nach, als sie in das helle Wohnzimmer trat und nichts Überraschendes vorfand, abgesehen davon, dass Herr Hauser es noch unordentlicher als sonst hinterlassen hatte. Eine Whiskyflasche und ein halb geleertes Glas standen auf dem Tisch neben dem Sessel; ein paar Bücher und Zeitschriften waren auf dem Sofa verstreut. Kristina war immer wieder erstaunt darüber, dass jemand, der so besorgt über die Umwelt war, seine persönliche Umgebung so sehr vernachlässigte. Kristina Dreyer, die fleißige Reinigerin der Behausungen anderer Menschen, musterte das Zimmer und machte im Geist einen Plan für die erforderliche Arbeit. Aber eine frühere Kristina, eine Kristina der Vergangenheit, schrie ihr zu, dass der gespenstische Geruch des Todes in der stickigen Wohnung hing.
Kristina trat zurück in den Flur. Dort blieb sie plötzlich wie angewurzelt stehen, als müsse die Energie sogar der kleinsten Bewegung zu ihrem Gehör umgeleitet werden. Ein Geräusch. Aus dem Schlafzimmer. Etwas pochte. Jemand pochte. Sie näherte sich der Schlafzimmertür, rief noch einmal: »Herr Hauser«, und verharrte. Keine Antwort außer dem ominösen Geräusch aus dem Schlafzimmer.
Sie umklammerte die Flasche mit der Reinigungsflüssigkeit noch fester und stieß die Tür so heftig auf, dass sie von der Wand zurückprallte. Erneut stieß Kristina die Tür auf, diesmal etwas behutsamer. Das Schlafzimmer war groß und hell, hatte weißgraue Wände und einen polierten Holzfußboden. Durch das gekippte Fenster rührte eine Brise an den Jalousien, die im Takt an die Scheibe pochten. Kristina stieß den Atem, den sie unbewusst angehalten hatte, mit einem halben Lachen und einem halben Seufzer der Erleichterung aus. Doch die Unruhe verließ sie nicht ganz und trieb sie wieder hinaus in den Flur.
Der Wohnungsflur war L-förmig. Kristina bewegte sich nun etwas selbstsicherer auf die Stelle zu, wo der Flur nach rechts abbog und zum Schlafzimmer und dem Bad der Wohnung führte. Hinter der Ecke bemerkte sie, dass die Schlafzimmertür geöffnet war, sodass der helle Sonnenschein durch die Fenster auf die geschlossene Badezimmertür fiel. Kristina erstarrte.
Etwas war an die Badezimmertür genagelt worden. Ein mit Ekel vermischter Schrecken durchfuhr sie. Es schien ein Tierfell zu sein. Das Fell eines kleinen Tieres, doch Kristina hatte keine Vorstellung, um was für eine Art von Tier es sich handeln mochte. Das Fell war feucht und verfilzt und hellrot. Unnatürlich rot. Das Fell schien gerade abgehäutet worden zu sein, denn es tropfte noch Blut an der weißen Farbe der Tür hinunter.
Sie ging langsam auf die Tür zu. Ihr Atem war kurz und abgehackt, und ihr Bück richtete sich auf den feuchten Gegenstand.
Einen halben Meter vor der Tür blieb sie stehen und starrte das Fell verständnislos an. Ihre Hand wollte es berühren, doch ihre Finger verhielten vor dem glänzenden Rot.
Es dauerte nur einen Sekundenbruchteil, bis ihr Gehirn analysiert hatte, was ihre Augen sahen. Es war ein einfacher Gedanke, eine schlichte Tatsachenfeststellung, doch in jenem Moment wurde ihre geordnete Welt zerfetzt. Sie hörte einen unmenschlichen Schrei des Entsetzens, der im Flur widerhallte und durch die noch immer geöffnete Haustür drang. Während der mürbe Stoff von Kristina Dreyers Welt zerrissen wurde, merkte sie, dass sie selbst den Schrei ausgestoßen hatte.
Ein solches Grauen. So viele seit langem verbannte Erinnerungen strömten zurück. Alles ausgelöst durch eine einzige Erkenntnis.
Was sie vor sich sah, war kein Fell.
Hamburg-Eppendorf, 9.10 Uhr
Maria stand in der Traumlandschaft mitten auf dem Feld. Wie immer in ihren Träumen waren die Einzelheiten übertrieben ausgeprägt. Der Mond schien groß und hell wie ein Bühnenscheinwerfer vom Himmel. Die Grashalme, die an ihren nackten Beinen entlang strichen und lautlos in einer unhörbaren Brise wogten, bewegten sich zu geschmeidig. Es gab kein Geräusch. Keinen Geruch. Marias Welt war auf zwei Sinne beschränkt: Sehen und Tasten. Sie schaute über das Feld hinweg.
Die Stille wurde durch eine leise Stimme mit der Spur eines schwäbischen Akzents zerrissen. Durch eine Stimme, die aus einer anderen Welt stammte.
»Wo sind Sie jetzt, Maria?«
»Dort. Auf dem Feld.«
»Ist es dasselbe Feld und dieselbe Nacht?«, fragte die Geisterstimme des Psychologen.
»Nein … nein. Oder doch … Aber alles ist anders. Größer. Breiter. Der gleiche Ort in einem anderen Universum. Zu einer anderen Zeit.« In der Ferne konnte sie eine Galeone erkennen, deren große weiße Segel sich in einem schwachen Wind kräuselten, während sie auf Hamburg zuglitt. Sie schien durch das wogende Gras statt über Wasser zu treiben. »Ich sehe ein Schiff. Ein altmodisches Segelschiff. Es fährt von mir weg.«
»Was noch?«
Sie drehte sich in eine andere Richtung. Ein zusammengefallenes Gebäude stand wie eine Burgruine klein und dunkel am Rand des Feldes, geradezu am Ende der Welt. Ein kaltes, strenges Licht schien aus einem der Fenster.
»Ich sehe eine Burg, wo die verlassene Scheune sein sollte. Aber ich bin so weit weg. Zu weit.«
»Haben Sie Angst?«
»Nein. Nein, ich habe keine Angst.«
»Was sehen Sie noch?«
Sie drehte sich um und schrak zusammen. Er hatte von Anfang an dort, hinter ihr, gestanden. Da sie den Traum so viele Male geträumt hatte, war ihr seine Anwesenheit bewusst gewesen, doch trotzdem erschreckte sie sein Anblick. Aber wie in all ihren Träumen empfand sie nichts von der nackten Furcht, die sein Gesicht in ihren wachen Stunden auslöste, wann immer sie es auf einem Foto erblickte oder es plötzlich und ungebeten aus dem dunklen Saal ihres Gedächtnisses auftauchte, wo sie versuchte es einzusperren.
Eine fremdartige Rüstung und ein schwarzer Umhang bedeckten die kräftigen Schultern des hochgewachsenen Mannes. Er setzte seinen schmuckvollen Helm ab. Sein Gesicht hatte scharfe slawische Kanten und war von grober Attraktivität. Seine stechenden Augen, hell und von schrecklich kaltem Smaragdgrün, bohrten sich in ihre. Er lächelte sie an wie ein Liebhaber, doch die Augen blieben kalt. Dann trat er so dicht auf sie zu, dass sie seinen frostigen Atem spürte.
»Er ist hier«, sagte Maria zu dem Arzt in einer anderen Dimension, während sie in die grünen Augen schaute.
»Ich bin hier«, bestätigte der auf grausame Art attraktive Slawe.
»Haben Sie Angst?« Minks’ Stimme aus der anderen Dimension wurde plötzlich schwächer. Ferner.
»Ja«, antwortete sie. »Nun habe ich Angst. Aber das gefällt mir.«
»Spüren Sie noch etwas außer Furcht?«, fragte Minks, doch seine Stimme war kaum noch zu hören.
Maria spürte, wie sich ihre Furcht änderte. Stärker wurde. »Ihre Stimme wird leise«, sagte sie. »Ich kann Sie kaum noch hören. Warum ist Ihre Stimme leiser geworden?«
Minks erwiderte etwas, aber seine Stimme war nun so fern, dass sie seine Antwort nicht verstehen konnte.
»Warum kann ich Sie nicht hören?« Nun hatte ihre Furcht eine neue Größenordnung erreicht und brannte mit der Kraft eines Hochofens in ihr. »Warum kann ich Sie nicht hören?«, schrie sie in den dunklen Himmel mit dem zu gewaltigen Mond.
Wassyl Witrenko neigte sich vor, um sie auf die Stirn zu küssen. Seine Lippen waren trocken und kalt. »Weil du dich irrst, Maria.« Er sprach mit einem schweren osteuropäischen Akzent. »Dr. Minks ist nicht da. Dies ist keine seiner Hypnotherapiesitzungen. Es ist Realität.« Er griff unter seinen wogenden schwarzen Umhang. »Dies ist kein Traum. Und niemand ist hier außer uns beiden. Wir sind allein.«
Maria wollte aufschreien, doch sie konnte es nicht. Stattdessen starrte sie wie gebannt auf die im Mondlicht böse funkelnde Klinge von Wassyl Witrenkos langem, breitem Messer.
Schanzenviertel, Hamburg, 9.10 Uhr
Kristina hatte noch nie einen menschlichen Skalp gesehen, aber sie wusste mit absoluter Sicherheit, dass sie einen vor sich hatte. Zuerst hatte die Haarfarbe sie daran gehindert, ihn als etwas Menschliches zu identifizieren. Er war rot. Unnatürlich rot.
Doch nun hatte sie keinen Zweifel mehr, dass es sich um Menschenhaar handelte. Glänzendes feuchtes Haar. Und Haut. Eine große, zackige Scheibe. Sie war mit drei Stiften an die Badezimmertür genagelt worden. Der obere Teil war vornüber geklappt, sodass etwas von der gekräuselten, blutigen Unterseite zu erkennen war, wo jemand die Haut durchschnitten und dann vom Schädel gerissen hatte. Ein Y-förmiges, glitzerndes Rot tropfte langsam von dem Skalp hinunter auf das Holz der Badezimmertür.
Blut.
Kristina schüttelte den Kopf. Nein. Nicht noch einmal. Sie hatte schon zu viel Blut in ihrem Leben gesehen. Nicht noch mehr. Nicht jetzt. Nicht, nachdem sie sich gerade ihr Leben zurückerobert hatte.
Sie neigte sich erneut vor und merkte, wie ihre Beine bebten, als könnten sie das Gewicht ihres Körpers nicht mehr tragen. Ja, es war Blut, doch das konnte nicht alles sein. Außerdem war das Rot zu grell. Von derselben Farbe wie das durchnässte, verfilzte Haar.