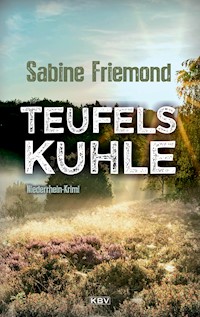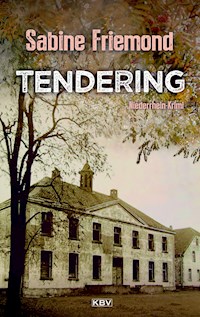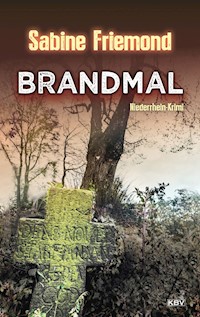
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Christin Erlenbeck
- Sprache: Deutsch
Ein gefährliches Spiel mit dem Feuer … Am Fuß der mächtigen Gerichtslinde in Götterswickerhamm wird die Leiche eines erstochenen Mannes gefunden. Zur Überraschung aller gerät der Polizist Freddie Neumann, der sich nach einer durchzechten Nacht mit seinem alten Freund Mark an nichts mehr erinnern kann, sehr schnell ins Zentrum der Ermittlungen. Als sich nämlich herausstellt, dass es ausgerechnet der Ermordete war, der ihm vor fünfzehn Jahren aufgelauert, ihn zusammengeschlagen und mit Feuer entstellt hat, ist Freddie mit einem Mal Hauptverdächtiger in der Mordsache und kommt in Untersuchungshaft. Seine Frau, die Pfarrerin Christin Erlenbeck, glaubt fest an die Unschuld ihres Mannes und beginnt nun ihrerseits zu ermitteln. Schon bald entdeckt sie eine Spur, die in die Vergangenheit von Götterswickerhamm führt. Freddies Kollegin, die angehende Polizistin Laura Bauer, ist ebenfalls davon überzeugt, dass er nicht der Täter ist und hofft, im rechtsextremen Umfeld des Ermordeten auf entlastende Hinweise zu stoßen. Zu diesem Zweck schleust sie sich undercover in die Duisburger Skinheadszene ein. Stück für Stück enthüllt sich ihnen ein Drama, das sich aus Tod, Verlust und dem Hunger nach Rache zusammensetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Hochbahn
Teufelskuhle
Tendering
Sabine Friemond, geb. 1968 in Duisburg, wuchs in der Gemeinde Spellen am Niederrhein auf. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Ihre Liebe zu Büchern ist bereits daran ersichtlich, dass sie am Niederrhein eine Buchhandlung in Voerde betreibt. Ihre Heldin Pastorin Christin Erlenbeck ermittelt bereits in ihrem vierten Fall.
Sabine Friemond
Brandmal
Kriminalroman
Für Ingrid,noch keine Ewigkeit, aber fast
Originalausgabe
© 2022 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von
© Michael Belter · Belter-Photo.net
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-627-1
E-Book-ISBN 978-3-95441-637-0
Rächt euch nicht selbst, meine Lieben,
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes;
denn es steht geschrieben: »Die Rache ist mein;
ich will vergelten, spricht der Herr.«
5. Mose 32,35
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Ein Wort an die Leser
Prolog
Duisburg 1886
Immer noch hoffte Ludwig, dass dies alles nur ein Alptraum sei. Oder eine Erziehungsmaßnahme seines Vaters Karl, eine grausamere als die bisherigen. Bis jetzt hatte er nur begriffen, dass Karl gar nicht sein Vater war, und dass Agathe, die er immer »Mutter« genannt hatte, nicht seine Mutter war und sie ihn deswegen für immer abgeben konnten.
Ludwig hatte gespürt, dass diesmal etwas anders war als nach seinen früheren Wutanfällen. Er hatte es in Agathes Blick gesehen. Wie sie beide Arme schützend um Maria legte und ihn aus endlos traurigen, großen Augen anguckte, stumm, kein Schimpfen, kein Tadeln. Ihn wortlos in sein Zimmer schob. Als ob sie da schon angefangen hätte, Abschied von ihm zu nehmen. Er setzte sich auf die Bettkante und versuchte, an etwas anderes zu denken. Zum Beispiel an seinen ersten Schultag im Sommer, an die Zuckertüte, die er bekommen würde. Aber dann fiel sein Blick auf die zerbrochene Schiefertafel, und er wurde unbarmherzig wieder an den Wutanfall erinnert, bei dem er die Tafel auf seinem Pult zerschlagen hatte. Dabei war ein messerscharfer Splitter des dünnen Schiefers gegen die Wange seiner kleinen Schwester geflogen. Sofort hatte das Mädchen zu schreien angefangen. Ein feines Rinnsal Blut war über die bleiche Wange geflossen.
Durch das Fenster sah er, wie die klare Februarsonne langsam der Dunkelheit wich und wie die Silhouette der Dächer, die er vom dritten Stock aus gut sehen konnte, immer mehr verblasste. Nur der Turm der Salvatorkirche, die er mit seinen Eltern jeden Sonntag besuchte, war noch deutlich zu erkennen.
Dann hörte er die festen Schritte seines Vaters das Treppenhaus hochkommen. Das Quietschen der Türangel, als seine Mutter ihrem Mann die Haustüre öffnete. Ludwig schob seine schweißnassen Hände unter die Oberschenkel. In Erwartung des Gürtels saß er auf dem Bett, mit hängendem Kopf und Tränen in den Augen. Nach, wie es ihm vorkam, endlosen Stunden, öffnete sein Vater die Tür zu seinem Zimmer.
Der Alptraum begann.
1. Kapitel
Mittwoch, 19. Februar 2020
Sein Griff um die Klinge wurde fester. Er atmete tief durch, versuchte, alles auszublenden. Er schloss die Augen und dachte kurz an die vergangene Zeit. Ständig unter Strom, keine Ruhe.
Das anfängliche Wimmern hatte sich zu einem Mitleid erregenden Schreien gesteigert. Nein, er würde kein Erbarmen haben, erst musste er an sich selbst denken. Das Geschrei ließ nicht nach, wurde noch einen Ton jämmerlicher.
Die Klinge war scharf, es würde schnell gehen. Los, dachte er, jetzt! Und verzog sein Gesicht zu einer entschlossenen Fratze.
In diesem Moment durchfuhr ihn wieder dieses ungeheure Gefühl. Es breitete sich von der Magengrube aus, ging durch den Brustkorb bis in sein Gehirn. Pures Glück. Tiefe Zufriedenheit. Fehlte nur noch die Musik aus dem Hintergrund. Good day Sunshine …
Freddie setzte das Messer an und hatte mit wenigen Zügen seine rechte Wange rasiert. Er versuchte weiterhin, Floras empörtes Gebrüll auszublenden. Bei der Hals- und der Kinnpartie musste er aufpassen. Kritisch beäugte er sich im Spiegel. Gerne hätte er sich auch einen Wikingerbart stehen lassen, Christin fand die Darsteller einer entsprechenden Serie alle so sexy, aber seine vernarbte, linke Gesichtshälfte ließ dies nicht zu.
Nur noch kaltes Wasser ins Gesicht, abtrocknen, dann den Pulli an. Schon war er im Schlafzimmer, in dem das Gitterbett seiner Tochter stand. Sofort, als sie ihren Vater sah, hörte sie auf zu jammern. Flora griff, die kleinen, roten Lippen entschlossen zusammengepresst, mit ihren beiden Händchen um die Querstrebe des Gitters und rüttelte daran, als wenn ihr Vater sonst nicht begreifen würde, dass der Tag für sie schon längst und hier und jetzt begonnen hatte.
»Guten Morgen, meine kleine Blume«, gurrte Freddie in einem Ton, über den er sich bis vor fünfzehn Monaten noch bei jedem anderen Mann lustig gemacht hätte.
Flora löste ihre Händchen von dem Gitter und deutete auf die Tür. »Da! Da!«, stieß sie aufgeregt hervor und wippte von einem Fuß auf den anderen.
Ihr Vater hob sie hoch. »Erst einen Kuss. Das weißt du doch schon.«
Mit großen Augen sah das kleine Mädchen seinen Vater an. »Tu«, sagte sie und drückte ihre feuchten Lippen auf Freddies. Dann machte sie ihm weiter klar, dass sie außerhalb des Schlafzimmers am Familienleben der Erlenbeck-Neumanns teilnehmen wollte.
»Nein, oh du meine wohlduftende Blume«, Freddie verzog angewidert das Gesicht. Dann zwinkerte er Flora verschwörerisch zu. »Matti!«, rief er, »Blümchen möchte zu dir!«
»Nee, Freddie«, hörte er aus dem Flur Mathildas Stimme, »kannste vergessen.« Floras große Schwester steckte den Kopf durch die Tür. »Guten Morgen, mein Schwesterstinker-schweinchen!«, gurrte auch sie jetzt und machte Kussgeräusche in Floras Richtung. Dann rümpfte sie die Nase. »Nee, Freddie«, wiederholte sie. »Ich muss jetzt auch machen.«
Ihr Stiefvater stockte kurz. »Matti! Komm noch mal rein! Hast du dich etwa geschminkt?«
Ohne ihm eine Antwort zu geben, setzte Mathilda ihren Weg in die Küche fort. Aus Angst, dass Floras Windel »überschwappte«, wie Oskar es immer nannte, folgte Freddie ihr nicht in die Küche, sondern legte das kleine Mädchen auf die Wickelkommode.
Auch wenn Freddie gerne Witze über das Windelwechseln machte und aus Spaß das Gesicht verzog, liebte er diese Minuten, in denen er mit seiner kleinen Tochter einen so innigen Kontakt hatte. Nachdem er sie ausgezogen und komplett gereinigt hatte, drückte er seine Nase in ihren nackten Bauch und prustete, was Flora stets zu tief aus dem Hals kommenden Glucksgeräuschen brachte. Sie versuchte, sich auf den Bauch zu drehen und wegzukrabbeln, aber natürlich fing Freddie sie ein, bevor sie an den Rand der Wickelauflage kam. Dann umschloss er erneut links und rechts mit seinen riesigen Männerhänden Floras kleinen Menschenkörper, bevor er sie mit einer Salve schmatzender Küsse attackierte. Nun, völlig außer Rand und Band, versuchte die Kleine, Freddie wegzudrücken. Die Berührung dieser zarten Händchen und Füßchen, die warm und manchmal auch klebrig-feucht von Schweiß und Speichel waren, schnürte ihm die Brust vor Glück zu.
Oskar und Mathilda, die in der Küche ihre Pausenboxen befüllten, kamen ihm gegen Flora, die jetzt frisch gewaschen und fertig angezogen auf seinem Arm saß, wie schon fast fertige Erwachsene vor. Wann war Oskars Gesicht so schmal geworden? Und was war mit Mathildas Beinen los? Waren sie über Nacht wieder länger geworden? War das eine geheimnisvolle Krankheit?
Oskar flippte in jede Box schnell ein paar kleine Cocktailtomaten, bevor er sich zu Freddie drehte und sich mit einem lauten »Flörchen!« auf seine kleine Schwester stürzte.
»Hey, wer nicht wickelt, darf auch nicht schmusen«, hielt Freddie Oskar auf Abstand. Der Teenager war manchmal zu stürmisch und auch mal etwas grob im Umgang mit Flora.
Nachdem es wieder einen Streit zwischen Freddie und Oskar deswegen gegeben hatte, hatte Christin versucht, ihren Mann, als sie alleine waren, zu beschwichtigen. »Oskar ist eifersüchtig auf unser Blümchen«, hatte sie Freddie gesagt. »Du weißt, wie er dich vergöttert. Die Erinnerung an seinen Vater wird immer mehr von dir verdrängt.« Freddie wollte protestieren. »Nein«, winkte Christin ab, »das ist okay. Er braucht einen Vater, der ihm im Hier und Jetzt Kontra gibt und die Richtung zeigt. Er ist total stolz, wenn fremde Leute sagen ›er sieht aus wie sein Vater‹ und dann dich meinen. Und jetzt ist da auf einmal unser kleines Blümchen. Wir müssen sehr geduldig mit Oskar sein.«
Wie ein kleiner Junge hatte Freddie einen Schmollmund gemacht. »Puh«, murmelte er, »ganz schön kompliziert!«
Während Freddie die zappelnde Flora in ihren Hochstuhl setzte, versuchte er, Mathilda zu mustern, ohne dass sie es merkte. Sie hatte ihm bisher noch nicht das Gesicht zugewandt. Anscheinend konzentriert beugte sie den Kopf über die Arbeitsplatte und arrangierte Gemüsesticks, Tomaten und Brotscheiben in den Boxen. Nebenbei trank sie eine Tasse Kaffee. Hatte sie die Haare anders? Ihm kam es so vor, als ob ihre dunklen, leicht wellig fallenden Haare heute viel glatter aussähen. Irgendwie steif. Gekünstelt.
»Willst du dich nicht setzen? Seit wann trinkst du den Kaffee im Stehen?« Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu, »und seit wann trinkst du überhaupt Kaffee? Ist das nicht ein bisschen …« Freddie verstummte. Ja, was eigentlich? Wann hatte er selbst mit dem Kaffeetrinken begonnen?
Freddie griff nach einer Scheibe Brot und dem Frischkäse, während er auf eine Antwort von Mathilda wartete.
»Freddie«, Mathilda klang genervt, »ich bin fast fünfzehn. Ich finde Kaffee jetzt nicht so megamäßig brutal.« Ohne sich zu ihm umzudrehen, ging sie mit der Lunchbox in den Flur. »Kommst du, Oskar?«
Ihr Bruder gab seiner kleinen Schwester noch einen schmatzenden Kuss auf die Stirn, was diese mit einem schnellen Griff in seine Haare quittierte. »Aua!«, spielte Oskar den Empörten und rannte dann in den Flur, um sich mit Mathilda gemeinsam auf den Weg zur Schule zu machen. Beide riefen noch: »Tschüss«, dann knallte die Haustür zu.
»Bo«, machte Flora und guckte Freddie mit großen Augen an.
»Ja, bo!«, echote ihr Vater. »Christin?«, rief er dann. »Du kannst kommen!«
* * *
Natürlich hatte Christin Erlenbeck aus ihrem Büro heraus fast alles mitverfolgen können, was der Rest ihrer Familie gesprochen beziehungsweise gerufen hatte. Nach dem »Tschüss« und dem Knallen der Haustür wurde es einen kurzen Moment sehr still. Sie schloss ihr Mailprogramm und folgte dann Freddies Ruf in die Küche.
Jetzt kam ein Teil des Tages, auf den sie sich sehr freute. Immer, wenn Freddie Spätschicht hatte, stand sie sehr früh auf, um den Tag in Ruhe mit ihrem Gott beginnen zu können. Darauf folgte dann ganz profane Büroarbeit, während Freddie sich um die Kinder kümmerte. Wenn dann die beiden Großen das Haus verlassen hatten, um zur Schule zu fahren, frühstückte sie mit Freddie und Flora.
Seit der Geburt ihres dritten Kindes vor fünfzehn Monaten kämpfte die Pfarrerin ständig gegen Überforderung an. Dieses Gefühl hatte sich langsam entwickelt. In den ersten Wochen hatte Dietmar, ihre Vertretung, ihr die komplette Gemeindearbeit abgenommen. Dann musste sie wieder mehr Stunden übernehmen. Was sie ja auch wollte. Sigrid Fohrmann, ihre Haushaltsfee, erklärte sich bereit, sich jeden Tag ein paar Stunden um Flora zu kümmern. Den Rest fing Freddie auf. Aber Christin Erlenbeck hatte sich und ihre psychische Stärke nach den dramatischen Geschehnissen kurz vor Floras Geburt überschätzt. Nachts wachte sie immer wieder mit Atemnot auf, sie hatte das Gefühl, dass dunkle Schatten wie Mauern auf sie herunterfielen.
Auch das vorletzte Jahr hatten sie alle gemeinsam verarbeiten müssen. Christin war nach dem Tod ihres Mannes, dem Vater ihrer Kinder Mathilda und Oskar, aus Süddeutschland zurück an den Niederrhein gezogen und sofort in die dramatischen Geschehnisse um eine alte Leiche und einen ermordeten Mann gezogen worden. Dabei hatte sie ihren alten Jugendschwarm Freddie wiedergetroffen, der mittlerweile Polizist war. Und schon kurz, nachdem sie festgestellt hatte, dass sie schwanger war, und sich entschieden hatte, Freddie und dem ungeborenen Kind eine Chance als Familie zu geben, waren neue Erkenntnisse über einen alten Fall ans Tageslicht gekommen, die wieder den Alltag der Familie Erlenbeck-Neumann an den Rand des Abgrundes brachten. Dann der Mord an einer jungen Frau, der beinahe auch sie und Flora das Leben gekostet hätte.
Ein langer, gemeinsamer Familienurlaub mit seelsorgerischer und psychotherapeutischer Begleitung hatte ihr, Freddie und den Kindern geholfen, ein neues Gleichgewicht zu finden. Dazu gehörte auch eine konsequente »Alleinzeit« mit Freddie und Flora. Die sie jetzt genießen wollte.
Freddie hatte ihr schon einen Kaffee mit aufgeschäumter Milch zubereitet. Flora griff konzentriert mit Daumen und Zeigefinger nach den kleinen, mit Frischkäse bestrichenen Brotquadraten, die ihr Vater ihr gemacht hatte. Als sie ihre Mutter sah, leuchteten ihre Augen auf, aber da sich etwa acht kleine Brotstückchen in ihrem Mund befanden, konnte Flora nicht mehr als durch die Nase schnauben.
Freddie zog Christin auf seinen Schoß. Nachdem sie sich lange geküsst hatten, nahm die Pfarrerin das Gesicht ihres Mannes in die Hände und musterte es.
»Du hast dich geschnitten«, sagte sie dann und küsste ihn noch einmal, diesmal kurz, wie zum Abschied. Seufzend stand sie dann auch auf und setzte sich auf den Stuhl, der auf der anderen Seite von Flora stand.
»Seit wann trinkt Mathilda Kaffee?«, fragte Freddie sie über Floras Kopf hinweg. »Ist das in dem Alter überhaupt gesund?«
Christin zuckte mit den Schultern. »Ich denke, Kaffee ist nicht so schlimm. Viel mehr Sorge macht mir, dass sie irgendetwas beschäftigt und sie nicht mit mir darüber redet.«
Freddie grinste. »Ich bin da ja fast noch Anfänger, aber nennt man das nicht Pubertät?«
Nun musste Christin auch lachen. »Könnte sein«, sagte sie, »ist auch mein erstes Mädchen in dem Alter.« Dann wurde sie wieder ernst. »Aber es ist schon … merkwürdig, diese Veränderung.«
Freddie guckte auf die Uhr. »Komm, du hast noch eine halbe Stunde, lass uns mit Laika gehen, da reden wir weiter.«
* * *
»Oskar hat gefragt, ob du einen Mark Baumann kennst«, begann Christin das Gespräch, als sie kurze Zeit später Hand in Hand die kleine Straße »Över de Hölter«, die gegenüber der Polizeiwache in die Mommniederungen führte, mit ihrer Wolfsspitzhündin Laika entlangspazierten. Christin schob den Buggy, in dem Flora saß, dick eingemummelt gegen die immer noch sehr kühle Luft. Das kleine Kind ließ den Hund keine Minute aus den Augen.
Mark Baumann.
War Freddie etwa zusammengezuckt, als dieser Name fiel? Christin sah ihren Mann prüfend von der Seite an. Und, wie immer, wenn Freddie nervös oder verunsichert war, fuhr seine Hand automatisch an die von Brandnarben entstellte linke Gesichtshälfte.
»Was ist los?«, lachte Christin. »Wer ist das? Irgendetwas sagt mir der Name.«
»Oh Mann!«, stöhnte der Polizist. »Mark Baumann«, wiederholte er nachdenklich. Er zögerte und lachte dann etwas verlegen. »Wir waren mal die besten Kumpel.«
Sofort tauchten Hunderte Bilder aus der Zeit mit Mark vor seinem inneren Auge auf.
* * *
Husten. Lachen.
»Bah!«, stieß der etwas kleinere von ihnen aus. »Kann dein Vater nicht Ernte 23 rauchen, wie alle anderen auch?«
Der größte der drei Teenager lachte überlegen. »Du bist eine Memme. Da gewöhnt man sich dran. Klau du doch deinem Vater Zigaretten!«
Freddie schüttelte den Kopf. »Mein Vater zählt seine Zigaretten ganz genau ab. Der teilt sie sich ein. Sonst kriegt er Ärger mit Mama.« Mit Todesverachtung nahm er wieder einen Zug von der filterlosen Roth Händle. Beim Versuch, nicht wieder zu husten, lief er knallrot an. Auch Jan, der kleinste von ihnen, verzog angewidert das Gesicht, paffte aber tapfer weiter.
Sie starrten auf den träge dahinfließenden Rhein. Die Sonne brannte vom Himmel. Um sich vor den Blicken der Erwachsenen zu schützen, die eventuell Marks Vater vom Rauchen der Jungen erzählen würden, hatten sie sich etwas abseits der trubeligen Rheinpromenade einen Platz gesucht.
Jetzt, im Sommer, verbrachte Freddie viel Zeit bei seinem Freund. Auch Jan war oft dabei, er wohnte, genau wie Mark, in Götterswickerhamm.
Marks Vater, den Freddie »Siggi« nennen durfte, hatte mitten in Götterswickerhamm eine Autowerkstatt.
Ein Paradies für Freddie.
Siggi half ihm, an seiner Kawasaki zu schrauben, ihre Leistung zu erhöhen, sie zu »frisieren«. Mark durfte schon alleine an den Autos der Kunden kleinere Reparaturen vornehmen, worum ihn Freddie heiß beneidete. Und natürlich durfte Mark in dem alten Ford Escort seines Vaters durch die kleinen Straßen der Rheindörfer fahren.
Breites Grinsen.
Mark und Freddie, denen beide die Schule schwerfiel, lernten sich am Anfang der fünften Klasse kennen. Während Jan das Voerder Gymnasium besuchte, gingen Freddie und Mark in die gleiche Klasse der Realschule Voerde. Schon am ersten Schultag, direkt bei den Einschulungsfeierlichkeiten, grinsten sich die beiden schlaksigen, strohblonden Jungen an. Wie magnetisch voneinander angezogen, setzten sie sich später nebeneinander an einen der Tische in der hintersten Reihe. Freddies Mutter schüttelte später immer wieder seufzend den Kopf. »Gesucht-gefunden«, murmelte sie in gespielter Ergebenheit. Und wenn sich die beiden Jungen stritten oder sogar prügelten, guckte sie ihren Sohn nur unaufgeregt an. »Pack schlägt sich, Pack verträgt sich«, sagte sie dann mit einem verschmitzten Lächeln, wenn er sich lauthals über Mark beschwerte und nie wieder mit ihm spielen wollte. Dann protestierte Freddie laut. »Wir sind doch kein Pack, Mama!«
Mit Jan trafen sie sich gemeinsam nachmittags, aber die enge Bindung, das Sich-ohne-Worte-Verstehen bestand nur zwischen Freddie und Mark.
Julia.
Vor ihnen saß Julia. Ihr puppenhaftes, herzförmiges Gesicht wurde von pechschwarzen Haaren eingerahmt, die zu einem perfekten Bob geschnitten waren. In der Mitte des Haaransatzes über der Stirn hatte sie einen Wirbel, die einzige Unregelmäßigkeit, zu der Freddie immer wieder hinschielen musste.
Schon bald wurde Julia ständig von Mark geärgert. Er beschoss sie von der hinteren Bank aus durch ein Röhrchen mit Papierkügelchen, die er vorher, in seinem Mund, mit viel Spucke geformt hatte. Oder er klaute ihr, wenn er an ihrem Tisch vorbeikam, irgendeinen Stift. Wenn Freddie versuchte, Mark von diesen Ärgereien abzuhalten, grinste dieser ihn, seine großen, weißen Zähne zeigend, nur an. »Freddie!«, schnaubte er dann überlegen durch die Nase, »die will das doch!«
Freddie beobachtete und lernte. Tatsächlich zischte Julia Mark eine Beleidigung hinterher, wenn er sie mal längere Zeit nicht beachtete, um Mark zu einer Reaktion zu provozieren, die natürlich prompt kam. So war das also mit den Mädchen.
* * *
»Mit Mark habe ich früher ’ne Menge Zeit verbracht«, erzählte der Polizist seiner Frau nun.
»Du hast noch nie von ihm gesprochen«, sagte Christin.
»Nein. Irgendwie …«, Freddie zögerte, »du weißt doch, wie das ist, irgendwann verliert man sich aus den Augen.«
Christin nickte. Da sie selbst in einer anderen Stadt studiert hatte und dann mit ihrem ersten Mann nach Süddeutschland gezogen war, hatte sie dies am eigenen Leib erlebt. Mehrmals. Dafür hatte sie jetzt das Gefühl, dass sie neue Freundschaften viel bewusster schloss, weil sie genau entschied, welcher Mensch ihr Leben bereicherte.
»Wie kommt Oskar denn auf Mark? Und wieso hat er mich heute Morgen nicht selber gefragt?«, wollte Freddie wissen.
Christin zuckte mit den Schultern. »Erwachsenenkram ist ihm nicht so wichtig«, entgegnete die Pfarrerin, »er kam da nur drauf, weil wir gestern übers Schwimmen gesprochen haben und Oskar sich da mit einem Jungen angefreundet hat. Nico Baumann.«
»Marks Sohn«, schlussfolgerte Freddie.
»Ja«, Christin nickte und sagte dann mit tiefer, belegter Stimme, »er ist wieder in der Stadt, er wird Tod und Verderben bringen.«
Ihr Mann guckte sie von der Seite an.
Christin prustete los. »Na«, lachte sie, »so hat sich das gerade angehört! Als wenn er der Sohn des wiederauferstandenen Al Capone ist!«
Freddie musste auch schmunzeln. »Für eine Pfarrerin hast du einen ziemlich makabren Humor.«
Dann schwiegen beide.
Zumindest der Tod hatte die letzten Jahre des Ehepaars schon überschattet.
Verderben nicht. Noch nicht.
2. Kapitel
Samstag, 22. Februar 2020
Das war also der Ort, an dem Freddie einen Teil seiner Jugend verbracht hatte.
Christin musterte die Werkstatt von Mark Baumann, zu der sie Nadine, Marks Freundin, in die hinterste Ecke des Gartens geführt hatte. Die Werkstatt sah eher aus wie ein Schuppen, den irgendjemand mal einfach gebaut hatte. Laut Freddies Erzählungen wahrscheinlich Marks Vater. Aber so, wie es aussah, hatte sie alles, was ein Automechaniker brauchte. Verschiedene Werkzeuge hingen ordentlich an den Wänden; größere Geräte, teilweise ölverschmiert, von denen die Pfarrerin überhaupt keine Ahnung hatte, wofür man sie brauchen könnte, hockten wie geduckte kleine Monster vor den Wänden. In einer Ecke stand ein Spind. Auf der Tür klebte ein Kalenderblatt von Juli 1998, mit einer schwarzhaarigen, exotischen Schönheit, die kokett versuchte, sich den Blicken des Betrachters auf ihre entblößte, enorme Oberweite mit Hilfe eines löchrigen Spitzentuches zu entziehen.
Vor dem schmalen Schrank, unter dem Bild dieser Frau, spielte ein kleines Mädchen. Die Pfarrerin schätzte ihr Alter auf sechs, sieben Jahre. Mit einem Lappen, der vorher wahrscheinlich zum Putzen eines Motors benutzt wurde, wischte sie eifrig an dem Spind herum. Nur kurz blickte sie auf, strich mit ihren schmutzigen Händen eine ins Gesicht gefallene Haarsträhne zur Seite, dann vertiefte sie sich wieder in ihre Arbeit. Dabei murmelte sie vor sich hin: »Hier ist ja heute ein Dreck.«
Unter einem Auto konnte Christin eine Grube erkennen, aus der sie ein breitgrinsender Mann mit kurzen, blonden Stoppelhaaren musterte.
Christin fühlte sich ertappt. Sie hoffte, dass Mark, um den es sich aller Wahrscheinlichkeit nach handelte, sie nicht schon länger beobachtet hatte, denn sie hatte bestimmt bei dem Anblick des spielenden Kindes unter einer pornographischen Darstellung die Nase gerümpft. Ihr entgleister Gesichtsausdruck schien ihm dennoch nichts auszumachen.
»Du bist die Mutter von Oskar!«, rief er fröhlich aus der Grube. »Moment mal! Ich komme mal hoch, um dich richtig zu begrüßen.« Mit einer geschmeidigen Bewegung stemmte er sich auf seinen Armen ab und landete auf dem Boden neben ihr. Etwa 190 muskulöse Zentimeter falteten sich vor ihr auf. Trotz der Kälte trug Mark nur ein T-Shirt, dessen Stoff um seine Oberarme spannte. Durch seine Haare zogen sich erste, graue Strähnen, was seiner Attraktivität aber keinen Abbruch tat.
Sie wich einen Schritt zurück und lachte nervös.
»Tut mir leid«, sagte er bedauernd, »normalerweise würde ich die Frau eines alten Kumpels zur Begrüßung drücken, aber«, er schaute an seinen schmutzigen Sachen hinunter, »besser nicht.« Dabei blitzten seine Augen, und das ansteckende Lachen in seinem Gesicht breitete sich wieder aus.
»Äh, ja, hallo, ich bin Christin.« Ihr war völlig klar, warum Freddie und Mark mal ein so gutes Gespann gewesen waren. Beide sahen unverschämt gut aus, entsprachen dem gängigen, männlichen Schönheitsideal. Sie konnte sich gut vorstellen, wie die beiden nebeneinander durch eine Menschenmenge gegangen waren, cool und selbstbewusst. Jetzt strahlte nur noch Mark dieses Selbstbewusstsein aus, während Freddie der zurückhaltende Beobachter geworden war.
»Ich habe Oskar gebracht, wann soll ich ihn denn wieder abholen?«
Mark winkte ab. »Besprich das mit Nadine. Ich glaube, die hat für die Jungs noch was geplant. Wie geht’s Freddie denn so? Ist er ein braver Ehemann?« Dann guckte er kurz über seine Schulter. »Jacqueline, gib dem Papa mal ’ne Zigarette.«
Sofort unterbrach das kleine Mädchen ihre Wischarbeiten, griff zielstrebig nach der Packung mit den Zigaretten und gab ihrem Vater eine.
»Danke, mein Schatz«, knurrte er durch seine Zähne, zwischen denen schon die Zigarette steckte. Mit herausforderndem Blick öffnete Jacqueline provozierend langsam die Zigarettenschachtel, nahm sich ebenfalls eine heraus und tat so, als wollte sie sich diese anstecken. »Wag’ es, du Satansbraten«, drohte Mark spielerisch mit dem Finger und lachte dann wieder.
Kichernd legte das Mädchen die Schachtel weg. Christin hätte nicht darauf geschworen, dass Jacqueline auch die Zigarette in die Schachtel zurücklegte.
Wollte Mark eine Antwort auf seine Frage? Christin war unsicher, ob das nur Geplänkel war. Aber er sah sie auffordernd an.
Dann erinnerte sie sich. Vor gefühlt hundert Jahren hatte Freddie ihr in einer Diskothek mal ein Getränk ausgegeben. Mark hatte danebengestanden und anzüglich gegrinst. Sie hatte sich unwohl gefühlt, wie ein Kaninchen vor einer Schlange. Obwohl sie damals heimlich von Freddie fasziniert gewesen war, hatten die jungen Männer ihr Angst gemacht und sie hatte sich wie ein kleines Mädchen gefühlt. Jetzt hatte sie natürlich keine Angst, aber immer noch ein komisches Gefühl. Was ging es Mark an, ob Freddie ein »braver« Ehemann war, dachte sie trotzig.
Gott sei Dank kam in diesem Moment Nadine.
»Kommen Sie, hier ist es doch kalt und ungemütlich!«, erlöste sie Christin, »wenn Sie möchten, können wir drinnen einen Kaffee trinken.«
Mark umschlang seine Freundin mit einem Arm, seine Hand wanderte zu ihrem Po, der in einer Röhrenjeans steckte.
Lachend wand sich Nadine aus seiner Umarmung. »Geh mit deinen Drecksfingern weg! Kommen Sie, nicht, dass Sie sich hier noch Ihre Jacke ruinieren.«
»Bestell Freddie mal ’nen schönen Gruß von mir!«, rief Mark Christin hinterher.
Sie folgte Nadine ins Haus zurück. Von hinten konnte sie erkennen, dass Nadine extrem schlank war, mit einer schmalen Taille und einem wohlgeformten Hinterteil, das durch die enge Jeans betont wurde. Ihre dunklen, fast schwarzen Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden, der bei ihrem flotten Schritt auf und ab wippte.
Im Haus des Paares waren Oskar und Nico schon nicht mehr zu sehen. Nadine deutete auf eine schwarze Ledergarnitur. »Möchten Sie mit mir einen Kaffee trinken?«
Verstohlen sah die Pfarrerin sich um. An der Wand hing der größte Flachbildschirmfernseher, den sie je gesehen hatte. Auf einem Regal über der Couch standen mehrere leere Jägermeisterflaschen, um sie herum die passenden Gläser. Vor einer Theke, die das Wohnzimmer von der offenen Küche trennte, standen mit imitiertem Leopardenfell bezogene Barhocker. Die Wände waren mit Bildern geschmückt, auf denen großäugige Frauen, wahlweise mit Tränen in den Augen, wehmütig in die Ferne blickten oder mit wehenden Kleiderbahnen auf einem Pferd über einen Strand ritten.
Christin schüttelte den Kopf. »Nein, danke, gerne ein anderes Mal. Meine große Tochter ist mit der Kleinen allein, und sie möchte auch gleich weg.«
»Stimmt, Sie haben ja noch ein Baby bekommen«, sagte Nadine.
»Wir können uns gerne duzen«, bot die Pfarrerin an, und als Nadine lächelnd nickte, fuhr sie fort. »Ja, woher weißt du das?«
Sie setzte ein verschmitztes Grinsen auf, das ihr perfekt geschminktes Gesicht noch hübscher aussehen ließ. »Die Buschtrommeln!« Als Christin sie fragend anguckte, fügte sie hinzu: »Ich arbeite als Altenpflegerin in dem Seniorenheim ›Altes Rathaus‹, da wurde darüber gesprochen. Aber keine Angst«, redete sie schnell weiter, »nur Gutes! Die Oldies waren alle begeistert.«
Der Pfarrerin war Nadine sympathisch. Sie war kurz abgelenkt, denn ihr Blick fiel auf den Teil einer Tätowierung in Nadines Dekolleté. Christin war selbst tätowiert und hätte gerne den Rest von Nadines gestochenem Bild gesehen, fragte aber natürlich nicht danach.
Christin lachte auf. »Na, Gott sei Dank! Wolltet ihr nicht Karneval feiern gehen? Wann soll ich denn Oskar abholen? Es kann auch sein, dass Freddie kommt.«
»Nein«, antwortete Nadine, »wir gehen morgen früh zum Zug, das wird uns dann reichen. Da werden wir bestimmt bei Hinnemann versacken«, sie zog eine Grimasse. »Das wäre total klasse, wenn Freddie Oskar abholt. Ich wollte ihn schon bitten, das zu arrangieren.«
Fragend schaute die Pfarrerin sie an.
»Wir haben an der Terrassentür so komische Kratzspuren«, erklärte sie. Genervt verzog sie das Gesicht. »Ich habe die Befürchtung, dass da jemand reinwollte, aber Mark hat keinen Bock, dafür die Polizei zu rufen. Vielleicht könnte dein Mann da mal drauf gucken?«
Christin nickte. »Macht er bestimmt. Wann soll er dann kommen? Er hat um sieben Uhr Feierabend.«
»Das ist vielleicht zu früh.« Nadine überlegte. »Ich wollte den Jungen noch ein paar Würstchen machen, vielleicht gegen neun? Aber es kommt nicht auf die Minute an.«
»Gut«, bestätigte Christin. »Wir sehen uns dann bestimmt auch bald wieder. Viel Spaß mit den beiden!«
* * *
»Puh«, sagte Freddie später, als Christin ihn von ihrem Besuch bei Mark erzählt hatte. Flora schlummerte schon in ihrem Bett, und Mathilda war bei einer Freundin. Er strich sich nachdenklich über seine Wange. »Alles klar, ich hole Oskar jetzt direkt ab. Und ich gucke mir mal die Tür an. Im Moment ist wohl wieder irgendeine Bande unterwegs.«
»Was ist los mit dir?«, fragte seine Frau ihn erstaunt. »Soll ich Oskar abholen?«
Freddie winkte ab. »Nein, ich fahre.«
»Aber irgendetwas stimmt doch nicht! Es kommt mir fast so vor, als ob dir eine Begegnung mit Mark unangenehm wäre«, stellte Christin fest.
Ihr Mann grinste schief. »Hm. Sagen wir mal so. Unser letztes Treffen endete nicht gerade … sehr harmonisch.«
»Ach«, Christin nickte, »dachte ich mir schon. Ihr wohnt schließlich beide in Voerde und habt meines Wissens keinen Kontakt zueinander. Prügelei?«
Wider Erwarten blieb ihr Mann ernst. Wenn Freddie nicht lächelte, hatte sein Gesichtsausdruck durch die Entstellung etwas Düsteres. Sie hatte immer geglaubt, dass er dies wisse und deswegen so oft grinste und lächelte, aber Miriam, Freddies Schwester, hatte sie aufgeklärt. »Nein«, hatte sie gesagt, »Freddie lacht erst so viel, seitdem er mit dir zusammen ist.« Dann fügte sie noch hinzu: »Er hat nach dem Überfall lange gebraucht, bis er überhaupt mal ab und zu lächelte. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, sieht sein Lächeln ja auch ziemlich gruselig aus.«
Christins Herz hatte sich zusammengezogen, aber Miriam hatte recht.
»Lässt sich nicht so einfach erzählen«, sagte ihr Mann schließlich.
Christin schmiegte sich an Freddie. »Dann hol schnell Oskar, damit wir gleich in Ruhe reden können«, murmelte sie.
KARNEVALSSONNTAG
Keiner hilft einem.
Die Dinge geraten in Vergessenheit,
und nur die, die gelitten haben, erinnern sich.
Sie müssen sich selbst helfen.
Und vergessen nicht.
Es ist wie der Kern einer Bohne,
der in einem Einmachglas, auf Watte
und regelmäßig gegossen, wächst und wächst,
sobald er genügend Licht bekommt.
3. Kapitel
Focko Hieronimus trug das Wetter mit Fassung.
Es war sechs Uhr morgens, und er hatte seinem Enkel versprochen, mit ihm zum Karnevalszug in Voerde zu gehen. Über sein Smartphone informierte er sich in kurzen Abständen über die Lage in der Innenstadt. Sturm und Regen waren vorhergesagt, und er hatte schon gehört, dass die Karnevalisten den Zug eventuell absagen würden.
Aber Focko wollte gewappnet sein. Deswegen ging er schon so früh mit seiner Hündin Emma eine große Runde, damit der kleine Hund später müde war und er ihn beruhigt einige Stunden alleine lassen konnte.
Es war richtig kalt und ungemütlich. Obwohl er in Friedrichsfeld wohnte, ging er am liebsten mit seinem Hund durch Götterswickerhamm, wo er geboren wurde, aufgewachsen war und den größten Teil seines Lebens verbracht hatte. Nur die Überlegung, wo er, wenn er »mal nicht mehr könnte«, zu Fuß einkaufen und zu einem Arzt gehen konnte, hatte ihn die pragmatische Entscheidung treffen lassen, in den Friedrichsfelder Ortskern zu ziehen.
Sein Auto parkte auf dem Platz des Autohauses Bernds. Von dort aus war er, am Haus Götterswick und der evangelischen Kirche vorbei, zum Rhein gegangen, wo er die Promenade ein Stück entlanglief. Aber am Rhein, der aufgewühlt und unruhig an ihm vorbeifloss, war es ihm zu kalt. Seine kleine Hündin war schon völlig durchnässt und zitterte. So drehte er um und ging an dem Restaurant Zur Arche vorbei wieder auf die Hauptstraße zurück.
Um die Uhrzeit begegnete ihm noch kein Mensch, und nur wenige Autos befuhren die Dammstraße. Er entschied sich, den Weg über den Unteren Hilding zu nehmen, um dann an der Gerichtslinde vorbei wieder zu seinem Auto zu kommen.
Vereinzelte Fenster versuchten, mit warmem Licht gegen die graue Dämmerung anzuleuchten. Er freute sich auf seine gemütliche Küche und eine heiße Tasse Kaffee.
Bald schon ragte die mächtige Linde, die in früheren Zeiten als Thingstätte genutzt wurde, vor ihm auf. Dort würde er den Weg über den Spielplatz nehmen.
Mit jedem Schritt konnte er die Konturen des alten, mächtigen Baumes immer besser erkennen. Direkt vor der Gerichtslinde standen zwei sehr alte Grabsteine. Da ihm der Anblick dieser Stätte seit Jahrzehnten vertraut war, fiel ihm sofort auf, dass etwas an den Umrissen des Gesamtbildes nicht stimmte.
Da lag etwas. Ein Rucksack? Oder saß dort jemand? An den Baumstamm gelehnt, zwischen den dicken Wurzeln? Bei dieser Kälte?
Alarmiert ging er näher. Jetzt, in der Karnevalszeit, war vielleicht mit einem Betrunkenen zu rechnen, der den Weg in sein sicheres Zuhause nicht mehr geschafft hatte. Was bei der Kälte der vergangenen Nacht sehr gefährlich werden konnte.
Ja, dort saß jemand. Zusammengesackt, den Kopf auf die Brust gelegt, an den Stamm der Linde gelehnt.
Focko Hieronimus war ein großer Mann, der keine Angst hatte, die schlafende oder bewusstlose Person anzusprechen.
Er befahl seiner Hündin, zu warten, und ging dann zielstrebig zu dem dort Liegenden.
»Hallo?«, sprach er ihn an. Aber der Mann, wie er jetzt erkennen konnte, reagierte nicht.
Erst als er direkt vor ihm stand, sah er, dass aus der Brust des völlig reglos liegenden Mannes der Schaft eines Messers ragte, um den sich ein dunkler Fleck ausgebreitet hatte. Focko Hieronimus schluckte und atmete tief durch. Er beugte sich noch etwas weiter vor, hoffte, dass ihm das diffuse Licht einen Streich gespielt hatte und es sich vielleicht nur um ein ausgefallenes Schmuckstück handelte. Aber nein, es war tatsächlich ein Messer, das in einem menschlichen Körper steckte. Er schnappte nach Luft. Sein Blick bahnte sich langsam einen Weg zu dem von der Kapuze halb verdeckten Gesicht. »Oh mein Gott!«, entfuhr es ihm.
Er sah sich hilflos um, wollte weglaufen. Dann riss Focko sich zusammen und tastete durch die dicke Jacke des Mannes nach dem Handgelenk, um den Puls zu fühlen. Das dünne Handgelenk lag wie ein bleicher, eiskalter Knochen in seiner Hand. Das Nichts, das er fühlte, bestätigte nur den Blick des Toten aus seinen starren Augen.
* * *
Duisburg, 2004
»Freddie, kommst du mal in mein Büro?« Polizeioberkommissarin Maria Skalecki fing ihren jungen Kollegen ab, als er gerade seine Dienstwaffe in den dafür vorgesehenen Schrank schloss und die Polizeiwache verlassen wollte.
Polizeiobermeister Neumann war nicht begeistert, seine Frau wartete auf ihn, es würde schon etwa halb zehn sein, bis er zu Hause in Voerde sein würde. Aber keine Chance, wenn Skalecki ihn noch sprechen wollte, musste er parieren.
»Nur kurz, ich weiß, dass du nach Hause willst«, leitete Skalecki das Gespräch ein, als er in ihrem Büro stand.
»Wenn es um die Sache von vorgestern geht, habe ich dazu nichts mehr zu sagen«, stieß Freddie hervor. Er musste leicht den Blick heben, um ihr trotzig in die Augen gucken zu können.
Seine Vorgesetzte musterte ihn streng. Seine blonden Haare waren akkurat geschoren und verliehen seinem markanten Gesicht einen kernigen Ausdruck. Sehr attraktiv. Wäre sie ein Mann, würde sie in seiner Liga spielen. Aber natürlich war es ein Unterschied, ob man als Frau 1,90 Meter groß war oder als Mann. Und ob man als Frau ein Kreuz wie ein Raubritter hatte oder als Mann. Aber Skalecki mochte Frederick Neumann. Auch wenn sie ihn insgeheim, wenn sie etwas zu viel Whisky getrunken hatte, manchmal einen Schönling nannte. Er hatte ihr nie das Gefühl gegeben, in ihr eine unattraktive Frau zu sehen. Im Gegenteil. Von Anfang an hatte er ihr Respekt gezollt und sich an ihr gemessen.
Deswegen hatte sie ihn auch dazu gedrängt, den Antrag auf einen Laufbahnwechsel zu stellen. Von dem mittleren Polizeidienst in den gehobenen. In ihren Augen besaß er nämlich die richtigen Eigenschaften dafür. Hartnäckigkeit und Empathie. Nur seinen zweifelhaften Humor musste sie ihm noch austreiben.
»Nein, darum geht es nicht.« Skalecki durfte Freddie jetzt nicht in die Augen sehen. Aber zu spät. Mit einem kleinen Seitenblick hatte sie gesehen, wie er sie frech angrinste, und schon musste sie laut lachen. »Nein, Freddie, hör auf! Ich kann dir nicht durchgehen lassen, dass du ein Bild von Werner Immermann an das Schwarze Brett hängst, das ihn als Adonis zeigt, der seine Rente als Stripper aufbessert! Und das noch in Uniform!«
»Aber du musst zugeben, die Fotomontage ist genial«, feixte Freddie. »Ihr wolltet doch, dass ich einen Computerkurs belege, jetzt seht ihr, was man da so alles machen kann.«
Skalecki wurde ernst. »Du willst nach Hause.« Sie griff nach einer Mappe auf ihrem Schreibtisch und reichte sie ihm. »Heute habe ich einen Brief der Bezirksregierung bekommen.«
Freddies Augen weiteten sich, und er schob sein Kinn leicht vor. »Und? Mach’s nicht so spannend.«
Seine Vorgesetzte presste die Lippen zusammen und senkte den Blick. »Sie haben von deinem Verhalten hier auf der Wache gehört.« Skalecki verstummte, machte eine kleine, effektvolle Pause.
»War doch klar«, Freddie winkte ab, »ich gehöre nicht …«
»Doch Freddie!«, rief Skalecki nun laut. »Dem Antrag wurde stattgegeben! Hier sind die Unterlagen für die Kurse, die du belegen musst.« Triumphierend drückte sie ihm die Mappe in die Hände. »Hab ich doch gewusst, dass das klappen wird!«
* * *
Kurze Zeit später ging Freddie, mit der Mappe in seiner Hand, beseelt durch die Tür der Wache. Es war schon dunkel, der Herbst ging in den Winter über. Da der Parkplatz, der zur Wache gehörte, sehr beengt war und es sowieso nicht für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort einen Stellplatz gab, musste er einen kleinen Fußmarsch zu seinem Auto machen.
Er war glücklich. Der Laufbahnwechsel machte ihn sehr stolz. Seine Frau, seine Schwester Miriam und seine Eltern würden sich mit ihm freuen. Mit achtundzwanzig hatte er noch gute Chancen, richtig Karriere zu machen. Gerade als er sich innerlich darüber amüsierte, wie er vor mehr als zehn Jahren mit Ach und Krach die Mittlere Reife geschafft hatte, nahm er eine Bewegung aus dem Augenwinkel wahr.
Seine Dienststelle war in Hamborn. Nicht das beste Viertel Duisburgs, aber auch nicht das schlechteste. Er hatte keine Angst, in seiner Uniform allein durch die Straßen zu gehen, hätte er Angst, müsste er den Beruf wechseln. In dieser Straße hatte er auch bisher noch nie ein mulmiges Gefühl gehabt, sie war ihm vertraut, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.
Aber jetzt sah er einige Gestalten auf der anderen Seite des Gehwegs in geduckter Haltung herumrennen. Sie liefen auf eine andere Person zu, einen Mann. Bevor der überhaupt die sich nähernden Gestalten wahrnahm, hatten diese ihn schon umringt und bauten sich provozierend vor ihm auf.
Freddie blieb stehen, behielt die Situation im Blick.
Dann fing der erste an, dem Passanten die ausgestreckten Fäuste drohend vor das Gesicht zu halten. Mit zum Schutz erhobenen Armen wand er sich aus der Gruppe heraus, lief in einen Hauseingang. Freddie konnte nicht alles genau erkennen, die Straßenbeleuchtung wies genau an diesem Abschnitt eine größere Lücke auf. Aber er konnte genau sehen, dass die vermummten Gestalten der Person folgten.
»Du Türkensau!«, johlten sie jetzt. Jugendliche Stimmen.
Langsam wurde Freddie wütend. Er blickte zurück zu der Polizeiwache, aus der er vor wenigen Minuten gekommen war. Die Nachtschicht hatte gerade eben begonnen, Skalecki war schon auf dem Weg nach Hause.
Das Geschrei der Gruppe wurde lauter und aggressiver. Nun wurden eindeutig rechtsradikale Liedzeilen gegrölt.
Freddie fasste einen Entschluss. Er würde eingreifen, sich aber sofort zurückziehen, falls er die Situation unterschätzt hatte.
Er ging über die Straße. »Halt!«, rief er, »Polizei! Was macht ihr da?« In diesem Moment kam sich Freddie selber blöd vor. Erwartete er etwa, dass einer dieser Typen sich vorstellte und ihm erklärte, dass sie einen türkischen Mitbürger verprügeln wollten?
Während er überlegte, Verstärkung zu rufen, beobachtete er, wie jetzt sowohl der Türke als auch die Gruppe Randalierer in dem Hauseingang verschwanden.
Nein, dachte Freddie, jetzt schnell hinterher. Nun rannte er auch auf die wie ein dunkles, großes Maul geöffnete Toreinfahrt zu. Es war sehr dunkel, die Beleuchtung war aus oder kaputt, Freddie sah gar nichts. Nein, zu gefährlich! Dann hörte er unterdrückte Schreie. Sein Herz klopfte, Adrenalin rauschte durch seinen Kopf. Er griff zu der Stelle, an der normalerweise seine Dienstwaffe steckte, aber nein, er hatte Dienstschluss, die Waffe war ordnungsgemäß im Waffenschrank auf der Wache.
Scheiße, dachte er, kniff seine Augen zusammen, um besser sehen zu können, und ging weiter. Er kam auf einen teilüberdachten Hof. Dort, wo die Überdachung einen Schatten warf, war es noch dunkel, aber aus einigen Fenstern sah er Licht in den Hinterhof fallen. In dem dunklen Bereich erkannte er zwei der Gestalten, die ihn mit vor dem Körper verschränkten Armen zu erwarten schienen.
Plötzlich hörte er eine Stimme hinter sich. »Oh! Die Polizei! Du siehst aber auch echt gefährlich aus.«
Freddie drehte sich um. Zwei Personen, der Gestalt nach Männer, standen dicht hinter ihm. Trotz der Dunkelheit konnte er erkennen, dass sie Sturmhauben über ihre Gesichter gezogen hatten. Sie kamen näher und trieben ihn auf die anderen beiden Typen zu. Ganz ruhig bleiben, dachte er, bleib ruhig, die werden es nicht wagen, mich anzugreifen. Er sah aus den Augenwinkeln eine schmale Gestalt über den Hof laufen. Sollte er sie ansprechen? Oder brachte er sie damit auch in Gefahr?
Bevor er einen Entschluss fassen konnte, rammte ihm der erste der Männer die Schulter gegen seine Brust. Überrascht taumelte er nach hinten, wo sich die Hände eines anderen wie Schraubstöcke um seinen Bizeps legten und seine Arme fixierten. Er versuchte, sich aus diesem Griff zu befreien, fast wäre es ihm auch gelungen, als er den ersten Schlag in den Magen spürte. Freddie war schon oft in ein Handgemenge verwickelt gewesen. Seitdem er bei der Polizei war, hatte er Judo gelernt und trainierte regelmäßig. Aber so einen Schlag hatte er noch nie bekommen. Sein Oberkörper versuchte reflexartig, zusammenzuklappen, der Typ hinter ihm hielt aber weiter seine Arme umklammert. Freddie schossen die Tränen in die Augen, er schnappte nach Luft. Dann kam der nächste Schlag und ihm wurde klar, dass er in eine Falle getappt war. Er versuchte, zu schreien. Der nächste Treffer landete in seinem Gesicht. Er hörte das rohe, hämische Gelächter und in der Ferne meinte er, das hysterische Gekicher einer Frau wahrzunehmen. Endlich wurde er losgelassen und durfte sich zusammenkrümmen. Aber die Stiefelspitze einer seiner Angreifer traf sein Gesicht trotzdem, und er hörte etwas in seinem Kiefer knacken. Alle Versuche, sich irgendwie zu schützen, liefen ins Leere. Freddie kam sich wie ein zaghaft zappelndes Baby vor, das gar nicht wusste, wie es sich schützen kann. Wie lange musste er das aushalten?
Als er meinte, sterben zu müssen, hörten die Schläge und Tritte plötzlich auf. Er blieb regungslos auf dem kalten Pflaster des Hofes liegen, seine Augen waren geschwollen, warme, schleimige Flüssigkeit lief aus seiner Nase. Freddie konnte die Schemen der schwarzen Stiefel erkennen, die um ihn herumstrichen wie Hyänen, die auf ihren Teil der Beute warten.
Keiner sagte etwas. Die Stille fraß sich wie Salzsäure in Freddies Bewusstsein.
Gerade, als er glaubte, die Schläger hätten die Lust an weiteren Attacken verloren, hörte er das ratschende Geräusch eines Feuerzeugs. Mit letzter Kraft versuchte er, seinen Blick nach oben zu drehen. Der Polizist sah den tanzenden Lichtschein einer Fackel, der den dunklen Hof etwas erhellte.
Dann kam die Flamme näher. Ab und zu meinte er wieder, ein helles Kichern zu hören, wie von einem Mädchen. Brutale Hände griffen wieder nach seinen Armen und drückten sie auf den Boden. Jemand presste Freddie ein Knie auf den Brustkorb, ein anderer setzte sich auf seine Oberschenkel. Völlig unfähig, sich zu bewegen, breitete sich langsam Panik in seinem Körper aus, stieg wie ein fester Knoten in seine Kehle. Freddie ahnte, dass es noch nicht zu Ende war, dass sie aus irgendeinem Grund noch nicht mit ihm fertig waren.
Er konnte Wärme spüren, die sich seinem Gesicht näherte. Er war geblendet, schloss die Augen. Die Wärme wurde zur Hitze.
Freddie spürte, wie ihm brutal etwas Weiches in die Kehle gedrückt wurde, dann schoss ein Schmerz durch sein Bewusstsein, von dem er niemals gedacht hätte, dass es ihn gab.
* * *
Kurz nachdem Polizeihauptkommissar Michael Schlüter und seine junge Kollegin, Polizeioberkommissarin Katja Weber, in Götterswickerhamm ihr Auto geparkt hatten und in Richtung Gerichtslinde gegangen waren, kamen, mit Blaulicht, gleichzeitig der Rettungswagen und der Notarzt an.
Schlüter deutete auf Katjas Kopf. »Steht dir gut«, sagte er und verzog dabei keine Miene.
Katja griff, verlegen lachend, mit einer Hand an ihre dicke, dunkelblaue Wollmütze, unter der ein paar quietschrosa gefärbte Strähnen hervorlugten. »Danke«, antwortete sie, »du müsstest mal Elli sehen!«
»Oh Gott!«, stöhnte Schlüter mit gespieltem Entsetzen. »Bitte nicht! Diese Mähne möchte ich nicht in Schweinchenrosa sehen! War’s denn nett, gestern Abend?«
Katja nickte. »Es war grandios! Schade, dass du nicht dabei warst. Stell dir vor, Skalecki kam als Brienne von Tarth und Rolf als ›der Berg‹. Die beiden sahen so klasse aus!«
Schlüter sah sie verständnislos an, aber bevor sie ihm erklären konnte, welche Figuren die beiden auf der Karnevalsparty auf dem Reiterhof dargestellt hatten, kamen die beiden Polizisten an dem alten Baum an.
Focko Hieronismus, der die 110 gewählt hatte, deutete winkend mit dem Finger auf den Boden vor der riesigen Linde. Genau daneben, mitten auf der Straße, bremste der Rettungswagenfahrer und sprang gleichzeitig mit seiner Beifahrerin aus dem Auto. Hinter ihnen hielt der Notarztwagen. Genauso zügig wie die Besatzung vor ihr stieg die Notärztin aus und ging mit großen, schnellen Schritten zu der hilfebedürftigen Person, aber an den Gesichtern ihrer erfahrenen Kollegen konnte sie schon erkennen, dass wohl jede Hilfe zu spät kam. Die trüben Augäpfel und die wächserne Gesichtsfarbe mit den fast hellblauen Lippen zeigten der Ärztin, dass sie einen Toten vor sich hatte. Sie beugte sich zu dem leblosen Mann hinunter und schüttelte den Kopf, nachdem sie ergebnislos nach einem Puls an seiner Halsschlagader gesucht hatte.
Schlüter und Katja reagierten sofort. Waren sie bis dahin noch in dem gelassenen Routinemodus, fing das eingespielte Team sofort an, die vorgeschriebenen und nötigen Schritte abzuarbeiten.
Katja ging zu ihrem Einsatzwagen und holte Absperrband heraus. Michael Schlüter griff sofort zum Telefonhörer.
»Ist Skalecki schon ansprechbar?«, fragte er seine Kollegin, die mit hektisch geröteten Wangen Focko Hieronimus anwies, rückwärts und mit großen Schritten den Fundort zu verlassen.