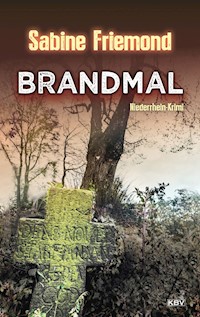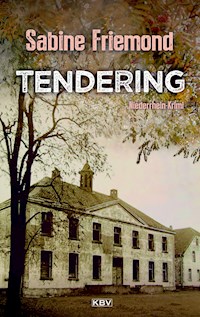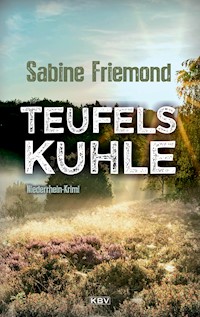
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Christin Erlenbeck
- Sprache: Deutsch
Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Eine völlig betrunkene Frau wird nachts von den Polizisten Freddie und Schlüter aufgegriffen. Den Beamten der Voerder Wache ist Laura nicht unbekannt. Vor über zwanzig Jahren wurde ihre Mutter Nicole Bauer - eine Kollegin - auf einem Waldweg angefahren und starb. Die Umstände jener schicksalshaften Nacht wurden nie aufgeklärt, der Fahrer des Wagens nie gefunden. Ein bislang unbekanntes Tagebuch wirft bei Freddies Freundin, der Pastorin Christin Erlenbeck, Fragen auf. Und wieder einmal kann sie nicht anders und muss sich auf die Suche nach den dazugehörigen Antworten machen. Während die Polizisten in einer Reihe von mysteriösen Todesfällen ermitteln, forscht sie nach der Wahrheit im Falle des Todes von Nicole Bauer. Und alle stoßen bei ihrer Suche immer wieder auf den sagenumwobenen Schwarzen Mann, der an der Teufelskuhle, einem geheimnisvollen Ort in der Spellener Heide, sein Unwesen treiben soll. Handelt es sich dabei nur um eine Legende? Oder gibt es diese finstere Gestalt wirklich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Hochbahn
Sabine Friemond, geb. 1968 in Duisburg, wuchs in der Gemeinde Spellen am Niederrhein auf. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Über Stationen in München, Nürnberg und Mosbach landete sie – nun verheiratet und mit drei Kindern – wieder in ihrer alten Heimat und führt dort seit 2009 eine eigene Buchhandlung. Teufelskuhle ist ihr zweiter Kriminalroman.
Sabine Friemond
Teufelskuhle
Originalausgabe
© 2020 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von © RuZi - stock.adobe.com
Print-ISBN 978-3-95441-544-1
E-Book-ISBN 978-3-95441-553-3
Für Frank.
Inhalt
Über den Autor
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Ein Wort an den Leser!
Prolog
Mitternacht, 23. Juli 1937
Vollmond. Genau wie erwartet.
Friedhelm lag regungslos in seinem Bett und hielt den Atem an. Das Mondlicht erhellte die Baracke, in der er mit seiner Familie wohnte. Schemenhaft konnte er den Kleiderschrank erkennen, daneben den Stuhl, auf dem er beim Zubettgehen am Abend absichtlich seine Strickjacke und seine Hose hatte liegen lassen. Es war zwar warm, aber wenn sie das, was sie geplant hatten, tatsächlich schaffen würden, wäre ihm anschließend bestimmt kalt. Deswegen die Jacke.
Langsam schob er die Bettdecke nach unten und streckte gleichzeitig ein Bein über die Bettkante. Dann drehte er, nicht ganz so behutsam, seinen Oberkörper auf die linke Seite, zum Rand des Bettes hin. Er horchte, ob sich eine seiner beiden kleinen Schwestern, die mit ihm in dem Zimmer schliefen, rührte. Aber es blieb alles still. Mit einer geschmeidigen Bewegung glitt er aus dem Bett. Wenn jetzt jemand wach werden würde, könnte er immer noch sagen, dass er nur auf die Toilette müsste.
Aber nein, keiner richtete sich auf und stellte Fragen. Waltraud und Sieglinde schliefen tief und fest weiter. Fast bedauerte er dies.
Wenn Werner nicht draußen auf ihn warten würde, dann würde er tatsächlich nur aufs Klo gehen und anschließend wieder unter seine Bettdecke kriechen. Aber er glaubte nicht daran. Werner war so entschlossen, diese Mutprobe zu bestehen, dass er wahrscheinlich schon längst am Ehrenmal auf ihn wartete.
Friedhelm schlich mit nackten Füßen über die Holzdielen. Er griff sich die Jacke und die Hose, drückte vorsichtig die Türe auf und trat in den Flur.
Immer noch alles still.
Das Schlafzimmer seiner Eltern lag direkt neben dem Kinderzimmer. Beide Räume bildeten den Abschluss der rechteckigen Baracke, in der Friedhelm mit seiner Familie und den Witwen Frau Meier und Frau Mai wohnte. Seine Eltern ließen ihre Türe immer einen Spaltbreit auf, so konnte er noch deutlicher seinen Vater schnarchen hören.
Er schlich den langen Flur, der genau in der Mitte der Baracke lag, weiter Richtung Haustür. Zuerst kam er an den Zimmern der Witwen vorbei, von denen jeweils eins links und rechts des Flures lag. Er ging am Wohnzimmer vorbei. Aus der Waschküche griff er sich seine ausgetretenen Sandalen – die, die er nur noch zum Spielen anziehen durfte. Am Ende des Flures lagen, links und rechts von der Haustür, die Küche und die Toilette. In beiden Räumen gab es einen Wasseranschluss. Darüber freute sich besonders seine Mutter, die deshalb nicht, wie viele andere Hausfrauen in der Friedrichsfelder Barackensiedlung, das Wasser für den Haushalt mühselig an einer Gemeinschaftspumpe holen musste.
Bevor Friedhelm durch die Haustür ins Freie schlüpfte, zog er sich seine Hose, die Strickjacke und die Sandalen an.
Genau in dem Moment, als er vorsichtig die Haustür von außen schloss, hörte er zweimal das Läuten der Glocke der katholischen Kirche, die im ehemaligen Offizierskasino untergebracht war. Erschreckt zuckte er zusammen.
Halb zwölf. Ihnen blieb noch genug Zeit.
Durch das Licht, das der volle Mond spendete, hatte Friedhelm überhaupt keine Probleme, den Weg zu finden. Auch ohne den hellen Mondschein, selbst in völliger Dunkelheit, hätte er sich zurechtgefunden. Seit seinem zweiten Lebensjahr, also seit acht Jahren, lebte er mit seinen Eltern in der ehemaligen Leutnantsbaracke Nummer sieben. Die Siedlungsgesellschaft der Stadt Dinslaken, die nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg das Barackenlager und den Truppenübungsplatz übernommen hatte, vermietete die Baracken als günstigen Wohnraum, unter anderem auch an kinderreiche Familien
Wenn er nicht in der Schule war, rannte er mit den anderen Kindern zwischen den Baracken umher. Im Winter bewarfen sie sich mit Schneebällen und bauten Schneemänner. Im Sommer, so wie jetzt, spielten sie im Sand oder erkundeten die Heide, immer die Augen offen, in der Hoffnung, alte Patronen der Soldaten, die vor ihnen in den Baracken gewohnt hatten, zu finden.
Auf dem kurzen Weg zum Ehrenmal im Offizierspark dachte er über das Abenteuer nach, zu dem ihn sein Freund Werner angestiftet hatte. Werner, stets eine Spur frecher als er. Immer etwas waghalsiger. So wie letzte Woche, als sie wieder in einen Streit mit den Jungen, die mit ihren Familien in den ehemaligen Mannschaftsbaracken wohnten, geraten waren. Friedhelm blieb immer defensiv, wenn sie ihr »Revier«, die Wege und Plätze rund um die früheren Leutnantsbaracken Nummer sieben bis zwölf, verließen. Dort waren die Kinder, die er kannte, Nachbarskinder, bei denen man ein- und ausging. Aber nur einen kleinen Marsch weit entfernt, schräg über die Wilhelmstraße, rotteten sich andere Kinder zusammen, die eine eigene Gruppe bildeten. Vielleicht lag es daran, dass deren Eltern aus Ostpreußen vertrieben worden waren und sie das Gefühl hatten, sich ihre neue Heimat noch erkämpfen zu müssen, vielleicht waren »die anderen« einfach auch nur etwas älter und somit auch draufgängerischer. Jedenfalls lachten sie Friedhelm und Werner einfach aus, als sie erfuhren, dass die beiden noch nie den »Schwarzen Mann« gesehen hatten.
»Man sieht ihn nur bei Vollmond«, höhnten sie. »Aber da liegt ihr Memmen ja brav im Bett.«
Der Schwarze Mann.
Friedhelm hatte schon mal von ihm gehört, aber er konnte sich nicht erklären, wieso ein schwarzer Mann an der Teufelskuhle, hinter dem erst ein paar Jahre alten Kommunalfriedhof, herumgeistern sollte.
»Uahhh!«, brüllte Hans, ein großer Junge, breitete seine Arme aus und wankte auf die beiden eingeschüchterten Jungs zu. »Ersoffen bin ich!« Dramatisch schnappte er nach Luft und rollte mit den Augen.
»Beim nächsten Vollmond werden wir ihn auch sehen!«, schrie Werner wütend zurück.
»Das traut ihr Bubis euch niemals!«, lachte Hans ihn aus.
»Doch, bestimmt!«, beharrte Werner. »Oder, Friedhelm?« Werner stieß ihn in die Seite.
»Ja, bestimmt!«, unterstütze Friedhelm seinen besten Freund, wobei er sich anstrengen musste, seiner Stimme einen festen Klang zu geben, da er nicht unbedingt von dem Vorhaben begeistert war.
»Gut, dann schwört auf unser Vaterland, dass ihr nächste Woche bei Vollmond zur Teufelskuhle geht und auf den Schwarzen Mann wartet!«, verlangte Hans von den beiden jüngeren Buben.
Hans’ Freunde kamen immer näher. Alle grinsten, einige von ihnen fingen an, quäkend wie kleine Kinder zu heulen.
So kam es, dass Friedhelm sich jetzt mitten in der Nacht auf den Weg zum Ehrenmal machte, um dort Werner zu treffen.
Wie erwartet stand sein Freund schon im Schatten des Denkmals für die gefallenen Soldaten des Franzosenkrieges von 1870/71, einem Krieg, an den sich nur noch die Großeltern erinnern konnten.
»Da bist du ja endlich!«, maulte Werner. »Komm, lass uns rennen.«
Eigentlich war der Weg zur Teufelskuhle nicht weit. Die beiden Jungs liefen die Hindenburgstraße Richtung Dinslaken entlang. Sie querten die Von-Einem-Straße, die jetzt, mitten in der Nacht, menschenleer war. Vorsichtshalber hielten sie sich in der Deckung der Bäume, die links und rechts wuchsen. Der raue Asphalt strahlte noch die Wärme des heißen Sommertages aus.
Friedhelm hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch.
Es war totenstill. Selbst von den Bäumen, die entlang der Hauptverbindungsstraße zwischen der alten Garnisonsstadt Wesel und der Kreisstadt Dinslaken standen, hörte man keinen Laut. Da es windstill war, raschelten auch keine Blätter. Tagsüber schossen ab und zu Motorräder mit lautem Geknatter in beide Richtungen, flitzten Fahrradfahrer hin und her, transportierten Omnibusse ihre Fahrgäste von Wesel nach Dinslaken und zurück. Und immer mehr Automobile fuhren über den Asphalt. Neidisch blickten Friedhelm und Werner den wenigen Autofahrern hinterher, die Hitlers »Volksmotorisierung« schon umgesetzt hatten. Den einzigen Autobesitzer, den sie in Friedrichsfeld kannten, war der Arzt Dr. Blanke.
Kurz vor van de Sand hielten die beiden Jungen an. Das imposante Gebäude der Gaststätte wurde von dem schimmernden Licht des Mondes dramatisch in Szene gesetzt. Aber obwohl es die Nacht von Freitag auf Samstag war, lag auch das Lokal in absoluter Stille. Gegenüber der Gaststätte, auf der anderen Straßenseite, befand sich der Eingang zum Friedhof. Aber so weit wollten die beiden Jungen gar nicht, denn hinter der nördlichen Begrenzung des Friedhofs führte ein Trampelpfad zur Teufelskuhle, einem Gewässer mitten in der Heidelandschaft.
»Hast du immer noch Schiss?«, keuchte Werner völlig außer Atem und grinste dabei breit. »Es ist doch fast taghell! Wir gehen jetzt zur Teufelskuhle, werden einmal da reingehen und untertauchen, und dann verschwinden wir wieder in unsere Betten.«
»Den ›Schwarzen Mann‹ gibt es gar nicht. Wie können wir nur so blöd sein und ihn mitten in der Nacht sehen wollen?«, moserte Friedhelm.
Dann huschten sie über die Straße. Der schmale Weg zur Teufelskuhle führte sie nun am Friedhof vorbei über den alten Truppenübungsplatz. Über die von jahrelangen Schieß- und Exerzierübungen zerstörte Heidelandschaft breitete sich immer mehr ein Dickicht aus Sträuchern und jungen Bäumen aus.
Friedhelm würde es niemals zugeben, aber um Mitternacht, denn das müsste es jetzt langsam sein, direkt in Sichtweite der Gräber zu gehen, um den »Schwarzen Mann« zu treffen, verängstigte ihn nun doch etwas. Auch das freundliche Mondlicht kam ihm nun viel dunkler und bedrohlicher vor.
Sein Freund Werner schritt, immer noch schwer atmend, zielstrebig voran. Dann endete der Zaun, der den Friedhof umgab, und deutlich zeichneten sich die Wälle ab, an deren Enden die preußischen Soldaten früher gestanden und mit Gewehren und Pistolen geschossen hatten. Nur noch ein paar Meter, dann würden sie vor der Teufelskuhle stehen.
»Komm, lass uns jetzt nach Hause gehen«, drängte Friedhelm. »Wir können doch einfach sagen, dass wir hier waren, aber den ›Schwarzen Mann‹ nicht getroffen haben. Wie auch? Den gibt es ja gar nicht!«
»Wir haben geschworen, dass wir heute hierhin kommen«, beharrte Werner, »und du weißt, seinen Schwur bricht man nicht.« Werner war begeisterter Karl-May-Leser.
Du hast es geschworen, dachte Friedhelm trotzig.
Dann standen sie vor der Teufelskuhle. Wie ein kleiner, länglicher See lag sie vor ihnen. Tagsüber, wenn die Kinder und auch so manche Erwachsene den Weg hierhin fanden, um sich in der sommerlichen Hitze abzukühlen, war das Wasser durch den aufgewirbelten Sand trüb, aber jetzt, in der Ruhe der Nacht, schimmerte es glasklar.
Auch hier eroberten schon Gräser und kleine Eichen und Kiefern den Rand des Gewässers. Teilweise wucherten dichte Büsche bis ins Wasser hinein und warfen dunkle Schatten.
Da, bewegte sich da nicht etwas?
Friedhelm ballte seine Hände vor Nervosität immer wieder zu Fäusten. Die Teufelskuhle war nur wenige Meter lang und breit, aber trotz des hellen Vollmondes konnte er das gegenüberliegende Ufer nicht genau erkennen.
Werner zog sich schon sein Hemd und seine Hose aus. »Los, jetzt beeile dich«, trieb er Friedhelm an, »du willst doch so schnell wie möglich wieder in deine Pofe!«
Zögerlich zog sich nun auch Friedhelm aus.
Nur noch in Unterhosen standen die beiden Jungen an der Teufelskuhle. Im Gegensatz zu ihren braungebrannten Gesichtern schien es fast so, als leuchteten ihre schmalen, hellen Oberkörper. Beide hatten am ganzen Körper eine Gänsehaut. Sie sahen sich an und Friedhelm musste nun doch ein wenig grinsen.
Normalerweise sprangen sie mit Geschrei in das kühle Wasser, aber jetzt, als ob sie es abgesprochen hätten, wateten sie nur langsam hinein, Schritt für Schritt.
Was dann passierte, würden beide, Friedhelm und Werner, den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen.
1. Kapitel
Dienstag, 29. Mai 2018, abends
Christin Erlenbeck starrte wehmütig auf die rotschimmernde Flüssigkeit in dem Weinglas, das vor ihr auf dem Schreibtisch stand. Sie war in den letzten Wochen sehr geschäftig gewesen. Als sie die Stelle als Pfarrerin in der evangelischen Gemeinde Grünstraße angenommen hatte, Anfang des Jahres, hatte sie auch gleichzeitig die Betreuung von zwei Konfirmandengruppen übernommen. Diese Veränderung mitten im Vorbereitungsjahr und, wie sie zugeben musste, ihre eigene Nervosität, hatten sich natürlich auch auf die Jugendlichen ausgewirkt, und es hatte sie einiges an Mühe gekostet, Ruhe in die letzten Wochen vor diesem großen Ereignis zu bringen. Aber nun war es geschafft, die letzte Konfirmation war gefeiert worden, und alles in allem hatte sie das Gefühl, mit den Teenagern und deren Eltern eine schöne Zeit verbracht zu haben.
Jetzt saß sie in ihrem gemütlichen Büro, ihre Kinder, Mathilda und Oskar, lagen schon in ihren Betten, und sie versuchte, ein Schreiben an die frisch konfirmierten Jugendlichen und deren Eltern aufzusetzen. Das Problem war nur, dass die eingekehrte Ruhe sie nun mit dem konfrontierte, was sie die letzten Wochen verdrängt hatte. Nein. Was sie bewusst auf sich hatte zukommen lassen. Ihr Körper wusste Bescheid, hatte schon alles entschieden. Das Eingießen des Rotweins war nur ein Ritual.
Als sie mit dem Brief fertig war, wusste sie, dass es an der Zeit war, auch ihren Verstand tätig werden zu lassen. Seufzend stand sie auf, nahm das Glas mit dem Rotwein, ging in die Küche und schüttete es, wie in den letzten Wochen schon zweimal zuvor, in den Ausguss der Spüle. Als sie sich stattdessen roten Traubensaft nahm, musste sie schmunzeln. Aber sie liebte den fruchtigen, herzhaften Geschmack roter Trauben nun einmal.
Der Tag war warm gewesen. Schwülwarm. Für den nächsten Tag waren Gewitter und Regen vorhergesagt. Das kann ja ein schöner Sommer werden, dachte Christin spöttisch. Der Vollmond strahlte warm in die Küche, in der sich die Hitze des Tages staute. Die Fenster waren schon alle auf, die Kühle der Bodenfliesen tat ihren nackten Füßen gut. Laika, ihre Wolfsspitzhündin, schleppte sich hechelnd vom Flur in die Küche, wo sie sich ohne Umschweife direkt vor Christin auf den Boden fallen ließ.
Die Pfarrerin setzte sich an den Küchentisch.
Dachte nach.
Freddie war sie, so gut es ging, aus dem Weg gegangen, hatte viel Arbeit vorgetäuscht, was ja auch stimmte. Sie starrte in den Traubensaft. Die Kinder fragten schon. Nein, eigentlich nur Oskar. Mathilda schaute sie ständig mit großen Augen von der Seite an. Sie war jetzt dreizehn Jahre alt, aber viel sensibler als gleichaltrige Mädchen. Zu sensibel.
Der zehnjährige Oskar war genau das Gegenteil von seiner Schwester. Direkt, neugierig und laut. Also genau so, wie sie es selber als Teenager gewesen war. Oskar wollte, nach den dramatischen Geschehnissen im Frühjahr, unbedingt Polizist werden und unternahm so viel wie möglich mit Frederick Neumann. Eigentlich alles klar.
Mit schlechtem Gewissen sah sie, wie ein paar Tropfen des roten Saftes die Außenwand des Glases heruntergelaufen waren und nun auf dem frisch gescheuerten Holztisch rote Ränder hinterließen.
Da wird Frau Fohrmann schön schimpfen, dachte Christin, und das mit Recht. Die schon ältere Frau Fohrmann hatte die Pfarrerin von ihrem Vorgänger Manfred Lindemann »geerbt«, sie kümmerte sich ein paar Stunden in der Woche um die Haushaltsbelange, die Christin gerne vernachlässigte. Wie zum Beispiel das Scheuern alter Holztische.
Sie stand auf, nahm einen Lappen aus der Spüle und putzte die Traubensaftränder gründlich weg. Dann räumte sie ihr Weinglas in die Spülmaschine und deckte den Frühstückstisch für den nächsten Morgen. Schließlich ging sie noch eine kurze Abendrunde mit Laika.
Als sie auf ihrem Bett saß, griff sie zu ihrem Handy. Sie hatte einen Entschluss gefasst.
Frederick Neumann hatte Nachtschicht. Die Minuten vergingen kaum, es war ruhig, nichts los, als ob die schwülfeuchte Luft auch die Gemüter dämpfte. Das war ihm natürlich recht. Einerseits war er versucht, den Kopf auf die Tischplatte zu legen und ein bisschen zu schlafen, andererseits wusste er, dass seine Gedanken dann sowieso nur Karussell fahren würden.
Gestern noch waren er und Oskar mit Laika am Tenderingssee spazieren gegangen. Er hatte gehofft, dass Christin mitkommen würde, aber, wie so oft in letzter Zeit, hatte sie sich nur lächelnd entschuldigt und sich darüber gefreut, dass sie nicht selber mit dem Hund gehen musste. Als er dann vom Spaziergang wiederkam, war sie weg.
Er hätte auch gerne mal Skalecki, seine alte Duisburger Kollegin, mit der er gerade erst einen Fall gelöst hatte, und ihren Mann zu einem gemeinsamen Essen eingeladen, aber da er nicht wusste, woran er gerade mit Christin war, fand er ein gemütliches Pärchenessen unpassend.
Er strich sich mit einer Hand vorsichtig über seine linke Gesichtshälfte. Durch das schwül-heiße Wetter spürte er sein vernarbtes Gewebe besonders unangenehm. Er hatte das Gefühl, als ob er ein ABC-Pflaster auf seiner Wange kleben hätte.
Gerade als er aufstehen wollte, um sich kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen, brummte sein Handy.
Laura Bauer konnte nicht mehr. Sie schwitzte, und die Übelkeit drückte ihr die Kehle zu, immer wieder musste sie würgen, aber es kam schon längst nichts mehr aus ihrem Magen hoch, nur noch giftbittere Galle. Fast noch schlimmer war, dass sie überhaupt keinen klaren Gedanken mehr hinbekam. Sie hätte sich sonst schon längst ein Taxi gerufen, statt mitten in der Nacht den Weg aus der Dinslakener Altstadt bis nach Voerde zu laufen. Aber es war, als ob in ihrem Kopf dicke, feuchte Watte herumschwappte.
Obwohl man sie in dem hellen Vollmondlicht gut sehen konnte, hielt keines der paar Autos, die um diese Zeit noch fuhren, an. So schleppte sie sich auf wackeligen Beinen weiter. Ihr dünnes, schwarzes Top klebte an ihrem Körper, die Träger rutschten dauernd herunter und entblößten fast ihre Brüste. In ihrer hautengen Röhrenjeans fühlte sie sich wie in einer Zwangsjacke, ihre klobigen Boots hatte sie schon längst irgendwo ausgezogen und liegen gelassen. Unter einer Wollmütze undefinierbarer Farbe quollen Lauras rotblonde Dreadlocks hervor, ihr verschmierter Lippenstift ließ sie wie einen unglücklichen Clown aussehen.
Bis zum Wohnungswald hatte sie es bisher geschafft. Die Straße führte jetzt zwischen den Bäumen durch, und sofort spürte sie eine wohltuende Kühle auf der Haut. Mit eisernem Willen torkelte sie weiter. Nur noch durch den Wohnungswald, dann … verzweifelt wurde ihr bewusst, wie weit sie noch von dem, was wohl ihr Zuhause sein sollte, entfernt war.
Etwas ausruhen. Danach würde es besser gehen.
Im Graben neben dem Fahrradweg lagen ein paar Holzstämme. Laura fiel fast der Länge nach hin, als sie über die Grasnarbe zu dem Holzstapel stolperte. Vorsichtig drehte sie sich um und setzte sich hin. Die Holzstämme hielten. Ausgiebig kratze sie sich ihre Kopfhaut, wobei die Mütze endgültig herunterrutschte. Dann sackte die junge Frau in sich zusammen und schlief ein.
»Freddie!« Polizeioberkommissar Michael Schlüter riss ihn aus seinen Gedanken. Das Telefonat mit Christin vor einer Stunde hatte ein mulmiges Gefühl in ihm zurückgelassen.
»Ich muss mit dir reden«, hatte sie ohne Einleitung gesagt.
»Ja, ich glaube auch«, hatte er so selbstbewusst wie möglich gekontert, obwohl ihm das Herz bis zum Hals schlug.
»Donnerstag?«
»Ich komme am Nachmittag.«
»Gute Nacht«, dann hatte sie schon aufgelegt.
»Komm, da liegt eine Person im Straßengraben im Wohnungswald in Richtung Dinslaken«, Schlüter griff schon nach dem Autoschlüssel.
»Rettungswagen?«, fragte Freddie.
»Hat der Anrufer schon gerufen«, entgegnete sein älterer Kollege.
Zügig fuhren sie die Frankfurter Straße entlang, dann hinter dem stillgelegten Kraftwerk links, um zur Dinslakener Straße zu kommen. Diese fuhren sie in Schrittgeschwindigkeit entlang, auf der Suche nach der besagten Person. Schon bald sahen sie das Blaulicht eines Krankenwagens.
»Sturzbetrunken, aber kein Fall für uns«, empfing sie einer der Rettungssanitäter, »sie sieht zwar fertig aus, ist aber stabil und schlummert wie ein Baby.«
»Oh nein«, Schlüter verzog das Gesicht, »ich hab keinen Bock, dass die uns die Zelle vollkotzt! Oder schon das Auto! Die braucht doch bestimmt ärztliche Hilfe.«
»Nein, keine Chance«, grinste der Sanitäter, »bei der Hitze haben wir genug mit den Herzpatienten zu tun.«
»Irgendwelche Papiere gefunden?«, Freddie betrachtete die junge Frau, die schlafend eher wie ein junger Teenager aussah. Sie kam ihm bekannt vor.
»Noch nicht«, antwortete der Sanitäter. Vorsichtig richtete er ihren Oberkörper auf. Mit einem Blick erkannte er, dass nur die Hosentaschen einen möglichen Hinweis auf ihre Identität zulassen könnten. Er schob seinen Zeige- und Mittelfinger in die vorderen Taschen, zuckte aber nur mit den Schultern, als er dort nichts fand. Dann half Freddie ihm, die Schlafende nach vorne zu kippen, so dass sie an die Gesäßtaschen kamen. Triumphierend zog er eine EC-Karte aus der rechten Tasche. Freddie lehnte die junge Frau wieder gegen den Holzstapel und nahm die Bankkarte, die ihm der Rettungswagenfahrer entgegenstreckte.
»Mensch, klar«, rief Freddie aus, »das ist Laura, Laura Bauer!«
»Laura Bauer? Oh Mann!« Schlüter schüttelte den Kopf.
»Ja«, murmelte Freddie, »allerdings.«
Bist du noch wach?
Nein.
Brauchen deine Hilfe, kommen gleich.
Immer, wenn er sie sah, schlug sein Herz schneller. Auch jetzt, mitten in der Nacht. Mit zerzausten Haaren und einer aufgeregt hechelnden Laika neben sich öffnete Christin ihre Haustür.
»Oh! Hallo!«, überrascht musterte sie die drei Personen, die vor ihr standen.
Michael Schlüter und Frederick Neumann stützten in ihrer Mitte eine junge Frau, die offensichtlich völlig betrunken war.
»Nisch na Hause«, nuschelte sie, »nisch, sons bringisch sie um.«
»Pscht«, beruhigte Christin Laura, »hier bringt niemand jemanden um. Kommt rein«, und zu Freddie gewandt, »du hast mir da einiges zu erklären!«
2. Kapitel
Samstag, 26. Oktober 1996
Polizeiobermeister Jens Kahler saß breitbeinig auf seinem Bürostuhl, die Arme vor der Brust verschränkt. Er schüttelte den Kopf und grinste seine Kollegen an.
»Total asozial«, schnaubte er, »und die Alte, also kein Wunder, dass der ihr eine gepfeffert hat.«
»Und wie das da gestunken hat!« Uli Brücker hielt sich geziert die Nase zu und riss seine Augen dramatisch auf. Fast alle lachten.
»Spinnst du?« Nicole Bauer stand von ihrem Schreibtischstuhl auf. »Fällt dir bei dem Anblick von diesem Elend nichts anderes ein, als dämliche Witze zu reißen?«
Uli Brücker und Michael Schlüter verstummten.
Bisher war die Nachtschicht auf der Polizeiwache Voerde ruhig verlaufen. Die vier diensthabenden Polizisten Nicole Bauer, Uli Brücker, Michael Schlüter und Jens Kahler konnten sogar ungeliebten Papierkram erledigen. Dann wurden Kahler und Bauer zu einem Einsatz zum Buschacker in Voerde gerufen. Ein älteres Ehepaar fühlte sich von dem Geschrei in der Nachbarwohnung belästigt. Vor wenigen Minuten waren die beiden Polizisten wiedergekommen und berichteten.
»Ey, was willst du denn?« Jens Kahler grinste noch breiter. »Wenn sich zwei Besoffskis zuziehen und sich dann gegenseitig in die Fresse hauen, kann ich da mittlerweile nur noch drüber lachen«, er zuckte mit den Schultern, »fürs Ändern sind wir nicht zuständig.«
»Trotzdem finde ich es total unangebracht, darüber Witze zu machen«, insistierte Nicole wütend.
»Bleib mal cool«, versuchte Polizeikommissar Schlüter seine junge Kollegin zu beruhigen, »wir sind doch unter uns, und wir wissen alle, dass solch ein Gerede hier drin bleibt.« Er ließ seinen Blick einmal durch den Raum schweifen.
Schon länger hatte er das Gefühl, dass die einzige Frau im Team der Voerder Polizei nicht mehr mit der Begeisterung arbeitete, die sie vor der Geburt ihrer kleinen Tochter an den Tag gelegt hatte. Er empfand sie oft als launisch, was sie früher nicht war. Schlüter konnte sich gut vorstellen, wie anstrengend die Doppelbelastung als Mutter und als Berufstätige war. Nicole machte viele Nachtschichten, damit sie und Carsten, ihr Mann, nicht so oft die Großeltern fragen mussten.
Aber Nicole wollte unbedingt arbeiten.
Sie betonte immer, dass man als Frau so oder so, dabei rollte sie stets vielsagend mit den Augen, auf das Schlimmste vorbereitet sein sollte – und das sei sie, wenn sie arbeitete.
Außerdem hatte er das Gefühl, dass Nicole dünnhäutiger geworden war. Schlüter hatte schon von anderen Revierleitern gehört, dass Polizistinnen nach der Geburt ihres ersten Kindes sensibler geworden seien. Aber, wenn er genau darüber nachdachte, stritt sie sich meistens nur mit Jens. Polizeiobermeister Kahler konnte auch nerven. Er war ein Macho durch und durch, immer einen Spruch auf den Lippen, gedrungen, muskulös, immer dicke Hose.
»Ich fahr mal ’ne Runde.« Die Polizistin hielt Kahler die geöffnete Hand hin. »Gib mir den Schlüssel.«
»Wer soll denn mit dir mitfahren?« Kahler sah zu Schlüter.
»Niemand, ich will einfach nur was gucken fahren und nicht hier dumm rumhocken und dein Gelaber anhören«, fauchte Nicole.
»Ja, dann fahr halt ein bisschen rum«, trat Schlüter zwischen die beiden Streitenden. Das hält ja niemand aus, dachte er, vielleicht liegt es ja auch am Vollmond.
Nicole Bauer schnappte sich den Schlüssel aus Kahlers Hand und ging ohne ein weiteres Wort nach draußen.
Nicole atmete tief durch, als sie in die kalte Nachtluft trat. Mein Gott, dachte sie, bin ich froh, wenn ich hier weg bin!
Wenig später hatte sie ihr Ziel erreicht.
Eigentlich war es absurd. Carsten liebte sie über alles. Er bekam von ihr, was er brauchte. Und doch war da ein klitzekleiner Verdacht. Außerdem, vielleicht hatte sie ja Glück und würde … Sie lächelte in sich hinein.
Sie parkte das Polizeiauto auf dem Parkplatz eines Hotels zwischen den Autos der Übernachtungsgäste und stieg aus. Obwohl das Wetter tagsüber durchwachsen gewesen war, jetzt war es trocken und wolkenlos. Hier auf dem Parkplatz tauchte der Mond alles in ein warmes, milchiges Licht, aber wenn sie sich zum Friedhof umdrehte, warf das Mondlicht groteske Schatten.
Sie lief ein Stück in den Risselweg hinein. Der Wald, der sich schon bald links und rechts von ihr ausbreitete, schluckte einen Teil des Lichts, aber sie konnte noch alles sehr gut erkennen. Auch die Autos, die an beiden Straßenseiten standen. Sie runzelte die Stirn. Teilweise gegen die Fahrtrichtung. Nein, sie hatte jetzt bestimmt keine Lust, da tätig zu werden. Die Polizistin wechselte zur rechten Seite.
Dann kam die Zufahrt, die zum Hundeverein mit seinem Vereinsheim führte. Komplett zugeparkt. Sie ging weiter geradeaus. Auf ihrer Armbanduhr sah sie, dass es jetzt kurz vor Mitternacht war. Dass im Inneren des Vereinsheims eine riesige Feier stattfand, konnte sie nur gedämpft hören. Ein etwa zwei Meter hoher Wall, der sich parallel zum Risselweg Richtung Hans-Richter-Straße zog, fing einen großen Teil der dröhnenden Bässe auf. Sie konnte auch nur einen Teil des Lichts sehen, das aus dem Haus kam.
Aber beim Anblick der Autos hatte sie gesehen, was sie sehen wollte. Zufrieden wechselte sie wieder die Straßenseite und ging zurück zu ihrem Dienstwagen.
Obwohl es Mitternacht war, war sie hellwach und die Gedanken in ihrem Kopf sprangen hin und her. Seit ein paar Wochen wurden ihr einige Dinge klar und klarer. Sie hatte die Mechanismen, die ihr Leben bisher bestimmten, erkannt und wusste nun genau, was sie in Zukunft wollte. Oder eben nicht wollte. Es würde ein anstrengender Prozess werden, aber irgendetwas in ihr freute sich auch darauf.
Vielleicht würde sie ja einen Teil des Weges mit ihm zusammen gehen. Das hätte sie ihm gerne heute gesagt, aber er war nicht gekommen. Und wenn ich jetzt mit mir im Reinen bin, kann ich vielleicht auch wieder Jens ertragen, dachte sie.
Auf der Geburtstagsfeier stellte jemand die Musik plötzlich aus und Nicole hörte die Partygäste, wie sie von zehn runterzählten, um dann nach der Eins laut »Happy Birthday to you« anzustimmen. Nicole schmunzelte, ja, happy Birthday auch von mir, dachte sie. Dann hörte sie, wie sich die Partygeräusche langsam mit dem Brummen eines sich ihr von hinten nähernden Wagens vermischten. Je näher der Wagen kam, umso lauter hörte sie jetzt die Musik, die daraus wummerte.
Heavy Metal. Harte, aggressive Beats.
»Ey, du Spacko!«, rief der Boss und riss ihm das Feuerzeug aus der Hand.
»Passt doch auf!« Der Fahrer hatte Mühe, den Pritschenwagen zu steuern. Neben ihm saß sein Boss, gegen die Beifahrertür gequetscht, der, den sie nur »Spacko« nannten. Der Boss und Spacko waren laut und aufgekratzt, als ob sie schon etwas geraucht hätten. Sie zankten sich um alles Mögliche, um den Tabak, um das Feuerzeug, um ein Pornoheft, das sie in der Ablage unter dem Armaturenbrett gefunden hatten.
Natürlich zog der Spacko dabei immer den Kürzeren. Der Fahrer konnte nicht sagen, ob der Spacko extra etwas ungeschickt war, wenn es zum Beispiel darum ging, nach dem Tabakpäckchen zu greifen, das der Boss ihm vor die Nase hielt und dann plötzlich wieder wegzog, oder ob Spacko den langsamen und etwas begriffsstutzigen Kollegen spielte, um es sich nicht mit dem Sohn des Chefs zu verscherzen. Letztendlich war es ihm egal, er riss hier einen Aushilfsjob ab, und dann würde er wahrscheinlich nie wieder etwas mit diesen Typen zu tun haben.
Auch zu dieser nächtlichen Aktion hatte er sich nur überreden lassen, den Chauffeur zu machen, weil der Boss ihm versprochen hatte, dass er dafür Arbeitsstunden angerechnet bekomme. Wie für jeden Chauffeurdienst, um den er ihn bat. Der Sohn des Firmenchefs hatte zurzeit nämlich keinen Führerschein, aber da er von einem Gast, der im Hotel Saathoff übernachtete, gehört hatte, dass diverse Damen nachts am Risselweg zu finden seien, wollte er unbedingt dorthin.
Die Heavy-Metal-Musik, die laut und schlecht aus den einfachen Boxen des Baustellenfahrzeugs schallte, nervte ihn genauso wie seine aufgekratzten Kollegen. Aber da der Boss sie eingelegt und den Lautstärkeregler bis zum Anschlag gedreht hatte, konnte er dagegen leider nichts machen.
»Ey«, der Fahrer verdrehte die Augen, mit diesem Wörtchen fing der Boss jeden Satz an, »da vorne!« Der Boss deutete mit dem Finger zur Straße. »Ey, guckt mal! Da läuft ’ne Kuh! Guckt mal, wie der fette Arsch wackelt! Is vielleicht schon eine der Nutten!«
Der Spacko und der Boss grölten. Dieser stieß ihn an. »Ey, schläfst du schon? Oder sind dir die Nutten nicht gut genug?«
Langsam näherten sich die drei der Fußgängerin. Ihr geflochtener, rotblonder Zopf wippte bei jedem Schritt leicht mit. Sie drehte ihren Kopf nach links, um dann aber wieder stur geradeaus zu gucken.
»Ach, du Scheiße!«, rief der Boss aus, »das ist die Polizistin, die mir meinen Lappen abgenommen hat! Warte mal«, er legte seine Hand auf seinen Arm, »fahr mal langsamer, bleib hinter der!«
Er schaltete einen Gang runter und spielte vorsichtig mit der Kupplung und dem Gaspedal. Der Spacko hatte keinen Führerschein, und der Boss hatte seinen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vorläufig verloren. So musste er immer den Pritschenwagen zu den Arbeitseinsätzen, die sie gemeinsam hatten, steuern. Es war für ihn eine große Umstellung, da er bisher nur den Kleinwagen seiner Mutter gefahren hatte.
»Das kannst du doch gar nicht richtig sehen«, sagte er, »komm, guck, was du gucken willst, und dann ist gut.«
»Nein, warte!« Der Boss lehnte sich noch weiter nach vorne. »Das ist die blöde Kuh! Das ist sie ganz bestimmt!« Aufgeregt drehte er seinen Kopf nach links und rechts zu seinen Kollegen. »Ich erkenne sie an dem dämlichen Zopf und dem fetten Hintern. Fahr mal langsam näher ran!«
Er wurde nervös. »Nee«, schüttelte der Fahrer den Kopf, das Lenkrad mit verkrampften Händen umschließend, »jetzt gib doch mal Ruhe mit der Frau. Es ist doch viel zu dunkel, das kannst du doch gar nicht richtig erkennen. Lass’ mich jetzt einfach fahren.«
»Ja, gleich.« Sein Chef wandte sich mit einem hämischen Grinsen zu ihm, »wir jagen jetzt der blöden Fotze einen richtigen Schrecken ein! Komm, gib mal ein bisschen Gas!«
»Ja«, feuerte auch Spacko ihn an und echote seinen Boss, »jag der mal einen Schrecken ein!«
Er trat die Kupplung, gleichzeitig griff sein Boss nach dem Lenkrad und zog es nach rechts, zum Straßenrand. Er versuchte, ihn mit seinem Ellenbogen wegzudrücken. Dabei rutschte sein Fuß von dem Kupplungspedal und der Wagen machte einen Satz nach vorne.
Es dauerte einen ewigen Moment, bis sie realisierten, was gerade gegen die Front des Pritschenwagens geknallt war.
Erst die Überraschung, dann der Schmerz.
Unerträglich.
Sie schmeckte Blut in ihrem Mund.
Sie versuchte, irgendwie ihre Hände zu bewegen. Sie auf das nasse, struppige Gras und Laub des Randstreifens zu drücken. Den Kopf zu heben. Nach hinten zu schauen.
Sie hörte, wie der Wagen, ein großer Wagen, wendete und wegfuhr.
Nicole konnte auch nicht unterscheiden, ob das Dröhnen in ihrem Kopf Musik oder Schmerz war.
Sie legte ihre Wange auf den kühlen Boden.
Die aggressive, wummernde Musik verklang. Er konnte jetzt noch vage die Partymusik aus dem Gebäude hinter dem Wall hören und das gedämpfte Rauschen der B 8.
Langsam kam er wieder im Hier und Jetzt an und realisierte, was er beobachtet hatte. Trotz der fahlen Dunkelheit konnte er sie auf dem Boden liegen sehen. Er sah, dass sie lebte. Gott sei Dank!
Gerade, als er sich aus seiner Erstarrung lösen und zu ihr gehen wollte, sah er jemanden auf Nicole zugehen.
Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sie Schritte hörte. Ganz vorsichtig wendete sie ihren Kopf und blickte nach oben.
»Du!« Erleichterung rieselte ihr durch den Körper. »Gott sei Dank!«
3. Kapitel
Dienstag, 29. Mai 2018, nachts
Mein Gott, das ist ja furchtbar!«, flüsterte Christin und strich eine der verfilzten Strähnen aus dem Gesicht der schlafenden Laura. Sie hatten die junge Frau auf das Sofa im Wohnzimmer gebettet. Die Pfarrerin hatte den beiden Polizisten einen Kaffee angeboten, den diese dankbar angenommen hatten. »Und man hat nie herausgefunden, wer eure Kollegin angefahren hat?«
Schlüter schüttelte den Kopf. »Nein. Die Fakten waren eindeutig. Ein großes Auto, ein Jeep oder Transporter. Aber obwohl in dieser Nacht im Risselweg eine Party stattfand, gab es keine Zeugen. Es war kalt, damals hat noch jeder im Raum geraucht, gegen zwölf wurde dem Gastgeber ein Ständchen gesungen.«
»Natürlich haben wir alle Werkstätten kontaktiert«, ergänzte Freddie, »auch über die Presse, ob irgendwo ein Wagen mit einem Frontschaden abgegeben wurde, aber nix.«
»Du kannst dir nicht vorstellen, was wir und viele Kollegen von anderen Revieren alles unternommen hatten«, ergänzte Schlüter, »wochennein, monatelang immer wieder alles durchgegangen, rekonstruiert, angehalten, kontrolliert, bis wir einsehen mussten, dass wir tatsächlich niemanden zur Verantwortung ziehen konnten.«
»Warum ist sie da überhaupt alleine hingefahren?«, hakte Christin nach, »darf man als Polizistin oder Polizist überhaupt alleine Streife fahren?«
»Ja, das dürfen wir«, antwortete Schlüter, »es war ja auch keine gefährliche Situation oder ein Einsatz.«
»Ich verstehe aber immer noch nicht, was sie da genau wollte?« Christin betrachtete Laura und wischte ihr dann wieder vorsichtig mit einem feuchten Waschlappen einen Speichelfaden, der aus ihrem Mund lief, vom Kinn.
»Hm, wir glauben, dass sie tatsächlich auf der Party kurz ›Hallo‹ sagen wollte. Ein Bekannter von ihr und ihrem Mann hatte in dieser Nacht dort seinen dreißigsten Geburtstag gefeiert. Und dann hat sie dieses verdammte Auto erwischt«, Schlüter rieb sich mit der rechten Hand über sein Kinn. Christin konnte spüren, wie ihm die Geschehnisse dieser Nacht noch immer sehr nahe gingen. Schlüter war damals schon der Dienstälteste gewesen, Nicole eine junge Polizistin, frisch gebackene Mutter und sein Schützling.
Dann auf einmal tot.
»Ich hatte damals das Gefühl gehabt, als ob es im Grunde vor meinen Augen passiert war«, stieß Schlüter aus.
»Und Laura ist ihre Tochter«, murmelte die Pfarrerin.
»Ja«, nickte Freddie zur Bestätigung, »und uns leider schon bekannt. Bringt sich selber ständig in Schwierigkeiten.«
Christin musste gähnen und schaffte es nur knapp, rechtzeitig eine Hand vor den Mund zu halten.
»Na, wir gehen dann mal«, sagte Schlüter.
»Können wir dich jetzt mit Laura alleine lassen?«, fragte Freddie.
»Wenn ihr mir nicht verschweigt, dass dieses reizende Geschöpf eigentlich eine massenmordende Psychopathin ist, werd ich schon mit ihr fertig«, lächelte die Pfarrerin, sich wieder ein Gähnen verkneifend.
»Danke, Christin, und jetzt schlaf noch schön!«, verabschiedete sich Schlüter.
Mittwoch, 30. Mai 2018, morgens
Ein merkwürdiges Geklapper weckte Christin Erlenbeck. Einen Moment gab sie sich noch, um richtig wach zu werden und herauszufinden, was das für Geräusche waren. Dann wurden ihr einige Tatsachen schlagartig klar.
Es war Mittwoch, ihre Kinder mussten zur Schule, sie hatte eventuell den Wecker nicht gehört, sie hatte einen sturzbetrunkenen Gast in ihr Haus aufgenommen, sie musste arbeiten – und irgendjemand hantierte in ihrer Küche herum. Zum Glück war es erst Viertel vor sieben.
Langsam stand sie auf, schlich zur Treppe, die in das Erdgeschoss führte, und weiter einige Stufen hinab. Die Sonne schien schon durch alle Fenster herein, es würde wieder ein warmer Tag werden. Kaffeeduft stieg ihr in die Nase.
»Aber warum tust du dann immer so unvernünftige Sachen«, hörte sie ihre Tochter sagen, »damit gibst du ihnen doch nur recht.«
Christin schien es so, als ob sie einiges verpasst hätte. Verwundert lauschte sie dem Gespräch in der Küche.
»Ich weiß es auch nicht.«
Sie stellte fest, dass die zarte, junge Frau eine sehr tiefe und raue Stimme hatte.
»Ein Therapeut hat mir mal erklärt, dass ich so nur Aufmerksamkeit bekommen möchte. Aber auch wenn ich das jetzt weiß, betrinke ich mich trotzdem immer regelmäßig.«
»Aber der Therapeut muss dir doch …«, Mathilda sah zu ihrer Mutter auf, die die Küche betreten hatte. »Morgen Mama, das ist Laura.«
Christin kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dass ihre Tochter mit einer fremden Frau Gespräche über Alkoholkonsum führte, erstaunte sie nicht so sehr wie die Tatsache, dass Mathilda, die sich morgens vor der Schule immer weigerte, etwas zu essen, an einem schön gedeckten Frühstückstisch saß und Müsli mit Joghurt und Obst aß. Laura drückte gerade die fertig gepackten Brotdosen zu und griff dann zur Kaffeekanne, um ihrer Gastgeberin Kaffee einzugießen.
»Guten Morgen«, sagte Laura und stellte die Kanne wieder auf die Wärmeplatte der Kaffeemaschine. Sie setzte sich dann auch an den Küchentisch. »Ich hoffe, der Kaffee schmeckt Ihnen. Matti sagte, Sie mögen ihn nicht so stark. Oh, übrigens«, sie deutete zu den Brotboxen, »die Fleischwurst ist jetzt alle.«
Ursula Höfer schaute ihre Chefin schon erwartungsvoll an, als diese um halb neun ins Pfarrbüro kam.
»Wie geht es Laura?«, fragte sie nach einem schnellen Guten-Morgen-Gruß. »Schläft sie noch?«
Pfarrerin Christin Erlenbeck verschränkte die Arme vor der Brust.
»Sorry, aber langsam komme ich nicht mehr mit!«, schimpfte sie. »Ich habe im Moment wirklich andere Dinge im Kopf! Ich werde mitten in der Nacht wegen einer Betrunkenen geweckt. Meine dreizehnjährige Tochter verrät meine mütterlichen Bemühungen um eine gesunde Ernährung und führt mit einer völlig fremden Person ein Gespräch über Alkoholtherapien. Dann schafft es diese Laura auch noch, schon um Viertel vor sieben perfekte Lunchboxen für meine Kinder fertig zu haben und mir nebenbei einen göttlichen Kaffee einzuschütten. Und nun interessiert sich auch meine Sekretärin nur für diese geheimnisvolle Fremde!«
»Sie ist meine Großcousine.«
Christin brauchte eine Sekunde, um diese Aussage zu begreifen.
»Genau genommen«, fuhr Ursula fort, »meine Nichte zweiten Grades. Die Tochter meiner verstorbenen Cousine.«
Sonntag, 20. Oktober 1985
Ich habe mich das erste Mal bumsen lassen!
So, meine liebe Cousine Uschi, hättest du mir auch so ein dämliches Tagebuch geschenkt, wenn du gewusst hättest, dass ich so böse Wörter da reinschreibe?
Uschi Uschi Uschi
Du hasst es, wenn ich dich so nenne, denn dann fangen alle an zu grinsen.
Uschi Muschi
Ich bin 16 geworden, du bist 18, aber hast bestimmt mit deinem Jürgen bisher nur Händchen gehalten.
Aber bei mir ist nix mehr mit Like a Virgin!!!!
Aber jetzt der Reihe nach. Schließlich ist das ein wichtiger Moment in meinem Leben, und du wolltest doch, dass ich wichtige Momente aufschreibe.
Vor genau einer Woche bin ich 16 geworden. Das muss ich meinen Eltern lassen, die Party war spitzenmäßig. Die haben wirklich nicht genervt, kamen natürlich um Mitternacht runter und haben mich umarmt und so, das war okay. Sind dann wieder hoch, Mama hat Papa am Arm mitgezerrt, habe kurz gedacht, der schickt jetzt alle nach Hause. War auch echt blöd von mir, den Bacardi nicht zu verstecken.